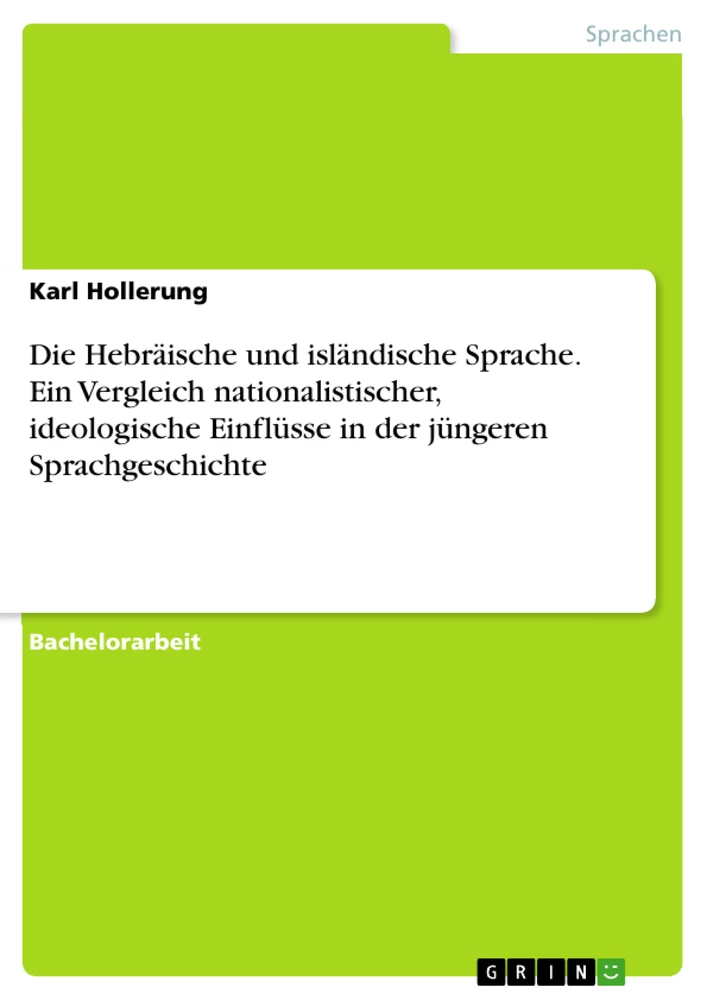Im Rahmen dieser Arbeit wird die Wiederbelebung des Hebräischen, ein sicherlich einmaliger Vorgang und somit ein Extrembeispiel, mit der isländischen "Sprachreinigung" – auf Isländisch „Málhreinsun“ genannt, verglichen. Im Rahmen der Málhreinsun wurde hauptsächlich im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert der weitgehend erfolgreiche Versuch unternommen, zu verhindern, dass das Isländische eine ähnliche Entwicklung durchmachte wie die meisten anderen skandinavischen Sprachen, in deren Wortschatz Fremdwörter eine große Rolle spielen und welche vom ursprünglichen komplexen Flexionssystem des Altnordischen kaum etwas bewahrt haben – ganz im Gegensatz zum Isländischen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über die Geschichte des Hebräischen bis zu ihrer Wiederbelebung als gesprochener Sprache in Palästina
- Über die Umstände der Wiederbelebung des Hebräischen
- ,,Vom lebendigen Spiele der kommende Generation“
- ,,Wie sollen wir sprechen“ und „Wie sollen wir sprechen und schreiben?”
- ,,Das Technion und das Hebräische“
- Über die Geschichte der isländischen Sprache bis zur Zeit der Málhreinsun
- Über die Umstände der Málhreinsun
- Die Paragraphen fünf bis sieben der Satzung des „Hið íslenzka Lærdómslistafélag“
- Eine Erinnerung von Páll Melsteð über seinen Lehrer Hallgrímur Scheving
- Der ,,Fjölnir-Mann“ Tómas Sæmundsson über die Bedeutung der Sprache für die isländische Nation
- Fazit und Ausblick auf die heutige Situation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die Wiederbelebung des Hebräischen und die isländische „Málhreinsun“ zu vergleichen und die Rolle nationalistischer Ideologien in diesen Sprachentwicklungsprozessen zu untersuchen. Der Fokus liegt auf dem Vergleich gezielter, ideologisch motivierter Eingriffe in die Sprachentwicklung und deren Auswirkungen auf die Grammatik der heutigen Sprachen.
- Vergleich der Wiederbelebung des Hebräischen und der isländischen Málhreinsun
- Rolle nationalistischer Ideologien in der Sprachplanung
- Auswirkungen sprachplanerischer Eingriffe auf die Grammatik
- Analyse zeitgenössischer Quellen zur Sprachplanung
- Die Bedeutung von Sprache für die nationale Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung erläutert die Komplexität der Erforschung bewusster sprachlicher Veränderungen und die Schwierigkeiten, natürliche von künstlichen Entwicklungen zu unterscheiden. Sie begründet den gewählten Vergleichsansatz zwischen der Wiederbelebung des Hebräischen und der isländischen Málhreinsun als zwei Extrembeispiele gezielter Sprachplanung, die durch nationalistische Ideologien beeinflusst wurden. Die Arbeit skizziert die Methode des Vergleichs, die auf der Analyse der Sprachgeschichte, der Umstände der Sprachplanung und der Auswertung zeitgenössischer Quellen basiert.
Über die Geschichte des Hebräischen bis zu ihrer Wiederbelebung als gesprochener Sprache in Palästina: Dieses Kapitel beleuchtet die lange Geschichte des Hebräischen als Sprache des jüdischen Volkes, von seiner Verwendung in der Bibel bis zu seiner Funktion als religiöse Schriftsprache nach dem Verlust seiner Rolle als Muttersprache. Es beschreibt die Verwendung verschiedener jüdischer Dialekte im Alltag und die Rolle des Hebräischen als verbindende Schriftsprache und Liturgiesprache innerhalb der jüdischen Gemeinden, trotz der Dominanz anderer Sprachen in den jeweiligen Ländern. Die Kapitel beschreibt auch den Prozess der Sprachvereinheitlichung in anderen Ländern und hebt die Sonderstellung des Hebräischen als identitätsstiftendes Element für ein Volk ohne Staat hervor.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Vergleich der Wiederbelebung des Hebräischen und der isländischen Málhreinsun
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text vergleicht die Wiederbelebung des Hebräischen als gesprochene Sprache in Palästina mit der isländischen "Málhreinsun" (Sprachreinigung). Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Rolle nationalistischer Ideologien in diesen Sprachentwicklungsprozessen und die Auswirkungen gezielter Eingriffe auf die Grammatik der heutigen Sprachen.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Geschichte des Hebräischen und Isländischen, die Umstände ihrer jeweiligen Sprachentwicklungen (Wiederbelebung bzw. Málhreinsun), die Rolle nationalistischer Ideologien in der Sprachplanung, die Auswirkungen sprachplanerischer Eingriffe auf die Grammatik beider Sprachen und die Bedeutung von Sprache für die nationale Identität. Analysiert werden zeitgenössische Quellen zur Sprachplanung beider Fälle.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitung, Geschichte des Hebräischen bis zur Wiederbelebung, Umstände der Wiederbelebung des Hebräischen, verschiedene Kapitel über Schlüsselfiguren und -ereignisse der Wiederbelebung des Hebräischen, Geschichte der isländischen Sprache bis zur Málhreinsun, Umstände der Málhreinsun, relevante Auszüge aus der Satzung des „Hið íslenzka Lærdómslistafélag“, eine Erinnerung an einen isländischen Lehrer, die Bedeutung der Sprache für die isländische Nation durch Tómas Sæmundsson und schließlich ein Fazit und Ausblick.
Welche Methode wird im Text angewendet?
Der Text basiert auf einem vergleichenden Ansatz. Er analysiert die Sprachgeschichte, die Umstände der Sprachplanung (Wiederbelebung des Hebräischen und isländische Málhreinsun) und wertet zeitgenössische Quellen aus, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Prozesse aufzuzeigen und die Rolle nationalistischer Ideologien zu untersuchen.
Was ist das Ziel des Textes?
Das Ziel des Textes ist es, die Wiederbelebung des Hebräischen und die isländische Málhreinsun als zwei Extrembeispiele gezielter Sprachplanung zu vergleichen, die durch nationalistische Ideologien beeinflusst wurden. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Eingriffe in die Sprachentwicklung und deren Auswirkungen auf die Grammatik.
Welche Quellen werden im Text verwendet?
Der Text bezieht sich auf zeitgenössische Quellen zur Sprachplanung im Kontext der Wiederbelebung des Hebräischen und der isländischen Málhreinsun. Konkrete Quellenangaben sind im Text selbst nicht explizit aufgeführt, aber die Zusammenfassung der Kapitel deutet auf die Verwendung von historischen Dokumenten und persönlichen Erinnerungen hin.
- Arbeit zitieren
- Karl Hollerung (Autor:in), 2016, Die Hebräische und isländische Sprache. Ein Vergleich nationalistischer, ideologische Einflüsse in der jüngeren Sprachgeschichte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1059946