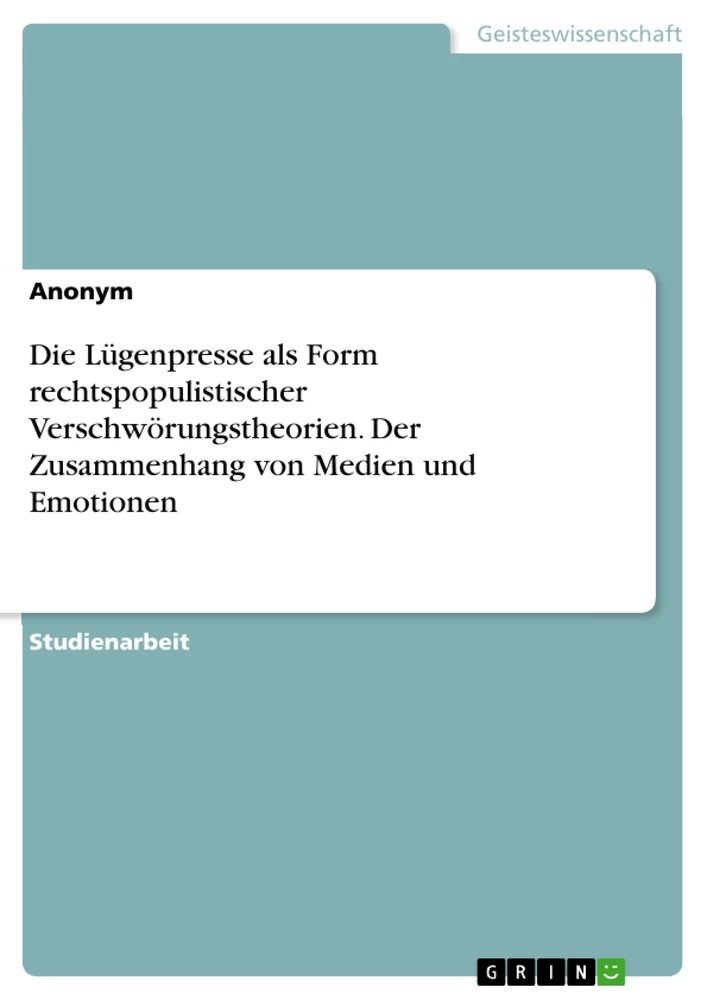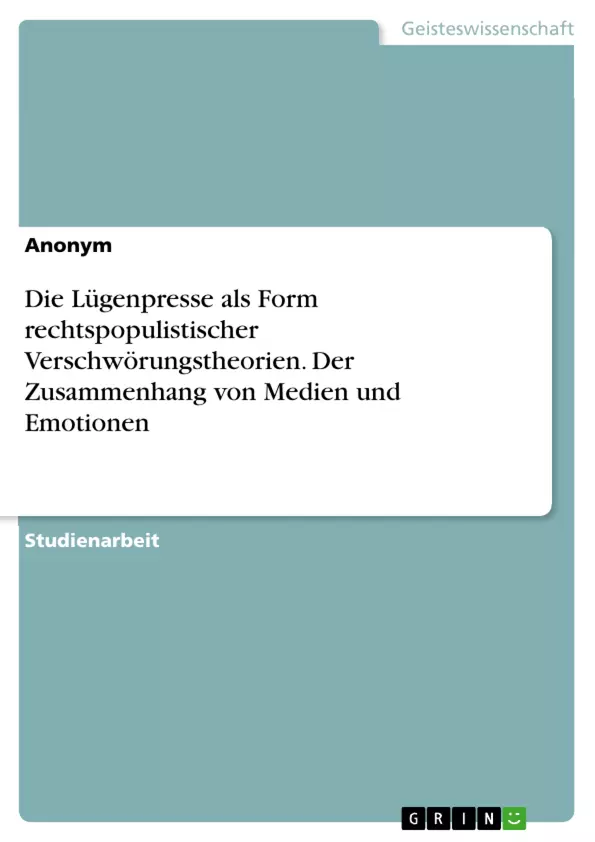Diese Arbeit beschäftigt sich mit Emotionen und Medien als Gegenstand von Verschwörungstheorien am Beispiel der Lügenpresse.
In den etablierten Demokratien sind wesentliche Krisenmerkmale zu verzeichnen, wie unteranderem die Flüchtlingsdebatte seit 2015. Folglich kam es zu einem ein Rückgang der politischen Beteiligung und einem Vertrauensverlust in die politischen VertreterInnen und die Medien. Demonstrationen und Versammlungen gegen zum Beispiel Flüchtlinge, aber auch gegen Medien sind keine Seltenheit mehr.
Verschwörungstheorien liefern in diesen Momenten eine Lösung auf der Suche nach Erklärungen. Sie verkürzen und vereinfachen dabei komplexe Sachverhalte, wobei Genauigkeit und Korrektheit verloren geht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffserklärung, Merkmale und Funktionen von Verschwörungstheorien
- Das Glaubwürdigkeitsproblem der Medien
- Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien
- Ein Gespenst geht umher: Das Gespenst heißt „Lügenpresse“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Emotionen und Medien im Kontext von rechtspopulistischen Verschwörungstheorien. Die Untersuchung konzentriert sich auf das Beispiel der „Lügenpresse“, um die Funktionsweise und Verbreitung solcher Theorien aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf den Merkmalen von Verschwörungstheorien, dem Glaubwürdigkeitsproblem der Medien im Zeitalter der digitalen Revolution, und der Verbindung zwischen Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien.
- Merkmale und Funktionen von Verschwörungstheorien
- Das Glaubwürdigkeitsproblem der Medien in der digitalen Welt
- Der Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien
- Die Rolle von Emotionen in der Verbreitung von Verschwörungstheorien
- Der Einfluss von Fake News auf die Verschwörungstheorie der „Lügenpresse“
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der Verschwörungstheorie der „Lügenpresse“ ein und stellt den Kontext der Arbeit dar. Sie zeigt die Relevanz des Themas im Kontext aktueller politischer und gesellschaftlicher Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf den Vertrauensverlust in Medien und Politik.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die Merkmale und Funktionen von Verschwörungstheorien. Es erklärt den Begriff, geht auf die historischen Wurzeln und die gängigen Motivlagen für den Glauben an Verschwörungstheorien ein. Zudem wird der Einfluss von Medien und Krisen auf die Verbreitung von Verschwörungstheorien thematisiert.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Glaubwürdigkeitsproblem der Medien. Es analysiert die Herausforderungen, die sich durch die digitale Revolution für die Medien ergeben haben, und geht auf den Einfluss von Fake News und Desinformation ein. Zudem wird der Zusammenhang zwischen der medialen Revolution und dem Aufstieg von Verschwörungstheorien erläutert.
- Das vierte Kapitel beleuchtet den Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus und Verschwörungstheorien. Es zeigt auf, wie rechtspopulistische Akteure Verschwörungstheorien nutzen, um politische Ziele zu erreichen, und wie die „Lügenpresse“-Narrative in diesen Kontext eingebettet sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themenfeldern, die im Kontext der Verschwörungstheorie der „Lügenpresse“ relevant sind. Hierzu zählen u.a. Verschwörungstheorien, Rechtspopulismus, Medien, Glaubwürdigkeit, Fake News, digitale Revolution, Emotionen, und gesellschaftliche Krisen. Die Arbeit analysiert die Interaktion dieser Themenfelder und versucht, die Ursachen und Folgen der Verbreitung von Verschwörungstheorien aufzudecken.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Die Lügenpresse als Form rechtspopulistischer Verschwörungstheorien. Der Zusammenhang von Medien und Emotionen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1061064