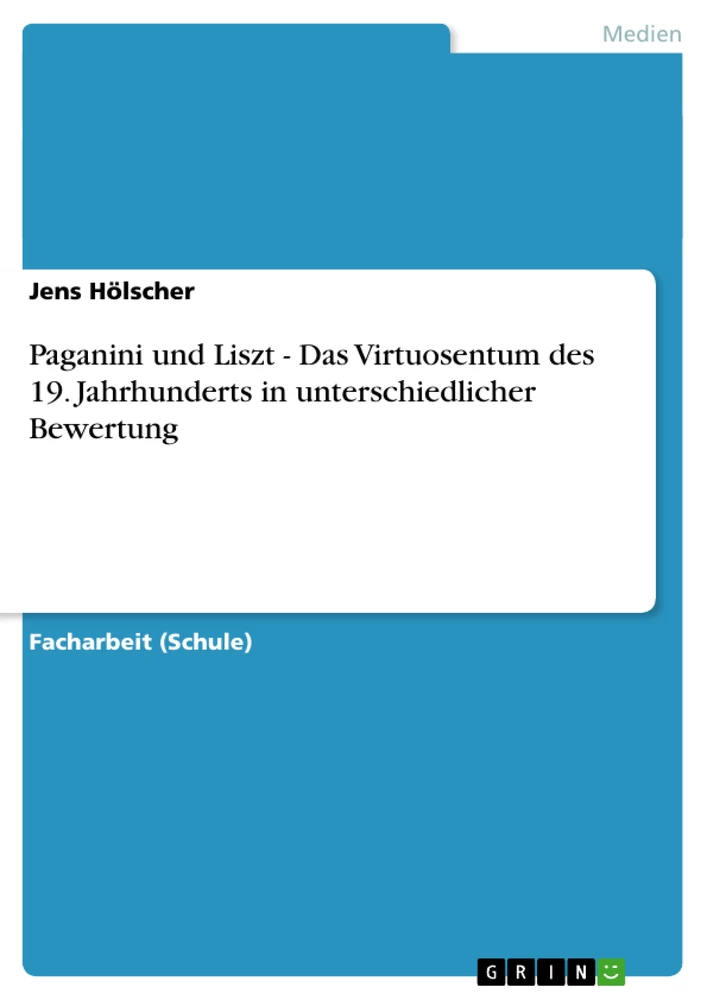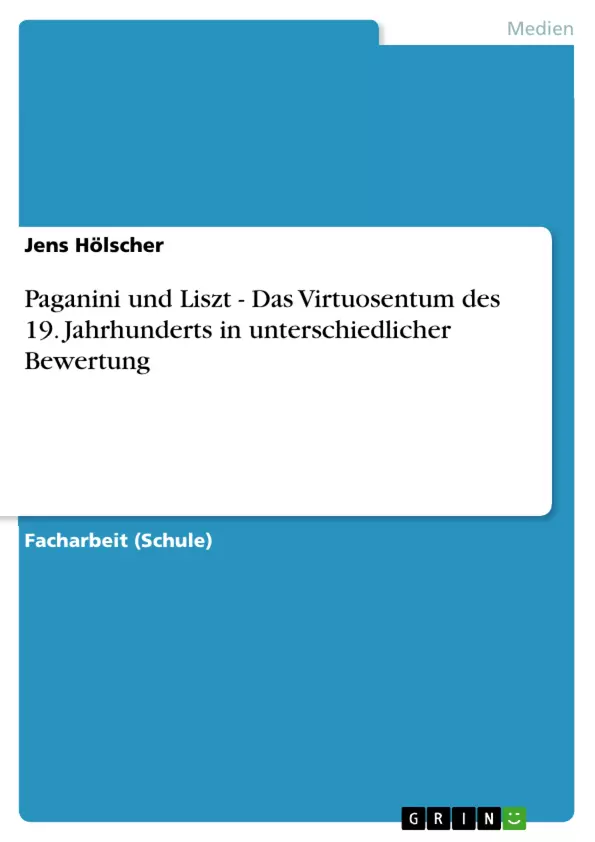Was bedeutet es, ein Virtuose zu sein? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Epoche der Musikgeschichte, in der Künstler wie Niccolò Paganini und Franz Liszt die Grenzen des technisch Machbaren sprengten und das Publikum in Ekstase versetzten. Diese packende Analyse des Virtuosentums im 19. Jahrhundert enthüllt die komplexen Bedingungen, die diese einzigartige Kunstform hervorbrachten. Von den bahnbrechenden Entwicklungen im Instrumentenbau bis hin zum aufkommenden Sturm und Drang in der Musik, werden die entscheidenden Einflüsse beleuchtet, die Paganini und Liszt zu Ikonen ihrer Zeit machten. Entdecken Sie, wie Paganinis dämonische Geigenkunst und Liszts eruptive Klaviertechnik das Publikum in ihren Bann zogen und eine regelrechte Virtuosenmanie auslösten. Doch war diese Zurschaustellung technischer Brillanz wirklich Ausdruck höchster Kunst, oder verkam sie zur reinen Effekthascherei? Erforschen Sie die kontroversen Debatten und Kritiken, die das Virtuosentum umgaben, von Schumanns Ablehnung des "Virtuosengeklimpers" bis hin zu Wagners Kritik an der Ablenkung vom eigentlichen Kunstwerk. Anhand detaillierter Analysen von Paganinis Caprice Opus 1 Nr. XXIV und Liszts Paganini-Etüde Nr. VI werden die virtuosen Elemente in den Werken der beiden Meister offengelegt. Erleben Sie, wie Staccato, Doppelgriffe, Terzenläufe und atemberaubende Akkordfolgen die Interpreten an ihre Grenzen bringen und das Publikum in Staunen versetzen. Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Reise durch die ambivalente Welt des Virtuosentums, zwischen Bewunderung und Kritik, zwischen technischer Perfektion und künstlerischem Ausdruck. Diese Untersuchung des Virtuosentums bietet nicht nur eine profunde Analyse der Musik des 19. Jahrhunderts, sondern regt auch dazu an, über die Rolle des Interpreten, die Bedeutung von Technik und die Definition von wahrer Kunst nachzudenken. Ein Muss für Musikliebhaber, Historiker und alle, die sich von der Virtuosität und dem außergewöhnlichen Können großer Künstler faszinieren lassen. Diese kritische Auseinandersetzung lädt dazu ein, die glanzvolle Fassade des Virtuosentums zu hinterfragen und einen tieferen Einblick in die musikalischen und kulturellen Strömungen des 19. Jahrhunderts zu gewinnen, um so die bleibende Bedeutung dieser Epoche für die heutige Musikwelt neu zu bewerten.
1. Einleitung
Wenn heutzutage Musik aufgeführt wird, dann gilt die Aufmerksamkeit der Zuhörer weitestgehend demjenigen, der sie wiedergibt, bzw. dessen Leistung. Dass die Leistung des Komponisten, also das gespielte Werk, dabei in den Hintergrund rückt, ist ein Effekt des Virtuosentums, das seinen Höhepunkt im 19. Jahrhundert in Paganini und Liszt hatte. Man erwartet „von allen konzertierenden Solisten, daßsie die Virtuosität dieser Vorbilder erreichen“(Buchner 1986, S. 162) und belegt Musiker, die Spezialisten und Meister ihres Instruments sind, gerne mit dem Titel „Virtuose“. Daher liegt es nahe, eine Untersuchung über das Virtuosentum zunächst mit einer Definition des Terminus „Virtuose“ zu beginnen. Um die Virtuosität Paganinis und Liszts näher betrachten zu können, ist es ebenso sinnvoll, die Bedingungen zu berücksichtigen, unter denen das Virtuosentum entstehen konnte, und nachfolgend auf die Situation im 19. Jahrhundert einzugehen. Schwerpunkt der Arbeit soll neben der Analyse jeweils eines Werkes von Paganini und Liszt im Hinblick auf die darin enthaltenen virtuosen Elemente die zum Teil weit auseinandergehende Bewertung des Virtuosentums aus zeitgenössischer wie auch historisch distanzierter Sicht sein. Ziel ist es schließlich, mit den zu Anfang erworbenen Kenntnissen und aufbauend auf die Kritiken anderer zu einer persönlichen Einschätzung und Beurteilung des Virtuosentums zu gelangen.
2. Was ist ein Virtuose?
Der Begriff „Virtuose“ stammt ursprünglich von dem lateinischen Wort „virtus“ ab, dessen Grundbedeutung „Mannhaftigkeit“ ist. Weitere Übersetzungsmöglichkeiten sind unter anderem „Tüchtigkeit“, „gute Eigenschaft“, „Tugendhaftigkeit“ und „Verdienst“, im Plural auch „Vorzüge“ oder „Heldentaten“(Stowasser 1991, S. 501). Mit „virtuoso“ bezeichnete man im 16./17. Jahrhundert in Italien zunächst alle „Personen, die sich durch Wissen, Fertigkeiten oder Lebensführung hervortaten“(Bozzetti 1991, S. 173). Als der Terminus im 18. Jahrhundert auch in Deutschland verwendet wurde, war er ausschließlich Bezeichnung für einen bedeutenden Musiker; ab etwa 1740 verengte sich der Begriff noch weiter auf einen „besonders qualifizierten ausübenden Musiker“, wobei meistens der Solist in einem Konzert gemeint war (Kwiatkowski 1989, S. 426). Gegen Ende des 18. Jahrhunderts tauchte zum ersten Mal eine negative Bedeutung auf. So war und ist der Virtuose nicht nur „der ideale nachschaffende Musiker, der, technisch und geistig souverän, Gehalt und Gestalt des Werks vollkommen und lebendig interpretiert“, sondern auch derjenige Musiker, der seine technische Kunstfertigkeit bewusst zur Schau stellt und damit das von ihm gespielte Werk in seiner „ästhetischen Qualität“ vernachlässigt (Kwiatkowski 1989, S. 426).
3. Die technischen und kompositorischen Entstehungsbedingungen des Virtuosentums
Die Wurzeln der Geigenvirtuosität sind bereits im 17. Jahrhundert zu suchen. Die vielfältigen spieltechnischen Möglichkeiten der Violine, durch die Weiterentwicklung des Streichinstrumentenbaus erst seit etwa 1560 hergestellt und doch in ihrer Konstruktion im 17. Jahrhundert schon beinahe auf dem heutigen Stand, waren eine der Grundlagen des Violinvirtuosentums. Eine weitere wichtige Voraussetzung lag darin, dass die Spielfigur, die das wesentliche Element der Virtuosität darstellt, in der Kompositionslehre eine immer größere Rolle erhielt. Die Monodie, Ende des 16. Jahrhunderts in Italien als eine Art „Wiederbelebung antiken Gesangs“ entstanden, die den „Sinn- und Affektgehalt der Sprache“ musikalisch nachzuahmen versuchte, diente letztendlich als Vorlage für die Geigenvirtuosität; der „erregt deklamatorische[r] Sprechgesang“ der monodischen Musik, der Virtuosität geradezu „erzwang“, wurde auf die Violine übertragen (Kwiatkowski 1989, S. 223). Die Klaviervirtuosität fand ihre anfänglichen Voraussetzungen - weitaus später als die Virtuosität auf der Violine - in der Zeit des Sturm und Drang des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Neben der Tatsache, dass die neue „englische Mechanik“ einen kräftigeren Anschlag der Klaviatur ermöglichte, wurde der ausdrucksvolle und gefühlsbetonte Stil des Sturm und Drang zur Grundlage und zum tragenden Merkmal, da er den idealen „Widerpart zum Passagen- und Figurenwerk“ bildete (Dahlhaus 1980, S. 111). Er äußerte sich unter anderem in „raumgreifender Melodik, kühner Harmonik (...), starken Gegensätzen der Dynamik und Instrumentation und teilweise freien Formverläufen“(Kwiatkowski 1989, S. 375).
4. Die Situation Paganinis und Liszts
Der Italiener Niccolo Paganini (1782-1840) begann Anfang der Dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts, mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten auf der Geige das Publikum zu begeistern. Er war imstande, seine zahlreichen Werke von höchstem Schwierigkeitsgrad, in denen er eine vollkommene Violintechnik entwickelte, so effektvoll und beeindruckend vorzutragen, dass er von einigen Zeitgenossen als „Teufelsgeiger“ bezeichnet wurde; und dies war nicht etwa im übertragenen Sinne gemeint. Dabei war Paganini auf der Bühne nichts weiter als eine „lange, hagere Gestalt in altmodischem, schwarzem Frack . . . und mit vorgestrecktem eingeknickten rechten Bein, nichts als Geist und Knochen in schlottrigen Kleidern“(Dahlhaus 1980, S. 114). Doch durch genau dieses Auftreten und sein Spiel vermochte er seine Zuschauer in seinen Bann zu ziehen, und es herrschte beinahe „eine religiöse Stille im ganzen Saal. Jedes Auge war nach der Bühne gerichtet“(Bozzetti 1991, S. 174). So begeisterte er auch Franz Liszt (1811-1886) aus Ungarn. Dieser hörte Paganini 1831 in Paris und „geriet (...) in einen Zustand von Besessenheit und Drang zur Nacheiferung“(Dahlhaus 1980, S. 111). Von da an setze er sich zum Ziel, eine vergleichbare Technik auf dem Klavier zu entwickeln, durch die er endlich „die musikalischen Gedanken eruptiven Charakters, die sich ihm aufdrängten“(Dahlhaus 1980, S. 111), in eine Form bringen konnte, und konzertierte bereits wenige Jahre später vor Publikum mit virtuosen Werken. Liszts Erfolg blieb nicht aus, nicht nur, weil er ein hervorragender Pianist war, sondern auch, da er wie Paganini eine für die Zuschauer „genieartige“ Erscheinung zu sein schien: Mager, engschultrig und schlank, und wenn er sich an das Klavier setzte, „so streicht er die Haare hinter’s Ohr, der Blick wird starr, das Auge hohl, der Oberleib ruhiger, nur der Kopf und Gesichtsausdruck bewegen und spiegeln sich nach der jedesmaligen Stimmung, die ihn angreift, oder die er hervorzurufen Willens ist, was ihm auch immer gelingt“(Schneider 1984, S. 153). Außerdem warf er immer wieder Blicke in das Publikum, so dass es am Ende eines Konzerts „entzückt“ und „hingerissen“ sein musste (Schneider 1984, S. 152).
Die Begeisterung, die sowohl Paganini als auch Liszt erfuhren, ist in etwa mit dem Massenwahn um heutige Popstars vergleichbar. Während in unserer Zeit Madonna und Robbie Williams verehrt werden, herrschte zu der damaligen Zeit eine allgemeine Virtuosenmode, und es ist offenkundig, dass bei einem solchen Enthusiasmus für die Person des Künstlers das gespielte Werk, ja sogar zuweilen selbst die musikalische Leistung nicht mehr allein das Ausschlaggebende für einen Zuhörer sein konnte, um an einem Konzert Gefallen zu finden. Denn so wollte „ein großes und folglich gemischtes Publikum durch etwas Außerordentliches überrascht werden (...), und das sicherste, ja einzige Mittel dazu ist: - vollendete Bravour mit gutem Geschmack vereinigt“(Bozzetti 1991, S. 173).
5. Die Elemente der Virtuosität in Werken Paganinis und Liszts
Anhand der Caprice Opus 1 Nr. XXIV von Paganini und der Paganini-Etüde Nr. VI von Liszt, die eine Bearbeitung ebendieser Caprice für Klavier ist, soll nun herausgestellt werden, wie sich die Virtuosität tatsächlich in der Komposition von Musik bemerkbar macht.
5.1 Beschreibung des Themas
Paganinis Werk beinhaltet 11 Variationen zu einem Thema in a-Moll. Dieses steht im 2/4- Takt und ist „Quasi Presto“ - also relativ schnell - und „piano“, leise, zu spielen. Eine Gliederung lässt sich hier in eine viertaktige und eine achttaktige Periode vornehmen. Der viertaktigen Periode liegt das Schema Tonika (a-Moll) - (Dur-)Dominante (E-Dur) - Tonika - Dominante zugrunde. In der achttaktigen Periode folgt sequenzartig auf die Dominant- Septime auf der 1. Stufe (A7) die Subdominante (d-Moll), auf die Dominant-Septime auf der 7. Stufe oder auch Dominantparallele (G7) die Tonikaparallele (C-Dur); dann geht es über die verkürzte Dur-Dominant-Septime zurück zur Tonika, bevor das Thema nach der Dominant- Septime auf der 6. Stufe (F7) und der Dominant-Septime (E7) mit der Tonika endet.
Dabei zieht sich ein Motiv durch das gesamte, unter doppelter Berechnung der ersten vier Takte, die wiederholt werden, 16 Takte lange Thema: Einer Achtel folgt nach einer Sechzehntelpause eine angehängte, kurze Sechzehntel, nach welcher sich auf der zweiten Zählzeit des jeweiligen Taktes vier gebundene Sechzehntel anschließen, die zur ersten Zählzeit des jeweils folgenden Taktes hinführen. Dieses tänzerisch wirkende Motiv wird jeweils im vorletzten Takt einer Periode, d.h. in den Takten 3 und 11, leicht abgeändert, so dass auf der zweiten Zählzeit nicht mehr vier, sondern nur drei Sechzehntel gebunden werden, das vierte Sechzehntel aber abgesetzt und kurz gespielt wird. Den Abschluss einer Periode markiert in den Takten 4 bzw. 12 je eine Viertel, der eine eine Oktave tiefer gelegene Achtel angebunden ist.
Im Unterschied zu Paganini wiederholt Liszt nicht nur die ersten vier Takte des Themas, sondern auch den zweiten Teil. In seiner Etüde sind dadurch, dass das Klavier deutlich mehr technische Möglichkeiten bietet als die Violine, bereits im Thema Veränderungen zu erkennen. So beginnt er die erste Zählzeit eines Taktes fast durchweg mit großrahmigen Arpeggio-Akkorden und schließt in der rechten Hand nicht eine Sechzehntel-, sondern eine punktierte Sechzehntelpause an, was eine Zweiunddreißigstel als Auftakt zur zweiten Zählzeit nach sich zieht. Bei der Wiederholung der Takte 5-12 bei Paganini setzt der Komponist außerdem vermehrt die linke Hand ein, die vorher beinahe ausschließlich für das Arpeggio gebraucht wurde.
5.2 Paganinis Variationen über das Thema
Aus dem technisch recht einfachen und musikalisch schlichten Thema entwickelt Paganini in den Variationen teilweise enorme technische Schwierigkeiten, die dem Spieler sehr viel abverlangen, sowie eine differenzierte dekorative Motivik. So ist in der ersten Variation schnelles Staccato mit zahlreichen Saitenübergängen gefragt, wobei das Spiel durch Vorschläge zusätzlich erschwert wird. Der Tonumfang wird im Vergleich zum Thema durch gebrochene Akkorde über zumeist zwei Oktaven deutlich erhöht. In Variation 3 tauchen zum ersten Mal Doppelgriffe auf. Hier muss der Violinist es die gesamte Variation über mit Oktaven aufnehmen und dabei auf den beiden tiefen Saiten zwischen der ersten und achten Lage „hin- und herrutschen“. In hohe Lagen stößt man auch in der nächsten Variation vor, die fast nur aus gebundenen Sechzehntelläufen besteht, welche überwiegend chromatisch abwärts verlaufen und vor allem schnelle Finger erfordern. Eine große, dehnungsfähige Hand ist Voraussetzung für das Meistern der sechsten Variation. Nachdem im erstem Teil „nur“ Terzenläufe auftreten, wird dieses Intervall im zweiten Teil um eine Oktave vergrößert, so dass Sechzehntel-Tonleitern von Dezimen eine Herausforderung darstellen. Variation 8 sieht das Spielen von dreistimmigen, lauten Akkorden vor. Da die Akkorde schnell aufeinander folgen, bleibt nicht viel Zeit, drei Finger innerhalb einer Lage umzusortieren oder die Lage zu wechseln. Sehr anspruchsvoll ist auch die neunte Variation. Dem Komponisten genügt es offenbar nicht mehr, Sechzehntelketten länger zu streichen, denn jetzt wechseln sich gestrichene mit solchen Sechzehnteln ab, die mit der linken Hand gleichzeitig gegriffen und gezupft werden. Zu alledem verändert sich die Abfolge von „arco“ und „pizzicato“ während der Variation, so dass die Koordination nicht gerade leichter fallen dürfte. Eine extreme Schnelligkeit wird in der letzten Variation mit anschließendem Finale benötigt. Neben je von der G/D- zur A/E-Saite gebundenen Sechzehntel-Doppelgriffen müssen - wohlgemerkt immer noch im „Quasi Presto“-Tempo - an einer Stelle gar Zweiunddreißigstel in Form eines gebrochenen Akkordes gespielt werden, aber auch die Sechzehntel-Sextolen im Finale, ebenfalls in gebrochenen Akkorden, sind nicht wesentlich langsamer, und zum Ende des Stückes hin sind dann bis zu 18 Sechzehntel im 2/4-Takt notiert, die über drei Oktaven auf- und wieder abwärts im gebrochenen A-Dur Akkord in einem zwei Takte andauernden Triller auf A enden, der dann durch einen sehr lauten A-Dur-Akkord beendet wird.
5.3 Die Variationen Liszts
Liszt übernimmt in seinen Variationen die Elemente der Variationen Paganinis, verändert sie nach seinen Vorstellungen und fügt den technischen Möglichkeiten des Klaviers entsprechend weitere Elemente hinzu, die den Anspruch an den Pianisten stark ansteigen lassen. In Variation 1 übernimmt die rechte Hand beispielsweise in etwa das, was der Geiger in Paganinis erster Variation zu spielen hat, während die linke Hand das Thema der Caprice spielt. Dabei entsteht die Schwierigkeit, dass Achtel-Triolen gegen Sechzehntel gespielt werden müssen, d.h. „3 gegen 4“ innerhalb einer Zählzeit. Das Oktaven-Motiv der dritten Variation ist in Liszt dritter Variation in der linken Hand zu finden. Eine etwas abgewandelte Version des Themas, auch in Oktaven, wird nun zusätzlich vom Pianisten bewältigt, und da im zweiten Teil der Variation in der linken Hand auch Dezimen auftauchen, kommt man nur mit breitem und kräftigem Anschlag zum Erfolg. In der vierten Variation verwendet der Komponist wiederum das bei ihm wohl beliebte Intervall der Oktave. Die Sechzehntel- Chromatik in der rechten Hand wird durch kurze Sechzehntel auf jedem gezählten Achtel unterstützt. Variation 6 wartet vorwiegend mit Terz- bzw. Oktavtonleitern in der linken Hand und einer Kombination aus beiden, nämlich Tonleitern aus Oktaven mit eingeschlossener Terz, in der rechten Hand auf. Die Tatsache, dass linke und rechte Hand zumeist nicht parallel spielen, sondern aufeinander zu oder voneinander weg, erschwert die Aufgabe für den Klavierspieler. In der achten Variation macht vor allem das Tempo zu schaffen, dass nun mit „Animato“ - lebhaft - angegeben ist. Laute Staccato-Akkorde sollen hier in schneller Folge zu Gehör gebracht werden, wobei die rechte Hand zumeist synkopisch nach der linken spielt. Variation 9 versucht, das „pizzicato“ bei Paganini durch „staccato“, und zwar „quasi pizzicato“, nachzuahmen. Die linke Hand nimmt die Funktion der Begleitung, ebenfalls in kurzen Sechzehnteln, ein. Den Höhepunkt an virtuoser Gestaltung bildet in Liszts Etüde die letzte Variation. Für gebrochene Akkorde in Zweiunddreißigstel-Triolen, chromatische Oktavenläufe oder, am Schluss des Stückes, 29 Zweiunddreißigstel in einem Takt, sind überaus enorme Fingerfertigkeiten notwendig, will man das Tempo nicht „verlieren“.
5.4 Wirkung der virtuosen Elemente
Der Einsatz von Mitteln der Virtuosität geschieht also sowohl bei Paganini als auch bei Liszt alles andere als sparsam. Obgleich die festgestellten Harmonien des Themas im großen und ganzen beibehalten werden, bekommen motivische Spielfiguren in einzelnen Variationen ein so deutliches Übergewicht, dass der thematische Grundgedanke zwar nicht ganz verloren geht, aber doch ein unmittelbarer Bezug zum Thema teilweise nur bedingt zu erkennen ist. Auch wenn hier beeindruckende Klangeffekte erzielt werden und man sicherlich in keiner der Variationen Paganinis und Liszts musikalische Substanz vermissen muss, wird man beim Hören der Caprice und der Etüde den Gedanken nicht los, dass an so mancher Stelle weniger, d.h. eine nicht ganz so übertrieben deutliche Anhäufung technischer Schwierigkeiten, mehr sein könnte, um die Leichtigkeit des Themas nicht völlig zu zerstören.
6. Die unterschiedliche Bewertung des Virtuosentums
Dass das Virtuosentum, wie wir es bisher kennen gelernt haben, nicht nur positiv aufgenommen wurde und wird, ist offenkundig. Daher sollen hier zunächst diejenigen zu Wort kommen, die sich durch eine ablehnende Haltung zur Virtuosität auszeichnen.
Demgegenüber sollen dann anschließend Äußerungen von Befürwortern Paganinis und Liszts gestellt werden (wobei ich mich ausschließlich auf die Einschätzung von Liszt beschränken möchte), um letztendlich in einer Zusammenfassung zu einem abschließenden Urteil zu gelangen.
6.1 Negative Beurteilung
Robert Schumann, selbst einer der bedeutendsten Komponisten der Romantik, lehnte „Virtuosengeklimper“ ab. An Clara Wieck, seine spätere Frau, schrieb er einmal: „Ich kann kein Konzert schreiben für Virtuosen, ich mußauf etwas anderes sinnen“(Dahlhaus 1980, S. 116). Denn Schumann wollte kein Material für Künstler liefern, die nichts anderes „als amüsieren und nebenbei reich werden“ wollten (Bozzetti 1991, S. 175). Auch Florestan, wahrscheinlich einer seiner Freunde, hegte einen regelrechten Widerwillen gegen leere Virtuosität. So hielt dieser „einen Virtuos, der nicht acht Finger verlieren könne, um mit den zwei übrigen zur Not seine Kompositionen aufzuschreiben, (...) keinen SchußPulver wert“; des weiteren gab er den Virtuosen die Schuld, „daßdie göttlichsten Komponisten verhungern müßten“(Bozzetti 1991, S. 175). Richard Wagner, der besonders durch seine Opern bekannt ist, war der Ansicht, „die Besonderheit des Ausführenden [dürfe] (...) in keiner Weise unsere Aufmerksamkeit auf sich, d.h. eben vom Kunstwerk ablenken“(Bozzetti 1991, S. 175). Er stellte aber zugleich fest, dass das Publikum sich bei einem öffentlichen Konzert zuallererst an der „Kunstgeschicklichkeit“ erfreue und den ausübenden Künstler dadurch „verdürbe“, so dass dieser vergesse, „den Ernst und die Reinheit der Kunst überhaupt zu wahren“(Bozzetti 1991, S. 175). Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ein zeitgenössischer Musikwissenschaftler, bemerkte über Flügel-Konzerte: „Hier soll die Virtuosität des einzelnen Spielers in Passagen und im Ausdruck der Melodie geltend gemacht werden (...), man bewundert die Fertigkeit der Finger u. dergl., ohne daßdas Gemüt recht angesprochen wird“(Bozzetti 1991, S. 174). Derselbe zitierte auch folgendes aus einem Brief des Kapellmeisters Kreisler an den Baron Wallborn: „(...) wenn ich oft von heillosen Bravour- Arien, Konzerten und Sonaten ordentlich zerschlagen (...) worden, oft eine kleine unbedeutende Melodie, (...) unsicher und stümperhaft gespielt, aber treulich und gut gemeint und recht aus dem Innern heraus empfunden, mich tröstete und heilte“(Bozzetti 1991, S. 174/175).
Sind alle vorangegangenen Kritiken nicht direkt auf Liszt oder Paganini bezogen - dies soll aber nicht heißen, dass sie nicht auch größtenteils auf die beiden zutreffen - , so zielen die Ausführungen Eduard Hanslicks in seinem Buch „Geschichte des Concertwesens in Wien“ auf das Auftreten Liszts ab. „Lißt’s Spielweise [war] bei aller Genialität ungleich und hatte zu viel von absolutem Virtuosenthum, um in den höchsten und reinsten Begriff der Kunst aufzugehen. Ohne Zweifel gewann Lißt seinen Ruhm (...) durch die geistreichste Berechnung des Sinnenfälligen in der Musik, welches er auf eine Weise behandelte, die das Publicum zu sich heranziehend oder auch auf Unkosten des Tonstückes in tausend kleinen Künsten zu dem Publicum sich herablassend, diese vielköpfige Sammlung unbedingt gewinnen mußte. (...) Lißt, das anerkannte Genie des Pianofortes, konnte sich seinen Launen hingeben, durfte ungleich, ja unrein spielen und war doch mit seiner fein weiblichen Koketterie sicher, Alles zu entzücken“(Schneider 1984, S. 155/156).
6.2 Positive Beurteilung
Die Tatsache, dass Liszt sein Publikum so entzückte, wie Hanslick es beschreibt, wird anhand von Rezensionen seiner Konzerte deutlich. In einer Theaterzeitung von 1839 finden wir dies: „Welch ein Reichthum von Gefühl mußin einer Seele liegen, welche solche Töne den Saiten, - und so freudig - wehmüthige Thränen den Augen zu entlocken weiß!“(Schneider 1984, S. 154). Und 1841 wird Liszt ebendort „jene Kraft der Conception, jene Stärke des Geistes und Gefühls, jene ernste männliche Schönheit“ bescheinigt, an denen „man wahrhaft große Männer erkennt“(Schneider 1984, S. 154). Liszts „ Tiefe der Empfindung “, die ihm auch im Wiener „Anzeiger“ 1838 zuerkannt wurde, bildet ebenso den Kern der Bewertung vom Spiel Liszts durch die „Wiener Zeitschrift“ 1840. „Er fragte immer heftiger, denn seine Gefühle wogten höher, und sein Lieben und Sehnen, Hoffen und Leiden fanden den Weg durch seine Fingerspitzen (...); das lebendig gewordene Piano antwortete auf alle Fragen, es liebte, sehnte, hoffte und litt mit ihm, und trug sein Lieben, Hoffen, Sehnen und Leiden weiter in fremde Herzen“(Schneider 1984, S. 154). Liszt Spiel ist „Entrückung in jene Sphäre, wo Klang zur Vision wird, Klavierspiel zur Utopie, das Menschenunmögliche zum Lustgewinn, der Tastendonner zu einem Vortasten in die Zukunft“, so schrieb Dieter Hildebrandt (Bozzetti 1991, S. 176). Neben diesen emotional geprägten Bewertungen gibt es aber auch sachlichere Stellungnahmen, die das Virtuosentum in einem positiven Licht sehen. Max Weber beispielsweise urteilte über Liszt, dass dieser „seinem Instrument an Möglichkeiten des Ausdrucks alles Letzte, was es in sich barg“, entlockt habe (Schneider 1984, S. 157). Schumann sah, obwohl er wie erwähnt für absolute Virtuosität nichts übrig hatte, in dessen Klavierspiel die „Aussprache eines kühnen Charakters, dem zu herrschen, zu siegen das Geschick einmal statt gefährlichen Werkzeugs das friedliche der Kunst zugeteilt“(Bozzetti 1991, S. 176). Carl Dahlhaus, vielleicht der herausragendste Musikwissenschaftler unserer Zeit, stellte schließlich heraus, dass die „emphatische Modernität der musikalischen Sprache [der Romantik] der virtuosen Technik eine Substanz zu geben vermochte“ und das Entscheidende für Liszt nicht die Technik, „sondern die fundamentale Einsicht, daßVirtuosität, statt in der musikalischen Substanz epigonal bleiben zu müssen, prinzipiell fähig ist, an der ‚romantischen Revolution’ zu partizipieren“, gewesen sei (Dahlhaus 1980, S. 111). Außerdem nennt Dahlhaus als Vorzug der Virtuosität einen unerschöpflichen Gestaltenreichtum sowie die aus einer „revolutionären Motivik“ resultierende „Herausforderung zu ‚exzessiver’ - von ungewöhnlichen Dissonanzen und tonalen Sprüngen durchsetzter - Harmonik“, die verhindert habe, „daßsich die Virtuosität in bloße ‚Brillanz’ (...) verlor“(Dahlhaus 1980, S. 112).
Liszt selbst äußerte sich in einem Brief dahingehend, dass die Klavierspieler aufgrund des Virtuosentums durch eine anhaltende Beschäftigung mit der neu entwickelten Technik enorme Fortschritte machten und die Ausdrucksmöglichkeiten des Klaviers nun mit denen eines ganzen Orchesters vergleichbar seien (vgl. Schneider 1984, S. 156).
6.3 Zusammenfassung und eigenes Urteil
Man muss grundsätzlich zwei Seiten des Virtuosentums unterscheiden: Zum einen die Aufführungspraxis, also die Art und Weise, wie die Virtuosen des 19. Jahrhunderts aufzutreten pflegten, andererseits die Kompositionspraxis, d.h. die Art und Weise, wie sich Virtuosität in den Werken virtuoser Komponisten äußerte. In den vorangegangenen Bewertungen ist deutlich geworden, dass die Virtuosen sich in ihren Konzerten wohl gezielt publikumswirksam, mit entsprechend „effektvollen“ und schwierigen Werken präsentierten und die breite Masse daher für sich gewannen, die Künstler wie Liszt und Paganini dann zum Teil „wie Stars verehrte“. Diese Entwicklung, dass die Aufmerksamkeit der Zuhörer beinahe nur noch dem Interpreten galt, war natürlich für „wahre“ Musikfreunde nicht wünschenswert, und ihre abwertenden Äußerungen sind nur allzu nachvollziehbar und berechtigt, da schöne, aber zu „unspektakuläre“ Musik anderer, die nicht im virtuosen Stil komponierten, offensichtlich kaum noch angenommen wurde. Zwar sagte Liszt einmal, man solle „die Kunst nicht als bequemes Mittel für eigennützige Zwecke und unfruchtbare Berühmtheit (...), sondern als eine heilige Macht, welche die Menschen umfaßt“, auffassen und als Künstler „auf eine eitle, egoistische Rolle verzichten“(Bozzetti 1991, S. 175) - die er im übrigen Paganini zuweist, eine recht bezeichnende Kritik an seinem Vorreiter und Vorbild -, doch steht diese Aussage in direktem Gegensatz zu der bereits erwähnten Meinung Hanslicks, der Liszt ja eben den Missbrauch der Virtuosität für persönliche Zwecke vorwarf, und ich glaube, Liszt wäre nicht zu einem solchen Ruhm gekommen, wenn er sich nicht auch ein Stück weit darum bemüht hätte, denn sonst wäre die Verwendung virtuoser Elemente wie in der untersuchten Paganini-Etüde nicht so auffällig. Außerdem kann auch der Satz Liszts, „Das Konzert - das bin ich“(Schneider 1984, S. 141), in diese Richtung gedeutet werden.
Erkennbar ist aber durchaus, dass sowohl die virtuosen Kompositionen nicht unbedingt arm an musikalischem Gehalt sind als auch das Spiel der Virtuosen nicht gänzlich ohne Gefühl und Ausdruck gewesen sein kann, wenn ein Musikerkollege wie Schumann von einer „gewaltigen Art“ Liszts Spiels spricht (Schneider 1984, S. 143); dennoch wirkt die Anhäufung von Passagen in der Caprice von Paganini und der Etüde von Liszt (wobei dies wahrscheinlich auch auf andere Werke der beiden bezogen werden kann) zuweilen etwas übertrieben, aufgezwungen und eben vom eigentlichen Kern des Stückes ablenkend, weshalb auch eine noch so gute Wiedergabe eine „reine“ Schönheit, welche die Variationen ohne Zweifel haben könnten, nur ansatzweise, nicht in vollem Umfang darbringen kann. Allenfalls wird man fast gezwungenermaßen dazu veranlasst, die Leistung des Künstlers bewundern, der alle vorhandenen Schwierigkeiten bewältigt, und genau dazu ließsich das Publikum der Virtuosenzeit hinreißen. Wie schon in der Einleitung erwähnt, verursachte diese „Akzentverschiebung vom Werk zur Wiedergabe“(1), dass heute bei jeder musikalischen Aufführung meistens der Interpret im Interesse der Zuhörer und Medien steht, was sicherlich Vor- und Nachteile hat. Eine positive und nicht zu unterschätzende Nachwirkung des Virtuosentums ist aber, dass die wachsende Instrumentaltechnik dazu führte, dass sich die Künstler bis heute intensiver mit der Kunst beschäftigten und beschäftigen und „bei ständig verbesserten Trainingsmethoden“ bis zur Höchstperfektion zu gelangen versuchen (Bozzetti 1991, S. 174); zudem konnten ganz neue Klangeffekte auf der Geige und dem Klavier erzielt werden, wie sie in den besprochenen zwei Werken zum Ausdruck kommen.
Insgesamt war das Virtuosentum des 19. Jahrhunderts eine umstrittene Erscheinungsform und wird es wohl auch bleiben. Sie hat meiner Meinung nach einerseits Werke hervorgebracht, die eher zum Herausstellen technischer Fähigkeiten des Künstlers geeignet sind als dass sie ästhetisch vollkommen überzeugen, zum anderen bewiesen, welche Möglichkeiten in einem Instrument stecken und zugleich die Technik geliefert, mit der diese dem Instrument entlockt werden können. Drittens hat sie gezeigt, dass auch Musiker nicht von dem allgemeinen Streben nach Erfolg und Berühmtheit, das in allen Lebensbereichen zu beobachten ist und immer in irgendeiner Form auf Kosten anderer, vielleicht wichtigerer Dinge erfolgt, ausgenommen waren bzw. sind.
7. Literaturverzeichnis
Bozzetti, Elmar. Das Jahrhundert der Widersprüche. Musik im 19. Jahrhundert. Kursmodelle Musik Sekundarstufe II. Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg, 1991
Buchner, Gerhard. Musik A-Z. Klassik, Jazz, Rock, Pop; Musikgeschichte, Instrumentenkunde, berühmte Komponisten und Interpreten. 2. Auflage. München: Franz Schneider Verlag, 1986
Dahlhaus, Carl. Die Musik des 19. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenschaft Band 6. Laaber: Laaber-Verlag, 1980
Flesch, Carl [Hrsg.]. Niccolo Paganini; Capricen für Violine Opus I. Frankfurt/London/New York: Edition Peters Nr. 1984
Kwiatkowski, Gerhard [Hrsg.]. Die Musik. 2. Auflage. Schülerduden. Mannheim/Wien/Zürich: Dudenverlag, 1989
Schneider, Ernst Klaus. Original und Bearbeitung. Kursmodelle Musik Sekundarstufe II. Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg, 1984
Stowasser, Josef M. Der kleine Stowasser. Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch. 3. Auflage. München: R. Oldenbourg Verlag, 1991
Häufig gestellte Fragen zum Thema Virtuosentum
Was ist ein Virtuose gemäß dem Text?
Der Begriff stammt von "virtus" (Mannhaftigkeit) ab. Ursprünglich bezeichnete er im 16./17. Jahrhundert in Italien Personen, die sich durch Wissen oder Fertigkeiten hervortaten. Im 18. Jahrhundert wurde er enger gefasst und bezog sich ausschließlich auf bedeutende Musiker, später auf besonders qualifizierte ausübende Musiker, meist Solisten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts kam eine negative Konnotation auf, die den Virtuosen als jemanden sieht, der seine Technik zur Schau stellt und die ästhetische Qualität des Werkes vernachlässigt.
Welche Bedingungen begünstigten die Entstehung des Virtuosentums?
Die Geigenvirtuosität wurzelt im 17. Jahrhundert, begünstigt durch die Weiterentwicklung des Streichinstrumentenbaus und die vielfältigen spieltechnischen Möglichkeiten der Violine. Die Monodie, die den Affektgehalt der Sprache musikalisch nachzuahmen versuchte, diente als Vorlage. Die Klaviervirtuosität entstand später, im Sturm und Drang des ausgehenden 18. Jahrhunderts, unterstützt durch die neue "englische Mechanik" der Klaviere und den ausdrucksvollen Stil dieser Epoche.
Wie wird die Situation von Paganini und Liszt im Text dargestellt?
Niccolo Paganini begeisterte das Publikum im frühen 19. Jahrhundert mit seiner außergewöhnlichen Violintechnik. Seine Werke von höchstem Schwierigkeitsgrad und sein beeindruckendes Auftreten führten dazu, dass er als "Teufelsgeiger" bezeichnet wurde. Franz Liszt wurde von Paganini inspiriert und entwickelte eine vergleichbare Technik auf dem Klavier. Beide Künstler erlebten eine große Begeisterung, die mit dem Massenwahn um heutige Popstars vergleichbar ist.
Welche Werke von Paganini und Liszt werden analysiert?
Die Caprice Opus 1 Nr. XXIV von Paganini und die Paganini-Etüde Nr. VI von Liszt, eine Bearbeitung der Caprice für Klavier, werden im Hinblick auf virtuose Elemente analysiert.
Wie wird das Thema der Caprice beschrieben?
Das Thema steht in a-Moll, im 2/4-Takt, ist "Quasi Presto" und "piano" zu spielen. Es besteht aus einer viertaktigen und einer achttaktigen Periode. Ein tänzerisches Motiv zieht sich durch das Thema.
Wie unterscheiden sich Paganinis und Liszts Variationen?
Paganini entwickelt aus dem einfachen Thema technische Schwierigkeiten und eine differenzierte Motivik. Liszt übernimmt Elemente Paganinis, verändert sie und fügt den technischen Möglichkeiten des Klaviers entsprechende Elemente hinzu. Dadurch steigen die Anforderungen an den Pianisten stark an.
Welche negativen Beurteilungen des Virtuosentums werden im Text genannt?
Robert Schumann lehnte "Virtuosengeklimper" ab. Richard Wagner kritisierte, dass die Aufmerksamkeit nicht vom Kunstwerk abgelenkt werden dürfe. Eduard Hanslick bemängelte, dass Liszt die "Sinnenfälligkeit" der Musik berechnend einsetzte, um das Publikum zu gewinnen.
Welche positiven Beurteilungen des Virtuosentums werden im Text genannt?
Liszt wurde "Tiefe der Empfindung" bescheinigt. Max Weber lobte, dass Liszt seinem Instrument alles entlockt habe. Carl Dahlhaus hob hervor, dass die Virtuosität an der "romantischen Revolution" teilhaben konnte und Gestaltenreichtum sowie eine "revolutionäre Motivik" bot.
Zu welchem abschließenden Urteil gelangt der Text bezüglich des Virtuosentums?
Das Virtuosentum wird als umstrittene Erscheinungsform dargestellt. Einerseits brachte es Werke hervor, die eher technische Fähigkeiten hervorheben als ästhetisch vollkommen zu überzeugen. Andererseits bewies es, welche Möglichkeiten in einem Instrument stecken und lieferte die Technik, mit der diese dem Instrument entlockt werden können. Zudem zeigte es, dass Musiker auch dem Streben nach Erfolg unterliegen.
Welche Literatur wird im Text zitiert?
Das Literaturverzeichnis enthält Werke von Bozzetti, Buchner, Dahlhaus, Flesch, Kwiatkowski, Schneider, Stowasser und Von Sauer.
- Quote paper
- Jens Hölscher (Author), 2002, Paganini und Liszt - Das Virtuosentum des 19. Jahrhunderts in unterschiedlicher Bewertung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106160