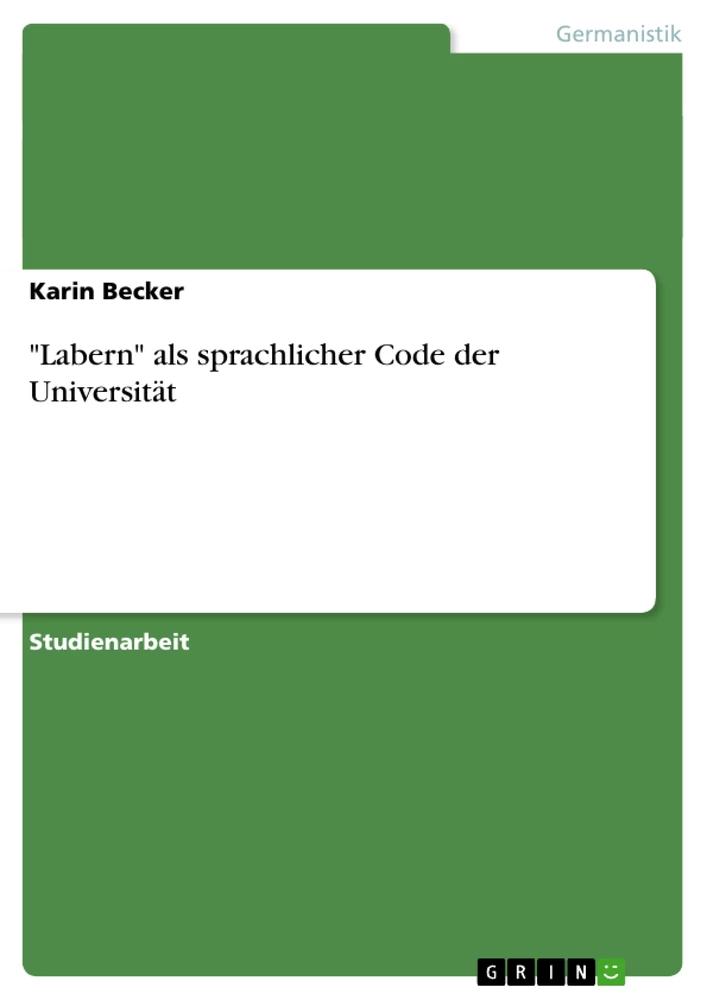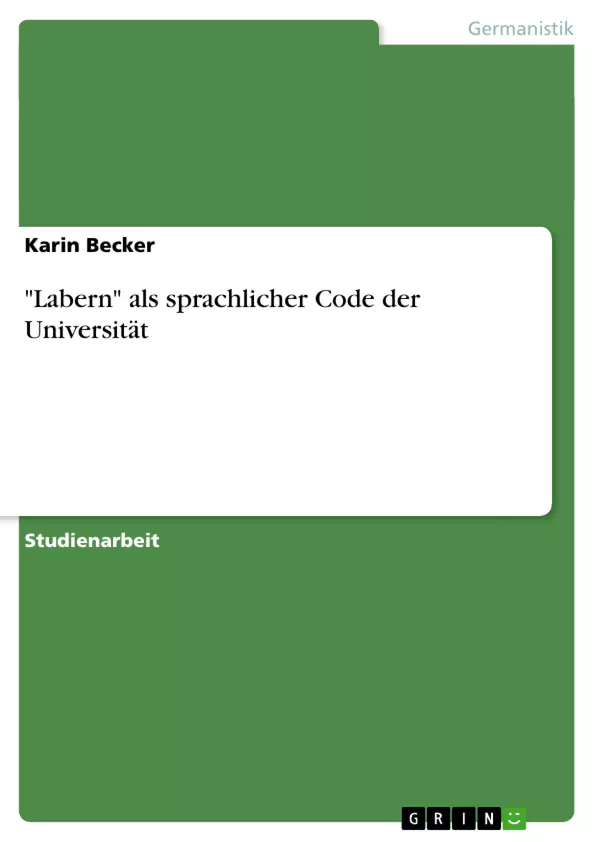Inhalt
1. Einleitung
2. Wissenschaftliche Meinungen
2.1. Merkmale der Wissenschaftssprache
2.2. ,,Denkmal Platos aus Hefe" - zynische Verrisse des universitären Redestils
3. Methoden
4. Eigene Analyse
4.1. Entwicklung der Fragestellung
4.2. Methodisches Vorgehen
4.2.1. Annäherung an die Thematik, Vorüberlegungen
4.2.2. Strukturelle Analysen
4.2.3. Befragung als Meinungsbild
4.4. Zusammenfassung der Analyse
5. Schluss
6. Literatur
7. Anhang
7.1. Verschriftlichung der analysierten Sequenzen
7.2. Strukturdiagramme
7.3.1. Fragebogen zur Studie
7.3.2. Statistische Auswertung des Fragebogens
7.3.3. Zusammenfassung Auswertungen
7.3.4. Einzelne Auswertungen
1. Einleitung
Die Ethnographie der Kommunikation beschäftigt sich mit kontextspezifischen Sprechweisen, das heißt, wie wird wo über was gesprochen. Auch an jeder Universität finden sich gleich mehrere solcher typischer Sprechformen, abhängig vom formalen Charakter des Zusammentreffens der Sprecher. Die Bandbreite reicht dabei von Auskunfts- oder Beratungsgesprächen und Prüfungen über Seminare bis hin zu sachlicher im Gegensatz zu informeller Kommunikation zwischen Studenten, z.B. Referatstreffen im Gegensatz zu Gesprächen beim Essen oder in einem Café.
Als zentralen Punkt des universitären Alltags können jedoch Seminare gesehen werden1, so dass eine Analyse derselben nahe liegt. Als besonders universitätstypische Redeform erschien uns dabei das Phänomen des ,Laberns'. Auch wenn dies nicht ausschließlich auf Seminare beschränkt ist, so scheint es jedoch auf wissenschaftliche Sprache im Allgemeinen zuzutreffen.
Erste Reaktionen zeigten, dass der Begriff ,Labern' von fast allen Kommilitonen sofort verstanden wurde, im Sinne von ,,wenig Inhalt in viele Worte verpackt" oder auch der Tendenz eines Sprechers, der Form Vorrang vor dem Inhalt eines Beitrags zu geben. Anhand welcher Merkmale das ,Labern' jedoch wirklich zu erkennen und vielleicht auch festzumachen ist, scheint jedoch eine weit schwierigere Frage zu sein, nicht zuletzt deshalb, weil es häufig sehr subjektiv beurteilt wird.
Dennoch soll eine Begriffsdefinition im Folgenden versucht werden. Dazu werde ich zunächst einige Meinungen von Wissenschaftlern und anderen Autoren wiedergeben, um dann mit einem kurzen Abriss über die Methoden der Ethnographie der Kommunikation zur eigenen Analyse zu kommen. Darin wird sowohl das methodische Vorgehen, eine strukturelle Analyse und eine Befragung von Testpersonen besprochen, um dann in der Zusammenfassung die Untersuchung abschließend zu beurteilen.
2. Wissenschaftliche Meinungen
2.1. Merkmale der Wissenschaftssprache
Spätestens seit der Universitätsreform Ende der 60er Jahre gibt es immer wieder kritische Stimmen auch aus der Universität über die Universität, so auch wiederholt über die Sprache der Wissenschaftler.
In einem eher populär- denn wissenschaftlichen2 Buch, ,,Uni-Angst und Uni-Bluff" (1992), beschreibt Wolf Wagner die Spielformen universitärer Kommunikation, wobei seiner Erfahrung nach Unsicherheit oder Unwissen häufig durch gezielten ,,Bluff" und bewusste Vagheit vertuscht werden. Die wissenschaftliche Sprache sei als unpersönlich gekennzeichnet durch die Verwendung der Termina ,man' (,Man sieht also, dass...') oder ,wir' (,Wir kommen so zu dem Ergebnis, dass...') anstelle des konkreteren ,ich'.
Weiter zeichne sie sich aus ,,durch verdrehte Konjunktive, mit denen sich die Sprecherinnen und Sprecher von dem distanzieren, was sie gerade eben sagen: ,ic h würde sagen (oder gar meinen) wollen, daß...'" und die ,,Kompliziertheit des Redens" durch ,,eingeflochtene[n] Nebenschachtelsätze" (Wagner 1992:16). So sieht er als allgemeines Merkmal der Wissenschaftssprache, dass die Form eines Beitrags Vorrang vor dem Inhalt hat (Wagner 1992:57).
Dabei nimmt er bezug auf einen Artikel Helmut Seifferts:
Man tut so, als ob Innovation etwas anderes sei als Neuerung und rigide etwas anderes als starr. Man unterschlägt also, bewußt oder unbewußt, die schlichte Synonymität (Bedeutungsgleichheit, W.W.) der Wortpaare, die jedem Übersetzer geläufig ist, und tut so, als könne man mit Innovation und rigide atemberaubend neue Sachverhalte bezeichnen.
Seiffert 1979:681; zitiert nach Wagner (seine Anmerkung) 1992:17
Unnötige Fremdwörter sind für Seiffert (,,Die Sprache der Wissenschaftler als Imponiergehabe", 1979) das hauptsächliche und problematische Element der Wissenschaftssprache. So werde ,,die Wissenschaftssprache [...] von einem Teil ihrer Benutzer dazu gebraucht, anderen zu imponieren. [...] Sie soll zeigen, daß der Benutzer ,in' ist, daß er einer bestimmten sozialen Gruppe zugerechnet werden darf" (Seiffert 1979:680). Die Wissenschaftssprache also als verbaler Kode der Universität.
All dies führt letztendlich zu Wagners These, dass ,,schwieriges bis unverständliches Reden und weltabgewandte Exklusivität [...] mithin konstitutive Kriterien des universitären Regelsystems [sind]" (Wagner 1992:59). Wie sehr dies der Fall ist und wie wenig man sich dem entziehen mag, beweist nic ht nur das durch Wagners Anmerkung betonte ,,Synonymität" in Seifferts Artikel, auch Wagner selbst kann sich nicht ganz von mehr oder minder unnötigen Fremdwörtern wie ,,Exklusivität" oder ,,konstitutiv" (siehe letztes Zitat) befreien.
2.2. ,,Denkmal Platos aus Hefe" - zynische Verrisse des universitären Redestils
,,Aha, das klingt gut, dachte ich. Aber hat es auch einen Sinn? [...] wer so etwas schreibt, [ist] wohl froh [...], wenn ich ihn nicht öffentlich frage, was es bedeutet" (Laermann 1985:212). Diesen Satz schreibt Klaus Laermann (,,Das rasende Gefasel der Gegenaufklärung. Dietmar Kamper als Symptom" 1985) im Hinblick auf einen Text des Soziologen Dietmar Kamper, der durch sein ,,rasendes Gefasel", fremdwortüberladene, inhaltlich aber sehr vage Texte auffällt. Laermann nimmt ihn zum Anlass, die aufgeblasene und inhaltslose Sprache bestimmter Geisteswissenschaftler zu verurteilen, ,,die [...] über alles und jedes schreiben können, nur nicht über ein Thema" (Laermann 1985:213). Er wirft Kamper vor, Gedanken nicht zu Ende zu denken bevor er sie formuliert oder gar bewusst im Unklaren zu bleiben. Es scheine, so Laermann, ,,daß hier einer [...] im Grunde nur undeutlich wiederholt, was andere ihm vorgesagt haben" (Laermann 1985:215).
Auch hier findet sich als o, wie bei Seiffert, die Kritik an dem übermäßigen Gebrauch von Fremdwörtern und einer unnötig komplizierten Sprache. Trotzdem, oder gerade, funktioniere diese ,Taktik' an der Universität aber hervorragend, denn, wie Wagner bemerkt, oftmals sei Unverständlichkeit das unausgesprochene Ziel der Wissenschaft, um sich von der breiten Masse der Bevölkerung abzugrenzen (Wagner 1992:59). Laermann erklärt diese Faszination, die oftmals eher der Verwirrung denn der Aufklärung diene, folgendermaßen:
Denn sie [die Zuhörer oder Leser, Anm.] finden sich zurückversetzt in jene Zeit, in der sie als Kinder die Sprache der Erwachsenen zwar hören, aber nicht auffassen konnten. Immer wieder mußten sie meinen, daß, wer so merkwürdig und unverständlich spricht, schon irgendwie recht haben dürfte, auch wenn sie (noch) nicht verstanden, was da gesagt wurde. Laermann 1985:219
Diese Kritik an übertrieben komplizierter Sprache ist jedoch kein Phänomen allein der letzten Jahre. Seiffert beschrieb den Gebrauch von Fremdwörtern 1979 als ,,Zeitstil" (Seiffert 1979:680), seitdem haben sich m.E. vielleicht die Fremdwörter an sich, nicht aber der Stil im Ganzen gewandelt. Und auch damals war dieser Stil nicht neu, schon 1931 veröffentlichte Kurt Tucholsky unter dem Pseudonym ,Ignaz Wrobel' in der Zeitschrift Die Weltbühne einen Aufsatz über die verschwommene Sprache der ,,Essayisten" (Tucholsky 1931).
,,Verwickelte Dinge kann man nicht simpel ausdrücken; aber man kann sie einfach ausdrücken" (Tucholsky 1931:134). Dazu aber müsse man sie selbst verstanden haben und man dürfe nicht primär für sich selbst, sondern für den Leser schreiben. ,,Man brauche gewöhnliche Worte und sage ungewöhnliche Dinge", so sein Ratschlag, ,,aber sie machen es umgekehrt" (Tucholsky 1931:129).
Auch inhaltlich verurte ilt Tucholsky diese Art zu schreiben aufs Schärfste. Er vergleicht die Texte mit ,,[...] Kinderballons. Stich mit der Nadel der Vernunft hinein, und es bleibt ein runzliges Häufchen schlechter Grammatik. [...] Zu sagen haben sie alle nicht viel - aber so viel zu reden!" (Tucholsky 1931:132).
Doch auch Tucholsky sieht dies als Mode seiner Zeit:
Wenn aber ein ganzes Volk mittelm äß iger Schreiber [...] etwas Ähnliches produziert wie ein Denkmal Platos aus Hefe, bei dreißig Grad Wärme im Schatten, dann darf doch dieser lächerliche Essay-Stil eine Modedummheit genannt werden. (Tucholsky 1931:134)
Da sich bis heute diese ,Mode' jedoch nicht gelegt hat, scheint es weniger eine zeitliche Mode zu sein denn eine Besonderheit der intellektuellen oder wissenschaftlichen Sprache.
3. Methoden
Die Ethnographie der Kommunikation (z.B. Saville-Troike 1982, Hymes 1979) gibt für Untersuchungen von kommunikativen Normen ein breites Band an Methoden vor. Häufig sind diese zwar auf die Untersuchung einer dem Forscher fremden Kultur ausgerichtet, sie können aber i.A. problemlos auf die Beschreibung der eigenen Gesellschaft übertragen werden3.
Zunächst muss die Art des zu untersuchenden Ereignisses klar abgegrenzt werden. Dies geschieht durch die Unterteilung in (1) soziale Situation (communicative situation), also dem Kontext einer Kommunikation, z.B. ein Gespräch beim Abendessen, (2) soziales Ereignis (c ommunicative event), der unmittelbaren Kommunikationsart, z.B. ein Bericht oder eine Diskussion, und (3) kommunikativem Akt (communicative act), also dem einzelnem verbalen oder auch nonverbalen Interaktionsbeitrag (Saville-Troike 1982:28f.). Ebenfalls wichtig für unsere Untersuchung scheint das Konzept der sozialen Rolle und den davon abhängigen Kommunikationsformen zu sein:
[...] each member of a community has a repertoire of social identities, and each identity in a given context is associated with a number of appropriate verbal and nonverbal forms of expression. (Saville-Troike, 1982:21f)
Aus dieser Abhängigkeit heraus lässt sich so von der Form eines Ausdrucks auf die Rolle des Sprechers und meist auch auf den kommunikativen oder sozialen Hintergrund eines Beitrags schließen.
Auch Hymes weist auf das Vorhandensein von Kodes bzw. Sprechebenen hin (Hymes 1979:146ff), die sich je nach Situation unterscheiden und in der Regel ,,strukturell definiert und voneinander unterschieden sind (etwa ,formell' oder ,zeremoniell'; ,informell' oder ,umgangssprachlich'; ,Slang' oder ,Jargon')" (Hymes 1979:147). Dabei seien diese ,Kodes' oder auch ,Stile' kontextabhängig, d.h. also, je nach Umfeld würden bestimmte Arten von Äußerungen als akzeptabel oder abweichend empfunden.
Sprachliche Normen entwickeln sich also ganz logisch in jeder zumindest zeitweise nach außen abgrenzbaren Gruppe. Dies kann, muss aber nicht zur positiven Identifikation mit der Gruppe führen. Nur ,,wenn die [...] herrschende Kommunikationsstruktur von allen Betroffenen akzeptiert und respektiert wird, hat sie vielleicht Erfolg - zumindest in dem von den Betroffenen definierten Sinne" (Hymes 1979:198).
4. Eigene Analyse
4.1. Entwicklung der Fragestellung
Das ,Labern', nach Saville -Troike (Saville -Troike 1982:28f; siehe hier Punkt 3) definiert als kommunikativer Akt, kommt eigener Defintion zufolge im Rahmen des sozialen Ereignisses ,Diskussion' innerhalb der sozialen Situation eines Universitäts-Seminars vor. Der Begriff ,Labern' wurde, wie schon in der Einleitung angemerkt, von eigentlich allen Kommilitonen sofort verstanden und war größtenteils negativ besetzt. Mit dem ,Labern' verbundene Schlagworte waren z.B. ,unnötig komplizierte Sprache', ,nicht zum Ende kommen', ,unpassende, oft persönliche Beispiele', ,am Thema vorbei reden' oder ,Man hat am Ende keine Ahnung, was derjenige eigentlich gesagt hat'.
Weitere Merkmale waren die direkte Wiederholung einer Aussage in anderen Worten, eine starke Dozenten-Bezogenheit und eine relativ aggressive Gesprächsführung, also Unterbrechungen von Vorrednern und Ähnliches. Auch die eigene Entkräftung der Kritik, z.B. ,,Es ist natürlich so, dass... aber eigentlich ist doch viel wichtiger, dass ...", oder die Selbstrücknahme in Form von ,,Meiner Erfahrung nach..." oder ,,...könnte ich mir vorstellen" scheinen auf ,Labern' hinzuweisen. Zusammenfassend scheint dabei nicht der inhaltliche Beitrag an sich, sondern die Selbstdarstellung im Vordergrund zu stehen.
Letztendlich ist das ,Labern' jedoch nicht so unmissverständlich wie zunächst angenommen.
Im Laufe der Untersuchung kristallisierte sich die Hypothese von zwei unterschiedlichen Auffassungen des ,Laberns' heraus: das komplexe im Gegensatz zum ausschweifenden ,Labern'. Das ,komplexe Labern' zeichnet sich durch viele Fremdwörter und eine sehr komplizierte Satzstruktur aus4, so dass die eigentliche Aussage unverständlich erscheint.
Hier hat die Form eindeutig Vorrang vor dem Inhalt. Beim ,ausschweifenden Labern' dagegen gilt das Prinzip der Wiederholungen und der zwar einfachen, in ihrem Zusammenhang aber unklaren Worte. Inwiefern dies mit einer Unstrukturiertheit der Beiträge zusammenhängt oder aber gerade davon zu trennen ist, ist zunächst noch fraglich.
Beiden dieser Konzepte liegt scheinbar das, vielfach wohl unbewusste Motiv zugrunde, bekannte oder banale Sachverhalte so zu formulieren, dass sie dem Zuhörer als neuartig und interessant erscheinen. Auch wenn ein bewusstes Erkennen dieser Strategie im unmittelbaren Diskussionszusammenhang oft nicht möglich ist, wird ,Labern' dennoch meist intuitiv wahrgenommen.
4.2. Methodisches Vorgehen
4.2.1. Annäherung an die Thematik, Vorüberlegungen
Aus dieser unbewusste Wahrnehmung des ,Laberns' entwickelte sich die Schwierigkeit, die grundlegenden Kriterien bewusst und anhand verschiedener Kategorien fest zu machen. Erste Seminarprotokolle, die weniger den Inhalt als die Form der Beiträge dokumentierten, sollten das Vorkommen des ,Laberns' eingrenzen, ergänzt durch kurze, ungezielte Umfragen unter Kommilitonen zu den Eigenschaften des Laberns.
Danach wurde eine Seminarsitzung im Fach Soziologie auf Video aufgenommen, das die Basis unserer folgenden Untersuchung darstellte. Das z.B. von Saville-Troike angesprochene ,Beobachter-Paradoxon', "so called because the observer cannot observe what would have happened if he or she had not been present" (Saville-Troike 1982:114), greift natürlich auch hier. Alles in allem aber schien diese Seminarsitzung relativ natürlich abzulaufen, wohl auch deshalb, weil wir als Studenten als normale Teilnehmer dieser Situation angesehen wurden und wir außerdem die übrigen Studenten nicht über das genaue Ziel unserer Untersuchung aufklärten, um einen bewussten und somit unechten Umgang damit zu vermeiden.
Nach Sichtung und protokollarischer Auswertung des aufgezeichneten Materials entschieden wir uns dann für insgesamt vier Redebeiträge, anhand derer wir das Phänomen genauer analysieren wollten. Sie zeichneten sich zum einen durch technisch bedingte Kriterien wie Verständlichkeit und relative Länge aus, zum anderen gegeneinander durch unterschiedliche Redestrukturen. Dabei spielte natürlich auch unsere eigene Empfindung des ,Laberns' eine Rolle, so dass die Beiträge auch von uns als ,klar, logisch' bis hin zu ,extremes Gelaber' bewertet wurden.
Anschließend entwickelten wir aus den vorher ungezielt gesammelten Einschätzungen zum Thema einen Fragebogen, den einige Testpersonen nach der Vorführung der Videosequenzen beantworten sollten5. Dabei wurden gezielt subjektive Kriterien (,,Ist Dir der Sprecher/ die Sprecherin sympathisch?"; ,,War der Beitrag für Dich verständlich?") mit eher objektiven Kriterien (,,War der Beitrag eher persönlich oder sachlich formuliert?"; ,,Hatte der Beitrag eine zentrale Aussage?") vermischt.
Unklarheit herrschte bezüglich der Frage, ob lediglich ,Ja-Nein' Antworten vorgegeben werden sollten oder eine Antwort-Skala, zur Unterscheidung zwischen ,stark-mittel-wenig'.
Letztendlich entschieden wir uns für ersteres Verfahren6, ergänzt durch kurze Aufforderungen zur Begründung an entscheidenden Stellen. Außerdem sollte der Beantwortung des Fragebogens ein offenes Interview folgen, denn ,,The ethnographer can never assume that the same labels used in closed-ended or scaled responses refer to similar patterns of language use" (Saville -Troike 1982, S. 127). Es sollte also abgefragt werden, ob die auf den Fragebogen angegebenen Kriterien zutreffend und ausreichend die verschiedenen Redebeiträge kennzeichnen konnten.
Außerdem sollte bei der Beantwortung des Fragebogens der Begriff des ,Laberns' noch nicht erwähnt sein, erst im narrativen Interview wurden die Testpersonen gezielt zum Zusammenhang von den gezeigten Beiträgen und dem Phänomen ,Labern' befragt.
4.2.2. Strukturelle Analysen
Die Vermutung, dass ,Labern' subjektiv bewertet wird und von der Form des Beitrags abhängt, führte zu der Videoauswertung einerseits und zu einer strukturellen Analyse andererseits. Dafür transkribierte ich die einzelnen Beiträge grob und versuchte, sie in Strukturdiagrammen darzustellen. Das heißt, zentrale Stichworte oder Thesen des Textes werden aufgezeichnet und durch eine Linie in der Reihenfolge ihrer Erwähnung verbunden.
Redebeitrag (Rb) 1 z.B. zeigt so eine relativ unübersichtliche Struktur:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anstatt direkt von den ,,universalistischen Zieen" über die ,,Leistungsgesellschaft" zur ,,Verinnerlichung ergo Sozialisation" zu kommen, reißt er die ersten Begriffe mehrmals an, auch unter Verweis auf die ,,Kultur", bevor er dann über ein Beispiel zu dem Zielpunkt seiner Rede kommt.
Rb 2 ist im Gegensatz sehr viel klarer strukturiert, was auch mit der Länge (Rb 1: 1:30 Minuten; Rb 2: 20 Sekunden) zusammenhängt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Dies macht sich auch in der Länge bemerkbar, trotz einfacher Struktur und nur fünf isolierbaren Redeabschnitten hat der Beitrag eine Dauer von ca. 1:15 Minuten.
Die Strukturdiagramme zeigen also einen mehr oder weniger klaren Aufbau der Redebeiträge. Um herauszufinden, was davon als ,Labern' empfunden wird und wo also die Zusammenhänge zur Struktur liegen, wird nun auf die Beurteilung durch Testpersonen eingegangen.
4.2.3. Befragung als Meinungsbild
Um die Studie einigermaßen einzugrenzen, wählten wir als Testpersonen ausschließlich andere Studenten, primär aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich aus. Insgesamt nahmen fünf Personen daran teil7, denen die einzelnen Redebeiträge vorgespielt wurden, nach jedem erhielten sie Ze it, den Fragebogen auszufüllen.
Bei der Auswertung zeigte sich, dass die Beiträge von den einzelnen Personen relativ unterschiedlich bewertet wurden. Erwartungsgemäß fielen dabei die Fragen nach Sympathie und Interessantheit der Beiträge am unterschiedlic hsten aus. Differenziert wurde auch die Nachvollziehbarkeit der Argumentation beurteilt, so dass bei diesen Kriterien kaum generelle Tendenzen feststellbar sind.
Am einheitlichsten, bei zwei Beiträgen einstimmig, bei den anderen zwei mit nur einer Abweichung, wurde dagegen die Frage nach der Verständlichkeit beantwortet. Dabei waren die Redebeiträge 1, 3 und 4 generell verständlich, Redebeitrag 2 wurde dagegen einstimmig als unverständlich beurteilt. Allerdings begründet sich diese Unverständlichkeit bei fast allen Befragten draus, dass der Sinnzusammenhang zum vorher Gesagten unklar sei. Trotzdem steht dies im totalen Gegensatz zu der oben aufgezeigten sehr klaren Struktur des Beitrags.
Die übrigen Fragen wurden kaum einstimmig, meist jedoch mit klaren Tendenzen beantwortet. Interessant dabei ist, wie große Unterschiede auch bei den vermeintlich objektiven Fragen nach einfacher oder komplexer sowie präziser/knapper im Gegensatz zu ausschweifender Sprache auftraten. Dabei muss aber nach den einzelnen Beiträgen unterschieden werden. Bei oben genannten Beispielen fällt besonders Beitrag 4 aus der Reihe, der durchgängig als ausladend, mit einfacher Sprache beschrieben wurde.
Bei den Fragen nach Gestik und Körperhaltung bzw. Tonfall des jeweiligen Sprechers sind ebenfalls meist klare Tendenzen feststellbar, allerdings schien keinerlei Gestik extrem ausgeprägt oder vermindert zu sein. Rb 2 wurde als noch am zurückhaltendsten beschrieben, Rb 1 und Rb 4 dagegen hatten stärkere Gestik. Der Tonfall wurde generell eher als ruhig, manchmal auch monoton beschrieben, bei Rb 1 und Rb 4 gehen die Meinungen dazu aber stark auseinander. Insgesamt ist es durch die offene Antwortmöglichkeiten aber schwerer, diese Tendenzen genauer zu definieren.
Vergleicht man die Bewertung der Beiträge gegeneinander, so wurde Beitrag 3 am einstimmigsten, Beitrag 1 am uneinheitlichsten bewertet, wenn auch die Unterschiede generell nicht sehr groß sind. Allgemein gilt also, dass jeder Redebeitrag, egal ob potenzielles ,Gelaber' oder klar strukturiert, je nach Person sehr unterschiedlich bewertet wird.
Auch im Gesamtbild ist die Beurteilung nicht einheitlich. Beitrag 1 wird insgesamt am positivsten beurteilt, trotz der im Diagramm gezeigten Unstrukturiertheit.
Dabei könnte allerdings der ,Dozenten-Bonus' eine Rolle spielen, also eine möglicherweise allgemein unkritischere Haltung dem jeweiligen Professor oder Dozenten gegenüber.
Beitrag 4 wird dagegen am negativsten bewertet. Er wird mit drei zu zwei Stimmen als uninteressant beschrieben, mit vier zu eins erhält die Sprecherin auch die geringsten Sympathie -Werte. Zwei Mal fällt hier in der formalen Beschreibung des Beitrags auch das Stichwort ,Labern', in beiden Fällen verbunden mit ,,uninteressanter Beitrag" und ,,unsympathische Sprecherin". Dabei ist aber nicht geklärt, ob das ,Labern' die negative Beurteilung bedingt oder umgekehrt, ob man eher bereit ist, einen Beitrag als ,Labern' zu bezeichnen, wenn einem die Person unsympathisch ist.
Danach wurden die Beteiligten einzeln zu folgenden Fragen interviewt:
1) Kennst Du ,Labern' an der Uni? Wenn ja, erzähle davon.
2) Welche Merkmale hat ,Labern' für Dich?
3) Hast Du einen der gezeigten Beispiele als ,Gelaber' empfunden?
Frage 1) beantworteten alle Befragten positiv, was das schon vor der Studie gewonnene Bild bestätigt. Auch die unter 2) abgefragten Merkmale deckten sich mit den vorweg gesammelten, in Punkt 4.1. dargestellten Beschreibungen. Auf Frage 3) wurde tendenziell am ehesten Beitrag 4 als ,Labern' bezeichnet. Ebenfalls genannt wurden Beitrag 3 mit Einschränkungen und von einem Befragten Beitrag 1.
Es ergibt sich also, dass Rb 4 dem Konzept dessen, was mehrheitlich als ,Labern' empfunden wird, am meisten entspricht. Beitrag 2 dagegen steht dem konträr gegenüber.
4.3. Zusammenfassung der Analyse
Es zeigt sich also, dass Redebeiträge prinzipiell stark unterschiedlich, sowohl in Inhalt als auch Form, bewertet werden. So hängt also auch und vielleicht gerade die Empfindung von ,Labern' sehr vom Betrachter bzw. Zuhörer ab.
Dennoch scheint Rb 4 dem ,Labern' generell noch am nähesten zu kommen. Dabei fällt auf, dass dieser Beitrag mehrheitlich als verständlich bezeichnet wurde, mit nachvollziehbarer Argumentation und einem gut erkennbaren Redethema. Rb 2 dagegen, der nie als ,Labern' bezeichnet wurde, ist in diesen Punkten durchgehend entgegengesetzt empfunden worden, wurde sogar einheitlich als ,,unverständlich" bezeichnet. Inhaltliches Verständnis kann also kein Kriterium für ,Labern' sein.
Wichtig scheint dagegen die Länge des Beitrags bzw. die Knappheit der Formulierungen zu sein. Rb 4 wurde einstimmig als ausschweifend beurteilt, Rb 2 dagegen mit deutlicher Mehrheit als präzise und knapp formuliert.
Unstrukturiertheit des jeweiligen Beitrags (extrem in Rb1) scheint dagegen nur begrenzt eine Rolle zu spielen, eher schon Wiederholungen der einzelnen Thesen oder Beispiele (Rb 4). Auch einfache im Gegensatz zu komplexer Sprache ist eher unwichtig bei der Bewertung, jedenfalls wurde bei allen untersuchten Beiträgen die Sprache als eher einfach empfunden.
Interessant ist dagegen, dass ,,persönliche Beispiele" zwar von eigentlich allen Befragten im Interview als sehr typisch für das ,Labern' angegeben wurden, sich dies aber im Fragebogen auf keine Weise wiederspiegelt, da alle Beiträge eher als ,,sachlich formuliert" empfunden wurden.
Betrachtet man also die Studie, ist ausschweifende Formulierung das zentrale Merkmal des ,Laberns'. Eine Beurteilung des Beitrags als ,,uninteressant" und der Person als ,,unsympathisch" hängt damit zusammen, es ist aber weiterhin fraglich, welches dieser Kriterien das andere bedingt.
5. Schluss
,Labern in Seminaren', wie in der Analyse dargestellt, scheint so also nichts mit dem unter 2. beschriebenen ,Labern in wissenschaftlichen Texten' zu tun zu haben. Dennoch stelle ich hier die These auf, dass ,Labern' als sprachlicher Kode der Universität angesehen werden kann, wobei es die unterschiedlichen Ausprägungen des ,komplexen Laberns' als Kode der Schriftsprache und des ,ausschweifenden Laberns' als Sprech-Kode gibt. Gemeinsam wäre diesen beiden Formen, dass Sachverhalte nicht so präzise und klar dargestellt werden, wie es möglich wäre und dass dadurch in beiden Fällen eine Art ,Abwehrreaktion' des Rezipienten und eine negative Beurteilung des jeweiligen Verfassers bzw. Sprechers eintritt.
Weiter zu untersuchen wären die Paraverbalien wie Gestik und Tonfall, die bei dieser Studie zwar berücksichtigt wurden, die Ergebnisse jedoch nur wenig aufschlußreich waren. Dies könnte an den offenen Antworten, vielleicht aber auch an der für diese Zweck nicht optimalen Video-Aufzeichnung liegen, da viele der Sprecher halb verdeckt oder aber relativ klein im Hintergrund waren.
Ein weiterer interessanter Untersuchungspunkt wäre das ,Dozenten-Bonus' genannte Phänomen. Für beide Fälle, ,Dozenten-Bonus' wie auch die Rolle der Gestik, wäre denkbar, alle Redebeiträge nachsprechen zu lassen oder aber eine reine Audio-Aufnahme vorzuführen, um so eine von der Rolle des Sprechers und seiner Gestik unbeeinflusste Beurteilung zu erhalten. Vielleicht könnte so auch herausgefunden werden, ob die Sympathie-Beurteilung vom Beitrag oder der Person des Sprechers abhängt.
Weitergehende Studien könnten auch die Wahrnehmung des ,Labern' durch verschiedene Gruppen untersuchen, also durch Studenten und ehemalige Studenten im Gegensatz zu nicht mit der Universität vertrauten Personen und durch Geisteswissenschaftler im Gegensatz zu Naturwissenschaftlern, um so das Vorkommen des Phänomens weiter einzugrenzen.
6. Literatur
Hymes, Dell (1979) Soziolinguistik. Zur Ethnographie der Kommunikation. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.
Laermann, Klaus (1985) Das rasende Gefasel der Gegenaufklärung. Dietmar Kamper als Symptom. In: Merkur, Heft 431-442, S. 211-220.
Saville -Troike, Muriel (1982) The Ethnographie of Communication. An Introduction. Oxford: Basil Blackwell.
Seiffert, Helmut (1979) Die Sprache der Wissenschaftler als Imponiergehabe. In: Deutsche Universitätszeitung, Bd. 21, S. 680-682.
Tucholsky, Kurt (alias Ignaz Wrobel) (1931) Die Essayisten. In: Kurt Tucholsky (Hg. von Mary Gerold-Tucholsky, 1960) Panter, Tiger & Co. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
Wagner, Wolf (1992) Uni-Angst und Uni-Bluff. Wie studieren und sich nicht verlieren. Berlin: Rotbuch Verlag.
7. ANHANG
7.1. Transkripte der analysierten Redebeiträge
Rb 1 (,,Haste was, biste was")
(bei Minute 18, Dauer ca. 1:30 Minuten)
Inhaltlicher Kontext: Der Dozent fragte nach der allgemeinen Motivation zu studieren. Es fallen Stichworte wie ,Existenz sichern', ,Ansehen' und ,Status'. Er fährt dann fort:
1 das heißt also / die= wir müssen dafür sorgen dass die menschen einer
2 gesellschaft nach universALISTischen ZIElen streben / die diese gesellschaft
3 VORgibt / das ist das was sie jetzt mit kultur meint / das ist das kultur / das ist im
4 grunde der kulturelle überbau / die werte und normen (.) einer gesellschaft / (1,0)
5 LEIstungsgesellschaft (1,5) nicht äh/ zum beispiel / unsere gesellschaft kann man
6 ja als LEIstungsgesellschaft beschreiben / das ist ja so so allgemein ein
7 universalistisches werte= ein ein universalistischer wert / ein ein ja eine NORM
8 auch / also man muss leistung erbringen und dann wird man dafür beLOHNT /
9 sprich (dort) gratifikation / und je mehr leistung man erbringt wird desto (.) mehr
10 wird man belohnt / (.) und ähm äh (.) nicht eh (1,0) das heisst also für= wenn man
11 STAtus hat (wird man belohnt) / das heißt also wir müssen sehen / dass die
12 menschen nach unseren allgemeinen zielen streben / die für alle äh menschen
13 einer gesellschaft wichtig sein SOLLen / das ist ja was was das kultursystem
14 vorgibt / das sind die die gängigen werte und normen / HAST du was BIST du
15 was / (.) zum beispiel (.) nicht / hast du nichts bist du nichts / (.) LEIstung muss
16 sich wieder LOHnen sagen unsere politiker da immer / das heißt unser ganzer
17 zusammenhang von leistung / gratifikation / (.) nicht / STAtus / (.) äh ANsehen /
18 was sie sagen hier / das gehört ja alles irgendwie zusammen / von diesen= von
19 diesen werten sind wir doch= / sind doch diejenigen die hier= / die haben wir
20 doch eben verdeutlicht/ ( 1,5) äh ich glaub hab ich ja gefragt warum wollen sie
21 nen SCHEIn machen / ne / sagen sie wollen ein diplOM machen / ja / warum
22 wollen sie ein diplOM machen / ja (.) nicht / weil ich GEld verdienen möchte / ja
23 / warum wollen sie GEld verdienen / also gut / wenn sie jetzt mal weiter= /
24 würden sie doch irgendwie (.) / ja ich möchte in dieser gesellschaft doch
25 irgendwie ne position mal bekleiden / nicht / äh (.) wo ich ansehen= wo ich
26 angesehen bin / und wo ich mir keine sorgen machen muss / über mein
27 auskommen oder was auch immer / und das= DIEses / dass wir das SOLLen / das
28 wir das MÖchten / das wir das WOllen / das haben wir doch im grunde verinnerlicht / (1,0) nicht das haben sie ja verinnerlicht durch die erziehung / durch die sozialisation / (1,5) wenn sie aussteiger= oder aussteigen möchten im endeffekt dann würden sie doch jetzt nicht hier sitzen /
Rb 2 (,,Darum geht's")
(bei Minute 32, Dauer ca. 20 Sekunden)
Inhaltlicher Kontext: Der Dozent hatte die Frage gestellt, wo sich Probleme aus dem Konflikt zwischen den Bedürfnissen des Individuums und der Rollenerwartung ergeben können. Eine der Referentinnen verweist daraufhin auf gesellschaftlichen Druck, z.B. bei der Berufswahl, eine andee Referentin spricht das Problem an, dass aufgrund finanzieller oder sozialer Bedingungen nicht jeder die Möglichkeit habe zu studieren. Darauf meldet sich eine andere Studentin und wird vom Dozenten aufgerufen.
1 ich denke dass bei konflikten zwischen den bedürfnissen des individuums und
2 den rollenerwartungen (.) geht es eher darum dass man zum beispiel (.) nicht so
3 viel eigenleistung mit einbringt / die rolle des lehrers zum beispiel / weil man
4 sich viel mehr um die schüler kümmern möchte weil sie wissen / zu hause haben
5 sie es schwer aber ich mUß ihm jetzt ne fünf geben / darum geht's / ich glaube
6 nicht um soziale chancengleichheit/ (was ihr da gerade angesprochen habt) /
Rb 3 (,,New Economy")
(bei Minute 35, Dauer ca. 35 Sekunden)
Inhaltlicher Kontext: Der Dozent redet zum Thema Identifikation eines Individuums mit dem Kollektivgeist, und verweist auf das System sozialer Kontrolle, wer aus der Rolle fällt, werde als Abweichler sanktioniert. Darauf meldet sich ein Student und wird aufgerufen.
1 er hat glaube ich auch noch nicht vorhergesehen / dass gesellschaften / um stabil
2 bleiben zu können / sich auch wandeln müssen / also dass der politikgeist sich
3 auch wandeln muss / und halt veränderung / dass werte / wie ähm auch
4 selbstbestimmung / auch sehr funktional für kapitalistische gesellschaften wurden
5 / natürlich nicht für alle teile und (da gibts dann) in vielen teilen brüche / aber für
6 leute in der new eCOnomy ist natürlich sowas wie selbstbestimmung was ganz (.)
7 zentrales / um sich so ausbeuten lassen zu können (.) und in anderen bereichen
8 funktionierts nicht / und manche leute sagen dann halt so (will ich) nicht leben /
9 (.) ich find in meiner selbstbestimmung ne aus= (.) irgendeine auswahl aus den
10 gegebenen berufen und andere sagen nicht / (1,0) ist halt weitaus differenzierter geworden (.) und kommt jetzt wieder so/
Rb 4 (,,Chef")
(bei Minute 46, Dauer ca. 1:15 Minuten)
Inhaltlicher Kontext: Es wurde überlegt, inwiefern bzw. bei welchen Berufen die Person austauschbar sei, solange sie ihre Arbeit mache. Bei Kranführern z.B. sei das ohne weiteres möglich, nicht so bei Lehrern (,,sonst würden sich die Eltern ja nicht beschweren, wenn in einer Klasse dreimal im Jahr der Klassenlehrer wechselt"). Der Dozent fragt nach den Gründen dafür, nach einigen anderen antwortet eine Studentin.
1 irgendwie (kann man alles differenzieren ... gewährleisten...) / ich meine es geht
2 gar nicht nur um wissensvermittlung sondern um ein (1,0) ganzes
3 erziehungskonzept / wie= wie (.) also wie die menschen (.) da herANgebildet
4 werden / weil es geht ja nicht darum wenn man eine schule absolviert / dann dass
5 ich dann ein zeugnis da habe mit einsen sondern dass ich auch (.) zu einen= (.)
6 auch ein stabiles wERtesystem vermittelt bekomme / und das kann (.) äh / wenn
7 das irgendwie ein lehrer (.) alle= / dreimal im monat da irgendwie gewechselt
8 wird oder drei drei mal im jahr / dann wird das eben NICHt vermittelt / oder ich
9 denk mal auch / wenn ich zum beispiel einen chef bei der arbeit habe (.) weiß ich
10 nicht / und der wird dann auch irgendwie ausgewechselt / dann wird / dann wird
11 diese ganze (.) stabilität in der ARbeit oder die athmosphäre in der arbeit auch
12 vielleicht unterbrochen und dann kann ich vielleicht diese arbeit / die ich vorher
13 (1,5) die mir spaß gemacht hat und die ich auch gut geleistet habe nicht mehr
14 weitermachen weil (.) mein chEF (.) äh gewechselt wurde / und dann kann man
15 diese position vielleicht (.) doch ersetzen / aber um= um= äh (.) um diese
16 athmosphäre wieder herzustellen in der arbeit gEHt ds gar nicht mehr (.) und
17 dann wird die arbeit vielleicht äh (.) durch n= (.) wenn der (.) chef da ersetzt wird oder der boss vielleicht / mINderwertig gemACHt von der ähm / weiß ich nicht / von diesen ganzen (.) leuten da /
Transkript-Schlüssel
die= Abbruch
LEIstung Betonung
/ Abgrenzung von Teilsätzen durch fallende Intonation, Mikropausen etc.
(.) Mikropausen unter 1 Sekunde
(1.5) längere Pausen mit Angabe in Sekunden
(solche) vermuteter, unklarer Wortlaut
7.2 Strukturdiagramme
7.3.1. Fragebogen zur Studie
,,Kommunikationsformen an der Uni: Seminar"
Code: Rb1 Rb2 Rb3 Rb4
Wie war Dein erster Eindruck des Redebeitrages (Rb)? (Beschreibe den Beitrag kurz mit eigenen Worten)
Rb1: ________________________________________________________
Rb2: ________________________________________________________
Rb3: ________________________________________________________
Rb4: ________________________________________________________
War der Redebeitrag für Dich eher
a) verständlich ? O O O O
b) unverständlich? O O O O
(Bitte begründe Deine Entscheidung kurz)
Rb1: ________________________________________________________
Rb2: ________________________________________________________
Rb3: ________________________________________________________
Rb4: ________________________________________________________
Fandest Du den Beitrag eher
a) interessant? O O O O
b) uninteressant? O O O O
Ist Dir der Sprecher/ die Sprecherin eher
a) sympathisch? O O O O
b) unsympathisch? O O O O
Hatte der Redebeitrag eine zentrale Aussage?
a) Nein O O O O
b) Ja O O O O
War das Thema des Redebeitrages gut erkennbar?
a) Ja O O O O
b) Nein O O O O
(Bitte begründe Deine Entscheidung kurz)
Rb1: ________________________________________________________
Rb2: ________________________________________________________
Rb3: ________________________________________________________
Rb4: ________________________________________________________
Hatte der Redebeitrag
a) ein Thema? O O O O
b) mehrere Themen? O O O O
War die Argumentation des Beitrags gut nachvollziehbar?
a) Nein O O O O
b) Ja O O O O
Wie war der Beitrag formuliert?
a) Eher persönlich O O O O
b) Eher sachlich O O O O
(Bitte begründe Deine Entscheidung kurz)
Rb1: ________________________________________________________
Rb2: ________________________________________________________
Rb3: ________________________________________________________
Rb4: ________________________________________________________
Wie hast Du den Redebeitrag formal empfunden?
a) Eher ausladend/ ausschweifend O O O O
b) Eher präzise/ knapp formuliert O O O O
War die Sprache eher
a) einfach? O O O O
b) komplex? O O O O
Hat der Sprecher/ die Sprecherin eher
a) stockend/ unsicher gesprochen? O O O O
b) flüssig gesprochen? O O O O
Beschreibe kurz (soweit ersichtlich!) Gestik und Körperhaltung der Sprechenden!
Rb1: ________________________________________________________
Rb2: ________________________________________________________
Rb3: ________________________________________________________
Rb4: ________________________________________________________
Beschreibe kurz den Tonfall der Sprechenden!
Rb1: ________________________________________________________
Rb2: ________________________________________________________
Rb3: ________________________________________________________
Rb4: ________________________________________________________
7.3.2. Statistis che Auswertung des Fragebogens
Rb1 Rb2 Rb3 Rb4
War der Redebeitrag für Dich eher
c) verständlich ? 5 0 4 4
d) unverständlich? 0 5 1 1
Fandest Du den Beitrag eher
c) interessant? 3 3 4 2
d) uninteressant? 2 2 1 3
Ist Dir der Sprecher/ die Sprecherin eher
c) sympathisch? 4 3 3 1
d) unsympathisch? 0 2 2 4
Hatte der Redebeitrag eine zentrale Aussage?
c) Nein 1 2 0 2
d) Ja 4 3 5 3
War das Thema des Redebeitrages gut erkennbar?
c) Ja 4 2 5 3
d) Nein 1 3 0 2
Hatte der Redebeitrag
c) ein Thema? 3 4 5 3
d) mehrere Themen? 2 1 0 1
War die Argumentation des Beitrags gut nachvollziehbar?
c) Nein 1 3 3 1
d) Ja 4 2 2 4
Wie war der Beitrag formuliert?
c) Eher persönlich 2 1 1 1
d) Eher sachlich 3 4 4 4
Wie hast Du den Redebeitrag formal empfunden?
c) Eher ausladend/ ausschweifend 3 1 1 5
d) Eher präzise/ knapp formuliert 2 4 3 0
War die Sprache eher
c) einfach? 4 4 3 5
d) komplex? 1 1 2 0
Hat der Sprecher/ die Sprecherin eher
c) stockend/ unsicher gesprochen? 2 0 0 2
d) flüssig gesprochen? 3 5 5 3
7.3.3. Zusammengefasste Auswertung des Fragebogens
Rb1 ("Haste was, biste was")
AL8:durchgehend positiv bewertet
AN: Zwiespältig: Form eher negativ, Inhalt positiv, trotzdem uninteressanter
Beitrag, Sprecher sympathisch
DE: Zwiespältig: Inhalt positiv, Persönliches und Form leicht negativ
HE: relativ positiv bewertet, wenn auch keine zentrale Aussage
JA: Durchgehend positive Beurteilung
Rb2 (,,Darum geht's")
AL: zwiespältig bewertet, weil Aussage unklar. Trotzdem interessant &
sympathisch
AN: negativ bewertet (besonders inhaltlich), negatives Fazit
DE: Durchgehend positiv bewertet (Verständnisprobleme durch abrupten
Einstieg)
HE: Positiv bewertet, nur unverständlich im Bezug auf den Kontext JA: Durchgehend positive Beurteilung
Rb 3 (,,New Economy")
AL: relativ positiv bewertet, jedoch Kritik an unnötiger Länge
AN: durchgehend positiv bewertet
DE: Eher negativ bewertet, dennoch interessant
HE: zwiespältig, guter Anfang, Gesamtbild eher negativ
JA: Positiv bewertet, trotzdem unsympathisch
Rb 4 (,,Chef")
AL: durchgehend negativ bewerteter Beitrag (,,Labern")
AN: relativ positiv bewertet
DE: verständlich, aber inhaltlich negativ bewertet (,,Labern")
HE: relativ positiv bewertet, Person aber unsympathisch
JA: eher positiv bewertet, aber zu lang, Fazit negativ
7.3.4. Einzelne Auswertungen
Antworten der Ankreuzfragen sind kursiv wiedergegeben, abgefragte Erläuterungen ohne Hervorhebung. Die einzelnen Fragen sind erst für die Auswertung in thematische Abschnitte (Fettdruck) eingeteilt worden.
Auswertung /AL/
Rb 1 (,,Haste was, biste was")
Inhalt:
abstrakt, aber interessant
verständlich (Kurze, knappe Sinneinheiten mit Beispielen, Wiederholung der Kernaussage)
zentrale Aussage
erkennbares Thema (durch Umgangssprache)
ein Thema
Argumentation nicht nachvollziehbar
persönlich (abstraktes, aber jeden betreffendes Thema)
Form:
präzise/knapp formuliert
einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: dozierend, Zuhörer durch Armbewegung einbeziehend Tonfall ruhig, souverän, sorgfältig formuliert, variabel
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag
Sprecher sympathisch
Rb 2 (,,Darum geht's") Inhalt:
Unverständlich (Argumentation nicht nachvollziehbar, keine Abgrenzung von Sinneinheiten) keine zentrale Aussage
kein erkennbares Thema (keine klare Aussage, nur erläuternde Ergänzung zum Dozenten) ein Thema (?)
keine nachvollziehbare Argumentation
eher sachlich (an kurzem Beispiel versucht, generelle Theorie zu erklären)
Form:
ausladend, ausschweifend einfache Sprache
flüssig
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: Auf Dozent bezogen, befangen, aber entschlossen Tonfall: monoton, einlullend
persönlicher Eindruck:
interessant
Sprecherin sympathisch
analysierendes Fazit: zwiespältig bewertet, Aussage unklar. Fazit positiv.
Rb 3 (,,New Economy")
Inhalt:
sachlich, informiert, anfangs klar, später konfus
verständlich (Kernaussage zuerst, Rest war verwirrend und unnötig) zentrale Aussage
erkennbares Thema (Kernaussage /Argument zu Anfang, dann Erläuterung) ein Thema
Argumentation nicht nachvollziehbar
sachlich (lange Schachtelsätze, unpersönliche Wortwahl, bemüht wissenschaftlich)
Form:
präzise/knapp formuliert komplexe Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: ruhig, unmerklich, konzentriert
Tonfall relativ monoton, deutliche Artikulation, Hochdeutsch
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag Sprecher sympathisch
Rb 4 (,,Chef")
Inhalt:
,,Total gelabert", Ausschweifend und überflüssig
unverständlich (keine Aussage erkennbar, nur ausschweifende Erläuterung des
bekannten Sachverhaltes mit blöden Beispielen)
keine zentrale Aussage
kein erkennbares Thema (keine Aussage, Gedanken- und Satzsprünge, durch
,,Gesprächsduell" mit Dozent gegen Ende nervende Vagheit)
[kein Thema]
Argumentation nicht nachvollziehbar
persönlich (Alltagsbeispiel, einfacher Satzbau und Sprache, dialogisch) Form:
ausladend/ ausschweifend formuliert einfache Sprache
stockender / unsicherer Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: mit Armen rudernd, nervös, hektisch Tonfall ungleichmäßig, abgehackt, teilweise Wortfetzen
persönlicher Eindruck:
uninteressanter Beitrag
Sprecherin unsympathisch
Auffälligkeiten bei der Bewertung generell: Kopplung9 von:
- [Beiträge interessant] & [Sprecher sympathisch]
- [Flüssige Sprache] & [Beiträge interessant, Sprecher sympathisch]
- [zentrale Aussage], [erkennbares Thema], [Verständlichkeit] & [präzise Formulierung]
Generell10 :
- [Argumentation nicht nachvollziehbar] Narratives Interview
Er kennt ,,Labern" gut. (Gibt zu, es früher in der Schule auch gemacht zu haben -> ,,Alle hingen an den Lippen, beeindruckt, Lehrerin: Und was wolltest Du jetzt damit sagen?")
Bedeutung/Formen:
Nicht auf den Punkt kommen; nicht zum Ende kommen; Bekannte Sachverhalte neu und evtl. unklar formulieren; Persönliche Beispiele; mit einem Punkt anfangen, dann wirds unklar; am Anfang selbst nicht wissen, worauf man hinaus will (-> Rb 3).
Gezeigt Beiträge: Rb 4 als ,Labern', sehr negativ; implizit auch Beitrag 3
Auswertung /AN/
Rb 1 (,,Haste was, biste was")
Inhalt:
verständlich (im Rahmen einer Einführung ins Thema, es gab eine These, aber keine
konkrete Frage)
zentrale Aussage
erkennbares Thema (Thema ja - Fragestellung nein, wg. Schlagworten) mehrere Themen
Argumentation nachvollziehbar
sachlich (Trotz direkter Anrede an die Zuhörer ging es um eine generelle These mit
allgemeinen Beispielen)
Form:
ausladend/ausschweifend formuliert komplexe Sprache
stockender Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: direkt auf Zuhörerschaft gerichtet, starke Mimik, Hände/Arme
zaghaft fließend
Tonfall kurze, melodiöse Stimmbögen
persönlicher Eindruck:
uninteressanter Beitrag Sprecher sympathisch
Rb 2 (,,Darum geht's") Inhalt:
unverständlich (Anschluss an vorhergehenden Beitrag schlecht verknüpft) zentrale Aussage
kein erkennbares Thema (insgesamt unverständlich, wg. Blitz- oder Schlaglichtartigkeit) ein Thema
nicht nachvollziehbare Argumentation
eher sachlich (obwohl eine Meinung geäußert wurde, war es allgemein gemeint)
Form:
knapp (inhaltlich) formuliert einfache Sprache
flüssig
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: unauffällig Tonfall: etwas beleidigt
persönlicher Eindruck:
uninteressant
Sprecherin unsympathisch
Rb 3 (,,New Economy")
Inhalt: verständlich (deutlich abgeschlossene Sätze, verständliches Beispiel) zentrale Aussage
erkennbares Thema (wg. Verständlichkeit) ein Thema
Argumentation nachvollziehbar
sachlich (Allgemeingültigkeit, kein alltägliches Thema)
Form:
präzise
einfache Sprache flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: unauffällig, sehr reduziert, steif Tonfall: klare Stimme, gute Betonung
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag Sprecher sympathisch
Rb 4 (,,Chef")
Inhalt:
verständlich (relativ klar formuliert aber ohne Anbindung an vorhergehende Beiträge) zentrale Aussage
erkennbares Thema (da verständlich) ein Thema
Argumentation nachvollziehbar sachlich (Allgemeingültigkeit)
Form:
ausladend/ ausschweifend formuliert einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: einfach, aber die Aussage unterstützend Tonfall etwas zurückhaltend
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag
Sprecherin sympathisch
Auffälligkeiten bei der Bewertung generell:
Kopplung:
[Verständlichkeit], [Sympathie], [erkennbares Thema], [nachvollziehbare Argumentation] [einfache Sprache], [flüssige Sprache] & [ein Thema]
Generelle Bewertungen:
- [zentrale Aussage]; [Sachlichkeit]
Narratives Interview
Eine genaue Auswertung des Interviews liegt mir noch nicht vor.
Der Befragte kennt jedoch ,Labern' und empfand am ehesten Rb 1 als ,Gelaber'.
Auswertung /DE/
Rb 1 (,,Haste was, biste was")
Inhalt:
grundlegendes, wichtiges Thema, recht abstrakt
verständlich (Vom Verlauf des Monologs recht gut nachvollziehbar) zentrale Aussage
erkennbares Thema (Schlussaussage als zusammenfassender Dozentenmonolog klar strukturiert)
mehrere Themen
Argumentation nachvollziehbar
sachlich (eher allgemein, generelle Thesen, jedoch mit einem persönlichen Beispiel)
Form:
ausladend/ausschweifend formuliert (größtenteils) einfache Sprache stockender Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: ausladende Handbewegungen, viele Kopf-/Körperdrehungen Tonfall eher monoton, schnell, aber kein ruhiger Tonfall
persönlicher Eindruck:
uninteressanter Beitrag
[keine Sympathiebeurteilung]
Rb 2 (,,Darum geht's")
Inhalt:
schwer nachvollziehbar durch abrupten Einstieg, dadurch anstrengend
unverständlich (Zusammenhang zum Vorhergesagten fehlt, Schluss sehr klar) zentrale Aussage
erkennbares Thema (,,Darum geht's", also war Struktur klar) ein Thema
nachvollziehbare Argumentation
eher persönlich (besonders Ende persönlich, da Bezug zum Beispiel deutlich wurde)
Form:
knapp /präzise formuliert einfache Sprache
flüssig
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: Viele Handbewegungen, ruhiger Körper Tonfall: Betonung einzelner Wörter, sonst ruhig
persönlicher Eindruck:
interessant
Sprecherin sympathisch
Rb 3 (,,New Economy")
Inhalt:
verwirrend
unverständlich (Formulierung und Argumentation waren nicht klar verständlich) zentrale Aussage
erkennbares Thema (Hauptaussage deutlich, ,,Drumherum" nicht; eher Schlagwörter als Sätze)
ein Thema
Argumentation nicht nachvollziehbar
sachlich (bezog sich auf Aussage des Autors)
Form:
[keine Angabe zu präzise vs. ausladend] komplexe Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: [schlecht erkennbar] wenig Bewegung Tonfall: laut, ruhig, langsam, relativ monoton
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag
Sprecher unsympathisch (besonders durch Unstrukturiertheit)
Rb 4 (,,Chef")
Inhalt:
,Laber', viele Beispiele, ausführlich verständlich (anschauliche Sprache) keine zentrale Aussage
kein erkennbares Thema (eher Gedankensammlung, die sich nicht um einen Punkt drehte) mehrere Themen
Argumentation nachvollziehbar
sachlich (Beispiele waren nicht wirklich auf Sprecherin bezogen)
Form:
ausladend/ ausschweifend formuliert einfache Sprache
stockender / unsicherer Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: viele Handbewegungen in alle Richtungen, ruhiger Körper Tonfall langsam, verständlich
persönlicher Eindruck:
uninteressanter Beitrag
Sprecherin unsympathisch
Auffälligkeiten bei der Bewertung generell:
Kopplung:
- [verständlich], [uninteressant], [mehrere Themen] & [stockend/unsicher]
- [zentrale Aussage] & [erkennbares Thema]
- [einfache Sprache] & [nachvollziehbare Argumentation]
Narratives Interview
Sie kennt Labern an der Uni.
Bedeutung/Formen:
In der Literatur: in Texten ,,es muss ja noch viel geforscht werden"
-> Aussagen relativieren, trotzdem seitenlange Texte; es kommt wenig auf Ergebnisse an.
Mündlich / in Seminaren: abgehobene Sprache; unverständlich; Aussagen sind nicht zu fassen
Gezeigt Beiträge:
Rb 4 war ,,extremes Gelaber": Gedankengang ausgeschweift, keine Aussage. Rb 3 ,,Schwafel", Hauptsache Fremdwörter.
Auswertung /HE/
Rb 1 (,,Haste was, biste was")
Inhalt:
Dozent umreist Thema, gebraucht plakative Schlagworte
verständlich (Durch Schlagworte Zusammenhang gut erklärt) keine zentrale Aussage
kein erkennbares Thema (,,Ich weiß nicht, worauf der Dozent hinaus will") ein Themen
Argumentation nachvollziehbar
persönlich (Dozent bringt Beispiele von Studenten)
Form:
ausladend/ausschweifend formuliert einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: viele Kopf- und Armbewegungen, gestenreich Tonfall: Stimme moduliert, Tonfall ändert sich, nicht monoton
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag
sympathischer Sprecher
Rb 2 (,,Darum geht's")
Inhalt:
Meinung, einbringen einer These in die Diskussion
unverständlich (Zusammenhang zu vorigen Redebeiträgen nicht klar, Thema unklar) zentrale Aussage
erkennbares Thema (These klar formuliert) ein Thema
nachvollziehbare Argumentation
eher sachlich (Beispiele aus der Praxis)
Form:
knapp /präzise formuliert komplexe Sprache
flüssig
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: kaum Gestik Tonfall: gleichbleibend kontrolliert
persönlicher Eindruck:
interessant
Sprecherin sympathisch
Rb 3 (,,New Economy")
Inhalt:
gute Anfangsthese, lässt aber stark nach
verständlich (geht auf Dozent ein, fügt Argument an) zentrale Aussage
erkennbares Thema (,Wandel des Kollektivgeistes' wird klar formuliert) ein Thema
Argumentation nicht nachvollziehbar (zu Anfang nachvollziehbar, dann immer unklarer) persönlich (Argumentation aus eigenem Gutdünken)
Form:
ausladen/ausschweifend einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: viele Armbewegungen, gestenreich Tonfall: gleichbleibend kontrolliert
persönlicher Eindruck:
uninteressanter Beitrag Sprecher sympathisch
Rb 4 (,,Chef")
Inhalt:
Meinungsvermittlung wortreich, aber nachvollziehbar
verständlich (Gegenthese zu Dozent, ausreichend präzise formuliert) zentrale Aussage
erkennbares Thema (Argumente ausreichend formuliert) ein Thema
Argumentation nachvollziehbar
sachlich (versucht sachlich, wahrscheinl. auch aus eigenem Empfinden)
Form:
ausladend/ ausschweifend formuliert einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: viele Arm- und Kopfbewegungen Tonfall: moduliert, komischer Akzent
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag
Sprecherin unsympathisch
Auffälligkeiten bei der Bewertung generell:
Kopplung:
- [zentrale Aussage] & [erkennbares Thema]
- [Verständlichkeit], [ausladende Formulierung] & [einfache Sprache]
- [nachvollziehbare Argumentation] & [interessanter Beitrag]
Generelle Beurteilung:
- [ein Thema]; [flüssige Sprache]
Narratives Interview
Eine genaue Auswertung des Interviews liegt mir noch nicht vor.
Der Befragte kennt jedoch ,Labern' und empfand besonders Rb 4 als Labern.
Auswertung /JA/
Rb 1 (,,Haste was, biste was")
Inhalt:
der typ. Prof.-Einschub; Versuch d. Einführung
verständlich (relativ gegliedert; Beispiele; Publikumsansprache) zentrale Aussage
erkennbares Thema ein Thema
Argumentation nachvollziehbar
sachlich (Hauptsächlich allgemein begründete Aussagen, Beispiele sachlich bezogen)
Form:
präzise / knapp formuliert
einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: untermalen die Rede; Sprecher wirbt somit um Aufmerksamkeit Tonfall zwischen sachl. u. freundschaftl. - vermittelnd
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag Sprecher sympathisch
Rb 2 (,,Darum geht's")
Inhalt:
engagiert; bemüht; unverständlich
unverständlich (Zusammenhang unklar; Einordnung des Beispiele? Inhalt ungeordnet) keine zentrale Aussage
kein erkennbares Thema mehrere Thema
Argumentation nicht nachvollziehbar
sachlich (Versuch der Begriffsbestimmung; Gesamtges. Beispiele)
Form:
knapp /präzise formuliert einfache Sprache
flüssig
Paraverbalie n:
Gestik/Körperhaltung: pausenfüllend; hinterm Tisch versteckt Tonfall: ein wenig quakig, zurückhaltend, trotzdem bestimmt?
persönlicher Eindruck:
uninteressant
Sprecher unsympathisch
Rb 3 (,,New Economy")
Inhalt:
Sicher, flüssig, guter Beitrag
verständlich (klare These, Zusammenhang. zum Text, klar geordnet) zentrale Aussage
erkennbares Thema ein Thema
Argumentation gut nachvollziehbar
sachlich (Argumentation gg. bekannten Text; Beispiele aus gesamtges. Kontext)
Form:
präzise / knapp formuliert einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: untermalend; schwer zu erkennen
Tonfall: leichter Berliner-Akzent - wirkt immer bisschen doof
persönlicher Eindruck:
interessanter Beitrag
Sprecher unsympathisch
Rb 4 (,,Chef")
Inhalt:
ziemlich umfangreich, inhaltl. redundant, unpräzise
verständlich (flüssiger Vortrag; treffende Beispiele, nur zu lang) zentrale Aussage
Thema gut erkennbar ein Thema
Argumentation gut nachvollziehbar
sachlich (2 Beispiele; keine persönlichen Details)
Form:
ausladend/ ausschweifend formuliert einfache Sprache
flüssiger Vortrag
Paraverbalien:
Gestik/Körperhaltung: lebhaft u. suchend Tonfall lebhaft
persönlicher Eindruck:
uninteressanter Beitrag
Sprecherin unsympathisch
Auffälligkeiten bei der Bewertung generell:
Kopplung:
- [Verständlichkeit], [zentrale Aussage], [erkennbares Thema], [ein Thema] und
- [nachvollziehbarer Argumentation]
Generell:
- [sachlich], [einfache Sprache] und [flüssige Sprache] Narratives Interview
kennt ,Labern'; Bsp: Referat, in dem keine sachlichen Informationen mitgeteilt wurden, sondern nur persönliche Gefühle zum Thema
Bedeutung/Formen: Persönlich, am Thema vorbei, Wiederholungen, viel zu lang
-> es müssen einige dieser Kriterien zusammenkommen, damit es als ,Labern' bewertet wird
Gezeigt Beiträge:
kein Beitrag wurde als Gelaber empfunden
,,In Geisteswissenschaften seien Diskussionen etc. normal, man neige aber dazu nach einer einzigen Wahrheit zu suchen, und dass sei in diesen Bereichen gar nicht nötig. Als Geisteswissenschaftler solle man lernen, dass es nicht nur eine Wahrheit gibt."
[...]
1 Dies gilt zumindest für das deutsche Universitätssystem und vor allem für geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer. Während in anderen Ländern Seminare in Form einer Studenten-Dozenten-Interaktion allgemein weitestgehend unbekannt sind, wird auch in Deutschland z.B. in naturwissenschaftlichen Fächern dieser Lehrmodus eher durch Vorlesungen oder aber Praxiselemente ersetzt.
2 Auch ich unterliege an dieser Stelle dem, von Wagner kritisierten, universitären
Denkschema, dass Wissenschaftlichkeit gut und Popularität minderwertig sei. Ich versuche, dies als Beweis für die These der unbewussten Anpassung an die jeweilige Kommunikationsnorm (Wagner 1992:114) zu nehmen.
3 Im hier untersuchten Fall, also die Beschreibung universitärer Kommunikationsformen durch Studenten, ist die Identifikation mit dem Untersuchungsgegenstand besonders groß. Dies hat z.B. den Vorteil, dass teilnehmende Beobachtung problemlos möglich ist, man ,sein eigener Informant' ist und Teilnehmerkategorien sofort verständlich sind, andererseits ist es schwieriger, zu einem neutralen und nicht zu sehr von der eigenen Meinung geprägten Ergebnis zu kommen.
4 vergl. hierzu die unter 2.1. besprochene Thematik der Wissenschaftssprache.
5 Die Redebeiträge wurden nach einer kurzen Einführung in den Kontext des jeweiligen Beitrages isoliert gezeigt und auf Wusch ein oder zweimal wiederholt, um akustisches Verständnis sicherzustellen.
6 Diese diametralen Antworten wurden später von einigen Testpersonen kritisiert. Einerseits sind sie hilfreich, um bei der Auswertung zu relativ klaren Ergebnissen zu kommen, andererseits werden so extreme Ausprägungen eines Phänomens gleichgesetzt mit nur leichten Tendenzen. Ob skalierte Antwortmöglichkeiten also ein anderes Bild gezeichnet hätten, ist unklar.
7 Diese geringe Teilnehmerzahl rechtfertigt keine generellen Aussagen, lässt jedoch Tendenzen feststellen.
8 Ursprünglich wurden die Testpersonen mit einem Buchstaben-Zahlen-Code versehen, der sich aus den jeweils ersten Buchstaben des Vornamens von Mutter und Vater, der Strasse und des Geburtsortes, außerdem dem Alter und dem Geschlecht (M/W) zusammensetzte. Für die Auswertung zeigte sich dieser Code jedoch als zu unübersichtlich, so dass die Personen nun wieder lediglich nach den ersten beiden Buchstaben ihres Vornamens gekennzeichent sind.
9 Die jeweils angegebenen Antworten traten immer in Verbindung auf, d.h. z.B. wenn der Beitrag als interessant bezeichnet wurde war der Sprecher sympathisch, wenn der Sprecher als unsympathisch bezeichnet wurde, war auch der Beitrag uninteressant.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine Analyse universitärer Kommunikationsformen, insbesondere des Phänomens des "Laberns" (umgangssprachlich für "viel reden, wenig sagen") in Seminaren. Er untersucht Merkmale wissenschaftlicher Sprache, zitiert wissenschaftliche Meinungen, beschreibt Methoden der Kommunikationsethnographie und stellt eine eigene Analyse mit Fragebogen und Strukturdiagrammen vor.
Was sind die Hauptmerkmale wissenschaftlicher Sprache laut dem Text?
Laut zitierten Autoren wie Wolf Wagner und Helmut Seiffert zeichnet sich wissenschaftliche Sprache oft durch Unpersönlichkeit (Verwendung von "man" oder "wir" statt "ich"), komplizierte Satzstrukturen, Verwendung von Konjunktiven zur Distanzierung und unnötige Fremdwörter aus. Oft hat die Form Vorrang vor dem Inhalt, und die Sprache dient dazu, zu imponieren und sich von anderen abzugrenzen.
Wer sind die zitierten Kritiker des universitären Redestils?
Der Text zitiert Kritiker wie Klaus Laermann, Kurt Tucholsky (unter dem Pseudonym Ignaz Wrobel), Wolf Wagner und Helmut Seiffert. Diese Autoren kritisieren unter anderem inhaltsleeres "Gefasel", übermäßigen Gebrauch von Fremdwörtern und eine unnötig komplizierte Sprache.
Welche Methoden wurden in der eigenen Analyse verwendet?
Die Analyse basiert auf ethnographischen Methoden der Kommunikationsforschung. Sie umfasst:
- Seminarprotokolle und Vorumfragen
- Videoaufzeichnung einer Seminarsitzung
- Strukturelle Analyse ausgewählter Redebeiträge (mittels Strukturdiagrammen)
- Fragebogenerhebung mit anschließenden Interviews zur subjektiven Wahrnehmung der Redebeiträge.
Was ist das Ergebnis der Analyse zum "Labern"?
Die Analyse zeigt, dass die Wahrnehmung von "Labern" stark subjektiv ist und vom Zuhörer abhängt. Es wurden zwei Arten von "Labern" unterschieden: "komplexes Labern" (mit vielen Fremdwörtern und komplizierten Sätzen) und "ausschweifendes Labern" (mit Wiederholungen und unklaren Worten). Generell scheint ausschweifende Formulierung ein zentrales Merkmal zu sein. Unklar bleibt, ob eine negative Bewertung des Beitrags die Ursache oder die Folge der Wahrnehmung als "Gelaber" ist.
Was sind die möglichen Forschungsansätze die in der Analyse angegeben werden?
Der Text schlägt vor, weitere Untersuchungen zu den Paraverbalien (Gestik, Tonfall), den Einfluss des "Dozenten-Bonus" (also eine unkritischere Haltung gegenüber Dozenten) und die Wahrnehmung von "Labern" durch verschiedene Gruppen (Studenten vs. Nicht-Studenten, Geisteswissenschaftler vs. Naturwissenschaftler) durchzuführen.
Was ist die Definition der Ethnographie der Kommunikation?
Die Ethnographie der Kommunikation beschäftigt sich mit kontextspezifischen Sprechweisen, das heißt, wie wird wo über was gesprochen.
Was sind die erwähnten kommunikativen Normen der Ethnographie?
Es gibt drei: (1) soziale Situation (communicative situation), also dem Kontext einer Kommunikation; (2) soziales Ereignis (communicative event), der unmittelbaren Kommunikationsart; und (3) kommunikativem Akt (communicative act), also dem einzelnem verbalen oder auch nonverbalen Interaktionsbeitrag.
- Citation du texte
- Karin Becker (Auteur), 2001, "Labern" als sprachlicher Code der Universität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106233