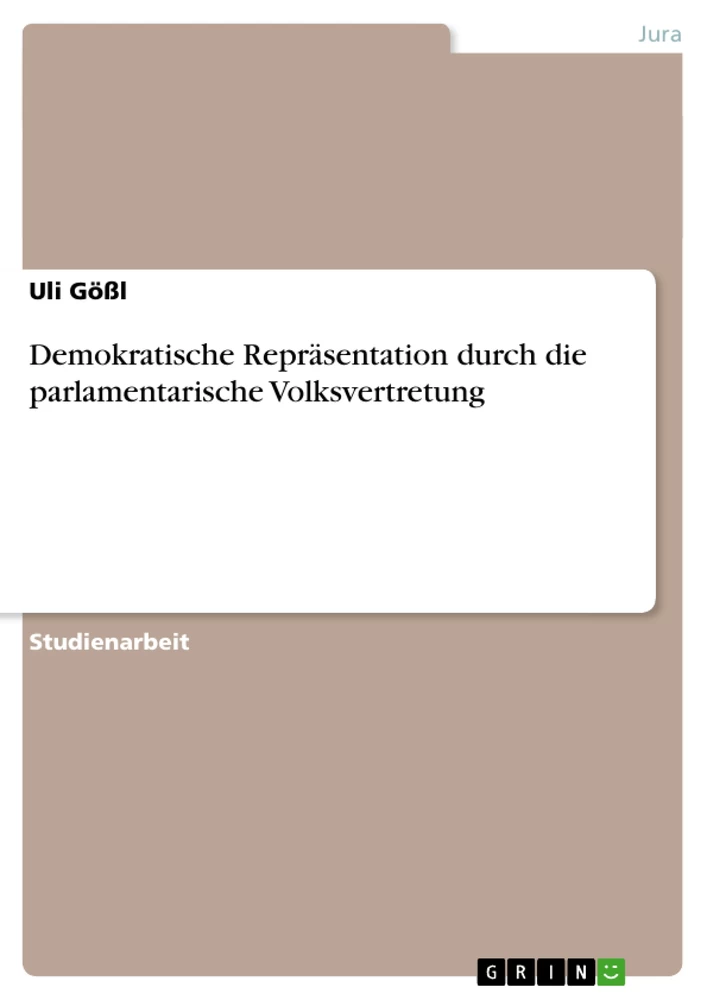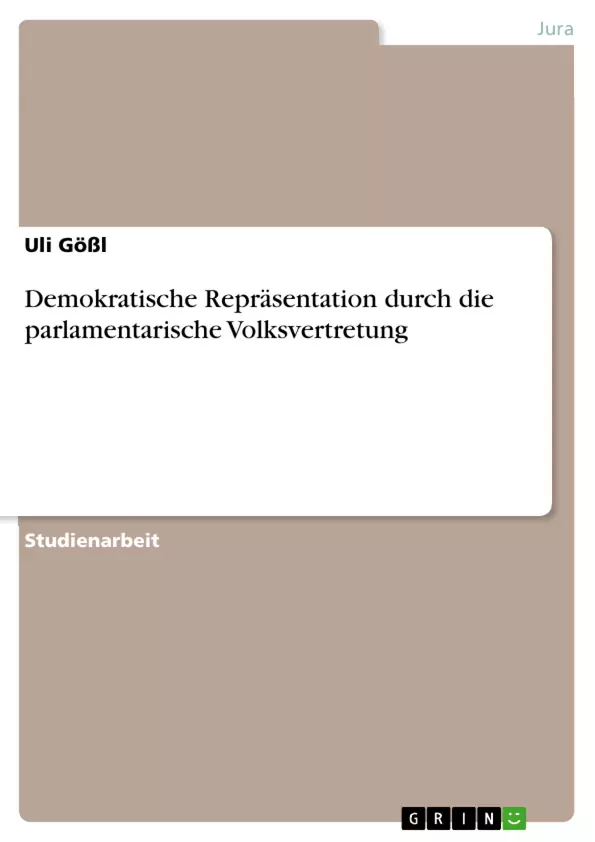Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Macht des Volkes nicht nur eine leere Worthülse ist, sondern ein lebendiges, atmendes Prinzip, das die Grundfesten der Gesellschaft formt. Dieses Buch ist eine fesselnde Reise durch die Geschichte und Theorie der parlamentarischen Demokratie, von ihren bescheidenen Anfängen in den Ständeversammlungen des Mittelalters bis hin zu den komplexen, vielschichtigen Systemen, die heute unsere modernen Nationalstaaten prägen. Untersuchen Sie die intrigenreiche Entwicklung des Parlamentarismus im Spannungsfeld zwischen Regierung und Parlament, beleuchtet durch historische Schlüsselmomente wie die Magna Carta und die Französische Revolution. Tauchen Sie ein in die feinen Unterschiede zwischen unmittelbarer und mittelbarer Demokratie, analysieren Sie die Vor- und Nachteile beider Modelle und hinterfragen Sie, inwieweit das Ideal der Volkssouveränität in der Realität tatsächlich verwirklicht wird. Entdecken Sie die fundamentalen Wahlrechtsgrundsätze, die die Basis für freie und faire Wahlen bilden, und setzen Sie sich kritisch mit den verschiedenen Wahlsystemen auseinander, einschliesslich ihrer verfassungsrechtlichen Probleme wie Überhangmandate und Sperrklauseln. Erfahren Sie mehr über die zentrale Rolle politischer Parteien im demokratischen Prozess, ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten, aber auch die Gefahren der Oligarchisierung und des Machtmissbrauchs. Verstehen Sie die Bedeutung des Mehrheitsprinzips als Entscheidungsfindungsinstrument in der Demokratie und seine Grenzen im Rechtsstaat. Schliesslich wird die Frage erörtert, ob und inwieweit plebiszitäre Elemente eine sinnvolle Ergänzung zur parlamentarischen Repräsentation darstellen können, wobei sowohl die Argumente für als auch gegen Volksentscheide und Referenden sorgfältig abgewogen werden. Dieses Buch ist ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ein tiefes Verständnis der parlamentarischen Demokratie und ihrer Herausforderungen suchen, sei es als Student der Politikwissenschaft, interessierter Bürger oder politisch engagierter Aktivist. Es wirft ein helles Licht auf die Mechanismen der Macht, die Bedeutung der Repräsentation und die fortwährende Suche nach einer gerechteren und partizipativeren Gesellschaft, und erörtert Themen wie Volkssouveränität, Wahlrecht, politische Parteien, Mehrheitsprinzip, Rechtsstaatlichkeit und plebiszitäre Demokratie.
Inhaltsverzeichnis
1. Geschichtliche Entwicklung der parlamentarischen Repräsentation
2. Abgrenzung der parlamentarischen von der plebiszitären Demokratie
2.1. Die unmittelbare oder plebiszitäre Demokratie
2.2. Die mittelbare oder parlamentarische Demokratie
3. Die Wahlen zur parlamentarischen Volksvertretung
3.1. Die Wahlrechtsgrundsätze
3.2. Wahlsysteme
3.3. Verfassungsrechtliche Probleme des geltenden Wahlrechts
4. Der Status und die Aufgabe der politischen Parteien
5. Das Mehrheitsprinzip
6. Plebiszitäre Ergänzungen der parlamentarischen Repräsentation
Literaturverzeichnis
Badura, Peter:
Die parlamentarische Demokratie, in Issensee/Kirchhof (Hrsg.) HdStR II, S. 953 - 985, 1987
Badura, Peter:
Staatsrecht - Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 2. Auflage, 1996
Bleckmann, Albert:
Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 1. Aufflage, 1993
Böckenförde, Ernst - Wolfgang:
Demokratie als Verfassungsprinzip, in Issensee / Kirchhof (Hrsg.) HdStR II, S. 887 - 952
Böckenförde, Ernst - Wolfgang:
Demokratische Willensbildung und Repräsentation, in Isensee / Kirchhof (Hrsg.) HdStR I, S. 29 - 48.
Degenhart, Christoph:
Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht, 15. Auflage, 1999
von Danwitz, Thomas:
Plebiszitäre Elemente in der staatlichen Willensbildung, DÖV 1992, S. 601 - 608
Hoppe, Werner:
Verfassungswidrigkeit der Grundmandatsklausel, DVBl 1995, S. 265 - 280
Hesse, Konrad:
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 19. Auflage, 1993
Karpen, Ulrich:
Plebiszitäre Elemente in der repräsentativen Demokratie?; JA 1993, S. 110 - 114
Katz, Alfred:
Staatsrecht, 14. Auflage, 1999
Kluxen, Kurt:
Geschichte und Problematik des Parlamentarismus, 1983
Krause, Peter:
Verfassungsrechtliche Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie, in Isensee / Kirchhof (Hrsg.) HdStR III, § 39
Maurer, Hartmut:
Staatsrecht - Grundlagen, Verfassungsorgane, Staatsfunktionen, 1. Auflage, 1999
Meyer, Hans:
Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, in Issensee / Kirchhof (Hrsg.) HdStR I, § 38
Papier, Hans - Jürgen:
Überhangmandate und Verfassungsrecht, JZ 1996, S. 265 - 274
Zippelius, Reinhold:
Die rechtsstaatliche parlamentarische Demokratie als Ergebnis geisesgeschichtlicher Lehren, JuS 1987, S. 685 - 689
Zippelius, Reinhold:
Allgemeine Staatslehre, 13. Auflage, 1999
1. Geschichtliche Entwicklung der parlamentarischen Repräsentation
Historisch hat sich der Parlamentarismus aus dem Gegensatz zwischen Regierung und Parlament entwickelt, vor allem aus dem Gedanken, die Regierung unter die Kontrolle eines Parlaments zu bringen. Die geschichtliche Grundlage ist die Entwicklung der Nationalstaaten, vor allem in England und Frankreich, in deren Fortgang eine Vertretung der „Nation“ in einer Nationalrepräsentation zum Hauptstück der verfassungsrechtlichen Bindung der monarchistischen Herrschaftsgewalt wurde.1
Als erste Entwicklungsstufe des Parlamentarismus gelten die Ständeversammlungen, deren Anfänge bis ins spätere Mittelalter zurückreichen.2 Nach damaligem Recht besaß der Monarch nur einzelne Hoheitsrechte, sogenannte Regalien, die durch einen besonderen Rechtstitel legitimiert sein mussten. Die freie Steuererfindung zählte nicht dazu. Wollte er also Zugeständnisse finanzieller Art, die nicht schon in den Lehensverpflichtungen lagen, benötigte er dazu die Zustimmung der Stände. Die Stände bestanden nur aus Vertretern des Adels, der Geistlichkeit und Bürgern.
In der Folgezeit sollte die Entwicklung in Großbritannien und auf dem Kontinent unterschiedlich verlaufen. Insbesondere in Frankreich hatte sich der Fürst, gestützt auf das von Bodin entwickelte Souveränitätsprinzip des Absolutismus, von der Notwendigkeit einer Zustimmung durch die Stände befreien können. In Großbritannien ging dagegen die Ständeversammlung fast kontinuierlich in die modernen Formen der Demokratie über.3
In England wurde Grundsatz des Steuerbewilligungsrechts der Stände in der Magna Carta im Jahre 1215 bestätigt; bald darauf wurde jedoch eine weitere Kontrolle der Regierung beansprucht.4 Ein wichtiger Schritt in Richtung Demokratisierung war die Erweiterung der parlamentarischen Basis. Edward I. berief in das Parlament von 1268 auch Vertreter der Cities (=Städte) und Boroughs (=Flecken);5 sie bildeten ein gewisses Gegengewicht zu den Lords und zeigten die Anfänge demokratischer Repräsentanz. Im Zusammenhang damit begann sich die Zweiteilung des Parlaments herauszubilden: dem House of Lords und dem House of Commons, dem die Gesetzesinitiative zuwuchs.6 Der Einfluss der Commons war zwar anfangs gering, dennoch war es ein grosser Schritt, dass die Repräsentanten breiter Bevölkerungsschichten, anstatt Zuflucht zu Aufständen nehmen zu müssen, ein gesetzliches und reguläres Mittel erlangt hatten, den Gang der Regierung zu beeinflussen.7 Im 17. Jahrhundert versuchten Jakob I. und später sein Sohn, Karl I. nach kontinentalem Vorbild eine absolutistische Herrschaftsweise durchzusetzen und stießen dabei auf den Widerstand des Parlaments. Dem Souveränitätsanspruch des Monarchen hielt der Chief Justice Sir Edward Coke die Rule of Law - die These vom Supremat des Rechts - entgegen.8 Das ist eine frühe Fassung des „Vorrangs des Gesetzes“ vor den Befugnissen der Exekutive, der heute zu den klassischen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit gehört. In den fortlaufenden Auseinandersetzungen zwischen König und Parlament setzte sich die Vorstellung durch, dass der Einzelne in seiner religiösen Gewissensentscheidungen keiner staatlichen Bevormundung untersteht. Dieser Anspruch auf Glaubensfreiheit bildete einen frühen Kristallisationspunkt für die Idee allgemeiner Menschenrechte, d.h. für den Gedanken, dass es eine unantastbare Individualsphäre gebe, über die die Staatsgewalt prinzipiell nicht verfügen dürfe.9 Mit dieser Idee der individuellen Selbstverantwortung ging die nicht minder grundlegende Vorstellung einher, dass der Staat jetzt als das Ergebnis einer Übereinkunft von Individuen verstanden wurde und somit säkularisiert wurde. Diese Theorie eines Gesellschaftsvertrags wurde vor allem von John Locke und Thomas Hobbes vertreten.10 Demnach haben sich die Individuen zu einem bestimmten Zweck - der Wahrung des Friedens bei Hobbes und dem Schutz des Eigentums in einem weiten, alle Grundrechte umfassenden Sinne bei Locke - zusammengeschlossen.11 Herrschaftsgewalt sollte nicht mehr mit göttlicher Legitimation ausgeübt werden, sondern vom Volk legitimiert sein.12 Die Regierungsform blieb weiterhin die Monarchie, dem Volk wurde aber ein Widerstandsrecht und das Recht zur Absetzung des Fürsten eingeräumt.
Nach der Glorious Revolution wurde in der Bill of Rights 1689 als ein wesentliches Prinzip der Gewaltenteilung festgelegt, dass es unzulässig sei, kraft königlicher Autorität Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments ausser Kraft zu setzen. Im 19. und 20. Jahrhundert vollendete sich die Demokratisierung des Verfassungssystems. Das Wahlrecht war bisher an die Besitzverhältnisse geknüpft; so waren vor den Wahlrechtsreformen von 1832 nur ca. 5 % der erwachsenen Bevölkerung wahlberechtigt. Durch eine Reihe von Reformgesetzen wurde die allgemeine Wahl und schliesslich 1928 das uneingeschränkte Frauenwahlrecht eingeführt.13
In Frankreich wird der Übergang von der Ständeversammlung zur Nationalrepräsentation durch die französische Revolution binnen kürzester Zeit vollzogen. Als sich am 17. Juni 1789 der Dritte Stand - das Bürgertum - beim Zusammentreffen der Generalstände (États gènèraux) zur Nationalversammlung konstituierte, vollzog sich mit einem Schlag der Übergang von der ständischen Vertretung zur parlamentarischen Repräsentation.14 Damit war, vor allem durch den Einfluss von Emmanuel Joseph Siey è s, der Rousseau sche Gedanke einer unmittelbaren egalitären Demokratie revidiert und an seine Stelle das Modell einer repräsentativen Demokratie gesetzt.15
Jean-Jacques Rousseau war der einflussreichste Dogmatiker der Volkssouveränität. Nach seinem „contrat social“ prägt das Demokratieprinzip nicht nur die Legitimität des Staates, sondern auch den Aufbau.16 Er wollte eine Gesellschaftsform konstruieren, in der „jeder nur sich selbst gehorcht und ebenso frei bleibt, wie zuvor“. Nach Rousseaus sollte der einzelne seine Person und seinen Willen unter die Oberleitung eines allgemeinen Willens stellen. Der einzelne ist also aktiver Teilhaber an der staatlichen Willensbildung und zugleich Untertan dieses Staatswillens.17 Diesem Ideal entspräche am ehesten das Modell einer allzuständigen unmittelbaren Demokratie, bei der Beschlüsse in einer Volksversammlung gefasst werden. Dieses Modell erscheint angesichts der Weiträumigkeit und Komplexität der modernen Wirtschafts- und Sozialstrukturen heute als utopisch. Aber auch abgesehen von den praktischen Erwägungen, die gegen die unmittelbare Demokratie sprechen, wäre das Ideal der Selbstbestimmung nicht zu verwirklichen. Denn selbst in einer unmittelbaren Demokratie wäre es nicht zu umgehen, dass die Minderheit sich dem Willen der Mehrheit unterwirft. Rousseau erkannte dieses Problem und versuchte es durch eine fragwürdige Annahme wegzudiskutieren: Im Votum der Mehrheit komme der Gemeinwille (volont é g é n é rale) zum Ausdruck, der das Allgemeininteresse und damit auch den „wahren“ Willen der Minderheit definiere.18 Es ist jedoch nicht einleuchtend, warum es gerade das Privileg der Majorität sei, das wahre Gesamtinteresse zu erfassen, und dass in dem Punkte, in dem sich die Interessen der Mehrheit decken, auch die wahren Interessen der Minderheit lägen.19
Die Überspitzung der demokratischen Idee Rousseaus hatte dennoch erheblichen Einfluss auf die Verfassungen der französischen Revolution. Es wurde aber keine Demokratie mit egalitärem Wahlrecht geschaffen, denn auch die neue Verfassung sicherte die Vorherrschaft des Bürgertums in der gesetzgebenden Versammlung durch Einführung des Zensus - Wahlrechts, das die politischen Rechte an einen dreistufigen Steuerzensus band.20
2. Abgrenzung der parlamentarischen von der plebiszitären Demokratie
Der Satz „alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ Art. 20 II 1 GG drückt in einer traditionellen Formel das Prinzip der Volkssouveränität aus, das die ideelle und politische Legitimation der demokratischen Staatsform verkörpert.21 Das Prinzip der Volkssouveränität wird von dem Gedanken getragen die Herrschaft von Menschen über Menschen nicht einfach als vorgegeben hinzunehmen, sondern nach einer rechtfertigenden Herleitung (Legitimation) zu verlangen, die nur vom Volk selbst und nicht von einer Instanz ausserhalb des Volkes ausgehen kann.22 Dies bedeutet auch, dass das Volk nicht nur Ursprung und Träger der politischen Herrschaftsgewalt ist, sondern vielmehr die politische Herrschaftsgewalt auch selbst ausübt, sie aktuell innehat und innehaben soll.
Die fortdauernde Legitimation der Ausübung staatlicher Herrschaftsgewalt durch den Volkswillen kann sich in den Formen unmittelbarer und repräsentativer Demokratie vollziehen.23 In der unmittelbaren Demokratie trifft das Volk selbst alle massgeblichen Sach- und Personalentscheidungen, in der repräsentativen Demokratie wählt das Volk ein Parlament als Repräsentationsorgan, das seinerseits für das Volk handelt.24 Dabei hat die repräsentative Demokratie gegenüber der unmittelbaren den grösseren Legitimationsbedarf.
2.1. Die unmittelbare oder plebiszitäre Demokratie
Dem demokratischen Ideal der „ Identität von Regierenden und Regierten “ 25 scheint die unmittelbare Demokratie am nächsten zu kommen, in welcher das Volk die Staatsgewalt selbst handelnd ausübt.26 Doch abgesehen davon, dass eine unmittelbare Beteiligung und Präsenz des Gesamtvolkes zur gemeinsamen Entscheidungsfindung und Herrschaftsausübung in einem modernen Massenstaat nicht möglich ist,27 erweist sich die identitär - unmittelbare Demokratie auch aus anderen Gründen als Modell der eigentlichen Demokratie untauglich. Zum einen bedarf der Volkswille, der die massgeblichen Entscheidungen treffen soll, eines Verfahrens, in dem er durch Fragen den notwendigen Anstoss erhält um sich zu artikulieren. Dies hat zur Folge, dass dem Volk meist Fragen vorgelegt werden, auf deren Inhalt und Formulierung es keinerlei Einfluss hat, sodass derjenige, dem das Recht der Fragestellung zugebilligt wird, die Möglichkeit zur Beeinflussung des Volkswillens erhält.28 Ein zweiter Kritikpunkt ergibt sich aus der Pluralismustheorie der Demokratie: es lässt sich eine elitäre Struktur feststellen, d.h. nur bestimmte Gruppen schöpfen die gegebenen Beteiligungsmöglichkeiten aus und verleihen dadurch ihren Interessen vorrangige Bedeutung im politischen Prozess.29 Der Grund liegt darin, dass das Maß an Engagement, das ein identitär - direktdemokratisches Staats- und Regierungsmodell an die zu permanenten Entscheidungsträgern gewordenen Bürgern voraussetzt, nicht bei allen gleich gross ist. Die vermeintliche Selbstregierung des Volkes ist der Idee nach die Aufhebung politischer Herrschaft, der Sache nach eine an institutionelle Vorkehrungen ungebundene Oligarchie. In den realplebiszitären Abstimmungen wird nicht im Sinne des Rousseau` schen Ideal die Herrschaft über Menschen aufgehoben, sondern die meist nicht transparente Machtausübung einer Gruppe oder einer Kombination von Gruppen ohne rechtliches Reglement praktiziert.30 Die unmittelbare Demokratie ist also nur die theoretische Vorstellung einer Volksherrschaft ohne Staat.31
2.2. Die mittelbare oder parlamentarische Demokratie
Demokratie als Staatsform kann also nicht im Sinne des Modells unmittelbarer Demokratie konzipiert werden. Soll Demokratie eine Form politischer Herrschaft und eine Form der Herrschaftsorganisation darstellen, muss sie unter allen Umständen auch eine Entscheidungs- und Wirkungseinheit bilden und ein System relativer Willensvereinheitlichung hervorbringen.32 Der politische Willen des Volkes muss durch bestimmte Leitungs- und Willensbildungsorgane kanalisiert und transformiert werden.33 Dies geschieht in der parlamentarischen Demokratie durch eine gewählte und zur selbstverantwortlichen Entscheidung berufene Volksvertretung. Da eine herrschaftslose Organisation der Gesellschaft nicht möglich ist, ist Demokratie als Staatsform somit notwendigerweise die mittelbare oder repräsentative Demokratie und nicht nur eine technische Notlösung anstelle der erstrebenswerten und praktisch nicht durchführbaren unmittelbaren Demokratie.34 In der repräsentativen Demokratie folgt die Zustimmung zur Herrschaft nicht aus eigenem Sein oder besonderen Qualitäten, sie folgt aus der Anerkennung und Zustimmung der Beherrschten, ist ein erteilter und widerruflicher Auftrag. Die „ Identität von Herrschern und Beherrschten “ 3 5 liegt also darin, dass es keine qualitative Verschiedenheit zwischen beiden Gruppen gibt. Wer heute Regierender ist kann morgen wieder Regierter sein, er verlässt die Basis der demokratischen politischen Gleichheit nicht.36
Parlamentarische Repräsentation ist also ein die Verwirklichung der Volkssouveränität näher bestimmendes Verfassungsprinzip. Die Repräsentanten müssen demokratisch legitimiert sein, sich einem offenen Prozess demokratischer Willensbildung unterwerfen sowie an Verantwortlichkeit und demokratische Kontrolle gebunden sein, damit ihr Handeln für das Volk und im Namen des Volkes gelten kann.37 Die formale Repräsentation gewährleistet das politische Prinzip der Anerkennung der Gesetze und sonstigen Entscheidungen, die nach den Regeln der Verfassung von der gewählten Volksvertretung verabschiedet werden. Die inhaltliche Repräsentation stellt darauf ab, dass in einem wie auch immer vom Volk autorisierten und legitimierten Handeln inhaltlich der Volkswille zur Darstellung kommt.38 Dabei ist nicht eine tatsächlich bestehende Übereinstimmung des natürlichen Willens der einzelnen Mitglieder des Staatsvolkes mit den Entscheidungen der Volksvertretung erforderlich; eine Übereinstimmung muss nur möglich sein und wird gewährleistet durch die legitimierende Kraft der periodisch stattfindenden Wahlen.39
Da nach dem Prinzip der Volkssouveränität die Trägerschaft der Staatsgewalt unmittelbar beim Volk liegt, sie aber vom Volk nur in den verfassungsrechtlich vorgesehenen Artikulationsweisen, nämlich in Wahlen und Abstimmungen und durch die besonderen Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt wird, müssen diese Organe mittelbar oder unmittelbar legitimiert sein.40 Die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben und die Ausübung staatlicher Befugnisse bedarf einer Legitimation, die auf das Volk selbst zurückgeführt werden muss bzw. von ihm ausgeht.41 Demokratische Legitimation heisst also, dass Äusserungen der Staatsgewalt ihren Ausgangspunkt im Willen des Volkes haben und durch das Volk begründet und gerechtfertigt sein müssen. Sie bildet das Verbindungsglied, das das Volk mit dem die Staatsaufgaben wahrnehmenden Staatsorganen verknüpft.42 Ziel der demokratischen Legitimation ist es, einen effektiven Einfluss des Volkes auf die Ausübung der Staatsgewalt zu bewirken und sicherzustellen. Der Grundsatz der personellen demokratischen Legitimität verlangt, dass alle Organe und Amtsträger ihre Berufung - vermittelt durch jeweils ihrerseits demokratisch legitimierte Organe - auf das Volk zurückführen können, dass - anders betrachtet - „eine ununterbrochene Legitimationskette vom Volk über die von diesem gewählte Vertretung zu den mit staatlichen Aufgaben betrauten Organen und Amtswaltern“ besteht.43 Der Bundestag wird also durch die Wahlen unmittelbar demokratisch legitimiert; die weiteren Organe leiten ihre demokratische Legitimation vom Parlament ab.44 Die materielle demokratische Legitimation stellt auf den Inhalt der Staatstätigkeit ab und verlangt für diese eine rechtfertigende Grundlage im Volk.45 Um die Legitimation vom Volk zu erreichen müssen grundsätzlich die personelle und materielle Legitimationskomponente zusammenwirken.
3. Die Wahlen zur parlamentarischen Volksvertretung
Die Parlamentswahl ist der in seinen Bedingungen wie in seinem Verfahren staatlich reglementierende Akt, durch den das in Art. 20 II GG zum Ursprung aller staatlichen Gewalt erklärte Volk seinen Willen über die Zusammensetzung der Volksvertretung verbindlich kundtut.46
Damit jedoch die Wahlen zum Bundestag diesem tatsächlich demokratische Legitimation als dem Repräsentanten des Volkswillens verleihen können, müssen sie bestimmten verfassungsrechtlichen Anforderungen genügen. Diese enthält Art. 38 I 1 GG: darin kommt das demokratische Prinzip einer egalitären, freien und definitiven Mitentscheidung aller Bürger zum Ausdruck.47 Durch die Homogenitätsklausel des Art. 28 I 2 GG gilt dies für alle demokratische Wahlen.
3.1. Die Wahlrechtsgrundsätze
Allgemeinheit der Wahl bedeutet, dass die Zugehörigkeit zum Staatsvolk grundsätzlich die Fähigkeit vermittelt zu wählen oder gewählt zu werden; zu den herkömmlichen Ausnahmen zählen Altersgrenzen oder der Ausschluss vom Wahlrecht und der Wählbarkeit im Falle der Entmündigung und wegen bestimmter entehrender Straftaten.48
Die Unmittelbarkeit der Wahl besagt, dass sich zwischen Wähler und Wahlbewerber, zwischen Wahlentscheidung und Wahlergebnis keine weiteren Personen oder Entscheidungen schieben dürfen. Das bedeutet auch, dass der Wähler vor dem Wahlakt erkennen muss, wer sich um ein Mandat bewirbt und wie sich seine Stimmabgabe darauf auswirkt.49
Der Grundsatz der geheimen Wahl erfordert, dass die Wahl so durchgeführt wird, dass andere Personen nicht in Erfahrung bringen können, wie der einzelne Wähler abgestimmt hat.50 Freiheit der Wahl bedeutet, dass von niemandem, weder vom Staat noch von privater Seite, ein Zwang auf die Wahlberechtigten ausgeübt werden darf, um deren Stimmabgabe in eine bestimmte Richtung zu drängen. Während Allgemeinheit der Wahl bedeutet, dass jeder Zugang zur Wahlurne hat, bedeutet Gleichheit der Wahl, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat.51 Jede wirksam abgegebene Stimme muss denselben Zählwert und denselben praktischen Erfolgswert für die Bemessung des Wahlergebnisses haben, soweit sich nicht aus der demokratischen Funktion der Wahlen die Rechtfertigung für eine Abweichung von dieser - streng formal zu verstehenden - Wahlrechtsgleichheit ergibt.52 Die Gleichheit der Wahl verwirklicht das demokratische Prinzip im egalitären Sinn und muss deshalb im strengen Sinn formaler Gleichheit verstanden werden.53 Daher sind Ungleichheiten im Zählwert der Stimmen generell ausgeschlossen und bedürfen Ungleichheiten im Erfolgswert eines zwingenden Grundes.54
Die demokratischen Wahlrechtsgrundsätze sollen den die Legitimität der Volksvertretung vermittelnden Charakter und Erfolg des Wahlaktes gewährleisten. Sie sichern die unverfälschte und egalitäre Repräsentation und die unreglementierte Chance des Wandels durch Mehrheitsbildung.55
3.2. Wahlsysteme
Es ist die Aufgabe des Gesetzgebers diese Grundsätze zu verwirklichen, die gesetzliche Regelung hierzu finden sich im Bundeswahlgesetz (BWahlG). Besonders bei der Gleichheit, genauer bei der Gleichheit im Erfolgswert der Stimmen, treten Probleme auf. Herkömmlicherweise werden die Wahlsysteme der Mehrheitswahl und der Verhältniswahl unterschieden.
Bei der Mehrheitswahl wird das Wahlgebiet in so viele Wahl- oder Stimmkreise eingeteilt als Sitze in der Volksvertretung zu vergeben sind. Soll dabei jede Stimme annähernd gleiches Gewicht haben, muss man das Staatsgebiet in Wahlkreise mit etwa gleich grosser Einwohnerzahl einteilen. In den einzelnen Wahl- oder Stimmkreisen wird der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt.56 Das klassische Land der Mehrheitswahl ist England. Der Vorteil dieses Systems ist die engere Beziehung des Abgeordneten zu seinem Wählerkreis und damit die Stärkung seines repräsentativen Status´.57 Sein Nachteil liegt jedoch darin, dass Volksvertretung nicht exakt die politische Gliederung der Gesellschaft wiedergibt. Nimmt man als extremes Beispiel an, dass in allen Wahlkreisen die A-Partei 49% und die B-Partei 51% der Stimmen erhalten hätte, so wäre nach dem Mehrheitswahlrecht die A- Partei nicht im Parlament vertreten, obwohl sie 49% der Stimmen auf sich vereinigt hätte.58
Um die im Volke herrschenden politischen Auffassungen getreu wiederzugeben, braucht man ein Wahlsystem, nach welchem die Parteien im Parlament in dem Verhältnis vertreten sind, in dem sie Wählerstimmen errungen haben. Bei der Verhältniswahl muss der Wähler zwischen mehreren von politischen Parteien vorgeschlagenen Listen von Bewerbern entscheiden. Das Wahlergebnis, d.h. die Sitzverteilung im Parlament, bemisst sich nach der proportionalen Verteilung der abgegebenen Stimmen auf die konkurrierenden Listenwahlvorschläge.59 Das Verhältniswahlsystem projiziert die in der Wahl zum Ausdruck kommenden politischen Auffassungen verhältnismässig ins Parlament.
Im Grundgesetz findet sich keine Festlegung für eines der beiden Systeme,60 es steht dem Gesetzgeber also frei welches System er wählt, solange er die Wahlrechtsgrundsätze des Art. 38 I 1 GG verwirklicht. Das geltende Wahlrecht kombiniert Verhältnis- und Mehrheitswahl, man spricht von einer personalisierten Verhältniswahl.61 Dabei wird wie folgt verfahren: in den einzelnen Bundesländern wird jeweils die Hälfte der 598 Abgeordneten direkt in den Wahlkreisen gewählt, und zwar durch die Mehrheit der Erststimmen, die andere Hälfte über Landeslisten mit den Zweitstimmen § 1 I 1 BWahlG.62 Landeslisten können nur von Parteien eingereicht werden, die Landeslisten der gleichen Parteien gelten als verbunden. Die für verbundene Listen abgegebenen Zweitstimmen werden zusammengezählt. Die Gesamtzahl der Mandate wird nach dem Verhältnis der Zweitstimmen aufgeteilt und auf die einzelnen Listen unterverteilt § 7 III 1 BWahlG, wobei nur Parteien berücksichtigt werden, die mindestens 5 % der Zweitstimmen oder drei Direktmandate erhalten haben. Dabei werden die in diesem Land erworbenen Direktmandate angerechnet, die verbleibenden Mandate aus der Landesliste besetzt § 6 IV BWahlG.
Da den Parteien die direkt erworbenen Mandate in jedem Fall verbleiben, kann es vorkommen, dass sie in einem Bundesland mehr Direktmandate erringen, als ihnen eigentlich nach dem Verhältnis der Zweitstimmen bei der Unterverteilung der Mandate auf die Landeslisten zuständen. Durch diese sog. Überhangmandate erhöht sich die Gesamtzahl der Mandate des Bundestags § 7 III 2 iVm § 6 V BWahlG.63
2.3. Verfassungsrechtliche Probleme des geltenden Wahlrechts
Die zunehmende Zahl der Überhangmandate in den letzten Wahlen verstärkte auch die Diskussion über ihre Verfassungsmässigkeit.64 Durch die Erhöhung der Gesamtzahl der Bundestagsabgeordneten ist die Erfolgswertgleichheit der Stimmen nicht mehr gewährleistet. Das BVerfG hat in einer knappen Entscheidung die Verfassungsmässigkeit der Überhangmandats - Regelung mit der Begründung bejaht, dass es sich hierbei um eine zulässige Konsequenz der Elemente des Persönlichkeitswahlrechts handle,65 dessen Anliegen, die persönliche Beziehung des Abgeordnetem zu seinem Wahlkreis, die Differenzierung der Erfolgswertgleichheit der Stimmen legitimiere.66 In der Literatur wird teilweise die Erhaltung der errungenen Direktmandate gefordert, nicht aber den Anfall von Überhangmandaten ohne gleichzeitigen Verhältnisausgleich über die Landeslisten.67 Doch dadurch würde für die Parteien der Anreiz für verstärkte Politik vor Ort und grössere Bürgernähe verloren gehen.68
Die 5 % Sperrklausel des § 6 VI 1 1. HS BWahlG ist der gravierendste Eingriff in das Verfassungsrecht auf gleiche Wahl, da zwar alle Stimmen den gleichen Zählwert, aber nicht den gleichen Erfolgswert haben. Der besondere rechtfertigende Grund hierfür liegt im Schutz der Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Parlaments.69 Es soll verhindert werden, dass sich das Parlament in viele Gruppen und Grüppchen zersplittert, was der Bildung entscheidungskräftiger Regierungen abträglich ist.70 Die Sperrklausel beeinträchtigt die Chancen kleiner und vor allem neuer Parteien erheblich; der Aufstieg der Grünen zeigt jedoch, dass sie einer Veränderung der Parteienlandschaft nicht im Wege steht.
Direkt erworbene Mandate verbleiben der Partei jedoch in jedem Fall. Hat aber eine Partei drei Direktmandate errungen, so gilt nach der Grundmandatsklausel für sie die 5 % Sperrklausel nicht § 6 VI 1 2. HS BWahlG; diese Partei nimmt an der Verteilung der Mandate nach dem Verhältnis der Zweitstimmen über die Landeslisten teil.71 Angesichts des Zwecks der 5% Sperrklausel - Bildung stabiler Mehrheiten - erscheint diese Regelung kontraproduktiv, da sie gerade kleinen, unter 5% liegenden Splitterparteien den Zugang wieder verschafft.72 Der Grund hierfür liegt nach Ansicht des BVerfG darin, dass der Gesetzgeber die besondere politische Kraft einer Partei und die Billigung der politischen Anliegen der Partei, die in der Wahl von 3 Direktmandaten zum Ausdruck komme, berücksichtigen dürfe.73 Ausserdem handle es sich um Parteien mit regionalen Schwerpunkten, die in ihren räumlichen Bereichen eine grössere Bevölkerungsgruppe repräsentierten.74 Der Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit des Parlaments tritt nach der Ansicht des BVerfG gegenüber dem Grundsatz der Integrationsfunktion der Wahl zurück.
4. Der Status und die Aufgabe der politischen Parteien
Um überhaupt von Wahlen sprechen zu können, muss eine echte Auswahl, Wahlmöglichkeit unter mindestens zwei Alternativen gegeben sein. Dies kommt auch im Verfassungsprinzip des Pluralismus zum Ausdruck, das die Anerkennung der politischen Vielfalt von Meinungen und Interessen, wie sie organisatorisch in den politischen Parteien und in den Verbänden oder Interessengruppen in Erscheinung tritt, fordert.75 Im Gegensatz zur Weimarer Verfassung, die die politischen Parteien ignorierte,76 erkennt das Grundgesetz in Art. 21 die Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung ausdrücklich an und gewährleistet dadurch den Pluralismus des demokratischen Prozesses.77 Das Grundgesetz hat die Bildung und Betätigung der politischen Parteien nicht dem Grundrecht der Vereinigungsfreiheit Art. 9 I, II GG zugeordnet, sondern in einer verfassungsrechtlichen Grundsatzordnung institutionalisiert, d.h. in Aufgabe und Stellung objektivrechtlich bestimmt und dementsprechend mit verfassungsmässigen Rechten und Pflichten ausgestattet Art. 21 GG.78 Art. 21 GG ist insoweit lex specialis zu Art. 9 I GG.79 Nach der Definition des Art. 2 I PartG sind politische Parteien „Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit für den Bereich des Bundes oder eines Landes auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen“, sofern sie eine gewisse organisatorische Gewähr für die Ernsthaftigkeit ihrer Zielsetzung bieten.80
Der verfassungsrechtliche Status der Parteien als ein Status der Freiheit, der Gleichheit und der Öffentlichkeit ist Voraussetzung für die sachgemäße Mitwirkung an der politischen Willensbildung. Die äussere Parteifreiheit soll sicherstellen, dass die erforderliche Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit der Parteien gegeben ist, d.h. die Partei wird vor staatlichen Eingriffen und Einflüssen geschützt.81 Im Unterschied zu Vereinen iSd Art. 9 GG geniessen Parteien einen erhöhten Schutz gegen Auflösung, die dem BVerfG vorbehalten und damit der administrativen, vereinsrechtlichen Entscheidung der Exekutiven entzogen ist (Parteienprivileg).82
Die innere Parteifreiheit soll gewährleisten, dass die innere Ordnung der Parteien demokratischen Grundsätzen entspricht Art. 21 I 3 GG. Das Gebot der demokratischen Binnenstruktur ist eine Einschränkung der Vereinsautonomie mit dem Ziel, die Freiheit des politischen Prozesses an der Parteibasis, die Entscheidungsbildung von unten nach oben sichern.83
Gleichheit der Parteien bedeutet, dass der Staat alles zu unterlassen hat, was die Chancen der Parteien untereinander beeinträchtigt. Dies bezieht sich nicht nur auf die Wahlen, sondern umfasst den gesamten Wirkungskreis der Parteien. Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine schematische Gleichheit, die Modifikationen zur Bewältigung von Aufgaben der demokratischen Ordnung zulässt. Ein Charakteristikum der Parteien ist, dass sie quasi als „Bindeglied“ zwischen Staat und Gesellschaft stehen. Die Parteien sind zwar grundsätzlich privatrechtliche Vereinigungen und in der Gesellschaft verwurzelt, sie wirken aber als Quasi - Verfassungsorgane in den staatlichen Bereich hinein und können - soweit verfassungsrechtliche Aufgaben in Frage stehen - ihre Rechte im Wege des Organstreitverfahrens vor dem BVerfG verfolgen Art. 93 I Nr. 1 BVerfGG, ohne jedoch ein Teil der Staatsorganisation zu werden.84 Darin kommt zum Ausdruck, dass der verfassungsrechtliche Status der Parteien ein singulärer öffentlicher Status ist.85 Die Pflicht, über Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentlich Rechenschaft abzulegen, ist den Parteien auferlegt, um zu einer Durchsichtigkeit der wirtschaftlichen Beziehungen und der Finanzierung der Parteien beizutragen und um mögliche Abhängigkeiten sichtbar zu machen.86
Die Parteien wirken als integrierende Bestandteile der demokratischen Ordnung an der politischen Willensbildung des Volkes vornehmlich durch ihre Beteiligung an Wahlen mit, daher werden sie auch als „Wahlvorbereitungsorganisationen“ bezeichnet.87 Zwischen den Wahlen sollen Parteien die Interessen des Volkes aufnehmen, bündeln, integrieren und darstellen, die Verbindung zwischen dem Volk und den staatlichen Organen iSd demokratischen Rückkopplung herstellen und pflegen, das Interesse der Bürger am politischen Leben fördern und ihre politischen Vorstellungen in die staatlichen Organe einbringen.88 Den Bürgern soll durch die Parteien die faktische Möglichkeit gegeben werden, sich durch unmittelbare politische Beteiligung als Mitgestalter des öffentlichen Lebens zu betätigen. Ob die Parteien diesen ihnen zugewiesenen Aufgaben nachkommen dürfte wohl zweifelhaft sein, teilweise wird davon gesprochen, dass die Parteien zur „Oligarchisierung und damit zur Umdeutung ihrer Mittlerfunktion in eine eigene, sich selbst tragende politische Entscheidungsmacht“ tendierten.89 Wenn in neuerer Zeit von einer „Parteiendemokratie“ gesprochen wird, wird dadurch ausgesagt, dass die parlamentarische Demokratie von den Parteien bestimmt ist. Das Gegenüber von Parlament und Regierung wird weithin überlagert durch die Frontstellung der Mehrheitsfraktion im Parlament, welche die Regierung stellen und unterstützen, gegenüber der an der Regierung nicht beteiligten Opposition der parlamentarischen Minderheit.90
5. Das Mehrheitsprinzip
Auch in der Demokratie müssen Entscheidungen getroffen werden. Zunächst ist im Wege der Verhandlungen und des Ausgleichs eine Einigung anzustreben, da sie eine alle Interessen berücksichtigende Lösung gewährleistet und die Akzeptanz der Entscheidungen erhöht.91 Wenn sich im Wege des Kompromisses keine Einigung erzielen lässt greift, das Mehrheitsprinzip ein. In den Wahlen zur parlamentarischen Volksvertretung und in den Wahlen und Abstimmungen, durch welche die parlamentarische Volksvertretung ihren Willen bildet, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.92 Es bedeutet, dass grundsätzlich die Minderheit das zu respektieren und zu beachten hat, was die Mehrheit entscheidet, wobei dies allerdings nicht im Sinne einer willkürlichen, sondern im Sinne einer rechtsstaatliche Grundsätze beachtenden Ausübung dieses Prinzips zu verstehen ist.93 Durch das Mehrheitsprinzip wird auch ausgesagt, dass eine dem politischen Prozess vorgegebene politische Richtigkeit oder Sachgerechtigkeit weder vorausgesetzt noch anerkannt wird. Die Vernünftigkeit bzw. Gerechtigkeit einer Entscheidung ist gerade durch das dem Mehrheitsprinzip folgende Verfahren der politischen Willensbildung zu finden. Das Mehrheitsprinzip setzt allerdings voraus, dass die an der Wahl aktiv und passiv Beteiligten in den politischen und kulturellen Wertvorstellungen im wesentlichen übereinstimmen, dass sie bei ihrer Urteilsbildung aus einem freien und offenen Prozess der Meinungen schöpfen können und dass diejenigen, die in der Minderheit bleiben, mit der Chance einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse rechnen können.94 Das Erfordernis qualifizierter Mehrheiten dient dem Minderheitenschutz und einer erhöhten Bestandskraft der betroffenen Materien - etwa bei Verfassungsänderungen, die dem Zugriff wechselnder knapper Mehrheiten entzogen werden sollen.95
Je höher die Anforderungen an die Mehrheit sind, desto mehr Einfluss erlangt die Minderheit. Abgesehen davon, dass die Minderheit ihre Zustimmung verweigert, wirken sich die Minderheitsrechte vor allem im verfahrensrechtlichen Bereich aus, etwa in der Einräumung von Antragsrechten, Rederechten und Einspruchsrechten. Dadurch kann die Minderheit ihre Vorstellungen in das Verfahren und gegebenenfalls auch in die Entscheidung selbst einbringen.
Das Mehrheitsprinzip findet seine Grenzen in den Grundsätzen des Rechtsstaats und seinen Ausprägungen in formeller und materieller Hinsicht. Mehrheitsentscheidungen dürfen sich also nicht über die vom Verfassungsrecht festgelegten Grundvorstellungen über Richtigkeit, Vernünftigkeit und Gerechtigkeit politischer Entscheidungen hinwegsetzen.96 Der demokratische Verfassungsstaat vertraut demnach Gerechtigkeit und politische Vernünftigkeit nicht schlechthin der Mehrheit an.
6. Plebiszitäre Ergänzungen der parlamentarischen Repräsentation
Im streng verwirklichten repräsentativen System gibt es für das Volk keine Möglichkeit, jenseits der Wahl selbst einen unmittelbaren Einfluss auf die Inhaber der Staatsgewalt auszuüben. Unter dem Schlagwort „Demokratisierung“ ist daher die Forderung gestellt worden, die repräsentative Demokratie durch plebiszitäre Elemente zu ergänzen.
Wenn eine Verfassung Verfahren der „Volksgesetzgebung“ vorsieht, können entweder wesentliche Entscheidungen, insbesondere Verfassungsänderungen, einer plebiszitären Entscheidung unterworfen werden oder aber das Gesetzgebungsrecht des Parlaments durch die Möglichkeit beschränkt werden, dass unter bestimmten Voraussetzungen gegen ein Parlamentsgesetz das Referendum in Gang gebracht wird oder ein Gesetzentwurf im Wege des Volksbegehrens zum Gegenstand einer parlamentarischen oder plebiszitären Gesetzgebung (Volksentscheid) gemacht wird.97
Im Grundgesetz werden „Abstimmungen“ zwar in Art. 20 II 2 erwähnt, im folgenden finden sich aber - mit Ausnahme des Art. 29 und Art. 118a - keine weiteren Vorschriften, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen sie durchgeführt werden können. Im neueren Schrifttum wird daher der Versuch unternommen, das postulierte „Demokratiedefizit des Grundgesetzes“ durch Auslegung des Art. 20 II 2 GG als Kompetenznorm zu beheben und Volksentscheide unter der Bedingung ihrer einfach - gesetzlichen Zulassung durch den Gesetzgeber als verfassungsrechtlich statthaft anzusehen.98 Diese Auffassung lässt sich bei genauerer Betrachtung nicht halten. Bereits die Entstehungsgeschichte ergibt, dass die Problematik plebiszitärer Demokratieformen Gegenstand der Beratungen des Parlamentarischen Rates waren, deren Einführung aber trotz mehrfachen Antrags jedesmal abgelehnt wurde.99 Auch die systematische Stellung des Art. 20 GG als Grundsatznorm spricht gegen eine Auslegung als Ermächtigung an den Gesetzgeber, da die Vorschriften über die Gesetzgebung des Bundes in den Art. 70 ff. GG abschliessend geregelt ist. Wenn Art. 20 II 2 GG tatsächlich als Ermächtigungsgrundlage hätte dienen sollen, so müssten - wegen ihrer Bedeutung und Qualität - darin auch die Quoren, die Abstimmungsbeteiligung, das Abstimmungsergebnis usw. geregelt sein, um dem Zugriff der jeweiligen Parlamentsmehrheit entzogen zu werden. Nach geltendem Verfassungsrecht sind Volksabstimmungen also nicht zulässig. Die Bedeutung des Art. 20 II 2 GG liegt aber dennoch darin, dass die Einführung plebiszitärer Elemente nicht an Art. 79 III GG scheitern würde und dass landesverfassungsrechtliche Plebiszitregelungen abgedeckt werden, was bezüglich Art. 28 I 1 GG bedeutsam ist.100
Dennoch werden in der Literatur immer wieder Argumente für die Einführung plebiszitärer Elemente vorgetragen. Zum einen wird angeführt, dass die Deutschen in der ehemaligen DDR durch den revolutionären aber gleichwohl friedlichen Sturz des SED - Regimes ihre demokratische Reife derart unter Beweis gestellt hätten, dass es nicht angehe ihnen - und damit auch den Deutschen im Westen - die unmittelbare Beteiligung am politischen Entscheidungsprozess zu verwehren.101 Dazu ist anzumerken, dass es den Deutschen wohl nicht an demokratischer Reife fehlt; jedoch sind die Umstände, die zur Einheit Deutschlands unter verfassungsrechtlichen Vorzeichen geführt haben, aus einer einmaligen historischen Situation erwachsen, die im politischen Alltag ohne Parallele ist. Das Bekenntnis zur Demokratie mehrt gewissermassen das demokratische Grundkapital, rechtfertigt aber keine Experimente mit der Verfassung. Die Notwendigkeit etwaiger Verfassungsänderungen muss sich auch in dem hier in Rede stehenden Bereich aus Funktionsmängeln ergeben, die das geltende Recht in Normallage aufweist; Ausnahmelagen sind nicht geeignet, Lehren für die Bewältigung der Normalsituation abzuwerfen.
Weiterhin wird behauptet, dass sich die politischen Parteien zu dominierenden Machtträgern entwickelt hätten, die Gefahr liefen sich vom Volk zu entfernen und ihre Position zu missbrauchen.102 Die Parteien kämen ihrer Aufgabe, die inhaltliche Repräsentation, dass heisst den ständigen, intensiven und öffentlichen Austausch von Informationen und Meinungen zwischen Regierenden und Regierten zu gewährleisten, nicht mehr in ausreichendem Maße nach. Dazu ist anzumerken, dass es wohl kaum eine Sachfrage von allgemeiner Bedeutung gibt, die von den Parteien nicht alsbald aufgegriffen und öffentlich wie intern erörtert wird. Die Tatsache, dass es mitunter lange dauert bis anstehende Probleme in befriedigender Weise gelöst werden, liegt wohl mehr an der Schwierigkeit und Komplexität der Probleme als an mangelnder Sensibilität der Parteien.103
Diese angesprochene Komplexität der Probleme ist gleichwohl ein Argument gegen die Einführung plebiszitärer Verfahren. Die meisten Bürger dürften wohl nicht in der Lage sein, die Spezialität und Vielschichtigkeit der in unserem „technokratischen Massenstaat“ auftretenden Probleme zu erkennen und können daher die Folgen ihrer Entscheidung nicht absehen.104 Dies ist auch der Grund, warum auf Ebene der Länder und Kommunen mit überschaubaren Wirkungskreisen plebiszitäre Ergänzungen durchaus sinnvoll sein mögen, sich aber nicht erfolgversprechend auf Bundesebene übertragen lassen. Ein weiteres Argument gegen die Einführung plebiszitärer Verfahren ist die sich dadurch ergebende Schwächung der obersten Staatsorgane in ihren politischen Leitungsfunktionen. Die Stabilität der Demokratie beruht auch auf einer klar definierte Ziele verfolgenden politischen Führung. Diese Führung ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Parlament nicht mehr abschliessend entscheiden kann, sondern wenn es beispielsweise der sich in der Opposition befindenden Minderheit möglich ist, eine Entscheidung zu konterkarieren, indem sie einen Volksentscheid in die Wege leitet.105
Ein weiteres Problem ist, dass die durch Volksbegehren veranlassten Volksabstimmungen von einer bestimmten Organisation oder Gruppe ausgehen, die durch die Fragestellung die Möglichkeit haben, das Ergebnis zu präjudizieren und das Volk für eigene Zwecke zu instrumentalisieren.106 Zunächst werden durch plebiszitäre Elemente denjenigen ein Vorsprung verschafft, die in der Lage sind, die dafür erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen zu treffen und die notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen.107 Da aus praktischen Gründen nur mit „Ja“ oder „Nein“ gestimmt werden kann, ist es nicht realisierbar, dem Volk alle möglichen Problemlösungen vorzustellen. Durch die Formulierung und die Umstände, unter denen die Alternative aufgeworfen wird, ist es dem Fragesteller möglich, massgeblichen Einfluss auf das Ergebnis zu erlangen.108 Weiterhin besteht die Gefahr, dass sich geschickte Demagogen die gegebenen Möglichkeiten zu Nutze machen. In diesem Zusammenhang ist auch die machtvolle Beeinflussung des Volkes durch Massenkommunikationsmittel zu nennen. Sie haben als „Faktor“ der politischen Meinungsbildung einen selbständigen Einfluss erlangt, sodass durch aktuelle Geschehnisse mit Verstärkung der Medien die politische Vernünftigkeit auf der Strecke bleiben könnte.
Durch plebiszitäre Verfahren bekommen oppositionelle und kleine Parteien wie auch ausserhalb des Parteienspektrums operierende Gruppen die Möglichkeit, ihre nach den Regeln des Mehrheitsprinzips und des Parlamentarismus begrenzte Position mit Hilfe der Massenmedien zu verstärken.109 Daraus erwachsen also nicht Kräfte einer unmittelbaren Demokratie, sondern nur andere Formen mittelbarer Demokratie. Das durch die Wahlen in der parlamentarischen Demokratie wirksame Mehrheitsprinzip, die Gewaltenteilung und die bundesstaatlichen Institutionen werden von Fall zu Fall beiseite geschoben. Um einer in der öffentlichen Meinung oder von einer Minderheit für wichtig gehaltenen Sache willen wird auf die Richtigkeitsgewähr der parlamentarischen Gesetzgebung verzichtet und wird eine vereinzelte Sachfrage aus dem Gesamtspektrum politischer Aufgaben und dem Ausgleichsmechanismus der Kompromisse herausgelöst.
[...]
1 Badura: Die parlamentarische Demokratie, in: HdStR, § 23 Rn. 37
2 Badura: Staatsrecht E 10
3 Bleckmann: Staatsrecht I, Rn 261
4 Kluxen: Geschichte und Problematik des Parlamentarismus, S. 20
5 Badura: Die parlamentarische Demokratie, § 23 Rn. 21
6 Kluxen: Geschichte und Problematik des Parlamentarismus, S. 34
7 Zippelius: AStL, § 41 I
8 Kluxen: Geschichte und Problematik des Parlamentarimus, S. 55 ff.
9 Zippelius: JuS 1987, S. 688
10 Zippelius: JZ 1993, S. 1126
11 Bleckmann: Staatsrecht I, Rn. 260
12 Wegbereiter dieses Gedankens waren vor allem Johann Althusius und Hugo Grotius
13 Zippelius: JuS 1987, S. 689
14 Badura: Die parlamentarische Demokratie§ 23 Rn. 22
15 Zippelius: AStL, § 23 I 1
16 Bleckmann: Staatsrecht I, Rn. 262
17 Zippelius: AStL, § 17 III
18 Bleckmann: Staatsrecht, Rn. 262
19 Zippelius: JZ 1999, S. 127
20 Badura: Die parlamentarische Demokratie, § 23 Rn. 52, 27
21 Badura: Staatsrecht, D 6; Degenhart: Staatsrecht, Rn. 18
22 Böckenförde: Demokratie als Verfassungsprinzip, HdStR § 22 Rn. 3
23 Böckenförde: Demokratische Willensbildung und Repräsentation, HdStR § 30 Rn. 1
24 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 13
25 aus Carl Schmidt: Verfassungslehre, 1970, S. 234
26 Zippelius: AStL, § 23 I
27 Katz: Staatsrecht, Rn. 141
28 Böckenförde: Demokratische Willensbildung und Repräsentation, HdStR § 30 Rn. 4
29 Zippelius: AStL, § 23 I
30 Badura: Die parlamentarische Demokratie, HdStR § 23 Rn. 40
31 Badura: Staatsrecht, D 10
32 Böckenförde: Demokratische Willensbildung und Repräsentation, HdStR § 30 Rn. 13
33 Katz: Staatsrecht, Rn. 141
34 Badura: Staatsrecht, D 10
35 s.o. Fußn. 34
36 Böckenförde: Demokratie als Verfassungsprinzip, HdStR § 22 Rn. 49
37 so auch der Schlussbereicht der Enquêtekommission Verfassungsreform des Dt. Bundestags BT - Drucks. 7/5924, S. 49
38 Böckenförde: Demokratische Willensbildung und Repräsentation, HdStR § 30 Rn. 18
39 Badura: Staatsrecht, E 11
40 Katz: Staatsrecht, Rn. 141; Badura: Die parlamentarische Demokratie, HdStR § 23 Rn. 34
41 Böckenförde: Demokratie als Verfassungsprinzip, HdStR § 22 Rn. 11
42 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 21
43 BVerfGE 83, 60, 73
44 Degenhart: Staatsrecht, R. 15
45 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 28
46 Meyer: Demokratische Wahl und Wahlsystem, HdStR III, § 37 Rn. 1
47 Degenhart: Staatsrecht, Rn. 15; Zippelius: AstL, § 24 I 1
48 § 13 Ziffer 1 BWahlG wird zum Teil als verfassungswidrig angesehen, da das Wahlrecht kein politisches „Ehrenrecht“ mehr sei, sondern das politische Grundrecht überhaupt; so Meyer: Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, HdStR § 38 Rn.3
49 BVerfGE 95, 335, 350
50 Maurer: Staatsrecht, § 13 Rn. 12; Degenhart: Staatsrecht, Rn. 16
51 Zippelius: AStL; § 24 I
52 Badura: Staatsrecht, E 3; Maurer: Staarsrecht, § 13 Rn. 7
53 Degenhart: Staatsrecht, Rn. 16
54 BVerfGE 82, 322, 337
55 Badura: Staatsrecht, E 3
56 Maurer: Staatsrecht, § 13 Rn. 20, Zippelius: AStL; § 24 II
57 Degenhart: Staatsrecht, Rn. 17
58 Zippelius: AStL; § 24 II
59 Badura: Staatsrecht, E 4
60 anders als z.B. Art. 41 I 2 SächsVerf
61 Degenhart: Staatsrecht, Rn. 17
62 Degenhart: Staatsrecht, Rn. 17a; Maurer: Staatsrecht, § 13 Rn. 27
63 Degenhart: Staatsrecht, Rn. 19
64 schwankte die Zahl zunächst zwischen 1 - 3 Überhangmandaten, so gab es 1990 bereits 6 Überhangmandate (alle CDU), 1994 16 Überhangmandate (12 CDU + 4 SPD), 1998 13 Überhangmandate (alle SPD)
65 BVerfGE 95, 335
66 Papier: JZ 1996, S. 268
67 Meyer: Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, HdStR § 38 Rn.32
68 Papier: JZ 1996, S. 270 m.w.N.
69 BVerfGE 6, 84; 14, 121; 34, 81; Meyer: Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, HdStR § 38 Rn.27
70 Zippelius: AStL, § 24 II
71 § 6 VI 1 2. HS BWahlG fand Anwendung bei den BT - Wahlen 1994: PDS erzielte 4,4% (<5%) Zweitstimmen, aber 4 Direktmandate in Berlin
72 Hoppe: DVBl 1995, S. 268, ebenso Meyer: Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, HdStR § 38 Rn.30
73 BVerfGE 95, 408, 421 f.
74 BVerfGE 6, 84, 96
75 Badura: Staatsrecht, D 9
76 abegesehen von der abwehrenden Formel des Art. 130 I WRV
77 Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 166; Badura: Staatsrecht, D 13
78 Badura: Staatsrecht, D 20
79 Kunig: Parteien, HdStR § 33 Rn. 60
80 so auch BVerfGE 91, 262, 266
81 Katz: Staatsrecht, Rn. 278; Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 174
82 Badura: Staatsrecht, D 20
83 Katz: Staatsrecht, Rn. 281; Kunig: Parteien, HdStR § 33 Rn. 78
84 st. nicht ganz einheitliche Rspr. BVerfGE 24, 260 (263); 27, 152 (157); Degenhart: Staatsrecht, Rn. 57
85 Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 177
86 Badura: Staatsrecht, D 21
87 BVerfGE 91, 262, 268; Katz: Staatsrecht, Rn. 271
88 Maurer: Staatsrecht, § 11 Rn. 15
89 Schlußbericht der Enquete - Kommission Verfassungsrecht BT - Drucks. 7/5924, S.12; Katz: Staatsrecht, Rn. 272
90 Badura: Staatsrecht, D 25
91 Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 141
92 Badura: Staatsrecht, D 8
93 Katz: Staatsrecht, Rn. 151
94 Badura: Die parlamentarische Demokratie, HdStR § 23 Rn. 31; Hesse: Grundzüge des Verfassungsrechts, Rn. 142
95 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 61
96 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 61; Badura: Staatsrecht, D 8
97 Badura: Staatsrecht, E 12
98 von Danwitz: DÖV 1992, S. 602
99 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 34
100 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 46
101 Karpen: JA 1993, S. 113
102 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 346
103 Karpen: JA 1993, S. 113
104 Krause: Verfassungsrechtliche Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie; HdStR III, § 39 Rn. 25
105 Karpen: JA 1993, S. 114
106 Maurer: Staatsrecht, § 7 Rn. 42
107 Karpen: JA 1993, S. 114
108 Krause: Verfassungsrechtliche Möglichkeiten unmittelbarer Demokratie; HdStR III, § 39 Rn. 27; ansonsten ähnliche Argumentation wie bei II.1. „unmittelbare Demokratie“
Häufig gestellte Fragen
Was ist die historische Entwicklung der parlamentarischen Repräsentation?
Der Parlamentarismus entwickelte sich aus dem Gegensatz zwischen Regierung und Parlament, insbesondere aus dem Gedanken, die Regierung unter die Kontrolle eines Parlaments zu bringen. Die Entwicklung der Nationalstaaten, vor allem in England und Frankreich, bildet die geschichtliche Grundlage. Ständeversammlungen, die bis ins spätere Mittelalter zurückreichen, gelten als erste Entwicklungsstufe des Parlamentarismus. In England setzte sich der Grundsatz des Steuerbewilligungsrechts der Stände in der Magna Carta im Jahre 1215 durch. Die französische Revolution vollzog den Übergang von der Ständeversammlung zur Nationalrepräsentation in kurzer Zeit.
Wie werden parlamentarische und plebiszitäre Demokratie voneinander abgegrenzt?
Das Prinzip der Volkssouveränität, ausgedrückt durch den Satz "alle Staatsgewalt geht vom Volke aus", bildet die ideelle und politische Legitimation der demokratischen Staatsform. Die fortdauernde Legitimation der Ausübung staatlicher Herrschaftsgewalt durch den Volkswillen kann sich in unmittelbarer und repräsentativer Demokratie vollziehen. In der unmittelbaren Demokratie trifft das Volk selbst alle massgeblichen Sach- und Personalentscheidungen, in der repräsentativen Demokratie wählt das Volk ein Parlament als Repräsentationsorgan.
Was sind die Wahlrechtsgrundsätze?
Art. 38 I 1 GG enthält die verfassungsrechtlichen Anforderungen an Wahlen zum Bundestag, insbesondere das demokratische Prinzip einer egalitären, freien und definitiven Mitentscheidung aller Bürger. Die Wahlrechtsgrundsätze umfassen Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Geheimheit, Freiheit und Gleichheit der Wahl.
Wie funktionieren Wahlsysteme (Mehrheitswahl vs. Verhältniswahl)?
Herkömmlicherweise werden die Wahlsysteme der Mehrheitswahl und der Verhältniswahl unterschieden. Bei der Mehrheitswahl wird das Wahlgebiet in Wahlkreise eingeteilt, und der Kandidat mit den meisten Stimmen gewinnt. Bei der Verhältniswahl werden die Parteien im Parlament proportional zu den erhaltenen Wählerstimmen vertreten. Das geltende Wahlrecht kombiniert Verhältnis- und Mehrheitswahl, was als personalisierte Verhältniswahl bezeichnet wird.
Welche verfassungsrechtlichen Probleme gibt es beim geltenden Wahlrecht?
Die zunehmende Zahl der Überhangmandate verstärkte die Diskussion über ihre Verfassungsmässigkeit. Die 5 % Sperrklausel des § 6 VI 1 1. HS BWahlG stellt einen gravierenden Eingriff in das Verfassungsrecht auf gleiche Wahl dar, da nicht alle Stimmen den gleichen Erfolgswert haben. Die Grundmandatsklausel wurde auch diskutiert.
Was ist der Status und die Aufgabe der politischen Parteien?
Das Grundgesetz (Art. 21) erkennt die Mitwirkung der Parteien bei der politischen Willensbildung ausdrücklich an und gewährleistet dadurch den Pluralismus des demokratischen Prozesses. Politische Parteien sind Vereinigungen von Bürgern, die dauernd oder für längere Zeit auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Volkes im Deutschen Bundestag oder einem Landtag mitwirken wollen. Sie haben einen verfassungsrechtlichen Status der Freiheit, Gleichheit und Öffentlichkeit.
Was ist das Mehrheitsprinzip?
In der Demokratie werden Entscheidungen durch das Mehrheitsprinzip getroffen. Wenn sich im Wege des Kompromisses keine Einigung erzielen lässt, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Minderheit hat das zu respektieren, was die Mehrheit entscheidet. Das Mehrheitsprinzip findet seine Grenzen in den Grundsätzen des Rechtsstaats.
Was sind plebiszitäre Ergänzungen der parlamentarischen Repräsentation?
Die Forderung nach plebiszitären Elementen zielt darauf ab, die repräsentative Demokratie durch Elemente der direkten Demokratie zu ergänzen. Es gibt Argumente für und gegen die Einführung solcher Elemente, insbesondere im Hinblick auf die Komplexität der Probleme, die Stabilität der Regierung und das Potential für Manipulation.
- Citation du texte
- Uli Gößl (Auteur), 2001, Demokratische Repräsentation durch die parlamentarische Volksvertretung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106333