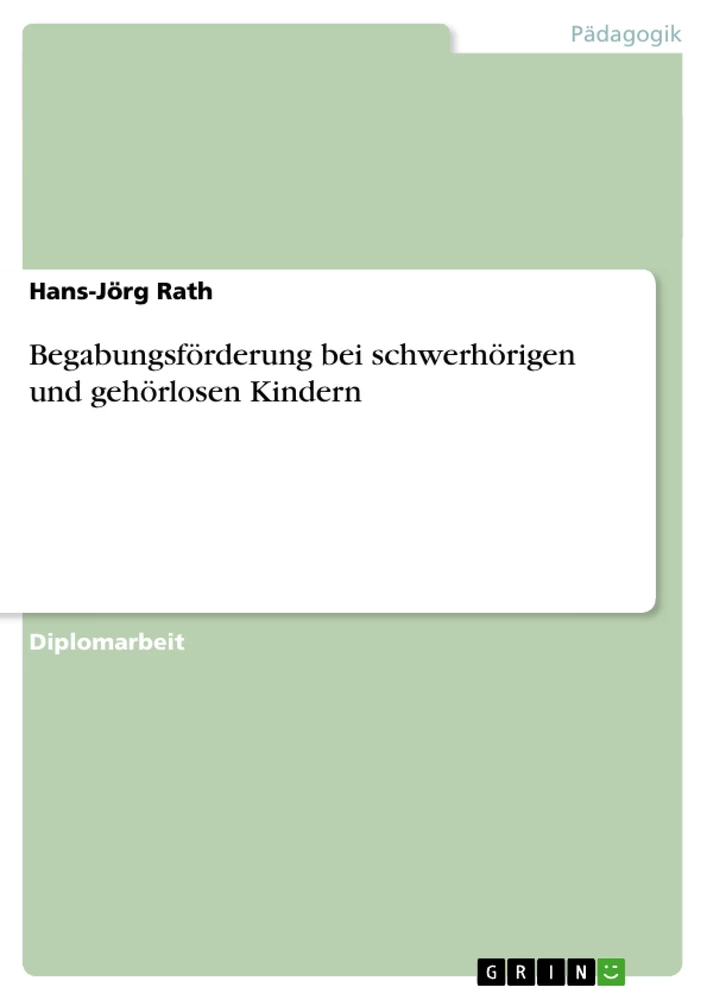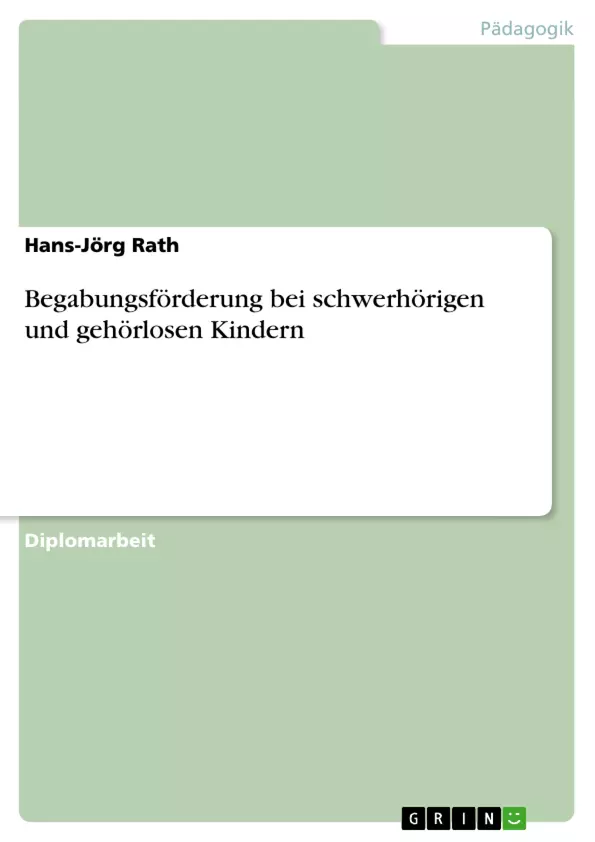Als ich mir im Sommersemester 2001 Gedanken machen musste, welches Thema ich mir für meine Diplomarbeit wähle, hatte ich zunächst bezüglich des Terminus „Begabungsförderung“ meine Bedenken, da während des ersten „Hineinschnupperns“ in die Literatur der modernen Begabungsforschung zunächst nur die Rede von den sogenannten Genies und Wunderkindern war. Ich konnte mir zu Beginn überhaupt nicht vorstellen, diese Thematik in Bezug zu einer Behinderungsgruppe wie den Schwerhörigen und Gehörlosen zu stellen. Zumal mir zu Beginn der Literatursuche auch kein Glück beschert war, da mir diverse Computersuchmaschinen in den Bibliotheken unter den Suchbegriffen „Behinderung und Begabung“ oder „Begabungsförderung bei behinderten Kinder“ etc. nur eine vernichtende Absage mit dem Satz „Keine Einträge gefunden!“ erteilten. So musste ich für mich einen anderen Weg suchen, um Begabungsförderung im Allgemeinen für behinderte Kinder zu verifizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 1.1 Behinderung und Begabung - ein unüberwindbarer Gegensatz?
- 2. Begabungsförderung als Wissenschaft
- 2.1 Was versteht man unter dem Begriff „Begabung“?
- 2.2 Modelle der Hochbegabung
- 2.2.1 Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli
- 2.2.2 Das Triadische Interdependenzmodell nach Mönks sowie dessen Erweiterung
- 2.2.3 Das Münchner Begabungsmodell
- 2.3 Begabung, Intelligenz, Kreativität und Motivation
- 2.3.1 Begabung und Intelligenz
- 2.3.2 Kreativität und Begabung – lässt sich Kreativität überhaupt beschreiben?
- 2.3.2.1 Kreativität als universeller Terminus - verschiedene allgemeine Ansätze
- 2.3.2.2 Kreativität aus evolutionärer Sicht
- 2.3.2.3 Kreativität aus anthropologischer und humanistischer Sicht
- 2.4 Weitere Sichtweisen zum Begriff Kreativität
- 2.4.1 Das 4p – U – Interaktionsmodell
- 2.4.2 Das Komponentenmodell nach Urban
- 2.4.3 Kann man Kreativität messen?
- 2.5 Zusammenfassung und Vorausschau
- 3. Identifikation von Begabungen
- 3.1 Der pädagogische „Potential - Ansatz“
- 3.2 Der dynamische Begabungsbegriff
- 3.2.1 Entwicklung von Begabungen in Zusammenhang mit der Vererbungslehre
- 3.3 Wie kann man Begabungen erkennen und adäquat fördern?
- 3.3.1 Searching
- 3.3.2 Screening
- 3.4 Behinderung und Begabung
- 3.5 Zusammenfassung und Vorausschau
- 4. Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit als Formen einer spezifischen Behinderung
- 4.1 Definition des Begriffs Hörschädigung
- 4.2 Weitere Begriffsbestimmungen
- 4.2.1 Schwerhörigkeit
- 4.2.2 Gehörlosigkeit
- 4.2.3 Die Gruppe der Hörauffälligen
- 4.2.4 Hörsprachbehinderte
- 4.2.5 Menschen, die im Sprachbesitz ertaubt sind
- 4.3 Der Aufbau des Ohres und der Hörvorgang
- 4.3.1 Wann sprechen wir von Schwerhörigkeit, wann von Gehörlosigkeit?
- 4.4 Die Sprach- und Hörentwicklung beim schwerhörigen bzw. gehörlosen Kind
- 4.4.1 Die normale Sprachentwicklung
- 4.4.1.1 Die Hör- und Sprachentwicklung im Säuglingsalter
- 4.4.1.2 Das Kleinkindalter (2. und 3. Lebensjahr)
- 4.4.1.3 Das jüngere Vorschulkind (4. und 5. Lebensjahr)
- 4.4.2 Die Hör- und Sprachentwicklung beim hörgeschädigten Kind und die Problematik in der verbalen bzw. nonverbalen Kommunikation
- 4.4.1 Die normale Sprachentwicklung
- 4.3 Zusammenfassung
- 5. Sprachliche Förderung bei gehörlosen und schwerhörigen Kindern
- 5.1 Förderung durch Lautsprache
- 5.2 Der Eltern-Kind-Dialog mit dem hörgeschädigten Kind als Voraussetzung für eine optimale Frühförderung
- 5.2.1 Fördermöglichkeiten im Alltag
- 5.3 Entwicklung von Sprechfertigkeiten bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern
- 5.4 Die Rolle des Gedächtnisses bei der Automatisierung von Sprechfertigkeiten
- 5.5 Frühförderung von hörgeschädigten Kindern
- 5.5.1 Förderung im Spiel
- 5.5.1.1 Geräuschspiele
- 5.5.1.2 Räumspiele
- 5.5.1.3 Bewegungsspiele
- 5.5.1.4 Spiele mit Papier, Farbe und Knete
- 5.5.1.5 Rollenspiele
- 5.5.1.5 Bücher
- 5.5.1 Förderung im Spiel
- 5.6 Das Cochlear-Implantat als Zukunftsperspektive für gehörlose Kinder
- 5.7 Zusammenfassung
- 6. Gebärden
- 6.1 Was versteht man unter dem Begriff „Gebärdensprache“?
- 6.1.1 Arten von Gebärden
- 6.2 Förderung durch Gebärdensprache
- 6.2.1 Geschichte der Schwerhörigen- und Gehörlosenpädagogik
- 6.3 Lautsprache und Gebärdensprache – ein Vergleich
- 6.3.1 Gebärdensyntax
- 6.4 Gebärdensprache versus Lautsprache
- 6.4.1 Hat die Gebärdensprache eine negative Auswirkung auf die Lautsprache?
- 6.4.2 Zusammenfassung und Vorausschau
- 6.1 Was versteht man unter dem Begriff „Gebärdensprache“?
- 7. Begabungsförderung von Gehörlosen und Schwerhörigen in der Schule und im Beruf
- 7.1 Das Zweisprachenmodell
- 7.2 Begabungsförderung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern, aber wie?
- 7.2.1 Das Prinzip der Normalisierung
- 7.3 Begabungsförderung durch den begabenden Lehrer
- 7.3.1 Der begabende Lehrer in der Schwerhörigen- und Gehörlosenpädagogik als Helfer zur Identitätsfindung
- 7.4 Bildung und Erziehung von Schwerhörigen und Gehörlosen in der Schule
- 7.4.1 Didaktik und Charakterisierung des Unterrichts
- 7.4.2 Umsetzung im Unterricht durch den begabenden Lehrer
- 7.4.2.1 Die Gestaltung des Klassenraums und das Wissen über die auditive Perzeption
- 7.4.3 Der Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie Hörgerät oder Mikroportanlage
- 7.4.4 Lern- und Sozialformen
- 7.5 Gesprächsformen im Unterricht und Methoden des Erarbeitens
- 7.5.1 Das katechisierende Unterrichtsgespräch
- 7.5.2 Das hermeneutische und heuristische Unterrichtsgespräch
- 7.5.3 Gesprächstechniken
- 7.6 Musik und Rhythmik als Erziehungs- und Fördermittel im Schwerhörigen und Gehörlosenunterricht
- 7.7 Sollen hörgeschädigte besser spezial oder integrativ unterrichtet werden?
- 7.7.1 Die Essener Schule, eine Erfolgsgeschichte, die für die Spezialschule spricht
- 7.7.2 Schwerhörige und Gehörlose in Integrationsklassen. Möglichkeiten aber auch Grenzen der Integration
- 7.7.3 Die Malerschule Baden (Schloss Leesdorf) - ein gelungenes Beispiel für die Integration Gehörloser und Schwerhöriger
- 7.8 Zusammenfassung
- 8. Erfahrungsbericht aus dem Blockpraktikum an einer Spezialschule für schwerhörige Kinder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Begabungsförderung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern. Ziel ist es, verschiedene Modelle der Begabungsförderung vorzustellen und deren Anwendbarkeit auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Kindergruppe zu beleuchten. Es werden verschiedene Förderansätze und -methoden diskutiert, die sprachliche und kommunikative Entwicklung berücksichtigen.
- Definition und Modelle der Begabung
- Identifikation von Begabungen bei hörgeschädigten Kindern
- Sprachliche Förderung (Lautsprache und Gebärdensprache)
- Begabungsförderung in Schule und Beruf (inklusive vs. exklusive Bildung)
- Die Rolle des Lehrers in der Begabungsförderung hörgeschädigter Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein. Kapitel 2 befasst sich mit verschiedenen Begabungsmodellen und -definitionen. Kapitel 3 widmet sich der Identifikation von Begabungen, insbesondere im Kontext von Behinderungen. Kapitel 4 definiert Schwerhörigkeit und Gehörlosigkeit und beschreibt die sprachliche Entwicklung betroffener Kinder. Kapitel 5 behandelt die sprachliche Förderung, einschließlich der Rolle von Lautsprache und Gebärdensprache. Kapitel 6 erläutert den Begriff der Gebärdensprache und deren Bedeutung für die Förderung. Kapitel 7 fokussiert auf die Begabungsförderung in Schule und Beruf und beleuchtet inklusive und exklusive Ansätze.
Schlüsselwörter
Begabungsförderung, Schwerhörigkeit, Gehörlosigkeit, Sprachentwicklung, Gebärdensprache, inklusive Bildung, exklusive Bildung, Hochbegabung, Fördermodelle, pädagogische Ansätze, Kommunikation.
- Citar trabajo
- Hans-Jörg Rath (Autor), 2002, Begabungsförderung bei schwerhörigen und gehörlosen Kindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106433