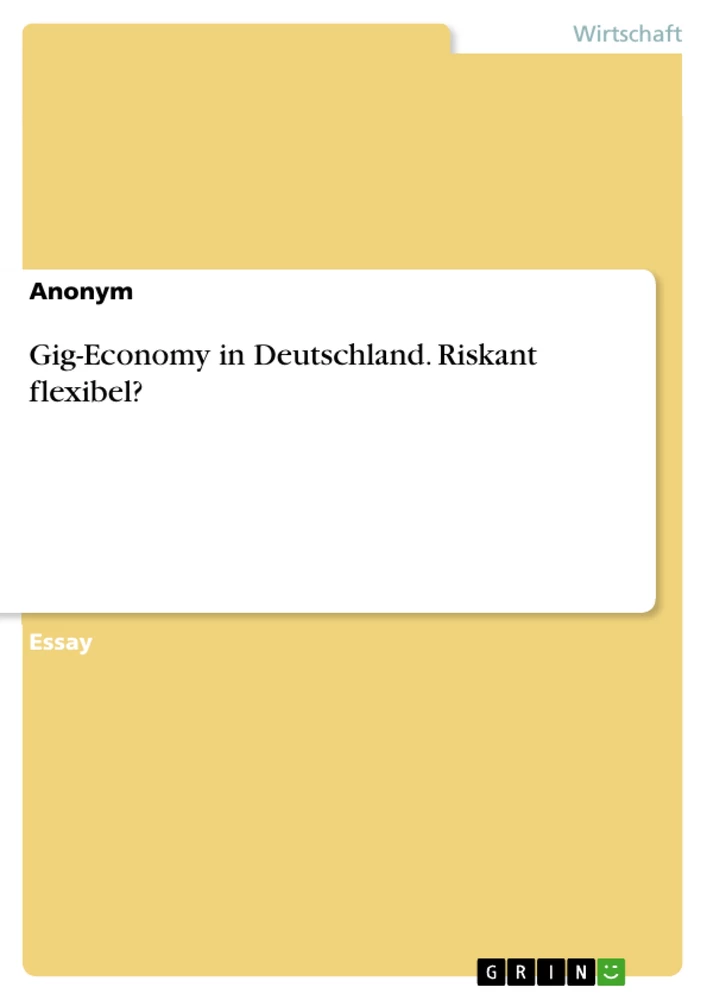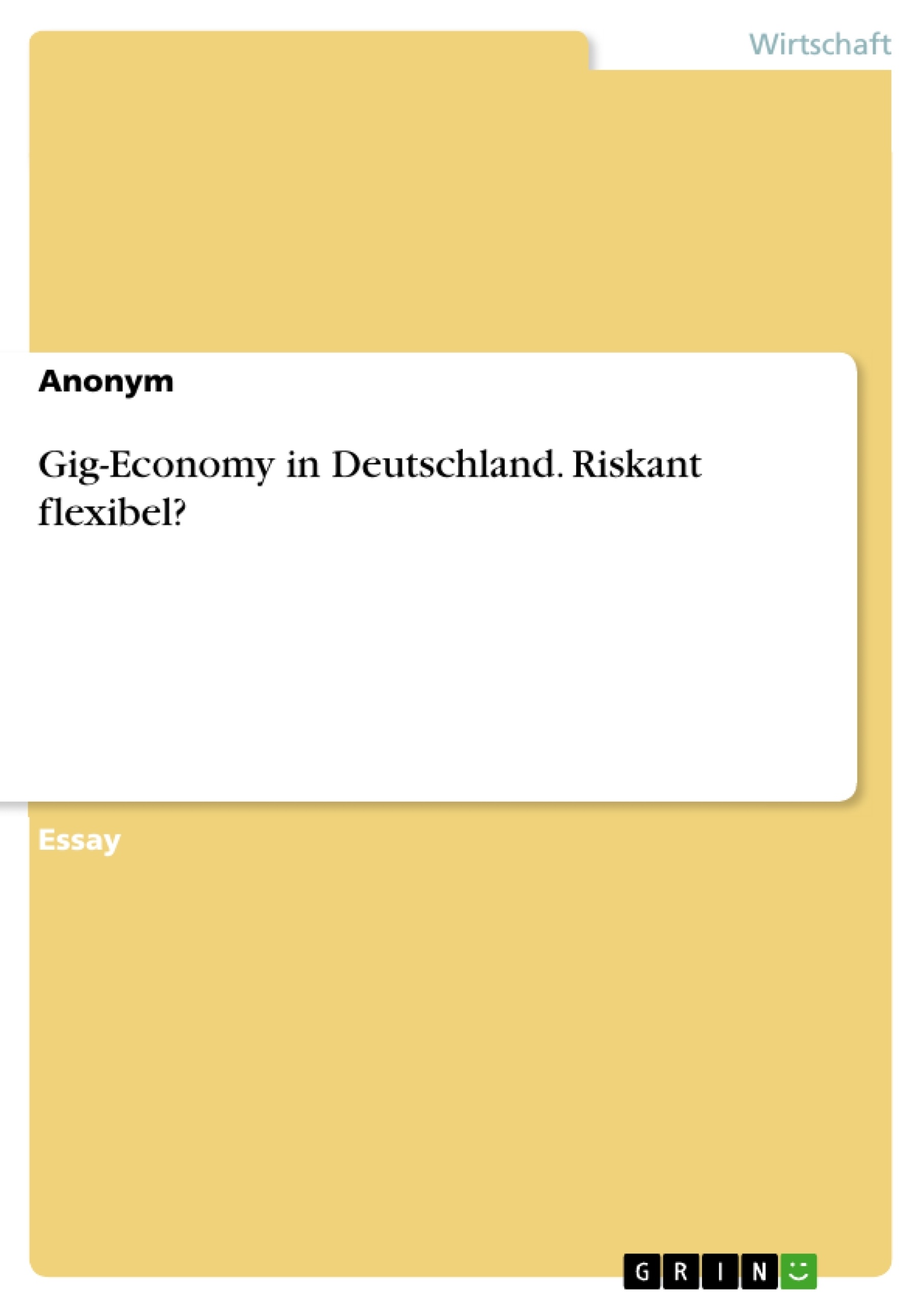In der Arbeit findet zunächst eine Auseinandersetzung mit dem Begriff „Gig-Economy“ statt. Anschließend wird die Funktionsweise anhand eines Beispiels erläutert, die Situation in Deutschland dargelegt sowie Chancen und Risiken diskutiert.
Plattformökonomie hat sich zu einem der Schlagworte der letzten Jahre entwickelt. Es handelt sich hierbei um „Arbeitsleistungen, die auf Arbeitsplattformen angeboten werden“. Diese Plattformen vermitteln bezahlte Arbeitsleistungen von Einzelpersonen, ohne dass ein Beschäftigungsverhältnis zwischen den Einzelpersonen und den Plattformen vorliegt.
Unaufhaltsam weitet sich die Digitalisierung auf alle Lebensbereiche aus und auch die Arbeitswelt bildet dabei keine Ausnahme. Nicht nur traditionelle Arbeitsprozesse werden digitalisiert, inzwischen basieren ganze Geschäftsmodelle auf Plattformen und damit verbundenen Algorithmen. Auch das Normalarbeitsverhältnis aus Arbeitgebenden und Angestellten unterliegt dieser Veränderung, besonders gefördert durch die plattformbasierte Vermittlung von kleinen, flexiblen Einheiten von Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Plattformökonomie
- Der Begriff „Gig-Economy“
- Funktionsweise Gig-Economy am deutschen Beispiel Foodora
- Gig-Economy am deutschen Arbeitsmarkt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht die Gig-Economy in Deutschland und hinterfragt deren Bezeichnung als „riskant flexibel“. Die Arbeit analysiert den Begriff der Gig-Economy, beleuchtet deren Funktionsweise anhand des Beispiels Foodora, und betrachtet die Situation am deutschen Arbeitsmarkt. Schließlich werden Chancen und Risiken dieser Arbeitsform diskutiert.
- Definition und Abgrenzung der Gig-Economy
- Funktionsweise der Gig-Economy am Beispiel Foodora
- Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt
- Chancen und Risiken der Gig-Economy
- Arbeitsrechtliche und soziale Absicherung von Gigworkern
Zusammenfassung der Kapitel
Plattformökonomie: Dieser Abschnitt führt in das Thema ein und beschreibt die zunehmende Verbreitung der Plattformökonomie und deren Einfluss auf die Arbeitswelt. Er differenziert zwischen Cloudwork und Gigwork und legt den Fokus auf letzteres, das im weiteren Verlauf des Essays im Mittelpunkt steht. Die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundene Veränderung des Arbeitsmarktes werden als Kontext für die Entstehung und Ausbreitung der Gig-Economy dargestellt. Die Abbildung 1 dient der Kategorisierung der verschiedenen Teilbereiche der Plattformökonomie und verdeutlicht die Positionierung der Gig-Economy innerhalb dieses größeren Kontexts.
Der Begriff „Gig-Economy“: Dieser Abschnitt definiert den Begriff "Gig-Economy" im Detail, indem er ihn von ähnlichen Konzepten wie Cloudwork abgrenzt. Die Entstehung des Begriffs im Kontext der US-amerikanischen Finanzkrise von 2009 wird erläutert, und es wird betont, dass die Abgrenzung zur Cloudwork weiterhin schwierig ist. Der Fokus liegt hier auf der ortsabhängigen Vermittlung von Einzelaufträgen an Individuen. Bekannte Beispiele wie Airbnb, Lieferando und Helping werden genannt, um den Begriff zu veranschaulichen und seine Relevanz für den deutschen Markt zu unterstreichen. Die Bedeutung der Einordnung der Gigworker zwischen Selbstständigkeit und Angestellten wird hervorgehoben, wobei die fehlenden politischen Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Fragen nach arbeitsrechtlichem Schutz und sozialer Absicherung thematisiert werden. Das rasante Wachstum und die damit verbundenen Herausforderungen für Politik und Forschung werden ebenfalls angesprochen.
Funktionsweise Gig-Economy am deutschen Beispiel Foodora: Dieser Abschnitt erläutert die Funktionsweise der Gig-Economy anhand des Beispiels Foodora. Die Rolle des Algorithmus als zentraler Koordinationsmechanismus wird beschrieben, ebenso wie die Vergütung der Fahrer und die notwendigen Arbeitsmittel, die von den Fahrern selbst bereitgestellt werden müssen. Der Abschnitt schildert die Arbeitsbedingungen der Foodora-Fahrer, einschließlich des Bonussystems, der Überwachung und des daraus resultierenden Konkurrenzdrucks. Der Widerstand der Fahrer und deren Organisation, zunächst über WhatsApp und später mit Unterstützung der FAU Berlin, wird ebenfalls detailliert dargestellt. Der Abschnitt endet mit der Übernahme von Foodora durch Lieferando.de.
Gig-Economy am deutschen Arbeitsmarkt: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Schwierigkeit, belastbare Zahlen zur Größe der Gig-Economy in Deutschland zu ermitteln. Die mangelnde Datenverfügbarkeit und die unklare Begriffsabgrenzung werden als Gründe genannt. Die Schätzung des DGB von etwa zwei Millionen Menschen in der Plattformökonomie wird erwähnt, sowie die Ergebnisse einer IZA-Studie, die von einer Größe nahe an der Messbarkeitsschwelle spricht. Konkretere Zahlen von Plattformen wie Foodora und Airbnb werden angeführt, um einen Eindruck von der Größenordnung zu vermitteln.
Schlüsselwörter
Gig-Economy, Plattformökonomie, Cloudwork, Crowdwork, Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Deutschland, Foodora, Algorithmus, Arbeitsrecht, soziale Sicherung, Selbstständigkeit, Arbeitnehmer, Uberization, Arbeitsbedingungen, soziale Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Gig-Economy in Deutschland
Was ist der Inhalt des Essays?
Der Essay untersucht die Gig-Economy in Deutschland und hinterfragt die Bezeichnung als „riskant flexibel“. Er analysiert den Begriff der Gig-Economy, beleuchtet deren Funktionsweise anhand von Foodora und betrachtet die Situation am deutschen Arbeitsmarkt. Chancen und Risiken dieser Arbeitsform werden diskutiert, ebenso die arbeitsrechtliche und soziale Absicherung von Gigworkern.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay umfasst folgende Themenschwerpunkte: Definition und Abgrenzung der Gig-Economy, Funktionsweise am Beispiel Foodora, Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt, Chancen und Risiken der Gig-Economy sowie die arbeitsrechtliche und soziale Absicherung von Gigworkern. Die Plattformökonomie im Allgemeinen wird ebenfalls eingeführt und die Gig-Economy als Teilbereich eingeordnet.
Wie ist der Essay aufgebaut?
Der Essay ist in Kapitel unterteilt, die sich mit der Plattformökonomie, der Definition von „Gig-Economy“, der Funktionsweise anhand von Foodora und der Situation der Gig-Economy am deutschen Arbeitsmarkt befassen. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Was wird unter „Gig-Economy“ verstanden?
Der Essay definiert die Gig-Economy detailliert und grenzt sie von ähnlichen Konzepten wie Cloudwork ab. Es wird auf die Entstehung des Begriffs im Kontext der US-amerikanischen Finanzkrise eingegangen. Der Fokus liegt auf der ortsabhängigen Vermittlung von Einzelaufträgen an Individuen. Beispiele wie Airbnb, Lieferando und Helping veranschaulichen den Begriff. Die Einordnung der Gigworker zwischen Selbstständigkeit und Angestellten wird hervorgehoben, inklusive der damit verbundenen Fragen nach arbeitsrechtlichem Schutz und sozialer Absicherung.
Welche Rolle spielt Foodora im Essay?
Foodora dient als Fallbeispiel, um die Funktionsweise der Gig-Economy zu veranschaulichen. Der Essay beschreibt die Rolle des Algorithmus, die Vergütung der Fahrer, die Bereitstellung der Arbeitsmittel durch die Fahrer, die Arbeitsbedingungen, das Bonussystem, die Überwachung und den Konkurrenzdruck. Der Widerstand der Fahrer und deren Organisation werden ebenfalls detailliert dargestellt.
Wie groß ist die Gig-Economy in Deutschland?
Der Essay beleuchtet die Schwierigkeit, die Größe der Gig-Economy in Deutschland genau zu bestimmen, aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit und unklarer Begriffsabgrenzung. Es werden Schätzungen des DGB und Ergebnisse einer IZA-Studie genannt, sowie konkrete Zahlen von Plattformen wie Foodora und Airbnb.
Welche Chancen und Risiken bietet die Gig-Economy?
Der Essay diskutiert die Chancen und Risiken der Gig-Economy, wobei die arbeitsrechtliche und soziale Absicherung der Gigworker ein zentraler Aspekt ist. Die fehlenden politischen Rahmenbedingungen und die daraus resultierenden Herausforderungen werden angesprochen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für den Essay?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gig-Economy, Plattformökonomie, Cloudwork, Crowdwork, Digitalisierung, Arbeitsmarkt, Deutschland, Foodora, Algorithmus, Arbeitsrecht, soziale Sicherung, Selbstständigkeit, Arbeitnehmer, Uberization, Arbeitsbedingungen und soziale Kontrolle.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Gig-Economy in Deutschland. Riskant flexibel?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064403