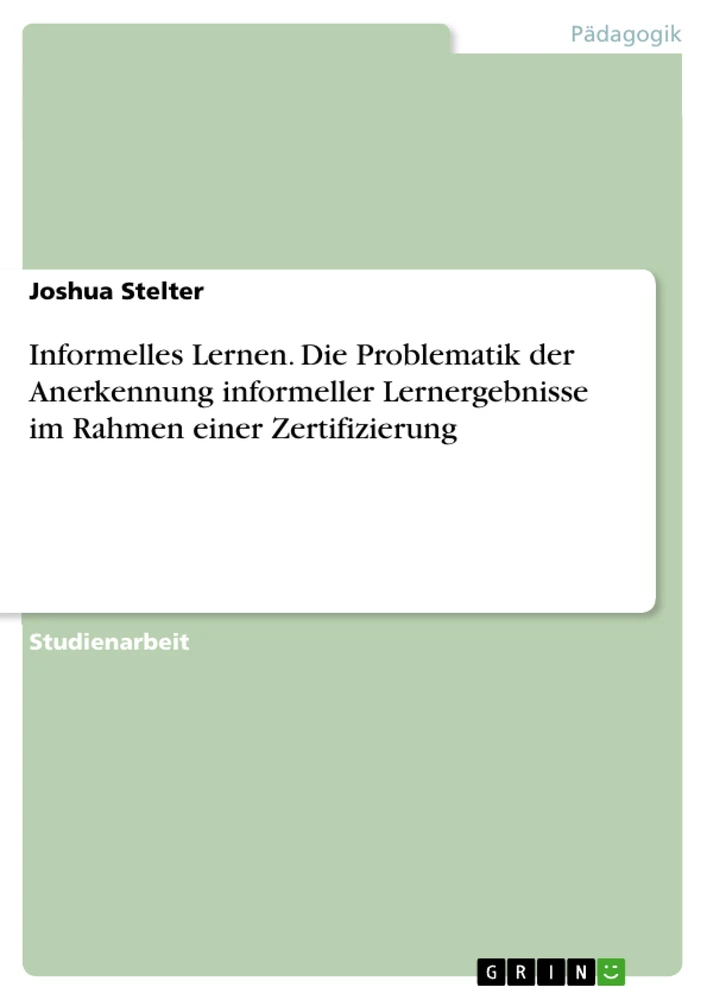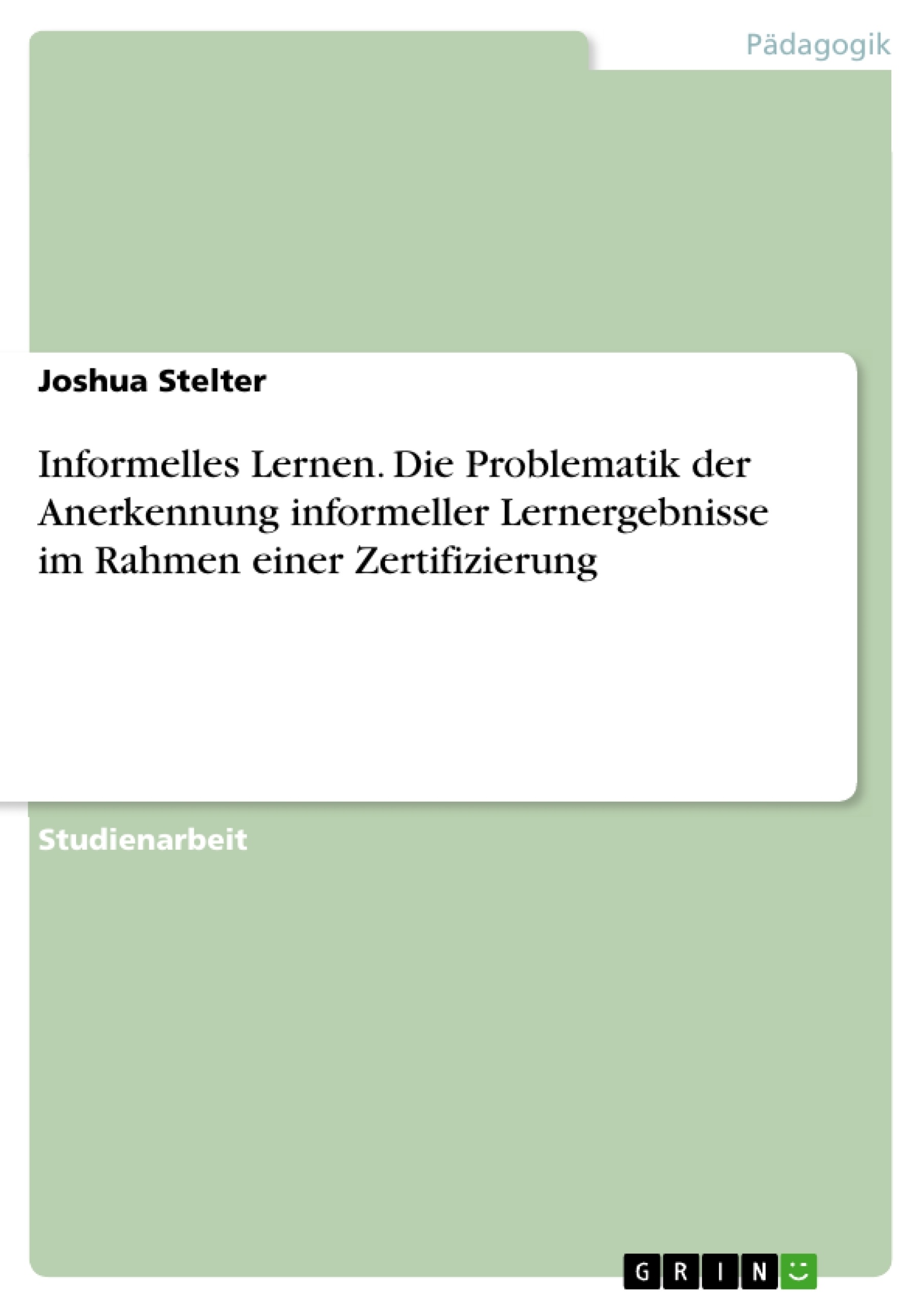Diese Arbeit bemüht sich, die Frage zu beantworten, warum die Anerkennung im Rahmen einer Zertifizierung von informellen Lernergebnissen problematisch ist und an-schließend vor dem Hintergrund der Digitalisierung näher ausgeführt.
Dafür wird folgend im ersten Teil eine Begriffserläuterung des informellen Lernens in Abgrenzung zum formalen und nicht formalen Lernen unternommen. Dabei soll die Zertifizierungsproblematik bereits skizziert werden. Im zweiten Teil wird sich mit der Entwicklungsgeschichte des informellen Lernens beschäftigt und aufgezeigt, welche bildungspolitischen und gesellschaftlichen Umstände sowie relevante Akteure und Institutionen eine tragende Rolle spielen, um auch die Problematik aus dieser Perspektive besser nachvollziehen zu können. Darauf basierend wird im dritten Teil die aktuelle Zertifizierungsproblematik behandelt und in den Kontext der Digitalisierung eingebunden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Hinführung zum Thema
- 2. Informelles Lernen – Begriffserläuterung in Abgrenzung zum formalen und non-formalen Lernen
- 3. Entwicklungsgeschichte des Informellen Lernens
- 3.1 Ausgangslage der Entwicklungsgeschichte des informellen Lernens
- 3.2 Entwicklungsgeschichtliche Ursachen und Hintergründe für die Problematik der Anerkennung informeller Lernergebnisse
- 4. Die Zertifizierungsproblematik
- 4.1 Anerkennung im Rahmen einer Zertifizierung informeller Lernergebnisse
- 4.2 Entwicklung im Rahmen der Digitalisierung mit Bezug auf informelles Lernen
- 5. Konklusion
- 5.1 Resümee
- 5.2 Perspektive auf zukünftige Entwicklungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Problematik der Anerkennung informeller Lernergebnisse im Kontext von Zertifizierungen. Sie beleuchtet die Bedeutung informellen Lernens im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung und analysiert die Herausforderungen bei der Formalisierung und Bewertung dieser Lernprozesse. Ziel ist es, die Ursachen für die Schwierigkeiten der Anerkennung zu verstehen und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zu geben.
- Definition und Abgrenzung informellen Lernens von formalem und non-formalem Lernen
- Entwicklungsgeschichte und gesellschaftliche Ursachen der Anerkennungsproblematik
- Herausforderungen der Zertifizierung informeller Lernergebnisse
- Der Einfluss der Digitalisierung auf informelles Lernen und dessen Anerkennung
- Zukünftige Perspektiven für die Anerkennung informellen Lernens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung und Hinführung zum Thema: Die Einleitung führt in das Thema der Anerkennung informeller Lernergebnisse ein und betont die zunehmende Bedeutung informellen Lernens im beruflichen Kontext aufgrund von Globalisierung, Digitalisierung und sich verändernden Anforderungsprofilen. Sie hebt die Diskrepanz zwischen der hohen Relevanz informellen Lernens und den Schwierigkeiten bei dessen formaler Anerkennung hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Informelles Lernen – Begriffserläuterung in Abgrenzung zum formalen und non-formalen Lernen: Dieses Kapitel widmet sich der komplexen Definition von informellen Lernen. Es differenziert zwischen formalem, non-formalem und informellem Lernen, wobei insbesondere die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und der daraus resultierenden Vielfalt an Definitionen betont werden. Die unterschiedlichen Ansätze und Definitionen von Organisationen wie der OECD werden diskutiert und kritisch beleuchtet, um die Herausforderungen bei der einheitlichen Begriffsbestimmung aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf der Kennzeichnung informellen Lernens als ungeplantes, beiläufiges und oft unbewusstes Lernen. Die Kapitel diskutiert auch die unterschiedlichen Arten der Wissensverarbeitung (reflexiv und implizit) innerhalb von informellen Lernprozessen.
3. Entwicklungsgeschichte des Informellen Lernens: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des informellen Lernens und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich der Anerkennung. Es analysiert die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Faktoren, die zur Problematik der Anerkennung informeller Lernergebnisse beigetragen haben. Es werden wichtige Akteure und Institutionen identifiziert und deren Rolle für die Entwicklung der Situation analysiert. Die Zusammenfassung des Kapitels zeigt die langfristige Entwicklung der Herausforderungen und erklärt den Zusammenhang zwischen historischen Ereignissen und der aktuellen Situation auf.
4. Die Zertifizierungsproblematik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die konkreten Schwierigkeiten bei der Zertifizierung informeller Lernergebnisse. Es analysiert die Anerkennungsprozesse im Detail und beleuchtet die Herausforderungen in der Bewertung informellen Wissens und Können im Vergleich zu formal erworbenen Qualifikationen. Der Einfluss der Digitalisierung auf die Zertifizierungsproblematik wird ausführlich behandelt, inklusive der Möglichkeiten und der Herausforderungen, die sich aus den neuen Technologien ergeben.
Schlüsselwörter
Informelles Lernen, formales Lernen, non-formales Lernen, Zertifizierung, Anerkennung, Digitalisierung, Kompetenzen, Wissensverarbeitung, Bildungspolitik, gesellschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Anerkennung Informeller Lernergebnisse
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Problematik der Anerkennung informeller Lernergebnisse, insbesondere im Kontext von Zertifizierungen. Sie beleuchtet die Bedeutung informellen Lernens im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung und analysiert die Herausforderungen bei der Formalisierung und Bewertung dieser Lernprozesse. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Begriffserklärung informellen Lernens im Vergleich zu formalem und non-formalem Lernen, einen historischen Überblick über die Entwicklung des informellen Lernens und die damit verbundenen Anerkennungsprobleme, eine detaillierte Analyse der Zertifizierungsproblematik und schließlich eine Schlussfolgerung mit einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Was versteht die Arbeit unter informellem Lernen?
Die Arbeit definiert informelles Lernen als ungeplantes, beiläufiges und oft unbewusstes Lernen. Sie betont die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zu formalem und non-formalem Lernen und diskutiert verschiedene Definitionen und Ansätze, inklusive der Betrachtung unterschiedlicher Arten der Wissensverarbeitung (reflexiv und implizit).
Welche historischen Aspekte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung des informellen Lernens und die damit verbundenen Herausforderungen bezüglich der Anerkennung. Sie analysiert die gesellschaftlichen und bildungspolitischen Faktoren, die zur Problematik der Anerkennung informeller Lernergebnisse beigetragen haben, und identifiziert wichtige Akteure und Institutionen.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Digitalisierung auf informelles Lernen und dessen Anerkennung. Sie betrachtet sowohl die Möglichkeiten als auch die Herausforderungen, die sich aus neuen Technologien für die Zertifizierung informeller Lernergebnisse ergeben.
Welche konkreten Probleme der Zertifizierung werden angesprochen?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Schwierigkeiten bei der Bewertung informellen Wissens und Könnens im Vergleich zu formal erworbenen Qualifikationen. Sie analysiert die Anerkennungsprozesse im Detail und beleuchtet die Herausforderungen bei der Übersetzung informell erworbener Kompetenzen in formale Zertifizierungen.
Welche Schlussfolgerungen und Perspektiven werden gegeben?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen bezüglich der Anerkennung informeller Lernergebnisse. Sie skizziert mögliche Lösungsansätze und Perspektiven für eine verbesserte Anerkennung informellen Lernens.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Informelles Lernen, formales Lernen, non-formales Lernen, Zertifizierung, Anerkennung, Digitalisierung, Kompetenzen, Wissensverarbeitung, Bildungspolitik, gesellschaftliche Entwicklung.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung und Hinführung zum Thema; 2. Informelles Lernen – Begriffserläuterung in Abgrenzung zum formalen und non-formalem Lernen; 3. Entwicklungsgeschichte des Informellen Lernens; 4. Die Zertifizierungsproblematik; 5. Konklusion (Resümee und Ausblick).
- Arbeit zitieren
- Joshua Stelter (Autor:in), 2021, Informelles Lernen. Die Problematik der Anerkennung informeller Lernergebnisse im Rahmen einer Zertifizierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1064561