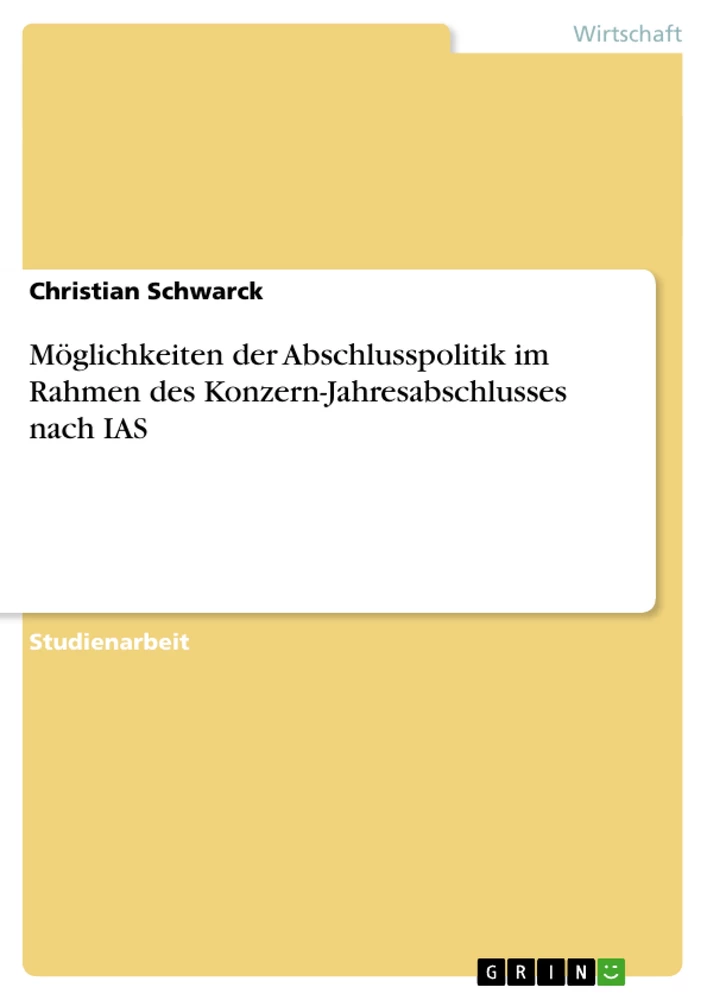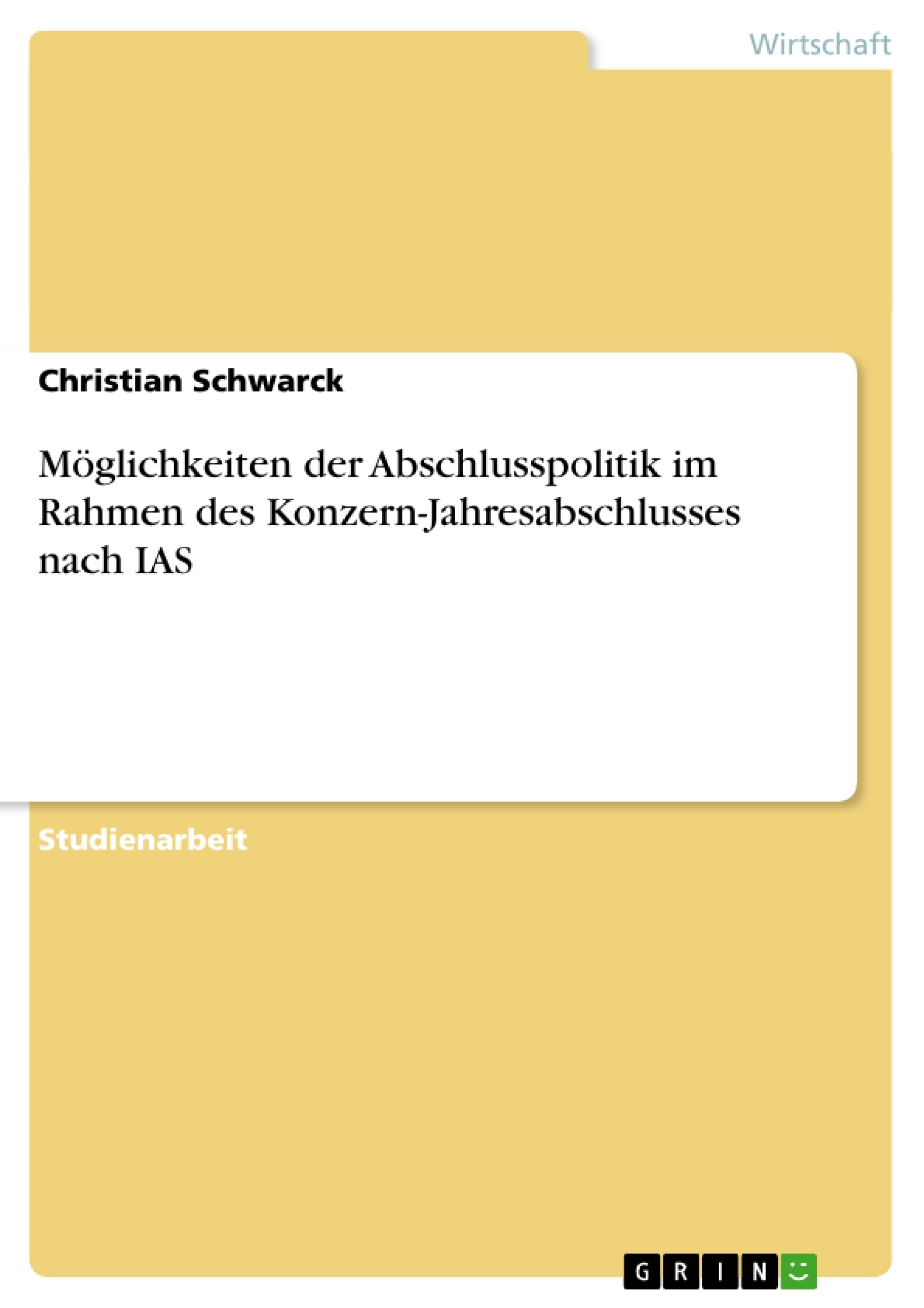Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
1. Grundlagen der Jahresabschlusspolitik
1.1 Begriff der Jahresabschlusspolitik
1.2 Aktionsparameter der Jahresabschlusspolitik
1.3 Objekte der Jahresabschlusspolitik
1.4 Ziele der Jahresabschlusspolitik
2. Möglichkeiten der materiellen Jahresabschlusspolitik im Einzel- und Konzernabschluss
2.1 Allgemeine Regelungen
2.1.1 Bewertung nach dem Framework
2.1.2 Bestimmung der Anschaffungs- und Herstellungskosten
2.1.3 Beizulegender Zeitwert (fair value)
2.1.4 Erzielbarer Betrag (recoverable amount)
2.2 Immaterielle Vermögensgegenstände
2.3 Sachanlagevermögen
2.4 Leasinggeschäfte
2.5 Vorratsvermögen
2.6 Rückstellungen
2.7 Latente Steuern
2.8 Langfristige Auftragsfertigung
3. Möglichkeiten der Jahresabschlusspolitik ausschließlich im Konzern-Jahresabschluss
3.1 Grundkonzept nach IAS
3.2 Autonome Konzernabschlusspolitik
3.3 Einbeziehung von Tochterunternehmen
3.4 Wahlrecht bei Gemeinschaftsunternehmen
3.5 Abschlusspolitik im Rahmen der Kapitalkonsolidierung
3.6 Grundsatz der Wesentlichkeit
3.7 Fremdwährungsumrechnung
4. Konzernabschlusspolitik der technotrans AG
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Einleitung
Der seit einigen Jahren erkennbare Trend zur Inanspruchnahme der internationalen Kapitalmärkte und die damit verbundene Entwicklung global agierender Konzerne hat das Bedürfnis nach einer Harmonisierung der Rechnungslegung stark erhöht. Gerade im Kampf der Unternehmen um neue Kapitalquellen und Märkte ist die
Vergleichbarkeit, der den Abschlussadressaten zur Verfügung gestellten Informationen, zu einer existenziellen Frage geworden. [1] Das International Accounting Standards Committee (IASC), als private Organisation mit der Harmonisierung der Rechnungslegung befasst, hat durch seine International Accounting Standards (IAS) international große Beachtung gefunden.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der Jahresabschlusspolitik im Rahmen des Konzern-Jahresabschlusses nach IAS. Dabei werden die Aktionsparameter der Jahresabschlusspolitik sowohl für den Einzel- und Konzernabschluss, als auch nur für den Konzernabschluss dargestellt. Auf die Betrachtung sachverhaltsgestaltender Maßnahmen vor dem Bilanzstichtag wird verzichtet, da ihr Umfang den Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde und sie in den meisten Fällen für den Betrachter nicht sichtbar werden. Ebenfalls werden formelle Gestaltungen nicht thematisiert. Die Betrachtung ist ausschließlich auf materielle Möglichkeiten der Jahresabschlusspolitik gerichtet. Im Verlauf der Arbeit wird weiterhin auf die wesentlichen abschlusspolitischen Gestaltungsparameter eingegangen, die im Konzernabschluss der technotrans AG Eingang gefunden haben.
1. Grundlagen der Jahresabschlusspolitik
1.1 Begriff der Jahresabschlusspolitik
Von Politik spricht die betriebswirtschaftliche Literatur häufig „im Falle bewussten Handelns und Gestaltens im Hinblick auf die Ziele der Unternehmung“[2]. Damit könnte die Jahresabschlusspolitik als eine bewusste und zielgerichtete Ausnutzung jahresabschlusspolitischer Aktionsparameter im Rahmen der gesetzlichen Normen verstanden werden. Der von vielen Autoren verwendete Begriff der Bilanzpolitik, der synonym für Jahresabschlusspolitik benutzt wird, kann die eigentlichen Möglichkeiten nicht vollkommen darstellen, da nicht nur die Bilanz,
sondern sämtliche Elemente des Jahresabschlusses (financial statement) Ansatzpunkte für die Abschlusspolitik bieten.
Ein Verlassen des legalen Bereiches wird als Jahresabschlussfälschung bezeichnet.
1.2 Aktionsparameter der Jahresabschlusspolitik
Für die Systematisierung der Jahresabschlusspolitik gibt es zwei zentrale Ansatzpunkte. Wird die Politik mittels Beeinflussung der Sachverhaltsdarstellung betrieben, handelt es sich um Jahresabschlusspolitik im engeren Sinne.[3] Als Aktionsparameter werden Wahlrechte und Ermessensspielräume unterschieden.
Im Falle der Sachverhaltsgestaltung wird von einer Jahresabschlusspolitik im weiteren Sinne gesprochen.[4] Eine Erkennbarkeit der Maßnahmen ist für den externen Betrachter schwierig oder unmöglich.
Wahlrechte liegen dann vor, wenn an einen gegebenen Tatbestand mindestens zwei verschiedene, eindeutig fixierte, einander ausschließende Normenfolgen anknüpfen und der Abschlussersteller bestimmt, welche von ihnen eintritt.[5]
Ermessensspielräume ergeben sich, da der Normengeber zwar Rechnungslegungsvorschriften erlassen hat, aufgrund einer nicht zu beseitigenden oder nicht beseitigten Ungenauigkeit sich aber vorliegende ökonomische Sachverhalte nicht eindeutig unter eine Rechnungslegungsnorm subsumieren lassen oder die Handlungsanweisungen einer Vorschrift nicht scharf umrissen sind, so dass die konkrete Ausgestaltung der in der Norm geforderten Rechnungslegungskonsequenzen im Ermessen des
Jahresabschlusserstellers liegt.[6]
Innerhalb der Ermessensspielräume kann zwischen Verfahrens- und Individualspielräumen unterschieden werden. Dabei bieten die Verfahrensspielräume eine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen standardisierten Vorgehensweisen im Rahmen der Rechnungslegung. Sie können auch als faktisches Wahlrecht bezeichnet werden.[7] Als Beispiel sind die
„Bewertungsvereinfachungsverfahren“ zu nennen. Individualspielräume ergeben sich hingegen nicht aus bestimmten Verfahren, sondern aus der Unvollkommenheit des Wissens. Da dem Abschlussersteller meist nur unvollkommene Informationen über die gegenwärtige Lage und die zukünftige Entwicklung vorliegen, ergibt
sich daraus ein subjektiver Spielraum zur Beurteilung der Sachverhalte.[8] Beispiele sind die Schätzung von Nutzungsdauern für Anlagegegenstände bei Zeitabschreibung oder die Beurteilung der Höhe von Rückstellungen bei deren Bildung.
Die Trennung zwischen Verfahrens- und Individualspielräumen ist nicht immer klar , da individuelle Schätzwerte teilweise als Parameter in Verfahrenspielräume eingehen, so beispielsweise bei der Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer in einer Zeitabschreibungsmethode.
Bei der Betrachtung der Wirkungsrichtung der Aktionsparameter ist eine Einteilung der Jahresabschlusspolitik in eine materielle und eine formelle Ausprägung möglich. Die materielle Jahresabschlusspolitik zielt vornehmlich auf die Beeinflussung des ausgewiesenen Jahresergebnisses, die formelle hingegen beeinflusst die äußere Form, insbesondere die Gliederung, den Ausweis und damit die Struktur, sowie die Erläuterungen.[9]
1.3 Objekte der Jahresabschlusspolitik
Als Objekte einer Jahresabschlusspolitik kommen alle Bestandteile des Jahresabschlusses (financial statement) in Betracht.[10] Als Bestandteile ergeben sich aus den IAS:
1. Bilanz (balance sheet),
2. Gewinn- und Verlustrechnung (income statement),
3. Ausweisspiegel der erfolgsneutralen Eigenkapital- veränderungen (statement of non-owner movements in equity),
4. Cash-Flow-Rechnung (cash flow statement) und
5. Anhang (notes to the financial statements).
1.4 Ziele der Jahresabschlusspolitik
Allgemein versucht die Unternehmung die Verhaltensweisen und Entscheidungen der Abschlussadressaten mit Hilfe der Jahresabschlusspolitik in ihrem Sinne zu beeinflussen.[11] Ausgehend von der Informationsfunktion des Jahresabschlusses fordern Fachkreise einen Wechsel vom bisherigen Financial Accounting zum Business Reporting, bei dem zur Erhöhung der Transparenz und Vergleichbarkeit vorhandene Wahlrechte abzuschaffen sind.[12] In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass IAS-Abschlüsse auch ein Instrument der Investor-Relation-Politik, insbesondere unter dem Aspekt des mittlerweile weit verbreiteten shareholder-value- Gedankens, sein können.[13]
[...]
[1] Vgl. Hayn, S., 1994, S. 713; Goebel, A., 1994, S. 2457.
[2] Vgl. Bieg, H., 1993, S. 97.
[3] Vgl. Kußmaul, H./Lutz, R., 1993b, S. 399.
[4] Vgl. Kußmaul, H./Lutz, R., 1993b, S. 399.
[5] Vgl. Ruhnke, K./Schmidt, M./Seidel, T., 2001, S. 657
[6] Vgl. Marettek, A., 1976, S. 515.
[7] Vgl. Kußmaul, H./Lutz, R., 1993b, S. 401
[8] Vgl. Kußmaul, H./Lutz, R., 1993b, S. 401.
[9] Vgl. Kußmaul, H./Lutz, R., 1993b, S. 400; Peemöller, V., 1993, S. 169.
[10] Vgl. Scheren, M., 1993, S. 61.
[11] Vgl. Kußmaul, H./Lutz, R., 1993a, S. 344.
[12] Vgl. Schmalenbach-Gesellschaft, 2001, S. 160.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit den Möglichkeiten der Jahresabschlusspolitik im Rahmen des Konzern-Jahresabschlusses nach IAS (International Accounting Standards).
Was sind die Aktionsparameter der Jahresabschlusspolitik?
Die Aktionsparameter der Jahresabschlusspolitik sind Wahlrechte und Ermessensspielräume. Wahlrechte entstehen, wenn für einen gegebenen Sachverhalt mehrere, eindeutig festgelegte Normenfolgen existieren. Ermessensspielräume entstehen aufgrund von Ungenauigkeiten in den Rechnungslegungsvorschriften.
Was ist der Unterschied zwischen materieller und formeller Jahresabschlusspolitik?
Die materielle Jahresabschlusspolitik zielt auf die Beeinflussung des ausgewiesenen Jahresergebnisses ab. Die formelle Jahresabschlusspolitik beeinflusst die äußere Form, insbesondere die Gliederung, den Ausweis und die Erläuterungen des Jahresabschlusses.
Welche Bestandteile des Jahresabschlusses können Objekte der Jahresabschlusspolitik sein?
Als Objekte der Jahresabschlusspolitik kommen alle Bestandteile des Jahresabschlusses (financial statement) in Betracht, einschließlich der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung, des Ausweisspiegels der erfolgsneutralen Eigenkapitalveränderungen, der Cash-Flow-Rechnung und des Anhangs.
Was sind die Ziele der Jahresabschlusspolitik?
Im Allgemeinen versucht die Unternehmung, die Verhaltensweisen und Entscheidungen der Abschlussadressaten mit Hilfe der Jahresabschlusspolitik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dies kann auch ein Instrument der Investor-Relation-Politik sein.
Was versteht man unter Jahresabschlussfälschung?
Ein Verlassen des legalen Bereiches wird als Jahresabschlussfälschung bezeichnet.
Was sind Verfahrens- und Individualspielräume innerhalb der Ermessensspielräume?
Verfahrensspielräume bieten eine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen standardisierten Vorgehensweisen im Rahmen der Rechnungslegung. Individualspielräume ergeben sich aus der Unvollkommenheit des Wissens über die gegenwärtige Lage und die zukünftige Entwicklung.
Was ist der Unterschied zwischen Jahresabschlusspolitik im engeren und weiteren Sinne?
Jahresabschlusspolitik im engeren Sinne wird durch Beeinflussung der Sachverhaltsdarstellung betrieben, unter Nutzung von Wahlrechten und Ermessensspielräumen. Jahresabschlusspolitik im weiteren Sinne wird durch Sachverhaltsgestaltung betrieben, wobei die Maßnahmen für den externen Betrachter schwer erkennbar sind.
- Quote paper
- Christian Schwarck (Author), 2001, Möglichkeiten der Abschlusspolitik im Rahmen des Konzern-Jahresabschlusses nach IAS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106491