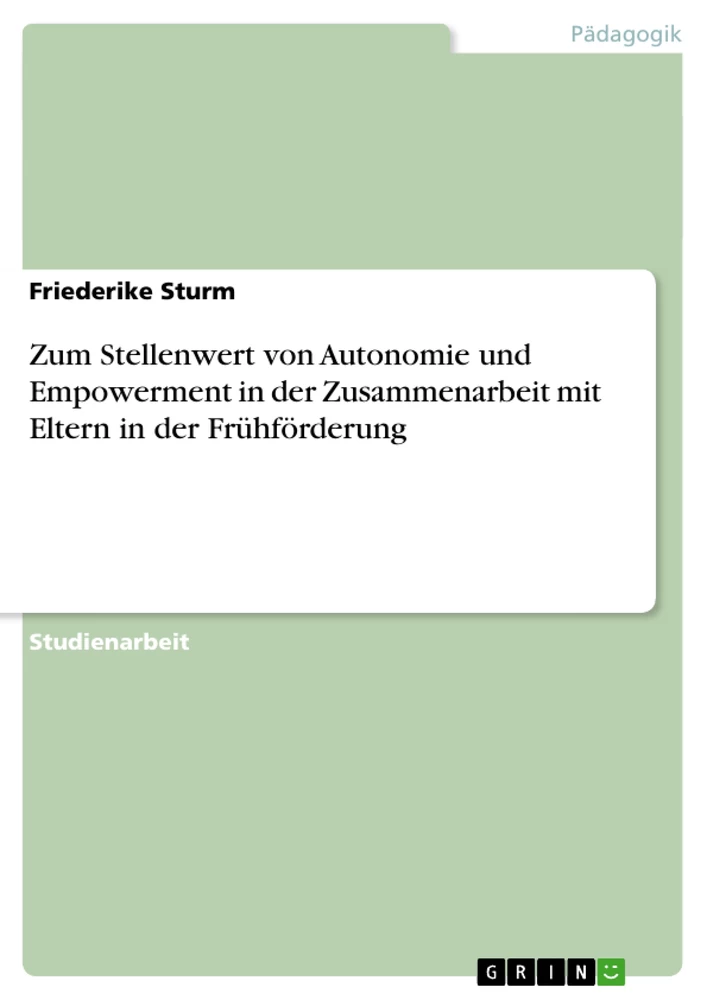Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Anfang eines Weges, der unerwartete Herausforderungen bereithält – die frühe Förderung Ihres Kindes. Doch was, wenn die vermeintliche Hilfe mehr Schatten als Licht wirft? Dieses Buch taucht tief ein in die komplexe Welt der Frühförderung, beleuchtet kritische Stimmen von Experten und betroffenen Eltern, die sich gegen ein technokratisches System und entmündigende Praktiken wehren. Es deckt die oft übersehenen kulturellen Defizite auf und zeigt, wie Eltern in eine „sozial arrangierte Abhängigkeit“ geraten können, in der ihre Kompetenzen und Bedürfnisse ignoriert werden. Doch es gibt Hoffnung! Das Buch präsentiert das Empowerment-Konzept als einen Weg zu echter Selbstbestimmung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Entdecken Sie, wie Eltern ihre eigenen Stärken wiederfinden, ihre Rechte einfordern und gemeinsam mit Fachleuten eine individuelle und lebensweltorientierte Förderung gestalten können. Lernen Sie, wie Sie die Balance zwischen Autonomie und Unterstützung finden, um Ihrem Kind die bestmögliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Eltern, Fachkräfte und alle, die sich für eine inklusive und würdevolle Frühförderung einsetzen wollen. Es bietet fundierte Einblicke, praktische Anleitungen und inspirierende Beispiele für eine gelingende Partnerschaft, die das Kind in den Mittelpunkt stellt und die Familie stärkt. Erfahren Sie, wie Sie gängige Fallen vermeiden, eine Frühförderkultur der Wertschätzung und des Respekts etablieren und so die Weichen für eine positive Zukunft Ihres Kindes stellen können. Lassen Sie sich ermutigen, den eigenen Weg zu gehen und die Herausforderungen mit Selbstvertrauen und Zuversicht anzunehmen. Dieses Buch ist Ihr Kompass im Dschungel der Frühförderung, der Ihnen hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und Ihrem Kind ein erfülltes Leben zu ermöglichen. Schlüsselwörter: Frühförderung, Empowerment, Elternarbeit, Inklusion, Behinderung, Entwicklungsförderung, Selbstbestimmung, Partnerschaft, Familie, Kritik, Pädagogik, Therapie, Beratung, Lebensweltorientierung, Kompetenzorientierung, soziale Unterstützung, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Elternseminare, Autonomie, Respekt.
Inhaltsverzeichnis
1. Frühförderung
1.1 Was ist Frühförderung?
1.2 Zielgruppen der Frühförderung
1.3 Aufgaben und Ziele der Frühförderung
2. Kritik an der klassischen Frühförderung
2.1 Die Kritik aus der Sich eines Fachmanns: Hans Weiß
2.2 Die Kritik aus Sicht einer betroffenen Mutter: Jutta Behringer
3. Das Empowerment-Konzept
3.1 Die Grundzüge des Empowermentkonzepts
3.2 Empowerment in der Frühförderung
3.3 Partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten
4. Literaturverzeichnis
1. Frühförderung
1.1 Was ist Frühförderung?
Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Vorschulalter, die eine Behinderung haben, oder davon bedroht sind. Außerdem bietet sie Hilfen für die Eltern und andere Bezugspersonen dieser Kinder an.
Ziel der Frühförderung ist es, eine kindliche Entwicklungsgefährdung möglichst früh zu erkennen und fachliche wie menschliche Hilfen anzubieten, die am ehesten dazu beitragen, dass die Kinder sich möglichst gut entwickeln, ihre Kompetenzen entfalten und sich in ihre Lebenswelt integrieren zu können.
Otto Speck nennt als Eckpfeiler der Frühförderung die Frühen Hilfen, Prävention, Förderung und Kooperation mit den Bezugspersonen1. Um diese Eckpfeiler bedarfsgerecht und zugeschnitten auf das einzelne Kind und seine Familie einzusetzen, haben Frühförderstellen einen entsprechenden fachlichen und organisatorischen Hintergrund. Sie arbeiten dabei interdisziplinär, ganzheitlich und familienorientiert. Außerdem geben sie Hilfe zur Selbsthilfe und sozialer Integration und beziehen das soziale Umfeld mit ein.
Frühförderung ist ein gemeinde- und familiennahes Angebot, das von Frühförderstellen gemacht wird. Diese sind konzipiert als offene Anlaufstellen für Eltern, die sich Sorgen um die Entwicklung ihrer Kinder machen. Als regionale Einrichtungen sollten sie von den Familien gut erreichbar sein. Um der Familienorientierung besser gerecht werden zu können, arbeiten viele Stellen auch mobil (Hausbesuche).
1.2 Zielgruppen der Frühförderung
Für wen ist Frühförderung da? Auf diese Frage antworten Thurmair und Naggl: „Als allgemeine Bestimmung dazu kann formuliert werden, dass Angebote der Frühförderung sich an Kinder richten, die behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, sowie an deren Eltern.“2 Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um körperliche, geistige oder seelische Auffälligkeiten handelt.
Diese Definition macht die große Bandbreite der Zielgruppe von Frühförderung deutlich. Sie soll Hilfe leisten und vorbeugend wirksam werden. Ihren präventiven Auftrag akzentuiert der Begriff der ‚drohenden Behinderung’. Es werden damit Risiken angesprochen, die sich in Zukunft als Behinderung manifestieren können und denen zu einem frühen Zeitpunkt entgegen gewirkt werden kann. Fachlich entspricht dieser Begriff den Kategorien der ‚Entwicklungsverzögerung’ und ‚Entwicklungsauffälligkeit’, die eine Vielzahl von Auffälligkeiten bei Kindern, verbunden mit ungünstigen Milieus, umfassen.
Die Autoren konkretisieren unter Berücksichtigung des präventiven und Hilfe-Auftrags der Frühförderung folgende Zielgruppen:
- Säuglinge und Frühgeborene mit Entwicklungsrisiken
- mehrfachbehinderte Kinder
- Kinder mit Verhaltensbesonderheiten und Lern- und Leistungsstörungen
- Entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien
- Verunsicherte Eltern und Familien3
1.3 Aufgaben und Ziele der Frühförderung
‚Frühförderung’ ist der Oberbegriff für die Gesamtaufgabe der Diagnostik, Therapie und Förderung, Elternberatung und Vernetzungsarbeit.
Ihre Ziele lassen sich auf folgenden drei Ebenen formulieren:
1. kindbezogen
2. bezogen auf die Eltern und andere wesentliche Bezugspersonen
3. und auch bezogen auf gesellschaftliche Anliegen
Im Hinblick auf die Kinder hat Frühförderung im wesentlichen folgende drei Ziele: die Entfaltung der Kompetenzen der Kinder, Entwicklung ihres Selbsterlebens und Selbstwertgefühls und die Integration in ihre Lebenswelt.
Elternbezogen hat sie die Ziele, die Kompetenzen der Eltern in bezug auf den Umgang mit ihrem Kind zu stärken und zu erweitern, und die Eltern bei ihrer Auseinandersetzung mit der Situation zu begleiten.
Das gesellschaftliche Anliegen der Integration von Menschen mit einer Behinderung verlangt auch von der Frühförderung einen Betrag. Sie muss zunächst die notwendigen Hilfen sicherstellen, sie muss also erreichbar sein und nach den aktuellen Erkenntnissen arbeiten können. Außerdem sollte sie sich gegenüber ethischen und gesellschaftlichen Fragen, wie beispielsweise die der Pränataldiagnostik, eine klare Position erarbeiten und diese auch vertreten.
2. Kritik an der klassischen Frühförderung
2.1 Die Kritik aus der Sich eines Fachmanns: Hans Weiß
Hans Weiß arbeitet in seinem Artikel „Familien zwischen Autonomie und sozial arrangierter Abhängigkeit. Kritische Fragen zur Kultur der Frühförderung“4 grundsätzliche Kritikpunkte an der klassischen Frühförderung heraus. Sein Hintergrund ist der intradisziplinäre Diskurs Ende der 1980er / Anfang der 1990er Jahre.
Dieser Diskurs dreht sich um die Neuorientierung und Weiterentwicklung der Frühförderung und wurde in besonders zugespitzter Weise von Monika Jonas und Dietmut Niedecken entfacht.
Als Beispiel für diese Kritik sei die Argumentation von Jonas kurz nachgezeichnet: sie wendet sich gegen die ‚sozial arrangierte Abhängigkeit’ der Mütter im Rahmen der Frühförderung. Sie unterstellt der Frühförderung die Ideologie, aus den staatlich- ökonomischen Interessen der Arbeitsfähigkeit und Selbstversorgung heraus die Rehabilitation eines Menschen mit Behinderung zu fördern. Außerdem würden die Mütter zur Liebe verpflichtet und diese Liebespflicht zum Zwecke der Förderung eingesetzt.
Weiß relativiert die Kritik, indem er zugesteht, dass in der theoretischen Neuorientierung bzw. Weiterentwicklung der Disziplin diese Kritik bereits Eingang gefunden hätte. So wurde beispielsweise das die Eltern funktionalisierende Kotherapeuten- Modell abgelöst von einem Modell der partnerschaftlichen Kooperation. Aber er bemerkt auch, dass die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis nicht vergessen werden sollte. Für ihn scheinen die Tendenzen im Sinne der traditionellen Frühförderung in der Praxis weiterhin als handlungsweisend zu bestehen. Weiß nennt diesen Frühförderungstyp pointiert das ‚technokratisch-funktionalistische Modell’.
Technokratisch deshalb, weil es einem großen Glauben an die Beeinflussbarkeit der kindlichen Entwicklung durch differenzierte Fördertechniken verhaftet ist. Seinen funktionalistischen Charakter zeigt es dadurch, dass es die Eltern für Zwecke der Förderung funktionalisiert - und dies gelte nicht nur für den ko- therapeutischen Ansatz.
Weiß sieht in der Kritik an diesem Modell den Anlass, die Kultur der Frühförderung zu beleuchten und ihre Schwachstellen aufzuzeigen. Auf Basis des ‚weiten’ Kulturbegriffs von Mario Erdheim versteht er unter Kultur in diesem Zusammenhang „... nicht nur ‚Höheres’..., also Kunst, Wissenschaft oder Religion. ‚Kultur’ ist auch Lebensprozess der Individuen selber, die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten, und ihre Handlungen mit Sinn und Bedeutung belegen.“5 Frühförderung ist Teil der gesamten Kultur und entwickelt als System selbst eine spezifische Kultur. Die spezifische Frühförderkultur umfasst sowohl ihr Selbstverständnis als auch die Art und Weise der Gestaltung ihrer Arbeitswirklichkeit.
Im Weiteren werden von Weiß Momente des technokratisch- funktionalistischen Modells aufgezeigt, die er gleichzeitig als kennzeichnend für eine unzureichende Kultur der Frühförderung sieht. Er nennt hier den ‚negativen’ Begründungszusammenhang für die Eltern- und Familienarbeit, nach dem Familien mit behinderten Kindern als ‚behinderte’ Familien gesehen werden. Des weiteren leiste Elternarbeit nicht Hilfe für alltägliche Probleme, sondern es herrsche eine zweckrationale Perspektive, nach der Eltern lediglich die professionelle Arbeit ‚am’ Kind unterstützen sollen. Weiß nennt die Hoffnungen der Eltern auf ‚Heilung’ der Behinderung. Diese werden von der Frühförderung genährt. Leider werde oft vergessen, die Ängste und Nöte der Eltern, das Kind könne behindert bleiben, und die elterliche Verzweiflung und Wut angemessen aufzufangen. Wie hier deutlich wird, kritisiert Weiß also nicht das konkrete Vorgehen der Frühförderung in der Fördersituation mit dem Kind. Sein Fokus liegt vielmehr auf dem Bild, das die Frühförderung von Eltern hat und auf ihrem Umgang mit Eltern.
Mittlerweile haben die kritischen Momente des klassischen Modells Eingang gefunden in die fachliche Diskussion. Von Mitarbeiten der Frühförderung sowie von einigen Autoren wurden daraufhin alternative Handlungsorientierungen für Frühförderer entwickelt. Diese möchte ich an dieser Stelle nicht weiter erläutern. Weiß kommt jedoch zu der Erkenntnis, dass auch die alternativen Modelle kulturelle Defizite aufweisen und die Situation der Eltern nicht adäquat behandeln können. „Der Glaube an die Wirksamkeit von ‚Behandlungstechnologien’ und damit einhergehende Förderverpflichtungen scheinen weiterhin einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auszuüben.“6
Im zweiten Teil seines Artikels7 befasst Hans Weiß sich mit der Frage nach den tieferen Gründen der defizitären Frühförderkultur. Seine grundsätzliche Antwort darauf lautet, dass das technokratisch-funktionalistische Modell der Frühförderung mit seinen dargestellten problematischen Konsequenzen im Zusammenhang mit der in der heutigen Zeit tendenziellen ‚Pädagogisierung der Kindheit’ zu sehen ist.
Pädagogisierende Tendenzen sieht er dabei nicht nur bei Eltern behinderter Kinder, sondern bei Eltern generell. Er führt dies auf die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse der vergangenen 200 Jahre zurück.
Die Menschen der vorindustriellen, ständischen Gesellschaft lebten in einer statisch-hierarchischen Sozial- und Ordnungsstruktur, welche wenig Spielraum für selbstbestimmte Entscheidungen ließ. Dies hatte Auswirkungen auf die intrapsychische Sicht der Menschen, die ihr Leben als schicksalshaftgegeben und gottbestimmt hinnahmen.
Die durch die Industrialisierung einsetzende soziale Mobilität ermöglichte den Menschen mehr Möglichkeiten der individuellen Lebensplanung und -gestaltung. Die Konsequenzen der Möglichkeiten einer ‚Selbstherstellung von Biographie’, wie Weiß es nennt, für das Selbstbild des Individuums lassen sich mit dem Slogan ‚Jeder ist seines Glückes Schmied’ charakterisieren. Bezogen auf die Sozialisation und Erziehung von Kindern wird die planvolle, gezielte Beeinflussbarkeit der Entwicklung durch ‚optimale Förderung’ zum Gebot für Eltern. „Erst aus den aufgezeigten gesellschaftlichen Veränderungen und ihren Auswirkungen auf das Selbstbild der Menschen vermögen wir zu ermessen, welcher psychische Druck (Hervorhebung: F.S.) daraus entstehen kann.“8
Psychischer Druck wird laut Weiß noch aus einem anderen Zusammenhang heraus auf die Eltern ausgeübt: Folge sozialer Mobilität sei neben dem bereits Erwähntem außerdem der „Verlust überlieferter Wissensbestände und Orientierungsmuster“9 speziell des Elternwissens. Weiß spricht mit Bezug auf Balzer und Rolli von der ‚traditionslosen Elternschaft’.
Dem Verlust traditionellen Wissens steht das von Professionellen vorgegebene ‚Ideal der perfekten Elternschaft’ gegenüber, welches in Elternzeitschriften und populärwissenschaftlichen Ratgebern verbreitet wird. Die daraus resultierenden Erziehungsstandards sind so hochgesteckt, dass sie von Eltern auf Dauer nicht eingelöst werden können. Mutter und Vater werden zu Entwicklungshelfern für ihr Kind und geraten so in einen kulturell vorgegebenen Druck, demnach sie auf eigene Bedürfnisse, Rechte und Interessen zugunsten des Kindes Verzicht leisten müssen.
Den Zusammenhang der ‚optimalen Förderung als Gebot der Moderne’ bezieht Weiß folgendermaßen auf die Kultur der Frühförderung:
Von dem ‚gesellschaftlichen Verblendungszusammenhang’10 förderbezogener Machbarkeit der kindlichen Entwicklung sind nicht nur die Eltern betroffen. Ebenso Professionelle sind von diesem Denken durchdrungen und es prägt die praktische Frühförderarbeit. Außerdem ist die große Akzeptanz des technokratischen-funktionalistischen Modells damit zu erklären, dass in der modernen Leistungsgesellschaft Behinderung nicht anders als unter dem Blickwinkel ‚technologischer Transformation’ zu sehen ist.
Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen fordert Weiß eine Neuorientierung des Selbstverständnisses der Frühförderung, wobei die tieferliegenden gesellschaftlichen Bedingungszusammenhänge berücksichtigt werden müssen. Es bedarf einer Theorie, die einseitig negative Begründungszusammenhänge für die Notwendigkeit der ‚Elternarbeit’ überwindet, und somit der Vorstellung einer elterlichen Expertenabhängigkeit entgegentritt.
2.2 Die Kritik aus Sicht einer betroffenen Mutter: Jutta Behringer11
Jutta Behringer ist Mutter einer Tochter mit schwerer Körperbehinderung als Folge von Sauerstoffmangel. Zur der Zeit, als sie den Bericht veröffentlichte, war sie bei der Elterninitiative des Kinderneurologischen Zentrums Bonn aktiv. Als Vorsitzende einer Arbeitsgruppe hatte sie das Ziel, Selbsthilfegruppen für Eltern behinderter Kinder aufzubauen. Die Arbeitsgruppe setzte sich zusammen aus Mitarbeitern des Bonner Zentrums und Eltern behinderter Kinder. Während der gemeinsamen Arbeit wurde die traditionelle Rollenverteilung zwischen Fachleuten und Patienten schnell sehr deutlich: „Auf der einen Seite waren die Fachleute mit ihrem therapeutischen Anspruch, aber wenig Kenntnis der realen Lebenssituation der Eltern behinderter Kinder. Auf der anderen Seite waren die Eltern, die nicht nur als ‚Ko-Therapeuten‘ ihrer Kinder angesehen werden, sondern die diesen Teil ihres Lebens aktiv mitgestalten und verbessern wollten.“12 Schnell erkannte die Arbeitsgruppe, dass dieses Rollenverständnis für eine erfolgreiche Kooperation aufgebrochen werden und neue Wegen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit gefunden werden müssen.
Zur Veränderung des Rollenverständnisses ist es ihr als betroffenen Mutter wichtig, die Situation der Eltern, ihre Ängste, Sorgen und Bedürfnisse zu verdeutlichen.
Die Belastung für Eltern beginnt, sobald ihnen auffällt, dass ihr Kind in der Entwicklung hinter Gleichaltrigen zurückbleibt und sich anders verhält als andere Kinder. Die schlägt um in Hoffnungslosigkeit, wenn eine Behinderung diagnostiziert wird. Es ist für Eltern schmerzhaft und schockierend, die Wahrheit über die Andersartigkeit ihres Kindes zu erfahren. Zu der Erkenntnis, dass Behinderung nicht heilbar ist, gelangen sie erst langsam. In der ersten Zeit setzten Eltern ihre ganze Hoffnung auf Therapien, die das Kind heilen sollen. Sie vertrauen auf Ärzte und Therapeuten. In dieser Situation besteht die Gefahr, dass sie ihre elterlichen Kompetenzen nicht mehr wahrnehmen und die Verantwortung in die Hände der Fachleute legen. Das Problem manifestiert sich, dadurch dass Ärzte und Therapeuten die Kompetenzen von Vater und Mutter nicht akzeptieren und die Verantwortung für das Kind bereitwillig übernehmen. Dabei berufen sie sich auf ihre Fachautorität. Eltern werden häufig nur als Ausführende der Therapie gesehen. Dazu ein Zitat von einer betroffenen Person: „Ich fühlte mich... so hilflos. Alle anderen wussten, was für mein Kind das Richtige war. Gefragt worden bin ich nicht.“13
Behringer fordert, dass Fachleute Eltern ernst nehmen in ihrer Kompetenz für ihr Kind. Da Mutter und Vater rund um die Uhr mit ihrem Kind zusammen sind, sind sie Experten und können am besten beurteilen, was gut für es ist. Beobachtungen der Eltern und ihre Ängste sollten immer Eingang finden in die Arbeit des Arztes. Im folgenden Beispiel wird dies deutlich: „Der Arzt hat mir nicht geglaubt, dass T. Krämpfe hat. Er sagte, das könne ich gar nicht beurteilen. Ich war richtig froh, als T. dann einen Anfall in der Praxis hatte, da hat er endlich eingesehen, dass ich recht hatte.“14
Ausserdem helfe Eltern bei der Diagnosemitteilung lediglich die Wahrheit als Basis für eine angemessene Verarbeitung der Tatsachen und Gestaltung eines gemeinsamen Lebens mit ihrem Kind. Neben Ehrlichkeit und Offenheit solle beim behandelnden Arzt die Bereitschaft zur emotionalen Anteilnahme vorhanden sein.
Da es heute immer noch so ist, dass die Mütter durch Therapieangebote, Arztbesuche, täglich Pflege mehr eingespannt sind als die Väter, plädiert Behringer auf eine neue Sicht auf die Mutter. Laut Schlack hat der psychosoziale Rahmen, in dem die Mutter mit ihrem Kind lebt, häufig mehr Einfluss auf die Entwicklung als ein umfassendes Therapieangebot.15 Deshalb sollten Fachleute wie Eltern akzeptieren, dass es ihren Kindern nur gut gehen kann, wenn es ihnen selbst auch gut geht. Speziell für die Mutter heisst das, dass sie sich nicht nur im Zusammenhang mit ihrem Kind und seinen Fortschritten erleben darf und Schuldgefühle empfindet, wenn erhoffte Erfolge ausbleiben. Ärzte wie Therapeuten sollten eine eigene Identität der Mutter als Individuum fördern und immer wieder thematisieren.
Auch für Gefühle des Trauerprozesses sollte in der Therapie Platz sein - besonders zu Beginn, aber auch später wird es immer wieder Situationen geben, in denen Eltern der Verlust ganz deutlich wird.
Schritte zu einer Partnerschaft zwischen Eltern und Fachleuten sollten auf Basis der geschilderten Sichtweisen erfolgen. Dabei ist für Behringer eine der wichtigsten Grundlagen einer jeden Partnerschaft der wechselseitige Respekt voreinander, ohne die Verantwortung des Partners für sein Kompetenzgebiet zu beschneiden.
3. Das Empowermentkonzept
3.1 Die Grundzüge des Empowermentkonzepts
Mit Empowerment sind Prozesse der Selbst-Bemächtigung gemeint. Es ist schwer, im deutschen ein angemessenes Wort für Empowerment zu finden. Wörtlich übersetzt heißt ‚(to) empower’: (sich) ermächtigen, (sich) befähigen. Die reflexive Form (sich...) entspricht dabei dem Gedanken des Empowerment eher als die transitive. Empowerment kann nicht direkt von Fachleuten hergestellt oder bewirkt werden, die Prozesse des Bewusstwerdens und Umsetzens können lediglich unterstütz werden. Empowerment hat zum Ziel, dass eigene Ressourcen gefunden und mobilisiert und Kompetenzen der Selbstgestaltung aufgedeckt oder wiedergefunden werden.
Das Empowerment-Konzept entstand innerhalb der us- amerikanischen Bürgerrechtsbewegung der 1960er und 1970er Jahren. Es geht dabei um die Idee, dass jeder Mensch und jede Gruppe in benachteiligten und schwierigen Situationen ihr Leben sozusagen in die ‚eigene Hand nehmen’ könne - und dies mit Hilfe eigener Stärken und auf der Grundlage gleicher Rechte für alle Mitglieder einer Gesellschaft.
Dieser Gedanke des Empowerment wurde in der amerikanischen Gemeindepsychologie besonders von Julian Rappaport weiterentwickelt. Er nahm die einseitige Ausrichtung an den Defiziten und der Hilfsbedürftigkeit von Menschen in schwierigen Lebenssituationen kritisch in den Blick. Besonders das Verständnis von solchen Menschen als ‚Kinder in Not’ bedeutete für ihn eine Entmündigung und den Verlust von Rechten. Bei dieser Bedürftigkeits-Perspektive, die Nöte und Defizite einer Person in den Vordergrund stellt, würden - möglicherweise verdeckte - Kompetenzen und Selbstgestaltungskräfte leicht übersehen. Gerade sie gelte es im Sinne der Selbsthilfe und selbstbestimmten Gestaltung eigener Lebensräume zu stärken.
Trotz der Abwendung von einer defizitären Sichtweise dürfen andererseits jedoch die besonderen Bedürfnisse dieses Personenkreises nicht verleugnet werden. Rappaport sieht die "Bedürftigkeits-Perspektive" und die "Rechte-Idee" im Empowerment-Ansatz angemessen verknüpft: "Unter 'empowerment' verstehe ich, dass es unser Ziel sein sollte, für Menschen die Möglichkeiten zu erweitern, ihr Leben zu bestimmen. (...) Mit dem Konzept 'empowerment' können wir nicht länger Menschen einfach als 'Kinder in Not' oder als 'Bürger mit Rechten' sehen, sondern vielmehr als vollwertige menschliche Wesen, die sowohl Rechte als auch Bedürfnisse haben. Wir müssen uns mit dem Widerspruch auseinandersetzen, dass selbst Menschen mit wenigen Fähigkeiten oder in extremen Krisensituationen, genauso wie jeder von uns, eher mehr als weniger Kontrolle über ihr eigenes Leben brauchen. Das heißt nicht notwendigerweise, dass wir deren Bedürfnisse nach Hilfe vernachlässigen, wenn wir für mehr Selbstbestimmung votieren."16
Was bedeuten diese Ausführungen über Empowerment für Frühförderung? Für eine Familie ist die Erkenntnis einer Behinderung eine tiefgreifende Krisenerfahrung. Individuelle Pläne und Wünsche für das Kind und die familiäre Zukunft müssen revidiert werden. Die Familie steht einem breiten Spektrum meist negativer Reaktionen des sozialen Umfeldes wie Erschrecken, Abwehr und Mitleid gegenüber. Laut Böhm17 kann man auf Basis gewisser Forschungsergebnisse im Bewältigungsprozess von Familien in Krisensituationen charakteristische Phasen des Empowermentprozesses erkennen.
Diesen Verlauf beschreibt Böhm mit Kieffer in vier Phasen:
1. Der Prozess beginnt mit dem Bruch einer zentralen Alltagsidentität, das heißt der Betroffene nimmt ein Ereignis als besonders schwerwiegend wahr. Dadurch beginnt die Entwicklung zu partizipatorischer Kompetenz, wobei sich die Einstellung zu (gesellschaftlichen) Autoritätssymbolen und -systemen verändert. „Die Entmystifikation von Macht und die Neuorientierung des Selbst in Beziehung zu Autorität ist die zentrale Entwicklungsaufgabe dieser anfänglichen ... Phase.“18 Bezogen auf Frühförderung ist die Geburt eines behinderten Kindes sowohl solch ein hoch emotional besetzter Bruch mit der familiären Alltagsidentität als auch einer Konfrontation mit anerkannten gesellschaftlichen Normen. Die ‚Entmystifizierung’ dieser Erwartungen und Normen, die das Kind mit Behinderung betreffen, vollzieht sich bei den Eltern während der Auseinandersetzung mit ihrem Kind und seinem So-Sein. Gleichzeitig entwickelt sich die von Kieffer genannte ‚partizipatorische Kompetenz’ weiter, worunter Böhm versteht, dass es durch den Prozess der eigenen Veränderung durch die Behinderung des Kindes zu einer aktiven Veränderung und Ausgestaltung der eigenen Familie und der sozialen und materiellen Umwelt kommt.19
2. Als zentralen Aspekt der zweiten Phase nennt Kieffer die ‚gegenseitige Unterstützung’: mit Hilfe einer unterstützenden Person oder der Unterstützung einer Gruppe Gleichbetroffener kommt es zur Weiterentwicklung des Empowermentprozesses. Die unterstützende Person oder Gruppe sollte eine Umgebung bereitstellen, in welcher der Betroffene ermutigt wird, Risiken einzugehen und Frustrationen auszudrücken. Außerdem sollten in dieser Umgebung Ängste gemildert werden können.
Solch eine Person könnte beispielsweise eine Mitarbeiterin der Frühförderung sein, die sich als Ansprechpartnerin bereit hält und für Eltern wie Kind individuell angemessene Hilfe anbieten kann. Gruppentreffen mit anderen betroffenen Eltern können emotionale und praktische Unterstützung bieten und der Informationsvermittlung dienen. Auch eventuell entstehende Freundschaften können eine Basis bilden, auf der positive wie negative Erlebnisse mit dem Kind verarbeitet werden.
3. Die ‚Phase der Verinnerlichung’: Im Laufe des Empowermentprozesses erleben Menschen eine Veränderung ihres Selbstkonzepts. Ihre Fähigkeiten, Ziele durch den Einsatz von Strategien zu erreichen und ihr kritisches Verständnis werden größer.
Je häufiger Eltern von Kindern mit einer Behinderung Entscheidungen treffen und sich mit Fachleuten auseinandersetzen müssen sowie Reaktionen der Umwelt auf die Behinderung ihres Kindes wahrnehmen, desto sicherer werden sie und sind in der Lage, adäquate Handlungsstrategien einzusetzen.
Die Veränderung des Selbstkonzeptes kann sich auf die Familieneinheit beziehen und stärkt dann vorwiegend das innerfamiliäre Leben. Es kann aber auch das Bedürfnis nach stärkerem Engagement in größeren sozialen Zusammenhängen zur Folge haben.
4. Die von Kieffer letztgenannte Phase ist die ‚Phase der Verpflichtung’. Dadurch, dass sich die partizipatorische Kompetenz immer weiter entwickelt, werden das neue Wissen und die erworbenen Fähigkeiten im Alltagsleben verankert. Betont werden sollte der soziale Aspekt dieser Phase: die Weitergabe der gewonnenen Erfahrungen an andere. Mit dieser letzten Phase ist der Empowermentprozess nicht abgeschlossen, er zieht sich durch den ganzen Lebenslauf. „Es ist klar, dass das Ringen um persönliches Wachstum anhält. Diese Kontinuität stimmt mit dem überein, was wir über die Entwicklung innerhalb der ganzen Lebensspanne wissen.“20
3.2 Empowerment in der Frühförderung
Um die Bedeutung des Empowermentskonzepts für die Frühförderung darzustellen, möchte ich noch einmal auf unter 2a) dargestellte Kritik an der klassischen Frühförderung von Hans Weiß verweisen. Weiß verurteilt die technokratisch-funktionalistische Kultur der klassischen Frühförderung. Er fordert eine Theorie, die den defizitorientierten Blickwinkel der generell hilfsbedürftigen, inkompetenten Eltern ablöst. Dies sieht er im Konzept des Empowerment gewährleistet.
„Dem Empowerment-Konzept zufolge kommt es darauf an, ‚die Vielfalt der realen Lebenswelt der Menschen zu begreifen‘ ..., ihre je spezifischen Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmuster zu verstehen.“21 Daraus folgt ein umfassenderes Bild von den Aufgaben der ‚frühen Hilfen‘: diese müssen ein breites Spektrum von Angeboten bereitstellen und daraus gemeinsam mit jeder einzelnen Familie eine auf ihre Bedürfnisse und Vorstellungen zugeschnittene Zusammenstellung angemessener Hilfen erstellen.
Angebote können beispielsweise sein: Gruppenangebote mit gemeinsamen Erfahrungs- und Problemaustausch Gleichbetroffener, regelmäßige Kinderbetreuung zu Entlastung der Familie, Beratung und Anleitung.
Aufgabe der Fachleute ist in diesem offenen und verständigungsorientierten Ansatz nicht mehr die dominante oktroyierte Förderung am Kind, sondern vielmehr die fachliche Assistenz. Sie sollen Eltern bei der Aufgabe begleiten, das Leben mit dem Kind mit Behinderung selbst zu gestalten.
In der konkreten Praxissituation kann dieser flexible Ansatz bei Fachleuten schnell zu Orientierungslosigkeit führen, da es kein ‚Patentrezept‘ mehr gibt. Die Frage ist, welcher Art der Hilfe bedarf die Familie und das einzelne Familienmitglied. Um Anhaltspunkte zu finden, sollte sich der ‚Profi‘ vor dem Hintergrund des Empowermentkonzepts folgende Fragen stellen: Was blockiert den Empowermentprozess bei der Person? Wie könnte ich als Fachmann die Person in ihrem individuellen Empowermentprozess unterstützen?
Böhm nennt als wichtiges Merkmal der Hilfen durch die Frühförderung den Lebensweltbezug.22 Das bedeutet, für den Frühförderer sollten die subjektiven Erfahrungsmuster und konkreten Lebensumstände der Familienmitglieder Ansatzpunkte für die Hilfen sein. Der Einzelne bestimmt, was ihm momentan wichtig ist und wird bei seinem individuellen Weg der Problemlösungssuche unterstützt. Der Professionelle ist Mentor, ihm steht es aber nicht zu, zu definieren, was von der Familie als Problem wahrgenommen wird, was als normal oder abweichend gesehen wird. Er darf nicht versuchen, Kontrolle über bestimmte Lebensbereiche auszuüben. Ich zitiere exemplarisch einige Wünsche, die Eltern gegenüber Böhm bezüglich der Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten äußerten: „unkompliziertes Zusammenwirken an der Erziehung, ohne was ‚aufschwatzen‘ zu wollen, Engagement, Hilfsbereitschaft, Verständnis, Offenheit, Infomationsvermittlung, Transparenz in der Frühförderung“23.
Kompetenzorientierung ist das zweite Charakteristikum der professionellen Hilfe beim Prozess des Empowerment. Dem liegt die Idee zugrunde, dass Fähigkeiten sich nur entwickeln können, wenn wir sie bei unserem Gegenüber voraussetzten. „Menschen sind in der Lage, ihr Leben auch aus der Not heraus zu gestalten, wenn man es ihnen zutraut und strukturelle Rahmenbedingungen schafft, die solche Entwicklungen erlauben.“24 Hilfreiche strukturelle Rahmenbedingungen in diesem Sinne sind für Böhm einerseits Elterngruppen und andererseits die ‚Elternarbeit‘ der Frühförderung als Ansprechbarkeit des Frühförderers für Sorgen und Nöte der Eltern. Ziel dieser Elternarbeit ist die Entwicklung von ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘. Böhm gliedert sie in drei Phasen25:
1. Offensein und Kennenlernen: Der Frühförderer sollte bereit sein für eine partnerschaftliche Begegnung mit den Eltern, während der er versucht, ihre Empfindungen, ihr Leid und ihre Wertvorstellungen zu verstehen. Dies funktioniert nur, wenn auch die Eltern Offenheit zeigen, was nicht immer der Fall ist.
2. Ermunterung und Bestärkung der Eltern: Das Selbstbewußtsein der Eltern soll gestärkt, Hoffnungen aufgebaut und Zuversicht und Zutrauen genährt werden. Erst wenn eine Person in sich gestärkt ist, kann sie sich öffnen für weitere Angebote.
3. Echtes Mit- und Füreinander: Dies kann sich nur mit der Zeit entwickeln.
3.3 Partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten
Speck und Peterander charakterisieren die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachleuten als ‚interdependente Autonomie'26. Dem Begriff Autonomie geben sie grundlegend zwei verschiedene Bedeutungen: Autonomie als faktische und als normative Selbstbestimmung.
Unter ersterer ist zu verstehen, dass der Mensch, wie alle Lebewesen, als autonomes System nicht von außen determiniert wird. Er ist keine Marionette seiner Umwelt, sondern kann aus der Fülle äußerlicher Einwirkungen für ihn Relevantes auswählen. Normative Selbstbestimmung des Handelns meint die freiwillige Einschränkung der absoluten Autonomie des Einzelnen. Damit ist die Möglichkeit und auch Verpflichtung des Menschen gemeint, ein eigenes Normen- und Wertesystem aufzubauen und sich diesem aus eigenem Willen zu verpflichten. Es bedeutet die Selbsteinordnung in sinnvolle Regeln des Miteinander, in Verbindlichkeiten und Prinzipien.
In diesem Sinne kann es zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit des autonomen Systems Eltern mit dem autonomen System Frühförderung kommen. „Es handelt sich ... (hierbei) um eine offene Kommunikation auf Basis gegenseitiger Ergänzung zweier in sich autonomer Einheiten.“27 Grundlage hierfür ist die gegenseitige Respektierung der Autonomie, wechselseitiger Austausch von Informationen durch Verständigungsgespräche und Kooperation.
Frühförderung basiert somit auf einem Kooperationsmodell. Dabei liegt die Chance der Verständigung in der Bereitschaft des Einzelnen, sein Verhalten zu modifizieren. „Die (dafür nötige) Verstehensbereitschaft wächst, wenn sie auf Basis von Vertrauen und gegenseitig anerkannter Kompetenz beruht.“28 Wichtig ist, dass jedem seine Meinung und auch seine Kritik zugestanden wird.
Kontrolltendenzen, Schuldzuschreibungen, Rechthaberei und Unterstellungen wirken sich hingegen negativ aus.
Auch Behringer unterstreicht diese Auffassung: „Eine der wichtigsten Grundlagen einer jeden Partnerschaft ist ... der wechselseitige Respekt voreinander, ohne die Eigenverantwortlichkeit des Partners in seinem Kompetenzgebiet einzuschränken.“29 Gerade zu Anfang nehmen Fachleute Eltern nicht unbedingt als kompetente Partner wahr. Die Geburt eines Kindes mit Behinderung löst eine tiefgreifende Lebenskrise aus, die ihr Selbstvertrauen erschüttert. Die elterliche Kompetenz wird dadurch häufig verschüttet. Aufgabe der Fachleute ist es, sie trotzdem wahrzunehmen und das Vertrauen der Eltern in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die einfühlsame und ehrliche Aufklärung in einer Atmosphäre, welche die Eltern ermutigt, offen Fragen zu stellen und Gefühle auszudrücken.
Selbsthilfegruppen sind ein weiterer wichtiger Teil der Elternarbeit, der sich positiv auf die Belastungsverarbeitung auswirkt. Fachleute sollten es Eltern immer wieder nahe legen, den Austausch mit anderen Betroffenen zu suchen.
Exemplarisch für die Durchführung erfolgreicher Elternarbeit möchte ich die kooperativen Elternseminare vorstellen, die Etta Wilken30 seit 1976 durchführt. An den Seminare nehmen Eltern mit Kindern mit Behinderung sowie Professionelle, also Pädagogen, Psychologen und Ärzte, teil. Sie sind ein ergänzendes, interdisziplinäres Angebot neben anderen Formen der Elternarbeit, dauern eine Woche und werden überregional durchgeführt. „Die kooperativen Seminare von Eltern und Professionellen ermöglichen..., sich in konstruktiver (und intensiver) Zusammenarbeit mit einem Thema oder einer speziellen Fragestellung auseinander zu setzen und damit ein wechselseitiges Verstehen der unterschiedlichen Sichtweisen zu fördern.“31
Zudem sind ein zweiter wichtiger Bestandteil der Seminararbeit gemeinsame themenbezogene Spiel- und Arbeitsphasen für Erwachsene und Kinder.
Für viele Eltern ist es wichtig, sich untereinander auszutauschen. So stellte ein Teilnehmer fest. „Für mich war die Erfahrung wichtig: Ich bin nicht allein! Der Austausch mit den anderen Eltern gibt mir Mut und neue Motivation.“32
Ebensogroße Bedeutung hat der Dialog mit Fachleuten. Wilkes Erfahrung zeigt, dass eine unfangreiche Beratung und Begleitung der Eltern wichtig ist, gerade zu Beginn der Auseinadersetzung mit der Behinderung des Kindes und seinen unklaren Entwicklungsperspektiven. Dazu gehören sowohl Informationen über die Behinderung und über Ziele und Möglichkeiten der Förderung, als auch die Unterstützung familienspezifischer Kompetenzen bei der Alltagsbewältigung und Aufklärung über die rechtliche Lage, wie beispielsweise Pflegeversicherung und Familienentlastende Dienste.
Ziel der Seminare ist es, die häufig zu beobachtende sprachlose Betroffenheit der Bezugspersonen zu überwinden, so dass ein Austausch über ihre Schwierigkeiten unter den veränderten Bedingungen möglich wird. Durch die Auseinandersetzung damit, wie der gemeinsame Alltag für die Familie und für das besondere Kind optimal gestaltet werden kann, soll ein Abbau des oft empfundenen Förderdrucks erreicht werden.
Außerdem werden Informationen über die verschiedenen Therapieformen geboten, so dass Eltern sich kompetent für die von ihnen als optimal angesehene Förderung entscheiden können. Durch die Möglichkeit der gezielte Auswahl soll Therapiestress für das Kind wie für die gesamte Familie vermieden werden.
Abschließend möchte ich die Möglichkeiten und Vorteile des Empowerment - Konzepts für die Frühförderung mit Etta Wilkens Worten noch einmal prägnant zusammenfassen: „Durch kooperative Elternarbeit (ergo Elternarbeit nach der Idee des Empowerment)33 in den Seminaren können familienspezifische Kompetenzen gestärkt und nachhaltige Veränderungen für das Zusammenleben mit dem behinderten Kind ermöglicht werden. Die Fähigkeit der Eltern, selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, ermöglicht auch, dem Kind Freiräume zu geben und ihm im Familienalltag seinen individuellen Kompetenzen entsprechend Eigenständigkeit und Mitbestimmung zuzutrauen.“34
4. Literaturverzeichnis
1. Frühförderung
Sohns, Armin: Frühförderung entwicklungsauffälliger Kinder in Deutschland, Weinheim/Basel 2000
Thurmair, Martin u. Naggl, Monika: Praxis der Frühförderung, München 2000
2. Kritik an der klassischen Frühförderung
Behringer, Jutta: Partnerschaft zwischen Eltern behinderter Kinder und Fachleuten - Utopie oder realistisches Ziel? ... aus der Sicht
einer Mutter. In: Geistige Behinderung 30 (1991), 3, 224 -229
Weiß, Hans: Familien zwischen Autonomie und sozial arrangierter
Abhängigkeit. Kritische Fragen zur Kultur der Frühförderung. In: Geistige Behinderung 30 (1991), 3, 196 - 218
3. Das Empowerment-Konzept
Behringer, Jutta (1991) / s. 2.Teil
Böhm, Ingrid: Gemeinsam(e) Kräfte entdecken - Empowerment in der Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär, 11 (1992), 170 - 178
Speck, Otto und Franz Peterander: Elternbildung, Autonomie und
Kooperation in der Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär 13 (1994), 108 - 120
Weiß, Hans (1991) / s. 2.Teil
Weiß, Hans: Annäherungen an den Empowerment-Ansatz als handlungsorientierendes Modell in der Frühförderung. In: Frühförderung interdisziplinär 11 (1992), 157 - 169
Weiß, Hans: Selbstbestimmung und Empowerment - Kritische Anmerkungen zu ihrer oftmaligen Gleichsetzung im sonderpädagogischen Diskurs. In: Behindertenpädagogik 39 (2000), 3, 245 - 260
Willken, Etta: Eltern stärken - Erfahrungen aus Seminaren für Eltern von Kindern mit Down-Syndrom. In: Geistige Behinderung 39 (2000), 215 - 229
[...]
1 Speck nach Sohns, Armin; 2000
2 Thurmair/Naggl, S.16
3 dies., S. 19
4 Weiß, 1991
5 Erdheim nach Weiß, 1991
6 Weiß, 1991; S. 203
7 ders., S. 202ff
8 ders., S. 204
9 ders., S.204
10 ders., S. 206
11 Behringer, 1991
12 dies., S. 224
13 dies., S. 226
14 dies., S. 226
15 Schlack nach Behringer, S. 227
16 Rappaport nach Weiß 2000, S. 254
17 Böhm, S. 173
18 Kieffer nach Böhm, S. 173
19 Böhm, S. 173
20 Kieffer nach Böhm, S. 175
21 Weiß (1991), S. 209
22 Böhm, S. 176
23 dies., S. 176
24 dies., S. 177
25 dies., S. 177
26 Speck/Peterander, S. 115
27 dies., S. 117
28 dies., S. 116
29 Behringer, S. 228
30 Wilken 2000
31 dies., S. 215
32 dies., S. 218
33 Ergänzung: F.S.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Frühförderung laut diesem Text?
Frühförderung ist ein Hilfsangebot für Kinder im Vorschulalter, die eine Behinderung haben oder von einer solchen bedroht sind. Sie bietet auch Hilfen für die Eltern und andere Bezugspersonen dieser Kinder.
Welche Zielgruppen hat die Frühförderung laut diesem Text?
Die Frühförderung richtet sich an Kinder, die behindert oder von einer Behinderung bedroht sind, sowie an deren Eltern. Dies umfasst körperliche, geistige oder seelische Auffälligkeiten. Konkrete Zielgruppen sind:
- Säuglinge und Frühgeborene mit Entwicklungsrisiken
- Mehrfachbehinderte Kinder
- Kinder mit Verhaltensbesonderheiten und Lern- und Leistungsstörungen
- Entwicklungsgefährdete Kinder aus sozial benachteiligten Familien
- Verunsicherte Eltern und Familien
Welche Aufgaben und Ziele hat die Frühförderung?
Frühförderung umfasst Diagnostik, Therapie und Förderung, Elternberatung und Vernetzungsarbeit. Die Ziele lassen sich auf drei Ebenen formulieren:
- Kindbezogen: Entfaltung der Kompetenzen, Entwicklung des Selbsterlebens und Selbstwertgefühls, Integration in die Lebenswelt.
- Elternbezogen: Stärkung der Kompetenzen im Umgang mit dem Kind, Begleitung bei der Auseinandersetzung mit der Situation.
- Gesellschaftlich: Integration von Menschen mit Behinderung, Sicherstellung notwendiger Hilfen, klare Positionierung zu ethischen und gesellschaftlichen Fragen.
Welche Kritik an der klassischen Frühförderung wird in diesem Text besprochen?
Hans Weiß kritisiert in seinem Artikel das ‚technokratisch-funktionalistische Modell’ der Frühförderung. Er bemängelt eine sozial arrangierte Abhängigkeit der Mütter, eine Funktionalisierung der Eltern für Zwecke der Förderung und einen negativen Begründungszusammenhang für die Eltern- und Familienarbeit, bei dem Familien mit behinderten Kindern als ‚behinderte’ Familien gesehen werden. Er sieht auch die Gefahr einer Pädagogisierung der Kindheit.
Wie kritisiert Jutta Behringer die Frühförderung aus Sicht einer betroffenen Mutter?
Jutta Behringer betont die Wichtigkeit, die Situation der Eltern, ihre Ängste, Sorgen und Bedürfnisse zu verdeutlichen. Sie fordert, dass Fachleute Eltern ernst nehmen in ihrer Kompetenz für ihr Kind. Sie kritisiert, dass Eltern oft nur als Ausführende der Therapie gesehen werden und ihre eigenen Kompetenzen nicht mehr wahrnehmen. Weiterhin hebt sie hervor, dass der psychosoziale Rahmen, in dem die Mutter mit ihrem Kind lebt, oft mehr Einfluss auf die Entwicklung hat als ein umfassendes Therapieangebot.
Was ist das Empowerment-Konzept?
Empowerment meint Prozesse der Selbst-Bemächtigung. Es geht darum, eigene Ressourcen zu finden und zu mobilisieren und Kompetenzen der Selbstgestaltung aufzudecken oder wiederzufinden. Es entstand innerhalb der us-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und zielt darauf ab, Menschen in benachteiligten Situationen zu befähigen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen.
Wie wird das Empowerment-Konzept in der Frühförderung eingesetzt?
Das Empowerment-Konzept zielt in der Frühförderung darauf ab, die defizitorientierte Sichtweise auf die Eltern zu überwinden und stattdessen ihre Kompetenzen zu stärken. Die Fachleute sollen als Assistenz dienen, die Eltern bei der Gestaltung des Lebens mit dem Kind mit Behinderung begleitet. Wichtig sind Lebensweltbezug und Kompetenzorientierung.
Was bedeutet partnerschaftliche Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten?
Speck und Peterander charakterisieren die Zusammenarbeit als ‚interdependente Autonomie'. Dies bedeutet, dass Eltern und Fachleute als autonome Systeme auf Basis gegenseitigen Respekts, Verständigungsgesprächen und Kooperation zusammenarbeiten. Wichtig ist, dass jedem seine Meinung und auch seine Kritik zugestanden wird.
- Citar trabajo
- Friederike Sturm (Autor), 2001, Zum Stellenwert von Autonomie und Empowerment in der Zusammenarbeit mit Eltern in der Frühförderung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106559