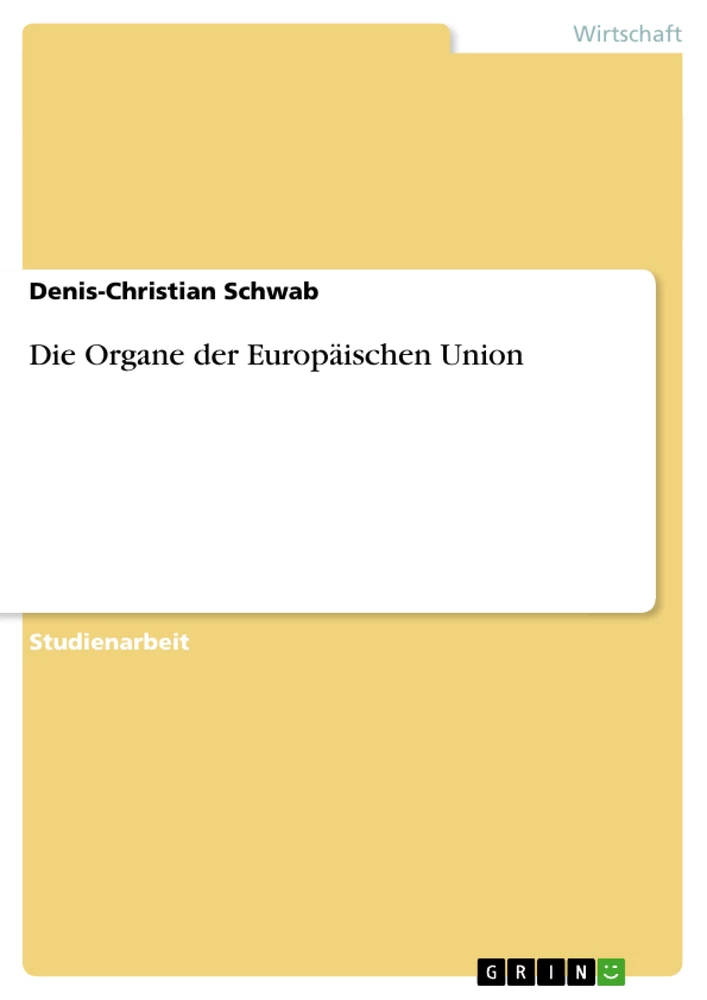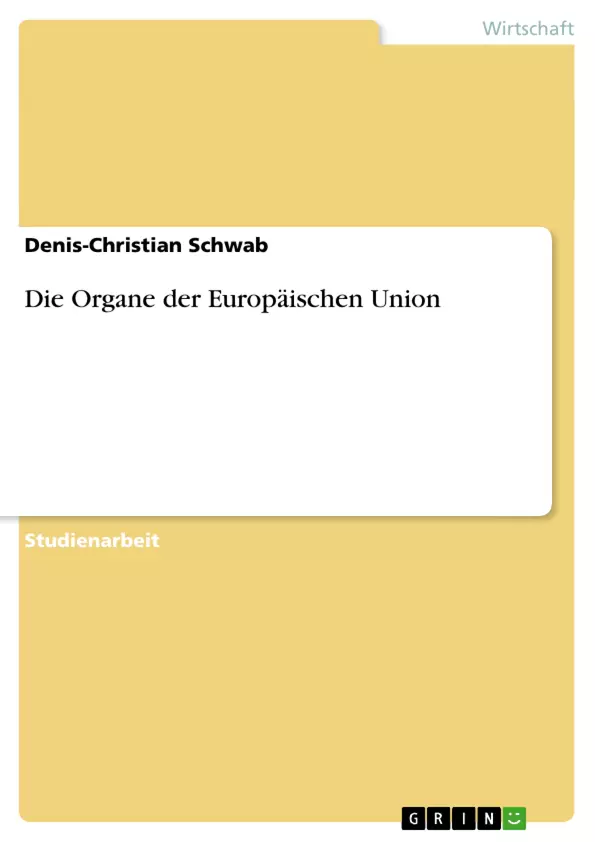1. Einleitung
Schon 1946 forderte der britische Premierminister Winston Churchill die Schaffung „einer Art Vereinigte Staaten von Europa und der erste Schritt muss in der Konstituierung eines Europäischen Rates bestehen.“1 1950 verkündete der französische Außenminister Robert Schuman seine Vorstellung von einer stufenweisen Integration europäischer Staaten.
„Die Europäische Union in einen einzelnen Staat mit einer Armee, einer Verfassung und einer Außenpolitik umzuformen, ist die kritische Heraus- forderung des Zeitalters.“
(Joschka Fischer, Deutscher Außenminister, The Guardian, London, 26. Nov. 1998)
Die Europäische Union ist das Ergebnis eines Kooperations- und Integrationsprozesses, der im Jahre 1951 mit sechs Staaten begann. Seit 2001 gehören ihr 15 Staaten als feste Mitglieder an. Hinzu kommt eine Reihe von beitrittswilligen und assoziierten Staaten.
2. Entwicklung der EU
18. April 1951: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande unterzeichnen in Paris den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).
1952: Es kommt zur ersten „Beratenden Versammlung“ von 78 Abgeordneten aus den nationalen Parlamenten der sechs Mitgliedstaaten der EGKS in Straßburg.
25. März 1957: In Rom unterzeichnen die sechs Staaten die „Römischen Verträge“ zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), die zum ersten Januar 1958 in Kraft treten.
1958: Die „Beratende Versammlung“ der Parlamentarier, bestehend aus 142 Ab- geordneten, ist nun für alle drei Gemeinschaften (EGKS, EWG, Euratom) zuständig.
1. Juli 1968: Die Zollunion ist verwirklicht: Zölle zwischen den Mitgliedstaaten sind abgeschafft, für den Handel mit Drittstaaten gilt ein gemeinsamer Zolltarif.
1971: Das Europäische Parlament erhält gesetzgeberische Befugnisse um sich an der Haushaltsgesetzgebung der Gemeinschaft zu beteiligen.
21. März 1972: Mit der Gründung des Europäischen Währungsverbundes wird der erste Schritt in Richtung Währungsunion getan.
1. Januar 1973: Die EG wächst von sechs auf neun Staaten durch den Beitritt von Dänemark, Großbritannien und Irland.
1. Januar 1979: Das Europäische Währungssystem tritt in Kraft und der ECU (European Currency Unit) wird als Währungseinheit eingeführt.
7./10. Juni 1979: Zum ersten Mal werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments durch die Bürger der EG direkt gewählt.
1. Januar 1981: Griechenland tritt als zehnter Mitgliedstaat der EG bei.
1. Januar 1986: Portugal und Spanien treten der EG bei.
17./28. Feb. 1986: Die Regierungsvertreter der 12 Mitgliedstaaten unterzeichnen in Luxemburg und Den Haag die „Einheitliche Europäische Akte“, die eine um- fassende Änderung der Gründungsverträge beinhaltet: Der Binnenmarkt soll bis Ende 1992 verwirklicht werden, die Integration erhält eine neue Dynamik.
1. Januar 1990: Die erste Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) beginnt (Liberalisierung des Kapitalverkehrs, bessere Annäherung der Wirtschafts- und Währungspolitiken der Mitgliedstaaten).
7. Februar 1992: Der „Vertrag über die Europäische Union“, kurz „Maastrichter Vertrag“, wird unterzeichnet. In ihm wird die Zusammenarbeit in weiteren Politikbereichen wie Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungshilfe, Justiz und Inneres, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, etc. vereinbart.
1. Januar 1993: Der Binnenmarkt ist verwirklicht: Die EG ist ein Wirtschaftsraum, in dem der freie Verkehr von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist.
1. November 1993: Der „Vertrag über die Europäische Union“ tritt in Kraft: Bis zum Jahre 1999 sollen eine Wirtschafts- und Währungsunion sowie eine politische Union verwirklicht werden.
1. Januar 1994: Die zweite Stufe der WWU beginnt. Das Europäische Währungsinstitut (EWI) mit Sitz in Frankfurt am Main wird errichtet, das den Aufbau einer Europäischen Zentralbank vorbereiten soll.
1. Januar 1995: Mit dem Beitritt von Österreich, Finnland und Schweden wächst die EG auf 15 Staaten.
16. Juli 1997: Die Europäische Kommission legt in der „Agenda 2000“ Reformvorschläge für verschiedene Bereiche der EU-Politik für den Zeitraum 2000 - 2006 vor.
2. Oktober 1997: Die Außenminister der 15 Mitgliedstaaten unterzeichnen den „Vertrag von Amsterdam“, der am 1. Mai 1999 in Kraft tritt. Er sieht eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Gebiet Justiz und Inneres und die weitere Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vor. Die Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments werden erweitert.
1. Januar 1999: Die dritte Stufe der WWU beginnt: Start der Europäischen Währungsunion mit elf Teilnehmerstaaten und Einführung des Euro im bargeldlosen Zahlungsverkehr.
24./25. März 1999: Auf der Sondertagung des Europäischen Rats in Berlin einigen sich die Mitgliedstaaten auf das Reformpaket „Agenda 2000“.
2000: Ein Gremium aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments, der nationalen Parlamente, der Kommission und Beauftragten der Regierungen arbeitet den Entwurf einer Charta der Grundrechte der EU aus.
1. Januar 2002: Der Euro wird alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in der Europäischen Währungsunion.
3. Organe der EU
Die Organe der Europäischen Union sind Ausdruck des Willens, „einen immer en- geren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen“. Sie arbeiten nach dem Grundsatz der Aufteilung der politischen Verantwortung: Die Kommission schlägt Rechtsakte vor, das Parlament nimmt zu ihnen Stellung, der Ministerrat verabschiedet sie, und der Gerichtshof ist zuständig für ihre Auslegung. Der wirtschaftliche und politische Einigungsprozess der Europäischen Union wird von folgenden offiziellen Organen gesteuert:
- Europäisches Parlament
- Europäische Kommission
- Europäischer Rat
- Rat der Europäischen Union (Ministerrat)
- Europäischer Gerichtshof
- Europäischer Rechnungshof
Beraten werden sie unter anderem von:
- Wirtschafts- und Sozialausschuss
- Ausschuss der Regionen
Eine besonders zentrale Funktion nimmt der Europäische Rat (der Staats- und Re- gierungschefs) ein, obwohl dieser nicht zu den offiziellen Organen der EU zählt.
3.1. Das Europäische Parlament
Das demokratische Kontrollorgan der Europäischen Union ist das Europäische Par- lament, dessen 626 Abgeordnete seit 1979 alle fünf Jahre direkt von den Bürgern gewählt werden. Das Parlament besteht momentan aus neun multinationalen Frak- tionen und bildet insgesamt 21 Ausschüsse. Durch den Maastrichter Vertrag hat es erweiterte Mitspracherechte erhalten. So ist in einigen Bereichen der Europäischen Politik seine Zustimmung erforderlich, in anderen Verfügt es über das Recht der Mitentscheidung oder ist im Verfahren der Zusammenarbeit an den Entscheidun- gen beteiligt. Die Kommission wird durch das Parlament in ihrem Amt bestätigt2. Als „Motor“ der EU arbeitete es eine europäische Verfassung aus, verlangte die Herstellung des Europäischen Binnenmarktes und sorgte für die Beratung der Institutionen der EU, einschließlich der Erweiterung der eigenen Befugnisse.
3.2. Die Europäische Kommission
Die aus 20 Mitgliedern - mit den Kommissionspräsidenten an der Spitze - beste- hende Europäische Kommission wird von den Regierungen der Mitgliedsstaaten vorgeschlagen und nach Zustimmung des Europäischen Parlamentes auf fünf Jahre ernannt. Die Kommissionsmitglieder vertreten nicht ihr Herkunftsland, sondern „ü- ben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemein- schaft aus“3. Die Kommission handelt als Kollegialorgan, aber jedes Mitglied hat einen bestimmten Geschäftsbereich, für den es zuständig ist. Die Hauptaufgaben- felder sind u. a. die Unterbreitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der ge- meinschaftlichen Politik, die Kontrolle über Einhaltung und richtige Anwendung der EU-Verträge, die Verwaltung und Durchführung der Gemeinschaftsvorschriften so- wie die Vertretung der Europäischen Union in den internationalen Organisationen.4
3.3 Europäischer Rat
Im Europäischen Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs der 15 Mitgliedstaaten sowie der Präsident der Kommission mindestens zweimal im Jahr zu einem Gipfeltreffen. Dieser Rat soll die europäische Entwicklung vorantreiben und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen für eben diese Entwicklung fest.
3.4. Der Rat der Europäischen Union (Ministerrat)
Der Rat - das zentrale Beschlussorgan der EU - setzt sich aus Ministern der Mitgliedstaaten zusammen. Er lenkt die Zusammenarbeit der einzelnen Teilnehmerstaaten und verabschiedet auf Vorschlag der Kommission und unter Beteiligung des Europäischen Parlamentes die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften. Seine fachliche Zusammensetzung wechselt je nach dem Gegenstand der Beratung. Jeder Mitgliedstaat übernimmt turnusgemäßfür sechs Monate den Vorsitz und trägt während dieser Zeit besondere Verantwortung für die europäische Zusammenarbeit. Für die Beschlüsse des Rates ist in besonders wichtigen, für die Mitgliedsstaaten sensiblen Bereichen, Einstimmigkeit vorgeschrieben.5
Auf weitere Einzelheiten wird in Kapitel 4 eingegangen.
3.5. Der Europäische Gerichtshof
Die Verträge, auf denen die Europäische Union beruht, bilden die Grundlagen einer eigenständigen Rechtsordnung. Als oberstes supranationales Rechtsprechungsor- gan sorgt der EU-Gerichtshof dafür, dass bei der Anwendung und Auslegung der Vereinbarungen das Recht gewahrt bleibt. Ebenso besitzt es das Richterrecht, d.h. lückenhafte oder nicht eindeutige Bestimmungen werden durch Spruch des Ge- richts geregelt. Erst durch seine Rechtsprechung ist eine umfassende europäische Rechtsordnung entstanden und der Vorrang des EU-Rechts vor entsprechenden nationalen Regelungen durchgesetzt worden. Der Gerichtshof, bestehend aus 15 Richtern, die von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einver- nehmen auf sechs Jahre ernannt werden, kann von allen angerufen werden, die für die Anwendung des Gemeinschaftsrecht verantwortlich sind (Organe und Mit- gliedstaaten der EU).
3.6. Der Europäische Rechnungshof
Aufgrund der finanziellen Autonomie der Europäischen Gemeinschaft gibt es als oberstes unabhängiges Überwachungsorgan des Finanzgebarens den Europäischen Rechnungshof. Der Rechnungshof besteht aus 15 Mitgliedern, die einstimmig auf sechs Jahre ernannt werden. Sie haben eine ähnlich unabhängige Stellung wie Richter des Europäischen Gerichtshofes und fassen als Kollegialorgan ihre Beschlüsse mit Mehrheit der Mitglieder.
3.7. Der Ausschuss der Regionen
Der Ausschuss der Regionen soll den Ländern, Regionen, autonomen Gemeinschaften und lokalen Gebietskörperschaften eine direkte, allerdings nur beratende Mitsprache in den Entscheidungsprozessen ermöglichen. Der Ausschuss, der aus 222 Vertretern besteht, wird besonders zu Fragen der Bildung und Kultur, der transeuropäischen Netze und zum Gesundheitswesen gehört.
3.8. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss
Der ebenso aus 222 Mitgliedern bestehende Wirtschafts- und Sozialausschuss, die unterschiedlichen sozialen und wirtschaftlichen Gruppen angehören, werden anhand von Vorschlagslisten der nationalen Regierungen ausgewählt und auf vier Jahre ernannt. Seine Aufgabenfelder sind unter anderem die gemeinsame Agrarpolitik, die Verkehrspolitik sowie die Sozialpolitik.
4. Der Ministerrat und seine demokratische Legitimierung
Der wöchentlich tagende Ministerrat, kurz auch Rat genannt, ist das höchste Ent- scheidungsorgan der EU mit Sitz in Brüssel, bestehend aus den Fachministern der Regierungen der Mitgliedstaaten. Als Zentrum vieler Entscheidungen nimmt er eine „Scharnierfunktion“6 innerhalb der Europäischen Gemeinschaft ein. Die Präsident- schaft wechselt alle sechs Monate und bildet mit ihrer Vorgängerin und Nachfolge- rin die „Troika“.
Der Rat widmet sich hauptsächlich seiner Legislativfunktion, verfügt aber zur sel- ben Zeit auch über Exekutivrechte. Seine exekutiven Rechte liegen vor allem im Bereich der Außenbeziehungen. So legt er hier beispielsweise Verhandlungsrichtli- nien fest oder schließt auch Abkommen. Ebenso entscheidet er in Kooperation mit dem Europäischen Parlament über die Erweiterung der EU. Der Vertrag von Maast- richt hat die Kompetenzen innerhalb der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspoli- tik erweitert und auch auf den Bereich Justiz und Inneres ausgedehnt. Des weite- ren stimmt er die nationalen Politiken aufeinander ab, macht die Gesetze und wirkt teilweise auch an deren Ausführung mit. Er besitzt mit dem Parlament das Haus- haltsrecht, beschließt über Vertragsänderungen und ernennt Mitglieder weiterer EU-Gremien.
Nach Artikel 145 des Vertrages über die Europäische Union von Maastricht besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis und überträgt der Kommission in den von ihm angenommen Rechtsakten die Befugnisse zur Durchführung der Vorschriften, die er erlässt. Diese Modalitäten müssen den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die der Rat auf Vorschlag der Kommission nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments vorher einstimmig festgelegt hat.
Der Rat kann die Kommission auffordern, die nach seiner Ansicht zur Verwirklichung der gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen vorzunehmen und ihm entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.
So lässt sich behaupten, dass die demokratische Legitimierung des Ministerrates nicht vollständig gegeben ist. Die im Rat vertretenen Minister werden von den jeweiligen Parlamenten der Mitgliedstaaten gewählt, ohne dass das vom gesamten europäischen Volk gewählte Europäische Parlament ein Mitspracherecht bei der Zusammensetzung des Ministerrates hätte. Auch tagt der Ministerrat geheim, sodass eine Transparenz der Beschlüsse oder gar das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitglieder des Rates nicht überprüfbar ist.
4.1. Die Stimmgewichtung im Ministerrat
Artikel 148 des Maastrichter Vertrages legt die Stimmgewichtung im Rat fest. Die Zuteilung der Anzahl von Stimmen hängt von der Bevölkerungszahl ab. So erhalten z.B. Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich von England jeweils 10 Stimmen, die einheitlich abgegeben werden, kleinere Staaten wie Lu- xemburg hingegen nur zwei Stimmen. Hier ist anzumerken, dass Deutschland als größtes und Frankreich als zweitgrößtes Land genau gleich viele Stimmen haben, obwohl Deutschland ca. 20 Millionen Einwohner mehr hat. Hier wird immer noch viel Rücksicht auf eine Gleichbehandlung der Anfängerstaaten, dem sogenannten „Kerneuropa“ genommen. Mitgliedsländer mit einer weniger hohen Anzahl von Einwohnern haben jedoch an den großen Ländern gemessen ein relativ höheres Gewicht, damit eine Interessenswahrnehmungsmöglichkeit von ihrer Seite aus ge- wahrt bleibt.7
4.2. Probleme durch das Einstimmigkeitsprinzip - die Notwendigkeit eines entscheidungsfähigen Rates
Der Rat der Europäischen Union hat mit Verlauf der europäischen Integration im- mer mehr an Gewicht innerhalb des Gefüges der Institutionen hinzugewonnen. Da der Ministerrat aber laut Vertragstexten eine so wichtige Rolle unter den Organen der EU einnimmt, sind Reformen in diesem Gremium besonders wichtig und gleich- zeitig auch besonders umstritten. Gerade angesichts der näherrückenden Oster- weiterung hängt innerhalb der EU viel von einem handlungs- und entscheidungs- fähigen Rat ab. Die wirtschaftlichen und politischen Divergenzen zwischen den ein- zelnen Ländern werden sich erhöhen und so eine Konsensbildung weiter erschwe- ren. Hinzu kommen außerdem kulturelle sowie historisch bedingte Differenzen. Die Beschlusskraft des Gremiums ist allerdings sehr gebunden an die Art und Weise der Abstimmung. Muss eine Entscheidung einstimmig getroffen werden, so sind die „Konsensbildungskosten“8 insgesamt höher als bei Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Die einzelnen Staaten haben oft sehr unterschiedliche Interessen. Wenn auf anderem Wege eine Beschlussfassung nicht möglich ist, weil ein Land sein Veto einlegt, so bemüht man sich, Paketbeschlüsse zu fassen. D.h. es wird versucht, dem unzufriedenen Mitgliedstaat auf anderem Gebiet Zugeständnisse zu machen, um doch eine Zustimmung zu erreichen.
Außer den genannten Paketentscheidungen gibt es noch andere Techniken der Kompromissbildung. Zu ihnen gehören die Verlängerung des Entscheidungsprozesses, die zeitliche Streckung der Umsetzung von Maßnahmen und die Vertagung von Entscheidungen.9 Der Rat ist immer wieder gezwungen, auf solche Techniken zurückzugreifen, da die Konsensbildungsschwellen oft sehr hoch liegen. Beispielsweise wurden Beschlüsse zu einer gemeinsamen Verkehrspolitik der EU zwanzig Jahre lang immer wieder vertagt und man einigte sich erst, nachdem eine Untätigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof Erfolg hatte.
Aber gerade im wirtschaftlichen Bereich ist es für die Staatengemeinschaft von großer Bedeutung, schnelle und effiziente Entscheidungen treffen zu können, um mit Staaten wie Japan oder den USA auf dem Weltmarkt weiterhin zu konkurrieren. Zudem ist es bezeichnend, dass es gerade im ökonomischen Bereich, der eine Grundlage für die weitere Entwicklung einer politischen Gemeinschaft darstellt, zu Problemen aufgrund der hohen Konsensbildungskosten bei Einstimmigkeit kommt. Die Wahrscheinlichkeit von einstimmigen Entscheidungen ist vor allem dann hoch, wenn jeder Mitgliedsstaat wirtschaftliche Vorteile für sein Land sieht, ohne viel von seiner eigenen Souveränität abgeben zu müssen.
4.3. Realpolitische Umsetzbarkeit weiterer Reformen
Schon früh zeigte sich die Einsicht der Staats- und Regierungschefs zur Notwen- digkeit einer Reform der Entscheidungsmodalitäten und einen Großteil der ein- stimmigkeitspflichtigen Themenbereiche in Abstimmungen mit qualifizierter Mehr- heit umzuwandeln. Allerdings sehen immer wieder einzelne Mitgliedstaaten Prob- leme auf sich zukommen, wenn in einem für sie relevanten Politikfeld Mehrheits- entscheidungen eingeführt werden sollen und es kommt zu Einsprüchen mit der Begründung, „nationales Interesse“ sei berührt. So besteht auf der einen Seite die Einsicht, dass Mehrheitsentscheidungen mehr Gewicht bekommen sollen, während gleichzeitig jede Regierung darauf bedacht ist, bestimmte Politikfelder nicht zu ü- berführen. Hier wird ersichtlich, wie sehr die Delegationen noch nationale Interes- sen vertreten und nicht in erster Linie an das Fortkommen der Union denken. Lässt eine Regierung dann Mehrheitsentscheidungen in diesem Politikbereich zu und gibt damit die eigene Veto-Möglichkeit auf, riskiert sie, bei Entscheidungen überstimmt zu werden und damit den Rückhalt in der eigenen Bevölkerung zu verlieren. So wird auch die europäische Bühne dazu genutzt, sich innenpolitisch positiv darzu- stellen.
Das Vertrauen der Bevölkerungen in die Europäische Union ist nach wie vor noch nicht großgenug, als dass es ausreichend Akzeptanz gäbe, wenn eine Delegation im Ministerrat gerade bei sensiblen Themen überstimmt werden würde. Innenpoli- tisch würde das negative Folgen für die Betroffenen ergeben. In diesem Bewusst- sein und auch im Wissen um niedrige Wahlbeteiligungen bei Europawahlen und um die schwere Vermittelbarkeit von institutionellen Reformen im eigenen Land, handeln die Politiker sehr vorsichtig bei der Ausweitung von Mehrheitsentschei- dungen. Nach wie vor besteht keine Einigkeit in teilweise sehr essentiellen Fragen. Beispielsweise gibt es im Bereich der Wirtschaftsunion unterschiedliche Standpunk- te zu Teilregelungen bei Sozialstandards oder der anzustrebenden Beschäftigungs- und Lohnpolitik.10 Bezeichnend ist auch, dass ein so bedeutendes Land wie Großbritannien nicht voll an der Währungsunion teilnimmt und deswegen den EURO noch nicht als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt hat.
Die unterschiedlichen Präferenzen drücken sich auch in der Uneinigkeit über das Ziel einer Weiterentwicklung der Union aus. Befürworter eines Staatenbundes, wie z.B. Frankreich oder Großbritannien, möchten nicht, dass Entscheidungen, wie im Bereich der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, mit qualifizierter Mehrheit getroffen werden können.
Es bleibt abzuwarten, ob die Staats- und Regierungschefs sich langfristig dazu durchringen können, Souveränitätsverluste in Kauf zu nehmen, um eine bessere Entscheidungsfähigkeit der EU durch Ausweitung der Mehrheitsentscheidungen zu ermöglichen. Das nächste Treffen des Europäischen Rates wird dazu eventuell neue Impulse geben.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
LITERATURVERZEICHNIS
BÜCHER
Schmidt, Manfred G.: Demokratietheorien, Opladen 1995
Thiel, Elke: Die Europäische Union. Von der Integration der Märkte zu gemeinsamen Politiken, 5. Auflage, Opladen 1998
Woyke, Wichard: Europäische Union: erfolgreiche Krisengemeinschaft. Einführung in Geschichte, Strukturen und Politiken, Wien 1998
BROSCHÜREN
Ohne Verfasser: Europa im Schaubild, Bonn 1996
ZEITSCHRIFTEN
Jochimsen, Reimut: Europa 2000 - Herausforderungen für die EU nach dem Vertrag von Amsterdam, in: Integration, Heft 1, 1998, S. 1
[...]
1 vgl. o.V., Europa im Schaubild, Bonn 1996, S. 24
2 vgl. o.V., Europa im Schaubild, Bonn 1996, S. 29
3 vgl. o.V., Europa im Schaubild, Bonn 1996, S. 36
4 vgl. o.V., Europa im Schaubild, Bonn 1996, S. 36
5 vgl. o.V., Europa im Schaubild, Bonn 1996, S. 35
6 Woyke, Wichard, Europäische Union, Wien 1998, S. 116
7 Thiel, Elke, Die Europäische Union, Opladen 1998, S. 79-81
8 vgl. Schmidt, Manfred G., Demokratietheorien, Opladen 1995, S. 235
9 vgl. Schmidt, Manfred G., Demokratietheorien, Opladen 1995, S. 253
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung der Europäischen Union?
Die Idee einer geeinten europäischen Staatengemeinschaft geht auf Winston Churchill zurück, der 1946 die Schaffung "Vereinigter Staaten von Europa" forderte. Robert Schuman präsentierte 1950 seine Vision einer schrittweisen Integration europäischer Staaten.
Welche Staaten waren Gründungsmitglieder der Europäischen Gemeinschaft?
Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande unterzeichneten 1951 den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS).
Welche wichtigen Verträge haben die Entwicklung der EU geprägt?
Die "Römischen Verträge" von 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom), die "Einheitliche Europäische Akte" von 1986 zur Verwirklichung des Binnenmarktes und der "Vertrag über die Europäische Union" (Maastrichter Vertrag) von 1992, der die Zusammenarbeit in weiteren Politikbereichen erweiterte.
Welche Organe bilden die Europäische Union?
Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission, der Europäische Rat, der Rat der Europäischen Union (Ministerrat), der Europäische Gerichtshof und der Europäische Rechnungshof.
Welche Rolle spielt das Europäische Parlament?
Das Europäische Parlament ist das demokratische Kontrollorgan der EU. Es hat erweiterte Mitspracherechte, insbesondere durch den Maastrichter Vertrag, und wirkt an der Gesetzgebung mit.
Was sind die Aufgaben der Europäischen Kommission?
Die Europäische Kommission unterbreitet Vorschläge zur Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen Politik, kontrolliert die Einhaltung der EU-Verträge, verwaltet die Gemeinschaftsvorschriften und vertritt die EU in internationalen Organisationen.
Wie setzt sich der Rat der Europäischen Union (Ministerrat) zusammen?
Der Rat besteht aus Ministern der Mitgliedstaaten, je nach dem Gegenstand der Beratung. Er ist das zentrale Beschlussorgan der EU und verabschiedet auf Vorschlag der Kommission und unter Beteiligung des Europäischen Parlaments die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften.
Wie ist die Stimmgewichtung im Ministerrat geregelt?
Die Stimmgewichtung im Rat hängt von der Bevölkerungszahl der Mitgliedstaaten ab. Größere Staaten haben mehr Stimmen als kleinere.
Was sind die Probleme des Einstimmigkeitsprinzips im Ministerrat?
Das Einstimmigkeitsprinzip kann Entscheidungen im Rat erschweren, da jedes Land ein Veto einlegen kann. Dies kann zu hohen Konsensbildungskosten und Verzögerungen führen.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof?
Der Europäische Gerichtshof sorgt für die Wahrung des Rechts bei der Anwendung und Auslegung der EU-Verträge. Er besitzt das Richterrecht und hat den Vorrang des EU-Rechts vor nationalen Regelungen durchgesetzt.
Was ist der Europäische Rat?
Im Europäischen Rat treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten zu Gipfeltreffen. Er soll die europäische Entwicklung vorantreiben und legt die allgemeinen politischen Zielvorstellungen fest.
Was ist das Ziel der Agenda 2000?
Die Europäische Kommission legte in der "Agenda 2000" Reformvorschläge für verschiedene Bereiche der EU-Politik für den Zeitraum 2000-2006 vor.
Welche Ziele verfolgte der Vertrag von Amsterdam?
Der Vertrag von Amsterdam sah eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Gebiet Justiz und Inneres und die weitere Stärkung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik vor. Die Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments wurden erweitert.
Wann wurde der Euro als alleiniges Zahlungsmittel eingeführt?
Der Euro wurde am 1. Januar 2002 als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in der Europäischen Währungsunion eingeführt.
- Quote paper
- Denis-Christian Schwab (Author), 2002, Die Organe der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106598