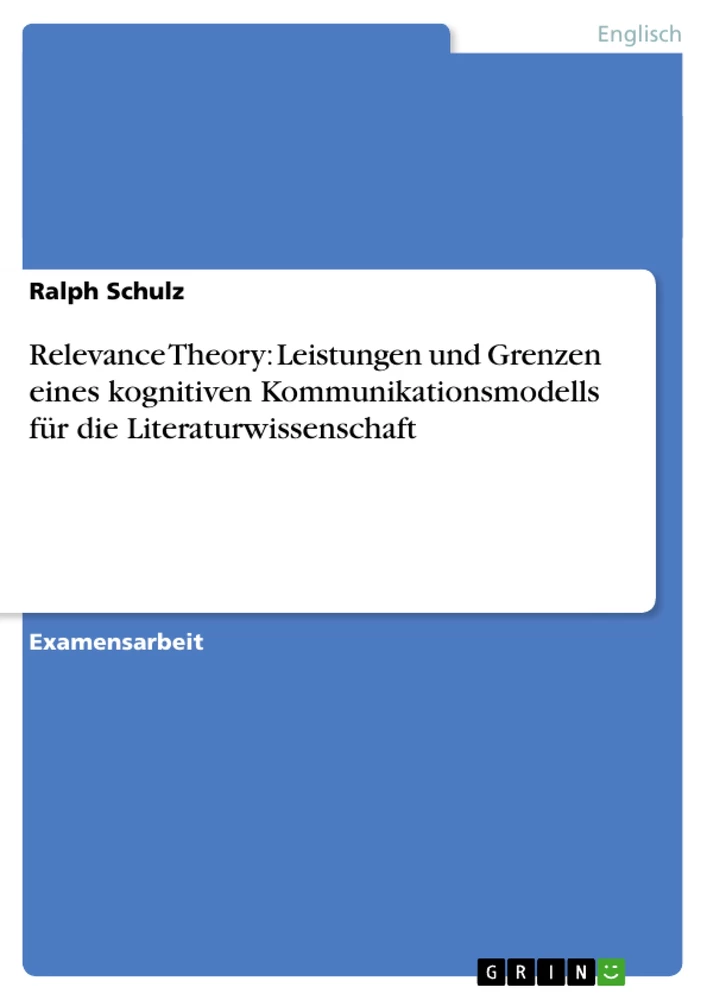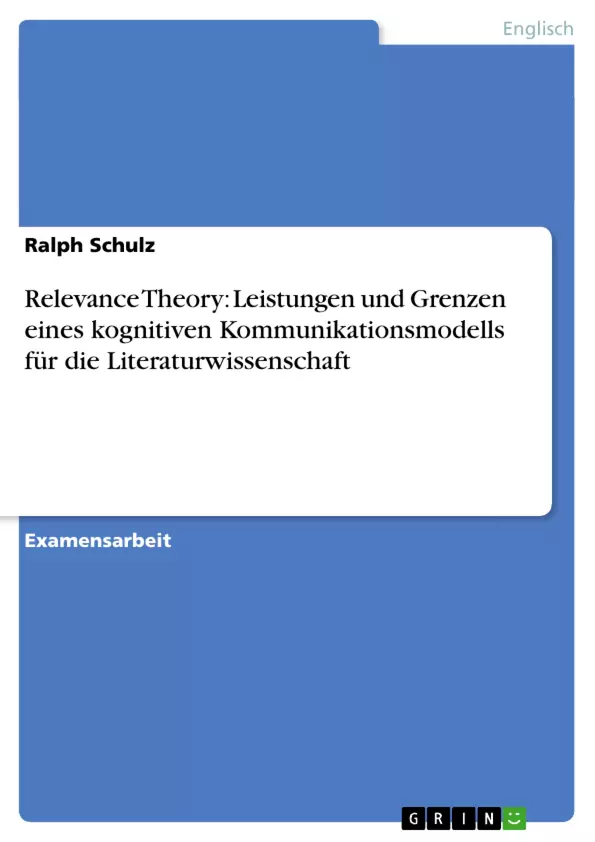Inhalt
1. Einleitung
2. Probleme der literarischen Linguistik und der neueren Literaturtheorien
3. Alternative Kommunikationsmodelle - Inferenz und Relevanz
4. Implikationen der Relevance Theory für die Literaturwissenschaft
4.1. Relevance Stylistics
4.2. Der Leseprozeß
5. Leistungen und Grenzen der Relevance Theory für die literarische Interpretation
5.1. Relevance Theory als Interpretationsmethode?
5.2. Relevance Theory als Meta-Theorie literarischer Interpretation
6. Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis
Ich möchte mich bei meiner Themenstellerin, Frau Dr. Kinsky-Ehritt, für ihre freundliche und kompetente Unterstützung bedanken.
1. Einleitung
"... a linguist deaf to the poetic function of language and a literary scholar indifferent to linguistic problems and unconversant with linguistic methods are equally flagrant anachronisms" (Jakobson 1960, 377). Diese Worte des Linguisten und Literaturwissenschaftlers Roman Jakobson zeugen vom großen Optimismus, mit dem man im Zuge des linguistic turn der 50er und 60er Jahre daran ging, Methoden der Linguistik auch auf die Literaturwissenschaft anzuwenden, um diese ebenso wissenschaftlich zu fundieren. Vor allem die Ideen Saussures eröffneten die Möglichkeit, die Strukturen des literarischen Kunstwerks analog zur langue zu untersuchen und dessen spezifischen Aufbau mit scheinbar exakten Begriffen wie Signifikant/Signifikat oder syntagmatisch/paradigmatisch zu beschreiben. Durch die konsequente Hinwendung zur sprachlichen Struktur selbst glaubte man, sowohl den Subjektivismus der biographisch orientierten Methode als auch den Ansatz, Literatur als Ausdruck der Ideen, Überzeugungen und Werte einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit zu sehen, durch objektivierbare Analyse zu überwinden und die Interpretation auf eine vermeintlich wissenschaftlichere Grundlage zu stellen.
Der Versuch Jakobsons, die Poetik - für ihn quasi synonym mit Literaturwissenschaft - als Teilgebiet der Linguistik zu etablieren (vgl. Jakobson 1960, 359), mußaus heutiger Sicht als gescheitert erscheinen. Daßsich beide Disziplinen inzwischen nahezu feindlich gegenüberstehen, hat seine Ursachen zum großen Teil im Einflußdes Poststrukturalismus, der vor allem im anglo- amerikanischen Raum fast gleichzeitig zum Strukturalismus rezipiert wurde und der, wie Hubert Zapf bemerkt, "... mit seinen verschiedenen Mischformen [...] zu einem der vorherrschenden Theorieansätze aufgestiegen ist" (Zapf 1996, 189)1. In seiner Kritik strukturalistischer Positionen stellte der Poststrukturalismus auch wichtige Grundannahmen der Linguistik, insbesondere deren Glauben an die Möglichkeit der objektiven Beschreibung sprachlicher Bedeutungskonstruktionen, in Frage:
... post-structuralism has moved away from structuralism's earlier, respectful relation to linguistics. In a range of different kinds of critique, it has come instead to argue that it has gone beyond linguistics in its attention to forms of writing and other kinds of signification, by showing these to be radically unstable in that they allow for a multiplicity of finally indeterminate understandings which linguistics - except in institutionally marginalised forms - is unwilling to countenance. (Fabb, Durant 1987, 2)
Vor allem Jacques Derridas Neubewertung der 'Schrift' als ein gegen jede Sinnpräsenz immunes Spiel von Signifikanten ist einerseits für jeden ernsthaften Sprachwissenschaftler schwer akzeptabel und brachte andererseits große Teile der modernen Literaturwissenschaft in Gegensatz zur etablierten Linguistik. So argumentieren Fabb und Durant: "Under the influence of deconstruction, writing has come to stand for 'uncertain, unstable', opposed to the certainty and confidence of linguistic theory" (Fabb, Durant 1987, 9).
Der große Einflußdes Poststrukturalismus mit seinen mitunter extremen Positionen und der Konzentration auf sehr ausgewählte linguistische Probleme. führte jedoch zu einer sehr einseitigen Rezeption linguistischer Theorien. So ist es aus Sicht der Literaturwissenschaft nach wie vor nicht selbstverständlich, wie Nigel Fabb und Alan Durant betonen, " ... that not only is modern linguistics not structuralism, but that structuralism was systematically analysed, modified and in many respects abandoned, in linguistics of an earlier period" (Fabb, Durant 1987, 12). Daßdie Linguistik hier der modernen Literaturtheorie in mancher Hinsicht voraus ist, liegt vor allem in der Tatsache, daßder Poststrukturalismus durch 'Dekonstruktion' bestehender Ansätze gewissermaßen als Parasit auf Grundlage der dekonstruierten Theorien entstanden ist. Damit liefert er zwar einerseits eine besonders wirkungsvolle Kritik dieser Theorien, "... gleichzeitig verstrickt er sich aber, wie seine profilierteren Vertreter durchaus selbst erkennen, in unaufhebbare Selbstwidersprüche. Nicht umsonst betrachtet er sich selbst als parasitär, insofern er konstitutiv auf eben die Konzepte angewiesen bleibt, deren Geltungsanspruch er bestreitet" (Zapf 1996, 202). Damit werden die speziellen Perspektiven dieser Konzepte und die damit verbundenen Probleme häufig mit übernommen, wodurch es unmöglich wird, über die Kritik hinausgehende Alternativen anzubieten.
In diesem Kontext erscheint es sinnvoll, mit der Relevance Theory einen relativ jungen und wenig beachteten Ansatz der Linguistik aus dem Blickwinkel der Literaturwissenschaft zu untersuchen. Dieses von Dan Sperber und Deirdre Wilson entwickelte und im weitesten Sinne der linguistischen Pragmatik zuzuordnende Kommunikationsmodell ist ebenso als Kritik bestehender strukturalistischer und semiotischer Theorien entstanden. Anders als etwa die Dekonstruktion versucht die Relevance Theory jedoch, konkrete Alternativen anzubieten. Die Frage, ob dieser linguistische Ansatz auch für die Literaturwissenschaft von Relevanz sein und auf welche Probleme die Relevance Theory hier Lösungen anbieten könnte, soll Thema der vorliegenden Arbeit sein. Wenngleich eine erneute Verschmelzung von Literaturwissenschaft und Linguistik im Sinne Jakobsons heute unmöglich scheint - auch die Gründe hierfür sollen thematisiert werden - so sollte dabei deutlich werden, daßein kritischer Dialog der Disziplinen für beide Seiten unentbehrlich ist.
Der Ansatz, Literatur im Kontext der sprachlichen Kommunikation zu verstehen, ist nicht neu, jedoch hat die strukturalistische Literaturbetrachtung mit ihrer starken Betonung der Ausdrucksebene den Blick auf wesentliche Aspekte des sprachlichen Kommunikationsprozesses verstellt. Dieses Problem wurde vom Postrukturalismus mit der zentralen Stellung des Signifikanten noch verstärkt und führte zu einer einseitigen Privilegierung der Polysemie sprachlicher Zeichen. Jedoch, wie Jonathan Culler feststellt, "... a theory that derives meaning from linguistic structure, though it contributes much to the analysis of meaning, does not account for it completely" (Culler 1982, 110).
In einem ersten Schritt soll deutlich gemacht werden, daßdie Überbetonung der literarischen Form gerade im Poststrukturalismus schon durch eine einseitige Rezeption strukturalistischer Theorien entstanden ist, wodurch etwa die Versuche des tschechischen Strukturalismus, Inhalts- und Ausdrucksebene im Akt der Rezeption aufeinander zu beziehen, nicht ausreichend gewürdigt wurden. Dabei ist beispielsweise die Ästhetik Mukarovskys auch heute noch interessant, da sie einerseits interessante Ansätze zur Beschreibung des literarischen Bedeutungsprozesses gibt, andererseits aber durch ihre Unzulänglichkeiten wesentliche Fragen aufwirft, die von einem modernen Kommunikationsmodell wie der Relevance Theory beantwortet werden müßten. Die Mängel bestehender Kommunikationsmodelle sollen dabei vor allem im Ansatz Kvetoslav Chvatiks und in der Rezeptionstheorie Wolfgang Isers deutlich gemacht werden. Beide versuchen, Anregungen des tschechischen Strukturalismus weiterzuführen und mit Elementen der Semiotik sowie, im Falle Isers, der Sprechakttheorie zu verbinden. Dabei stoßen sie auf Probleme, die von Poststrukturalisten wie Derrida zurecht deutlich gemacht wurden, wie etwa die Unmöglichkeit der Abschließbarkeit des Kontextes und die Schwierigkeit der Explizierung sprachlicher Codes.
Aufgabe für ein Kommunikationsmodell mußes daher sein, sich der vom Poststrukturalismus immer wieder betonten Unendlichkeit möglicher Bedeutungen zu stellen, gleichzeitig aber zu erklären, wie es dennoch möglich ist, literarische Texte sinnvoll zu verstehen. Der Beitrag der Relevance Theory könnte hier vor allem im Versuch bestehen, die Sinnkonstitution nicht über Dekodierung, sondern als inferentiellen Prozeßzu erklären. Dabei soll der Vorteil der Relevance Theory gegenüber früheren inferentiellen Kommunikationsmodellen (v.a. Paul Grice) deutlich werden. Durch das postulierte 'Prinzip der Relevanz' könnte zudem der Prozeßder Bedeutungskonstruktion im Spannungsfeld zwischen Text und Leser beschrieben werden, wobei über das bloße Ausfüllen vorgegebener Unbestimmtheitsstellen (wie bei Ingarden oder Iser) hinaus gegangen werden könnte, ohne aber andererseits die verschiedenen Interpretationen eines Textes zu willkürlichen Konstrukten einer interpretive community (vgl. Fish, 1980) zu machen.
Im nächsten Schritt sind die konkreten Implikationen der Relevance Theory für die Literaturwissenschaft zu untersuchen, wobei eine große Zahl jüngerer Arbeiten herangezogen werden kann, die sich auf der Grundlage der Relevance Theory mit Problemen der Stilistik und Textanalyse beschäftigen. Darüber hinaus soll auf die Rolle des Kontextes in der Interpretation eingegangen werden - eine Problematik zu deren Erhellung die Relevance Theory möglicherweise beitragen kann.
In der abschließenden kritischen Einschätzung der Relevance Theory sollen neben der Analyse der Schwachstellen des Modells auch verschiedene Versuche, die Relevance Theory als Interpretationsmethode auf konkrete literarische Texte anzuwenden, untersucht werden. Dabei wird deutlich werden, daßes sich wie bei anderen linguistischen Modellen auch bei der Relevance Theory nicht um eine discovery procedure handelt, mit der sich Interpretationen eines literarischen Textes gewinnen lassen. Nichtsdestotrotz sind linguistische Modelle wie die Relevance Theory auch für den Literaturwissenschaftler unverzichtbar als Perspektivsetzung für die literarische Analyse und, wie Jonathan Culler betont, "... offering a set of concepts in which interpretations may be stated" (Culler 1975, 109).
2. Probleme der literarischen Linguistik und der neueren Literaturtheorien
'When I use a word,' Humpty Dumpty said in a rather scornful tone, 'it means just what I choose it to mean - neither more or less.' (Lewis Carrol, Through the Looking Glass)
Versucht man, sich kurz nach der Jahrtausendwende Fragen der literarischen Linguistik im allgemeinen und der Bedeutungskonstruktion literarischer Texte im besonderen zuzuwenden, kommt man nicht an den vom Poststrukturalismus aufgeworfenen Problemen vorbei. Denn bei aller Kritik, der die verschiedenen Poststrukturalisten ausgesetzt waren und sind, handelt es sich doch, wie Hubert Zapf bemerkt, um "... eine provokative Innovationsphase der Theoriebildung, die neue und durchaus wichtige Fragestellungen aufgeworfen und konzeptionelle Differenzierungsschübe bewirkt hat." (Zapf 1996, 202). Sucht man jedoch, die Fragen zu beantworten, die seit den 1960er Jahren ganz zu Recht aufgeworfen worden sind, merkt man schnell, daßder Poststrukturalismus eher ein Teil des Problems als dessen Lösung ist. Im folgenden soll gezeigt werden, daßdie poststrukturalistische Kritik in erster Linie ganz bestimmte Aspekte des Strukturalismus radikalisiert und damit seine linguistische Perspektive verengt hat. Daher erscheint es sinnvoll, schon im Strukturalismus selbst nach möglichen Ansätzen für Alternativen zum Relativismus der Poststrukturalismusdebatte zu suchen.
Ein Grundmerkmal der Literaturbetrachtung des Strukturalismus besteht zweifellos in der mehr oder weniger starken Privilegierung der Ausdrucksebene gegenüber dem Inhalt. Der Strukturalismus zeigt sich hier eindeutig als Erbe des russischen Formalismus. Die Betonung der Form äußert sich exemplarisch in Jakobsons berühmter Formulierung der 'poetischen Funktion': "The set (Einstellung) toward the MESSAGE as such, focus for the message for its own sake, is the POETIC function of language" (Jakobson 1960, 356). Durch die Übernahme von Saussures Theorem von der willkürlichen Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat wird es dabei möglich, Literatur als Mechanismus zu betrachten, der neue Konventionen ins Leben ruft, indem sie sprachliche Zeichen auf neue, unkonventionelle Art verwendet (vgl. Zima 1995, 182). Jakobson hat selbst erkannt, daßdies zu einer Potenzierung der Vieldeutigkeit des Zeichens führen muß: "Ambiguity is an intrinsic, inalienable character of any self-focused message, briefly a corollary feature of poetry. [...] The supremacy of poetic function over referential function does not obliterate the reference but makes it ambiguous" (Jakobson 1960, 370-371). In dem Zitat wird aber ebenso deutlich, daßdie generelle Möglichkeit, Zeichen Bedeutungen zuzuordnen, nicht negiert wird. Dies ist dem Strukturalismus vor allem dadurch möglich, daßSaussures Systembegriff auch auf die Literatur angewendet wird, die man als funktionales System versteht, das sich über Differenzen konstituiert und in dem jedem Element eine bestimmte Funktion zufällt (vgl. Zima 1995, 182).
Der Poststrukturalismus zeigt sich als eindeutiger Erbe des Strukturalismus insofern, als er die Privilegierung der Ausdrucksebene übernimmt und weiter verstärkt. Wenn Mukarovsky schreibt, "die Aufmerksamkeit ist beim ästhetischen Zeichen auf den inneren Aufbau des Zeichens selbst konzentriert und nicht auf seine Zusammenhänge mit den Dingen und Subjekten, auf die das Zeichen hinweist oder hinzielt" (Mukarovsky 1989, 77), so relativiert er zwar die Bedeutung der Beziehung von Signifikant und Signifikat in der poetischen Sprache, bestreitet jedoch nicht ihre prinzipielle Gültigkeit. Bei Derrida hingegen ist die feste Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat in der diff é rance aufgelöst, eine feste Bedeutung damit unmöglich. Derrida gewinnt den Begriff diff é rance durch 'Dekonstruktion' des Saussureschen 'Differenz'-Begriffs, indem er zu zeigen versucht, daßSignifikanten nicht auf Signifikate verweisen können, da sie unablässig auch auf andere Zeichen verweisen (vgl. Zima 1994, 52-53). Der Sinngebungsprozeßbliebe dadurch auf der Ebene der Signifikanten gefangen und würde endlos aufgeschoben. Damit ist in der Dekonstruktion die Ausdrucksebene konsequent vom Inhalt getrennt. Derrida verlangt daher, den Begriff der Polysemie durch eine rein auf der Ebene des Textes angesiedelte sinnaufschiebende diss é mination zu ersetzen:
If there is thus no thematic unity or overall meaning to reappropriate beyond the textual instances, no total message located in some imaginary order, intentionality, or lived experience, then the text is no longer the expression or representation (felicitous or otherwise) of any truth that would come to diffract or assemble itself in the polysemy of literature. It is this hermeneutic concept of polysemy that must be replaced by dissemination. (Derrida 1981, S. 262)
Die logische Folge daraus wäre, daßes für literarische Texte keine rational faßbare Bedeutung und somit keine sinnvolle Interpretation geben kann. Ein solcher Ansatz mag gerade im Kontext der neueren Literaturgeschichte eine gewisse Plausibilität haben, scheint doch ein wesentlicher Zug moderner literarischer Texte - etwa das Werk Kafkas - gerade darin zu bestehen, daßsie sich gegen jede eindeutige Interpretation sperren. Dennoch widerspricht das Postulat der Unmöglichkeit jeglicher Bedeutungsfindung unseren Intuitionen und Erfahrungen im Umgang mit Literatur. Sollte Derridas Argumentation in ihrer Konsequenz zutreffen, wäre es gänzlich unmöglich, literarische Texte überhaupt gewinnbringend zu lesen und darüber zu diskutieren. Die Unmöglichkeit der Sinnkonstitution, darauf wurde vielfach hingewiesen, wird dabei schon von Derridas eigenem Werk widerlegt. So konstatiert Zapf: "Auch die Texte des Poststrukturalismus müssen, wenn sie einen wie auch immer gearteten Erkenntnisanspruch erheben wollen, abstrahieren und generalisieren. Und sie müssen darüber hinaus so geschrieben sein, daßsie - was überwiegend ja auch zutrifft - von ihren intendierten Lesern 'verstanden' werden können" (Zapf 1996, 203).
Die Erkenntnis, daßes nicht möglich ist, literarische Texte auf eine 'wahre' Interpretation festzulegen und daßsich die Konstitution von Bedeutungen weitaus komplexer vollzieht, als es das binäre Zeichenmodell Saussures suggeriert, ist ein wesentlicher Verdienst des Poststrukturalismus. Dafür allerdings auf die generelle Möglichkeit einer sinnhaften Interpretation zu verzichten, kann nicht im Interesse der Literaturwissenschaft sein. Der Poststrukturalismus ist hierin sicherlich, wie auch Zapf feststellt, als Überreaktion auf den Wissenschaftsglauben seiner strukturalistischen Vorläufer zu werten (vgl. Zapf 1996, 194). Daßdie Schlüsse des Poststrukturalismus möglicherweise übereilt sind, und daßes sich statt dessen lohnt, die Stärken und Schwächen des Strukturalismus genauer zu betrachten, deutet auch Jonathan Culler an, wenn er metaphorisch bemerkt: "They [gemeint sind hier die Poststrukturalisten der Tel Quel Gruppe, RS] are very much in the position of Von Neurath's mariners, trying to rebuild their ship in mid-ocean, but instead of realising that this must be done plank by plank they argue that the whole ship can be crapped" (Culler 1975, 253).
Indem der Poststrukturalismus gerade die Vorstellung von der Autonomie des literarischen Textes aufgriff und die radikale Polysemie oder, in Derridas Begriffen gesprochen, diff é rance und diss é mination zu Grundeigenschaften des Textes machte, verwarf er die Möglichkeit, außerhalb der Textstruktur nach der Bedeutung zu suchen. Dabei lohnt durchaus die Frage, ob es sinnvoll ist, literarische Texte als 'autonome' Gebilde zu betrachten und ob eine solche Perspektive nicht einen wesentlichen Teil des Bedeutungsprozesses übersieht. So bemerkt Culler: "... it may be misleading to think of texts as 'organic wholes'. Their unity is produced not so much by intrinsic features of their parts as by the intent at totality of the interpretive process: the strength of the expectations which lead readers to look for certain forms of organisation in a text and to find them" (Culler 1975, 91). Der Einfluß, den bestimmte sprachliche Strukturen auf den Akt der Rezeption eines literarischen Textes haben, wurde vor allem von Jakobson übersehen, der in seinen Analysen implizit davon ausging, daßdie speziellen poetischen Eigenschaften von Texten allein durch linguistische Analyse im Text erkannt werden könnten. Culler schlägt daher vor, den strukturalistischen Ansatz von der Seite der Rezeption, von den Effekten, die literarische Strukturen im Leser auslösen können, zu betrachten: "Indeed, it is in this perspective, as a theory of the operations which grammatical figures can induce readers to perform, that Jakobson's account of poetic language is most usefully considered" (Culler 1975, 71). Anders ausgedrückt, verlangt eine solche Perspektive eine stärkere Betonung des kommunikativen Aspekts der Literatur2.
Daßjede sprachliche Mitteilung einen kommunikativen Aspekt besitzt, war im Strukturalismus allgemein anerkannt. Jedoch erscheint gerade bei Jakobson der Akt der Kommunikation als ein sehr einfacher Prozeß: "Jacobson's stated position is clear: the reader is in the position of the 'addressee', the goal of the communicative channel, whose only requirement is that he or she is in a position to receive the message and has access to the code being used" (Attridge 1987, 17)3. Damit wird dem Adressaten, bzw. dem Leser, keine wirklich aktive Rolle zugebilligt. Wenn nun aber die Eigenschaft der Mitteilung, wie Jakobson selbst betont, gerade in ihrer unbegrenzten Vieldeutigkeit besteht, ist erfolgreiche Kommunikation so nicht zu erklären. Folgerichtig hält auch Derrida sein Konzept der 'Schrift' mit einem solchen Kommunikationsmodell für unvereinbar: "This concept [das Konzept der 'Schrift', RS] would no longer be comprehensible in terms of communication, at least in the limited sense of a transmission of meaning" (Derrida 1977, 174).
Will man davon ausgehen, daßliterarische Texte trotz ihrer Vieldeutigkeit rezipierbar sind, mußdem Leser im Rezeptionsprozeßeine aktivere Rolle zugestanden werden. Bereits im Strukturalismus selbst, vor allem bei Mukarovsky, gab es Versuche, über den Prozeßder Rezeption zwischen Form und Inhalt zu vermitteln. Die Kritik am Strukturalismus hat jedoch in ihrer starken Fixierung auf Saussure diese Ansätze möglicherweise nicht ausreichend gewürdigt4. Einige interessante Anregungen, vor allem aber auch daraus resultierende Probleme sollen im folgenden kurz untersucht werden.
Wie Jakobson übernimmt Mukarovsky von Saussure den Systembegriff, indem er das literarische Kunstwerk als funktionale Einheit begreift. Den Begriff 'Funktion' verwendet er allerdings anders als Jakobson, bei dem die 'poetische Funktion' eher einen Zustand beschreibt, nämlich die 'Einstellung' auf die Äußerung selbst. Mukarovskys Funktionsbegriff ist dagegen deutlich dynamischer: "Any function, for Mukarovsky, is a question of three factors: the object itself [...] the cultural conventions in force; and the individual - the reader" (Attridge 1987, 19). Auch das Verhältnis von Inhalt und Form wird durch Mukarovskys Funktionsbegriff komplexer:
Die sichtbare Anpassung des Kunstwerks an verschiedene Funktionen wird manchmal in der Weise begriffen, daßals Träger der ästhetischen Funktion die 'Form' angesehen wird und als Träger der außerästhetischen Funktion der 'Inhalt'. Dabei pflegt die Form mit der Gestalt und der Inhalt mit dem Thema gleichgesetzt zu werden. Das ist jedoch falsch: alle Komponenten des Kunstwerkes sind zugleich schon deshalb Inhalt und auch Form, weil sie in ihrem Wesen alle Träger von Bedeutung sind. (Mukarovsky 1989, 83)5
Darin wird deutlich, daßfür Mukarovsky nicht nur der literarische Text, das 'Artefakt', allein für die Bedeutung entscheidend ist, sondern auch der Prozeßseiner Rezeption. Eine der vielleicht interessantesten Anregungen Mukarovskys besteht in der Idee, zwischen dem materiellen Träger des Werkes, dem 'Artefakt' und seinem Korrelat im Bewußtsein der Gesellschaft, dem 'ästhetischem Objekt' zu unterscheiden (vgl. Chvatik 1981, 31). Die Bedeutung der Zeichen ergibt sich also nicht aus einer konventionellen Zuordnung von Signifikaten, sondern in einem aktiven Prozeßder Interpretation, in dem sich die Bedeutung zwischen Werk und Individuum konstituiert: "Mukarovsky schiebt zwischen das Werk und das Individuum den dynamischen Bereich des Ästhetischen, nämlich die eigentliche ästhetische Struktur, vor deren Hintergrund es erst zur Konkretisation einzelner Werke durch das wahrnehmende Subjekt kommt, das ein Bestandteil eines bestimmten gesellschaftlichen Kollektivs ist" (Chvatik 1981, 31). Der Interpretationsprozeßwird hier zusätzlich auf die historisch soziale Dimension hin geöffnet, indem Mukarovsky betont, daßsich das 'ästhetische Objekt' immer auch auf Grundlage eines gesellschaftlichen Horizonts und allgemeiner, historisch aber nicht konstanter Rezeptionshaltungen konstituiert.
Die Konstruktion des 'ästhetischen Objekts' ist jedoch nicht ohne Probleme, da es objektiv nicht faßbar ist, solange man nicht beschreiben kann, auf Grundlage welcher Mechanismen es vom Text einerseits und vom Leser andererseits konstruiert wird, bzw. wie großdie jeweiligen Anteile sind. Auch hier ist von poststrukturalistischer Seite relevante Kritik vorgetragen worden. So argumentiert Stanley Fish, der im Sinne des Poststrukturalismus davon ausgeht, daßliterarische Texte von sich aus keine sinnvolle Bedeutungskonstruktion zulassen, daßDiskurse über Literatur nur innerhalb eines geschlossenen gesellschaftlichen Systems möglich sind und Aussagen über Texte nur innerhalb solcher 'interpretive communities' Gültigkeit haben: "... communication occurs only within such a system (or context, or situation, or interpretive community) and the understanding achieved by two or more persons is specific to that system and determinate only within its confines" (Fish 1980, 304). Man könnte sagen, daßFish damit Mukarovskys Idee des 'ästhetischen Objekts' konsequent zu Ende denkt, indem er davon ausgeht, daßdas, was wir als objektive Fakten eines Textes wahrnehmen, bereits Produkt unser sozial vorgeprägten Perspektive ist: "... it is only in situations - with their interested specifications as to what counts as a fact, what is possible to say, what will be heard as an argument - that one is called on to understand" (Fish 1980, 304). Das hieße aber, daßes den Text als objektives Faktum praktisch gar nicht gäbe, oder daßdieser zumindest auf den Prozeßder Interpretation keinen wesentlichen Einflußhätte. Daßdies in dieser extremen Form nicht haltbar ist, hat Jonathan Culler unterstrichen:
This radical monism, by which everything is the product of interpretive strategies, is a logical result of analysis that shows each entity to be a conventional construct; but the distinction between subject and object is more resilient than Fish thinks and will not be eliminated 'at a stroke'. It reappears as soon as one attempts to talk about interpretation. To discuss an experience of reading one must adduce a reader and a text. [...] Interpretation is always interpretation of something, and that something functions as the object in a subject-object relation, even though it can be regarded as the product of prior interpretations. (Culler 1982, 74)
Dennoch ist Fishs Argumentation nicht gänzlich von der Hand zu weisen, solange man nicht in der Lage ist, den Anteil des Textes für die Konstitution des 'ästhetischen Objekts' zu erklären.
Mukarovskys eigener Ansatz, der auch von Kvetoslav Chvatik aufgenommen wird, erweist sich hier als unzureichend. Um den Prozeßder Genese des Sinnes im literarischen Text zu erfassen, prägte Mukarovsky den Begriff der 'semantischen Geste' (oder 'Bedeutungsdirektive'), die, in der Formulierung Chvatiks "... den dynamischen Übergang der Form zum Sinn, den spezifisch dichterischen Akt der Entstehung der Bedeutung aus dem dynamischen Gefüge der Formstruktur des Werkes umfassen soll"; die 'semantische Geste' beschreibt er als "... die Bemühung um eine Rekonstruktion jener inhaltlich nicht spezifizierten Geste, mit deren Hilfe der Dichter die Elemente seines Werks auswählt und zu einer Bedeutungseinheit verbunden hat." (Chvatik 1981, 36-37). Jedoch fällt es Chvatik ebenso schwer wie Mukarovsky, die Wahrnehmung der 'semantischen Geste' und die resultierende Bedeutungsbildung zu beschreiben, wie die folgende vage Formulierung zeigt:
Die Realisierung der Bedeutung wird durch entsprechende referentielle Strukturen ermöglicht, die im Prozeßder Ontogenese und Phylogenese, im Prozeßder gesellschaftlichhistorischen Praxis im Bewußtsein des Zeichenbenutzers verankert sind. Die Wahrnehmung des sinnlichen Zeichenträgers aktiviert diese Strukturen, wodurch im Bewußtsein des Benutzers die entsprechende Bedeutung auftaucht. (Chvatik 1981, 187)
Eine Vermittlung zwischen 'Zeichenträger' und 'referentiellen Strukturen' kann sich Chvatik nur über Codes vorstellen. Er geht somit davon aus, daßes sich bei einem sprachlichen Kunstwerk um ein kodifiziertes Mitteilungssystem handelt (vgl. Chvatik 1981, 191). Dies ist jedoch problematisch, da es schwerfällt, die grundsätzliche Offenheit sprachlicher Bedeutung zu betonen, wenn man andererseits davon ausgeht, daßdiese im Text kodifiziert, also eindeutig zugeordnet ist. Chvatik versucht das Problem dadurch zu lösen, daßer zwischen einem allgemein gültigen sprachlichen Code und einem dynamischen künstlerischen Code unterscheidet. Der Leser müsse nun auf Grundlage seiner Erwartungen diesen künstlerischen Code rekonstruieren: "Der Kode eines Kunstwerks ist nicht wie ein sprachlicher Kode im voraus gegeben, sondern mußvom Rezipienten im Verlauf der Rezeption des Werks auf der Grundlage der Erfahrung mit vorangegangenen Werken rekonstruiert werden. Der Rezeptionskode kann erst aus den Aufbauprinzipien des Kunstwerks selbst erschlossen werden" (Chvatik 1981, 192). Da der Code des Autors mit dem des Rezipienten nie ganz übereinstimmen könne, ergäben sich stets unterschiedliche Interpretationen.
Hier könnte nun wieder Stanley Fish einwenden, daßder 'Rezeptionskode' eine reine Konstruktion der Lesererwartung sei, denn die Frage, wie es dem Leser gelingt, den 'Rezeptionskode' zu erschließen, wird von Chvatik nicht überzeugend beantwortet. Auch Peter V. Zima kommt daher in seiner Kritik zu dem Schluß: "Dem Prager Strukturalismus fehlen präzise semantische und semiotische Begriffe, die es ihm gestatten würden, die Bedeutungskonstitution literarischer Texte zu beschreiben. Nicht nur der Begriff 'semantische Geste' ist zu metaphorisch, sondern auch Begriffe wie 'Werkaufbau' oder 'Aufbauprinzip'" (Zima 1995, 211). Hinzu kommt, daßder Begriff des Codes allein zur Beschreibung literarischer Kommunikation ungeeignet scheint, da er eine eindeutige Zuordnung von Form und Inhalt impliziert, die dem Versuch, zwischen Bestimmtheit und Vieldeutigkeit zu vermitteln, zuwider läuft.
Auch Wolfgang Iser könnte als Erbe des tschechischen Strukturalismus betrachtet werden, da er ebenso wie Mukarovsky davon ausgeht, daßdas literarische Kunstwerk erst im Prozeßder Textrezeption vom Leser als 'ästhetisches Objekt' konkretisiert werden muß. Iser versucht dabei, den Anteil des Textes an der Bedeutungsbildung mit Hilfe der Sprechakttheorie zu erklären. Dabei kann er in Anlehnung an Austin und Searle betonen, daßÄußerungen durch ihren Kontextbezug stets über ihren linguistischen 'Inhalt' hinaus bedeuten. Das Modell der Sprechakte ist jedoch nicht ohne Probleme und wurde dadurch ebenfalls zum 'Opfer' der Dekonstruktion. Vor allem Jacques Derrida hat zu zeigen versucht, daßdie 'Schrift', welche die fixierte Äußerung von Autor und Adressat trennt, den Bezug einer Äußerung auf einen eindeutigen und abgeschlossenen Kontext unmöglich macht.
Die Sprechakttheorie geht davon aus, daßSätze häufig mehr sind als einfache Aussagen. Vielmehr handelt es sich dabei oft um Handlungen; und zwar in dem Sinne, daßdie Tatsachen einer Äußerung erst durch diese selbst hervorgebracht werden - wie etwa in dem Satz: 'Ich erkläre die Veranstaltung für eröffnet'. Dazu Searle: "I think it is essential to any specimen of linguistic communication that it involve a linguistic act. It is not as has generally been supposed, the symbol or word or sentence, which is the unit of linguistic communication, but rather it is the production of the token in the performance of the speech act that constitutes the basic unit of linguistic communication" (Searle 1991, 254). Sprachhandlungen mit einer beabsichtigten Wirkung, wie 'Versprechen', 'Warnen' etc. werden von Searle als illokutionäre Sprechakte bezeichnet. Der Erfolg (also auch die erfolgreiche Interpretation) solcher Sprechakte hängt nach Searle von Regeln und Konventionen ab, die mit dem entsprechenden Sprechakt verbunden werden: "To perform illocutionary acts is to engage in a rule-governed form of behaviour" (Searle 1991, S. 255).
Iser überträgt nun das Modell der Sprechakte auch auf die Literatur, die für ihn eine Art illokutionären Sprechakt darstellt: "...die Sprechakttheorie versucht die Bedingungen zu beschreiben, die das Gelingen der Sprachhandlung gewährleisten. Um solche Bedingungen geht es auch in der Lektüre fiktionaler Texte, die insofern eine Sprachhandlung bewirken, als im Leser eine Verständigung mit dem Text bzw. über den Text mit dem, was er zu vermitteln bestrebt ist, gelingen sollte, aber auch mißlingen kann" (Iser 1994, 89). Dies könnte erklären, wie der literarische Text die Rezeption durch den Leser lenkt und dabei ein komplexeres 'ästhetisches Objekt' dadurch hervorbringen kann, daßer seinen Rezeptionskontext quasi mit vermittelt:
Für den Sprechakt als Kommunikationseinheit ist es entscheidend, daßer sowohl die Organisation der Zeichen als auch den intendierten Empfang der übermittelten Äußerung im Empfänger bedingen muß. Daraus folgt: Sprechakte sind nicht bloße Sätze, sondern sind als sprachliche Äußerungen immer schon situierte Sätze; daßheißt, solche, die in Situationen bzw. bestimmten Kontexten fallen. Deshalb erhalten die sprachlichen Äußerungen ihren Sinn durch ihre Verwendung. [...] Die pragmatische Dimension [der Literatur, RS] kommt erst dann voll zum Vorschein, wenn man das Augenmerk auf die vielen Kontexte richtet, die der fiktionale Text in sich hineinzieht, bündelt und parat hält, um sie durch den geschriebenen Text hindurch vermitteln zu können. (Iser 1994, 90-91)
Damit dieser sprachliche Akt gelingt, müssen jedoch verschiedene Bedingungen erfüllt sein: Die Äußerung des Sprechers mußsich auf eine Konvention berufen, die auch für den Empfänger gilt und es mußdie Situation definiert sein, in der sich eine solche Handlung vollzieht (vgl. Iser 1994, 92). Gerade die Situationsbindung ist für den Erfolg von Sprechakten zentral: "So bildet die Situation mit ihren Begleitumständen einen stark definierten Kontext, durch den Sätze nicht nur in Äußerungen verwandelt werden, sondern als Äußerungen ein dialogisches Verhältnis konstituieren, das die Voraussetzung für eine Kommunikation zwischen Sprecher und Empfänger bildet" (Iser 1994, 102).
Fraglich ist nun, wie in der geschriebenen Sprache über längere historische Zeiträume bei Abwesenheit von Sender und Adressat eines Sprechaktes ein Rückgriff auf Konventionen und Äußerungskontexte möglich sein kann. Dieses Problem wurde vor allem von Jacques Derrida hervorgehoben: "In order for my written communication to retain its function as writing, i.e., its readability, it must remain readable despite the absolute disappearance of any receiver, determined in general. My communication must be repeatable - iterable ..." (Derrida 1977, 179). Für Derrida ist dies unmöglich:
And this is the possibility on which I want to insist: the possibility of disengagement and citational graft which belongs to the structure of every mark, spoken or written [...] in writing, which is to say in the possibility of its functioning being cut off, at a certain point, from its 'original' desire-to-say-what-one-means and from its participation in a saturable and constraining context. Every sign [...] can be cited, put between quotation marks; in so doing it can break with every given context, engendering an infinity of new contexts in a manner which is absolutely illiminable. (Derrida 1977, 185)
Searle entgegnet in einer direkten Antwort auf Derrida, daßauch geschriebene Äußerungen interpretierbar wären, da die Autorintention erhalten bleibt: "Understanding the utterance consists in recognizing the illocutionary intentions of the author and these intentions may be more or less perfectly realized by the words uttered, whether written or spoken. And understanding the sentence apart from any utterance is knowing what linguistic act its utterance would be the performance of" (Searle 1977, 202). Dies entkräftet jedoch nicht Derridas Argument, denn wie soll der Leser die Autorintention erkennen, wenn der ursprüngliche Äußerungskontext nicht mehr zur Verfügung steht? Denn um zu erkennen, 'what linguistic act its utterance would be the performance of', benötigt der Leser eben mehr Informationen als nur den Satz selbst.
Auch Iser hat dieses Problem erkannt: "Die Gemeinsamkeit des Sprachhabitus von fiktionaler und gebrauchssprachlicher Rede findet an einem entscheidenden Punkt ihre Grenze. Der fiktionalen Rede fehlt der Situationsbezug, dessen hohe Definiertheit im Sprechaktmodell vorausgesetzt ist ..." (Iser 1994, 104). Iser argumentiert nun, daßder literarische Text die Anweisung zur Schaffung eines solchen Situationsbezugs mit sich führt, denn fiktionale Rede
... produziert einen illokutionären Sprechakt, der allerdings nicht mit einem gegebenen Situationskontext rechnen kann und folglich alle die Anweisungen mit sich führen muß, die für den Empfänger der Äußerung die Herstellung eines solchen situativen Kontextes erlauben. [...] Der autoreflexive Charakter fiktionaler Rede stellt daher Auffassungsbedingungen für die Vorstellung bereit, die dann einen imaginären Gegenstand zu erzeugen vermag. (Iser 1994, S. 106)
Iser trifft hier einen interessanten Punkt. Indem er annimmt, daßder Äußerungskontext auf Grundlage des Textes vom Leser hergestellt werden muß, entgeht er der Notwendigkeit, den Kontext mit der Äußerung als gegeben annehmen zu müssen. Fraglich ist nun aber, wie der Text die nötigen Instruktionen transportieren soll. Isers Modell bleibt dabei ungenau und erinnert in gewisser Weise an Chvatiks Unterscheidung zwischen 'normalsprachlichem' und 'künstlerischem' Code: "Der für das Verstehen eines fiktionalen Textes notwendige Abbau von Unbestimmtheit erfolgt nicht über solche [wie in der kommunikativen Rede durch Konventionen und Situationsangemessenheit, RS] festgelegten Referenzen. Vielmehr mußder den Elementen des Textes unterliegende Code erst entdeckt werden, der als Referenz den Sinn des Textes verkörpert" (Iser 1995, 98). Die Mechanismen dieser 'Entdeckung' bleiben jedoch weitgehend im Dunkeln.
Die Untersuchung der linguistischen Grundlagen des Strukturalismus und ihrer poststrukturalistischen Kritik zeigt, daßes unmöglich ist, die Bedeutung literarischer Texte allein aus ihrer sprachlichen Form abzuleiten. Der positivistische Glaube an die Möglichkeit einer wissenschaftlich eindeutigen Interpretation literarischer Texte hat sich schnell als Illusion erwiesen. Verschiedene Poststrukturalisten und speziell die Dekonstruktion haben gezeigt, daßliterarische Texte nicht auf eine 'richtige' Interpretation festzulegen sind. Die mit der 'Dekonstruktion' verbundene Radikalisierung strukturalistischer Prämissen führt dabei jedoch zu Widersprüchen und macht es dem Poststrukturalismus schwer, über eine bloße Kritik hinaus zu kommen.
Will man sich nicht mit der Unmöglichkeit sinnvoller Interpretation zufrieden geben, mußman erklären, wie es trotz der prinzipiellen Offenheit des literarischen Textes möglich ist, diesem Sinn zu verleihen. Daßman dafür den Leser stärker ins Kalkül ziehen muß, ist schon sehr früh und auch im Strukturalismus selbst erkannt worden. Vor allem die Anregungen Mukarovskys und Chvatiks verdienen hier nähere Betrachtung, da ihr Versuch, zwischen Form und Inhalt, bzw. zwischen Text und Leser dialektisch zu vermitteln, noch heute wertvolle Anregungen und Fragestellungen bietet. Mukarovsky hat gezeigt, daßder Akt der Interpretation das literarische Kunstwerk als ein 'ästhetisches Objekt' konstruiert, das mit dem Text als solchem nicht identisch ist. Dennoch ist diese Konstruktion nicht willkürlich, da sie durch die Strukturen des Textes gelenkt wird.
Als grundlegendes Problem dieser leserorientierten Ansätze zeigt sich die Schwierigkeit, die Mechanismen zu beschreiben, mit deren Hilfe solche 'ästhetischen Objekte' konstruiert werden und wie Text und Leser dabei zusammenwirken. Daßes Mukarovsky und Chvatik nicht gelingt, den Prozeßder literarischen Kommunikation adäquat zu beschreiben, liegt dabei vor allem am Fehlen einer soliden Textsemiotik. Ein Grundproblem verfügbarer semiotischer Kommunikationsmodelle scheint dabei vor allem in der Tatsache zu liegen, daßdiese Kommunikation als Vorgang von Encodieren und Dekodieren beschreiben. Wenn es aber, wie Chvatik annimmt, für den Leser darum geht, den 'künstlerischen Code' zu rekonstruieren, so impliziert dies eine mögliche korrekte Interpretation, was eine Reduzierung des Bedeutugspotentials des Textes zur Folge hätte.
Isers Versuch, die Sprechakttheorie auf die Literatur anzuwenden, zeigt, daßes sinnvoll sein kann, sich die Erkenntnis zu Nutze zu machen, daßsprachliche Äußerungen über ihren rein semantischen Inhalt hinaus bedeuten können und daßder Äußerungskontext einen wesentlichen Beitrag zur Interpretation leistet. Hier ist man jedoch mit dem - ebenfalls von der Dekonstruktion aufgeworfenen - Problem konfrontiert, daßliterarische Texte als schriftliche Äußerungen nicht auf einen präsenten Kontext bezogen werden können. Dabei ist Isers Idee interessant, daßerst der Leser durch bestimmte Vorgaben des Textes einen solchen Kontext schafft. Jedoch wirft das wieder die Frage auf, mit welchen Mechanismen dies gelingt.
Damit sind die wesentlichen Probleme benannt, die ein modernes Kommunikationsmodell zu lösen hätte. In den folgenden Kapiteln soll nun untersucht werden, inwiefern die Relevance Theory diese Fragen beantworten kann.
3. Alternative Kommunikationsmodelle - Inferenz und Relevanz
'So here is a question for you. How old did you say you were?' Alice made a short calculation, and said 'Seven years and six months.' 'Wrong!' Humpty Dumpty exclaimed triumphantly. 'You never said a word like it!' (Lewis Carrol, Through the Looking Glass)
Im ersten Kapitel wurde deutlich gemacht, daßman den Prozeßder Bedeutungsbildung eines Textes nur dann hinreichend beschreiben kann, wenn man auch den außertextuellen Bereich in die theoretischen Überlegungen einbezieht. Dabei mußsich das Augenmerk verstärkt auf die Rolle des Lesers richten, dem es in aller Regel gelingt, aus den Vorgaben des Textes ein sinnhaftes 'ästhetisches Objekt' zu konstruieren. Verschiedene theoretische Ansätze vom Strukturalismus bis zur Rezeptionstheorie legen die Möglichkeit nahe, die Bedeutungsbildung literarischer Texte analog zur allgemeinen sprachlichen Kommunikation zu beschreiben. Jedoch können die Ergebnisse - wie etwa bei Chvatik oder Iser - nicht wirklich überzeugen. Dabei war die Vermutung geäußert worden, daßeine wesentliche Ursache für die Probleme bei der Beschreibung des Rezeptionsprozesses bereits in den Defiziten der zugrunde gelegten Modelle sprachlicher Kommunikation liegt. Als zentrales Problem stellte sich dabei die Schwierigkeit heraus, Kommunikation als Prozeßdes Encodierens und Dekodierens von Bedeutung zwischen einem Sender und einem Empfänger zu beschreiben - eine Vorstellung die den meisten Kommunikationsmodellen mehr oder minder explizit zugrunde liegt.
Die Relevance Theory wird von ihren Begründern Dan Sperber und Deirdre Wilson selbstbewußt als Alternative präsentiert. Ein wesentlicher Teil ihres Standardwerkes Relevance: Communication and Cognition (Sperber, Wilson 1995) befaßt sich mit der Kritik des sogenannten 'Code-Modells' der Kommunikation, das von den Autoren verworfen wird. Dagegen stellen sie ein inferentielles Kommunikationsmodell im Sinne des Sprachphilosophen H. P. Grice, dessen Ideen sie in ihrer Relevance Theory konsequent weiterentwickeln und systematisieren. Bevor im nächsten Kapitel die mögliche Bedeutung der Relevance Theory für Probleme der Literaturwissenschaft untersucht werden kann, soll zunächst gezeigt werden, inwiefern sich das Modell von den im vorangegangenen Kapitel besprochenen Ansätzen unterscheidet und wo mögliche Vorteile liegen6. Dabei bietet es sich an, die Relevance Theory im Kontrast zu den Ideen von H. P. Grice darzustellen, da so einerseits die sprachphilosophischen Wurzeln, andererseits aber auch die Besonderheiten des Modells am besten deutlich gemacht werden können.
Neben dem Problem, die Vieldeutigkeit sprachlicher Äußerungen bei dennoch (meist) erfolgreicher Kommunikation über Codes zu erklären, liegt die wesentliche Schwierigkeit eines Code-Modells darin, erklären zu müssen, wie es möglich ist, mittels einer sprachlichen Äußerung Inhalte zu transportieren, die weit über die linguistische (codierte) Bedeutung hinausgehen. Sperber und Wilson sehen in diesem Punkt die Versuche der strukturalistischen Semiotik, sprachlichen oder kulturellen Systemen zugrundeliegende Codes herauszuarbeiten, als gescheitert:
... valient attempts were made by anthropologists such as Lévi-Strauss or literary theorists such as Barthes to approach cultural or artistic symbolism in semiotic terms. In the course of these attempts, they certainly shed new light on the phenomena, and drew attention to many interesting regularities; but they never came near to discovering an underlying code in the strict sense: that is, a system of signal-message pairs which would explain how myths and literary works succeed in communicating more than their linguistic meaning, and how rites and customs succeed in communicating at all. (Sperber, Wilson 1995, 8)
Eine mögliche Alternative versucht die Sprechakttheorie anzubieten. Austin hatte Ende der 1950er Jahre deutlich gemacht, daßsprachliche Äußerungen mehr tun, als verifizierbare Aussagen über die Wirklichkeit zu treffen (vgl. Austin 1994). Er hatte zu zeigen versucht, daßman sprachliche Äußerungen als Handlungen beschreiben kann, deren Erfolg oder Mißerfolg nicht allein durch die Art der sprachlichen Mitteilung, sondern durch Konventionen und kontextuelle Rahmenbedingungen bestimmt wird. Dies böte die Möglichkeit, das Code-Modell auf den außerlinguistischen Bereich zu übertragen, indem man annimmt, daßdie Art des vollzogenen Sprechaktes durch seine Konventionen codiert wird. In diesem Sinne argumentiert Searle; seiner Meinung nach erkennt der Hörer (Leser) den über die semantische Bedeutung hinausgehenden Inhalt "... in virtue of his knowledge of the rules for the sentence uttered" (Searle 1969, 48). Es müßte daher also semantische und pragmatische Codes geben, durch die neben der linguistischen Bedeutung auch die Sprechaktbedeutung, die 'illocutionary force' (Austin) einer Äußerung, kommuniziert werden kann.
Austins Ansatz ist jedoch in verschiedener Hinsicht problematisch. So handelt es sich bei den von ihm diskutierten Bespielen für 'performative' Sprechakte um sehr ausgewählte und konventionalisierte (codierte) Situationen wie Eheschließungen, Schiffstaufen etc. Daßes dagegen Sprechakte gibt, die weniger deutlich oder gar nicht durch Konventionen bedingt werden, hat Strawson deutlich gemacht: "... although the circumstances of utterance are always relevant to the determination of the illocutionary force of an utterance, there are many cases in which it is not as conforming to an accepted convention of any kind [...] that an illocutionary act is performed" (Strawson 1994, 43). Als Beispiel nennt Strawson den Aussagesatz 'the ice over there is very thin', der, an einen Schlittschuhläufer gerichtet, eindeutig als Warnung verstanden würde, wenngleich es dafür keine festgelegten Konventionen gibt. Strawson argumentiert, daßSprechakte vor allem durch die Intention geprägt sind, etwas zu bewirken: "And the understanding of the force of an utterance in all cases involves recognizing what may be called broadly an audience-directed intention and recognizing it as wholly overt, as intended to be recognized" (Strawson 1994, 55). Diese Idee stammt von H. P. Grice, der vorgeschlagen hatte, natural meaning (meaningN) und non-natural meaning (meaningNN) zu unterscheiden, um erklären zu können, wie es möglich ist, mit einer Äußerung etwas anderes als die linguistische Bedeutung zu 'meinen'7. Grice definiert non-natural meaning folgendermaßen:
A first shot would be to suggest that 'x meantNN something' would be true if x was intended by its utterer to induce a belief in some 'audience' and to say what the belief was would be to say what x meantNN. This will not do. [...] Clearly we must at least add that for x to have meantNN anything, not merely must it have been 'uttered' with the intention of inducing a certain belief but also the utterer must have intended an 'audience' to recognize the intention behind the utterance. (Grice 1994, 25)
Das Wesentliche einer sprachlichen Äußerung wäre also weniger der Vollzug einer konventionellen Handlung, als vielmehr das Erkennen der intendierten Inhalte einer Äußerung durch den Hörer (Leser) mittels der verwendeten sprachlichen Form. In der Pragmatik ist man sich weitgehend einig, daßsolche möglichen Inhalte einer die für Probleme der Literaturwissenschaft interessant sind, um die Grundlagen der folgenden Kapitel zu sichern Äußerung über Inferenzprozesse gewonnen werden können. Die Idee, die sich dahinter verbirgt ist, daßwir in der Lage sind, neue Informationen mit Annahmen aus vorhandenen Informationen zusammenzubringen und daraus neue Schlußfolgerungen zu ziehen. Durant und Fabb versuchen, einen solchen Prozeßzu explizieren, um zu zeigen, wie man von der Äußerung eines Sprechers X 'It's hot in here' zur Schlußfolgerung 'X would like me to open the window' gelangt (vgl. Durant, Fabb 1990, 149):
I1 It's hot in here.
C2 X thinks it is hot in this room.
B1 If X thinks it is hot in this room then he would like the room to be cooler.
C3 X would like the room to be cooler.
B2 If I opened the window then the room might be cooler.
C1 X would like me to open the window.8
Fraglich ist dabei nun, wie es dem Hörer (Leser) gelingt, die korrekten bridging inferences zu vollziehen, da es denkbar ist, durch unterschiedliche Annahmen (premises) unterschiedliche Schlußfolgerungen zu ziehen. So könnte die genannte Äußerung 'it's hot in here' auch folgende Inferenzprozesse auslösen (vgl. Durant/Fabb 1990, 150):
I1 It's hot in here
C2 X thinks it is hot in the room
B3 It is not hot in the room
B4 If X thinks it is hot in the room then X is probably feverish
C4 X is probably feverish
Sollte auch inferentielle Kommunikation tatsächlich über Codes funktionieren, müßte man erklären, "... how speaker and hearer can come to have not only a common language, but also common sets of premises, to which they apply identical inference rules in parallel ways" (Sperber, Wilson 1995, 15). Anders ausgedrückt hieße dies, daßursprünglicher Äußerungskontext und Interpretationskontext genau übereinstimmen bzw. daßSender und Empfänger über das exakt gleiche Wissen verfügen müßten.9 Was in einem kurzen mündlichen Austausch wie über das zu öffnende Fenster durch den unmittelbar präsenten Kontext noch ansatzweise vorstellbar wäre, scheint für schriftliche oder gar literarische Mitteilungen gänzlich unmöglich. Hier stößt man wieder an die von Derrida vorgetragene Kritik am Kontextproblem, in der er argumentierte, daßin der 'Schrift' der ursprüngliche Äußerungskontext durch die zeitliche Distanz und die mögliche Wiederholung von Äußerungen in verschiedenen Kontexten (iteravit é) unwiederbringlich verlorengeht.
Wenn man also davon ausgeht, daßzumindest ein Teil der kommunizierten Inhalte über Inferenzprozesse erschlossen wird, läßt sich ein Kommunikationsmodell, das allein auf Codes basiert nicht mehr aufrecht erhalten, da wesentliche Voraussetzungen wie ein exakt definierter Kontext (also ein manifestes gemeinsames Wissen zwischen Sender und Empfänger) nicht realistisch sind.
Wenn nun die Intention von Äußerungen nicht über Codes erschlossen werden kann, stellt sich die Frage, wie Verständigung dennoch erreicht wird. Wie kann man also erklären, daßaus der unendlichen Anzahl möglicher Inferenzen bestimmte mit einer größeren Wahrscheinlichkeit vollzogen werden als andere? H. P. Grice hat hier den Ansatz für eine mögliche Antwort gegeben, denn seine Definition von non-natural meaning kann als Grundstein eines Kommunikationsmodells aufgefaßt werden, wie auch Levinson konstatiert:
If, as we indicated, Grice's theory of meaning-nn is construed as a theory of communication, it has the interesting consequence that it gives an account of how communication might be achieved in the absence of any conventional means for expressing the intended message. A corollary is that it provides an account of how more can be communicated[...] than what is said. (Levinson 1983, 108)
In seinem Aufsatz Meaning hat Grice nicht nur betont, daß"... the meaning of a sign needs to be explained in terms of what users of the sign do (or should) mean by it on particular occasions" (Grice 1994, S. 25), sondern hatte auch einen Hinweis darauf gegeben, wie dies einem Sprecher (Autor) möglich ist; nämlich indem er durch seine Äußerung einen (sprachlichen) Beleg liefert, der es dem Hörer (Leser) ermöglicht, auf die intendierte Bedeutung zu schließen: "... not merely must it [die Äußerung, RS] have been 'uttered' with the intention of inducing a certain belief but also the utterer must have intended an 'audience' to recognize the intention behind the utterance" (Grice 1994, S. 25).
Verbindet man Grices Gedanken zum 'meaning'-Begriff mit seinem Konzept der conversational implicature aus seinem Aufsatz Logic and Conversation (Grice 1991a), erhält man die Möglichkeit, Kommunikation zu erklären, ohne auf Codes angewiesen zu sein. In Logic and Conversation stellt Grice fest, daßKommunikation meist von Kooperativität gekennzeichnet ist:
Our talk exchanges do not normally consist of a succession of disconnected remarks, and would not be rational if they did. They are characteristically, to some degree at least, cooperative efforts; and each participant recognises in them, to some extent, a common purpose or set of purposes, or at least a mutually accepted direction. (Grice 1991a, 307)
Grice geht nun davon aus, daßdiese Kooperativität als allgemeines Prinzip jeder Kommunikation zugrunde liegt; dieses Prinzip bezeichnete Grice als Co-operative Principle:
We might then formulate a rough general principle, which participants will be expected (ceteris paribus) to observe, namely: Make your conversational contribution such as is required, at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. One might label this the Co-operative Principle (CP). (Grice 1991a, 307)
Um zu konkretisieren, was es praktisch bedeutet, 'kooperativ' zu kommunizieren, formulierte Grice neun sogenannte Maxime (vgl. Grice 1991a, 307-309):
- The maxim of Quality:
1) Do not say what you believe to be false!
2) Do not say what for which you lack adequate evidence!
- The maxim of Quantity:
1) Make your contribution as informative as is required!
2) Do not make your contribution more informative than is required!
- The maxim of Relation
1) Be relevant!
- The maxim of Manner
1) avoid obscurity of expression!
2) Avoid ambiguity!
3) Be brief!
4) Be orderly!
Grices Maxime gaben Anlaßzu Mißverständnissen und Diskussionen. Die Tatsache, daßGrice die Maxime als Imperative formuliert, könnte den Schlußzulassen, daßes sich dabei um 'Instruktionen' darüber handelt, wie sich Sprecher in Kommunikationssituationen zu verhalten haben. Es handelt sich jedoch vielmehr um Erwartungshaltungen, die der Interpretation von Äußerungen zugrunde liegen: "So Grice's point is not that we always adhere to these maxims on a superficial level but rather that, wherever possible, people will interpret what we say as conforming to the maxims on at least some level" (Levinson 1983, 103). Das 'co-operative principle' ist dadurch in der Lage, Inferenzprozesse auszulösen, wie Grice an folgendem kurzen Dialog demonstriert (vgl. Grice 1991a, 311):
A: I am out of petrol.
B: There is a garage round the corner.
Würde B damit nicht implizieren, daßdie Tankstelle auch geöffnet hat, so würde er gegen die Maxime 'be relevant' verstoßen. Eine solche Annahme, die aus dem semantischen Inhalt zusammen mit weiteren Annahmen basierend auf dem co operative principle gewonnen wird, nennt Grice conversational implicature. Der Begriff der conversational implicature unterscheidet sich damit von Konzepten wie logic implication, die sich rein auf semantische Inhalte beziehen: "Implicatures are not semantic inferences, but rather inferences based on both the semantic content of what has been said and some specific assumptions about the co-operative nature of ordinary verbal interaction" (Levinson 1983, 104).
Grices Analysen bleiben jedoch sehr skizzenhaft und sind mit vielen Problemen behaftet. Der umstrittene Status der Maximen war bereits erwähnt worden. Es kann sich dabei nur um Idealisierungen handeln. Normalerweise halten sich Menschen in der Kommunikation selten genau an diese Maximen, ansonsten müßten Kommunikationsbeiträge ausschließlich aus absolut eindeutigen, wahrheitsgetreuen Äußerungen bestehen. Dies ist aber in der alltäglichen Kommunikation selten der Fall. Fraglich ist auch, ob es sich tatsächlich um diese neun und nicht mehr, weniger oder andere Maximen handelt. Die meisten Probleme, die aus dem Ansatz entstehen, wurden von Grice selbst nicht behandelt. So hat Levinson Recht, wenn er schreibt: "Grice has provided little more than a sketch of the large area [...]. So if use is to be made of these ideas in a systematic way within linguistic theory, much has to be done to tighten up the concepts employed and to work out exactly how they apply to particular cases" (Levinson 1983, 118). Auch wird Grices Ansatz in der bestehenden Form noch keinem explanativen Anspruch gerecht, wie Neale feststellt: "... Grice has certainly not stated any sort of method or procedure for calculating the content of conversational implicatures" (Neale 1992, 528). Nur wenn man die Prinzipien und Mechanismen, auf deren Grundlage implicatures gewonnen werden, fassen kann, ist es möglich, auch zu erklären, warum bestimmte implicatures wahrscheinlicher sind als andere.
Die Relevance Theory kann zweifellos als Weiterentwicklung der Ideen von H. P. Grice betrachtet werden. So liegt die Vorstellung, daßKommunikation weniger auf der Übermittlung fester Inhalte durch entsprechende sprachliche Formen als auf dem Erkennen informativer Intentionen durch den Hörer (Leser) beruht, der Relevance Theory als Basis zugrunde: "The idea that communication exploits the well-known ability of humans to attribute intentions to each other should appeal to cognitive and social psychologists" (Sperber, Wilson 1987, 699). In der Relevance Theory als kognitivem Modell ist Kommunikation daher nur als inferentieller Prozeßdenkbar, in dem Dekodieren nur eine untergeordnete Rolle spielt. In der Beschreibung dieses Prozesses machen sich Sperber und Wilson Grices Idee zu eigen, daßder menschlichen Kommunikation Prinzipien zugrunde liegen, welche den Interpretationsprozeßunbewußt steuern. Dabei versucht die Relevance Theory, sprachliche Kommunikation in allgemeinere kognitive Mechanismen einzubetten. Dadurch können Sperber und Wilson auf Grices strittige Konversationsmaximen verzichten. Sie postulieren statt dessen ein allgemeines Prinzip, das auf der Annahme gründet, daßdas menschliche Denken auf eine Maximierung der Relevanz10 von Informationen ausgerichtet ist:
Human cognition as a whole is a case in point: it is aimed at improving the quantity, quality, and the organisation of the individual's knowledge. To achieve this goal as efficiently as possible, the individual must at each moment try to allocate his processing resources to the most relevant information: that is [...] information likely to bring about the greatest improvement of knowledge at the smallest processing cost. Our claim is that this is done automatically and that an individual's particular cognitive goal at a given time is always consistent with the more general goal of maximising the relevance of the information processed. (Sperber, Wilson 1987, 700)
Bevor das Relevanzprinzip genauer erläutert werden kann, ist es nötig, einige Grundlagenprobleme zu erörtern, die für die Relevance Theory zentral sind. Dies ist vor allem daher wichtig, da die Theorie häufig auf das Relevanzprinzip reduziert wird, wobei wichtige Grundlagen und Abweichungen von bestehenden Modellen übersehen werden.
Ein Problem, das bereits weiter oben angesprochen wurde, ist die Schwierigkeit der Definition eines gemeinsamen Wissens (mutual knowledge) für die korrekte Interpretation von Äußerungen. Sperber und Wilson verfolgen hier einen eigenen Ansatz, indem sie davon ausgehen, daßnicht nur das bereits unmittelbar vorhandene Wissen von Bedeutung ist. Sie verwenden daher nicht den Begriff knowledge, sondern entwickeln das Konzept cognitive environment 11, definiert als "... a set of assumptions that an individual is capable of mentally representing and accepting as true or probably true" (Sperber, Wilson 1987, 699). Es geht also in der Kommunikation nicht um exakt definiertes gemeinsames Wissen (mutual knowledge), sondern lediglich um mutual manifestness von Annahmen in einer gemeinsamen kognitiven Umgebung. Eine Annahme wäre dann mutually manifest, wenn diese von den Kommunikationsteilnehmern entweder wahrnehmbar oder durch Inferenz herstellbar wäre; anders ausgedrückt: "... an assumption, then, is manifest in a cognitive environment if the environment provides sufficient evidence for its adoption ..." (Sperber, Wilson 1995, 39). Dieser Ansatz hat zwei wichtige Konsequenzen: Zum einen ist es leichter möglich, eine gemeinsame kognitive Umgebung anzunehmen, da diese nicht auf das individuell gebundene 'Wissen' beschränkt ist; zum anderen sind die Annahmen, aus denen eine kognitive Umgebung besteht (anders als Wissen) relativ: "Manifestness [...] is a property not only of facts but, more generally, of true or false assumptions. It is a relative property. Facts and assumptions can be more or less strongly manifest" (Sperber, Wilson 1987, 699).
Sperber und Wilson gehen nun davon aus, daßKommunikation nicht direkt das Denken des Kommunikationspartners beeinflußt, sondern lediglich dessen cognitive environment, indem bestimmte Annahmen manifestiert oder verstärkt werden: "We want to suggest that the communicator's informative intention is better described as an intention to modify directly not the thoughts but the cognitive environment of an audience, with only partly foreseeable effects on the audience's actual thoughts" (Sperber, Wilson 1987, 700). Sie veranschaulichen dies an einem Beispiel:
Peter and Mary are sitting on a park bench. He points in a direction where she had not so far noticed anything in particular. This time, she takes a closer look and sees their acquaintance Julius in the distance, sitting on the grass. In other words, as a result of Peters behaviour, the presence of Julius, which was weakly manifest in Mary's cognitive environment, has become more manifest, to the point of being actually noticed. Moreover, it has become manifest that Peter had himself noticed Julius and intended her to notice him too. (Sperber, Wilson 1987, 700)
Sperber und Wilson bezeichnen solch ein Verhalten als ostension und gehen davon aus, daßes sich dabei um ein der menschlichen Kommunikation zugrunde liegendes Prinzip handelt. Das Inferenzprinzip hinzugenommen ist Kommunikation für die Relevance Theory somit immer ostensive-inferential communication, dessen Definition bereits einen wesentlichen Teil des Kommunikationsmodells der Relevance Theory beschreibt: " the communicator produces a stimulus which makes it mutually manifest to communicator and audience that the communicator intends, by means of that stimulus, to make manifest or more manifest to the audience a set of assumptions" (Sperber, Wilson 1995, S. 63).
Wie sieht nun aber dieser Inferenzprozeßkonkret aus? Auch hier unterscheidet sich die Relevance Theory von anderen Modellen. Während häufig davon ausgegangen wird, daßes sich bei den Inferenzprozessen, durch welche conversational implicatures gewonnen werden, um komplexere Problemlösestrategien handelt, in denen deduktive Prozesse nur eine untergeordnete Rolle spielen (vgl. Levinson 1983, 115-116), sind in der Relevance Theory unbewußte Deduktionsprozesse zentral. Sperber und Wilson übernehmen dabei Fodors Modularitätshypothese (Fodor 1983), nach der in der mentalen Informationsverarbeitung zwischen input systems und central systems unterschieden wird. Der Inferenzmechanismus wäre demnach eher als input system zu sehen, in dem die Prozesse spontan und unbewußt (ähnlich wie physische Wahrnehmungen) ablaufen und somit den input für die komplexeren central systems bereitstellen. Dabei werden durch Verarbeitung neuer Informationen im Kontext vorhandener Informationen (lexikale und konzeptuelle Gedächtniseinträge) neue Annahmen produziert, die Sperber und Wilson als contextual implications bezeichnen:
We describe a deductive device which takes as input a set of assumptions and systematically deduces all the conclusions it can from them. [...] Such a deduction may yield conclusions not derivable from either the new information or the context alone. These we call the contextual implications of the new information in the context. A contextual implication is thus a synthesis of old and new information. We see it as a central function of the deductive device to derive, spontaneously, automatically and unconsciously, the contextual implication of any newly presented information in a context of old information. (Sperber, Wilson 1987, 702)
Die Informationen, die in dem beschriebenen deductive device verarbeitet werden, haben die Form von Annahmen (assumptions) unterschiedlicher Stärke. Diese richtet sich nach der Verarbeitungsgeschichte der entsprechenden Annahmen bzw. nach den Grundlagen ihrer Gewinnung (vgl. Sperber, Wilson 1995, 75-82). Sperber und Wilson können dadurch drei Arten sogenannter contextual effects unterscheiden:
The information processed by the deductive device [...] comes in the form of assumptions with variably strength. [...] This allows us to characterise three types of contextual effects: the first [...] is the derivation of new assumptions as contextual implications; the second is the strengthening of old assumptions; and the third the elimination of old assumptions in favour of stronger new assumptions which contradict them (Sperber, Wilson 1987, 702)
Das Konzept der contextual effects ermöglicht es, Annahmen nach ihrer Relevanz zu unterscheiden und damit zu erklären, warum bestimmte Annahmen wahrscheinlicher sind als andere: "An assumption is relevant in a context if, and only if, it has some contextual effect in that context" (Sperber, Wilson 1987, 702). Das Ausmaßder Relevanz richtet sich dabei einerseits nach dem Umfang der contextual effects, andererseits nach dem Verarbeitungsaufwand, der zu diesen contextual effects führt. Sperber und Wilson definieren demnach Relevanz folgendermaßen:
Relevance:
Extent condition 1: An assumption is relevant in a context to the extent that its contextual effects in that context are large.
Extent condition 2: An assumption is relevant in a context to the extent that the effort required to process it in that context is small. (Sperber, Wilson 1987, 703)
Der Interpretation einer Äußerung liegt nun die unbewußte Erwartung zugrunde, daßder entsprechende Stimulus (sprachliche Äußerung, Geste o.ä.) so ausgewählt wurde, daßer ausreichende contextual effects bei geringem Verarbeitungsaufwand ermöglicht. Sperber und Wilson bezeichnen dies als das Principle of Relevance:
... every act of ostensive communication communicates the presumption of its own optimal relevance. (Sperber, Wilson 1987, 704)
Dabei wird 'presumption of optimal relevance' folgendermaßen definiert:
(a) The ostensive stimulus is relevant enough for it to be worth the addressee's effort to process it.
(b) The ostensive stimulus is the most relevant one compatible with the communicator's abilities and preferences (Sperber, Wilson 1995, 270).
Grice hatte ganz allgemein formuliert, daßerfolgreiche Kommunikation darin besteht, daßdem Hörer (Leser) ein Beleg geliefert wird, der es ihm ermöglicht, auf die intendierte Information zu schließen. Wie dies geschieht, könnte nun mit Hilfe des Relevanzprinzips erklärt werden. In dem weiter oben zitierten Beispiel von Sperber und Wilson etwa erkennt Mary die Intention Peters, ihr durch sein Verhalten (indem er in eine bestimmte Richtung zeigt) etwas mitzuteilen. Sie bildet daher (unbewußt) Hypothesen über den Inhalt seiner Intention. Peter könnte auch auf einen Hund hinweisen wollen, der hinter dem gemeinsamen Bekannten Julius zu sehen ist, jedoch bietet die Annahme, Peter wolle Mary auf den gemeinsamen Bekannten Julius aufmerksam machen, mehr contextual effects für geringeren Verarbeitungsaufwand. Diese Interpretation wäre somit mit dem Relevanzprinzip in Einklang; Mary würde nun wahrscheinlich die Äußerung nicht weiter interpretieren, es sei denn, weitere contextual effects würden den entsprechenden Verarbeitungsaufwand rechtfertigen. Würde Mary beispielsweise über die Annahme verfügen, daßJulius ein Langweiler ist und auch Peter so denkt, könnte sie Peters Geste als Aufforderung zum Aufbruch interpretieren. Die Verständigung wäre in diesem Falle ohne jede konventionelle (codierte) Form von Bedeutung (sogar ohne Sprache) erreicht worden.
Bevor es im nächsten Kapitel um speziellere Anwendungen des Relevanzprinzips gehen kann, sind noch einige wichtige Fragen zu beantworten. Dabei handelt es sich um Probleme, die bereits weiter oben im Zusammenhang mit Derridas Kritik an der Sprechakttheorie angesprochen wurden. So behandeln Sperber und Wilson hauptsächlich kurze (mündliche) Kommunikationssequenzen, in denen addresser und addressee unmittelbar präsent sind. Derrida hatte aber darauf hingewiesen, daßschriftliche Kommunikation vor allem durch das Nichtvorhandensein eines konkreten Empfängers gekennzeichnet ist: "In order for my written communication to retain its function as writing, i.e., its readability, it must remain readable despite the absolute disappearance of any receiver, determined in general" (Derrida 1977, 179). Sperber und Wilson betonen jedoch, daßdas Relevanzprinzip, also die Annahme, daßjede 'ostensive' Äußerung die Garantie ihrer eigenen Relevanz impliziert, auch für schriftliche Äußerungen gilt, denn die Adressaten einer Äußerung:
... can be specific individuals [...] or they may be individuals falling under a certain description, as when we address the present paragraph to all individuals who have read the book so far and found it relevant to them. [...] a stimulus can even be addressed to whoever finds it relevant. The communicator is then communicating her presumption of relevance to whoever is willing to entertain it. (Sperber, Wilson 1995, 158)
Dies ist möglich, da das Relevanzprinzip nicht auf Codes basiert und somit nicht auf einen fest definierten Kontext angewiesen ist, der quasi als 'Protokoll' des Codes fungieren müsse, wie Derrida annimmt, um die Unmöglichkeit erfolgreicher Kommunikation zu demonstrieren. Schrift bewirke nach Derrida "... the disruption, in the last analysis, of the authority of the code as a finite system of rules; at the same time, the radical destruction of any context as the protocol of code" (Derrida 1977, 180).
Dennoch ist die Frage des Kontextes auch für die Relevance Theory nicht ohne Bedeutung. Auch für ein inferentielles Kommunikationsmodell stellt sich die Frage, wie der Kontext determiniert wird, denn dieser beeinflußt maßgeblich die ablaufenden Inferenzprozesse, die ja neue Informationen mit vorhandenen Annahmen (dem Kontext) verbinden sollen. Auch hier gilt es, das von Derrida aufgeworfene Problem zu lösen, daßder Kontext prinzipiell unendlich ist, der Interpretationsprozeßaber nicht unendlich fortlaufen kann. Derrida fordert "... the disqualification or the limiting of the concept of context [...], inasmuch as its rigorous theoretical determination as well as its empirical saturation is rendered impossible or insufficient by writing" (Derrida 1977, 181).
Wie bei Derrida wird in der Regel davon ausgegangen, daßder Kontext mit einer Äußerung gegeben, bzw. daßdieser vor der Interpretation vorhanden sei (vgl. auch Levinson 1983, Kap. 1.4). Daßeine solche Auffassung problematisch ist, hat Derrida selbst gezeigt: um eine Äußerung korrekt zu interpretieren, müßte der gegebene Kontext genau definiert und abgeschlossen sowie Sender und Empfänger gleichermaßen bekannt sein, was praktisch unmöglich ist. In der Relevance Theory wird dagegen davon ausgegangen, daßder Kontext erst im Prozeßder Interpretation vom Interpreten 'geschaffen' wird. Dies war ähnlich bereits von Wolfgang Iser vorgeschlagen worden, der im Kontext der Sprechakttheorie vermutet hatte, daßder Text Impulse für die Konstruktion eines adäquaten Kontextes liefert (vgl. Iser 1994, 106). Jedoch gelang es Iser nicht zu erklären, wie dies genau möglich ist. Hier könnte nun das Relevanzprinzip helfen.
Das Relevanzprinzip besagt, daßjede Äußerung die implizite Garantie ihrer eigenen Relevanz kommuniziert. Der Interpret mußalso nicht die Relevanz der kommunizierten Information überprüfen (denn diese wird unbewußt vorausgesetzt) , sondern mußversuchen, aus den zur Verfügung stehenden Annahmen (zuletzt verarbeitete Annahmen, semantische Konzepte, enzyklopädische Gedächtniseinträge) einen Kontext zu konstruieren, der die Relevanz der verarbeiteten Information verstärkt und somit eine Interpretation ermöglicht, die mit dem Relevanzprinzip in Einklang ist. Dies bedeutet eine komplette Umkehr in der Auffassung des Kontextes:
It is not that first the context is determined, and then relevance is assessed. On the contrary, people hope that the assumption being processed is relevant (or else they would not bother to process it at all), and they try to select a context which will justify that hope: a context which will maximise relevance. In verbal communication in particular, it is relevance which is treated as given, and context which is treated as a variable. (Sperber, Wilson 1995, 142)
Am Ende jedes Deduktionsprozesses steht dem Interpreten in Form von Annahmen eine Vielzahl von Kontexten zur Verfügung. Sperber und Wilson gehen davon aus, daßdiese teilweise geordnet sind, und zwar in der Hinsicht, daßjeder Kontext kleinere (speziellere) Kontexte einschließt bzw. selbst in größere Kontexte eingebettet ist. Diese Ordnung entspricht ihrer Erreichbarkeit. Je mehr Sub-Kontexte erreicht werden müssen, um so größer ist der Verarbeitungsaufwand. Entsprechend dem Relevanzprinzip würde der Interpret einer Äußerung den Kontext (ausgehend von den unmittelbar verfügbaren Annahmen) soweit erweitern, wie der nötige Verarbeitungsaufwand durch entsprechende contextual effexts gerechtfertigt würde. Der mögliche Kontext wäre also - wie von Derrida gefordert - unendlich, jedoch würde der Interpretationsprozeßnur so lange ablaufen, bis eine Interpretation erreicht wäre, die mit dem Relevanzprinzip in Einklang ist.
Bisher wurde in diesem Kapitel vorwiegend der Teil der Bedeutungsbildung behandelt, der im allgemeinen in das linguistische Teilgebiet der Pragmatik fällt, also Bedeutung, die über den rein linguistischen Inhalt hinausgeht. Die poststrukturalistische Kritik hatte jedoch gezeigt, daßdas Konzept der linguistischen Bedeutung alles andere als unproblematisch ist. Sicher gelingt es den pragmatischen Theorien, durch die Konzentration auf Sprechaktbedeutungen oder Sprecherintentionen das Problem der Polysemie wesentlich zu reduzieren, aber dennoch bleiben Kommunikationspartner auf linguistische Bedeutung angewiesen, da diese nach wie vor die Basis des Interpretationsprozesses darstellen. Hier könnten sich auch für die Relevance Theory Probleme ergeben. Sperber und Wilson gehen trotz ihrer Kritik am Code-Modell der Kommunikation davon aus, daßSprache zu einem gewissen Teil über Codes funktioniert: "Verbal communication, we argue, involves two types of communication process: one based on coding and decoding, the other on ostension and inference. The coded communication is of course linguistic: A linguistic stimulus triggers an automatic process of decoding. The semantic representations recovered by decoding are logical forms ..." (Sperber, Wilson 1987, 704). Daßsich die Relevance Theory damit möglicherweise wieder Probleme auflädt, die sie eigentlich durch die Abkehr vom Code-Modell vermeiden wollte, wird von Kritikern der Theorie hervorgehoben: "It is significant that Sperber and Wilson devote several pages at the beginning of their book to a rejection of a code theory of communication, only to compromise with the prevailing code- oriented linguistic paradigm later on" (Toolan 1992, 153). Solche Kritik ist teilweise berechtigt. Dennoch unterscheidet sich die Relevance Theory auch in dieser Hinsicht von anderen pragmatischen Modellen, da sie nicht von der üblichen Trennung zwischen Semantik und Pragmatik ausgeht, sondern annimmt, daßpragmatische Prinzipien bereits in der Gewinnung semantischer Repräsentationen eine wesentliche Rolle spielen.
Grice war davon ausgegangen, daßman relativ deutlich zwischen dem, was explizit gesagt und dem, was damit impliziert wird, unterscheiden könne. Dabei würde der explizite Inhalt der Äußerung (die explicature) über herkömmliches Dekodieren gewonnen und die conversational implicature dann daraus über Inferenz: "Grice and almost all those following him have assumed the explicature is the result of accessing the conventional sense of the linguistic form used plus assignment of referents to referring expressions and, occasionally, disambiguation of those words or phrases which have more than one sense" (Carston 1988, 155). Die Relevance Theory geht dagegen davon aus, daßder explizite Inhalt einer Äußerung weitaus umfangreicher ist und nur zu einem kleinen Teil über Dekodieren gewonnen wird. Carston (1988, 155) verdeutlicht dies an folgendem Beispiel:
A: How is Jane feeling after her first year at Uni?
B: She didn’t get enough units and can’t continue.
B's Antwort könnte folgende Interpretation auslösen
‘Jane didn’t get enough university course units to qualify for admission to second year study, and, as a result, Jane cannot continue with university study. Jane is not feeling at all happy about this’
Die Schlußfolgerung 'Jane isn't happy' ist in jedem Falle nicht explizit gegeben und wäre daher eine implicature. Nach Grice müßten auch die anderen nicht linguistisch gegebenen Teile implicatures sein; die Relevance Theory argumentiert dagegen, daßdiese enrichments ebenso wie reference assignment und disambiguation Teile eines Prozesses sind, die erst zu den propositional forms führen, auf deren Grundlage Hypothesen über die informative Intention angestellt werden können: "... in a range of examples this logical form is frequently not fully propositional, and a hearer then has the task of completing it to recover the fully propositional form that the speaker intended to convey" (Carston 1988, 167).
Auch hier könnte das Relevanzprinzip eine entscheidende Rolle spielen, wie Sperber und Wilson anhand sogenannter garden-path sentences (z.B. 'I saw that gasoline can explode. And a brand new can it was too') zeigen. Die Prozesse von enrichment, reference assignment und disambiguation laufen hier so ab, daßdie gewonnenen propositional forms bei geringerem Verarbeitungsaufwand viele contextual effects ermöglichen, also die entsprechende Interpretation mit dem Prinzip der Relevanz in Einklang ist. Die Vervollständigung der explicature im Falle der zweideutigen Äußerung 'I saw that gasoline can explode' würde wahrscheinlich zunächst 'I saw that it was possible for gasoline to explode' ergeben. Erst im Kontext mit der folgenden Äußerung würde die aufwendigere Interpretation 'I saw that can of gasoline explode' als explicature angenommen werden.
Hier zeigt sich, daßzur Herstellung von propositional forms Dekodieren nur einen geringen Beitrag leistet. Logical forms die durch Dekodieren gewonnen werden
... fall short of determining a single proposition. These logical forms, we claim, never surface to consciousness. Instead, they act as assumption schemas which can be inferentially completed into fully propositional forms, each determining a single proposition and serving as a tentative identification of the intended explicit content of the utterance. This explicit content alone has contextual effects and is therefore worthy of conscious attention. (Sperber, Wilson 1987, 704-705).
Sperber und Wilson sehen Dekodieren daher nicht als Teil des eigentlichen Verstehensprozesses, sondern "... rather as providing the main input to the comprehension process" (Sperber, Wilson 1987, 705).
Der beschriebene Ansatz könnte erklären, warum Kommunikationspartner mit relativ festen linguistischen Inhalten operieren, auch wenn - wie Derrida beschreibt - Zeichen auf immer andere Zeichen und Bedeutungen verweisen können. Dieser Verweisungsprozeßwürde aber nur so weit verfolgt, wie der Verarbeitungsaufwand durch entsprechend relevante Informationen belohnt wird, welche wiederum Interpretationen ermöglichen, die mit dem Relevanzprinzip in Einklang sind.
Es kann also konstatiert werden, daßin der linguistischen Theoriebildung seit langem Möglichkeiten verfolgt werden, die Probleme und Schwachstellen der strukturalistischen Sprachwissenschaft durch neue Perspektivsetzungen zu überwinden. Das junge linguistische Teilgebiet der Pragmatik hat dabei einen gänzlich neuen Bereich der Bedeutungsforschung erschlossen und damit die Möglichkeit gegeben, den Prozeßder Bedeutungsbildung weitaus umfassender zu beschreiben. Sprache wird dabei stärker als vorher als Mittel der Kommunikation von Gedanken und informativen Intentionen betrachtet. Dadurch wird es möglich, die unbegrenzte Vieldeutigkeit sprachlicher Zeichen mit der dennoch erfolgreichen Kommunikation zu vereinbaren.
Die Relevance Theory hat die Anregungen früherer und in vieler Hinsicht problematischer Modelle aufgenommen und durch die Verbindung mit Erkenntnissen der modernen Kognitionswissenschaft zu einem komplexen und dennoch einfachen Kommunikationsmodell weiterentwickelt. Das dabei formulierte Prinzip der Relevanz kann Probleme erhellen, die von der poststrukturalistischen Kritik am Strukturalismus und an der Sprechakttheorie aufgeworfen worden sind, aber von den Poststrukturalisten aufgrund der Grenzen ihres eigenen Ansatzes nicht gelöst werden konnten.
Die Relevance Theory könnte beschreiben, wie es Hörern bzw. Lesern von Sprache und Texten gelingt, auch vieldeutige Äußerungen sinnvoll zu interpretieren. Die implizite Garantie der Relevanz sprachlicher Stimuli lenkt dabei den Hörer (Leser) in der Konstruktion eines Kontextes, der eine Interpretation ermöglicht, welche die vermutete Relevanz der entsprechenden Äußerung bestätigt.
4. Implikationen der Relevance Theory für die Literaturwissenschaft
'It seems very pretty,' she said when she had finished it, 'but it's rather hard to understand! Somehow it seems to fill my head with ideas - only I don't exactly know what they are! (Lewis Carrol, Through the Looking Glass)
Im vorangegangenen Kapitel wurde die Relevance Theory als Möglichkeit zur Erklärung von Kommunikation im allgemeinsten Sinne diskutiert. Dabei sollte der spezifische Ansatz dieser Theorie, Kommunikation als einen von bestimmten kognitiven Prinzipien geleiteten Prozeßzu fassen, verdeutlicht werden. Interessant wäre es nun zu sehen, ob es möglich ist, mit der Relevance Theory auch Aussagen zu konkreteren und für die Literaturwissenschaft relevanten sprachlichen Phänomenen zu machen. Daran könnte man dann einerseits untersuchen, ob die Relevance Theory der Literaturwissenschaft tatsächlich neue Impulse verleihen kann; andererseits könnte man sehen, ob das Modell seinem eigenen Erklärungsanspruch gerecht wird.
Zuerst soll dabei nach Ansätzen für die Stilistik gefragt werden. In diesem an der Schnittstelle zwischen Linguistik und Literatur angesiedelten Forschungsfeld sind von einem Modell sprachlicher Kommunikation zuerst neue Impulse zu erwarten. Fast jedes linguistische Modell, fast jede Richtung der Literaturwissenschaft hat zu den vermeintlich besonders 'literarischen' Phänomenen wie Metapher, Metonymie, Ironie usw. Stellung bezogen. Dabei existieren zahlreiche ebenso alte wie letztlich ungelöste Probleme, wie etwa die Frage, ob und wie sich literarische Sprache vom 'normalen' Sprachgebrauch unterscheidet und ob es spezielle Mechanismen gibt, mit denen wir stilistische Elemente, wie etwa Metaphern, verstehen.
Einige zentrale Fragestellungen der Stilistik sind auch für allgemeinere Probleme der Literaturwissenschaft interessant. So ist die Frage nach den Mechanismen des Verstehens literarischer Sprache auch für den Prozeßder Bedeutungsbildung in der Rezeption narrativer Texte grundlegend. Da die Relevance Theory den Anspruch erhebt, über die rein linguistische Analyse hinauszugehen, sollte sie auch hier Aussagen machen können.
Literatur aus dem Blickwinkel der Pragmatik zu betrachten, bedeutet nach wie vor, sich auf relatives Neuland zu begeben, wie auch David Trotter feststellt: "During the 1970s, a surge of interest in literary language led critics to Chomsky and Saussure, but not to Grice. To this day, literary theory has barely acknowledged the existence of pragmatics" (Trotter 1987, 11). In diesem und im nächsten Kapitel soll sich zeigen, ob es sich dabei tatsächlich um ein Versäumnis handelt.
4.1. Relevance Stylistics
Die Frage nach der Spezifik der literarischen Sprache ist so alt wie die Beschäftigung mit Literatur selbst. Die Tradition, literarische Sprache (vor allem die der Lyrik) als vom 'normalen' Sprachgebrauch abweichend zu betrachten, geht dabei bis auf Aristoteles zurück. So definiert er etwa das Stilmittel der Metapher wie folgt: "Eine Metapher ist die Übertragung eines Wortes, das somit in uneigentlicher Bedeutung verwendet wird" (Aristoteles 1982, S. 67). Abrams in seinem Standardwerk A Glossary of literary terms beschreibt figurative language als "... departure from what speakers of a particular language apprehend to be the standard meaning of words, or the standard order of words, in order to achieve some special meaning or effect" (Abrams 1988, 64). Wenngleich inzwischen allgemein anerkannt ist, daßsolche 'literarischen' Phänomene in allen Formen des Diskurses anzutreffen sind, so geht doch die Auffassung, die verschiedenen Stilmittel als 'abweichende' Äußerungen zu betrachten, nach wie vor davon aus, daßes möglich ist, 'normalen' und figurativen Sprachgebrauch voneinander zu unterscheiden, und daßdie speziellen Effekte 'poetischer' Sprache aus eben diesem Gegensatz resultieren. Wäre dies der Fall, läge es nahe, einen Mechanismus anzunehmen, der es ermöglicht, figurative Sprache zu erkennen und korrekt zu interpretieren.
Die gegenteilige Auffassung, die davon ausgeht, daßes keinen prinzipiellen Unterschied zwischen 'literarischer' und 'normaler' Sprache gibt, geht bis auf die Romantiker zurück. So schreibt Wordsworth im Vorwort zu den Lyrical Ballads:
Is there then, it will be asked, no essential difference between language of prose and metrical composition? I answer that there neither is nor can be any essential difference. [...] They both speak by and to the same organs; the bodies in which both of them are clothed may be said to be of the same substance, their affections are kindred and almost identical, not necessarily differing even in degree ... (Wordsworth 1992, 749)
Daßder Konflikt zwischen beiden Auffassungen bisher schwer zu lösen war, liegt in erster Linie daran, daßdie zahlreichen Beiträge zur Stilistik hauptsächlich deskriptiver Natur sind. So ist die Frage, wie die beschriebenen Stilmittel eigentlich funktionieren und weshalb sie verwendet werden, bisher nur unzureichend beantwortet worden.
In den verschiedenen Versuchen, beispielsweise die Funktion von Metaphern zu erklären, herrscht die Auffassung der 'Normabweichung' vor. Viele dieser Versuche implizieren die Annahme "... that there is a clear-cut distinction between the literal interpretation and the metaphorical interpretation of an utterance, and the metaphorical interpretation presupposes and is derived from the literal interpretation" (Song 1998, 87). Grice und Searle sind zwei typische Vertreter dieser Auffassung. Setzt man Grices Konversationsmaximen voraus, so stellen metaphorische Äußerungen eine Verletzung des Co-operative Principle dar. So wäre etwa die Äußerung 'you are the cream in my coffee' ein klarer Verstoßgegen die Maxime 'don't say what you believe to be false'. Grice argumentiert nun, daßeben dieser offensichtliche Verstoßgegen das Co-operative Principle die metaphorische Interpretation auslöst: "In these examples, though some maxim is violated at the level of what is said, the hearer is entitled to assume that that maxim, or at least the overall Co-operative Principle, is observed at the level of what is implicated" (Grice 1991a, S. 311). Der Hörer mußalso nach einer anderen conversational implicature suchen. Damit liefert Grice zwar einen Ansatz zur Erklärung, wie figurative Interpretation möglicherweise ausgelöst wird, sagt aber wenig darüber, wie diese Interpretation letztendlich aussieht.
Ähnlich wie Grice argumentiert Searle; er sieht figurative Äußerungen als Abweichungen von einer Norm, als defective: "Suppose he hears the utterance, 'Sam is a pig'. He knows that that cannot be literally true, that the utterance, if he tries to take it literally, is radically defective" (Searle 1991b, 532). Um das Phänomen der figurativen Interpretation zu erklären, unterscheidet Searle zwischen word-meaning und utterance-meaning und geht davon aus, daßes spezielle Mechanismen gibt, die von der einen Bedeutung auf die andere schließen lassen: "Our task in constructing a theory of metaphor is to try to state the principles which relate literal sentence meaning to metaphorical utterance meaning" (Searle 1991b, 520). Dabei kommt Searle zu acht verschiedenen 'Prinzipien'; von denen hier eines als Beispiel angeführt werden soll (vgl. Searle 1991b, 533):
Principle 1
Things which are P are by definition R. Usually, if the metaphor works, R will be one of the salient defining characteristics of P. Thus, for example,
(1) Sam is a giant
will be taken to mean
(2) Sam is big,
because Giants are by definition big. That is what is special about them.
Diese Erklärungsmuster sind in verschiedener Hinsicht unbefriedigend und problematisch. Searles Prinzipien dienen eher der Klassifikation von Metaphern; deren Funktionieren scheint dadurch aber nicht ausreichend erklärt. Die Vorstellung, bei einer figurativen Äußerung handele es sich lediglich um eine von der wörtlichen Bedeutung abweichende, aber dennoch 'obviously related proposition' (Grice), wird vielen Metaphern nicht gerecht. Demnach müßte man Metaphern paraphrasieren können, was aber gerade bei 'poetischen' Metaphern nicht ohne Verlust möglich ist: "... it is usually not possible to find adequate paraphrases for such metaphors in terms of a list of what might be taken as implicatures. The metaphor seems to lose some of its expressive power in the paraphrase" (Pilkington 1996, 159). Bereits die Auffassung, literal meaning als Ausgangspunkt der Interpretation anzunehmen ist alles andere als unproblematisch, wie Raymond Gibbs unterstreicht: "... the search for a theory of what is literal about language and thought has not provided any clear answers to the question of what it means to say that we speak and think literally" (Gibbs 1994, 78).
Besonders modernere psychologische Studien widerlegen die Vorstellung von figurativer Sprache als Normabweichung. Als Grundproblem der theoretischen Ansätze zeigt sich dabei, daßMetaphern, Ironie etc. als in erster Linie sprachliche Phänomene beschrieben werden: "... metaphor is typically viewed as characteristic of language alone, a matter of words rather than thought or action" (Lakoff, Johnson 1980, 3). Lakoff und Johnson dagegen vertraten in Metaphors we live by (1980) zuerst die auch von experimenteller Psychologie gestützte Auffassung, daßfiguratives Denken nicht abgeleitet, sondern selbst integraler Bestandteil unserer Vorstellungswelt ist: "If we are right in suggesting that our conceptual system is largely metaphorical, then the way we think, what we experience, and what we do every day is very much a matter of metaphor" (Lakoff, Johnson 1980, 3). Konsequenz daraus wäre zum einen, daßes sinnvoll sein könnte, Stilistik mehr aus einer kognitiven Perspektive zu betrachten und zum anderen, daßes wenig Sinn macht, für die Interpretationen poetischer Sprache spezielle Prozesse oder Prinzipien anzunehmen, denn, so unterstreicht Raymond Gibbs: "Metaphor, metonymy, irony, and other tropes are not linguistic distortions of literal mental thought but constitute basic schemes by which people conceptualise their experience and the external world" (Gibbs 1994, S. 1). Es ist daher nicht plausibel anzunehmen, daßvor einer figurativen Vorstellung zunächst eine wörtliche Bedeutung aufgerufen wird, auf deren Grundlage man erst zur figurativen Interpretation gelangt.
Die Relevance Theory könnte hier ein alternatives Erklärungsmodell anbieten, da sie weder von einem Konzept 'wörtlicher' Bedeutung als Basis ausgeht, noch spezielle Prinzipien für die Interpretation 'poetischer' Sprache annimmt, sondern auch die Funktionsweise von Metaphern, Ironie etc. mit dem Relevanzprinzip zu erklären versucht. Dem liegt die tiefere Vorstellung zugrunde, daßÄußerungen häufig mehr als nur einzelne implicatures kommunizieren und dabei einen komplexen Gedanken des Sprechers (Autors) repräsentieren können:
... utterances in which all the speaker wants to do is to inform the hearer of a simple fact are untypical of communication in general. Quite often, the speaker wants to communicate not a single atomic proposition, but a complex thought made up of many atomic thoughts, some of which are salient while others are not consciously spelled out in her mind. The speaker does not expect the hearer to entertain exactly the same complex thought. Rather, she intends him to entertain the proposition(s) most salient in her mind and to construct around it (or them) a complex thought which merely bears some similarity to her own. (Sperber; Wilson 1991a, 541-2)
Dies wiederum entspräche durchaus der Vorstellung einer poetics of mind, wie sie von Lakoff, Johnson oder Gibbs vertreten wird.
Entscheidend für stilistische Erklärung auf Basis der Relevance Theory ist die Unterscheidung zwischen descriptive und interpretive language use, sowie das Konzept der weak implicatures. Sperber und Wilson gehen davon aus, daßpoetic effects, wie sie von 'literarischen' Stilmitteln hervorgerufen werden, nicht auf einzelnen implicatures sondern einer Vielzahl kleiner sogenannter weak implicatures beruhen. Sie verdeutlichen dies u.a. an folgendem Beispiel für das Stilmittel der epizeuxis (vgl. Sperber, Wilson 1995, 217-24):
(1) My childhood days are gone.
(2) My childhood days are gone, gone.
Beide Äußerungen haben die gleichen Wahrheitsbedingungen und müßten die gleichen contextual implications kommunizieren. Jedoch verursacht die Wiederholung von 'gone' einen erhöhten Verarbeitungsaufwand. Gemäßdem Relevanzprinzip müßte dieser Aufwand durch zusätzliche contextual effects gerechtfertigt sein. Dazu würde der Hörer den Kontext erweitern: die Äußerung "... may encourage the hearer to compare the speaker's childhood and her present condition, to assume that she herself is reminiscing and making a similar comparison, and to imagine the feelings this may evoke in her. What the repetition produces, then, is many very weak implicatures" (Sperber, Wilson 1987, 707). Poetic effects bewirken also keine gänzlich neuen Annahmen, sondern verstärken eine große Zahl vorhandener, schwächerer Annahmen. Pilkington vermutet darüber hinaus, daßdas Aufrufen unterschiedlicher Kontexte und encyclopaedic entries mit affektiven Prozessen gekoppelt sein könnte: "This kind of pragmatic processing might similarly be linked to a special kind of physiological response, and to a special kind of qualitative response or experience - an aesthetic response or experience" (Pilkington 1996, 159; vgl. auch Durant, Fabb 1990, 155).
Um komplexere Stilmittel wie Metaphern oder Ironie zu erklären, nutzen Sperber und Wilson die Tatsache, daßjedes Objekt unter bestimmten Umständen dazu benutzt werden kann, über eine Ähnlichkeitsbeziehung ein anderes Objekt zu repräsentieren; etwa ein Seil eine Schlange aufgrund seiner Form. Auch Äußerungen können aufgrund ihres propositional content repräsentieren; beispielsweise einen Zustand, indem sie für diesen Zustand wahr sind. Die Repräsentation wäre in diesem Falle deskriptiv. Sperber und Wilson postulieren, daßjede Äußerung darüber hinaus einen Gedanken des Sprechers repräsentieren kann, und zwar nicht notwendigerweise über das Kriterium der Wahrheit, sondern interpretativ über Ähnlichkeit (resemblance), nämlich "... when they [the utterance and the thought; RS] share analytic and contextual implications" (Sperber, Wilson 1987, 707). Sperber und Wilson nehmen an, daßes sich bei jeder Äußerung um die Interpretation eines Gedankens des Sprechers handelt: "... every utterance is used interpretively to represent a thought of the speakers. One of the assumptions a speaker intends to make manifest is that she is entertaining a thought with some particular attitude. It is on this ground that the hearer may be led to entertain a similar thought with a similar attitude" (Sperber, Wilson 1987, 707; vgl. auch Sperber, Wilson 1995, 224-31).
Geht man davon aus, daßÄußerungen interpretative Repräsentationen von Gedanken sind, wird deutlich, daßes sich bei 'wörtlicher Bedeutung' lediglich um einen (in der Praxis wohl eher seltenen) Grenzfall auf einer kontinuierlichen Skala handelt, auf der die Übereinstimmung der Repräsentation mit dem entsprechenden Gedanken (also die Anzahl gemeinsamer contextual implications) unterschiedlich stark ist und auf der rhetorische Figuren wie Hyperbel oder Metonymie Zwischenstufen zur Metapher darstellen. So würde die hyperbolische Äußerung (1) wahrscheinlich die Aussage (2) kommunizieren (vgl. Sperber, Wilson 1991a, 547):
(1) Bill is the nicest Person there is.
(2) Bill is a very nice Person.
Die Tatsache, daßder Sprecher jedoch nicht (2), sondern (1) geäußert hat, müßte aufgrund des Relevanzprinzips (ausreichend effects für entsprechenden Verarbeitungsaufwand) vermuten lassen, daßÄußerung (2) den Gedanken des Sprechers nicht ausreichend repräsentiert. Der Hörer ist also aufgefordert, nach weiteren contextual implications zu suchen. Neben der strong implicature, die von beiden Äußerungen kommuniziert wird, erzielt der Hörer dabei weitere, weak implicatures; etwa daßder Sprecher Bill sympathischer findet als die meisten seiner übrigen Bekannten, daßsich Bill in bestimmten Situationen besonders sympathisch verhalten hat etc. Der Gedanke, den der Hörer um die empfangene Äußerung konstruiert, entspricht dabei nicht exakt dem des Sprechers, ähnelt ihm aber in den relevantesten Punkten.
Der Unterschied zwischen dead und creative metaphors12 ließe sich somit über das Relevanzprinzip erklären. Ein Äußerung wie 'Bill is a lion' ist aufgrund des häufigen und standardisierten Gebrauchs leicht zu verarbeiten, bietet aber auch dementsprechend wenig contextual effects. Dagegen ermöglicht die folgende von Sperber und Wilson zitierte Metapher aus Shakespeares Tempest
The fringed curtain of thine eyes advance
And say what thou see'st yond.
dem Hörer, gleichzeitig sehr unterschiedliche Kontexte (Augenlider, Vorhänge, Theater etc.) zu erschließen und dabei selbst neue, wiederum metaphorische Interpretationen zu erreichen:
In the richest and most successful cases, the hearer can go beyond just exploring the immediate context and the background knowledge directly invoked, accessing a wider area of knowledge, entertaining ad hoc assumptions which may themselves be metaphorical, and getting more and more very weak implicatures, with suggestions for still further processing. The result is a quite complex picture, for which the hearer has to take a large share of the responsibility, but the discovery of which has been triggered by the speaker. (Sperber; Wilson 1991a, 548)
Die Relevance Theory versucht zu zeigen, daßes sich bei den 'poetischen' Wirkungen, die durch Sprache ausgelöst werden können, um kognitive Effekte handelt, die Resultat des natürlichen Sprachverarbeitungsprozesses sind. Ebenso wird deutlich, daßsich die kommunizierten Inhalte 'poetischen' Sprachgebrauchs nicht in einer Paraphrase erschöpfen, sondern daßes sich dabei um komplexe Effekte handelt, die mit affektiven Reaktionen gekoppelt sind. Hier jedoch stößt die Relevance Theory an Grenzen. So suggestiv und überzeugend ihre Argumentation auch sein mag, so kann auch das wissenschaftliche Begriffswerk nicht darüber hinwegtäuschen, daßdie gebotenen Erklärungen eher vage bleiben. So wird in Zukunft vieles davon abhängen, wie es gelingt, den Zusammenhang zwischen linguistischen Formen, mentalen Repräsentationen und affektiven Prozessen genauer zu erfassen.
4.2. Der Leseprozeß
Wenngleich die Stilistik ein auch und gerade für die Literatur wesentliches Forschungsgebiet darstellt, so bleiben doch stilistische Analysen in der Regel auf isolierte sprachliche Phänomene beschränkt. Um jedoch auch für die Analyse narrativer oder dramatischer Texte relevant zu sein, sollte ein Kommunikationsmodell darüber hinaus in der Lage sein, den Prozeßder Bedeutungskonstituierung auch komplexer literarischer Texte über einzelne stilistische Aspekte hinaus zu beschreiben. Dabei mußberücksichtigt werden, daßes sich bei der Rezeption von Literatur um eine durchaus spezielle Form von Kommunikation handelt. Wie im Zusammenhang mit der Stilistik festgestellt wurde, besteht ein wesentlicher Impetus der Relevance Theory in dem Versuch, unterschiedlichen Sprachgebrauch mit den gleichen Prinzipien zu erklären, also anzunehmen, daßkeine speziellen Mechanismen 'literarischen' Sprachgebrauchs existieren, sondern daßes sich lediglich um bestimmte 'Effekte' der Kommunikation handelt. Fraglich ist nun, wie dies im Prozeßder Bedeutungskonstituierung literarischer Texte funktioniert.
Eine Besonderheit schriftlicher Texte im allgemeinen und von Literatur im besonderen wurde bereits in den vergangenen Kapiteln deutlich: anders als in der mündlichen Kommunikation können sich schriftliche Texte nicht auf einen unmittelbaren Kontext berufen, da weder Autor noch Adressat präsent sind und zwischen Verfassen und Rezeption eine zeitliche Lücke entsteht. Speziell für die Literatur kommt hinzu, daßliterarische Texte in der Regel nicht an einen realen Empfänger gerichtet sind, was die Annahme ihrer Intentionalität problematisch macht. Die Relevance Theory hat hier teilweise eine neue Perspektive eröffnet, indem sie davon ausgeht, daßder Interpretationskontext zu großen Teilen durch die Annahmen des Lesers determiniert wird.
Eine weitere Besonderheit besteht in der Tatsache, daßliterarische Texte in der Regel zu großen Teilen fiktional sind13. Das Problem des logischen Status fiktionaler Äußerungen ist von John Searle in einem Artikel behandelt worden, der interessante Fragen auch für die Bedeutungskonstituierung literarischer Texte aufwirft. Fiktionale Äußerungen haben die Besonderheit, daßdie Umstände 'normaler' Kommunikation nicht auf sie zutreffen. Die Personen oder Gegenstände beispielsweise, auf welche die referentiellen Ausdrücke fiktionaler Äußerungen verweisen, existieren nicht; ebenso die Gedanken fiktionaler Personen, die durch deren (fiktionale) Äußerungen repräsentiert werden müßten. Searle, der fiktionalen Diskurs vom Standpunkt der Sprechakttheorie aus betrachtet, formuliert das Problem wie folgt: "... how can it be both the case that words and other elements in a fictional story have their ordinary meanings and yet the rules that attach to those words and other elements and determine their meanings are not complied with" (Searle 1975, 319)? Die Lösung, die Searle vorschlägt ist nicht unproblematisch, was vor allem am Modell der Sprechakttheorie selbst liegt, dessen Schwachstellen teilweise schon weiter oben erörtert wurden. Searle postuliert, daßdie illokutionären Sprechakte in fiktionalen Diskursen den gleichen semantischen Inhalt kommunizieren, aber nur 'vorgegeben' sind: "... an author of fiction pretends to perform illocutionary acts which he is not in fact performing" (Searle 1975, 325). Searle geht nun davon aus, daßes spezielle Konventionen gibt, die fiktionalen Diskurs möglich machen:
... the pretended illocutions which constitute a work of fiction are made possible by the existence of a set of conventions which suspend the normal operation of the rules relating illocutionary acts and the world. In this sense, to use Wittgenstein's jargon, telling stories really is a separate language game; to be played it requires a separate set of conventions, though these conventions are not meaning rules; and the language game is not on all fours with illocutionary language games, but is parasitic on them. (Searle 1975, 326)
Ob damit die Natur der 'vorgegebenen' Sprechakte ausreichend erklärt ist, bleibt fraglich und wird auch von Kritikern bestritten (vgl. Reboul 1992, 32-33). Das Grundproblem besteht allerdings darin, daßSearle fiktionalen Sprachgebrauch als vom 'normalen' Sprachgebrauch abgeleitet betrachten muß, um den Bestand der Sprechaktregeln zu sichern. Das Erklärungsmuster des 'parasitären' Sprachgebrauchs hatte sich aber bereits in der Stilistik als problematisch erwiesen.
Da die Relevance Theory nicht mit Regeln oder Konventionen operiert, auf die Äußerungen sich beziehen müssen, kann man in diesem Rahmen problemlos davon ausgehen, daßes nicht spezieller Mechanismen bedarf, um fiktionale Äußerungen zu verstehen. Dies ist plausibler als anzunehmen, daßzum Verständnis von Fiktion oder Literatur die (wenn auch unbewußte) Beherrschung spezieller Regeln notwendig ist. Anne Reboul argumentiert im Sinne der Relevance Theory, daßdie Verarbeitung fiktionaler Äußerungen weniger eine Frage der sprachlichen Form als ein Problem der kognitiven Repräsentation ist: "En effet, la spécificité des énoncés de fiction ne réside pas dans leur forme linguistique mais dans leur caractère fictif lui-même, à savoir dans l'inexistence des objets dont ils parlent. Ainsi les énoncés de fiction constituent une sous-catégorie de énoncés du discours ordinaire plutôt qu'une catégorie à part" (Reboul 1992, 37). Reboul geht davon aus, daßsich fiktive Äußerungen auf konzeptuelle mentale Repräsentationen beziehen, die sich nur insofern von anderen komplexen Konzepten unterscheiden, daßsie die Information ihrer Fiktionalität mit enthalten und somit den Verstehensprozeßentsprechend beeinflussen. Reboul illustriert dies anhand der Person des Hamlet: "Dans cette optique, Hamlet se définirait comme homme, jeune, prince, danois, qui a é tudi é à Wittenberg, dont le p è re a é t é assassin é, etc., et comme personnage d'une pi è ce de th éâ tre du m ê me nom" (Reboul 1992, 39).
Die Frage, die sich im Rahmen der Relevance Theory stellt, ist also weniger die nach speziellen Mechanismen zur Interpretation fiktionaler Äußerungen als die Frage, wie Fiktion relevant sein kann, ohne 'wahr' zu sein (vgl. Reboul 1992, 38). Dies ist ein Problem, das sich auch auf Literatur allgemein übertragen läßt: was gibt den Äußerungen in einem literarischen Werk Relevanz? Searle versucht, die Frage nach dem Sinn der Beschäftigung mit Fiktion und Literatur dadurch zu beantworten, daßer annimmt, daßfiktionale Texte eine zusätzliche Botschaft ('message') übermitteln können, die nicht direkt im Text enthalten ist: "... serious (i.e., nonfictional) speech acts can be conveyed by fictional texts, even though the conveyed speech act is not represented in the text. Almost any important work of fiction conveys a 'message' or 'messages' which are conveyed by the text but are not in the text" (Searle 1975, 332). Eine solche Argumentation, wenngleich sie tradierten Vorstellungen über Literatur entspricht, wirft Fragen und Probleme auf. Sicherlich entsteht unser Interesse an Literatur vor allem aus der Tatsache, daßliterarische Texte in der Lage sind, über ihren sprachlichen Inhalt hinaus Bedeutung zu vermitteln. Searles Vorstellung, daßdiese Bedeutung in einer (oder mehreren) message(s) besteht, ist dabei jedoch unbefriedigend. Nicht nur, daßüber die Art der message und die Mechanismen ihrer Übertragung nichts ausgesagt wird, schon der Begriff message selbst ist problematisch, da er eine Eindeutigkeit impliziert, die der Vorstellung der prinzipiellen Offenheit literarischer Interpretation entgegensteht. Von Searle scheint dies aber durchaus beabsichtigt14. Unterschiedliche Interpretationen derselben literarischen Werke machen aber deutlich, daßInterpretation von sehr verschiedenen (nicht nur textuellen) Faktoren abhängig ist. Schon aufgrund der Tatsache, daßes keine letzte Entscheidungsinstanz über eine Autorintention geben kann, macht es wenig Sinn, in der Literaturwissenschaft mit einem starren Begriff wie intended message zu operieren. Der Umkehrschluß, daßliterarische Texte in keinerlei Zusammenhang mit der Gedankenwelt des Autors stehen, scheint jedoch ebensowenig sinnvoll. Um dies zu berücksichtigen müßte man allerdings in der Lage sein, den Anteil des Autors an der Bedeutungskonstituierung des Textes flexibler zu fassen als durch die Annahme, daßder Autor durch einen indirekten Sprechakt eine message zu übertragen versucht.
Anne Reboul (1992) versucht das Problem zu lösen indem sie das in der Relevance Theory entwickelte Konzept des loose talk auch auf fiktionalen Diskurs und Literatur überträgt. Sperber und Wilson hatten argumentiert, daßrhetorische Figuren wie etwa Metaphern als Form des loose talk funktionieren15. Das heißt, daßes sich dabei nicht um wahrheitsgetreue Abbilder eines Gedankens des Sprechers, sondern lediglich um interpretative Repräsentationen handelt, die mit dem Gedanken des Sprechers in einigen relevanten contextual implications übereinstimmen und ihre Wirkung vornehmlich über weak implicatures, also Verstärkung bereits vorhandener Annahmen entfalten. Reboul versucht also zu zeigen, daßauch nicht-figurative Äußerungen in (fiktiven) literarischen Texten ähnlich wie Metaphern gelesen werden:
Dans les énoncés de fictions, comme dans les métaphores qui interviennent dans le discours ordinaire, l'intention du locuteur n'était pas de communiquer la proposition littéralement exprimée par l'énoncé mais plutôt de transmettre certaines implications contextuelles de cette énoncé. L'analogie se situe donc entre la pensée que le locuteur entendait exprimer et certaines implications contextuelles de l'énoncé qu'il a utilisé à cette fin. Dans cette optique, le principe de pertinence est utilisé pour déterminer lesquelles, parmi toutes les implications contextuelles d'un énoncé, sont celles que le locuteur entendait transmettre. (Reboul 1992, 45)
Inwiefern unterscheidet sich diese Argumentation nun von Searles intended message, zumal ja auch Reboul mit dem Begriff einer Autorintention (intention du locuteur) operiert? Zunächst einmal geht es für die Relevance Theory anders als für Searle nicht um das Erkennen einer zusätzlichen, durch einen indirekten Sprechakt kommunizierten message. Die Bedeutungskonstruktionen, die fiktionale und literarische Texte ermöglichen, sind keine 'zusätzlichen' Bedeutungen, sondern implicatures dieser Texte selbst. Problematischer ist die Frage der Autorintention. Hier ist jedoch daran zu erinnern, daßdie Intention des Autors im Sinne der Relevance Theory keine empirisch faßbare Aussage, sondern eine Hilfskonstruktion des Lesers ist, der in einem Text nicht nach relevanten Informationen sucht, sondern die Relevanz der sprachlichen Äußerung(en) als gegeben voraussetzt. Es ist vielmehr seine eigene Aufgabe, einen Kontext zu konstruieren, der die Annahme der Relevanz bestätigt. Das Ergebnis ist ein eigener Gedanke des Lesers, von dem dieser annimmt, daßer dem Gedanken des Autors ähnelt. Der Anteil des Autors besteht nun darin, daßer durch den Text Anhaltspunkte für die Konstruktion eines Kontextes liefert.
In literarischen Texten, in denen Kontexte durch den fehlenden Situationsbezug weniger eindeutig sind, steigt die Verantwortung des Lesers in der Konstruktion möglicher Kontexte. Anders formuliert fällt es dem Leser literarischer Texte schwerer, aus dem unmittelbar zugänglichen Kontext ausreichend contextual implications zu gewinnen, wodurch er angehalten ist, den Kontext zu erweitern und - ähnlich wie in der Interpretation von Metaphern -den erhöhten Verarbeitungsaufwand durch eine Vielzahl von weak implicatures zu rechtfertigen. Der Anteil des Lesers an der gewonnenen Bedeutung ist dabei wesentlich größer als in direkter Kommunikation. Ihr Auslöser bleibt jedoch der Autor. Es könnte somit durchaus Sinn machen, die Aussage Sperber und Wilsons über erfolgreiche Metaphern auch auf literarische Texte zu übertragen: "The result [of the interpretive process; RS] is a quite complex picture, for which the hearer has to take a large share of the responsibility, but the discovery of which has been triggered by the speaker" (Sperber, Wilson 1991a, 548).
Reboul sieht die Bedeutungskonstituierung eines komplexen literarischen Textes als globalen metaphorischen Prozeß, in dem die einzelnen Äußerungen die Konstruktion von Kontexten auslösen, die wiederum für die folgenden Äußerungen Erwartungshaltungen erzeugen und den Prozeßweiterer Kontextkonstruktionen beeinflussen:
Chaque énoncé apparaissant dans un texte de fiction contribue à la construction d'un contexte qui est déjà fruit d'une interprétation métaphorique. Chaque énoncé est donc interprété dans l'optique d'une interprétation métaphorique globale par rapport à laquelle l'interlocuteur projette des anticipations sur la suite des énoncés. Dans cette mesure, l'interprétation des textes de fiction constituerait la meilleure approximation d'un système de formation et de confirmation/infirmation d'hypothèses d'une grande subtilité. (Reboul 1992, S. 47)
Wenn nun, wie Sperber, Wilson und Reboul argumentieren, der Leseprozeßin erster Linie in der Konstruktion von Kontexten besteht, für die der Leser einen Großteil der Verantwortung übernimmt, stellt sich die Frage, ob die gewonnenen implicatures nicht ebenfalls reine Konstruktionen des Lesers sind, wie dies Stanley Fish behauptet hatte.16 Dabei würde man jedoch übersehen, daßdie Konstruktion von Kontexten nicht unwesentlich durch den Text gesteuert und begrenzt wird. Die Vorstellung, daßdie einzelnen Äußerungen eines literarischen Textes nicht isoliert verarbeitet werden, sondern in ihrem Ablauf Erwartungen erzeugen, welche die Interpretation folgender, oder auch (rückwirkend) vergangener Äußerungen beeinflussen ist nicht neu. Auch die Relevance Theory weist darauf hin, daßauf mögliche Kontexte nicht willkürlich zugegriffen wird, sondern daßdie Suche nach contextual implications immer in einem unmittelbar zugänglichen Kontext beginnt, der aus den jeweils zuletzt verarbeiteten Aussagen besteht. So betonen Durant und Fabb, daßverschiedene Leser zunächst von einem ähnlichen Kontext ausgehen müssen, dessen Konstruktion durch den Text ausgelöst wird: "For readers of a text, the preceding text creates a common context for all readers in the same way: what has happened in the text before the reader got to the sentence will give rise to overlapping assumptions for each reader" (Durant, Fabb 1990, S. 165). Auch Richards versucht zu zeigen, daßsich die Annahmen, die ein Text kommuniziert, erst in ihrem Zusammenspiel zu einem komplexen Bild vereinen: "The contextual implications of an utterance can, therefore, be seen as something that emerges out of a context that has itself been created by earlier acts of comprehension. In this way interpretation becomes a matter of working out the consequences of adding a new proposition to a stockpile of assumptions that have already been processed" (Richards 1985, S. 268).
Der Autor hat über die beschriebenen Mechanismen die Möglichkeit, die Richtung der Interpretation in gewisser Weise zu steuern. Seiji Uchida versucht dies für bestimmte Effekte literarischer Texte, etwa den Aufbau von Spannung (suspense) zu demonstrieren. So verwenden Autoren häufig definite Ausdrücke, ohne den Leser zuvor durch entsprechende Informationen in die Lage zu versetzen, durch die Konstruktion eines entsprechenden Kontextes eine Interpretation zu erzielen, die mit dem Prinzip der Relevanz in Einklang ist (also ausreichend contextual effects für angemessenen Verarbeitungsaufwand bietet). Uchida verdeutlicht die an der Eingangssequenz einer Kurzgeschichte von Hemingway (vgl. Uchida 1998, 164):
At the lake shore there was another rowboat drawn up. The two indians stood waiting.
Da der Leser außer diesem Stück Text noch keine weiteren Anhaltspunkte für die Konstruktion eines Kontextes hat, der für geringen Aufwand ausreichend contextual effects ermöglicht, mußer seine unbewußte Erwartung der Relevanz in der Hoffnung zurückstellen, daßdiese später erfüllt werden kann, wie auch Uchida argumentiert: "In a Relevance-based approach we can say the reader will assume that the author intends to create contextual effects which cannot be achieved with indefinite NP's and that the Principle of Relevance guarantees reference assignment at a later stage" (Uchida 1998, 164). Es erscheint durchaus gerechtfertigt, für solche 'Effekte' literarischer Texte zu behaupten, daßsie vom Autor 'intendiert' sind. Kriminalromane etwa beruhen ganz entscheidend auf solchen Effekten.
Generell könnte man somit feststellen, daßliterarische Texte durch ihren (als schriftliche Texte) fehlenden unmittelbaren Kontext einerseits und andererseits durch die Verwendung stilistischer Mittel und die mitunter komplizierte Informationsverteilung den Verarbeitungsaufwand, verglichen mit Alltagskommunikation, die zumeist auf Effektivität setzt, erheblich erhöhen. Um dennoch relevant zu sein, müssen sie diesen Aufwand durch eine Vielzahl von weak implicatures wettmachen. Dadurch, daßes sich in der Regel (etwa in einer Erzählung oder einem Roman) um Textmengen handelt, die 'normale' Kommunikationssequenzen bei weitem übersteigen, zwingen sie den Leser, die implizite Relevanzerwartung häufig zurückzustellen und mit sehr komplexen und stark erweiterten Kontexten zu operieren. Der Lohn sind ebenso komplexe und mitunter plötzliche Effekte, die man - wie Reboul dies versucht - als globale metaphorische Prozesse beschreiben könnte.
Der Relevance Theory gelingt es durch die Perspektivenverschiebung zu den kognitiven Prozessen, die in der Bedeutungsbildung literarischer Texte zum Tragen kommen, einige grundlegende Probleme der literarischen Linguistik und Interpretationstheorie durchaus überzeugend zu lösen. Dies gelingt vor allem dadurch, daßfür die Interpretation einzelner stilistischer Elemente wie auch komplexer literarischer Texte keine 'wörtliche' Bedeutung bzw. kein 'normaler' Sprachgebrauch vorausgesetzt werden muß, um dann die 'übertragene' oder 'literarische' Interpretation daraus abzuleiten. Ein weiterer überzeugender Gedanke besteht in der Vorstellung, daßsich die Bedeutungskonstituierung vor allem in der Konstruktion von Kontexten vollzieht, die zusammen mit den vom Text kommunizierten Annahmen contextual effects ermöglichen. Dadurch erreicht die Relevance Theory einen sehr dynamischen Bedeutungsbegriff, in dem der große Einflußdes Lesers nicht nur postuliert, sondern auch schlüssig erklärt werden kann. Auch die Frage, wie es möglich ist, daßliterarische Texte trotz des fehlenden Bezugs auf einen fest determinierten Kontext rezipierbar bleiben, erhält so eine mögliche Antwort.
Jedoch stößt die Relevance Theory - bedingt durch ihren kognitivistischen Ansatz - an Grenzen. So ist der Versuch, keine prinzipiellen Unterschiede zwischen der Bedeutungskonstituierung in literarischen Texten und alltagssprachlicher Kommunikation anzunehmen, zwar ein Vorteil für die Erklärungskraft des kognitiven Modells, jedoch bleibt fraglich, ob dieser Vorteil nicht auf Kosten der existierenden Unterschiede zwischen den Kommunikationsformen erreicht wird. Der Ansatz, unterschiedliche Dinge gleich zu erklären, birgt einen immanenten Widerspruch, der in der Relevance Theory nicht gänzlich gelöst wird. Das Problem liegt hier möglicherweise darin, daßsich die Relevance Theory auf den individuellen kognitionspsychologischen Prozeßder Interpretation konzentriert, andere Faktoren wie soziale Einflüsse etwa oder literaturspezifische Probleme - Besonderheiten einzelner Literaturgattungen beispielsweise - außer Acht läßt. Damit wird die allgemeinere Frage aufgeworfen, was ein linguistisch-psychologisch orientiertes Modell wie die Relevance Theory konkret für die Literaturwissenschaft leisten kann, etwa, wenn es um die Interpretation einzelner literarischer Texte geht.
5. Leistungen und Grenzen der Relevance Theory für die literarische Interpretation
'Let's hear it,' said Humpty Dumpty. 'I can explain all the poems that ever were invented - and a good many that haven't been invented just yet.' (Lewis Carrol, Through the Looking Glass)
Im letzten Kapitel wurde in erster Linie die Frage behandelt, wie bestimmte Effekte, die durch literarische Texte häufig bewirkt werden, erklärt werden können und ob sich literarische Sprache darin prinzipiell vom alltagssprachlichen Gebrauch unterscheidet. Es wurde gezeigt, daßdie Relevance Theory dabei ein kognitives Modell anbieten kann, das es im wesentlichen ermöglicht, 'normale' und literarische Kommunikation mit den gleichen Prinzipien zu erklären und gleichzeitig Besonderheiten literarischer Texte zu erfassen. Soweit handelt es sich allerdings um ein relativ abstraktes Modell, das die theoretischen Probleme literarischen Diskurses aufgreift; Beispiele aus konkreten literarischen Texten dienten dabei lediglich zur Illustration der Theorie. Fraglich ist nun, ob das Modell auch zur Interpretation literarischer Texte beitragen kann. Die Position der verschiedenen Relevance- Theoretiker zu dieser Frage ist nicht immer eindeutig - Fakt ist jedoch, daßsich verschiedene Literaturwissenschaftler und Linguisten auf Grundlage der Relevance Theory ausführlich auch mit konkreten literarischen Texten auseinandergesetzt haben (Clark 1996; MacMahon 1996; Pilkington 1992; Richards 1985; Trotter 1987). Darunter zeigt sich beispielsweise Clark davon überzeugt "... that a comprehensive account of how communicative acts are interpreted (in this case Relevance Theory) should generate accounts of how particular texts give rise to particular effects" (Clark 1996, 163). Ob die existierenden Studien tatsächlich diese Schlußfolgerung erlauben, soll im Folgenden untersucht werden, um festzustellen, welchen Status die Relevance Theory innerhalb der Literaturwissenschaft haben sollte und was damit wirklich erklärt werden kann.
5.1. Relevance Theory als Interpretationsmethode?
Betrachtet man die einzelnen Studien, die auf Grundlage der Relevance Theory konkrete literarische Texte untersuchen, so mußfestgestellt werden, daßder hohe Anspruch, der ihnen meist voraus geht, nicht immer eingelöst wird. Während die Relevance Theory an sich ein durchaus elegantes Modell zur Beschreibung alltagssprachlicher wie literarischer Kommunikation darstellt, so enttäuschen die Versuche, die Theorie auf einzelne Texte anzuwenden durch ihre relative Trivialität. Deutlichstes Beispiel ist Clarks (1996) Vorschlag einer 'Methode' zur Interpretation literarischer Texte auf Grundlage der Relevance Theory, welche er anhand einer Kurzgeschichte (Little Things von Raymond Carver) zu demonstrieren versucht. Zum besseren Verständnis von Clarks Argumentation soll die Kurzgeschichte hier wiedergegeben werden.
Little Things
Early that day the weather turned and the snow was melting into dirty water. Streaks of it ran down from the little shoulder-high window that faced the backyard. Cars slushed by on the street outside, where it was getting dark. But it was getting dark on the inside too.
He was in the bedroom pushing clothes into a suitcase when she came to the door.
I'm glad you're leaving! I'm glad you're leaving! she said. Do you hear?
He kept on putting his things into the suitcase.
Son of a bitch! I'm so glad you're leaving! She began to cry. You can't even look me in the face, can you?
Then she noticed the baby's picture on the bed and picked it up.
He looked at her and she wiped her eyes and stared at him before turning and going back to the living room.
Bring it back, he said.
Just get your things and get out, she said.
He did not answer. He fastened the suitcase, put on his coat, looked around the bedroom before turning off the light. Then he went out to the living room.
She stood in the doorway of the little kitchen, holding the baby.
I want the baby, he said.
Are you crazy?
No, but I want the baby. I'll get someone to come by for his things.
You're not touching this baby, she said.
The baby had begun to cry and she uncovered the blanket from around his head.
Oh, oh, she said, looking at he baby.
He moved toward her.
For God's sake! Se took a step back into the kitchen.
I want the baby.
Get out of here.
She turned and tried to hold the baby over in a corner behind the stove.
But he came up. He reached across the stove and tightened his hands on the baby.
Let go of him, he said.
Get away, get away! she cried.
The baby was red-faced and screaming. In the scuffle they knocked down a
flowerpot that hung behind the stove.
He crowded her into the wall then, trying to break her grip. He held on to the baby and pushed with all his weight.
Let go of him, he said.
Don't, she said. You're hurting the baby, she said.
I'm not hurting the baby, he said.
The kitchen window gave no light. In the near-dark he worked on her fisted fingers with one hand and with the other hand he gripped the screaming baby up under an arm near the shoulder.
She felt her fingers being forced open. She felt the baby going from her. 45
No! she screamed just as her hands came lose.
She would have it, this baby. She grabbed for the baby's other arm. She caught the baby around the wrist and leaned back.
But he would not let go. He felt the baby slipping out of his hands and he pulled back very hard.
In this manner, the issue was decided.
Den möglichen Weg zur Interpretation stellt sich Clark folgendermaßen vor: "The methodology involves three stages. The first stage involves writing down any inferential conclusions which might be reached after reading the text. [...] The second stage involves spelling out the evidence for particular conclusions and spelling out intuitions about them in some detail. [...] The third stage involves using relevance- theoretic assumptions to decide upon the status of the proposed conclusions" (Clark 1996, 169). Clark listet beispielsweise für das Ende der Kurzgeschichte folgende inferential conclusions auf:
(a) The struggle for the baby had a result.
(b) We do not know what the result of the struggle was.
(c) The man ended up with the baby.
(d) The woman ended up with the baby.
(e) The baby died.
Für all diese inferential conclusions finden sich nach Clark Belege im Text, etwa die Bemerkung She would have it, this baby (Zeile 47) für conclusion (d), oder She felt the baby going from her (Zeile 45) für conclusion (c). Clark glaubt nun, auf Grundlage der Relevance Theory einschätzen zu können, wie stark die jeweiligen Belege sind:
The evidence for (a) is very strong and based on the final sentence of the story, which states explicitly that 'the issue was decided'. The evidence for (b) is the fact that the story ends when it does, that is, that there is no explicit statement such as 'the baby was dead'. The evidence for (c) and (d) is much weaker, given that they contradict each other and Carver has been careful to provide evidence for each of them and given what we know about the fragility of babies and what is likely to happen if two adults try to pull a baby in half. In other words, the evidence for (e) is much stronger. [...] this story provides evidence for a range of implicatures. However, the evidence for some of these implicatures is stronger than for others; in particular, the death of the baby is strongly implicated. (Clark 1996, 176)
Diese Argumentation wirkt als Interpretation nicht nur in gewisser Weise naiv, sie steht auch im Gegensatz zu den in den vergangenen Kapiteln getroffenen Feststellungen über die Bedeutungsbildung literarischer Texte. Diese zeichnen sich ja gerade dadurch aus, daßes unmöglich ist, eindeutige Belege für bestimmte Bedeutungen zu finden. Das Modell der Relevance Theory verliert bei Clark nicht nur seine Komplexität, indem es darauf reduziert wird, über bestimmte Bedeutungshypothesen zu 'entscheiden', das Vorgehen steht auch im Widerspruch zu grundlegenden Annahmen der Relevance Theory selbst. So scheint Clark zu übersehen, daßes sich bei den Bedeutungskonstruktionen mit denen der Leser im Modell operiert, lediglich um Annahmen handelt, von denen eine gewisse Ähnlichkeit mit möglichen Intentionen des Textes angenommen wird. Die Relevance Theory bietet jedoch keine Möglichkeit, in konkreten Fällen darüber zu entscheiden, welche Bedeutungen wahrscheinlicher sind. Gerade dies scheint Clark aber anzunehmen, der darüber hinaus sogar glaubt, in seinen Ergebnissen die Autorintention repräsentiert zu sehen: "The final stage in this methodology involves deciding for each proposed conclusion whether it was intended by the author or not" (Clark 1996, 172). Gerade dies ist aber unmöglich und wird in der Relevance Theory so auch nicht behauptet. Generell ist fraglich, und hierin besteht das eigentliche Problem, ob die Ergebnisse, zu denen Clark kommt, die Relevance Theory überhaupt voraussetzen oder ob die gleiche Argumentation nicht auch ohne Begriffe wie implicatures, encyclopaedic entry etc. genauso möglich wäre. Die von Clark favorisierte Interpretation ist kein Ergebnis einer 'Anwendung' der Relevance Theory, ebenso wenig wie die dafür vorgebrachten Argumente durch Erkenntnisse der Relevance Theory relevanter werden.
Auch das Konzept der weak implicatures kann von Clark nicht wirklich für die Interpretation konkreter Texte fruchtbar gemacht werden. So argumentiert er, daßder Leser der Kurzgeschichte Little Things zunächst alle Bedeutungsvarianten, für die im Text Belege zu finden sind, durchspielen mußbevor er zur endgültigen Schlußfolgerung gelangt und daßdurch diesen zusätzlichen Aufwand neben der implicated conclusion zusätzliche Effekte erzielt werden. Dies mag zwar stimmen, jedoch ist fraglich, worin diese dann konkret bestehen und wodurch, also durch welche speziellen sprachlichen Anordnungen im Text, diese bewirkt werden.
Die Probleme, auf die Clark bei seinem Versuch, die Relevance Theory auf die Interpretation eines konkreten Textes anzuwenden stößt, zeigen, daßnicht immer Klarheit darüber herrscht, was mit einem linguistischen Modell eigentlich erklärt werden soll bzw. kann. Dies verdeutlicht auch die Studie von Richards (1985), die Annahmen der Relevance Theory nutzt, um Aspekte von Intertextualität anhand des Romanwerks von Henry James zu erklären. Insbesondere versucht sie zu zeigen, wie die Interpretation der Eingangssequenz von The Awkward Age durch die Kenntnis weiterer Texte des Autors beeinflußt wird. Dabei soll unter anderem die Bedeutung folgender Aussage geklärt werden (vgl. Richards 1985, 264-271):
Save when it happened to rain Vanderbank always walked home, but he usually took a hansom when the rain was moderate and adopted the preference of the philosopher when it was heavy
Da es sich dabei um den ersten Satz des Romans handelt, steht dem Leser kein passender Kontext zur Verfügung, um das Bild preference of the philosopher zu interpretieren. Richards argumentiert, daßder Leser zunächst mit einer Bedeutungshypothese arbeiten müsse, bevor der weitere Text Anhaltspunkte für die Bildung eines adäquateren Kontextes schafft. Richards Vorgehen ähnelt dabei Clarks 'Methode'. Allerdings versucht Richards, den möglichen implicatures Passagen aus anderen Romanen gegenüber zu stellen, die ebenfalls die Fortbewegung (vor allem in Kutschen) zum Thema haben. Sie kommt dann zu dem Ergebnis, daßmit dem Bild preference of the philosopher die Fahrt in einem four-wheeler gemeint ist, einer altmodischen Kutsche, die aufgrund der langsamen Geschwindigkeit zu dieser Zeit nur noch wenig frequentiert wurde, aber Schutz vor Regen, eine gemütliche Fahrt und Gelegenheit zu ausführlichem Nachdenken bot.
Richards Argumentation ist über weite Strecken durchaus interessant und überzeugend, jedoch ist nicht immer klar, was sie eigentlich zu erklären versucht und welche Rolle dabei die Relevance Theory spielt. Geht es darum zu erklären, wie Intertextualität allgemein im Prozeßder Interpretation funktionieren könnte, so ist der Rückgriff auf die Relevance Theory durchaus gewinnbringend. Der Text würde dann zur Illustration der Argumentation dienen. Soll aber die Bedeutung des konkreten Textes geklärt werden, ist die Relevanz der Relevance Theory fraglich. Wie im Falle von Clark käme die Interpretation in diesem Falle auch ohne das Regelwerk der Relevance Theory aus.
Worauf es ankommt - und was in den genannten Arbeiten nicht immer deutlich wird - ist der Unterschied zwischen der Interpretation eines Textes und einem Modell literarischer Kommunikation: die Interpretation versucht zu sagen, was ein Text bedeutet, das Modell will erklären, wie ein Text bedeutet. Wissen über das wie führt dabei in der Regel nicht automatisch zu Erkenntnissen über das was eines Textes. Culler hat auf die Gefahr hingewiesen, linguistische Theorien unreflektiert auf die Interpretation literarischer Texte anzuwenden: "... the prestige of linguistics may lead the critic to believe that simply applying linguistic labels to aspects of the text is necessarily a worth-while activity, but of course when used metaphorically or in isolation such terms enjoy no privileged status and are not necessarily more revealing than other concepts which the critic might import or create" (Culler 1975, 109). Linguistische Theorien können dabei, wie Culler deutlich macht, als discovery procedures mißverstanden werden, die es ermöglichen sollen, durch korrekte 'Anwendung' der Theory zu bestimmten, nachprüfbaren Resultaten zu gelangen. Die Ergebnisse solcher Versuche sind, wie auch die Studie von Clark zeigt, meist enttäuschend, da sie, wie auch Culler bemerkt, oft zu keinen neuen Resultaten führen: "... the search for discovery procedures leads one to concentrate on ways of automatically identifying facts which one knows already rather than on ways of explaining them" (Culler 1975, 21).
Die Versuche, die Relevance Theory zur Interpretation konkreter literarischer Texte zu nutzen, verdeutlichen, daßauch die Relevance Theory keine discovery procedure ist und daßdie Einschränkung, die Culler für die Linguistik im allgemeinen formuliert, auch für die Relevance Theory im speziellen gilt: "Linguistics is not hermeneutic. It does not discover what a sequence means or produce a new interpretation of it but tries to determine the nature of the system underlying the event." (Culler 1975, 31). Die Relevance Theory sollte daher nicht dazu benutzt werden, Texte zu interpretieren, sondern den Prozeßder Bedeutungskonstituierung in literarischen Texten zu erklären. Daßsie darin große Stärken besitzt, haben die vergangenen Kapitel gezeigt.
5.2. Relevance Theory als Meta-Theorie literarischer Interpretation
Als kognitives Modell, darauf wurde bereits hingewiesen, scheint die Relevance Theory am besten dazu geeignet, den subjektiven psychologischen Prozeßdes Lesens zu beschreiben. Ein wesentlicher Teil unserer Auseinandersetzung mit Literatur geht jedoch über den privaten Akt der Rezeption und die dabei eher unbewußt ablaufende Bedeutungskonstituierung hinaus. Interpretation, feulletonistische und wissenschaftliche Debatte über Literatur gehören inzwischen ebenso zum literarischen Diskurs wie die Literatur selbst. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit und um Literatur spielt sich dabei immer mehr in einem institutionellen Rahmen ab, der scheinbar eigene Gesetze hervorbringt. Viele Probleme und Kontroversen der neueren Literaturwissenschaft ranken sich somit weniger um Literatur als vielmehr um Fragen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit ihr. Dabei wird die Frage danach, was und wie literarische Texte bedeuten, letztendlich zu einer Frage nach dem Status unterschiedlicher Interpretationen. Derridas Skepsis gegenüber einer Sinnpräsenz im Text und der damit verbundene Glaube an die Unmöglichkeit stabiler Bedeutungskonstituierung entspricht auf der Ebene des institutionellen Umgangs mit Literatur Stanley Fishs Anname von interpretive communities, deren Lesarten nicht auf textuellen Fakten beruhen, sondern diese erst im Akt der Interpretation hervorbringen.
Bezogen auf den individuellen Akt der Bedeutungskonstituierung gelingt es der Relevance Theory, verschiedene Unzulänglichkeiten des Poststrukturalismus zu überwinden und ein Modell zu entwickeln, das erklären kann, wie Leser aufgrund des relevanz-orientierten menschlichen Denkens trotz der prinzipiellen Offenheit literarischer Texte mit relativ stabilen Bedeutungskonstruktionen operieren. Es wäre nun interessant zu sehen, ob die Relevance Theory als Kommunikationsmodell auch für den literaturwissenschaftlichen Diskurs - bei dem es sich letztendlich auch um eine Form der Kommunikation handelt - relevant sein könnte. Interessant wäre dabei speziell die Frage nach der Rolle des Textes in der Interpretation: beeinflußt er die Interpretationen oder sind die textuellen 'Fakten', wie Fish argumentiert, selbst erst das Resultat der speziellen Perspektive einer interpretive community ?
Auf Fishs Theorie der interpretive communities war bereits im ersten Kapitel hingewiesen worden, als es um die Frage ging, wodurch die Konstruktion 'ästhetischer Objekte' im Akt der Rezeption determiniert wird. Für den individuellen, eher unbewußt ablaufenden Leseprozeßlassen sich einige wesentliche Argumente Fishs mit Hilfe der Relevance Theory widerlegen. Die Bedeutungskonstituierung vollzieht sich zwar zum großen Teil auf Seiten des Lesers - nämlich durch die Konstruktion von Kontexten - jedoch sind die implicatures, die durch den Leser als vom Text impliziert angenommen werden, nur im Zusammenspiel der Annahmen des Textes mit den konstruierten Kontexten möglich.
Nun bezieht sich Fishs Argumentation aber nicht auf Interpretation als unbewußten Prozeß, sondern als institutionalisierte Aktivität der Darlegung einer bestimmten 'Lesart'. Zentrale Frage ist dabei, warum literarische Texte mitunter sehr unterschiedlich interpretiert werden können, und nach welchen Kriterien unterschiedliche Interpretationen gegeneinander abgewogen werden. Fish behauptet, daßes dafür keine objektiven Kriterien geben könne, insbesondere "... the text cannot be the location of the core of agreement by means of which we reject interpretations" (Fish 1980, 342). Er weist darauf hin, daßInterpretation nicht als eine Art demonstration aufgefaßt werden kann, der die Vorstellung zugrunde liegt, "... that literature is a monolith and that there is a single set of operations by which its characteristics are discovered and evaluated" (Fish 1980, 368). Interpretation könne statt dessen nur als persuasion beschrieben werden: "In short, we try to persuade others to our beliefs because if they believe what we believe, they will, as a consequence of those beliefs, see what we see. [...] Indeed, this is the whole of critical activity, an attempt on the part of one party to alter the beliefs of another so that the evidence cited by the first will be seen as evidence by the second" (Fish 1980, 365). Fish meint nun, daßdie Fakten des Textes daher selbst erst Produkt der Interpretation wären. Er versucht, dies anhand verschiedener Interpretationen von William Blakes Gedicht The Tyger zu verdeutlichen, die zu mitunter exakt gegenteiligen Ergebnissen kommen. Fish schließt daher: "... text, context, and interpretation all emerge together, as a consequence of a gesture (the declaration of belief) that is irreducibly interpretive. It follows, then, when one interpretation wins out over another, it is not because the first has been shown to be in accordance with the facts but because it is from the perspective of its assumptions that the facts are now being specified" (Fish 1980, 340). Dabei ist jedoch nicht deutlich, wie der Text zusammen mit Kontext und Interpretation 'entstehen' (to emerge) soll. Wörtlich genommen, darauf hat Paul Kiparski hingewiesen, ist diese Aussage falsch, denn "... the text of 'The Tyger', or the various properties of it that the critics appeal to in defending their interpretations (say the wording of a certain line) certainly existed before those interpretations were put forward, in fact they existed from the moment Blake wrote the poem" (Kiparski 1987, 188). Sicherlich werden in der Literaturwissenschaft Debatten darüber geführt. welche Eigenschaften und 'Fakten' eines Textes besonders wichtig sind und sicherlich wählt jeder Interpret die für seine Interpretation passenden 'Fakten', so daßder Eindruck entstehen kann, es würden gänzlich verschiedene Texte diskutiert. To emerge in diesem Sinne quasi metaphorisch zu lesen, käme aber einer trivialen Feststellung gleich und würde Fishs These nicht wirklich stützen, wie auch Kiparski betont: "It is true enough that the significance, or even the very existence of some property of a text might be noticed only because of a proposed interpretation, and that different interpretations account for different sets of facts. But that doesn't mean that the interpretations mysteriously create those facts" (Kiparski 1987, 188).
Ein Grundproblem für Fish scheint darin zu bestehen, daßfür ihn die Annahme der Möglichkeit, Interpretationen mit textuellen 'Fakten' zu stützen, dem Glauben an objektive Interpretation gleichkommt, also der Vorstellung, daßdie korrekte Interpretation der Fakten zu einer einzigen wahren Interpretation führen müsse. Um auch unterschiedliche Interpretationen dennoch erklären zu können, macht Fish die textuellen Fakten zu Bestandteilen der Interpretation. Daßes jedoch möglich sein könnte, auch bestehende textuelle Fakten unterschiedlich zu interpretieren, scheint Fish nicht in Betracht zu ziehen. Denkt man Interpretation dagegen ebenfalls - wie andere sprachliche Mitteilungen - als einen Akt inferentieller Kommunikation, bei dem Annahmen des Textes mit Annahmen des Interpreten interagieren, könnte erklärt werden, wie Interpretation trotz textueller 'Fakten' prinzipiell offen ist. Dabei könnten dann auch Ideen Fishs - etwa, daßes sich bei Interpretationen um eine Art persuasion handelt - relevant sein.
Die Relevance Theory hatte versucht zu zeigen, daßsich Bedeutungskonstituierung vor allem durch die Konstruktion von Kontexten vollzieht. Betrachtet man verschiedene Interpretationen literarischer Texte, so wird deutlich, daßdiese ebenfalls mit - allerdings bewußter - Konstruktion von mitunter stark erweiterten Kontexten arbeiten. Sperber und Wilson betonen, daßdas konzeptuelle Wissen und damit die möglichen Kontexte, die ein Individuum zu konstruieren in der Lage ist, stark variieren: "... as a result of our cognitive history, some topics in our memory are richer in information and, either temporarily or permanently, more accessible than others, so that information relating to them is likely to produce greater effect for less effort, i.e. be more relevant as defined" (Sperber, Wilson 1991a, 544). Ein Kritiker als Interpret stellt in diesem Sinne einen Sonderfall dar, da er Kontexte nicht allein auf Grundlage seiner cognitive history konstruiert, sondern bewußt spezielles Wissen zu einer bestimmten Thematik heranzieht und für seine Bedürfnisse ordnet. Indem er dieses Wissen in entsprechender Form seinem Publikum präsentiert, versetzt er dieses in die Lage, auch vergleichsweise weak implicatures mit dem Relevanzprinzip in Einklang zu bringen, also umfangreiche contextual effects für geringen Verarbeitungsaufwand zu erzielen. Im Modell der Relevance Theory ist es Ziel von Kommunikation, über die Beeinflussung der 'kognitiven Umgebung' (cognitive environment) die Gedanken (beliefs) von Adressaten zu beeinflussen. Der Adressat sollte dabei in die Lage versetzt werden einen Gedanken zu konstruieren, der dem des Autors ähnelt. Die kognitive Umgebung im Falle einer literarischen Interpretation bestünde dabei aus den textuellen 'Fakten' und den möglichen Kontexten. Der Interpret verändert diese Umgebung insofern, als er bestimmte 'Fakten' isoliert und ordnet und spezielle erweiterte Kontexte zur Verfügung stellt. Das angestrebte Ziel einer Interpretation könnte man, ganz im Sinne Fishs, als persuasion bezeichnen, soll doch das Publikum dazu gebracht werden, nach der Lektüre des zu interpretierenden Textes Gedanken zu hegen, die denen des Interpreten möglichst stark ähneln. Anders als Fish glaubt, mußaber die Wahrnehmung der textuellen (und kontextuellen) 'Fakten' dieser Übereinstimmung vorausgehen, da der Interpret die Gedanken des Publikums nur über dessen kognitive Umgebung beeinflussen kann. Wenn also Fish schreibt: "... if they believe what we believe, they will, as a consequence of those beliefs, see what we see" (Fish 1980, 365), so könnte man sein Argument umkehren und sagen: 'if they see what we see, they will, as a consequence, believe what we believe".
Daßliteraturwissenschaftliche Interpretation ganz wesentlich auf der Konstruktion spezieller Kontexte beruht und daßdies auf sehr unterschiedliche Weise bewerkstelligt werden kann, soll im folgenden kurz an zwei verschiedenen Interpretationen von Shakespeares Hamlet demonstriert werden. Im dritten Kapitel seines Werkes What Happens in Hamlet versucht John Dover Wilson zu zeigen, daßder Geist das zentrale Element in Hamlet ist: "The Ghost is the linchpin of Hamlet; remove it and the play falls to pieces" (Wilson 1996, 52). Insbesondere argumentiert Wilson, daßShakespeare (vor allem im ersten Akt) über die verschiedenen Geisterauffassungen seiner Zeit kritisch reflektiert: "For Shakespeare spent much thought upon this unique creature of his imagination; he made it an epitome of the ghost-lore of his age" (Wilson 1996, 53). Man könnte diese Hypothese als eine Art global implicature bezeichnen, welche die 'eigentliche' Bedeutung des Textes bezeichnen soll. Weiter oben war festgestellt worden, daßdie speziellen Effekte von Literatur aber vor allem auf weak implicatures beruhen. Für Wilson geht es nun darum, möglichst viele dieser weak implicatures deutlich zu machen, welche die einzelnen Fakten des Textes mit der globalen Hypothese in Einklang bringen und so entsprechende contextual effects liefern, welche die Hypothese wahrscheinlich erscheinen lassen. Die passenden Kontexte konstruiert Wilson, indem er zeitgenössische Quellen des Spiritualismus referiert und daraus drei 'Schulen' isoliert. Mit diesem Kontext gelingt es ihm, in den Geisterszenen des ersten Aktes die einzelnen Zeugen der Geistererscheinung mit den drei 'Schulen' zu identifizieren. Bestimmte mögliche implicatures werden dabei verstärkt. Horatio etwa, der vom Text als Student der Universität Wittenberg ausgewiesen wird, kann aufgrund dieser Tatsache einerseits und seiner Äußerungen andererseits als Vertreter eines wissenschaftlichen Skeptizismus gegenüber Geistererscheinungen identifiziert werden. Dies ist eine durchaus eine von vielen mögliche Implicatures, die jedoch durch den von Wilson geschaffenen Kontext (er führt ein skeptisches Traktat aus elisabethanischer Zeit an, in dem eben diese Auffassung vertreten wird) zu einer strong implicature wird. Dies geschieht entsprechend für die anderen Beteiligten. Durch den speziellen Kontext, den Wilson geschaffen hat, treten textuelle Fakten und mögliche i mplicatures anderer Kontexte entsprechend zurück.
René Girard (1990) in seinem Aufsatz Hamlet's Dull Revenge sieht in Shakespeares Hamlet die Manifestation seiner eigenen Theorie des 'mimetischen Begehrens'17. Er liest daher den ersten Akt gänzlich anders als Wilson. Girard versucht zu zeigen, daßShakespeare in Hamlet die Mechanismen des Rachekreislaufes im Sinne Girards Theorie aufzeigt: "In Hamlet Shakespeare turns this necessity for a playwright to go on writing the same old revenge tragedies into an opportunity to debate almost openly for the first time the questions I have tried to define" (Girard 1990, 168). Girard vertritt darauf die Hypothese, daßHamlet diesen Kreislauf durchschaut und daher nicht von der Rechtmäßigkeit der geforderten Rache überzeugt ist (Vgl. Girard 1990, 168-170). Bei dieser sehr speziellen Lesart handelt es sich mit Sicherheit nicht um strong implicatures, also Schlußfolgerungen die der Leser ohne großen Aufwand aus den Annahmen des Textes im Zusammenhang mit unmittelbar zugänglichen Kontexten ziehen könnte. Girard verbindet daher geschickt Elemente seiner eigenen Theorie mit Fakten des Textes und ermöglicht es so dem Leser, mit diesem Kontext andere implicatures aus dem Text zu gewinnen und diese mit Girard als strong implicatures zu lesen. Dabei werden gänzlich andere Fakten des Textes bedeutend als bei Wilson. Dennoch kann Girard ebensowenig wie Wilson die Fakten erfinden, auf die er sich beruft. Dies zeigt sich vor allem in Fällen, in denen es möglich wäre, Girards Interpretation eben aufgrund erfundener Fakten anzuzweifeln. So will Girard beispielsweise deutlich machen, daßHamlet (und mit ihm der intelligente Leser/Zuschauer) von der Rechtmäßigkeit der Rache deswegen nicht überzeugt ist, weil er zwischen Claudius und dem alten Hamlet keine Unterschiede feststellt und beide für Mörder hält: "It cannot be without purpose that Shakespeare suggests the old Hamlet, the murdered king, was a murderer himself [...] he cannot generate, as a villain, the absolute passion and dedication demanded of Hamlet" (Girard 1990, S. 169). Eine solche Konstellation ist für Girard wichtig, da sie die Zirkularität des Rachekreislaufs belegen würde. Jedoch gibt es im Text keine eindeutige Aussage, die belegt, daßHamlets Vater selbst ein Mörder war. Die Tatsache, daßGirard dieses Argument anführt, bringt uns nicht automatisch dazu, dies als textuellen Fakt zu akzeptieren.
Wenngleich es also - schon wegen ihrer unterschiedlichen Akzentsetzungen - schwer ist, Interpretationen qualitativ gegeneinander abzuwägen, so bleibt es doch möglich, diese auch aufgrund textueller 'Fakten' zu diskutieren. Es wäre somit Kiparski Recht zu geben, der die Interpretation literarischer Texte im Prinzip nicht von der Interpretation wissenschaftlicher Daten unterscheidet: "Supporting a reading in this fashion is very much like marshalling evidence for a theory in some empirical field of inquiry. There too, 'facts' do not wear their interpretation on their sleeves, but neither are they created by the interpretation. However great a stake we, or the 'interpretive community', have in a certain interpretation, to be convincing it still has to make the facts fall into better place than the alternatives do" (Kiparski 1987, S. 189). Dennoch - dies zeigen die verschiedenen Interpretation gleicher literarischer Texte - können die Ergebnisse der einzelnen Interpreten äußerst unterschiedlich und dennoch überzeugend sein. Hier besteht ein deutlicher Unterschied zur Interpretation wissenschaftlicher Daten. Während es in anderen Wissenschaften darum geht, die naheliegendste Interpretation schlüssig zu belegen und die Komplexität der Daten zu und daßsich große Schriftsteller dadurch auszeichnen, daßsie diesen Mechanismus durchschauen und reduzieren, ist es Aufgabe des Interpreten eines literarischen Textes, gerade neue und nicht immer naheliegende Aspekte des Textes aufzuzeigen, aber dennoch ebenso schlüssig zu belegen. Im Vokabular der Relevance Theory hieße dies, weak implicatures, von denen man ausgeht, daßsie die Wirkung literarischer Texte ausmachen, konsequent als strong implicatures zu lesen. Ansonsten würde sich Interpretation mehr oder minder auf eine Paraphrasierung des Textes beschränken, welche seine Komplexität eher reduzieren würde, als diese zu verdeutlichen. Der Interpret mußdabei Kontexte so konstruieren, daßdiese zusammen mit den textuellen Fakten bestimmte weak implicatures zu strong implicatures werden lassen. Durch den Kontext Girards Theorie des mimetischen Begehrens etwa ermöglichen gerade die Informationen des Textes mehr contextual effects, die sich mit diesem Thema befassen. Der Erfolg einer Interpretation hängt wesentlich davon ab, wie der konstruierte Kontext mit (möglichst vielen) Annahmen des Textes interagiert, also contextual effects ermöglicht.
Betrachtet man die Interpretation literarischer Texte als eine Art komplexe Kommunikation, in welcher der Interpret einerseits mit seinem Publikum kommuniziert und damit andererseits (über konstruierte Kontexte) dessen Rezeption des Textes beeinflußt, kann die Relevance Theory durchaus einen interessanten Beitrag zu einer (Meta-)Theorie der Interpretation leisten. Insbesondere können Argumente gegen Fishs These geliefert werden, daßdie scheinbar objektiven 'Fakten' eines Textes Produkt der Interpretation seien. Dabei ist es jedoch nicht nötig, Fishs Konzept der interpretive community gänzlich aufzugeben. Diese wäre im Sinne der Relevance Theory als eine Gruppe zu definieren, die eine bestimmte kognitive Umgebung, also spezielle Annahmen über den Umgang mit Literatur oder über bestimmte Texte, teilt. Jedoch ist fraglich, ob die Relevance Theory als psychologisches Modell auch den sozialen Charakter einer solchen interpretive community ausreichend erfassen kann, den Fishs Begriff in jedem Falle impliziert.
Auf das sozialwissenschaftliche Defizit der Relevance Theory war bereits am Ende des vierten Kapitels hingewiesen worden. Auch im Falle der Problematik der interpretive communities zeigt sich, daßdie Relevance Theory hauptsächlich den linguistisch - psychologischen Aspekt erfaßt, also erklären kann, wie es möglich ist einen literarischen Text sehr unterschiedlich und dennoch überzeugend zu interpretieren. Für den Literaturwissenschaftler ist es aber darüber hinaus interessant zu untersuchen, warum etwa ein literarischer Text zu bestimmten Zeiten gerade in einer bestimmten Weise interpretiert wird. Um solche Frage zu beantworten ist es nötig, die Perspektive auf eine historisch - sozialwissenschaftliche Dimension zu öffnen. Bereits der späte Strukturalismus unter Chvatik und Vodicka hatte verstärkt versucht, die Literatur und ihre Rezeption als gesellschaftliches Phänomen zu erfassen - eine Tendenz, die sich in der jüngeren Theoriebildung wieder verstärkt durchsetzt. Peter V. Zimas Plädoyer für eine 'Kritische Literaturwissenschaft als Dialog' (vgl. Zima 1995, 364-407) weist sehr stark in diese Richtung18. Für die Zukunft der Relevance Theory in der Literaturwissenschaft wird viel davon abhängen, ob es gelingt, den Relevanzbegriff stärker sozialwissenschaftlich zu fundieren. Sperber und Wilson halten dies generell für möglich und wünschenswert. Der häufig geäußerten Kritik, die Relevance Theory operiere zu sehr unter 'Laborbedingungen' und mit künstlichen Beispielen, begegnen ihre Begründer mit der Hoffnung, daßes sich bei dem derzeitigen Stand der Theorie noch um eine erste Abstraktionsphase handelt und daßsich die Theorie gerade im Hinblick auf sozialwissenschaftliche Phänomene weiterentwickeln könne, da sie auch für die Sozialwissenschaften eine wichtige Basis lege. So betonen sie: "Communication is a paradigm case of social interaction, and any theory of communication is a theory of the most ubiquitous social phenomenon" (Sperber, Wilson 1997, 146).
Eine weitere Kritik bezieht sich auf die textuelle Seite der Interpretation. So macht das Modell der Relevance Theory zwar die Rolle des Textes für die Interpretation (theoretisch) deutlich, jedoch läßt das Modell selbst keine Aussagen über den Text, bzw. seinen Aufbau, seine Eigenschaften etc. zu. Betrachtet man die Relevance Theory somit isoliert als Modell literarischer Kommunikation, scheint die gesamte Verantwortung der Bedeutungsbildung doch wieder auf den Rezipienten zurückgeworfen. Wollte man die Relevance Theory zum dominanten Paradigma der literarischen Linguistik machen, hieße dies, die Verabsolutierung der Ausdrucksebene durch eine Dominanz der Inhaltsebene, bzw. der Rezeption zu ersetzen. Die Frage ist, ob dieser Mangel tatsächlich als Schwachstelle des Modells zu werten ist. Betrachtet man den Anspruch und die spezielle Perspektive der Relevance Theory, ist dies nicht unbedingt der Fall. Es handelt sich bei der Relevance Theory um ein kognitives Modell menschlicher Kommunikation, nicht aber um eine Poetik. Aus eben diesem Grunde ist es auch nicht möglich, mit der Relevance Theory konkrete Texte zu interpretieren; es können nur bereits bestehende Interpretationen bzw. der abstrakte psychologische Prozeßder Bedeutungskonstituierung im Leser beschrieben und erklärt werden. Die Relevance Theory sollte dem Literaturwissenschaftler also als Hilfsmittel dienen, um bestimmte erkenntnistheoretische Fragen und Probleme der Bedeutungsbildung literarischer Texte sowie der Interpretation von Literatur besser verstehen, beschreiben und erklären zu können. Dabei mußjedoch beachtet werden, daßes sich dabei nicht um ein komplettes Theoriegebäude handelt, mit dem sich alle Fragen der Literaturwissenschaft beantworten lassen.
6. Zusammenfassung
Die vergangenen Jahrzehnte sprachtheoretischer Debatten in der Literaturwissenschaft waren geprägt von der poststrukturalistischen Skepsis gegenüber einer eindeutigen Bedeutungskonstituierung in literarischen Texten und zwangen zu einer Infragestellung nahezu sämtlicher etablierter Begriffe. Im Zuge dieser Entwicklung wurde es für den literarischen Linguisten immer schwieriger, eine Position außerhalb zweier Extreme einzunehmen: entweder man akzeptierte die Theoreme des Poststrukturalismus wie dissemination, it é rabilit é, diff é rance etc. und damit die Unmöglichkeit jeder abgeschlossenen Bedeutungsbildung, oder man hielt an hergebrachten Begriffen wie 'Bedeutung', 'Aussage', 'Intention' etc. fest und lief damit Gefahr, beständig 'dekonstruiert' zu werden. Der Poststrukturalismus und speziell die Dekonstruktion führte dabei in gewisser Weise in eine Sackgasse. Nicht nur, weil er aufgrund seiner eigenen Anlage jede 'rationale' Kritik ausschließt, sondern weil durch die beständige Konzentration auf bestimmte dekonstruierte Theorien - Saussures 'Differenz'-Begriff etwa - die Suche nach alternativen Auswegen blockiert wurde. Insbesondere führte die immanente Kritik am Strukturalismus zu einer weiteren Verschärfung eines seiner Grundprobleme, nämlich der übermäßigen Konzentration auf die Rolle der Ausdrucksebene in der Bedeutungsbildung literarischer Texte. Der Widerspruch zwischen der radikalen Polysemie schriftlicher Zeichen und der dennoch vorhandenen Möglichkeit, mit schriftlichen Texten Bedeutungen zu übermitteln, kann jedoch nicht auf der Ausdrucksebene allein gelöst werden.
Daßsich die Bedeutungsbildung literarischer Texte nicht allein auf der formalen Ebene vollziehen kann, ist bereits innerhalb des Strukturalismus - bei Mukarovsky und Chvatik etwa - erkannt und thematisiert worden. Jedoch fanden diese Ansätze durch die starke Konzentration der westlichen Literaturwissenschaft und literarischen Linguistik gerade auf Saussure und Jakobson nur wenig Beachtung. Dabei sind einige der Ideen der tschechischen Strukturalisten durchaus modern und liefern wertvolle Anhaltspunkte für eine alternative Beschreibung und Erklärung literarischer Kommunikation. Der tschechische Strukturalismus bezog Fragen der Rezeption literarischer Texte in den Prozeßder Bedeutungsbildung ein, wobei sein Verdienst vor allem darin liegt, daßer - anders als einige spätere Rezeptionstheorien - den Ort der Bedeutungskonstituierung nicht einfach auf den Leser verschob, sondern versuchte, zwischen Autor, Text und Leser zu vermitteln. Die Annahme, daßsich die Bedeutung von Literatur weder im Text noch im Leser allein konstituiert, sondern daßder Rezipient aus den Vorgaben des Textes und seinem eigenen Potential ein 'ästhetisches Objekt' konstruiert, ist ein interessanter Gedanke, dessen theoretische Fundierung aber eine grundlegende Schwäche des Strukturalismus offenbart: er verfügt nicht über ein überzeugendes Kommunikationsmodell, das es ermöglicht, den Prozeßder Konstruktion 'ästhetischer Objekte' adäquat zu beschreiben. Das tief im westlichen Denken verwurzelte Code-Modell der Kommunikation zeigt sich dem komplexen Phänomen der menschlichen Kommunikation nicht gewachsen.
Die Relevance Theory stellt hier eine vielversprechende Alternative dar, da das Modell die Möglichkeit bietet, Kommunikation weitgehend ohne den problematischen Begriff des 'Codes' zu beschreiben. Dabei zeigt sich die Relevance Theory früheren Versuchen, den über die 'linguistische Bedeutung' hinausgehenden Bereich der Kommunikation zu erfassen, deutlich überlegen. Beispielsweise kann die Relevance Theory auf problematische Konstruktionen wie 'Regeln' oder 'Konventionen', wie sie etwa für die Sprechakttheorie notwendig sind, verzichten. Die Relevance Theory beschreibt Kommunikation als komplexen inferentiellen Prozeß, bei dem nicht einfach feste Bedeutungen vom Leser 'decodiert', sondern Annahmen des Textes mit dem vorhandenen kognitiven Potential zu inferentiellen Schlüssen zusammengebracht werden. Geleitet wird dieser Prozeßnicht wie in früheren Modellen durch eine Vielzahl problematischer 'Konversationsmaximen', sondern durch ein einfaches Prinzip der Relevanz. Dem liegt die Hypothese zugrunde, daßdie menschliche Wahrnehmung auf eine Maximierung der Relevanz von Information gerichtet ist. Kommunikation funktioniert dabei nicht über codierte Bedeutungen, sondern über sprachliche Stimuli, die es dem Leser ermöglichen, Gedanken zu konstruieren, die denen des Autors in wesentlichen Punkten ähneln. Dieser Prozeßvollzieht sich vor allem durch die Konstruktion adäquater Kontexte, welche die implizit vorausgesetzte Relevanz der sprachlichen Stimuli bestätigen. Anders als in code-orientierten Kommunikationsmodellen ist damit weder das Vorhandensein eines exakt definierten und abgeschlossenen Kontextes notwendig, noch ist das von der Dekonstruktion formulierte Phänomen der diff é rance ein Problem, da der Interpretationsprozeßnur so lange fortläuft, bis eine Interpretation erreicht ist, die mit dem Relevanzprinzip in Einklang ist.
Daßdie Relevance Theory auch für die speziellen Probleme der Bedeutungsbildung literarischer Texte Lösungen anbieten kann, zeigt sich in erster Linie auf dem Gebiet der Stilistik. Der Vorteil der Relevance Theory gegenüber anderen theoretischen Ansätzen zeigt sich in der Möglichkeit, literarische Kommunikation nicht als von einer 'Norm' abweichenden Sprachgebrauch zu betrachten, sondern mit den gleichen Mitteln, nämlich dem Prinzip der Relevanz, erklären zu können. Stilistische Figuren wie Metonymien oder Metaphern repräsentieren dabei einen komplexen Gedanken eines Sprechers/Autors. Ihre Wirkung beruht auf der Kommunikation einer Vielzahl kleiner implicatures, die dem Hörer/Leser die Konstruktion eines ebenso komplexen Gedankens ermöglichen, der mit dem des Sprechers/Autors in wesentlichen Punkten übereinstimmt. Die Verantwortung über diese Konstruktion liegt dabei zu großen Teilen auf der Seite des Hörers/Lesers. Der Unterschied zwischen 'wörtlicher' und 'figurativer' Bedeutung ist im Modell der Relevance Theory lediglich graduell, wobei 'wörtliche' Bedeutung nur den theoretischen Extrempunkt auf der Skala der Übereinstimmung des Gedankens und der verwendeten Aussage einnimmt.
Anne Rebouls Theorie des fiktionalen Diskurses zeigt, daßdie stilistischen Erklärungsmuster der Relevance Theory auch für die Analyse narrativer literarischer Texte interessant sein könnten. Deren Besonderheit könnte wie im Falle von Metaphern darin liegen, daßsie ihre Wirkung über eine Vielzahl kleinerer implicatures entfalten und auch durch ihren Aufbau die Konstruktion weitaus komplexerer Kontexte auslösen, als dies in gebrauchssprachlicher Rede der Fall ist. Der Interpretationsprozeßwird dabei aber von dem gleichen Prinzip, dem Prinzip der Relevanz, geleitet. Rebouls Analysen bilden hier nur einen ersten Ansatz, der weiter verfolgt werden sollte, um die Relevance Theory, die sich bisher eher mit isolierten Aussagen beschäftigte, auch für komplexere Texte fruchtbar zu machen. Dabei wäre es interessant zu sehen, ob auch über den rein psychologischen Prozeßder Interpretation hinaus Aussagen über gattungsspezifische Fragen u.ä. möglich sind - in der bestehenden Form neigt das Modell dazu, die Unterschiede zwischen einzelnen Kommunikationsformen zugunsten der allgemeinen Erklärungskraft zu vernachlässigen. Ein weiterer Nachteil ergibt sich aus der (bisher) fehlenden sozialwissenschaftlichen Fundierung der Relevance Theory. Die Produktion und Rezeption literarischer Texte ist nicht nur ein kognitives, sondern auch ein soziales Phänomen, das historisch nicht konstant ist und in dem auch rezeptionssoziologische, gattungs- oder gender-spezifische Fragen eine Rolle spielen.
Die mangelnde sozialwissenschaftliche Fundierung ist auch ein Grund für die Tatsache, daßdie Relevance Theory keine 'Methode' darstellt, die geeignet ist, literarische Texte zu interpretieren. Der eigentliche Grund dafür ist jedoch ein prinzipieller. Eine linguistische Theorie, die dazu dient, den Prozeßder Bedeutungsbildung zu beschreiben und zu erklären, ist keine discovery procedure, mit der sich Interpretationen konkreter Texte liefern lassen. Die Relevance Theory sollte also nicht als eine solche Methode verstanden werden. Statt dessen sollte das Modell dazu dienen, im theoretischen Diskurs der Literaturwissenschaft Aussagen zu grundlegenden Fragen der Interpretation literarischer Texte zu machen. Hier könnte sie einen Anstoßzu einer Neuorientierung auf die kognitiven Prozesse der Bedeutungsbildung geben und als Alternative zum Code-Modell der Kommunikation denjenigen Literaturtheorien zur Verfügung stehen, die versuchen, im Spannungsfeld zwischen Polysemie der literarischen Form und Monosemierung der Interpretation Erklärungen anzubieten. Im Gegensatz zum Irrationalismus etwa der Dekonstruktion zeigt die Relevance Theory, wie Kommunikation trotz potentieller Vieldeutigkeit möglich ist und daßes daher keinen Sinn macht, den Anspruch auf wissenschaftliche Erklärung aufzugeben. Es wäre daher für die Literaturwissenschaft wünschenswert, die starke Fixierung auf Saussure und den von ihm geprägten Strukturalismus zugunsten neuerer linguistischer Theorien wie der Relevance Theory aufzugeben und in eine kritische Diskussion einzutreten, von der beide Seiten, Linguistik und Literaturwissenschaft, profitieren.
7. Literaturverzeichnis
Abrams, Meyer Howard (1988): A glossary of literary terms. New York. Holt, Rinehart and Winston.
Albrecht, Jörn (2000): Europäischer Strukturalismus. Ein forschungsgeschichtlicher Überblick. Tübingen: Francke.
Aristoteles (1982): Poetik. Stuttgart: Reclam.
Attridge, Derek: (1987): " Closing Statement: linguistics and poetics in retrospect". In: Fabb, Nigel (Hrsg.): The linguistics of writing. Manchester: Manchester University Press, 15-32.
Austin, John L. (1994): "Locutionary, Illocutionary, Perlocutionary". In: Harnish, Robert M. (Hrsg.): Basic topics in the philosophy of language. London: Harvester Wheatsheaf, 30-39.
Barck, Karlheinz (1976): "Zur Kritik des Rezeptionsproblems in bürgerlichen Literaturauffassungen". In: Naumann, Manfred (Hrsg.): Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin: Aufbau Verlag, 101-178.
Carston, Robyn (1988): "Implicature, explicature and truth-theoretic semantics". In: Kempson, Ruth (Hrsg.): Mental Representations. The interface between language and reality. Cambridge: Cambridge University Press, 155-81.
Chvatik, Kvetoslav (1970): Strukturalismus und Avantgarde. Aufsätze zur Kunst und Literatur. München: Hanser.
Chvatik, Kvetoslav (1981): Tschechoslovakischer Strukturalismus. München: Fink.
Clark, Billy (1996): "Stylistic analysis and Relevance Theory". In: Language and Literature, 5. Jg., 163-78.
Culler, Jonathan (1975): Structuralist Poetics. London: Routledge.
Culler, Jonathan (1982): On Deconstruction. Ithaca: Cornell University Press.
Derrida, Jacques (1977): "Signature, Event, Context". In: Glyph, 1. Jg., 172-9.
Derrida, Jacques (1977a): "Limited Inc, a b c "... In: Glyph, 1. Jg., 162-251.
Derrida, Jacques (1981): Dissemination. London: Athlone Press.
Dolezel, Lubomir (1988): "Literary transduction. Prague School approach". In: Tobin, Yishai (Hrsg.): The Prague School and its legacy. Amsterdam: Benjamins, 165-176.
Downes, William (1994): "Pragmatics of music and emotion". In: Language Forum, 2. Jg., 1-27.
Durant, Alan; Fabb, Nigel (1990): Literary Studies in Action. London: Routledge. Fabb, Nigel (1997): Linguistics and Literature. Language in the verbal arts of the world. Oxford: Blackwell.
Fabb, Nigel; Durant, Alan (1987): "Introduction: the linguistics of writing retrospect and prospect after 25 years". In: Fabb, Nigel (Hrsg.): The linguistics of writing. Manchester: Manchester University Press, 1-13.
Fish, Stanley (1980): Is there a text in this class? The authority of interpretive communities. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Fish, Stanley (1989): Doing what comes naturally. Oxford: Clarendon.
Fodor, Jerry A. (1983): The modularity of mind. Cambridge/Mass.: MIT Press.
Gibbs, Raymond (1994): The poetics of mind. Figurative thought, language and understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
Girard, René (1990): "Hamlet's Dull Revenge". In: Bloom, Harold (Hrsg.): Hamlet. New York: Chelsea House, 166-185.
Girard, René (1992): Das Heilige und die Gewalt. Frankfurt a.M.: Fischer.
Green, Keith (1993): "Relevance Theory and the literary text: some problems and perspectives". In: Journal of Literary Semantics, 22. Jg., 207-17.
Green, Keith (1997): "Butterflies, wheels and the search for literary relevance". In: Language and Literature, 6. Jg., 133-138.
Grice, Paul (1991): "Utterer's Meaning, Sentence-Meaning and Word-Meaning". In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 65-76.
Grice, Paul (1991a): "Logic and Conversation". In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 305-315.
Grice, Paul (1994): "Meaning". In: Harnish, Robert M. (Hrsg.): Basic topics in the philosophy of language. London: Harvester Wheatsheaf), 21-29.
Ingarden, Roman (1968): Vom Erkennen des Literarischen Kunstwerkes. Tübingen: Niemeyer.
Iser, Wolfgang (1972): Der implizite Leser. München: Fink.
Iser, Wolfgang (1972a): "The reading process". In: New Literary History, 3. Jg., 279- 99.
Iser, Wolfgang (1994): Der Akt des Lesens. München: Fink.
Jakobson, Roman (1960): "Closing statement: linguistics and poetics". In: Sebeok, Thomas A. (Hrsg.): Style in Language. Cambridge, Mass.: MIT Press, 350- 377.
Kiparski, Paul (1987): "On theory and interpretation". In: Fabb, Nigel (Hrsg.): The linguistics of writing. Manchester: Manchester University Press, 185-98.
Köller, Wilhelm (1977): "Der sprachtheoretische Wert des semiotischen Zeichenmodells". In: Spinner, Kaspar H. (Hrsg.): Zeichen, Text, Sinn. Zur Semiotik des literarischen Verstehens. Göttingen: Vandenhoeck, 7-76.
Lakoff, George; Johnson, Mark (1980): Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.
Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge: Cambrige University Press.
MacMahon, Barbara (1996): "Indirectness, rhetoric and interpretive use: communicative strategies in Browning's 'My Last Duchess'". In: Language and Literature, 5. Jg., 209-23.
Manktelow K. I.; Over D. E. (1990): Inference and understanding: a philosophical and psychological perspective. London: Routledge.
Matejka, Ladislav (1988): "The Sociological Concerns of the Prague School". In: Tobin, Yishai (Hrsg.): The Prague School and its legacy. Amsterdam: Benjamins, 219-226.
Mukarovsky, Jan (1989): Kunst, Poetik, Semiotik. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Neale, Stephen (1992): "Paul Grice and the philosophy of language". In: Linguistics and Philosophy, 15. Jg., 509-559.
Pilkington, Adrian (1992): "Poetic effects". In: Lingua, 87. Jg., 29-51.
Pilkington, Adrian (1996): "Introduction: Relevance Theory and literary style". In: Language and Literature, 5. Jg., 157-62.
Reboul, Anne (1990): Rh é torique et stylistique de la fiction. Nancy: Presses Universitaires de Nancy.
Richards, Christine (1985): "Inferential pragmatics and the literary text". In: Journal of Pragmatics, 9. Jg., 261-85.
Schlenstedt, Dieter (1976): "Das Werk als Rezeptionsvorgabe und Probleme seiner Aneignung". In: Naumann, Manfred (Hrsg.): Gesellschaft, Literatur, Lesen. Berlin: Aufbau Verlag, 301-53.
Scholes, Robert (1982): Semiotics and interpretation. New Haven: Yale University Press.
Searle, John R. (1970): Speech Acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press.
Searle John R. (1975): "The logical status of fictional discourse". In: New Literary History, 6. Jg., 318-332.
Searle, John R. (1977): "Reiterating the differences: a reply to Derrida". In: Glyph, 1. Jg., 198-208.
Searle, John R. (1991): "What is a speach act?" In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 254-264.
Searle, John R. (1991a): "Indirect Speech Acts". In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 265-277.
Searle, John R. (1991b): "Metaphor". In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 519-539.
Song, Nam Sung (1998): "Metaphor and Metonymy". In: Carston, Robyn; Uchida, Seiji (Hrsg.): Relevance Theory: applications and implications. Amsterdam: Benjamins, 87-103.
Sperber, Dan: Wilson, Deirdre (1987): "Précis of Relevance: communication and cognition". In: Behavioral and Brain Sciences, 10. Jg., 697-754.
Sperber, Dan; Wilson Deirdre (1991): "Irony and the Use-Mention Distinction". In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 550-563.
Sperber, Dan; Wilson Deirdre (1991a): "Loose Talk". In: Davis, Steven (Hrsg.): Pragmatics. Oxford: Oxford University Press, 540-549.
Sperber, Dan; Wilson, Deirdre (1995): Relevance. Communication and Cognition. Oxford: Blackwell.
Sperber, Dan: Wilson, Deirdre (1997): "Remarks on Relevance and the social sciences". In: Multilingua, 16. Jg., 145-51.
Strawson, Peter F. (1994): "Intention and Convention in Speech Acts". In: Harnish, Robert M. (Hrsg.): Basic topics in the philosophy of language. London: Harvester Wheatsheaf, 40-56.
Todorov, Tzvetan (1984): Critique de la critique. Paris: Seuil.
Toolan, Michael (1992): "On Relevance Theory". In: Wolf, George (Hrsg.): New departures in linguistis.c New York: Garland, 146-162.
Trotter, David (1992): "Analysing literary prose. The relevance of Relevance Theory". In: Lingua, 87. Jg., 11-27.
Uchida, Seiji (1998): "Text and Relevance". In: Carston, Robyn; Uchida, Seiji (Hrsg.): Relevance Theory: applications and implications. Amsterdam: Benjamins, 161-78.
Vodicka, Felix (1976): Die Struktur der literarischen Entwicklung. München: Fink.
Wilson, John Dover (1996): What Happens in Hamlet? Cambridge: Cambridge University Press.
Wilson, Deirdre; Sperber, Dan (1988): "Representation and Relevance". In: Kempson, Ruth (Hrsg.): Mental Representation The interface between language and reality. Cambridge: Cambridge University Press, 133-53.
Wilson, Deirdre; Sperber, Dan (1992): "On verbal irony". In: Lingua, 87. Jg., 53-76.
Wordsworth, William (1992): Lyrical Ballads, and Other Poems, 1797-1800. Ithaca: Cornell University Press.
Yus, Ramos F. (1998): "A decade of Relevance Theory". In: Journal of Pragmatics, 30. Jg., 305-45.
Zapf, Hubert (1996): Kurze Geschichte der anglo-amerikanischen Literaturtheorie. München: Fink.
Zima, Peter V. (1994): Die Dekonstrukton. Tübingen: Franke.
Zima, Peter V. (1995): Literarische Ä sthetik. Tübingen: Franke.
Erklärung:
Ich versichere, daßich die schriftliche Hausarbeit selbständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, habe ich in jedem einzelnen Fall unter genauer Angabe der Quelle deutlich als Entlehnung kenntlich gemacht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(Unterschrift) (Ort, Datum)
[...]
1 Beim sog. Poststrukturalismus handelt es sich um ein äußerst heterogenes Phänomen. So bemerkt Culler: "... structuralists generally resemble post-structuralists more closely than many post- structuralists resemble one another" (Culler 1981, 30). Wenn also im folgenden vom Poststrukturalismus die Rede ist, so soll damit in erster Linie die vor allem von französischen Intellektuellen vorgetragene Kritik an strukturalistischen Grundpositionen bezeichnet werden.
2 Zu diesem Schlußkommt auch Robert Scholes in seiner Bewertung von Jakobsons Formulierung der 'poetischen Funktion' (vgl. S. 7 dieser Arbeit): "... it abandons much that has been gained by seeing literariness as a feature of communication rather than as a mode of purposeless activity called 'art'. [...] It turns back towards aesthetics just when it should continue on with semiotics ..." (Scholes 1982, 21).
3 Vgl. Jakobson (1960, 352): "The ADRESSER sends a message to the ADRESSEE. To be operative the message requires a CONTEXT referred to [...], seizable by the addressee, and either verbal or capable of being verbalized; a CODE fully, or at least partially, common to the addresser and addressee (or in other words to the encoder and decoder of the message); and, finally, a CONTACT, a physical channel and psychological connection between the addresser and the addressee, enabling both of them to enter and stay in communication".
4 Dies mag vorrangig damit zusammenhängen, daßzahlreiche Werke gerade des tschechischen Strukturalismus lange Zeit nicht in Übersetzungen vorlagen und im Westen dementsprechend spät rezipiert wurden.
5 Ähnlich wie Jakobsons 'poetische Funktion' beschreibt die 'ästhetische Funktion' bei Mukarovsky die Fixierung auf die Äußerung selbst.
6 Eine erschöpfende Darstellung der Relevance Theory kann hier nicht erfolgen (vgl. dafür Sperber, Wilson 1987 und Sperber, Wilson 1995). Im folgenden sollen nur die Fragen grob umrissen werden,
7 Grice nennt folgende Beispiele: 'those spots meant measles' (natural meaning = A means that p); 'the three rings of the bell meant 'the bus is full'' (non-natural meaning = A means by x that p). Vgl. Grice 1994, 25.
8 Dabei steht I für 'input', C für 'conclusion' und B für eine sog. 'bridging inference' (die das Bindeglied zwischen der Äußerung I und der Schlußfolgerung C bildet)
9 Man könnte die Annahmen (premises) die einer Äußerung bzw. der Interpretation einer Äußerung zugrunde liegen als ihren 'Kontext' bezeichnen. Vgl. Sperber/Wilson 1995, 15.
10 Wenn im folgenden der im Englischen von Sperber und Wilson verwendete Begriff relevance mit dt. 'Relevanz' wiedergegeben wird, dann im Sinne der Relevance Theory, die den technischen Begriff vom alltagssprachlichen 'relevant' abgrenzt: "It should be clear that we are not trying to define the ordinary and rather fuzzy English word relevance. We believe, though, that there is an important psychological property [...] which the ordinary notion of relevance roughly approximates, and which it is therefore appropriate to call by that name, using it in a technical sense" (Sperber, Wilson 1987, 702).
11 Cognitive environment ist prinzipiell vergleichbar etwa mit visual environment, die nicht nur die Dinge umfaßt, die tatsächlich wahrgenommen werden, sondern die von einem Individuum in einer bestimmten zeitlichen und räumlichen Situation wahrgenommen werden können.
12 Zum Begriff der dead metaphor vgl. Abrams 1988, 66.
13 Es mußdarauf hingewiesen werden, daß'fiktional' nicht synonym mit 'literarisch' gebraucht werden kann. Einerseits ist nicht jeder fiktionale Text automatisch Literatur, andererseits gibt es in literarischen Texten Elemente, die nicht fiktional sind; etwa philosophische Kommentare auktorialer Erzähler (vgl. auch Searle 1975). Die Frage nach dem Status fiktionaler Äußerungen ist jedoch trotzdem für die Frage der Bedeutungskonstituierung literarischer Texte interessant.
14 So wählt Searle ausgerechnet das Beispiel didaktischer Kindergeschichten: "Only in such children's stories as contain the concluding "and the moral of the story is..." or in tiresome didactic authors as Tolstoy do we get an explicit representation of the serious speech acts which it is the point (or the main point) of the fictional text to convey." Searle formuliert daraufhin als Ziel eine "... general theory of the mechanisms by which such serious illocutionary intentions are conveyed by pretended illocutions" (Searle 1975, 332).
15 Vgl. Kap. 4.1. dieser Arbeit
16 Vgl. Fish 1980 sowie Kapitel 1 (S. 12-13) dieser Arbeit.
17 Girard vertritt eine anthropologische Theorie, nach der die labile Ordnung primitiver Gesellschaften stets von Gewalt bedroht ist, die durch einen Mechanismus 'nachahmenden Begehrens' ausgelöst wird, der in einen Kreislauf von Rachezwängen mündet, der die Unterschiede zwischen Täter und Opfer letztendlich verschwinden läßt. Dieser Kreislauf kann nur durch ein Opfer durchbrochen werden, in dem ein 'Sündenbock' die Schuld auf sich lädt und die Ordnung wieder herstellt. Die regelmäßige ritualisierte Wiederholung des Opfers schützt dabei vor einem neuen Ausbruch des Gewaltkreislaufes. Girard geht davon aus, daßsich Elemente dieses Opferkults auch im Theater der Neuzeit wiederfinden in ihren Werken inszenieren. Vgl. dazu Girard 1992.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text analysiert die Probleme der literarischen Linguistik und der neueren Literaturtheorien, insbesondere im Kontext des Poststrukturalismus. Es wird eine Alternative in Form der Relevance Theory von Dan Sperber und Deirdre Wilson vorgestellt, die als Kommunikationsmodell die Sinnkonstitution literarischer Texte erklären soll.
Welche Probleme der literarischen Linguistik werden diskutiert?
Die Überbetonung der literarischen Form, die einseitige Rezeption strukturalistischer Theorien und die daraus resultierende Vernachlässigung der Inhalts- und Ausdrucksebene im Akt der Rezeption werden kritisiert. Zudem wird die Schwierigkeit der Explizierung sprachlicher Codes und der Abschließbarkeit des Kontextes thematisiert.
Was ist die Relevance Theory und wie unterscheidet sie sich von anderen Kommunikationsmodellen?
Die Relevance Theory ist ein Kommunikationsmodell, das von Dan Sperber und Deirdre Wilson entwickelt wurde. Es wird als Kritik bestehender strukturalistischer und semiotischer Theorien präsentiert und versucht, konkrete Alternativen anzubieten. Im Gegensatz zu Code-Modellen erklärt sie Kommunikation als inferentiellen Prozess, bei dem die Sinnkonstitution nicht über Dekodierung, sondern über das Erkennen informativer Intentionen durch den Hörer (Leser) erfolgt.
Welche Rolle spielt der Leser in der Relevance Theory?
Der Leser spielt eine aktive Rolle bei der Sinnkonstitution. Er konstruiert einen Kontext, der die Relevanz der verarbeiteten Information verstärkt und somit eine Interpretation ermöglicht, die mit dem Relevanzprinzip in Einklang steht. Die Interpretation beruht auf der unbewussten Erwartung, dass der entsprechende Stimulus (sprachliche Äußerung, Geste o.ä.) so ausgewählt wurde, daßer ausreichende contextual effects bei geringem Verarbeitungsaufwand ermöglicht.
Was bedeutet "Relevanz" im Kontext der Relevance Theory?
Relevanz ist definiert als das Ausmaß, in dem eine Information "contextual effects" erzeugt, d.h., neue Annahmen ableitet, alte Annahmen stärkt oder eliminiert. Relevanz ist auch abhängig von dem Verarbeitungsaufwand, der nötig ist, um diese Effekte zu erzielen. Je größer die contextual effects und je geringer der Aufwand, desto relevanter ist die Information.
Was sind "contextual effects"?
Contextual effects sind die Auswirkungen, die eine neue Information im Kontext bestehender Annahmen hat. Dies kann die Ableitung neuer Annahmen (contextual implications), die Verstärkung bestehender Annahmen oder die Eliminierung falscher Annahmen sein.
Welche Implikationen hat die Relevance Theory für die Literaturwissenschaft?
Die Relevance Theory kann zur Analyse von Stilistik und Textinterpretation verwendet werden. Sie bietet einen Rahmen, um zu verstehen, wie sprachliche Äußerungen über ihren rein semantischen Inhalt hinaus Bedeutung erlangen und wie der Kontext zur Interpretation beiträgt. Die Relevance Theory bietet im wesentlichen einen neuen Blickwinkel für die Analyse von Sprache und Bedeutung.
Kann die Relevance Theory als Interpretationsmethode verwendet werden?
Der Text argumentiert, dass die Relevance Theory nicht als "discovery procedure" zur Interpretation einzelner literarischer Texte verwendet werden sollte. Stattdessen sollte sie als Meta-Theorie verstanden werden, die hilft, den Prozess der Bedeutungsbildung und die Rolle des Lesers in der Literaturwissenschaft zu erklären.
Welche Kritik gibt es an der Relevance Theory?
Kritiker bemängeln, dass die Relevance Theory möglicherweise zu stark auf die individuellen kognitiven Prozesse konzentriert ist und andere Faktoren wie soziale Einflüsse oder literaturspezifische Probleme vernachlässigt. Auch die Gefahr einer Überbetonung der subjektiven Perspektive wird benannt.
Inhalt
Was ist der Ansatz zur Lösung der Kommunikationslücke zwischen Autor und Leser?
Eine Lösung wird versucht zu finden, in dem vorgeschlagen wird, dass jede Äußerung die implizite Garantie ihrer eigenen Relevanz kommuniziert. Der Interpret muss also nicht die Relevanz der kommunizierten Information überprüfen (denn diese wird unbewusst vorausgesetzt), sondern muss versuchen, aus den zur Verfügung stehenden Annahmen einen Kontext zu konstruieren, der die Relevanz der verarbeiteten Information verstärkt und somit eine Interpretation ermöglicht, die mit dem Relevanzprinzip in Einklang ist.
Inhalt
Welche Schwachstellen des Modells der Relevanz Theorie sind bekannt?
Es wird ausgeführt, dass das Modell zwar die Rolle des Textes für die Interpretation (theoretisch) deutlich macht, jedoch lässt das Modell selbst keine Aussagen über den Text, bzw. seinen Aufbau, seine Eigenschaften etc. zu. Betrachtet man die Relevanz Theorie somit isoliert als Modell literarischer Kommunikation, scheint die gesamte Verantwortung der Bedeutungsbildung doch wieder auf den Rezipienten zurückgeworfen.
- Citation du texte
- Ralph Schulz (Auteur), 2001, Relevance Theory: Leistungen und Grenzen eines kognitiven Kommunikationsmodells für die Literaturwissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106617