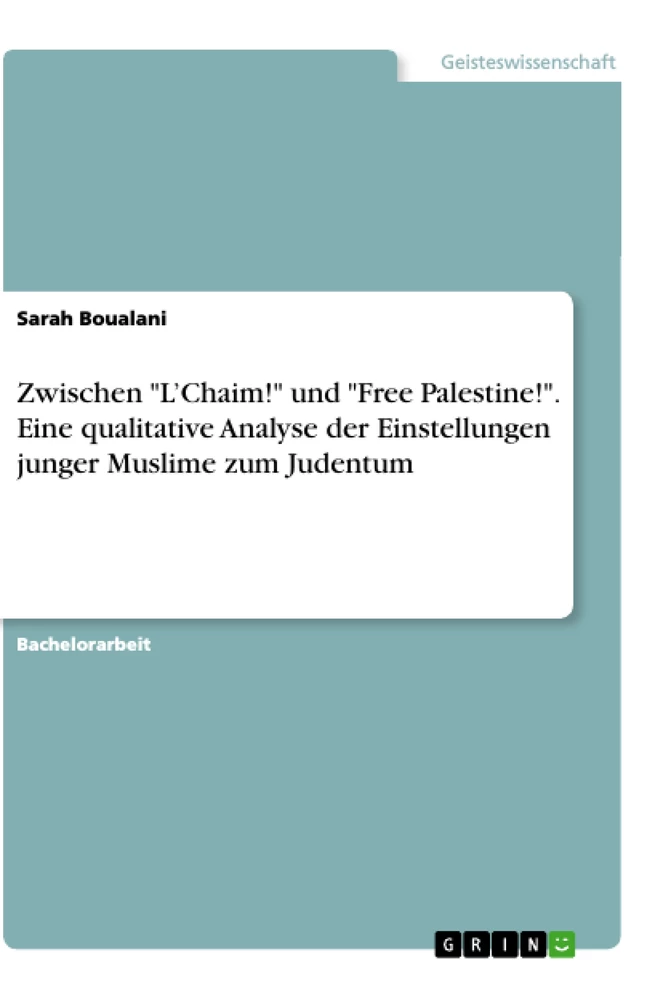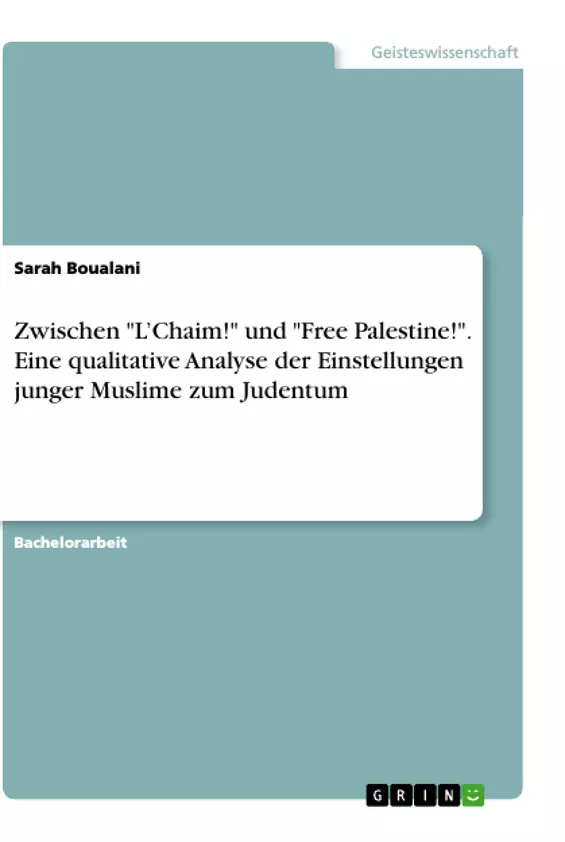In der Arbeit wurde sich den Einstellungen gewidmet, die Muslime in Deutschland zum Judentum haben. Die wesentliche Forschungsfrage ist dabei, welche Einstellungen zum Judentum unter "deutschen Muslimen" vorherrschen und welchen Argumentationsmustern und Erklärungsansätzen etwaiger Antisemitismus zugrunde liegt.
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile. Im ersten Schritt erfolgt die inhaltliche Einführung in die Thematik, wozu der Begriff Antisemitismus zunächst definiert und anschließend der Forschungsstand zum Thema vorgestellt wird. Der zweite Teil umfasst die theoretische Einbettung. Da Antisemitismus ein vielschichtiges Phänomen ist, werden die Erscheinungsformen und deren jeweilige Verbreitungsgeschichten in diesem Teil der Arbeit ausführlich behandelt. Nachfolgend werden theoretische Erklärungsansätze zur Entstehung des Antisemitismus unter Muslimen vorgestellt. Das Herzstück der Arbeit ist der dritte Abschnitt: In einer qualitativen Studie wurden junge Muslime im Rahmen von leitfadengestützten Interviews hinsichtlich ihrer Einstellungen zum Judentum befragt.
Die befragten Muslime wurden systematisch ausgewählt und sind unter 30 Jahren alt. Sie haben allesamt keine eigene Migrationserfahrung und ein verhältnismäßig hohes Bildungsniveau. Beschäftigt wurde sich demnach mit jungen Deutschen, die dennoch eine Subgruppe darstellen. Welche Einstellungen haben folglich Menschen zum Judentum, die an einer Schnittstelle zwischen zwei Lebenswelten stehen? Junge Menschen, die einerseits in einer Gesellschaft sozialisiert wurden, die aufgrund der historischen Vergangenheit Deutschlands den Anspruch darauf hat, einen sensiblen und pflichtbewussten Umgang mit dem Judentum und dessen Anhängern zu lehren? Gleichzeitig aber auch einem Umfeld zugehörig sind, das aufgrund politischer Konflikte im Nahen Osten die Tendenz hat, antisemitische Einstellungen zu haben? Genügen etablierte Antisemitismusformen und Erklärungsansätze um das Phänomen zu erklären? Können Aussagen darüber getroffen werden, welche Verhaltens- und Denkweisen über das Judentum aus welcher Lebenswelt adaptiert werden?
Letztlich wird in der Studie weitaus mehr thematisiert als die Frage, ob die Befragten antisemitische Einstellungen haben und welchen Erklärungsansätzen diese zugrunde liegen. Die Analyse gibt letztlich Hinweise darauf, warum Argumentationsmuster aus der einen Lebenswelt angenommen und aus der anderen abgelehnt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Theoretische Erscheinungsformen des Antisemitismus
- Religiöser Antisemitismus
- Rassistischer Antisemitismus
- Sekundärer Antisemitismus
- Antizionistischer Antisemitismus
- Wann ist Kritik antisemitisch?
- Zwischenfazit
- Warum sind Muslime antisemitisch?
- Methodik
- Forschungsansatz
- Interviewleitfaden
- Stichprobe
- Durchführung der Erhebung
- Auswertungsverfahren
- Methodische Reflektion
- Ergebnisse
- Beschreibung der Stichprobe
- Wissensbestände
- Antisemitische Einstellungen
- Sekundärer Antisemitismus
- Rassistischer Antisemitismus
- Antizionistischer Antisemitismus
- Positive Beispiele
- Erklärungsansätze
- Eigene Diskriminierungserfahrungen
- Identifikation und Solidarisierung mit muslimischer Gemeinschaft
- Sozialisationserfahrungen
- Der rote Faden
- Ausnahmen, die die Regel bestätigen
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Einstellungen junger Muslime zum Judentum in Deutschland. Sie untersucht, welche Einstellungen zum Judentum unter „deutschen Muslimen“ vorherrschen und welchen Argumentationsmustern und Erklärungsansätzen etwaiger Antisemitismus zugrunde liegt. Die Studie widmet sich einer spezifischen Stichprobe junger Muslime unter 30 Jahren mit einem verhältnismäßig hohen Bildungsniveau und ohne eigene Migrationserfahrung.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs Antisemitismus
- Analyse verschiedener Erscheinungsformen des Antisemitismus
- Erklärungsansätze für antisemitische Einstellungen bei jungen Muslimen
- Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Einstellungen zum Judentum
- Bedeutung des Kontexts der deutschen Geschichte und der Konflikte im Nahen Osten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Relevanz der Forschung. Sie beschreibt den aktuellen Stand der Debatte und stellt die Forschungsfrage in den Mittelpunkt. Das Kapitel „Forschungsstand“ bietet einen Überblick über die bestehende Literatur zum Thema Antisemitismus und dessen Erscheinungsformen. Im Kapitel „Theoretische Erscheinungsformen des Antisemitismus“ werden die verschiedenen Formen des Antisemitismus detailliert beschrieben und ihre historischen Wurzeln beleuchtet. Das Kapitel „Warum sind Muslime antisemitisch?“ beleuchtet die Frage, warum Muslime in Deutschland häufig mit antisemitischen Einstellungen in Verbindung gebracht werden. Das Kapitel „Methodik“ beschreibt den Forschungsansatz der Arbeit, den Interviewleitfaden, die Stichprobenauswahl, die Durchführung der Interviews und das Auswertungsverfahren. Das Kapitel „Ergebnisse“ präsentiert die Ergebnisse der Interviews und untersucht die Einstellungen der befragten jungen Muslime zum Judentum. Es analysiert die Ursachen für antisemitische Einstellungen und beleuchtet die Rolle von Diskriminierungserfahrungen, Identifikation mit der muslimischen Gemeinschaft und Sozialisationserfahrungen. Das Kapitel „Fazit und Ausblick“ fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsansätze.
Schlüsselwörter
Antisemitismus, Einstellungen, junge Muslime, Deutschland, Judentum, Islam, Diskriminierung, Sozialisation, Naher Osten, Konflikte, Forschungsstand, qualitative Analyse, Interviews, Argumentationsmuster, Erklärungsansätze.
- Citar trabajo
- Sarah Boualani (Autor), 2019, Zwischen "L’Chaim!" und "Free Palestine!". Eine qualitative Analyse der Einstellungen junger Muslime zum Judentum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1066515