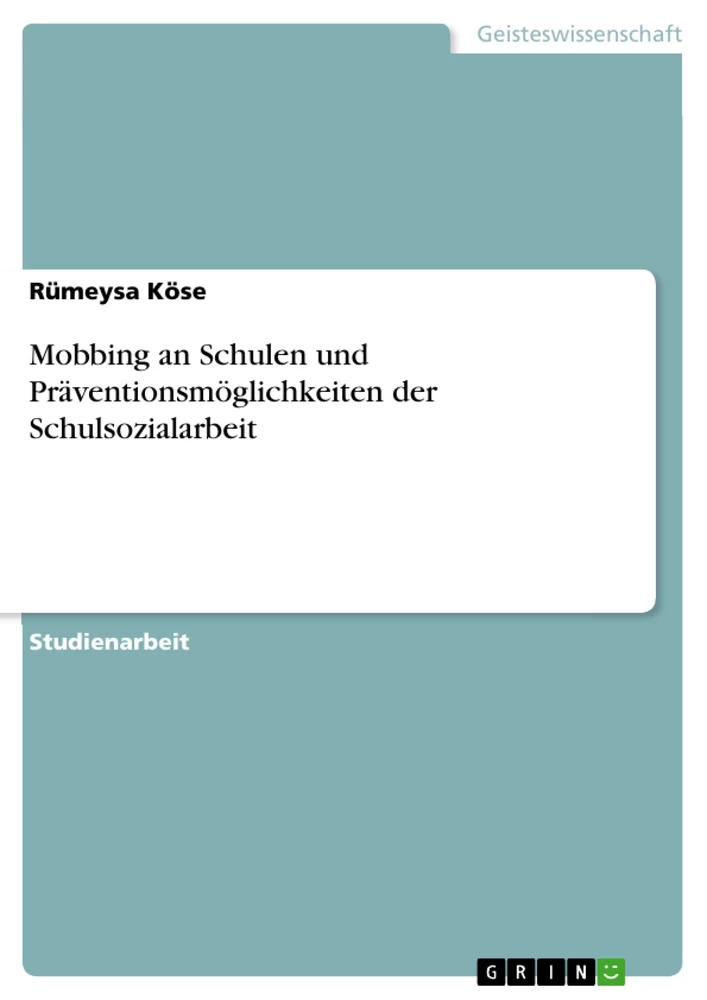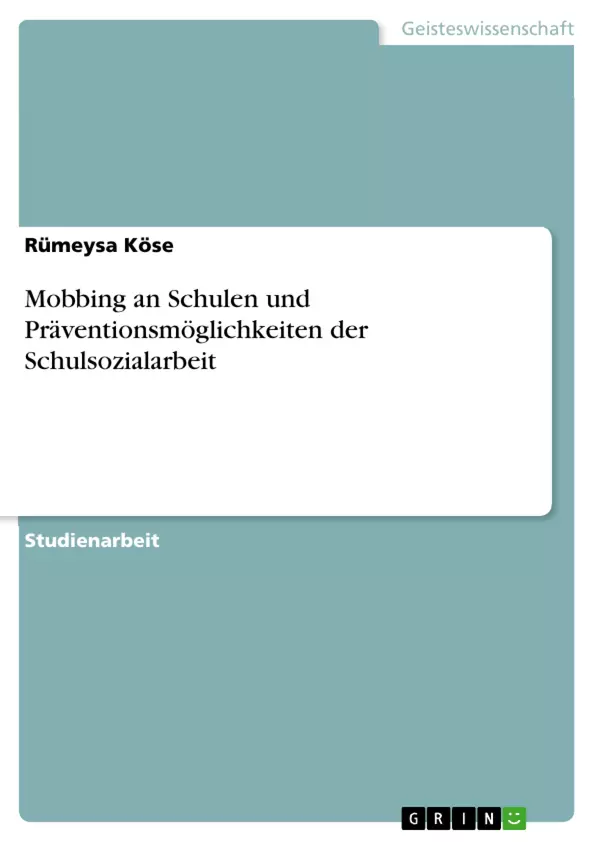Im ersten Kapitel wird das Mobbing-Phänomen in der Schule näher dargestellt. Wie Mobbing in den Institutionen durchgeführt wird und welche Motive vorliegen werden beschrieben. Darauf bezogen werden Opfer- und Tätermerkmale dargestellt und im Anschluss die mit den Rollen einhergehenden Folgen beschrieben.
Der zweite Teil beschäftigt sich näher mit der Schulsozialarbeit. Nachdem die Grundlagen abgearbeitet wurden, wird im dritten Abschnitt das präventive Vorgehen gegen Mobbing in Betrachtung gezogen. Dafür wurde das Anti-Mobbing Programm von Olweus und der No Blame Approach von Robinson und Mains ausgewählt. Abschließend werden die ausgearbeiteten Ergebnisse im Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mobbing an Schulen
- Mobbing unter Schülern
- Motive
- Typen von Opfer und Täter
- Folgen für Opfer und Täter
- Schulsozialarbeit
- Prävention
- Dan Olweus Anti-Mobbing-Programm
- No Blame Approach
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit dem Phänomen von Mobbing an Schulen und untersucht die Möglichkeiten der Schulsozialarbeit zur Prävention von Mobbing. Der Text analysiert das Mobbing-Phänomen, die Motive und Folgen für Opfer und Täter sowie die Rolle der Schulsozialarbeit in der Bekämpfung von Mobbing. Darüber hinaus werden zwei Präventionsansätze, das Anti-Mobbing-Programm von Olweus und der No Blame Approach, vorgestellt.
- Definition und Erscheinungsformen von Mobbing an Schulen
- Motive und Ursachen von Mobbing
- Folgen von Mobbing für Opfer und Täter
- Die Rolle der Schulsozialarbeit in der Prävention von Mobbing
- Zwei Präventionsansätze: Dan Olweus Anti-Mobbing-Programm und No Blame Approach
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Phänomen Mobbing an Schulen. Es werden die Definition und verschiedene Erscheinungsformen von Mobbing sowie die Motive und Folgen von Mobbing für Opfer und Täter beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Schulsozialarbeit und ihren Aufgaben im Bereich der Prävention und Intervention bei Mobbing.
Das dritte Kapitel stellt zwei wichtige Präventionsansätze vor: das Anti-Mobbing-Programm von Dan Olweus und den No Blame Approach. Diese Ansätze werden in ihrer jeweiligen Funktionsweise und ihren Schwerpunkten vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen der Ausarbeitung umfassen Mobbing, Schulsozialarbeit, Prävention, Anti-Mobbing-Programme, Opfer, Täter, Folgen von Mobbing, Dan Olweus, No Blame Approach.
Häufig gestellte Fragen
Was sind typische Merkmale von Mobbing an Schulen?
Mobbing zeichnet sich durch wiederholte, systematische Schikanen über einen längeren Zeitraum aus, bei denen ein Machtungleichgewicht besteht.
Welche Folgen hat Mobbing für die Opfer?
Die Folgen reichen von Schulangst und Leistungsabfall bis hin zu schweren psychischen Problemen und Depressionen.
Was ist das Anti-Mobbing-Programm von Dan Olweus?
Es ist ein strukturiertes Programm, das auf eine Veränderung der gesamten Schulstruktur und eine klare Haltung gegen Gewalt setzt.
Wie funktioniert der "No Blame Approach"?
Dieser Ansatz verzichtet auf Schuldzuweisungen und Bestrafung; stattdessen wird eine Unterstützungsgruppe gebildet, um gemeinsam Lösungen zu finden.
Welche Rolle spielt die Schulsozialarbeit bei Mobbing?
Schulsozialarbeiter fungieren als neutrale Ansprechpartner, führen Präventionsprojekte durch und intervenieren in akuten Konfliktfällen.
- Arbeit zitieren
- Rümeysa Köse (Autor:in), 2020, Mobbing an Schulen und Präventionsmöglichkeiten der Schulsozialarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1066522