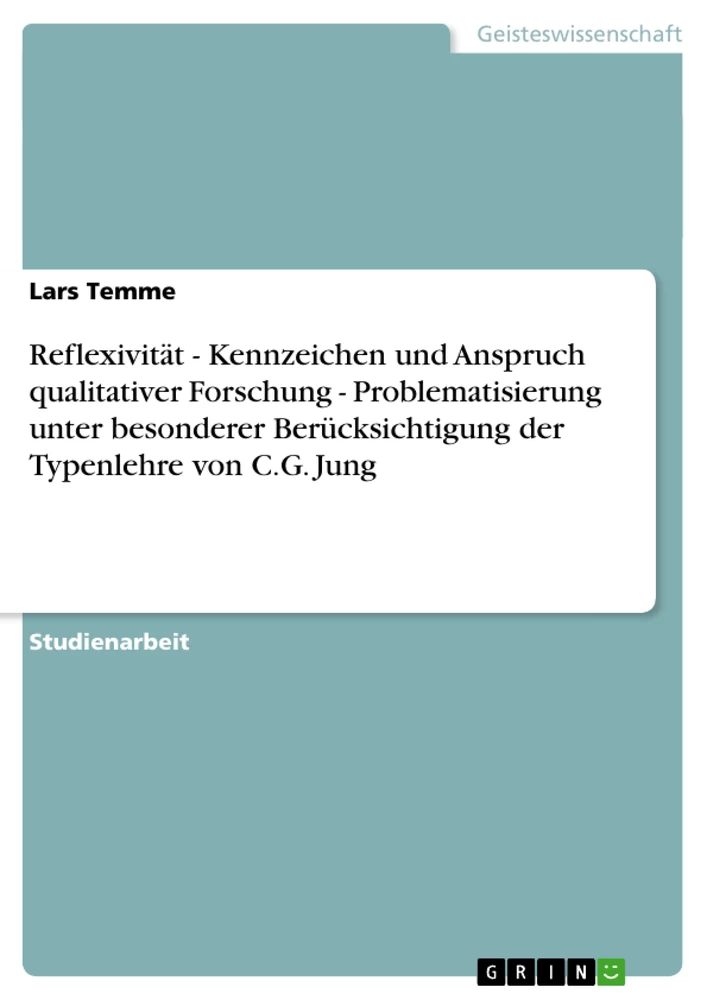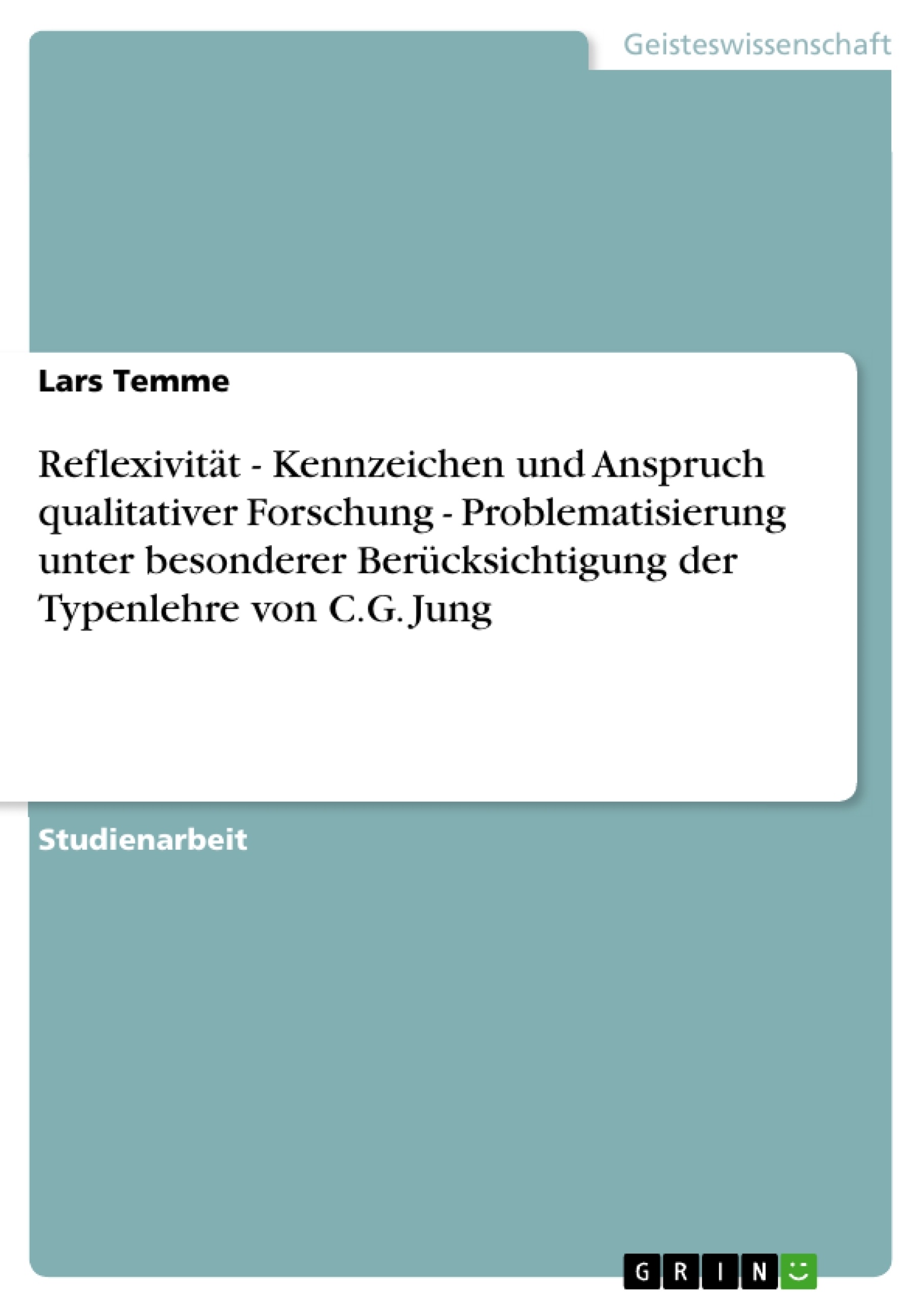Was beeinflusst die Erkenntnisse eines Forschers wirklich? Diese Frage steht im Zentrum einer tiefgreifenden Auseinandersetzung mit dem Anspruch der Reflexivität in der qualitativen Forschung. Jenseits bloßer methodologischer Bekenntnisse untersucht diese Arbeit, inwieweit Forschende tatsächlich den Einfluss ihrer eigenen Subjektivität und des Forschungskontexts berücksichtigen. Die Diskussion beleuchtet, ob die Heterogenität der qualitativen Forschung die Formulierung allgemeiner Gütekriterien überhaupt zulässt und welche Kriterienbereiche Anwendung finden können. Ein besonderer Fokus liegt auf den Schwierigkeiten, die mit dem Einbezug der Subjektivität der Forschenden und der Kontextualität von Forschung einhergehen. Am Beispiel der Typenlehre C.G. Jungs wird der Einfluss der Persönlichkeit auf Wahrnehmungs- und Beurteilungspräferenzen verdeutlicht und mögliche Konsequenzen für die Forschungspraxis aufgezeigt. Es wird argumentiert, dass die Anerkennung der Subjektivität nicht als Mangel, sondern als Chance für Erkenntnisgewinn betrachtet werden sollte. Die Arbeit plädiert für eine stärkere interdisziplinäre Zusammenarbeit, Forschungssupervision und die Bildung kollegialerSupervisionsgruppen, um eine Enttabuisierung von Subjektivität und Kontextualität zu erreichen. Abschließend wird diskutiert, inwiefern die Typenlehre Jungs einen nützlichen Zugang zur Reflexion der eigenen Persönlichkeit und ihrer Auswirkungen auf den Forschungsprozess bieten kann, ohne dabei den Anspruch auf Objektivität vollständig aufzugeben. Qualitative Forschung, Gütekriterien, Subjektivität, Reflexivität, Forschungspraxis, Persönlichkeitseinfluss, Typenlehre, C.G. Jung, Interdisziplinarität, Forschungssupervision, Erkenntnisgewinn, Forschungsmethodologie, Sozialforschung, Wissenschaftstheorie, Forschungskontext, Wahrnehmungspräferenzen, Beurteilungspräferenzen, Forschungsteam, Forschungsergebnis, Methodologie, Empirie, Datenauswertung, qualitativeInhaltsanalyse, Grounded Theory, Ethnographie, Aktionsforschung, interpretative Forschung, sozialeKonstruktion, Forschungsethik, Validität, Reliabilität, Objektivität, Forschungsprozess, Forschungspersönlichkeit, Wissenschaftskultur, Forschungsdesign, qualitative Methoden, Forschungsethik, forschendes Lernen, qualitative Bildungsforschung, qualitative Marktforschung, qualitative Evaluationsforschung, Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften.Die Arbeit richtet sich an Forschende und Studierende der Sozialwissenschaften, die sich mit den methodologischen und praktischen Herausforderungen qualitativer Forschung auseinandersetzen und neue Wege suchen, um die Qualität ihrer Forschung zu verbessern.
„Die Charakterstruktur des Forschers - die auch die subjektiven Determinanten seiner wissenschaftlichen Auffassung einschließt - beeinflußt in radikaler Weise sowohl seine Daten wie seine Schlüsse.“
„Die Scheu mit >weichen< Daten umzugehen, ist weit verbreitet. In ihr spiegelt sich eine weitere Angst im Umgang mit Komplexivität wider: Man fürchtet, durch Einbeziehung qualitativer Faktoren den >sicheren< Boden wissenschaftlicher Betrachtung zu verlassen. Dabei wird vergessen, daßAussagenüber ein System, die wesentliche Teile von ihm unberücksichtigt lassen, weit unwissen- schaftlicher sind“.
1. Ziel der Arbeit und Formalia
Subjektivität ist aus der Perspektive qualitativer Forschung kein Mangel, son- dern ermöglicht Erkenntnis (vgl. Lamnek 1988, vgl Mayring, 1999). Methodo- logisch verbindet sich damit die Formulierung von Reflexivität als Anspruch, empirisch dessen Umsetzung. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit die- sem Anspruch, dessen methodologischer Verortung sowie Erfüllung in der Praxis.
Ausgangspunkt ist zunächst die Klärung der Frage, ob die Diskussion um den Anspruch Reflexivität überhaupt in Bezug auf „die“ qualitative Forschung ge- führt werden kann, bzw. ob die Heterogenität des Forschungsfeldes diese Fragestellung erlaubt (Kap. 2). Die Frage ob und welche Gütekrite- rien(bereiche) genutzt werden können oder dürfen wird anschließend disku- tiert (Kap. 3). Ausgehend von der Erkenntnis, dass sich Forschung schwer tut „... mit einem Einbezug der Subjektivität der Forschenden und der Kontextuali- tät von Forschung ... “ (Mruck & Mey, 1996, Abs. 1), werden nachfolgend Problemfelder aufgezeigt (Kap. 4). Beispielhaft wird der Persönlichkeitsein- fluss anhand der Typenlehre C.G. Jungs verdeutlicht (Kap. 5). Abschließend werden mögliche Konsequenzen genannt (Kap. 6) und die Ergebnisse dieser Arbeit in Bezug auf das genannte Ziel diskutiert (Kap. 7).
Auf die Spezifika von Erhebungsverfahren sowie der Datenauswertung in Verbindung mit der angeführten Thematik konnte nicht eingegangen werden, dies hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt.
Hervorhebungen in wörtlichen Zitaten sind, sofern nichts anderes angegeben ist, so aus der Originalliteratur übernommen worden. Seitenangaben sind bei den häufigsten Formaten von Texten aus dem Internet nicht so eindeutig wie bei Büchern oder Zeitschriften in Papierform. Die Zitation von Internettexten erfolgt daher mit Bezug auf Absätze, z.T. sind Internetpublikationen bereits entsprechend fortlaufend nummeriert und es wird auf diese Art der Zitation explizit hingewiesen (vgl. http://qualitative-research.net). Sofern dies nicht der Fall ist, wurden die Absätze vom Verfasser der Arbeit nummeriert.
Im Interesse der Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit personale Beg- riffe unsystematisch sowohl in der weiblichen, als auch männlichen Form aus- gedrückt. Das andere Geschlecht ist (auch ungenannt) jeweils einbezogen.
2. Qualitative Forschung als Bezugsfeld für „Subjektivität“ und „Reflexivität“
In diesem Kapitel soll, mit einem kurzen historischen Einstieg beginnend, zunächst geklärt werden, ob die Diskussion um Subjektivität und Reflexivität zulässig ist, wenn sie auf „qualitative Forschung“ Bezug nimmt, da sie damit eine Form von Homogenität zu implizieren scheint.
In den Sozialwissenschaften hat im 20. Jahrhundert eine tiefgreifende Verän- derung stattgefunden: die sogenannte qualitative Wende (Mayring, 1999), der Trend zu qualitativen Erkenntnismethoden, weg vom zweifelhaft gewordenen rein quantitativem Denken. Die einzelwissenschaftlichen Entwicklungslinien verliefen dabei unterschiedlich. In den Erziehungswissenschaften wurde z. B. in den 70er Jahren die Wende gegen die späte aber konsequente Orientierung am empirisch- quantitativen Paradigma vollzogen (Mayring, 1999). Grundlegend war dabei die Erfahrung, dass „ ... die sich in immer höhere Ebenen der Abstraktion versteigen- den Generalaussagen ... nicht mehr die Wirklichkeit treffen, und daß überdies un- terstellt wird, als ob diese Wirklichkeit zumindest für alle untersuchten Personen gleich ist.“ (Heinze, 1995, S.10).
Demgegenüber will qualitative Forschung mit der Beschreibung der Lebenswelten der Akteure von innen heraus zum besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit bei- tragen und dabei auf Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam ma- chen, die den Handelnden selbstverständlich sind, nicht jedoch denjenigen, die nicht Teil haben an ihrer Lebenswelt (Flick & Kardorff & Steinke, 2000, S. 14 ff). Denn qualitative Forschung sieht - dem interpretativen Paradigma folgend - gesell- schaftliche Wirklichkeit nicht als objektiv gegeben an, sondern als gesellschaftlich konstruiert (Witt, 1997).
Bei der Frage, was qualitative Forschung denn genau ist, findet sich keine einheitliche Definition für dieses reichhaltige und z. T. auch selbstwidersprüchliche Feld (Chenail, 1992). Qualitative Forschung erscheint als unübersichtlich (Flick et al., 2000) und heterogen auf methodologischer sowie methodischer Ebene (Mruck & Mey, 2000). Und so zieht Mey (1999, S. 121) zu dieser Frage auch das Fazit, es sei „... festzuhalten, daß es die qualitative (wie die quantitative) Forschung so nicht gibt, sondern es sind die unterschiedlichsten Positionen vorfindbar, die mit z. T. verschiedenen Schulrichtungen korrespondieren.“. Und Chenail (1992, Abs.1) konstatiert nüchtern, dass der Begriff qualitative Forschung „... a variety of things for a variety of people ...“ bedeutet.
Einen Ordnungsversuch haben Lüders und Reichertz (1986, zitiert nach Mruck & Mey, 2000) für dieses differenzierte Feld unternommen und drei qualitative Forschungsstränge unterschieden:
- Nachvollzug des subjektiv gemeinten Sinns (das Subjekt steht im Vordergrund)
- Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus (und deren Herstellung)
- Rekonstruktion deutungs- und handungsgenerierender Tiefenstrukturen (objektiv-hemeneutisch oder psychoanalytisch)
Diese Hauptlinien unterscheiden sich in ihren theoretischen Bezugspunkten und methodischen Schwerpunkten. Dennoch teilen sie das Grundverständnis, dass Realität interaktiv hergestellt wird und ihre Interpretation durch Einzelne und Grup- pen subjektive (handlungsleitende) Bedeutung schafft (Flick et al., 2000).
Darüber hinaus lassen sich in der Diskussion um die (deutschsprachige) qua- litative Forschung zentrale Prinzipien oder Postulate feststellen (Mruck & Mey, 2000):
- Fremdheitspostulat:
- Es wird nicht einfach ein gemeinsames (Vor-)Verständnis und damit die Möglichkeit des wissenschaftlichen Verstehens - auch der eigenen Kultur -vorausgesetzt (Mruck & Mey, 2000).
- Prinzip der Offenheit:
- Es wird auf die informationsreduzierende Hypothesenbildung ex ante und standar- disierende Methoden verzichtet, d. h. die Betonung liegt auf der Exploration und der Hypothesenbildung ex post (Lamnek, 1988). Die Bereitschaft und Fähigkeit zum Perspektivenwechsel und die Akzeptanz des „Unvermögens“ keinen absolu- ten Standpunkt einnehmen zu können, bezieht sich darüber hinaus auf mehrere Aspekte, wie Forschungsfrage und -ablauf, Auswahl der Untersuchungspersonen, alternative Interpretationen u. s. w. (Froschauer, 1998). Das Prinzip Offenheit wird explizit auch in den ersten beiden der vier Kleiningschen Grundre- geln qualitativer Forschung (Kleining, 1995) genannt, der Vorläufigkeit des Vorver- ständnisses der Forscherin (Subjekt) und des Gegenstandes (Objekt). Das Offenheitsprinzip drückt sich auf methodischer Ebene in der Forderung nach Ge- 6 genstandsangemessenheit (Lamnek, 1988) aus, der Unterordnung der Methodik unter die Anforderungen des zu Erforschenden (Mruck & Mey, 2000).
- Prinzip der Kommunikation:
- Forschungssubjekt und -objekt sind immer verwobener Teil von Geschichte und Kultur. Die Herauslösung aus diesem Kontext und der Versuch das Subjektive zu eliminieren bzw. durch Normierung zu kontrollieren, können nicht Bedingungen wahrer Erkenntnis sein, sondern die Kommunikation „... zwischen Forscher(innen) und Beforschten als konstitutives und reflexionsbedürftiges Element des Verste- hensprozesses ... “ (Mruck & Mey 2000, Abs. 5). „Forschung wird damit als Kom- munikation begriffen.“ (Lamnek, 1988, S. 24). Das Handeln der Forschenden steht dabei nicht unter dem Verdikt eine Störquelle zu sein, eine neutrale Position der Forschenden wird nicht angestrebt (Lüders & Reichertz, 1986 zitiert nach Mruck & Mey, 2000), bzw. die Unabhängigkeit zwischen Forschenden und ihren Ergebnis- sen gibt es nicht (Lamnek, 1988). Nicht nur auf die direkte Kommunikation bezo- gen legt Kleining (1995) dem Forschungsprozess in der qualitativen Forschung das Dialogkonzept zugrunde, bei dem das Befragen des Gegenstandes (auch z. B. mittels Beobachtung) und dessen Antworten der Formulierung neuer Fragen dient. Bei dieser zirkulären Forschungsstrategie (im Gegensatz zum linearen Vorgehen unter dem quantitativen Paradigma) wird eine Abfolge von Forschungsschritten mehrfach durchlaufen, der jeweils nächste Schritt hängt von den Ergebnissen des Vorangehenden ab (Witt, 1997). Diese Iteration dient der Überwindung des als Vorurteil verstandenen Vorwissens der Forschenden (Kleining, 1995). Damit wird wieder auf das Fremdheitspostulat verwiesen.
Es wird deutlich: diese drei paradigmatischen Gemeinsamkeiten stehen in einem engen Zusammenhang. Über sie hinaus, werden oft weitere Kennzeichen qualitativer Forschung genannt (vgl. Lamnek, 1988, vgl. Mayring, 1999), wesentliche wurden den drei zentralen Prinzipien bereits zugeordnet.
Die dabei ebenfalls erwähnte Reflexivität wird jedoch in zweifacher Hinsicht ge- braucht, als Kennzeichen im Forschungsobjekt und als Anforderung an den For- schungsprozess (Lamnek,1988, S. 25). Für den Forschungsgegenstand braucht sie nicht erst eingefordert zu werden, da unter der Perspektive des interpretativen Paradigmas den Bedeutungen menschlicher Verhaltensprodukte „... eine prinzi- pielle Reflexivität zu unterstellen ...“ ist (Lamnek, 1988, S. 25). Bedeutungen wer- den „ ... nur durch den Rekurs auf den (symbolischen oder sozialen) Kontext ... verständlich.“ (Lamnek, 1988, S. 25). Dieser Aspekt findet sich in allen drei ge- nannten Kernprinzipien. Der Anforderungsaspekt der Reflexivität, der dem qualitativen Forschungsprozess nicht als konstituierendes Prinzip immanent ist, soll im weiteren besondere Beachtung erfahren, zunächst im Rahmen der Frage nach Gütekriterien von qualitativer Forschung.
Zur Leitfrage dieses Kapitels lässt sich nun antworten, dass - bei aller Verschiedenheit - qualitative Forschung paradigmatische Gemeinsamkeiten aufweist, die es erlauben Subjektivität und Reflexivität auf „qualitative Forschung“ zu beziehen, auch wenn es nicht „die“ Definition gibt. Letzteres kann jedoch nicht einfach als Mangel bezeichnet werden, sondern entlang der genannten Prinzipien scheint (zumindest in weiten Teilen) die Heterogenität und Unübersichtlichkeit dieses Forschungsfeldes derjenigen ihres Gegenstandes geschuldet (vgl. Knoblauch, 2000).
3. Gütekriterien qualitativer Forschung
In diesem Kapitel wird die Zulässigkeit und Notwendigkeit der Verwendung von Reflexivität als Gütekriterium fundiert.
Nach Kleining (1995) sind aus den Alltagsmethoden sowohl die Methoden der qualitativen, als auch der quantitativen Forschung hervorgegangen, die sich je- weils in ihrem Abstraktionsniveau unterscheiden. Die Wissenschaftlichkeit von Me- thoden begründet sich in deren reflektierter und systematischer Verwendung (Klei- ning, 1995). Reflektion bedarf eines Widerparts, der Vergleiche sowie Wertungen ermöglicht und legitimiert. Gütekriterien bieten dafür eine Grundlage. Nach Steinke (2000) kann qualitative Forschung ohne Gütekriterien nicht bestehen und die wei- tere Etablierung qualitativer Forschung setzt ihre Definition voraus. Im Hinblick auf diese Bedeutung bemängelt Steinke (2000, S. 319), dass die Frage nach den Gü- tekriterien häufig gestellt wird, die Antworten in Fachartikeln und -büchern jedoch sehr allgemein oder wenig systematisch seien. Und auch Mruck und Mey (2000, Abs. 33) kommen zum Schluss, dass allgemein anerkannte Kriterien zur Bewer- tung der Wissenschaftlichkeit qualitativer Forschung noch fehlen. In der Diskussi- on um Qualitätskriterien qualitativer Forschung, bei der sich z.T. „ ... verschiedene Autorinnen und Autoren auf unterschiedliche Qualitäts-Ebenen bzw. -Domänen beziehen, ohne dies (dem Leser, der Leserin oder sich selbst) deutlich zu machen ...“, wie dies Breuer und Reichertz 8 (2001, Abs. 9) konstatieren, können drei Grundpositionen ausgemacht werden (Steinke, 2000):
- Postmoderne Ablehnung von Kriterien:
- Danach wird die Möglichkeit der Anwendung von Kriterien grundsätzlich verneint, da für sie kein festes Bezugssystem existiert. Kriteriennutzung sei unvereinbar mit der Position des sozialen Konstruktivismus (Steinke, 2000, S. 321). Diese Orientie- rung „ ... in Richtung auf Relativität und Diskursivität/Diskursabhängigkeit wissen- schaftlicher Erkenntnis ... “ gewann in den 80er und 90er Jahren an Bedeutung, als bis dahin scheinbar unproblematische Kriterien hinterfragt wurden (Breuer & Reichertz, 2001, Abs. 33). Die Einsicht in den Konstruktionscharakter der Ergeb- nisse wissenschaftlichen Arbeitens rechtfertigt jedoch keine Beliebigkeit im Han- deln der Forschenden (Reichertz, 2000, Abs. 20), denn Ergebnisse qualitativer Forschung sind auch dann bewertbar wenn sie als Produkte von spezifischen Ent- scheidungs- und Konstruktionsleistungen begriffen werden (Steinke, 2000, S. 322).
- Nutzung quantitativer Kriterien für qualitative Forschung:
- Nach dieser Position, die bis in die 70er Jahre wissenschaftstheoretisch bestim- mend war (Reichertz & Breuer, 2001), haben Kriterien quantitativer Forschung, insbesondere die zentralen Kriterien Objektivität, Reliabilität und Validität auch Geltungsanspruch für qualitative Forschung. Es herrscht aus der Perspektive qua- litativ Forschender überwiegend Zustimmung zu der Unmöglichkeit die genannten Kriterien einfach zu übernehmen (Steinke, 2000; vgl. Lamnek, 1988; vgl. Mey, 1999). Während zur Frage wie mit ihnen denn umzugehen sei, keine einheitliche Haltung festzustellen ist (Mey, 1999). Steinke (2000, S. 323) schlägt vor, diese Kriterientrias u. a. wegen unterschiedlicher existierender Definitionen und verschiedenster entwickelter Formen nicht zu verwenden.
- Spezielle Kriterien für qualitative Forschung
- Die dritte Position geht von den Besonderheiten qualitativer Forschung auf wis- senschaftstheoretischer, methodologischer und methodischer Ebene aus. In die- sem Kontext werden z. B. die kommunikative Validierung, die Triangulation (heute eher als Methodik) genannt. Weiterhin soll die Interviewsituation validiert werden, im Hinblick auf das Entstehen eines Arbeitsbündnisses, das durch Offenheit, Vertrauen, und ein möglichst geringes Machtgefälle geprägt ist. Das Kri- terium Authentizität bezieht sich u.a. auf die angemessene Erhebung der Daten, 9 mit denen ebenso sorgfältig umzugehen ist, wie mit den Werten der Befragten (Steinke, 2000).
Reichertz und Breuer (2001) haben aus einer Metaperspektive für die Diskussion von Gütekriterien das Spektrum genutzter oder geforderter Kriterien geordnet, die wissenschaftlich eine Rolle spielen. Damit soll der Bezug auf unterschiedliche E- benen bei vielen Kontroversen transparent gemacht werden und zugleich das Spektrum dieser Ebenen oder Domänen aufgezeigt werden. Sie unterscheiden als Bereiche von Gütekriterien neben der Logik der Rechtfertigung, der Logik der Ent- deckung, der Redlichkeit der Wissenschaftler, der Ethik und der Technologiefähig- keit von Forschung auch die Domäne der Gegenstandsangemessenheit, mit der Selbstreflexion und Perspektivität. Für den letztgenannten Kriterienbereich ist in den Human- und Sozialwissenschaften grundlegend, dass Objekt und Subjekt prinzipiell identisch sind und damit „nur“ durch die Verabredung von Rollen unter- scheidbar. Daraus wird gefolgert, dass sich die Methodik dem Gegenstand unter- zuordnen hat, nicht umgekehrt. Der oder das „Andere“ wird mit Hilfe einer Metho- dik in der Forschungsinteraktion erst konstruiert, deren Spezifika das Ergebnis be- einflussen. Maximen in diesem Bereich sind z.B. die Selbstreflexivität der Objekte, die Selbstanwendung von Erkenntnissen auf Forschungssubjekte und die Reflexi- on der Entscheidung für die Grenzziehung zwischen Subjekt und Objekt und damit für die Stelle, an der Daten abgelesen werden (Devereux, 1967). Nach Reichertz und Breuer (2001) lässt sich für die Diskurse um Kriterien (respektive Kriterienmix) über die genannten Domänen hinweg kein einheitlicher Bezugspunkt mehr fest- stellen. Sie weisen denn auch explizit auf den Wertbezug jeder Entscheidung für Kriterien sowie deren Kontextualität hin, eine Verabsolutierung helfe daher auch der Kriteriendiskussion nicht weiter. Und auch Steinke (2000, S. 323) möchte ihre sieben Kernkriterien qualitativer Forschung nicht als universel- len Katalog verstanden wissen, sondern als ein untersuchungsspezifisch anzu- passendes System, welches den Besonderheiten qualitativer Forschung aller E- benen (methodisch, methodologisch, ...) Rechnung trägt. Ihre Kernkriterien berüh- ren mehrere der von Reichertz und Breuer (2001) genannten Bereiche. Neben der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit (nicht Überprüfbarkeit), der Indikation des Forschungsprozesses (weiter als Gegenstandsangemessenheit), der empirischen Verankerung, der Limitation, der Kohärenz und der Relevanz bildet die reflektierte Subjektivität ein eigenes Kernkriterium. Danach soll geprüft werden, inwiefern die konstituierende Rolle des Forschers als Subjekt methodisch reflektiert in die Theo- riebildung einbezogen wird. Forschende sind Teil der von ihnen erforschten Welt 10 und somit sind z. B. ihre Forschungsschwerpunkte, ihre Kommunikationsstile oder ihre Vorurteile in ihrer determinierenden Funktion zu reflektieren. Als Bezugsberei- che der Reflektion sieht Froschauer (1998) die Subjekt (-System) - Objekt (-System) - Beziehung, das Verhältnis Forschungsprozeß - Ergebnis sowie die Verbindung zwischen Elementen und ihrem Kontext. Steinke (2000, S. 331) weist konkreter auf Prozeßbegleitung durch Selbstbeobachtung, die Vertrauensbezie- hung Forscher - Informant und den Feldeinstieg als mögliche Reflektionspunkte hin. Explizit spricht sie darüber hinaus die Reflektion der persönlichen Vorausset- zungen der Forschenden und die Frage der Angemessenheit des methodischen Vorgehens in Bezug auf die Person des Forschers an. Letztere wird im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit besondere Beachtung erfahren.
Für den Bereich Gütekriterien lässt sich mit Mey (1999, S. 134) zusammenfassend festhalten, dass „... im Rahmen eines qualitativen Paradigmas, in dessen Zentrum die Postulate der Offenheit und der Kommunikation stehen - und noch zusätzlich für eine erkenntnistheoretische Position, die nicht mehr naiv darauf hofft, Gegens- tandscharakteristika einfach „entdecken“ und „abbilden“ zu können, sondern für die Sinnverstehen notwendig Sinnherstellung bedeutet - die eigene Teilhabe am Forschungsprozeß und an der Hervorbringung von Forschungsergebnissen stets reflektiert werden.“ muß. Es stellt sich nun die Frage, wie es in der Praxis qualitati- ver Forschung um die Erfüllung dieses Anspruchs bestellt ist.
4. Reflexivität als Anspruch: Stand, Inhalte, Ursachen
In diesem Kapitel wird Reflexivität als Anspruch in der Praxis beleuchtet und Be- zugsbereiche differenziert. Erklärungsansätze werden aufgezeigt. Der überwiegende Teil qualitativer Studien sieht die Forschenden als außerhalb des Forschungsfeldes stehend. Ihre Persönlichkeit und Subjektivität wird daher i. d. R. im Erkenntnisprozess nicht reflektiert. (Bergold & Breuer 1992, zitiert nach Mruck & Mey, 1996). Die Postulate, die qualitative Forschung kennzeichnen, wie die Transparenz des Vorverständnisses und des Vorgehens, werden nicht eingelöst (Mruck & Mey, 2000). Auch Lüders (2000, S. 635) sieht den weitgehen- den Verzicht auf die Reflexion der Methode in der Praxis als eine offene methodi- sche Frage an. Die scheinbare Subjektunabhängigkeit drückt sich nicht nur im Vorgehen, sondern auch in Schreibweise und Darstellung qualitativer Forschung aus (Mruck & Mey, 2000). Das, was in Forschungsberichten dargestellt wird, hat meist nur einen geringen Zusammenhang mit dem diese Ergebnisse hervorbrin- genden Prozess (Mruck & Mey, 1996). Im Hinblick auf die erläuterten, paradig- 11 matischen Gemeinsamkeiten qualitativer Forschung ist Knoblauch (2000, S. 629) davon überrascht, „... dass auch[eigene Hervorhebung] die qualitative Methodolo- gie noch immer dem Muster des einsam forschenden und erkennenden Wissen- schaftlers folgt.“. Es scheint hier einen Bruch zu geben, zwischen einer Methodo- logie, welche die Subjektivität der Forschenden anerkennt (Mruck & Mey, 1996) und einer Praxis, die (noch) vielfach der „...konventionellen Fiktion ...“ einer Wahr- nehmung unabhängig von der Forscherpersönlichkeit unterliegt (Devereux, 1967, S. 42). Aus einer Gesamtschau qualitativer Forschung wirkt paradox, dass die me- thodologische Forderung, die Erkenntnissituation einzubeziehen und die Reflexion auch als Instrument zu betrachten, in der Praxis meist nicht umgesetzt wird, ob- wohl zugleich grundsätzlich Einigkeit besteht über den Charakter von Erkenntnis- sen als Ergebnis eines gemeinsamen Konstruktionsprozesses. Dies kann z. T. durch das unabhängige Handeln erklärt werden, von Methodologen einerseits, die Vorgaben fernab der Praxis machen und Empirikern andererseits, die in einem na- turalistischen Verständnis ihre Deutungen zu Merkmalen des Forschungsgegens- tandes machen, Diskrepanzen nicht erklären und verschiedene Interpretationen nicht in Beziehung setzen (Mruck & Mey, 1996).
Welche inhaltlichen Bezugsthemen oder -ebenen sind es aber bei denen „ ... die kognitive Spiegelung und Bearbeitung ... [als] ... eigenständige Leistungen “ (Wagner & Niederberger, 2002, Abs. 12) defizitär sind? Devereux (1967) hat schon früh eine thematische Trias als Grundmuster dieses inhaltlichen Bezugs ge- nannt. Danach findet der Forschungsprozess im Spannungsfeld eines Unter- suchungsfeldes, der Persönlichkeit Forschender sowie der Wissenschaftskultur statt, in die Forschende eingebunden sind (Devereux, 1967). Diese drei Bereiche greifen ineinander, mit der Gemeinsamkeit, dass Regelsysteme, Konfliktfelder und Abwehrmechanismen das Handlungsfeld der Forschenden zu einem Span- nungsfeld werden lassen (Volmerg, 1988).
Institutionen bilden Hintergründe für die Forschenden, die bei der Reflektion nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Nach Knoblauch (2000, S. 631) u. a. wegen der Tendenz zur Institutionalisierung qualitativer Forschung, die verbunden ist mit der Ausbildung von „Schulen“. Die - zu reflektierende - Entscheidung Forschender für ein bestimmtes Verfahren, schon die Bevorzugung eines qualitativen, statt eines quantitativen, fällt vor dem Hintergrund erworbener Einstellungenunddem spezifi- schen Forschungskontext (Devereux, 1967). Selbstverständlich ist darüber hinaus auch die mikropolitische Ebene (Knoblauch, 2000, S.629) von Bedeutung. Über den Einfluss der wissenschaftsinternen Produktionsbedingungen und persönlichen Vorlieben und Abneigungen hinaus können nach den Erfahrungen von Mruck und Mey (2000) inoffizielle Themen für den ganzen Prozess eine Rolle spielen, wie z. B. die Selbstdarstellung im Team. Ein weiteres unumgängliches Thema ist auch in der Forschung die Finanzierungsfrage und damit verbunden Macht sowie Einfluss. Dieser muss dabei nicht unbedingt direkt z. B. in der Bevorzugung quantitativer Fragen durch Geldgeber liegen (vgl. Witt, 1997), sondern kann sich vergleichsweise subtil in der Übernahme eines „gängigen“ Konzeptes oder Modells (mit seinen Kausalbeziehungen und Variablen) entfalten (Mruck & Mey, 1996).
Es stellt sich die Frage, warum sich Forschende kaum mit ihrer eigenen Subjektivi- tät und der Kontextualität des Forschungsprozesses befassen. Zwei Gründe, die generell einer Methodenkontrolle über die Transparenz nicht nur des Gegenstan- des, sondern auch der Forschenden mit ihren Entscheidungen im Forschungspro- zess entgegenstehen können, sind einerseits der Aspekt der Privatheit von Daten und des Datenschutzes und andererseits die Entfernung vom Ziel des Handelns durch unendliche Reflexionsschleifen, die ja ohne Anspruch auf endgültige Wahr- heiten (Mey, 1999, S. 133) auch „nur“ Konstruktionen über Konstruktionen liefern können. Nach dem, was über die Erfüllung des Anspruchs an Reflexivität geäußert wurde, scheint dies jedoch nur partiell eine Erklärung liefern zu können. Auf der persönlichen Ebene sind nach Devereux (1967) Ängste, die durch verhaltenswis- senschaftliche Daten hervorgerufen werden und ihre (als Methodik getarnte) Ab- wehr „...für nahezu alle Mängel der Verhaltenswissenschaften verantwortlich.“ (Devereux, 1967, S. 18). Die Gegenübertragung sei dabei der entscheidende Fak- tor für alle Verhaltenswissenschaften, nicht die Übertragung, „... weil man eine aus der Übertragung ableitbare Information gewöhnlich auch noch auf anderen Wegen gewinnen kann, während das für die Information, die aus der Analyse der Gegen- übertragung hervorgegangen ist, nicht zutrifft.“ (Devereux, 1967, S. 17). Die Ge- fahr liegt in der Ignoranz oder Abwehr dieser Effekte, da sie dann „... zu einer Quelle unkontrollierter und unkontrollierbarer Irrtümer [werden], obwohl sie, wenn man sie ... als elementare und charakteristische Daten der Verhaltenswissenschaf- ten behandelt, gültiger und der Einsicht förderlicher sind als irgendeine andere Art von Datum.“ (Devereux, 1967, S. 18). Im Vorwort zu „ Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften“ (Devereux, 1967) hat Weston La Barre die Bedeutung der Arbeit Devereuxs dahingehend pointiert, dass die zum damaligen Zeitpunkt praktizierte „... Feldethnographie (und in Wirklichkeit jede Sozialwissenschaft) ... ein Form der Autobiographie sein könnte.“ (Devereux, 1967, S. 10). Für die Re- zeption der Erkenntnisse Devereuxs befürchtete er weniger die ihm aus seiner kli- 13 nische Erfahrung geläufige Bestrafung desjenigen, der zur Eigenerkenntnis verhilft und damit auch Angst auslöst, sondern „...eher schlichte Verleugnung und still- schweigende Vernachlässigung ..., die die einfachere Handhabe gegen die emo- tionale Schwierigkeit und die Last dieser Einsicht bieten.“ (Devereux, 1967, S. 12). Heute scheint dies prophetisch, wenn Mruck und Mey (1996) rund 30 Jahre nach dieser Arbeit Devereuxs (1967) den Sozialwissenschaften Rezeptionsdefizite in Bezug auf wissenschaftshistorische und soziologische Arbeiten sowie Berüh- rungsängste gegenüber (ethno-) psychoanalytischen Ansätzen attestieren. Nicht näher beleuchtet hat Devereux (1967) die Einflüsse, die durch die Einbin- dung der Forschenden in eine wissenschaftliche Gemeinschaft entstehen, in wel- cher die Erhaltung der Reputation wichtig ist (Volmerg, 1988) und Handeln natür- lich immer auch ein (Berufs)Rollenhandeln ist (Mruck & Mey, 1996). Neben oder besser im Zusammenhang mit den von ihnen genannten Rezeptionsdefiziten se- hen Mruck und Mey (1996) in der universitären Lehre Vermittlungsdefizite. Diese können zumindest teilweise auf mangelndes Wissen zurückgeführt werden, spe- ziell über den Erkenntnis- und Deutungsprozess (vgl. Devereux, 1967). Die Erwei- terung dieses Prozesswissens könnte auch zur Überwindung der Diskrepanz zwi- schen qualitativer Methodologie und empirischer Forschungsarbeit beitragen (De- vereux, 1967). Dem Vermittlungsdefizit ist zumindest auch ein Beitrag zur Tradie- rung von Tabus in diesem Bereich anzulasten, zugleich ist die Entmutigung von Forschern beim Versuch sich mit der eigenen Subjektivität und Kontextualität aus- einander zu setzen sowie das geringe Wissen um die Überlegungen anderer zum gleichen Thema, eng damit verknüpft (Mruck & Mey, 1996).
Neben den genannten persönlichen Aspekten, die verbunden sind mit dem Kon- text Wissenschaftskultur und speziell Institutionen, wie z. B. den Universitäten, sind weitere intra- und interpersonale Einflussfaktoren ins Kalkül zu ziehen. Zu ers- teren zählen u .a. Motive, Neigungen, Kommunikationsstile (Steinke, 2000, S. 330) und Herangehensweisen, die auch für die Dynamik eines (Forschungs- )Teams interpersonal eine Rolle spielen. In diesem können sich Probleme auf zwei Ebenen auswirken, zum einen direkt auf den Forschungsprozess mit seinen Er- gebnissen, zum anderen meta dazu in der Ver- oder Behinderung der Reflexion eben dieser Probleme im Team während der Forschungsarbeit (Mruck & Mey, 1996). Devereux (1967, S. 49) führt als einen Grund für solche Vermeidungshal- tungen an, dass „ ... wir uns selber und unseren Reiz-Wertnicht kennen, ... und auch nicht kennen lernen wollen.“. Devereux stellt dabei den hohen Anspruch, nicht nur der Kenntnis des spezifischen Reiz-Werts und dessen Berücksichtigung 14 bei der Einschätzung der Daten, sondern der Forscher „...muß zudem fähig sein, in der beobachteten ... oder der Interviewsituationüber diese Kenntnisseines spezifischen Reiz-Wertsfrei zu verfügen.“ (Devereux, 1967, S. 50). Eine Möglichkeit sich mit der eigenen Persönlichkeit und ihren Wahrnehmungs- und Beurteilungspräferenzen auseinander zu setzen, wird im folgenden mit der Typenlehre C.G. Jungs diskutiert - vielleicht unter einem geringeren Anspruch als ihn Devereux formulierte, aber mit dem Vorteil einer leichteren Zugänglichkeit.
5. Die Typenlehre von C.G. Jung als Zugangsmöglichkeit zu (eigenen) Wahr- nehmungs- und Beurteilungspräferenzen
Die Annäherung an den Einfluss der Persönlichkeit kann auf ebenso vielen Wegen erfolgen, wie es Persönlichkeitstheorien und -modelle gibt (vgl. Pervin, 1993). Auch die Persönlichkeitspsychologie hat noch nicht das Stadium des wissen- schaftlichen Fortschritts erreicht, das es erlauben würde ein universelles Paradig- ma zu nutzen, ebenso wenig, wie es wissenschaftlich gerechtfertigt wäre eine Po- sition auszuwählen und vorzuziehen (Pervin, 1993, S. 38). „Letztendlich sind The- orien nicht wahr oder falsch, sondern nützlich oder nutzlos.“ (Pervin, 1993, S. 36). Die jungsche Typenlehre, als „... deduktive Darstellung empirisch gewon- nener Einsichten.“ (Jung, 1925, S. 9) erscheint für die erläuterte Problematik als einnützlicher Zugang, dessen Kernaspekte in diesem Kapitel verdeutlicht werden. Jung sah seine Typologie als notwendige Beschränkung angesichts der Vielfalt seiner Beobachtungen, wohl wissend, dass es ihm nicht möglich sein würde von der menschlichen, psychologischen Reaktion „... ein absolut richtiges Bild ... zu geben.“ (Jung, 1925, S. 9). Er war jedoch überzeugt, einen klärenden Beitrag zu leisten für alle Wissenschaften (nicht nur die Psychologie), besonders aber für die persönlichen Beziehungen (Jung, 1925, S. 9).
Jung unterscheidet zwei Einstellungstypen, introvertiert und extrovertiert, die sich durch die Richtung ihres Interesses unterscheiden (Jung, 1925, S. 473) sowie vier Funktionstypen, „...deren Eigenart dadurch zustande kommt, daß das Individuum sich hauptsächlich mittels der bei ihm am meisten differenzierten Funktion anpaßt oder orientiert.“ (Jung, 1925, S. 473). Diese sind Denken, Fühlen, Empfinden und Intuition, die mit den Einstellungstypen kombiniert acht Haupttypen ergeben. Wäh- rend Jung nur vermuten konnte, dass für die individuelle Disposition „...in letzter Linie physiologische Gründe in Frage kommen ...“ (Jung, 1925, S. 477), gilt für Extroversion und Introversion, dass „...today the physiological foundations ... are known.“ (Benziger, 1999a). Ebenso ist man sich inzwischen 15 recht sicher „... about the physiology of Jung’s four functions ...“ (Benziger, 1999b).
Ein (nie reiner) Typus entsteht durch das chronische Überwiegen einer Einstellung sowie einer Grundfunktion, bedingt durch Disposition und Umstände. Einstellung und Funktion werden aus der bewussten Sicht des Subjektes zugeordnet. Die ent- sprechend unbewussten werden im Verhalten jedoch ebenfalls (kompensatorisch) wirksam).
Jeder Mensch verfügt über beide Mechanismen, Extroversion und Introversion, sie sind Teil seines natürlichen Lebensrhythmus (Jung, 1925, S.11). Subjekt - Objekt - Beziehungen sind immer Anpassungsverhältnisse, die Einstellungen zum Objekt Anpassungsprozesse (Jung, 1925, S. 475). Die Art der Orientierung an Daten der Umwelt ist dabei jedoch unterschiedlich bei beiden Einstellungen (Jung, 1925, S. 478). Bei der Introversion ist das Ich und der subjektive psychologische Vorgang dem Objekt übergeordnet, wohingegen nach der extravertierten Position das Subjekt „... denkt, fühlt und handelt, ... wie es den objektiven Verhältnissen und ihren Anforderungenunmittelbarentspricht ...“ (Jung, 1925, S. 478). Damit folgen auch Interesse und Aufmerksamkeit den objektiven Vor- kommnissen (Jung, 1925, S. 479). „Der eine sieht alles unter dem Gesichtswinkel seiner Auffassung, der andere unter dem des objektiven Geschehens.“ (Jung, 1925, S. 11).
Aus einer physiologischen Perspektive wird nach Denziger (1999a) extro- oder introvertiertes Verhaltens genutzt, um die Reiz-/Informationsaufnahme zu steuern, in Abhängigkeit eines spezifischen angeborenen Erregungslevels. Je höher dieser ist, desto höher ist die Informationsaufnahme (in der gleichen Situation) und desto mehr muss diese durch introvertiertes Verhalten limitiert werden. Dabei kann in Anpassung an individuelle extreme Reizüberflutung oder -mangel ein genotypisch Extrovertierter auch als introvertiert erscheinen und umgekehrt.
Jung unterscheidet die Urteilsfunktionen Denken und Fühlen sowie die Wahr- nehmungsfunktionen Empfinden und Intuition. Eine dieser vier Funktionen prägt das bewusste individuelle Verhalten am stärksten, eine (maximal zwei) haben Hilfsfunktion, während die vierte jeweils am schwächsten ausgeprägt ist. Diese schwächste Funktion ist bei einer primären Urteilsfunktion (bzw. Wahr- nehmungsfunktion) immer die zweite Urteilsfunktion (bzw. Wahrnehmungs- funktion) (Jung, 1925).
Nach den vier möglichen primären Funktionen ergeben sich vier Funktionstypen: Beim Denktypus basiert das Verhalten wesentlich auf intellektuellen Schlüssen. Basis des Urteils ist die Konsistenz bei Ein- und Zuordnung unter eine intellektuel- le Formel, die nicht nur ein logisches, sondern z. B. auch ein Wertsystem sein kann. In einer übermäßigen Ausprägung unterliegt der Denktypus, bedingt durch den Einfluss des kompensatorischen Unbewussten, der Gefahr der Irrationalität in der rigiden, archaischen Verabsolutierung seiner Formel (Jung, 1925). Der Fühltypus handelt bewusst primär auf der Grundlage von Werten. Bei Extra- version folgen die Bewertungen „... entweder direkt den objektiven Werten oder wenigstens gewissen traditionellen oder allgemein verbreiteten Wertmaßstäben.“ (Jung, 1925, S. 510).
Das Verhalten des Empfindungstypus ist in erster Linie von sinnlich Erfassbarem determiniert. Bei starker Extroversion ist der subjektive Anteil des Empfindens ge- hemmt oder verdrängt: Kriterium des Wertes der Objekte und ihrer Aufnahme in das Bewusstsein ist allein die durch objektive Eigenschaften bestimmte Empfin- dungsstärke, nicht ein Vernunfturteil. Dieser Typus ist sehr realistisch und prak- tisch, Denken und Fühlen werden auf Objekteinflüsse reduziert, Ideen-Ideale sind nicht entscheidend. Das Empfinden ist jedoch, wie die Intuition, ein aktiver gestal- tender Vorgang (Jung, 1925).
Das Verhalten des intuitiven Typus ist vor allem durch die Wahrnehmung von Chancen, Zusammenhängen und die Ahnung des Zukünftigen bestimmt. Bei Extraversion erlangen nicht, wie bei der ebenfalls empirischen Empfindungsfunktion die Objekte den Hauptwert, die physiologisch die stärksten Empfindungen auslösen, sondern (unbewusst) andere. Es dominiert daher nicht die Tatsächlichkeit, sondern die Möglichkeit und das Beginnende (Jung, 1925).
Die Typologie Jungs konnte hier nur kurz skizziert werden, der mögliche Nutzen im Kontext der aufgezeigten Problematik wird im folgenden diskutiert.
6. Mögliche Konsequenzen für qualitative Forschung
Es konnte gezeigt werden, dass es zulässig ist die Frage der Reflexivität in Bezug auf „die“ qualitative Forschung zu stellen. Reflexivität als Anspruch und (Teil)Kriterium von Qualität wird methodologisch überwiegend bejaht. Das konse- quent anschließende Hinterfragen des Einflusses der eigenen Subjektivität und der Kontextualität von Forschung wird in praxi jedoch nur unzureichend umgesetzt (vgl. Mruck & Mey, 1996). Zur Frage, was getan werden kann und muss, ist zu- nächst die Veränderung des tatsächlichen Verständnisses ein Ansatzpunkt. Über methodologische Bekenntnisse hinaus ist die Unhaltbarkeit einer naturalistischen Position zu akzeptieren, die glaubt in einem entsubjektivierten, angst- und stö- rungsfreien Prozess soziales Verhalten so abzubilden, wie es „wirklich“ ist (vgl. Devereux, 1967; vgl. Mruck & Mey, 1996). Versuche der Filterung „... verrü- cken nur leicht den Ort der Trennung zwischen Objekt und Beobachter und schie- ben den exakten Moment, in dem das subjektive Element in Form der Entschei- dung) interveniert, hinaus.“ (Devereux, 1967, S. 19). Die Akzeptanz, dass „Störun- gen“ normal und die Regel sind, ist auch die Voraussetzung dafür, in ihnen wert- volle Quellen für Informationen zu sehen, die kaum anderes zu gewinnen sind (Devereux, 1967). Wie jedoch verändert man das Verständnis Forschender? Ein wesentlicher Punkt scheint mir in der Interdisziplinarität von Forschung und Lehre zu liegen, zur Überwindung von Rezeptionsdefiziten und der Integration fachspezi- fischer Erkenntnisse in Methodologie und Praxis qualitativer Forschung. Zusam- men mit dem ebenfalls notwendigen Abbau des Vermittlungsdefizits an den Hoch- schulen könnte damit eine Beitrag zur Enttabuisierung von Subjektivität und Kon- textualität geleistet werden. Weiterhin hilfreich wäre Forschungssupervision, die aber häufig nicht finanzierbar sein wird; gerade dann bietet sich die Bildung kolle- gialer Supervisionsgruppen als zusätzliche Möglichkeit an (Mruck & Mey, 1996). Die bei der Supervision gewonnenen methodologischen Erkenntnisse könnten wiederum der Überwindung der Kluft zwischen Methodologen und Empirikern dienen (vgl. Devereux, 1967).
7. Diskussion
In Bezug auf die Persönlichkeit der Forschenden führt das Wissen, dass ein stö- rungsfreier, normierter Forschungsprozess nicht nur illusorisch ist, sondern zugleich der Gefahr der Irrelevanz anheim fällt (Berger, 1985) zu dem Schluss, dass die Einforderung bestimmter Persönlichkeitszüge als Bedingung von Er- kenntnis nicht zu rechtfertigen ist (vgl. Berger, 1985). Der Verbesserung der Selbstkenntnis kommt daher für die Reflexion des Einflusses der Persönlichkeit besondere Bedeutung zu. Die Typenlehre von C. G. Jung bietet dafür einen mög- lichen Ansatz. Es scheint angesichts der Basierung wissenschaftlicher Methoden in den Alltagsmethoden (Kleining, 1995) nicht verwunderlich, wenn die grundlegen- den Mechanismen Extroversion und Introversion (Jung, 1925) auffallende Paralle- len mit den Forschungsstrategien Induktion und Deduktion (vgl. Strauss, 1994) aufweisen. Die vier Funktionstypen machen verständlich, dass gleiche Situationen anders wahrgenommen und beurteilt werden (Jung, 1925), ohne dass dabei das 18 „richtige“ Verhalten benannt werden könnte. Diese Präferenzen wirken sich aber nicht nur direkt z. B. in einer Interviewsituation aus, sondern beeinflussen ebenso die Beziehungen in einem Forschungsteam und damit Forschungsprozess und - ergebnis.
Neben anderen Möglichkeiten, wie Forschungssupervision, ist das jungsche Modell eine Möglichkeit sich mit dem Einfluss der eigenen Subjektivität auseinander zu setzen - ohne dadurch dem Hochmut zu verfallen, dies Verdikt Jungs (1925, S. 18) aufheben zu können: „In wissenschaftlicher Theorie- und Begriffsbildung liegt viel von persönlicher Zufälligkeit.“
Literaturverzeichnis
- Benziger, Katherine, 1999a: The Physiology of Type. Part 1 The Physiology of Jung’s Extraversion, http://www.cgjungpage.org/articles/typereading1.html [05.02.2002]
- Benziger, Katherine 1999b: The Physiology of Type. Part 2 The Physiology of Jung’s Four Functions & Their Organization http://www.cgjungpage.org/articles/typereading2.htm [05.02.2002]
- Bergold, Jörg & Breuer, Franz 1992: Zum Verständnis von Gegenstand und For- schungsmethoden in der Psychologie. In: Journal für Psychologie, 1/1 1992, S. 24 - 35
- Berger, Hartwig 1985: Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit. König- stein/Ts.: Athenäum
- Breuer, Franz & Reichertz, Jo 2001: Wissenschafts-Kriterien: Eine Moderation [40 Ab- sätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 2(3). Verfügbar über: http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs.htm [28.03.2002]
- Chenail, Ronald J. 1992: Qualitative Research: Central Tendencies and Ranges, The Qualitative Report, Volume 1, Number 4, Fall, 1992. Verfügbar über: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR1-4/tendencies.html [20.03.202]
- Devereux, George 1967: Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften. Mün- chen: Hanser
- Flick, Uwe & Kardorff, Ernst v. & Steinke, Ines (Hrsg.) 2000: Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Hamburg: Rowohlt
- Flick, Uwe & Kardorff, Ernst v. & Steinke, Ines 2000: Was ist qualitative Forschung?. Einleitung und Überblick. in: Flick, Uwe & Kardorff, Ernst v.& Steinke, Ines (Hrsg.) 2000: Qualitative Forschung. Hamburg: Rowohlt: S. 13 - 29
- Froschauer, Ulrike 1998: Das qualitative Interview zur Analyse sozialer Systeme. Wien: WUV-Universitäts-Verlag
- Heinze, Thomas 1995: Qualitative Sozialforschung. Erfahrungen, Probleme und Perspektiven. Opladen: Westdeutscher Verlag
- Jung, Carl Gustav 1925: Psychologische Typen. Zürich: Rascher
- Kleining, Gerhardt 1995: Qualitativ-heuristische Sozialforschung. Schriften zur Theorie und Praxis. Hamburg: Fechner S. 12 - 46. Verfügbar über: http://www.rrz.uni-hamburg.de/psych-1/witt/Archiv/ringvorlesung%2096/umriss.html [20.11.2001]
- Knoblauch, Hubert 2000: Zukunft und Perspektiven qualitativer Forschung. in: Flick, Uwe; Kardorff, Ernst v.; Steinke, Ines (Hrsg.) 2000: Qualitative Forschung. Ham- burg: Rowohlt: S. 623 - 632
- Lamnek, Siegfried 1988: Qualitative Sozialforschung. Band 1. Methodologie. Mün- chen: Psychologie Verlags Union
- Leithäuser, Thomas & Volmerg, Birgit (Hrsg.) 1988: Psychoanalyse in der Sozialfor- schung. Opladen: Westdeutscher Verlag
- Lüders, Christian 2000: Herausforderungen qualitativer Forschung. in: Flick, Uwe & Kardorff, Ernst v. & Steinke, Ines (Hrsg.) 2000: Qualitative Forschung. Hamburg: Rowohlt: S. 632 - 642
- Lüders, Christian & Reichertz, Jo 1986: Wissenschaftliche Praxis ist, wenn alles funk- tioniert, und keiner weiß warum - Bemerkungen zur Entwicklung qualitativer Sozial- forschung. In: Sozialwissenschaftliche Literaturrundschau, 12, S. 90 - 102
- Mayring, Phillip 1999: Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zum qualitativen Denken. Weinheim: Psychologie Verlags Union
- Mey, Günter 1999: Adoleszenz, Identität, Erzählung. Berlin: Köster
- Mruck, Katja unter Mitarbeit von Mey, Günter 2000: Qualitative Sozialforschung in Deutschland [54 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(1). Verfügbar über: http://qualitative-research.net/fqs/fqs.htm [14.01.2002]
- Mruck, Katja & Mey, Günter 1996: Überlegungen zu qualitativer Methodologie und qualitativer Forschungspraxis. Forschungsberichte aus dem Institut für Psychologie der TU Berlin. 96-1. Verfügbar über: http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at:4711/LEHRTEXTE/Lehrtexte.html [08.03.2002]
- Pervin, Lawrence A. 1993: Persönlichkeitstheorien. München: Reinhardt
- Reichertz, Jo 2000: Zur Gültigkeit von Qualitativer Sozialforschung. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1(2). Ver- fügbar über: http://qualitative-research.net/fqs/fqs.htm [04.01.2002]
- Steinke, Ines 2000: Gütekriterien qualitativer Forschung. in: Flick, Uwe & Kardorff Ernst v.& Steinke, Ines (Hrsg.) 2000: Qualitative Forschung. Hamburg: Rowohlt: S. 319 - 331
- Strauss, Anselm L. 1994: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. München: Fink
- Vester, Frederic 1999: Die Kunst vernetzt zu denken: Ideen und Werkzeuge für einen neuen Umgang mit Komplexivität. Stuttgart: DVA
- Volmerg, Birgit 1988: Erkenntnistheoretische Grundsätze interpretativer Sozialfor- schung in der Perspektive eines psychoanalytisch reflektierten Selbst- und Fremdverstehens In: Leithäuser Thomas & Volmerg, Birgit (Hrsg.) 1988: Psychoanalyse in der Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. S. 131 - 179
- Wagner, Andreas & Niederberger, Andreas ohne Jahr: Modellbau -Probleme einer reflexiven Sozialtheorie zwischen Philosophie und Politik. Verfügbar über: http://www.gradnet.de/pomo2.archives/pomo2.papers/niewag00.htm [15.02.02]
- Witt, Harald 1997: Welche Forschung ist normal oder wie normal ist qualitative Sozial- forschung?. Verfügbar über: http://www.rrz.uni-hamburg.de/psych-1/witt/Archiv/ringvorlesung%2096/rvtxt4.html [10.01.2002]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Arbeit und welche formalen Aspekte werden behandelt?
Das Ziel der Arbeit ist die Untersuchung von Subjektivität und Reflexivität in der qualitativen Forschung. Es wird geklärt, ob Reflexivität als Anspruch formuliert und empirisch umgesetzt werden kann. Die Arbeit beschäftigt sich mit diesem Anspruch, seiner methodologischen Verortung sowie Erfüllung in der Praxis. Formale Aspekte umfassen Zitierweisen, insbesondere bei Internetquellen, und die Verwendung geschlechtergerechter Sprache.
Welche Rolle spielt die qualitative Forschung im Kontext von "Subjektivität" und "Reflexivität"?
Die qualitative Forschung wird als ein Feld betrachtet, in dem Subjektivität nicht als Mangel, sondern als Erkenntnismöglichkeit angesehen wird. Die Arbeit untersucht, ob die Heterogenität des Forschungsfeldes eine Diskussion über Reflexivität im Bezug auf "die" qualitative Forschung erlaubt. Es werden die Entwicklung der qualitativen Forschung, ihre Prinzipien (Fremdheitspostulat, Offenheit, Kommunikation) und die Rolle der Reflexivität als Kennzeichen und Anforderung beleuchtet.
Welche Gütekriterien sind für die qualitative Forschung relevant?
Es wird diskutiert, ob und welche Gütekriterien in der qualitativen Forschung verwendet werden können oder dürfen. Die Arbeit betrachtet verschiedene Positionen (postmoderne Ablehnung von Kriterien, Nutzung quantitativer Kriterien, spezielle Kriterien für qualitative Forschung) und ordnet das Spektrum genutzter Kriterien. Das Kernkriterium der reflektierten Subjektivität wird hervorgehoben.
Wie ist der Stand der Reflexivität als Anspruch in der qualitativen Forschung? Welche Inhalte und Ursachen werden betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die Umsetzung des Anspruchs Reflexivität in der Praxis qualitativer Forschung. Es werden Defizite in der Reflexion der Persönlichkeit der Forschenden und der Kontextualität des Forschungsprozesses aufgezeigt. Devereux' thematische Trias (Untersuchungsfeld, Persönlichkeit Forschender, Wissenschaftskultur) wird betrachtet. Es werden Gründe für die mangelnde Reflexion (Ängste, Abwehr, Rezeptionsdefizite, Vermittlungsdefizite) sowie intra- und interpersonale Einflussfaktoren analysiert.
Wie kann die Typenlehre von C.G. Jung als Zugang zu eigenen Wahrnehmungs- und Beurteilungspräferenzen dienen?
Die Typenlehre von C.G. Jung wird als eine Möglichkeit zur Annäherung an den Einfluss der Persönlichkeit auf den Forschungsprozess vorgestellt. Die Kernelemente der Typenlehre (Einstellungstypen: introvertiert, extrovertiert; Funktionstypen: Denken, Fühlen, Empfinden, Intuition) werden erläutert und ihr potenzieller Nutzen im Kontext der aufgezeigten Problematik diskutiert.
Welche Konsequenzen ergeben sich für die qualitative Forschung aus den Erkenntnissen dieser Arbeit?
Es wird festgestellt, dass eine Veränderung des tatsächlichen Verständnisses von Forschung notwendig ist. Die Unhaltbarkeit einer naturalistischen Position wird betont. Interdisziplinarität, Abbau von Vermittlungsdefiziten, Forschungssupervision und kollegiale Supervisionsgruppen werden als mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Reflexivität in der qualitativen Forschung genannt.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Diskussion gezogen?
Es wird betont, dass die Einforderung bestimmter Persönlichkeitszüge als Bedingung von Erkenntnis nicht zu rechtfertigen ist. Die Selbstkenntnis wird als besonders wichtig für die Reflexion des Einflusses der Persönlichkeit hervorgehoben. Die Typenlehre von C.G. Jung wird als ein möglicher Ansatz zur Auseinandersetzung mit der eigenen Subjektivität präsentiert. Es wird darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Theorie- und Begriffsbildung immer auch von persönlicher Zufälligkeit geprägt sind.
- Citar trabajo
- Lars Temme (Autor), 2002, Reflexivität - Kennzeichen und Anspruch qualitativer Forschung - Problematisierung unter besonderer Berücksichtigung der Typenlehre von C.G. Jung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106768