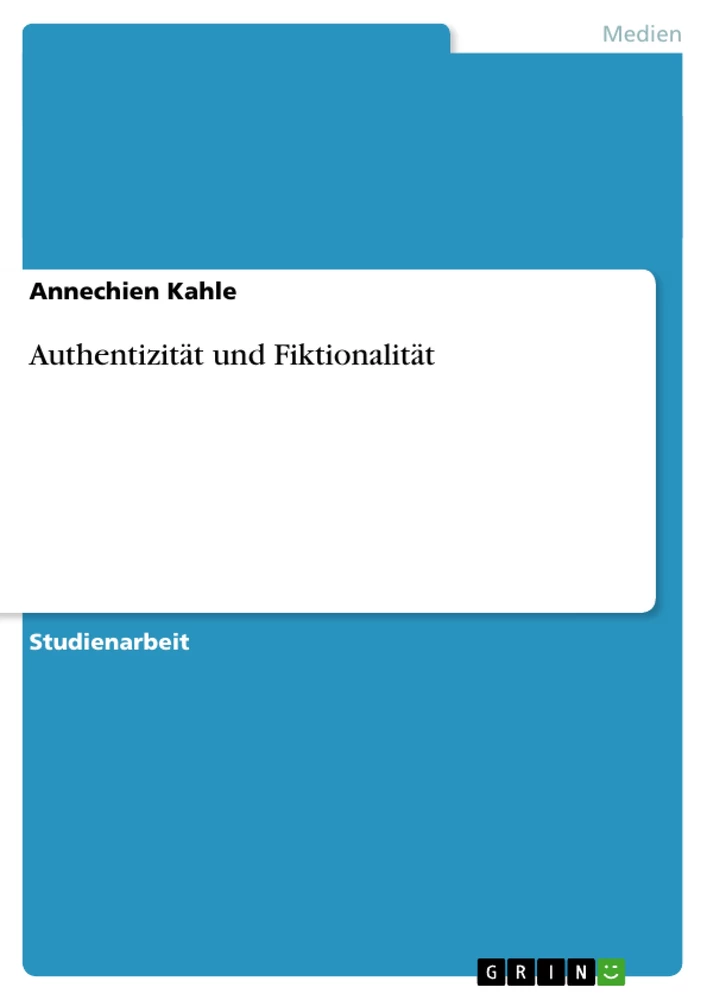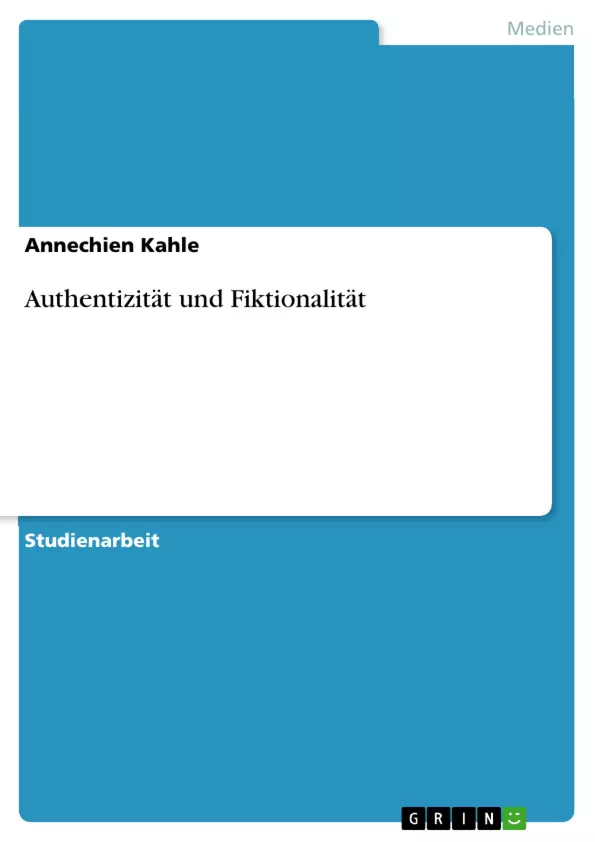In der Welt des Films, wo Bilder Geschichten erzählen und Emotionen wecken, verschwimmen oft die Grenzen zwischen Realität und Illusion. Aber was macht einen Film wirklich glaubwürdig? Diese Frage steht im Zentrum einer faszinierenden Auseinandersetzung mit den Begriffen Authentizität und Fiktionalität im filmischen Kontext. Die Analyse dringt tief in die Materie ein, um zu ergründen, wie wir als Zuschauer entscheiden, was echt und was inszeniert ist. Dabei wird ein differenziertes Bild von Authentizität gezeichnet, das weit über die bloße Abbildung der Realität hinausgeht. Es geht um die Glaubwürdigkeit, die ein Film vermittelt, unabhängig davon, ob er auf wahren Begebenheiten beruht oder einer reinen Erfindung entspringt. Die Untersuchung beleuchtet die subtilen Mechanismen, durch die Filmemacher unsere Wahrnehmung lenken und uns dazu bringen, in ihre Welten einzutauchen. Von Dokumentarfilmen, die den Anspruch erheben, die Wahrheit abzubilden, bis hin zu Spielfilmen, die uns in fantastische Gefilde entführen, wird die Rolle der Authentizität in all ihren Facetten erkundet. Der Leser wird auf eine erkenntnisreiche Reise mitgenommen, die sein Verständnis von Film und seiner Wirkung auf uns nachhaltig verändern wird. Es wird hinterfragt, wie der "Wahrnehmungsvertrag" zwischen Film und Zuschauer geschlossen wird und welche Rolle unser eigenes Wissen und unsere Erwartungen dabei spielen. Welche Strategien nutzen Filmemacher, um Authentizität zu erzeugen? Wie beeinflusst die subjektive Wahrnehmung die Bewertung eines Films? Und wie gehen wir mit der Tatsache um, dass auch Dokumentarfilme nicht frei von Manipulation sind? Diese Fragen werden anhand von konkreten Beispielen und theoretischen Überlegungen erörtert, um ein umfassendes Bild der komplexen Beziehung zwischen Authentizität, Fiktionalität und der Macht des Films zu zeichnen. Eine Analyse für Filmliebhaber, Medieninteressierte und alle, die sich fragen, wie viel Wahrheit in der Illusion steckt. Die Filmanalyse bietet einen neuen Blickwinkel auf die Filmtheorie, Filmwissenschaft und die generelle Medienwirkungsforschung, insbesondere im Bereich der Dokumentation, Reportage und Spielfilme. Tauchen Sie ein in die Welt von Hollywood, Independent Filmen und Klassikern.
Herstellung eines Kletterbaumes
Einleitung
Das Referat handelt - wie der Titel schon sagt - von den Begriffen Authentizität und Fiktionalität, die, auf diese Weise nebeneinandergestellt, Gegensätze zu bilden scheinen.
Auch scheint es, als verstünde man intuitiv die Bedeutung beider Wörter - vor allem in bezug auf das Medium Film.
Bei näherer Betrachtung beider Fremdwörter, besonders bezüglich des Films, tritt jedoch zutage, dass es sich um Bezeichnungen unterschiedlicher Bereiche handeln muss, denn der auffälligste Gedanke dabei ist, dass auch eine zur Gänze ausgedachte - also fiktive - Film-Geschichte intuitiv durchaus authentisch erscheinen kann - z.B. eine Tatort-Folge.
Deshalb und um Verwirrung zu vermeiden, beginnt das Referat mit der allgemeinen Klärung beider Begriffe.
1. Allgemeine Klärung der Begriffe Authentizität und Fiktionalität
Die Brockhaus Enzyklopädie definiert die Begriffe allgemein:
authentisch [von grch. authentes >Urheber<], verbürgt, echt, zuverlässig; z.B. solche Schriftstücke, die wirklich unter den vom Verfasser oder in der Überlieferung behaupteten Umständen geschrieben sind, im Gegensatz zu untergeschoben; sie besitzen Authentie oder Authentizität, d.h. Echtheit.
Fiktion [lat.], Erdichtung, erdichtete Annahme.
[Brockhaus Enzyklopädie, 17. Auflage, Zweiter Band ATF - BLIS und Sechster Band F - GEB, F.A. Brockhaus Wiesbaden 1967]
Für den Film ergeben sich zwei Möglichkeiten für Authentizität:
(1)'Authentisch' bezeichnet die objektive 'Echtheit' eines der filmischen Abbildungen zugrundeliegenden Ereignisses. Mit dem Verb ü rgen eines Vorfalls als authentisch wird impliziert, da ß eine Sache sich so ereignet hat, ohne da ß die filmische Aufnahme den Proze ß beeinflu ß t h ä tte. Die Authentizit ä t liegt in der Quelle begr ü ndet.
[M. Hattendorf, S. 67]
Das heißt also, dass es um ein echtes und weder von der Kamera selbst noch von den Leuten dahinter verfälschtes Ereignis geht, dass so als authentisch bezeichnet wird. Die Echtheit basiert dann darauf, dass es so passiert, ob mit oder ohne Kamera. Zum Beispiel geht die Sonne jeden Abend unter bzw. jeden Morgen auf - ob mit oder ohne Kamera.
(2)Authentizit ä t ist ein Ergebnis der filmischen Bearbeitung. Die 'Glaubw ü rdigkeit' eines dargestellten Ereignisses ist damit abh ä ngig von der Wirkung filmischer Strategien im Augenblick der Rezeption. Die Authentizit ä t liegt gleicherma ß en in der formalen Gestaltung wie der Rezeption begr ü ndet.
[M. Hattendorf, S. 67]
Hier wird etwas glaubwürdig gemacht, damit man als Zuschauer den Eindruck von 'Echtheit' hat. Der Eindruck des 'Echten' basiert auf der Glaubwürdigkeit, die durch bestimmte filmische Mittel produziert wird.
Zum Beispiel durch Einblenden von Orts- und Zeitangaben, die - abgesehen von anderen Effekten - die Illusion einer Berichterstattung fördern.
Ein anderes Beispiel für die Produktion von Authentizität sind verwackelte Bilder, die den Eindruck eines sogenannten Homevideos erwecken - wie z.B. der Film „Blair Witch Project“.
Die erste Definition steht für sich allein, weil sie auf das zufällige Beobachten und Abbilden ungestellter Situationen oder Ereignisse abzielt.
Die zweite Definition schließt die erste mit ein, denn hier kann es sich genauso um Beobachtungen wie um beeinflusste, gestellte, inszenierte - sprich fiktive Ereignisse handeln.
Man kann sehen, dass sich nach diesen Definitionen Authentizität und Fiktion nicht gegenseitig ausschließen, weil sie eigentlich auch nicht richtige Gegensätze bilden.
2. Unterscheidung zweier Filmtypen:
Gegenüber stehen sich laut Siegfried Kracauer zwei Filmtypen:
"Die zwei allgemeinsten Filmtypen sind der Spielfilm und der Film ohne Spielhandlung." [Kracauer 1973, S. 237. In: Knut Hickethier, Film- und Fernsehananlyse, 3. Auflage, Weimar 2001]
Kracauer hat eine Unterscheidung durch das Spiel getroffen, also durch die Inszenierung einer Situation, Geschichte oder eines Geschehens.
Der erste Typ dürfte klar sein, zum zweiten gehören Dokumentarfilme, Reportagen etc. Diese Unterscheidung ist jedoch problematisch, da im Film ohne konkrete Handlung ebenso Inszenierung vorkommen kann, wie im fiktionalen Film Elemente aus der Wirklichkeit auftreten.
In beiden Fällen spielt aber die Authentizität eine große Rolle.
So möchte der Zuschauer einer Reportage davon überzeugt sein, dass das Gezeigte echt bzw. wahr ist.
Der Zuschauer eines Spielfilms möchte davon überzeugt werden und erwartet, dass das Gezeigte unter bestimmten Umständen echt sein könnte.
3. Der "Wahrnehmungsvertrag" filmischer Authentizität
(Siehe dazu Abb.1 „Der Wahrnehmungsvertrag filmischer Authentizität“)
Abb. 1:
Wahrnehmungsvertrag filmischer Authentizität
[M. Hattendorf, S. 76]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Oben beschriebenes ist vergleichbar mit einem Vertragsabschluß zwischen Käufer und Verkäufer. Käufer ist der Zuschauer, Verkäufer ist eine ordnende Instanz, die hinter dem Film steht (Produzent, Filmteam, Drehbuchautor, etc.).
Der Zuschauer/Käufer ist interessiert, weil der Film signalisiert, 'authentisch' bzw. glaubwürdig zu sein. Es findet also ein ‚Verkaufsversprechen’ statt.
Es kommt zu einem Vertragsabschluß:
Zuschauer: "Ja, ich sehe mir den Film an, solange er glaubwürdig ist."
Das heißt, der Zuschauer bleibt solange treu, wie er die filmische Authentizität durch sein eigenes Kontext- und Gattungswissen positiv überprüfen kann.
Dieser Vertrag wird eigentlich auf den Dokumentarfilm bezogen, ich habe dieses Bild jedoch erweitert, weil ich der Meinung bin, dass es sich allgemein auf den Film beziehen kann.
Beispiel:
Im Wissen des Genres des Filmes erwartet der Zuschauer z.B. von „Star Wars“, dass die technische Entwicklung weit fortgeschritten ist und wenn nicht, dann eine Begründung dafür.
Im Gegensatz dazu erwartet er von dem Film „Ben Hur“ das Gegenteil.
Die Glaubwürdigkeit wäre restlos verloren, würde Ben Hur mit einer Strahlenkanone die konkurrierenden Wagen aus dem Rennen schicken.
Die Glaubwürdigkeit, ob nun im Spielfilm oder im Dokumentarfilm, hängt also von ihrem Bezug zu der Welt außerhalb der Kamera ab.
So kann ein Dokumentarfilm nur einen Ausschnitt aus der (bekannten) Wirklichkeit darstellen, während ein Spielfilm in eine konstruierte aber mögliche Wirklichkeit eingebettet ist.
4. Film in Bezug zur Realität und die Schwierigkeiten damit
Der Bezug zur äußeren Welt muss - wie jeder intuitiv weiß - bei einem nicht-fiktionalen Film anders sein als bei einem Spielfilm.
Der Begriff des Dokumentarfilms kommt von der Ableitung des lateinischen Wortes "documentum" mit der Übersetzung "Beweis".
Als Antwort auf die Frage, was denn der Dokumentarfilm "beweisen" soll, gibt Manfred Hattendorf die Realit ä t an.
Die Realität gibt es aber - philosophisch betrachtet - so nicht.
Sie ist nämlich sowohl subjektiv als auch objektiv gegeben und verschiedentlich interpretierbar und auch -bedürftig.
Dokumentarfilme sind demnach Beweise von Thesen, die eine Argumentation st ü tzen. Dies ist dem Zuschauer wohl in dieser Form nicht bewusst, aber darauf basiert eine Erwartung, die wahrscheinlich auch nicht so ausformuliert im Zuschauerkopf herrscht, doch intuitiv in dem Vertrag zwischen Zuschauer und Dokumentarfilm-Macher verzeichnet ist - darauf komme ich im Folgenden zur ü ck.
In Abb. 2 zeigt sich schematisch der Bezug eines Dokumentarfilms - bzw. Film der Kategorie „ nicht-fiktiv “ - zur Wirklichkeit und die Problematik, die damit verbunden ist:
Zunächst die Begriffe:
In dem Schema werden in fünf Punkten verschiedentliche Realitäten genannt: unter 1*) die vermutete Realität, also das, was der Zuschauer glaubt, in diesem Film von der Wirklichkeit zu sehen.
Diese Vermutung vergleicht er mit 1), der nichtfilmischen Realität.
Das ist der Zustand der Wirklichkeit, nur ohne Kamera, Film und den Leuten, die den Film bearbeiten.
2) Die vorfilmische Realität - die Wirklichkeit bevor der Film vollendet ist - wird mit 1) intentional (zielgerichtet) verknüpft, das heißt Kamera und Filmteam sind bereits da und arbeiten. Diese Realität befindet sich bereits auf Filmband, was bedeutet, dass sie zeitlich und räumlich von 1) getrennt ist.
Unter 3) - der Realität Film - verstehe ich, dass hier der Film von der Realität, also 2), bearbeitet wird. Hier werden die Sequenzen ausgesucht und zusammengesetzt, geschnitten usw.
Die filmische Realität 4) ist schließlich der fertige Film, den sich der Zuschauer anguckt. Diese Wirklichkeit ist durch den Produktionsprozess zeitlich und räumlich weit von 1. entfernt.
Ihr folgt der 5. und m.E. schwierigste Punkt - die Nachfilmische Realität 5). Nach meinem Verständnis benennt dieser Punkt die Wirkung des Films auf den Zuschauer:
- hat der Film den "Vertrag" erfüllt?
- ist er mit den Erfahrungswerten vergleichbar?
- etc.
Hier zeigt sich die Verbindung mit Punkt 1*).
Abb. 2:
Dokumentarfilm und Wirklichkeit
[M. Hattendorf, S.49]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Nun ist in dem ungeschriebenen Vertrag zwischen Zuschauer eines Dokumentarfilms und dessen Macher verzeichnet, dass die Möglichkeit bestehen muss bzw. sollte, das Gesehene nachzuprüfen.
Die Schwierigkeit liegt nun darin, dass bei einem Dokumentarfilm oder einer Reportage schon in Punkt zwei, dem ersten Schritt der Produktion - also während des Drehens - bereits Manipulation stattfinden kann. Dies ist dann der Fall, wenn "der Zuschauer nicht mehr direkter Augenzeuge im filmischen Prozess ist." [Hattendorf, S. 69].
Praktisch würde wohl kaum jemand nach Tschernobyl fahren, um sich die Folgen der Katastrophe 'in echt' anzugucken, um das Gesehene zu überprüfen. Aber man selbst als Zuschauer untersucht jedes Bild darauf, ob es gestellt oder 'echt' aussieht, vergleicht es mit den Erfahrungen oder den Zeitungsbildern, und sucht nach Übereinstimmung(en).
Nicht nur diese Möglichkeit sollte bestehen, damit ein nicht-fiktionaler Film authentisch ist oder kritisch: wirkt.
Zum Beispiel gehört zu den authentisierenden Strategien die Objektivierung (Sachlichkeit; Allgemeingültigkeit), die einen allumfassenden Wahrheitseindruck bewirkt.
5. Authentisierungsstrategien
In Anlehnung an den philosophischen Gedanken, dass es die Realität nicht gebe, gibt es auch eine offene Subjektivität im Gegensatz dazu - der/die 'Macher' bekennt sich zu "seiner Sicht der Dinge".
Auch Reflexionen über z.B. die Begrenztheit oder die manipulativen Eigenschaften des Mediums Film haben einen authentisierenden Charakter.
Diese Strategien machen sich zuweilen auch fiktive Filme zugunsten eines höheren Authentizitätsempfinden zunutze - man siehe z.B. "Blair Witch Project".
Andersherum benutzen auch manche eigentlich-nicht-fiktiven Filme fiktionale Erzählmuster für den Effekt einer größeren Ästhetik.
Mit diesen fünf Zeilen sind bereits die Mischformen dokumentarischer und fiktionaler Filme angesprochen, die in allen Mischungsverhältnissen zu finden sind.
Beispiele dafür sind "Die lustige Welt der Tiere", "Schindlers Liste", "Titanic" oder jetzt auch "Pearl Harbor".
In diesen Fällen bleibt für den „Ottonormal-Rezipienten“ zu diskutieren, inwieweit es sich um einen fiktionalen Film handelt, der auf einer wahren Geschichte beruht, ob es sich um eine Dokumentation mit fiktionalen Elementen handelt, ob es ein rein-fiktionaler Film sein könnte, etc.
Authentizität ist also für den Rezipienten mehr eine Empfindung, die Zustimmung zu dem Gesehenen - "es passt zu meinen Erfahrungen" - sowohl im Spielfilm als auch im nicht-fiktionalen Film.
Fiktion hingegen, das Fingierte oder Inszenierte, wird bei dem Spielfilm erwartet und hingenommen, beeinflusst aber nicht das Gefühl der Authentizität, sie kann sehr wohl glaubwürdig sein, also in den Zuschauer-Erfahrungs-Horizont hineinpassen.
In einem nicht-fiktionalen Film - wie die Bezeichnung schon sagt - wird sie als Manipulation wahrgenommen, wenn sie als Ausgedachtes entlarvt wird. Ein nicht-fiktionaler Film büßt damit alle Authentizität - Glaubwürdigkeit - ein.
Zusammenfassung
Das Kurzreferat „Authentizität und Fiktionalität im Film“ handelt von der Klärung und der Einordnung genannter Begriffe in einen filmischen Zusammenhang, beschränkt sich aber auf eine groben Überblick.
Der Begriff Authentizität in Bezug auf den Film kann zweifach definiert werden: zum einen als ‚Glaubwürdigkeit’, eine in der Produktion liegenden Größe des Films allgemein, zum anderen als ‚Echtheit’, eine Größe, die in der Realität verwurzelt ist. Fiktion, als alles Inszenierte bezeichnende Größe, hingegen ist der filmunterscheidende Faktor, wie im Folgenden sichtbar wird.
Um diese Definitionen weiter zu klären und die Unterschiede herauszuarbeiten, werden zwei Filmtypen unterschieden: der fiktionale und der nicht-fiktionale Film.
Während ein nicht-fiktionaler Film dem Anspruch auf glaubwürdige Echtheit genügen muss, wird von dem fiktionalen Film Glaubwürdigkeit, aber nicht unbedingt Echtheit erwartet.
Dieses entspricht dem Bild eines Vertragsabschlusses zwischen Rezipient und den Instanzen des Mediums Film, der auf der Erfüllung eines Authentizitätsversprechen beruht.
Die Glaubwürdigkeit hängt zudem von ihrem Bezug zur Realität außerhalb des Filmes, je nach Kategorie „fiktiv“ oder „nicht-fiktiv“, in unterschiedlicher Weise ab.
Für den nicht-fiktiven Film ergibt sich hier die größte Schwierigkeit, da an ihn obendrein der Anspruch der ‚Echtheit’ gestellt wird, und weil schon in den ersten Prozessen der Filmproduktion - gewollt oder ungewollt - Manipulation stattfinden kann. Somit wäre der Echtheitsanspruch nicht mehr zu erfüllen.
Andererseits kann es nach philosophischer Betrachtung nicht die Realität geben, was eine andere Schwierigkeit bildet.
Um diesen Überlegungen in einem nicht-fiktiven Film gerecht zu werden, kommt es zu authentisierenden Strategien, zu denen z.B. das offene Reflektieren über die Begrenztheit oder die manipulativen Eigenschaften des Mediums Film gehört.
Jedoch werden diese Strategien genauso für fiktive Filme zur Erzielung einer größeren Glaubwürdigkeit verwendet, z.B. in Form von Einblendung von Zeit und Ort in der rechten unteren Bildecke, um eine Illusion von Berichterstattung aufzubauen oder durch verwackeltes, (scheinbar) unbearbeitetes Filmmaterial, wie es beispielsweise in dem Film „Blair Witch Project“ der Fall ist.
Abschließend kann man sagen, dass Authentizität die Zustimmung des Rezipienten zu dem Gesehenen ist, und zwar in beiden Filmtypen, während die Fiktion im Spielfilm oder fiktiven Film erwartet und akzeptiert wird, sich im nicht-fiktiven jedoch, soweit erkannt, zu unerwünschter Manipulation verwandelt, und damit unglaubwürdig wird.
Quellen
Manfred Hattendorf
Dokumentarfilm und Authentizität:
Ästhetik und Pragmatik einer Gattung
Konstanz: Ölschläger in Univ.-Verl. Konstanz (UVK-Medien), 1994
Band ... der Reihe: Close up; 4
Knut Hickethier
Film- und Fernsehanalyse
3., überarbeitete Auflage
Häufig gestellte Fragen zu "Authentizität und Fiktionalität im Film"
Worum geht es in diesem Referat?
Das Referat behandelt die Begriffe Authentizität und Fiktionalität im Film und untersucht, wie diese scheinbaren Gegensätze im filmischen Kontext zusammenwirken.
Wie definiert die Brockhaus Enzyklopädie Authentizität und Fiktion?
Authentisch wird definiert als "verbürgt, echt, zuverlässig", im Gegensatz zu untergeschoben. Fiktion wird definiert als "Erdichtung, erdichtete Annahme".
Welche zwei Möglichkeiten für Authentizität im Film werden unterschieden?
Es gibt zwei Arten: erstens die objektive Echtheit eines Ereignisses, das der filmischen Abbildung zugrunde liegt, und zweitens Authentizität als Ergebnis der filmischen Bearbeitung, also die Glaubwürdigkeit eines dargestellten Ereignisses durch filmische Strategien.
Was unterscheidet Spielfilme und Filme ohne Spielhandlung (z.B. Dokumentarfilme)?
Siegfried Kracauer unterscheidet anhand der Inszenierung: Spielfilme beinhalten eine Inszenierung, während Filme ohne Spielhandlung (Dokumentarfilme, Reportagen) diese vermeintlich nicht haben. Allerdings kann auch in Dokumentarfilmen Inszenierung vorkommen, und Spielfilme können Elemente der Realität enthalten.
Was ist der "Wahrnehmungsvertrag filmischer Authentizität"?
Es ist ein unausgesprochener Vertrag zwischen Zuschauer und Filmemacher. Der Zuschauer akzeptiert den Film solange als glaubwürdig, wie er die filmische Authentizität durch sein eigenes Wissen und seine Erfahrungen bestätigen kann.
Was ist das Problem mit der Darstellung von Realität im Dokumentarfilm?
Der Dokumentarfilm beansprucht, die Realität zu beweisen, aber "die" Realität ist subjektiv und objektiv gegeben und verschiedentlich interpretierbar. Manipulationen während des Drehs können den Echtheitsanspruch untergraben.
Was sind Authentisierungsstrategien im Film?
Authentisierungsstrategien sind Mittel, um den Eindruck von Echtheit zu verstärken. Dazu gehören Objektivierung, das Bekennen zur eigenen Subjektivität und Reflexionen über die Begrenztheit des Mediums Film.
Wie beeinflusst Fiktion das Gefühl von Authentizität in Spielfilmen und Dokumentarfilmen?
In Spielfilmen wird Fiktion erwartet und hingenommen und kann trotzdem glaubwürdig wirken. In Dokumentarfilmen wird Fiktion als Manipulation wahrgenommen und untergräbt die Glaubwürdigkeit.
Was sind Beispiele für Mischformen von dokumentarischen und fiktionalen Filmen?
Beispiele sind "Die lustige Welt der Tiere", "Schindlers Liste", "Titanic" oder "Pearl Harbor". Hier ist oft unklar, ob es sich um einen fiktionalen Film handelt, der auf einer wahren Geschichte beruht, oder um eine Dokumentation mit fiktionalen Elementen.
Was ist die abschließende Aussage des Referats über Authentizität und Fiktionalität im Film?
Authentizität ist die Zustimmung des Rezipienten zu dem Gesehenen, sowohl im Spielfilm als auch im nicht-fiktionalen Film. Fiktion wird im Spielfilm erwartet und akzeptiert, im nicht-fiktionalen jedoch als unerwünschte Manipulation wahrgenommen, wenn sie als Ausgedachtes entlarvt wird.
- Quote paper
- Annechien Kahle (Author), 2001, Authentizität und Fiktionalität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106848