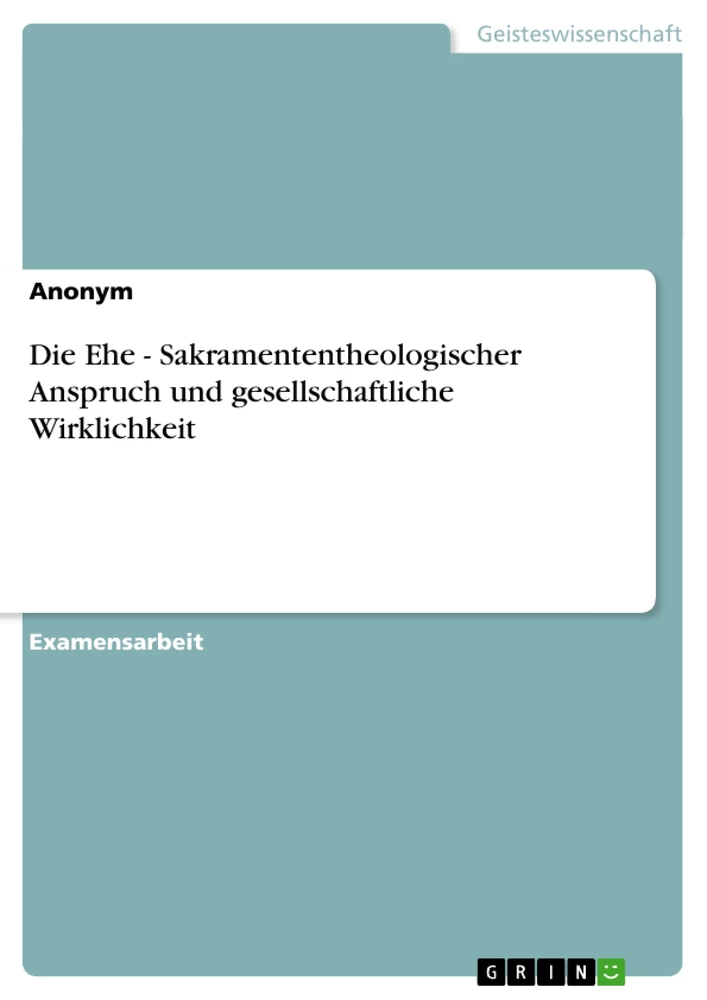Warum strömen Paare, die sonst kaum eine Kirche betreten, zur Hochzeit in den sakralen Raum? In einer Zeit, in der Individualisierung und die Suche nach dem persönlichen Glück im Vordergrund stehen, erforscht dieses Buch die Bedeutung des Ehesakraments in der postmodernen Gesellschaft. Es analysiert die Krise der traditionellen Ehe und die sich wandelnden Wertvorstellungen, die zu einer Entfremdung von den kirchlichen Lehren geführt haben. Dabei werden die historischen Wurzeln des Sakramentenverständnisses beleuchtet, von den Mysterienkulten der Antike bis zur modernen Theologie, um ein tieferes Verständnis der christlichen Ehe zu entwickeln. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle der Liebe in der Ehe und wie sie als Realsymbol der göttlichen Liebe verstanden werden kann. Das Buch bietet zudem praktische Überlegungen zur Gestaltung einer zeitgemäßen Ehekatechese, die sowohl die Bedürfnisse kirchenferner Brautleute berücksichtigt als auch die Authentizität der kirchlichen Botschaft wahrt. Es werden innovative Konzepte vorgestellt, die auf Projektorientierung und gemeinschaftliches Erproben des Glaubens setzen, um die Ehe als einen Bund zu stärken, der nicht nur auf menschlicher Liebe, sondern auch auf göttlicher Gnade gründet. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, wie die Kirche in einer pluralistischen Welt ihre Identität bewahren und gleichzeitig Brücken zu Menschen bauen kann, die auf der Suche nach Sinn und spiritueller Orientierung sind. Dieses Werk ist somit ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die sich mit der Zukunft der Ehe und der Rolle der Kirche in einer sich stetig verändernden Gesellschaft auseinandersetzen wollen, einschließlich Theologen, Seelsorger und interessierte Laien. Schlagwörter: Ehesakrament, Katechese, Postmoderne, Individualisierung, Liebe, Sakramententheologie, Kirchliche Lehre, Pastorale Herausforderungen, Glaubensvermittlung, Ehekrise, Sakramentenpastoral, Eheverständnis, Partnerschaft, Kirchliche Erneuerung, Gemeindearbeit, Sinnsuche. Die tiefgreifenden Analysen bieten neue Perspektiven für eine zukunftsweisende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen der Ehepastoral im 21. Jahrhundert, und will dabei helfen, tragfähige Antworten auf die Frage zu finden, wie die Kirche weiterhin ein relevanter Begleiter auf dem Weg zu einer erfüllten und sinnstiftenden Partnerschaft sein kann. Die umfassende Auseinandersetzung mit dem Thema macht dieses Buch zu einem wertvollen Beitrag für alle, die sich für die Zukunft von Ehe und Familie in einer zunehmend säkularen Welt interessieren.
INHALT
1 EINLEITUNG
2 ZUR SITUATION DER EHE HEUTE
2.1 Von der Produktionsgemeinschaft zur Liebesehe
2.2 Die Ehe heute
2.2.1 Die Ehe in der Krise?
2.2.2 Die Individualisierung der Biographie
2.2.3 Intimisierung und Privatisierung der Paarbeziehung
2.2.4 Die gewandelte Stellung der Frau
2.2.5 Folgen der allgemeinen Individualisierung für die Paarbeziehung
2.2.6 Die neue Einstellung zum Kind
2.2.7 Veränderungen im Lebenszyklus
2.3 Die irdische Religion der Liebe
3 KIRCHE IN DER POSTMODERNE
3.1 Die Krise der Sakramentenpastoral
3.1.1 Entwicklung des Katholizismus in der Postmoderne
3.1.2 Tradierungskrise
3.1.3 Pluralisierung und Differenzierung innerhalb des Christentums
3.1.4 Religionsproduktive Tendenzen der Gegenwart
3.1.5 Zur Situation der Kirche heute
4 ALLGEMEINE SAKRAMENTENLEHRE
4.1 Geschichte der Sakramente
4.1.1 Zum Begriff Mysterion
4.1.1.1 In Kult und Philosophie
4.1.1.2 Im biblischen Sprachgebrauch
4.1.2 Sacramentum als theologischer Terminus
4.1.3 Das Sakramentenverständnis des Augustin
4.1.4 Das Mittelalter
4.1.5 Reformation und Tridentinum
4.1.6 Neubesinnung im 20. Jahrhundert
4.2 Was ist ein Sakrament?
4.2.1 Theologische Voraussetzungen einer Sakramententheologie Exkurs: Was ist ein Symbol?
4.2.2 Christus als Ursakrament
4.2.3 Die Kirche als Grundsakrament
4.2.4 Die Sakramente als Grundvollzüge der Kirche
4.2.5 Sakramente als Feiern der Gemeinde
4.2.6 Wort und Sakrament
4.2.7 Sakramente als kommunikative Handlungen
5 DAS SAKRAMENT DER CHRISTLICHEN EHE
5.1 Zur Geschichte des Ehesakramentes
5.1.1 Die Ehe in biblischen Zeugnissen
5.1.2 Theologiegeschichtliche Entwicklung des Ehesakramentes
5.1.2.1 Praxis und Theologie der Ehe in den ersten Jahrhunderten
5.1.2.2 Mittelalter
5.1.2.3 Reformation und Tridentinum
5.1.2.4 Die Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils
5.1.2.5 Die EnzyklikaFamiliaris Consortio
5.2 Einige Anmerkungen zum Eherecht
5.3 Systematische Reflexion
5.3.1 Die eheliche Liebe
5.3.2 Ehe als Realsymbol der Liebe Gottes
5.3.3 Das Ehesakrament und seine kirchliche Dimension
5.3.4 Die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe
6 EHEKATECHESE
6.1 Strukturen einer ‘postmodernen’ Katechese
6.1.1 Probleme der Katechese heute
6.1.2 Kirchliche Neubesinnung in der Katechese
6.1.3 Praktische Konsequenzen
6.2 Das Ehesakrament zwischen Ausverkauf und Rigorismus
6.2.1 Mögliche Motive für den Wunsch nach dem Ehesakrament
6.2.2 Die Frage nach einem obligatorischen Ehekatechumenat
6.2.3 Kirchenferne als Glieder der Kirche
6.3 Konzepte der Ehekatechese
6.3.1 Ehekatechese in kirchlichen Verlautbarungen
6.3.2 Projektorientierte (Ehe)katechese
6.4 Konkretion
6.4.1 Ziele der Ehekatechese
6.4.2 Ehekatechese als Aufgabe der Gemeinde
6.4.3 Die Rolle des Amtsträgers
6.4.4 Ehekatechese als gemeinsames Erproben des Glaubens
6.4.5 Dimensionen einer projektorientierten Ehekatechese
6.5 Schlußwort
Literatur
1 EINLEITUNG
Als eine Freundin mir vor einigen Monaten erzählte, daßsie beabsichtige, im nächsten Jahr zu heiraten, und zwar sowohl standesamtlich als auch kirchlich, war ich, abgesehen von meiner Freude darüber, daßsich hier zwei Menschen gefunden haben, die wunder- bar zueinander passen und denen ich für ihre gemeinsame Zukunft alles Glück der Welt wünsche, auch etwas befremdet. Wußte ich doch, daßbesagte Freundin seit ihrer Fir- mung allenfalls noch anläßlich von Hochzeiten oder Beerdigungen ein Kirchengebäude von innen gesehen hatte und daßsowohl sie als auch ihr Verlobter sich selbst als ‘zwar gläubig, aber nicht kirchlich’ bezeichnen. Warum will jemand, der erklärtermaßen mit Kirche so gut wie nichts zu schaffen hat, kirchlich heiraten? Vorsichtig fragte ich nach. Die Antwort lautete: „Weil ich es schön finde!“. Auch eine Begründung, dachte ich. Aber kann sie zureichend sein, um darauf eine christliche Ehe aufzubauen? Meine Freundin und ich kennen uns seit über 20 Jahren, wir sind zusammen aufgewachsen, wir gingen zusammen zum Kommunionunterricht und zur Erstkommunion, gemeinsam waren wir als Meßdienerinnen aktiv und gemeinsam wurden wir schließlich auch ge- firmt. Man kann also sagen, daßsie eine durchaus katholisch geprägte Sozialisation erfahren hat. Und dennoch scheint sie mit dem Sakrament der Ehe nichts weiter zu verbinden als eine stimmungsvolle Zeremonie. Um so mehr erstaunte es mich, daßjeder der insgesamt vier Gemeindepfarrer, die sie und ihr Verlobter ansprachen, bevor sie sich für das ‘schönste’ Kirchengebäude entschieden, die Trauung sofort zusagte, ohne auch nur im entferntesten nach den Glaubensvoraussetzungen der Eheschließung zu fragen.
Diese Erfahrung läßt sich wohl als geradezu symptomatisch für die derzeitige Situation des Ehesakramentes bezeichnen. Menschen, die ansonsten jeden Kontakt zur Kirche haben einschlafen lassen, treten zum Anlaßihrer Hochzeit wieder an sie heran. Die eigentliche Bedeutung des Ehesakramentes bzw. der Sakramente überhaupt ist ihnen vielfach nicht bekannt und interessiert sie manchmal auch gar nicht. Und man fragt sich im Stillen, ob es überhaupt Sinn macht, diesen Paaren das Ehesakrament zu spenden. Wäre die Kirche vielleicht besser beraten, die Sakramentenspendung in solchen Fällen zu verweigern? Werden hier nicht ‘Perlen vor die Säue’ (Mt 7,6) geworfen? Oder sollte man die Paare, die immerhin an ihren Lebenswenden noch den Weg in die Kirche fin- den, als die ‘glimmenden Dochte’ (Mt 12,20) betrachten, die man nicht auslöschen darf? Ist in der heutigen Zeit überhaupt noch voraussetzen, daßMenschen, die ein Sakrament empfangen möchten, wenigstens grundlegende Kenntnisse über dessen Bedeutung mitbringen?
Mit vorschnellen Schuldzuweisungen an die eine oder andere Seite wird man in dieser Frage kaum zu befriedigenden Lösungen finden. Es müssen vielmehr sowohl die Situa- tion der Paare als auch die der Kirche in der heutigen Zeit bedacht werden. Diese Arbeit wird sich daher zuerst der Situation der Ehe in der heutigen Zeit widmen. Die Ehe als Lebensform hat sich in den letzten Jahrzehnten aufgrund gesellschaftlicher Umwälzun- gen stark verändert. Diese Wandlungsprozesse müssen berücksichtigt werden, wenn Schlußfolgerungen über die christliche Ehe gezogen werden sollen. Ist der Anspruch, den die Ehe als Sakrament an die Menschen stellt, unter den heutigen Voraussetzungen überhaupt noch einzuhalten, oder ist das, was die Kirche unter Ehe und Familie ver- steht, ohnedies nur noch eine „Zombie-Kategorie“1, die unter den Bedingungen der heutigen Zeit als veraltet abgetan werden muß? Im Anschlußan diesen ehesoziologi- schen Abschnitt, soll ein Blick auf die Situation der Kirche in unserer Gesellschaft geworfen werden, bevor in Kapitel 4 und 5 auf die allgemeine Sakramentenlehre und auf das Sakrament der Ehe im besonderen eingegangen wird, um zu klären, was es mit dem Ehesakrament überhaupt auf sich hat und welche Voraussetzungen gegeben sein sollten, damit es fruchtbar empfangen werden kann. In Kapitel 6 wird dann zu fragen sein, wie von kirchlicher Seite mit der derzeitigen krisenhaften Situation der Sakramen- tenpastoral im allgemeinen und der Ehepastoral im besonderen umgegangen werden kann. Gibt es in dieser Frage tatsächlich nur die Alternativen von ‘Ausverkauf’ oder ‘Rigorismus’? Meine Arbeit will versuchen, Wege aufzuzeigen, die sowohl der Situati- on der ‘kirchenfernen’ Brautleute gerecht werden, als auch das berechtigte Anliegen der Kirche, ihre Identität und Authentizität zu wahren, ernst nehmen.
2 ZUR SITUATION DER EHE HEUTE
2.1 Von der Produktionsgemeinschaft zur Liebesehe
Inzwischen ist es nicht nur unter Theologen gängige Meinung, daßdie Institution der Ehe sich in einer Krise befindet: die Häufigkeit von Eheschließungen, sowohl der stan- desamtlichen als auch kirchlichen, nimmt in der Bundesrepublik seit den sechziger Jahren mehr oder weniger kontinuierlich ab, während im Gegenzug die Zahl der Ehe- scheidungen signifikant zugenommen hat; gleichzeitig wächst die Zahl der nichteheli- chen Lebensgemeinschaften.2 Es wäre dennoch verfehlt, ob dieser Entwicklung in eine idealisierende Verklärung der Vergangenheit zu verfallen, denn Ehe und Familie, die bis zum Aufkommen der modernen Verhütungsmethoden gar nicht voneinander zu trennen waren, sind geschichtliche Größen, die zu allen Zeiten dem geschichtlichen und gesellschaftlichen Wandel unterworfen waren. So ist die heute in den Industrieländern als normal anzusehende ‘Liebesehe’ eine relativ junge Erscheinung und stellt im Kul- turvergleich die Ausnahme dar. Das romantische Liebesideal ist eine Erscheinung des 19. Jahrhunderts. In vorindustrieller Zeit waren die Gründe für eine Eheschließung ökonomischer oder - in adeligen Kreisen - dynastischer Natur.3 Geheiratet wurde aus rein sachlichen Gründen, über die nicht die Brautleute, sondern deren Familien ent- schieden, gegenseitige Zuneigung spielte keine Rolle. Zudem war bis zum Beginn des bürgerlichen Zeitalters „der öffentliche Eheschlußfür breite Schichten der Bevölkerung durch staatliche oder gutsherrschaftliche Heiratsverbote eingeschränkt.“4 In der vorin- dustriellen Zeit lebten die Verheirateten meistenteils in einem Haushalt, dem eine oder mehrere Kernfamilien, z.T. noch lebende Großeltern und andere Verwandte und ggf. das Gesinde angehörten. Diese im 16. und 17. Jahrhundert verbreitete Lebensform5 des ‘Ganzen Hauses’ bezeichnete eine „Arbeits-, Wirtschafts-, Lebens-, Erziehungs- und Konsumationsgemeinschaft“6 mit bestimmten sozialen Regeln und klarer Aufgaben- verteilung. Dabei war die Frau vornehmlich für den häuslichen Bereich zuständig, in dem sie relativ autonom agieren konnte, obwohl die ‘Arbeitsgemeinschaft Familie’ an sich hierarchisch strukturiert war und der ‘Hausherr’ die absolute Befehlsgewalt über seine Frau und die Kinder innehatte. Der Alltag war für alle Familienmitglieder geprägt durch harte Arbeit; die beengten Wohnverhältnisse ließen den Aufbau intimer Beziehungen kaum zu. Scheidungen waren mehr oder weniger unmöglich, da die Partner so fest in ihr soziales Gefüge eingepaßt waren, daßdie Auflösung der Ehe für beide ökonomisch und sozial katastrophale Folgen gehabt hätte.
Im 18. Jahrhundert verschwand mit dem Aufkommen der neuen Produktionsformen die Lebensform des ‘Ganzen Hauses’ allmählich; die Haushaltsgemeinschaft von einst wurde - zunächst allerdings nur in bürgerlichen Kreisen - auf die Kernfamilie reduziert, was „eine Privatisierung des familialen Binnenraums zur Folge hatte“7 - die Ehe wurde von der Zweckgemeinschaft zur Gefühlsgemeinschaft, in der die Rollen jedoch weiter- hin klar verteilt blieben: der Mann sorgte durch außerhäusliche Erwerbsarbeit für den Unterhalt der Familie, der Frau oblagen die Haushaltsführung und die Erziehung der Kinder. Dieser wurde nun ein hoher Stellenwert zugesprochen, denn durch die Auflö- sung der Ständeordnung waren die Schichtgrenzen durchlässiger geworden, der einzel- ne wurde nicht mehr qua Geburt auf einen bestimmten Platz in der Gesellschaft gestellt, sondern hatte - im Prinzip - die Möglichkeit, sich eine gesellschaftliche Stellung zu erarbeiten. Hierfür aber waren Leistungsvermögen, Flexibilität und Durchsetzungsver- mögen vonnöten. Diese zu vermitteln und somit das Kind optimal auf die Anforderun- gen seiner späteren Existenz vorzubereiten, wurde nun zum obersten Ziel der Erzie- hung; die Erziehung selbst avancierte zunehmend zur „zentralen Lebensaufgabe der Eltern, im besonderen der Frau.“8
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert kam das Modell der Arbeiterehe und -fa- milie auf, mit dem nun auch für die Familien der unteren Klassen die „Trennung von Arbeitsplatz und Wohn-/Lebensraum“9 ihren Anfang nahm, die langfristig zu einer Neubestimmung der Funktion von Familie führte: mit der Ausdehnung dieser Trennung auf weite Teile der Bevölkerung begann ein struktureller Differenzierungsprozeßder Gesellschaft; es kam zur Ausbildung und Institutionalisierung von Teilsystemen, etwa des Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesens, wodurch die Familie langfristig von ihren traditionellen gesellschaftlichen Aufgaben entbunden wurde und somit ihr Au- genmerk auf andere Dinge richten konnte, nämlich auf die innerfamiliären Beziehun- gen. Dies führte zu einer Intimisierung und Emotionalisierung sowohl der Beziehung zwischen den Ehegatten als auch zwischen Eltern und Kindern.
Im Gegensatz zum bürgerlichen Ideal waren in der Arbeiterklasse auch die Frauen außerhäuslich erwerbstätig, schon weil ob der geringen Löhne das wirtschaftliche Über- leben der Familie sonst nicht zu sichern gewesen wäre. Die Kinder blieben hier noch weitestgehend sich selbst überlassen und mußten schon früh eigenständig für ihren Lebensunterhalt sorgen. Erst durch das Verbot der Kinderarbeit und die Einführung der allgemeinen Schulpflicht verschwanden die Kinder aus der industriellen Produktion. Auch die Frauen wurden nach und nach aus dem Erwerbsleben ausgegliedert, soweit die Familien es sich leisten konnten: die Arbeiterklasse übernahm das bürgerliche Fami- lienleitbild, demzufolge es das Ziel des Mannes war, „so viel zu verdienen, daßdie Frau nicht mehr arbeiten mußte.“10 Zwar blieben Frauen faktisch ins Erwerbsleben integriert, da es sich auch weiterhin viele Familien nicht leisten konnten, auf das zusätzliche Ge- halt zu verzichten, doch wurde Frauenarbeit nun, nicht zuletzt von den Kirchen, als Ursache des Verfalls von Moral und Sitte stigmatisiert, es sei denn, diese Arbeit blieb in Landwirtschaft, Kleingewerbe oder Kleinhandel familienintegriert.11 Entsprechend der allgemein negativen Bewertung von Frauenarbeit wurden Frauen auch schlechter ent- lohnt und hatten keinerlei berufliche Aufstiegsmöglichkeiten. Das Ideal der Hausfraue- nehe war geboren und prägt trotz des Widerstandes der Alten und der Neuen Frauenbe- wegung12 die gesellschaftlichen Vorstellungen, wie eine Familie auszusehen habe, bis in unsere Zeit hinein. Demzufolge war der Mann derjenige, der sich ins „feindliche Leben“, in Wirtschaft und Politik hinausbegab, derweil der Arbeitsbereich der Frau auf das Häusliche beschränkt blieb, wo sie neben der Pflege des Heims und der Erziehung der Kinder vor allem die Aufgabe hatte, eine Atmosphäre der ‘Gemütlichkeit’ zu schaf- fen, in der der Mann sich von den wachsenden beruflichen Anforderungen - der Bürger erhielt seine gesellschaftliche Stellung ja nicht durch Geburt oder Besitz, sondern auf- grund individueller Leistung und stand unter entsprechendem Druck - erholen konnte. In dem Maße, in dem sich im „Verlauf der Industrialisierung und Urbanisierung die traditionellen verwandtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bindungen abschwäch- ten“13 wuchs die Bedeutung der psychisch stabilisierenden, bindenden, schützenden und ausgleichend-rekreativen Wirkung von Familie. Die neue Begründung der Ehe auf gegenseitige Liebe - gemeint war eine Art abgeschwächte Form der romantischen Liebe, bei der der „Aspekt der Leidenschaftlichkeit durch den der Vernünftigkeit und Dauerhaftigkeit“14 ersetzt worden war - bedeutete jedoch nicht, daßdie althergebrach- ten patriarchalen Strukturen sich aufgelöst hätten: die Frau blieb, da sie keinerlei eige- nes Einkommen hatte, wirtschaftlich vom Mann abhängig, ihre Bindung an Haus und Kinder wurde biologistisch untermauert, indem ihr die Fähigkeit, sich im Berufsleben zu behaupten, unter Verweis auf ihre geschlechtsbedingte Disposition abgesprochen wurde. Scheidungen kamen nicht in Frage, da sie für die Frau den wirtschaftlichen und sozialen Ruin bedeutet hätten - ein Beispiel hierfür bietet die literarische Gestalt der Effi Briest im gleichnamigen Roman Theodor Fontanes aus dem Jahre 1894/1895, dem eine tatsächliche Begebenheit aus dem Bekanntenkreis des Autors zugrundelag.15 Hinzu kam, daßdie von Frauen in Haus und Familie geleistete Arbeit in Anbetracht der Tatsache, daßsie kein Geld einbrachte, nicht mehr als Arbeit anerkannt wurde, „die Nachwuchssicherung und die Regeneration des Arbeitsvermögens wurden als selbstverständliche Leistungen der Familie unhinterfragt vorausgesetzt.“16
Es erscheint fast müßig zu betonen, daßunter diesen Voraussetzungen von einer gleich- berechtigten Partnerschaft von Mann und Frau nicht die Rede sein konnte. Ehen wurden zwar ‘aus Liebe’ geschlossen, doch waren Ehen über Standesgrenzen hinweg nahezu unmöglich; die Liebe hatte sich an den gesellschaftlichen Leitvorstellungen zu orientie- ren. Nach der Eheschließung war dann der Ehemann als Familienernährer derjenige, der die Entscheidungen traf, denen Frau und Kinder sich zu beugen hatten, zumal ihm auch die Gesetzgebung (und die Kirche!) dieses Recht zusprach. So konnten verheiratete Frauen bis in die sechziger Jahre unseres Jahrhunderts nicht ohne Zustimmung ihres Ehegatten eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, auch die Möglichkeit zur Ehescheidung blieb bis zur Eherechtsreform 1976 stark eingeschränkt, da eine nach dem Verschul- densprinzip für ‘schuldig’ befundene Frau keinen Anspruch auf Unterhaltszahlungen ihres Mannes hatte.
Abschließend bleibt noch darauf hinzuweisen, daßdie Homogenisierung familialer Lebensformen im oben beschriebenen Sinne - Trennung von Haushalt und Arbeitsplatz, Reduktion auf die Kernfamilie - durch alle gesellschaftlichen Schichten hindurch erst im 20. Jahrhundert stattgefunden hat,17 was wohl hauptsächlich auf den steigenden Wohlstand auch in den unteren Klassen zurückzuführen ist. In jedem Fall sollte deutlich geworden sein, daßdas bis noch vor wenigen Jahrzehnten propagierte Familienver- ständnis von der Kernfamilie mit ihrer strikten Rollenteilung ein historisch noch relativ junges Ideal darstellt, das sich letztendlich auch deshalb durchgesetzt hat, weil es den veränderten Anforderungen des Arbeitsmarktes in der entstehenden Industriegesell- schaft entgegenkam: die außerhäusliche Erwerbstätigkeit des Mannes im modernen Produktionsprozeßwurde dadurch ermöglicht, daßdie Frau unentgeltlich die Pflege von Haus und Kindern übernahm. „In Gestalt familialer Versorgung und marktabhängiger Produktion sind also zwei Epochen mit gegensätzlichen Organisationsprinzipien und Wertsystemen [...] im Grundrißder Industriegesellschaft zusammengeschweißt, die sich ergänzen, bedingen und widersprechen.“18 Es ist insofern irreführend, in Anbetracht der gegenwärtigen Situation in den Industrieländern vom ‘Verfall der Familie’ zu sprechen, denn ‘Familie’ ist eben keine statische Entität. Nun haben sich in den letzten 30 Jahren die gesellschaftlichen Voraussetzungen erneut gewandelt; das bürgerliche Verständnis von Ehe und Familie ist in vielerlei Hinsicht fragwürdig geworden. Die folgenden Kapitel wollen beleuchten, wie sich diese Entwicklungen auf Ehe und Partnerschaft ausgewirkt haben.
2.2 Die Ehe heute
In den letzten dreißig Jahren hat sich das gängige Eheverständnis grundlegend gewan- delt: Von einer - im Regelfalle - tatsächlich lebenslang haltenden Gütergemeinschaft mit klarer Rollenverteilung, entwickelte sie sich zu einer „Freizeitgemeinschaft und Sozialisierungsinstanz für Kinder“19. Die heutige Eheauffassung propagiert nicht mehr die Zusammenfügung zweier einander ergänzender Teile mit spezifischen Funktionen, sondern das Ideal einer Partnerschaft von Gleichberechtigten. Nahezu jegliche Heirats- beschränkungen staatlicher oder sozialer Art sind weggefallen, jeder und jede kann heiraten, wen er/sie will. Einzige Basis einer Ehe ist üblicherweise die gegenseitige Liebe, zumal durch moderne Verhütungsmethoden und gesellschaftliche Akzeptanz alleinerziehender Elternteile auch die sogenannten ‘Muß-Ehen’ selten geworden sind. Auch Scheidungen und Wiederheirat sind inzwischen fast zum Normalfall in der Bio- graphie des einzelnen geworden. Die folgenden Abschnitte wollen die Frage beleuch- ten, unter welchen Voraussetzungen sich der Wandel im Eheverständnis vollziehen konnte, und inwiefern es gerechtfertigt ist, von einer ‘Krise’ von Ehe und Familie zu sprechen.
2.2.1 Die Ehe in der Krise?
Durch die Ablösung der Zweckehe durch die Liebesehe, die allein auf der emotionalen Bindung der Partner basiert, ist die Ehe als Institution in eine schwere Legitimations- und Plausibilitätskrise geraten. Die Emotionalisierung und Privatisierung der zwischen- geschlechtlichen Beziehungen führte dazu, daßPaare immer weniger einsahen, was Staat oder Kirche mit ihrer eigenen, zutiefst persönlichen Beziehung zu tun haben soll- ten. Die Institution Ehe geriet vielmehr unter den Verdacht, lediglich ein Instrument zur Einengung und Beschränkung der persönlichen Freiheit des einzelnen zu sein, und wurde dementsprechend abgelehnt. Sie begünstige, so heißt es auch heute noch viel- fach, „den Ehetrott, [...] verhindere die freie Entfaltung der Persönlichkeit und überfor- dere den fragilen Menschen.“20 Die Zunahme der nichtehelichen Lebensgemeinschaften - im Zeitraum von 1972 bis 1996 hat sich ihre Zahl von 137.000 auf 1,4 Millionen verzehnfacht!21 - und die wachsende Zahl der Ehescheidungen - jede vierte Ehe wird derzeit vor Ablauf von 15 Jahren geschieden!22 - scheint eine logische Folge dieser neuen Sicht der Ehe zu sein. Heute stehen Ehe und nichteheliche Lebensgemeinschaft in der gesellschaftlichen Akzeptanz nahezu gleichberechtigt nebeneinander und werden auch in rechtlicher Sicht einander immer weiter angeglichen, die Ehe hat ihre „Mono- polstellung als einzige Form des Zusammenlebens von Mann und Frau eingebüßt“23. Auch Elternschaft ist kein zwingender Grund mehr, eine Ehe einzugehen, wie die wach- sende Zahl Alleinerziehender oder unverheirateter Eltern belegen, gleichzeitig bedeutet Ehe nicht mehr zwangsläufig Elternschaft. Darüber hinaus wurde auch die Sexualität von der Bindung an die Ehe befreit, so daßsie inzwischen nicht nur vor, sondern auch neben der Ehe „ein normales und ohne Tabu zugängliches Tun“24 geworden ist. Sexua- lität wird heute nicht mehr primär als Ausdruck einer Liebesbeziehung, sondern als eine von vielen ‘Erlebnismöglichkeiten’ gesehen25 - eine Entwicklung, die ohne die moder- nen Methoden der Empfängnisverhütung kaum denkbar gewesen wäre. Ergebnis dieser ‘Entinstitutionalisierung’ der Ehe ist eine „ Vielfalt höchst unterschiedlicher Partner- konstellationen, Motivations- und Verpflichtungsstufen “26, die zum Teil noch vor 20 Jahren als anstößig galten. Insofern bedeutet die Entkopplung zunächst einen Gewinn an Freiheit in der Gestaltung des eigenen Lebensweges. In bezug auf die Ehe aber zeigt sich, daßmit dem Institutionsverlust auch eine wichtige Stabilisierungsfunktion für Beziehungen weggefallen ist. Denn wo nur noch gegenseitige Zuneigung eine Lebens- gemeinschaft zusammenhält und auf die „Hilfe von gesellschaftlichen Normen und juristischen Klammern“27 bewußt verzichtet wird, sinkt die Bereitschaft zur Auseinan- dersetzung der Partner in Krisensituationen, weil die Trennung dann als der Weg des geringsten Widerstandes erscheint. Eine Tendenz, die durch die bereits angesprochene Eherechtsreform von 1976, die die Scheidung extrem vereinfachte, indem man das Verschuldens- durch das Zerrüttungsprinzip ersetzte, noch verstärkt wurde.
Alle diese Beobachtungen verführen dazu, die Ehe als überholt zu betrachten und auf lange Sicht ihr vollkommenes Verschwinden zu prognostizieren. Dem aber lassen sich Daten entgegenhalten, die eine andere Sprache sprechen: trotz der „Pluralisierung der Haushalts- und Familienformen“28 lebten im Jahre 1995 77,1% der 30- bis 65-jährigen in einer Ehe; Umfragen haben ergeben, daß87% der Bürger in den alten Bundesländern und 84% der Bürger in den neuen Bundesländern die Ehe als Lebensform positiv be- werten. Und obschon die Scheidungsraten steigen, leben nach wie vor 86% aller Kinder mit ihren leiblichen Eltern zusammen, die in 79% der Fälle miteinander verheiratet sind.29 Auch die steigende Zahl der Alleinerziehenden ist nicht unbedingt als Indiz für eine grundsätzliche Ablehnung der Ehe zu interpretieren: von den im Jahre 1996 ge- zählten 1,64 Millionen Alleinerziehenden (85,5 Prozent Frauenanteil), waren 60% geschieden oder getrennt lebend.30 Die nichtehelichen Lebensgemeinschaften hingegen haben oftmals den Charakter einer „Vorehe“, die legitimiert wird, sobald das Paar die Elternschaft anstrebt.31 Aus diesen Zahlen wird ersichtlich, daßdie Ehe als Lebensform durchaus nicht ‘vom Aussterben bedroht’ ist; das Ideal einer exklusiven und langdau- ernden Bindung ist nach wie vor in Kraft,32 lediglich der Institutionalisierung der Paar- beziehung stehen heute viele Menschen skeptisch gegenüber. Die Menschen fliehen aus der legalisierten Zweisamkeit, aber nicht, um fürderhin allein zu leben - wie die trotz Rückgang immer noch hohe Wiederverheiratungsrate von deutlich über 50%33 beweist - „sondern um frei zu sein für eine andere, bessere, schönere Herzensbindung, die einlöst, was die verworfene nicht gehalten hat.“34 Woran aber liegt es, daßes trotz der offenbar nach wie vor vorhandenen Wertschätzung der Ehe bzw. ihr ähnlicher Lebens- formen anscheinend fast unmöglich geworden ist, eine dauerhafte Bindung ‘durchzuhal- ten’? Daßimmer mehr Menschen es vorziehen, unverheiratet zu bleiben? Um diese Fragen zu beantworten, mußdie Ehe in ihrer Bedingtheit durch gesellschaftliche Fakto- ren betrachtet werden.
2.2.2 Die Individualisierung der Biographie
Der Begriff der Individualisierung, den Ulrich Beck zur Bezeichnung von gesellschaft- licher Modernisierung und Fortschritt geprägt hat, ist inzwischen, obwohl die Beck- schen Thesen nicht unwidersprochen geblieben sind,35 zu einem Schlagwort der zeitgenössischen Soziologie avanciert.36 Gemeint ist mit diesem Begriff das nössischen Soziologie avanciert.36 Gemeint ist mit diesem Begriff das neuzeitliche Phänomen, daß„die Biographie der Menschen [...] aus traditionalen Vorgaben und Sicherheiten, aus fremden Kontrollen und überregionalen Sittengesetzen herausgelöst, offen, entscheidungsabhängig und als Aufgabe in die Hand jedes einzelnen gelegt“37 wird. Diese Entwicklung ist keine Erscheinung des 20. Jahrhunderts, sondern nahm ihren Anfang bereits zu Zeiten der Reformation, jedoch ist sie durch die Modernisie- rung rasant beschleunigt worden. Es kam zu einer Individualisierung im dreifachen Sinne: „ Herauslösung aus historisch vorgegebenen Sozialformen und -bindungen im Sinne traditionaler Herrschafts- und Versorgungszusammenhänge (»Freisetzungsdi- mension«), Verlust von traditionalen Sicherheiten in Hinblick auf Handlungswissen, Glauben und leitende Normen (»Entzauberungsdimension«) und - womit die Bedeu- tung des Begriffes gleichsam in ihr Gegenteil verkehrt wird - eine neue Art der sozialen Einbindung („Kontroll- bzw. Reintegrationsdimension«).“38 Die Individualisierung ist eine direkte Folge der bereits beschriebenen Ausdifferenzierung der Gesellschaft (vgl. S. 4), die sich in unserem Jahrhundert fortgesetzt hat: es kam zu einer Ausdifferenzie- rung der Lebenswelten, die heute alle gesellschaftlichen Gruppierungen erfaßt hat. Sie begann, wie erwähnt, mit dem Auseinandergehen der Welten von Arbeit und Familie39 und ist inzwischen soweit fortgeschritten, daßim Grunde jeder und jede einzelne in diversen Welten beheimatet ist: der Welt seines Berufs, seiner Familie, seines Vereins, seiner Partei. Die automatische Einbindung in Sozialsysteme (Kirchengemeinde, Dorf- gemeinschaft, Großfamilie), die früher jeden Menschen von Geburt an in einen festen Rahmen einpaßte, ist weggefallen, so daßheute jeder selbst entscheiden darf (bzw. muß), an welchen Lebenswelten er in welchem Umfang teilhaben möchte, wie er sein Leben gestalten will, wie er seine eigene Identität entwirft - die „Normalbiographie“ ist zur „Wahlbiographie“40 geworden. Diese Entwicklung bedeutet auf der einen Seite einen großen Zugewinn an Freiheit, andererseits aber führt die Notwendigkeit, seine Lebenswelten so zu wählen, daßder Gesamteindruck eines ‘erfüllten’ Lebens entsteht, vielfach auch zu Überforderung, zumal sich der einzelne gegenüber einer sich immer rasanter verändernden und als zunehmend unüberschaubar erlebten Außenwelt zuneh- mend, hilflos, allein gelassen und unwohl fühlt.41 Als Folge der „zunehmenden Säkula- risierung, der Pluralisierung von Lebenswelten, der Konkurrenz von Werten und Glau- benssystemen“42 sieht sich das Individuum nicht mehr in einen sinnstiftenden Zusam- menhang eingebunden, es kommt zu einem tiefgreifenden Verlust an innerer Stabilität, zu einem Gefühl der Isolation und Heimatlosigkeit, zur verzweifelten Suche nach Sinn. Der Esoterik-Boom der letzten Jahre macht dies nur allzu deutlich: aufgrund des gestie- genen Wohlstandes ist der heutige Mensch nicht mehr primär damit beschäftigt, seine Existenz zu sichern. Dafür aber steht er nun vor der Notwendigkeit, seine gewonnene Freizeit ‘sinnvoll’ zu nutzen, er ist stets von Überdrußund Langeweile bedroht. Allzu leicht stellt sich das Gefühl eines ‘Sinnvakuums’ ein, das auf die eine oder andere Wei- se gefüllt sein will.
Wichtig ist noch zu betonen, daß‘Individualisierung’ nicht bedeutet, daßdie Menschen aus allen Zwängen entlassen wären, sondern sich neuen Zwängen gegenüber sehen: die Inszenierung der eigenen Biographie ist nicht eine offen stehende Möglichkeit, sie ist Diktat43, und zwar Diktat, den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu entsprechen, eine Berufsausbildung zu durchlaufen, mobil und zeitlich flexibel zu sein, sich fortzubilden. „Der »Zwang zur Wahl« ist eine große psychische Belastung, weil die hereinbrechen- den Ereignisse nicht mehr als Schicksalsschläge, sondern als Konsequenzen eigener Entscheidungen, als persönliches Versagen gedeutet werden.“44 Insofern hat die Indivi- dualisierung ein doppeltes Gesicht: auf der einen Seite setzt sie die Menschen aus frühe- ren Vorgaben frei, auf der anderen Seite aber auferlegt sie ihnen die Abhängigkeit vom Arbeitsmarkt und damit den „ Selbstzwang zur Standardisierung der eigenen Exis- tenz “45. Wie aber wirkt sich die Individualisierung und das mit ihr einhergehende neue ‘Lebensgefühl’ auf Ehe und Partnerschaft aus?
2.2.3 Intimisierung und Privatisierung der Paarbeziehung
Durch die Individualisierung hat sich die oben beschriebene Intimisierung der Partner- schaft fortgesetzt: in Anbetracht der Tatsache, daßder einzelne nicht mehr per se in soziale Gruppen eingebunden ist und daßdie Beziehungen, die innerhalb einzelner Lebenswelten geschlossen werden, unverbindlicher geworden sind, wird heute „ganz- heitliche Beziehung und Begegnung [...] ausschließlich im Raum der Privatheit gesucht und erwartet“46. Die Folge ist die ‘Privatisierung’ der Paarbeziehung: „die Ehepartner ziehen sich in den Raum des Privaten zurück, wo Intimität entfaltet und gelebt wer- den“47 kann, während der Kontakt zu wichtigen Funktionsbereichen der Gesellschaft verloren geht. In einem nie dagewesenen Maße erfüllen heute die Ehe oder sonstige Formen der Paarbeziehung die Funktion der psychischen Konsolidierung, sie werden zum „emotionalen Rückzugsort, der dem einzelnen Sinn und Halt, der ihm vor allem Geborgenheit und Identität in Form von personaler Nähe und Vertrautheit gibt.“48 Der geschlossene Raum der häuslichen Gemeinschaft eröffnet die Möglichkeit, dem Leistungs- und Konkurrenzdruck, dem der einzelne im Berufsleben ausgesetzt ist, zu entfliehen und Erfahrungen von Angenommensein, von Nähe, Geborgenheit und Intimi- tät zu machen, sich im (scheinbar) überschaubaren Raum der Privatheit als die Person zu verwirklichen, die man ist, und sich nicht mehr nur als ein Rädchen im Getriebe der modernen Produktionsweisen betrachtet zu sehen. „Im Austausch mit dem Ehepartner, in der Intimsphäre sucht der einzelne jeweils auch sich selbst, sucht er seine Lebensge- schichte, sein persönliches Glück und seinen Stand in der Welt.“49 Anders ausgedrückt: die Intimität der Paarbeziehung soll einen Ersatz schaffen für die Deutungsmuster und Sozialbeziehungen, die in der Moderne verloren gegangen sind. Die Abkapselung des Paares im geschlossenen Raum ihrer Privatsphäre geht vielfach einher mit seiner gesell- schaftlichen Isolation.
2.2.4 Die gewandelte Stellung der Frau
Während, wie beschrieben, noch bis in dieses Jahrhundert hinein der Wirkungsbereich der Frau entsprechend dem großbürgerlichen Eheideal auf den häuslichen Bereich, also die Pflege des Heimes und die Erziehung der Kinder begrenzt war, derweil der Mann einer außerhäuslichen Erwerbstätigkeit nachging, befreiten sich die Frauen in den ver- gangenen Jahrzehnten allmählich aus den geschlechtsbedingten Rollenzuweisungen, erstrebten materielle Unabhängigkeit und drängten ihrerseits auf den Arbeitsmarkt, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Wie die Männer bereits seit Beginn der Industrialisierung gerieten auch sie unter den Druck, ihr Leben eigenständig planen und entwerfen zu müssen, sie wurden aus den traditionalen Vorgaben herausgelöst und erlangten die Freiheit (bzw. sahen sich vor der Notwendigkeit), ihre Lebensplanung selbst in die Hand zu nehmen, kurz gesagt: sie durchliefen den Prozeßder Individuali- sierung. Heutzutage sind Frauen auf Erwerbstätigkeit angewiesen, da „die Ehe keine Garantie mehr für eine lebenslange Versorgung bietet“50, sie streben nach solider Aus- bildung, nach Selbstverwirklichung und beruflicher Anerkennung, „nach selbständiger ökonomischer Absicherung“51. Dies bedeutet aber gleichzeitig, daßauch sie sich den Erfordernissen des Arbeitsmarktes beugen müssen und somit nicht mehr unbegrenzt für die Pflege von Heim und Kindern zur Verfügung stehen. Während in früheren Zeiten nur der Mann im Berufsleben stand und die Frau, zumindest in bürgerlichen Kreisen, einzig dafür zuständig war, die häusliche „Agentur für Harmonie und Frieden zu sein“52 und dem Mann ein Oase zu bieten, in der er sich vom Konkurrenzkampf des Berufsle- bens erholen konnte, dafür aber die (relative) Gewißheit einer gesicherten Existenz hatte, gehen heute üblicherweise beide Partner einer Erwerbstätigkeit nach, wodurch die Frauen materiell unabhängig geworden und somit nicht mehr auf einen Ehemann als Versorger angewiesen sind. Mit steigender wirtschaftlicher Unabhängigkeit geht auch die zunehmende Stärkung des weiblichen Selbstbewußtseins einher, die es den Frauen ermöglichte, sich auch in anderen Lebensbereichen, nicht zuletzt auf dem Gebiet der Sexualität, von traditionellen Vorgaben freizumachen und schließlich auch in ihren Beziehungen Forderungen zu formulieren, die oft nicht leicht mit denen des Partners zu vereinbaren sind. Die moderne Ehe ist nicht mehr ein von vornherein festgelegtes Ab- hängigkeitsverhältnis, in dem die Frau sich, um ihre Existenzgrundlage nicht zu verlie- ren, nach den Vorstellungen des Mannes richten muß, sondern die Partner stehen sich - im Prinzip - gleichberechtigt gegenüber. Bei näherer Betrachtung wird jedoch schnell klar, daßvon einer wirklichen Gleichberechtigung der Frau weder im Beruf noch inner- halb der Paarbeziehungen (bisher) die Rede sein kann. Denn in der Frage der Gleichbe- rechtigung steht den „Veränderungen im Bewußtsein“ diametral die „Konstanz im Verhalten und der Lagen von Männern und Frauen gegenüber.“53 Zwar würden nur wenige Männer es heutzutage noch wagen, offen dafür zu plädieren, das als antiquiert geltende bürgerliche Eheideal wieder ‘einzuführen’, sondern im Gegenteil wünscht sich Umfragen zufolge der ‘Mann von heute’ eine selbstbewußte, selbständige Frau, die ihre Angelegenheiten autonom zu regeln in der Lage ist. Auch Berufstätigkeit von Frauen ist inzwischen sozial anerkannt und gewünscht. Doch spätestens dann, wenn sich Kinder einstellen, treten die Widersprüche zu Tage: Kindererziehung gilt auch heute noch als ‘Frauensache’, es wird von der „Gebärfähigkeit der Frau auf die Zuständigkeit für Kind, Hausarbeit, Familie und daraus auf Berufsverzicht und Unterordnung im Beruf ge- schlossen.“54 Schon die Tatsache, daßder Erziehungsurlaub, der nach heute geltendem Recht in bis zu dreimaligem Wechsel beiden Elternteilen zusteht, zum überwiegenden Teil von Frauen in Anspruch genommen wird, macht deutlich, daßweiterhin den Frau- en die Verantwortung für Haus und Kind zugesprochen wird. Das neue Wunschbild des Mannes ist „die Frau, die je nach Interessen des Mannes zugleich selbständig ist und hinreichend anpassungsbereit“55 ist, der ‘Hausmann’ hingegen bleibt die absolute Aus- nahme. Die Frauen wiederum aber können (schon aus rein wirtschaftlichen Gründen) und wollen zumeist auch nicht zurück in das Abhängigkeitsverhältnis der Hausfrauene- he, sondern fordern ihr Recht auf berufliche Selbstentfaltung ein.56 Da sie somit nicht mehr unbegrenzt für Hausarbeit und Kindererziehung zur Verfügung stehen, ist nun die gleichberechtigte Aufteilung der familiären Aufgaben gefordert. Mit dem Auszug der Frauen aus den traditionellen Geschlechterrollen wurde der herkömmlichen Form der Kleinfamilie der Boden entzogen, und es sind bislang keine überzeugenden Lösungen gefunden worden, wie es Männern und Frauen gelingen kann, Familie und Beruf zu vereinbaren, zumal das Problem der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienarbeit auch nach wie vor maßgeblich die Frauen betrifft.
2.2.5 Folgen der allgemeinen Individualisierung für die Paarbeziehung
Wie aber wirkt sich die allgemeine Individualisierung auf die konkrete Paarbeziehung aus? Während früher allein der Mann den ‘neuen Zwängen’ der Individualisierung und den Anforderungen des Arbeitmarktes unterlag, betreffen diese heute beide Partner. Das bedeutet, daßin der Beziehung zwei Wahlbiographien, zwei Arbeitsmarktkarrieren miteinander in Einklang gebracht werden müssen, woraus folgt, daßjeder das Paar betreffenden Entscheidung lange, mühselige Diskussionen vorangehen. Während früher die berufliche Stellung des Mannes die Lebensverhältnisse einer Familie bestimmte, müssen heute zwei Lebensläufe verzahnt werden. Dies erfordert mühselige Verhand- lungen und Kompromißbereitschaft auf beiden Seiten. Die Frage lautet: „Wie viel Raum bleibt in der selbstentworfenen Biographie mit all ihren Zwängen für einen Part- ner mit eigenen Lebensplänen und Zwängen?“57, oder auch: ‘Wie viele Zugeständnisse kann jeder machen, ohne daßseine eigene berufliche und persönliche Selbstentfaltung in Gefahr gerät?’. Während früher die Ehe eine Art symbiotische Beziehung war, in der Mann und Frau sich - bei allen daraus für die Frau resultierenden Einschränkungen - gegenseitig ergänzten, in der beide Teile aufeinander angewiesen waren, stellt sie heute den Zusammenschlußzweier eigenständiger Individuen dar, die jeweils auf ihrem ent- sprechenden Status beharren. Die Balance von Nähe und Distanz mußdaher das ganze Eheleben hindurch immer wieder neu austariert werden.
Hinzu kommt, daßMann und Frau zumeist in vollkommen verschiedenen Lebenswelten leben, es gibt keine „gemeinsame Arbeit, kaum noch einen gemeinsamen Alltag“58, der sie verbindet, gleichzeitig aber erwarten beide von der Partnerschaft, daßsie den emoti- onalen Ausgleich zu den im Beruf erbrachten Anstrengungen ermöglicht und das per- sönliche Glück garantiert. Das Leben erscheint für beide Geschlechter gleichsam hal- biert: auf der einen Seite steht der Bereich des Berufslebens mit seinen spezifischen Anforderungen, auf der anderen der Bereich der Ehe oder Familie, die das Gegenge- wicht darstellen und als Raum für all das herhalten sollen, was im Erwerbsleben zu kurz kommt. Die Beziehung wird emotional überfrachtet, die Enttäuschung (und daraus nicht selten resultierend: die Trennung) erscheinen fast schon vorprogrammiert.
Als Fazit der beiden vorangegangenen Abschnitte, die freilich nur schlaglichtartig die Folgen des gesellschaftlichen Wandels in den letzten 30 Jahren beleuchten konnten, kann festgehalten werden, daßviele Probleme heutiger Ehen auf die „Widersprüche zwischen traditionellem Ehebild und neuer gesellschaftlicher Situation“59 zurückzufüh- ren sind. Die Anforderungen von Arbeitsmarkt und Familie, das Bedürfnis nach berufli- cher Entfaltung und familiärem Glück scheinen unvereinbar zu sein. Gefragt sind ob dieser Situation vor allem familien- und arbeitspolitische Maßnahmen, die die Verein- barkeit von Erwerbs- und Familientätigkeit ermöglichen und so die Eheleute und Fami- lien entlasten, doch kann auf diesen sehr umfangreichen Themenkomplex im Rahmen dieser Arbeit nicht eingegangen werden.60 Gleichzeitig aber wurde deutlich, daßauch in der Einstellung der Partner, die ‘bei aller Liebe’ immer auch ihre je persönlichen Be- dürfnisse nach Selbstverwirklichung und -entfaltung im Auge haben, ein hohes Kon- fliktpotential für die Partnerschaft begründet liegt.
2.2.6 Die neue Einstellung zum Kind
Da auch heute noch die Ehe in den meisten Fällen die Zeugung und Erziehung von Nachkommen zum Ziel hat,61 müssen hier einige Worte über die ‘gewandelte Einstel- lung zum Kind’ verloren werden. Wie bereits angemerkt, ist auch die Emotionalisierung der Beziehung zum Kind eine Erscheinung des letzten Jahrhunderts. In vorindustrieller Zeit ‘benötigte’ man Kinder zunächst aus ökonomischen Gründen, nämlich als „Ar- beitskräfte in Haus und Hof, zur Alterssicherung der Eltern, zur Vererbung von Besitz und Namen.“62 Entsprechend war die Erziehung der Kinder der Existenzsicherung untergeordnet, sie wurden frühzeitig in den Produktionsprozeßeingegliedert, einen „Schonraum für die Lebensphasen der Kindheit und Jugend im heutigen Sinne kannte man nicht“63. Kinder wurden im Prinzip wie Erwachsene behandelt. Durch die man- gelnden Möglichkeiten der Empfängnisverhütung wurden viele Kinder geboren, gleich- zeitig aber waren die Überlebenschancen von Kindern aufgrund der hohen Säuglings- sterblichkeit sehr gering. Insofern war das einzelne Kind kein Objekt intensiver emotio- naler Zuwendung, es wurde geboren, es überlebte oder häufig auch nicht, sein Verlust wurde bedauert, aber er war kein Grund zur Verzweiflung.
Erst im 19. Jahrhundert änderte sich die Einstellung zum Kind, bedingt zum einen durch den auf Verbesserung der hygienischen Verhältnisse und neuen medizinischen Erkennt- nissen beruhenden Rückgang der Säuglings- und Kindersterblichkeit, zum anderen dadurch, daßman begann, sich über die Eigenarten und Bedürfnisse von Kindern Ge- danken zu machen und Kindheit und Jugend nun als eigenständige, vom Erwachsenen- alter völlig verschiedene Lebensphasen anerkannte.64 Gleichzeitig wurde, wie oben beschrieben, der Erziehung als Vorbereitung auf das Leben ein hoher Stellenwert einge- räumt (vgl. S. 4), eine Tendenz, die sich bis heute extrem verstärkt hat.65 Heute lautet das oberste Gebot von Erziehung, Kinder ihren Fähigkeiten und Begabungen entspre- chend optimal zu fördern. Die Ansprüche, die die Gesellschaft und dementsprechend auch die Eltern an sich selbst haben, sind immens. Es beginnt damit, daßman ein Kind erst dann bekommt, wenn man in der Lage ist, ihm auch materiell etwas zu bieten. Kinder stellen heute eine zunehmend hohe finanzielle Belastung dar, bedingt nicht zuletzt durch die sich ständig verlängernden Ausbildungszeiten. Tritt dann auch noch das Gebot der ‘optimalen Förderung’ hinzu, so bedeutet dies, daßverantwortungs- bewußte Eltern, die das Wohl ihres Kindes im Auge haben, mit der Entscheidung für ein Kind so lange warten, bis sie es sich finanziell leisten können.66 Doch allein mit den materiellen Voraussetzungen ist es noch nicht getan, denn worauf es nun ankommt, ist, dem Kind auch in jeder anderen Hinsicht die besten Voraussetzungen zu bieten. Dieses Bestreben beginnt im Extremfall schon vor der Zeugung, bestimmt die Schwangerschaft - die Anzahl der Ratgeber zu Schwangerschaft und Geburt ist ins Unüberschaubare gestiegen - und die Geburt. Wer sein Kind liebt, der ist quasi verpflichtet, sich durch Berge von Literatur zum Thema zu wälzen, verschiedene Expertenmeinungen zu sich- ten und zu bewerten, um nur ja nichts falsch zu machen und das Kind dadurch womög- lich physisch oder psychisch zu schädigen. Ist das Kind dann geboren - natürlich nach der besten der zahlreichen heute möglichen Gebärmethoden - so läßt der Druck keines- falls nach, sondern nun zerbrechen sich junge Eltern den Kopf über Stillen oder Nicht- Stillen, die richtige Bekleidung, das richtige Spielzeug, die kindgerechte Umgebung, später dann über die richtige Sportart, den richtigen Urlaubsort, die richtige Schule etc. Die Unsicherheit, die Angst, das Falsche zu tun begleitet Mütter und Väter und setzt sie unter enormen Druck, das Kind wird, neben der finanziellen, auch zur psychischen Belastung.
Auf der anderen Seite aber steht der unschätzbare ‘psychologische Nutzwert’ des Kin- des. Das Verhältnis von Eltern zum Kind hat eine ähnliche Entwicklung erfahren wie die zum Ehepartner: mit dem Wegfall der ökonomischen wurde es für ‘private’ Interes- sen geöffnet und „zunehmend bestimmt von den wachsenden, ja vielfach auch wu- chernden emotionalen Bedürfnissen, die im Zuge von Individualisierungsprozessen entstehen“67. Wo der einzelne in seiner Arbeitsmarktexistenz beständig unter dem Druck steht, zweckrational zu handeln, zu planen, zu entscheiden, sich durchzusetzen, stellt das Kind den Gegenpol dar, es vermittelt das Gefühl, gebraucht zu werden, die Erfahrung von zweckfreier Hingabe und selbstloser Übernahme von Verantwortung, von Zärtlichkeit, Offenheit, Natürlichkeit und Nähe und - vor allem - von Sinn. In einer Umgebung, in der sich der einzelne zunehmend entwurzelt fühlt, in der keine Bindung, nicht einmal die an den eigenen Ehegatten, mehr verläßlich erscheint, wird das Kind zur „Möglichkeit, dem eigenen Leben Sinn, Inhalt und Anker zu schaffen“68. Die Bindung an das Kind scheint endlich das Bedürfnis nach bedingungsloser gegenseitiger Annah- me zu erfüllen. Entsprechend rangiert Umfragen zufolge das Kind als Lebenssinn vor allen anderen Dimensionen, wie etwa Beruf, Selbständigkeit oder auch Ehe.69 Darüber hinaus übertragen viele Eltern ihre enttäuschten Hoffnungen und Erwartungen auf das Kind, das nun alles schaffen soll, was ihnen selbst nicht gelungen ist.70 Die Kehrseite dieser extremen Emotionalisierung der Beziehung zum Kind ist offensichtlich: leicht schlägt das wohlgemeinte ‘Fördern’ des Kindes in Überforderung um, schnell wird, wenn das Kind die an es gestellten Anforderungen, sei es auf reeller oder ideeller Ebene nicht erfüllt, „die enttäuschte Liebe zur grausamen Liebe“71.
Wie aber wirken sich die Überemotionalisierung der Beziehung zum Kind und das ‘Ge- bot der optimalen Förderung’ auf die Beziehung der Eltern zueinander aus? Die hohen Anforderungen, die die Betreuung der Kinder an den dafür zuständigen Elternteil - nach wie vor in der Regel die Mutter - stellen, führen häufig zu einem Gefühl der Über- forderung, eigene Belange werden zugunsten des Kindes zurückgestellt, häufig ist Unzufriedenheit die Folge. Oft dreht sich das gesamte Leben einer jungen Familie um das oder die Kind(er), die Konzentration auf den Nachwuchs läßt häufig nur wenig Raum für die Pflege der Paarbeziehung. Alle Energie wird für das Kind verbraucht, die Eheleute geraten in Gefahr, sich einander zu entfremden, insbesondere, wenn einer von beiden ganztägig außerhäuslich erwerbstätig ist, während der andere sich ausschließlich um den Nachwuchs kümmert. Da sowohl institutionelle Kinderbetreuungseinrichtungen als auch Großmütter oder Freunde und Bekannte zur Betreuung des Kindes nur begrenzt zur Verfügung stehen, mußeiner der Partner nahezu immer für die Beaufsichtigung des Kindes zur Verfügung stehen, so daßgemeinsame Unternehmungen entweder ganz unterbleiben oder auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt werden müssen. Es liegt auf der Hand, daßKinder nicht unbedingt stabilisierende Funktion für eine Beziehung haben müssen, obwohl die gemeinsame Verantwortung für die Kinder die Eltern natür- lich auch fester aneinander binden kann, sondern daßsie durchaus auch eine Belastung für eine Paarbeziehung darstellen können.
2.2.7 Veränderungen im Lebenszyklus
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Funktion der Ehe wie auch ihre Stellung im Lebenslauf des einzelnen entscheidend verändert, was vor allem auf die gewandelten beruflichen Anforderungen zurückzuführen ist: durch die zunehmende Spezialisierung in der Berufswelt haben sich die Ausbildungszeiten deutlich verlängert, was dazu ge- führt hat, daßwirtschaftliche Unabhängigkeit und somit ‘Ehefähigkeit’ erst in einer späteren Lebensphase erreicht werden - dementsprechend ist auch das durchschnittliche Erstheiratsalter gestiegen, es lag im Jahre 1996 für Frauen bei 27,7, für Männer bei 30,1 Jahren.72 Gleichzeitig aber ermöglicht der gestiegene Wohlstand Kindern früher die Gründung eines eigenen Haustandes. Eine neue Lebensphase ist entstanden, die Phase der Postadoleszenz 73, die sich zwischen Jugend und Erwachsenenalter schiebt. In Hin- sicht auf Beziehungen ist diese eine Phase des Experimentierens: Beziehungen werden geknüpft und wieder aufgelöst, häufig ziehen Paare auch zusammen, ohne daßman gleich von einer Vor-Ehe 74 sprechen könnte, denn in Anbetracht der Tatsache daßdiese Form des Zusammenlebens zumeist „unter dem Vorbehalt jederzeitiger, formloser und sofortiger Kündigung“75 steht, sind diese Beziehungen häufig nicht von Dauer - nichts- destotrotz darf aber wohl unterstellt werden, daß, wer mit dem geliebten Menschen zusammenzieht, zumindest insgeheim „hofft, eine Partnerin, einen Partner fürs Leben zu finden“76. Dadurch, daßein Großteil der Paare heute schon vor der Eheschließung zusammenlebt und insofern die Möglichkeit besteht, miteinander Beziehungserfahrung zu sammeln, ist die Zahl der Scheidungen in den ersten beiden Ehejahren zurückgegangen, die meisten Scheidungen fallen heute in das sechste bis siebte Ehejahr.77
Hat ein Paar sich schließlich für Heirat und Familiengründung entschieden, so beginnt ein Ablauf von verschiedenen Ehephasen, die Thomas KIEFER wie folgt benennt: 1. Vorbereitungs- und Aufbauphase (Paarbildung und Planung des gemeinsamen Lebens- weges), 2. Beginn der Expansionsphase (Geburt des/der Kinder), 3. Phase der Primär- sozialisation, 4. Phase der Familie mit schulpflichtigen Kindern, 5. Familie während der Adoleszenz der Kinder, 6. Familie in der Spätphase der Adoleszenz der Kinder, 7. Kontraktionsphase (Selbständigwerden der Kinder), 8. Altersphase.78 Jede dieser Pha- sen hat ihre spezifischen Schwierigkeiten: so müssen sich in der Vorbereitungs- und Aufbauphase die Partner nach dem Single-Dasein zuerst einmal an den neuen Lebens- stil zu zweit gewöhnen, es mußgemeinsam erarbeitet werden, wie das Zusammenleben zur Zufriedenheit beider Partner geregelt werden kann. Aufgrund der möglicherweise erst jetzt offenbar werdenden unterschiedlichen Vorstellungen beider Partner kann es leicht zu Spannungen kommen. Während dieser ersten Phase sind zumeist noch beide Partner berufstätig. Mit dem Übergang in die Expansionsphase ergeben sich neue Prob- leme: die Rund-um-die-Uhr-Betreuung des/der Säugling(e) und Kleinkinder stellt für das Paar, meist aber vor allem für die Mutter, eine hohe psychische und physische Belastung dar. Darüber hinaus leiden Mütter von Kindern im Vorschulalter, die ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Kindererziehung unterbrochen oder aufgegeben haben, häufig unter dem Verlust der Außenkontakte und dem daraus resultierenden Gefühl der Isolation. Viele Frauen versuchen dem zu entgehen, indem sie, sobald die Kinder schul- pflichtig geworden sind, zumindest als Teilzeitkräfte wieder ins Berufsleben zurückkeh- ren,79 doch führt der Spagat zwischen Kindererziehung und Beruf sehr häufig zur Über- lastung der berufstätigen Mütter. Zudem sind sie auch in ihrem Beruf vielfach unzufrie- den, da die Arbeit in Teilzeit meist keinerlei Aufstiegschancen bietet. Die psychische Unzufriedenheit der Frauen in der 4. und 5. Ehephase stellt eine große Belastung für die Ehe dar, zumal „durch die Rollenteilung die Kommunikation des Paares stark einge- schränkt ist.“80 In den Phasen 5 und 6 erfolgt die Ablösung der Kinder vom Elternhaus, die Familienstruktur ändert sich grundsätzlich: die Kinder, die bis dahin der Autorität der Eltern unterstanden haben, erlangen allmählich gleichberechtigten Status - dies geht in den seltensten Fällen ohne Auseinandersetzungen innerhalb der Familie vonstatten. Zudem neigen Eltern dazu, den Kindern die Abnabelung eher zu erschweren.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die Kontraktionsphase: Durch die gestiegene Lebenserwartung ist die Erziehung der Kinder nicht mehr länger der Hauptinhalt, son- dern nur noch einer von mehreren Abschnitten des ehelichen Lebens, an den sich eine lange postfamiliale Phase anschließt. Besonders Frauen, die nicht berufstätig waren empfinden, diese Phase des ‘leeren Nests’ als problematisch, da sie sich mit dem Aus- zug der Kinder aus dem elterlichen Haushalt ihrer bisher primären Aufgabe, der Sorge für Mann und Kinder, beraubt sehen. Das Gefühl von Überflüssigkeit und Sinnentlee- rung ist häufig die Folge. Nicht selten entstehen in der Kontraktionsphase aber auch schwerwiegende Beziehungsprobleme, da die Partner plötzlich feststellen, daßsie ohne die gemeinsame Aufgabe der Sorge für die Kinder nicht mehr in der Lage sind, ihre Zweierbeziehung „existentiell auszufüllen“81, man stellt fest, daßman ‘sich nichts mehr zu sagen’ hat, in der familiären Phase unterdrückte Konflikte brechen wieder auf.82 Dies manifestiert sich im drastischen Anwachsen der Anzahl von Spätscheidungen: über 30% aller Scheidungen erfolgen heute zwischen dem 15. und 25. Ehejahr.83
Die lange Reihe von Ehephasen verdeutlicht einen Sachverhalt, der bei der Sichtung der Ursachen für die Krise der Ehe nicht außer acht gelassen werden darf, nämlich, daßeine Ehe heute wesentlich länger dauert, als noch im letzten Jahrhundert, als die geringe Le- benserwartung auch die Ehedauer beschränkte. Heute hat ein Paar, das im Alter von 25 Jahren heiratet, von der Lebenserwartung der Partner her gesehen gute Chancen, seine Goldene Hochzeit (also das 50jährige Ehejubiläum) noch zu erleben, während in der vorindustriellen Zeit die Gesamtehedauer einschließlich der postfamilialen Phase höch- stens 36 Jahre betrug.84 Die sich daraus ergebenden Probleme sind evident: eine längere Ehe bedeutet eine umfangreichere Abfolge von Phasen in der Entwicklung des einzel- nen, zumal in der heutigen Zeit, da das Streben nach Selbstverwirklichung sich in stän- diger Neuorientierung des einzelnen manifestiert und sich die Gefahr, daßsich die Partner vollkommen auseinander entwickeln, potenziert.
2.3 Die irdische Religion der Liebe
„Frau Mutter, was meint Liebe?“85 lautet einer der letzten Sätze des bekannten Romans ‘Schlafes Bruder’ von Robert Schneider, und genau das ist die Frage, mit der sich die folgenden Abschnitte beschäftigen wollen. Nun ist über die Liebe in der Kultur- geschichte der Menschheit viel gesagt und geschrieben worden, ohne daßdabei mehr ‘herumgekommen’ wäre als die Erkenntnis, daßder Liebe mit Rationalität kaum ge- recht zu werden ist: die Liebe ist nicht widerlegbar, nicht begründbar, nicht diskursiv wahrheitsfähig. Zudem ist das Bedeutungsfeld, das im Deutschen mit dem Begriff ‘Liebe’ abgedeckt werden soll, nahezu unüberschaubar, weil es diverse Formen und Arten von Liebe umfaßt. Schon deshalb entzieht sich die Liebe weitgehend einer Definition. Wenn die folgenden Passagen nun trotzdem von der Liebe handeln, so bleiben auch diese Aussagen ohne den Anspruch, die ‘Wahrheit’ über die Liebe zu enthalten. Es soll vielmehr darum gehen, zu fragen, was das für eine Liebe ist, die heute die Basis der meisten Ehen oder Partnerschaften ist, welchen Stellenwert sie im Leben des einzelnen einnimmt und warum sie so krisenanfällig ist.
Bevor auf das heute allgemein verbreitete „»bürgerliche« Verständnis der Liebe“86, eingegangen wird, erscheint es, um zu verdeutlichen, wo die Problematik dieses neu- zeitlichen Liebesverständnisses liegt, sinnvoll, zunächst kurz zu skizzieren, was das christliche Verständnis von Liebe ist (vgl. Kap. 5.3.1). Nach christlicher Auffassung ist die Liebe eine den Menschen von Gott geschenkte Gabe, die immer auf Gott bezogen bleibt; wo sich ein Individuum auf die Liebe zu einem anderen Menschen einläßt, läßt es sich nach christlicher Interpretation immer auch auf Gott ein,87 Gottes- und Nächs- tenliebe bedingen sich gegenseitig. Die Liebe zum Menschen ist die „Vermittlung, ohne welche die Gottesliebe, das rechte Wissen um Gott und unsere wahre und volle Bezie- hung zu ihm, gar nicht möglich ist.“88 In der Liebe erfährt der Mensch das Glück der einenden Begegnung, das Gefühl des Angenommenseins, aber er erfährt auch, daßdie Liebe immer von Untreue, Trennung und Tod bedroht ist und daß„der Partner nicht die volle, erschöpfende Antwort auf die Sehnsucht des Herzens ist.“89 Denn indem der Mensch sich eine Liebe wünscht, die ewig und absolut ist, sehnt er sich nach der Liebe Gottes. In der Liebe zum Menschen aber scheint diese Liebe Gottes auf, sie ist gewis- sermaßen ein „Vorgeschmack der alle Sehnsucht beantwortenden Liebe Gottes“90 und immer von der göttlichen Gnade umfangen und gehalten. Wenn sich der Liebende diesen transzendentalen Charakter seiner Liebe zum Menschen ins Bewußtsein ruft, so wird er erkennen, daßin aller menschlichen Liebe immer auch Gott gemeint ist, der den Grund und das Ziel aller Liebe darstellt, der sie trägt und erhält. Vor diesem Hinter- grund kann der schwache, bedingte Mensch den Partner nur unbedingt annehmen, indem er sich selbst und den Partner unbedingt angenommen weiß. Die Erkenntnis dieser transzendentalen Dimension der Liebe ist für die konkrete Beziehung sehr wich- tig, denn sie bewahrt die Liebenden davor, ihr Heil in der Liebe selbst oder im Partner zu suchen, und motiviert sie, diesen „in seiner Bezogenheit auf Gott zu bejahen und, wo nötig, kritisch zu unterstützen.“91 Überdies verheißt die christliche Glaubensbotschaft, daßdie Liebe nicht mit dem Tode endet und somit letztlich doch vergebens bleibt, sondern daß„jede Tat der Liebe und das ganze in ihrem Dienst eingesetzte Leben [...], daßdies alles aufgehoben ist und uns zurückgegeben wird zu unserer eigenen Vollen- dung in einer endlich gelingenden und allem Glücksverlangen gerecht werdenden Ge- meinschaft von Liebenden.“92
In krassem Gegensatz zu diesem Verständnis der menschlichen Liebe steht das ‘bürger- liche’ Liebesverständnis der heutigen Zeit, obwohl auch dieses durchaus religiöse Züge trägt, allerdings in einem eher negativen Sinne: die Liebe scheint heute im Leben des einzelnen den Stellenwert eingenommen zu haben, der „früher der Religion vorbehalten war“93, insofern sie unter dem Anspruch steht, dem Menschen zum Heil zu verhelfen. Jeder Mensch empfindet, mehr oder weniger bewußt, eine „grundlegenden Disharmo- nie“94 seines Daseins, die dadurch entsteht, daßer im Gegensatz zum Tier nie ganz mit sich selbst im Einklang sein kann, er sehnt sich danach, diese Disharmonie zu überwin- den und ‘heil’ zu werden. Alle Religionen versuchen auf die eine oder andere Weise, den Menschen mit sich selbst zu versöhnen, indem sie ihm die Erfahrung vermitteln, Teil einer höheren Ordnung zu sein, ihm zumindest partiell die Vereinigung mit der ‘umfaßenden Ganzheit’ ermöglichen. Vor der allgemeinen Individualisierung waren die meisten Menschen im christlichen Abendland per se in einen religiösen Gesamt- zusammenhang und in eine religiöse Symbolwelt eingebunden, in denen sie immer wieder daran erinnert wurden, daßsie mit ihrer Sehnsucht nach Erlösung und Heil letztlich auf eine jenseitige Wirklichkeit verwiesen waren. Mit dem Bedeutungsverlust der institutionalisierten Religion (vgl. Kap. 3) in den westlichen Industriegesellschaften ging diese religiöse Einbindung verloren; die religiöse Symbolwelt gehört nicht mehr zum täglichen Leben, sondern wird als fremd empfunden, die religiösen Formen schei- nen nicht mehr in der Lage zu sein, dem einzelnen Perspektiven zu eröffnen, die ihm helfen können, die Disharmonie seines Daseins zu bewältigen. Das bedeutet aber kei- nesfalls, daßdamit die Sehnsucht nach Erlösung, nach Vereinigung mit dem Ganzen verschwunden wäre. Doch jetzt tritt an die Stelle des Glaubens an Gott der „leiden- schaftliche Glaube an die Liebe“95, sie wird zur Ersatzreligion, die als einzige in unserer durch Rationalität und ‘Machbarkeitswahn’ geprägten Welt noch Sinnerfahrung zu vermitteln imstande zu sein scheint. Die Liebe ist „die kirchenlose und priesterlose »Religion«“96 der heutigen Zeit. Diese ist gekennzeichnet zum einen durch ihre Pri- vatheit: sie ist institutionsunabhängig, das Gelingen der Liebe und somit des Lebens liegen in der Verantwortung des einzelnen bzw. des Paares. Zum anderen durch ihre radikale Diesseitigkeit, d.h. daßdie Erfüllung des Verheißenen vor Ort eingefordert wird: „das ‘Glück in der Liebe’ wird von vielen Menschen mit ‘Erlösung’ gleichge- setzt.“97 Gemeint ist hiermit jedoch im Unterschied zur Verheißung der Religion eine ‘diesseitige’ Erlösung, „es fehlt das Erbarmen des Jenseits, mit dem die Religionen die Konflikte und das überbordende der Ansprüche zugleich entladen und erfüllen konn- ten.“98 In dieser Überhöhung der personalen Liebe „spiegelt sich noch einmal der Weg der Moderne. Die Überhöhung ist das Gegenbild zu den Verlusten, die diese hinterläßt. Gott nicht, Priester nicht, Klasse nicht, Nachbar nicht, dann wenigstens Du. Und die Größe des Du ist die umgedrehte Leere, die sonst herrscht“99 - mit anderen Worten: es ist die Angst vor der Leere, vor der Einsamkeit, vor der Sinnleere, die Beziehungen zusammenhält. Und mit der Anforderung an die Beziehung, die ‘Erlösung’ zu bringen, wird der ‘Heilsanspruch’ letztlich über die Beziehung, über den konkreten Partner gestellt, die Liebe wird „zum Vehikel eigener Selbstverwirklichung“100.
Es erscheint müßig darauf hinzuweisen, daßkein Partner und keine Beziehung diesen Heilsanspruch auf die Dauer zu erfüllen in der Lage sind und somit am Ende einer Beziehung, die unter solchen Voraussetzungen geschlossen wurde, zwangsläufig die Enttäuschung stehen muß. Die Liebe ist zwar dem Menschen von Gott geschenkt und immer auf ihn hin transparent, sie eröffnet, nicht zuletzt in der Sexualität, Transzen- denzerfahrung, aber sie ist nicht Gott, sie kann niemals die menschliche Sehnsucht nach Transzendenz, nach ‘Heil’ erfüllen, sie ist „ nicht das Letzte [...] und auch nicht das Ab- solute “101, sondern bleibt menschlich und damit Stückwerk, sie befreit nicht aus der menschlichen Begrenztheit. Auch eine ‘gute’ Beziehung kann den Menschen letztlich nicht vor der Erfahrung der Vereinzelung bewahren, vor der Erkenntnis, daß„man irgendwo und irgendwie vom Partner unüberbrückbar verschieden und geschieden ist.“102
Wo die Liebe unter dem Anspruch steht, das persönliche Glück zu garantieren, geht au- ßerdem die Fähigkeit zur Selbstdistanzierung verloren, d.h. es gibt es keinen Standpunkt mehr außerhalb der unmittelbaren Beziehungserfahrung, das Gelingen oder Scheitern der persönlichen Beziehungsgeschichte erhält den Anschein des Unbedingten, es wird „zur Entscheidung über Sinn und Unsinn des Lebens“103. Vor diesem Hintergrund wird nur zu verständlich, daßin der Bundesrepublik die meisten Selbstmorde im Zusammenhang mit Beziehungsproblemen stehen.104
Wie aber kommt es, daßviele Menschen heute, ihr Heil in der Liebe suchen? Wie be- reits angedeutet ist die Apotheose der Liebe eine Reaktion auf den Wegfall anderer Möglichkeiten der Transzendenzerfahrung und Kontingenzbewältigung. Der ‘moderne Mensch’ ist vielfach nicht mehr religiös sozialisiert, er sucht, nicht zuletzt beeinflußt durch das ‘romantische’ Liebesideal, das ihm die Medien vermitteln,105 Sinn und Halt in der Paarbeziehung - und mußdoch feststellen, daßseine Sehnsucht nach Ganzheitlich- keit vom Partner letztlich nicht erfüllt wird. Viele Menschen sind sich nicht im Klaren darüber, daßihre Sehnsucht eine im Kern religiöse ist, sie erkennen nicht, daßdie Liebe zum Partner sie zwar auf ein Ziel verweist, daßsie aber noch nicht das Ziel ist. Hans JELLOUSCHEK sieht in dieser Problematik einen der Hauptgründe für das zahllose Schei- tern von Beziehungen: ohne die gemeinsame Bezogenheit auf ein transzendentes Drittes innerhalb einer Paarbeziehung wird es für die Partner unendlich viel schwerer, auch in Krisensituationen ihrer Beziehung „den Rest von Sinn und Hoffnung aufzulesen, um dessentwillen es sich vielleicht dennoch lohnt, den gemeinsamen Weg fortzusetzen“106.
3 KIRCHE IN DER POSTMODERNE
Nachdem im vorangegangenen Kapitel die Situation der Ehe mit ihren spezifischen Schwierigkeiten heute betrachtet wurde, soll nun ein Blick auf die Kirche in der Post- moderne geworfen werden. Auch an ihr und ihren Mitgliedern sind die gesellschaftli- chen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte keinesfalls spurlos vorübergegangen, son- dern haben im Gegenteil dazu geführt, daßsich die Kirche heute völlig anderen Voraus- setzungen gegenüber sieht als noch vor 50 Jahren. Die folgenden Abschnitte möchten kurz skizzieren, wie die gesellschaftlichen Umwälzungen sich für die Kirche ausgewirkt haben und vor welcher Situation sie sich heute sieht. Hierbei wird im Hinblick auf das Gesamtinteresse dieser Arbeit der Schwerpunkt auf die Situation der Sakramentenpasto- ral zu legen sein.
3.1 Die Krise der Sakramentenpastoral
Daßsich die Sakramentenpastoral in einer Krise befindet, ist inzwischen unübersehbar geworden. Da treten beispielsweise Menschen mit dem Wunsch nach einem Sakrament an die Kirche heran, die keinerlei Kirchenbindung haben und weiteren Kontakt zur Gemeinde auch nicht wünschen. Sie bringen keinerlei Glaubenswissen mit und haben z.T. auch kein Interesse daran haben, sich auch nur ein Mindestwissen anzueignen. Nach erfolgter Sakramentenspendung verschwinden sie wieder aus dem Blickfeld der Gemeinde. Was bleibt, ist ein bitterer Nachgeschmack beim Amtsträger und, wenn der Sakramentenspendung, wie etwa bei Erstkommunion und Firmung üblich, eine kateche- tische Unterweisung vorausgegangen ist, bei den Katecheten und die bange Frage: darf mit den Sakramenten als Grundvollzügen der Glaubensgemeinschaft so inflationär verfahren werden? Gerät durch eine solche Praxis nicht die eigene Glaubwürdigkeit in Gefahr? Haben wir bei dem Versuch, diesen Menschen das Evangelium nahezubringen versagt? Die Schere zwischen kirchlicher „Praxis von Feier und Spendung der Sakra- mente und Rückgang von Glauben und Glaubensleben“107 scheint sich immer weiter zu öffnen.
Wie aber kommt es, daßso viele Katholiken sich vom institutionell verfaßten Christentum abgewandt und keinen Bezug mehr zu seinen Vollzügen haben? Ist der Anspruch, der in der Sakramentenspendung erhoben wird, vielleicht vor dem Hintergrund der derzeitigen religiösen Situation in der Bundesrepublik gar nicht mehr aufrechtzuhalten? Die folgenden Abschnitte möchten diesen Fragen nachgehen.
3.1.1 Entwicklung des Katholizismus in der Postmoderne
Daßdie Kirche für das Leben des einzelnen im Vergleich zu früheren Zeiten erheblich an Bedeutung verloren hat, ist allgemein bekannt und läßt sich anhand von statistischen Daten belegen: die Zahl der Katholiken ist in der Bundesrepublik seit zwei Jahrzehnten rückläufig, nicht zuletzt bedingt durch die wachsende Anzahl der Kirchenaustritte.108 Gleichzeitig steigt die Zahl der ‘Fernstehenden’, d.h. jener Katholiken, die zwar in der Kirche verbleiben, aber nicht mehr am kirchlichen Leben teilnehmen, was sich exem- plarisch am kontinuierlichen Rückgang der Zahl der Gottesdienstteilnehmer aufzeigen läßt. Besuchten im Jahre 1960 noch ca. 46% der Katholiken den Sonntagsgottesdienst, so waren es 1997 noch nur 17,6%.109 Die Ursache dieser Entwicklung ist darin zu se- hen, daßder Trend zur Individualisierung längst auch den Bereich des Glaubens erfaßt hat. Noch vor wenigen Jahrzehnten war die Kirchenzugehörigkeit eines Katholiken weniger das Ergebnis einer persönlichen Entscheidung, sondern Folge seiner Herkunft aus dem katholischen Milieu. Er wurde geboren und der Konfession seiner Familie entsprechend getauft, er besuchte den Kommunions- und Firmunterricht, er heiratete nach katholischem Ritus - meistens innerhalb seines eigenen religiösen Umfeldes, konfessionsverschiedene Ehen waren erheblich seltener als heute110 -, er erzog seine Kinder in seinem Glauben, er engagierte sich in katholischen Vereinen, im Krankheits- falle ließer sich in einem Krankenhaus in katholischer Trägerschaft behandeln und schließlich wurde er katholisch bestattet. Die persönliche Glaubensentscheidung war ihm „abgenommen oder [wurde] doch durch das allseits christianisierte öffentliche und private Milieu erleichtert“111. Der Katholizismus war eine Sozialform, die alle Lebens- bereiche umfaßte und „eine hohe Geschlossenheit nach außen und eine prägende Kraft nach innen entwickelt hatte“112. Dieses Milieu hatte sich mit der Modernisierung und der daraus folgenden Entstehung der bürgerlich-modernen Industriegesellschaft in Abgrenzung vom modernen Weltbild entwickelt. Wo die Moderne „das Projekt der Weltbeherrschung als uneingeschränkte Ausführung menschlicher Autonomie“113 ver- hieß, das durch die Mobilmachung aller Fortschrittskräfte verwirklicht werden sollte, wo Wissenschaft und Vernunft als die einzigen Parameter angesehen wurden, an denen der Mensch sich zu orientieren hatte, wurde das Christentum im Zuge der beginnenden Ausdifferenzierung der Gesellschaft in spezialisierte und institutionalisierte Teilberei- che (vgl. S. 4) „in die Grenzen eines spezifischen Funktionsystems für Religion zurück- gedrängt“114. Die katholische Kirche reagierte darauf mit der „Ausbildung einer hoch- organisierten Sonderkultur [...] unter deutlicher Abgrenzung gegenüber den Grund- strömungen und -entscheidungen der Moderne“115 ; es entstand das katholische Milieu als kirchlich organisierte Sozialform. In den späten 50er Jahren unseres Jahrhunderts begann das katholische Milieu, wie auch sein Pendant, die sozialistische Arbeiterbewe- gung, abzuschmelzen. Maßgeblich für diese Entwicklung war vor allem, daßnun die traditionellen Substrate der bürgerlich-modernen Industriegesellschaft zu verschwinden begannen. War die aus dem 19. Jahrhundert stammende Gesellschaftsform noch „zur Hälfte eine vormoderne, traditionale und segmentär statt funktional differenzierte“116, so fielen diese Traditionsbestände nun im Zuge der Ausdifferenzierung der Gesell- schaft, der allgemeinen Individualisierung und der kulturellen Pluralisierung weg; die Großgruppenmilieus lösten sich auf. Die bürgerlich-moderne Industriegesellschaft wurde zur „entfaltet-moderne[n] Gesellschaft mit „post“-modernen Zügen“117. Die strukturell-gesellschaftlich begründete Individualisierung erfaßte den Menschen auch als Glied seiner Kirche und setzte ihn aus den sozialen Beziehungen seines Milieus frei, was sich natürlich auch auf seine religiöse Bindung auswirkte. Es begann ein Prozeßder religiösen Individualisierung, der zu einem Plausibilitätsverlust der überlieferten traditi- onellen Deutungsmuster führte. Herausgelöst aus ihrer bisherigen engen und exklusiven Bindung an die katholische Kirche blickten Katholiken um sich und stellten fest, daßsie auf einem „Erlebnismarkt“118 anderer Deutungssysteme standen, von denen der ‘Fort- schrittsmythos’ nicht das unattraktivste war, daßsich vor ihnen eine ‘schöne neue Welt’ anderweitiger religiöser Erfahrungsräume auftat, unter denen sie wählen konnten. Die Kirche verlor ihr Monopol auf Sinnvermittlung und somit ihre Autorität in Fragen der Lebensgestaltung, die christlichen Rituale - also auch die Sakramente - büßten ihre „Funktion als einheitsstiftende Gruppenrituale“119 (vgl. Kap. 4.2.7) ein. Das Individuum selbst war es nun, das sich auch im religiösen Bereich gemäßseinen Bedürfnissen zu entfalten trachtete und seine religiöse Autonomie einforderte. Diese „religiöse Subjekti- vierung“120 zog geradezu zwangsläufig das Infragestellen der Kirche als Institution nach sich. Die Kirchenmitglieder begannen, nicht zuletzt auch bedingt durch das steigende Bildungsniveau und die sich daraus ergebende höhere Reflexionsfähigkeit, sich kritisch mit der Institution Kirche auseinanderzusetzen und die Vor- und Nachteile einer Mitgliedschaft in derselben zu prüfen.
3.1.2 Tradierungskrise
Die Folge dieser Entwicklung ist die vielbeklagte „Tradierungskrise des Christen- tums“121. Gemeint ist damit eine Krise der Glaubensvermittlung, die „sowohl die Tra- dierung des Glaubenswissens als vor allem auch die Einführung und Einübung christli- cher Lebensform“122 betrifft. Mit der Auflösung des katholischen Milieus haben die ‘klassischen’ Tradierungsräume christlicher Deutungsmuster, die Familie und ihr sozia- les Umfeld der Verwandtschaft, der Nachbarschaft und der Gemeinde an Bedeutung verloren, sie sind nicht mehr in der Lage, eine christlich geprägte Sozialintegration zu leisten. Gleichzeitig überschüttet der kulturelle Pluralismus der heutigen Zeit den ein- zelnen mit einer solchen Vielzahl von z.T. widersprüchlichen Sozialisationseinflüssen, daß„eine festere Identifikation mit irgendwelchen Werten“123 verhindert wird. Die Folge ist, daßsich viele Katholiken nicht mehr mit ihrer Kirche identifizieren können und die kirchenbezogene Religiösität abnimmt.124 Nicht zuletzt beeinflußt durch das kritische Bild, das die Medien ihm von der Kirche zeigen, erlebt der einzelne diese als institutionellen Apparat,125 dem er nicht zugehört, sondern der ihm gegenübersteht und ihm zu allem Überflußauch noch diktieren will, wie er sein Leben zu gestalten habe. Es erscheint von daher fast schon verständlich, daßviele Katholiken gegenüber ihrer Kir- che eine distanzierte bis mißtrauische Haltung einnehmen. Damit einhergehend ist ein allgemeiner Schwund des Glaubenswissens festzustellen, der dazu führt, daßdiese Menschen auch kaum die Möglichkeit haben, sich mit dem, was Kirche ist und will, differenziert auseinanderzusetzen. Sie kennen die Kirche nicht mehr als einen Ort des gemeinschaftlichen Lebens und Glaubens, sondern als die Institution, die z.B. den ‘Sex vor der Ehe’ und die Verhütung ablehnt. Die Aussagen der Kirche, insbesondere in bezug auf die Sexualmoral erscheinen vielen Menschen als überholt, sie wenden sich von der Kirche ab und ggf. anderen Sinnanbietern zu. Die Tradierungskrise wird lang- fristig dazu führen, daßder christliche Glaube zur Gänze „verdunstet“126 oder zumin- dest in eine Ghetto-Existenz abgedrängt wird, wenn es der Kirche nicht gelingt, den Wegfall der traditionellen Lernräume des Glaubens durch katechetische Unternehmun- gen zu kompensieren.
3.1.3 Pluralisierung und Differenzierung innerhalb des Christentums
Trotz der Krise des institutionell verfaßten Christentums wäre es jedoch (noch) verfehlt, seinen völligen Untergang zu behaupten. Für die derzeitige Situation erscheint es tref- fender, von seiner Pluralisierung und Differenzierung zu sprechen. Die institutionali- sierten Muster der christlichen Tradition haben ihren dominierenden Charakter verlo- ren, eine „neue Vielfalt religiöser Formen“127 hat sich entwickelt. Der einzelne sucht sich heute aus, - darin zeigt sich gerade sein gebrochenes Verhältnis zur Tradition - ob und in welchem Maße er an traditionellen Vollzügen teilhaben möchte, er entwickelt seinen eigenen Religionsstil, indem er „unter den Bedingungen eines strukturellen Individualismus christliche Traditionselemente mit Komponenten individueller Welt- und Lebensdeutung“128 verbindet. Das Ergebnis dieser Differenzierung und Pluralisie- rung innerhalb des Christentum ist, daßsich die katholische Christenheit in der Bundes- republik Deutschland in mehrere Sektoren aufgespalten hat: den fundamentalistischen Sektor, der den volkskirchlichen Zustand wiederherzustellen trachtet, den Sektor der expliziten Christen, die sich der Kirche noch stark verbunden fühlen und regelmäßig an ihren Vollzügen teilnehmen, jedoch im Gegensatz zu den ‘Fundamentalisten’ nicht ‘revisionistisch’ denken, den Sektor diffuser Christlichkeit, den Sektor formaler Organi- sation, dem die kirchlich Bediensteten aller Facetten angehören und den „Bewegungs“- Sektor, dem die Christen zuzurechnen sind, die sich einer der meist neuen christlichen Bewegungen angeschlossen haben.129
Von besonderem Interesse für unsere Themenstellung mußder Sektor der ‘diffusen Ka- tholizität’ sein. Es ist bei dieser Gruppe zwar besonders schwierig, Aussagen über das jeweilige persönliche Glaubenverständnis zu machen, jedoch scheint der Glaube der ‘diffusen Katholiken’ stark individualistisch geprägt zu sein. „Das Selbstverständnis ist um den als legitim betrachteten Anspruch zentriert, nach eigenen Kriterien der Plausibi- lität und Nützlichkeit für die Lebensbewältigung eine Auswahl aus verfügbaren Deu- tungen treffen zu können, ja, zu müssen.“130 Die Kirche hat in den Augen der Angehö- rigen dieser Gruppe vor allem die Funktion, soziale Werte hochzuhalten, Einflußauf die eigene Lebensführung wird ihr jedoch nicht zugestanden. Die Verbindung zur Kirche wird hauptsächlich über die Sakramente an den Lebenswenden (Geburt, Hochzeit, Tod) gehalten, deren Feiern dann allerdings eher als familiäre, denn als kirchlich- gemeindliche Feiern aufgefaßt werden. Bis dato gewährt die Kirche diesen Menschen mehr oder weniger fraglos die Sakramentenspendung zum gewünschten Termin, eine Praxis, die sicherlich nicht unproblematisch ist. So argumentieren Kritiker, mit einer solchen Handlungsweise werde die lebendige, ihr Christsein praktizierende Gemeinde „durch die ständigen Verwässerungen und Kompromisse, die selbst vor unaufgebbaren Kernbereichen keinen Halt machen, einer Irritation ausgesetzt, die sie bis in die Funda- mente“131 träfe. Darüber hinaus würde durch diesen Mangel an Authenzität der Ein- druck gefördert, die Kirche selbst nähme ihre Sakramente nicht besonders wichtig. Auf der anderen Seite aber mußgefragt werde, ob die Verweigerung einer Sakramen- tenspendung überhaupt kirchenrechtlich legitim ist und ob sie pastoral nicht sogar kontraproduktiv sein könnte, da die Gefahr besteht, daßhierdurch auch die letzte, viel- leicht doch noch ausbaufähige Verbindung dieser Menschen zur Kirche gekappt wird. In jedem Falle aber mußvon kirchlicher Seite bei allen Bemühungen um neue Formen der Glaubensvermittlung der Tatsache Rechnung getragen werden, daßaufgrund der unterschiedlichen Lebens- und Glaubensgeschichten von sehr divergenten Vorausset- zungen bei den Adressaten auszugehen ist. Hierauf wird im letzten Kapitel zurückzu- kommen sein.
3.1.4 Religionsproduktive Tendenzen der Gegenwart
Am Beginn der Moderne schien es so, als würden in dieser neuen Epoche Religion und religiöse Weltdeutung langfristig überflüssig werden. Das ‘moderne’ Weltbild132 propa- gierte die Befreiung der Menschen aus allen Zwängen, auch denen der instiutionalisier- ten Religion, und den Glauben an die menschliche Vernunft als einziges Mittel, die Probleme der Menschheit zu lösen. Die Geschichte schien einem solchen Weltbild recht zu geben. Der technische Fortschritt ermöglicht heute den Menschen in den Industriege- sellschaften einen Lebensstandard, der früher nur kleinen Teilen der Bevölkerung zu- gänglich war, die Medizin befreit die Menschen von Krankheiten und Seuchen, die in früheren Zeiten eine höchst reale Bedrohung darstellten, hochdifferenzierte Vorsorge- maßnahmen schützen den heutigen Menschen zumindest z.T. vor Naturkatastrophen, der moderne Wohlfahrtsstaat bewahrt ihn vor existenzgefährdender Armut. Kurz ge- sagt: nahezu alle Bedrohungen, die der ‘vormoderne’ Mensch noch zu fürchten hatte, sind heute dank Fortschritt und Wissenschaft auf ein Minimum reduziert. Und nicht Gott, sondern der Mensch selbst, der ‘Homo faber’ ist für diese Verbesserungen ver- antwortlich. Kann auf die ‘Hypothese Gott’ nicht verzichtet werden, wenn die Weltent- stehung durch den Urknall und die Entstehung des Menschengeschlechtes durch die Evolutionstheorie zu erklären ist, wenn das menschliche Zusammenleben durch eine säkularisierte Gesetzgebung geregelt, wenn das „Spannungsverhältnis von Selbstbe- stimmung und Fremdbestimmung (‘Schicksal’) durch die technische Beherrschung aller Lebensumstände zu ersetzen“133 ist? Dementsprechend zeichnen die Zahl der Kirchen- austritte und die Ergebnisse von Umfragen zum Thema Religion auf den ersten Blick das Bild einer fortgesetzten Säkularisierung unserer Gesellschaft. Doch gilt es hier zu differenzieren: in der Tat scheint es eher so zu sein, daßsich die genannten Daten als Anzeichen der Deinstitutionalisierung von Religiosität deuten lassen. Denn gerade in jüngster Zeit läßt sich ein Trend zum Wiederaufleben religiöser Weltdeutungen feststel- len, der allerdings am Christentum - und dies ist eine entscheidende Neuentwicklung in der neuzeitlichen Geistes- und Sozialgeschichte - vorbeizugehen scheint. Die Gründe für dieses neue Interesse an Religiosität sind sehr vielfältig und komplex und können daher hier nur angerissen werden.
Zum nennen ist zuvörderst die Tatsache, daßin den letzten dreißig Jahren zunehmend auch die Schattenseiten der Modernisierung in den Blick geraten sind. In Anbetracht der derzeitigen Situation ist der Glaube an den immerwährenden Fortschritt im Sinne einer fortschreitenden Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen bei gleichzeitiger Risikominimierung ins Wanken geraten. Denn der technische Fortschritt hat zwar viele Gefahren, denen der einzelne zu früheren Zeiten ausgesetzt war, zum Verschwinden gebracht, gleichzeitig aber hat er neue Risiken hervorgebracht, die, obwohl ‘hausge- macht’, noch weniger kalkulierbar sind. Die „ehemals hochgepriesenen Quellen des Reichtums (Atom, Chemie, Gentechnologie usw.)“ haben sich in „unabsehbare Gefah- renquellen“134 verwandelt, von denen eine Bedrohung für die gesamte Weltbevölkerung ausgeht. Die Politik steht damit vor Aufgaben, denen sie nicht mehr gewachsen ist, da ihre Handlungsspielräume in keinem Verhältnis zu ihren Handlungsressourcen und Steuerungskapazitäten stehen, so daßdie entstandenen Kontingenzen auf den einzelnen abgeladen werden.135 Im Angesicht von Klimakatastrophen und atomarer Bedrohung, Waldsterben, Meeresverschmutzung und Verkehrsinfarkt, aber auch von Überbevölke- rung und globaler Armut wird offenbar, „daßes irrig war anzunehmen, die Naturbeherr- schung könne unbegrenzt ausgedehnt werden, die Wirtschaft könne grenzenlos expan- dieren und die Natur biete keine Grenzmarke menschlichen Handelns mehr.“136 Die Wissenschaft, die doch alle Probleme lösen sollte, offenbart heute schonungslos die von ihr selbst generierten Gefahren; in einigen Bereichen, beispielsweise der Gentechno- logie, ist sie gar selbst zum Schreckgespenst geworden. Der Mythos des Fortschritts hat Risse bekommen, es zeigt sich, daßeben nicht alles verfügbar, planbar, machbar ist, daßKontingenzen weiterhin bestehen und bewältigt werden müssen. Dieser „Überschußan Kontingenzen“137 erzeugt Angst und Unsicherheit und damit einen neuen Bedarf an einer Religion, die hauptsächlich der Angst- und Lebensbewältigung zu dienen hat. Gleichzeitig erzeugt auch die Individualisierung religionsproduktive Tendenzen, indem sie das Individuum auf sich selbst zurückwirft, ihm die allein die Verantwortung für ein gelingendes Leben und somit auch die Suche nach Sinn als ureigene Aufgabe aufbürdet (vgl. S. 11). Es beginnt ein Suchen nach „Transzendenzen und Sicherheiten im eigenen Selbst und seiner partnerschaftlichen Dauerthematisierung als Form der Kontingenzbe- wältigung.“138 Die Angst und Unsicherheit, die die Individualisierung generiert haben, nähren die Sehnsucht, sich als Teil eines geordneten Sinnzusammenhanges zu verste- hen, sich in einer als zunehmend unüberschaubar und bedrohlich empfundenen Welt beheimatet zu fühlen. Der Trend zur Religion hat jedoch nicht, wie zeitweilig erhofft, dazu geführt, daßdie „in den letzten Jahrhunderten entlaufenen Söhne und Töchter [...] in großer Zahl ins christlich-kirchliche Vaterhaus“139 zurückgekehrt wären. Vielmehr entstanden verschiedene Flucht- und Suchbewegungen, die zwar z.T. Christliches mit- einbeziehen, sich von der institutionell verfaßten Kirche jedoch deutlich abgrenzen und ansonsten auf außer-christliche religiöse Sinnelemente zurückgreifen; besonders spiri- tuelle Gruppierungen erfreuen sich großen Zuspruchs. Es zeigt sich also für die momen- tane Situation, daßdie Moderne die Religion nicht zum Verschwinden gebracht hat, sondern daß„die religiöse Verfassung menschlichen Daseins im Grunde erhalten geblieben ist.“140 Das Bedürfnis nach Transzendenzerfahrung, nach Möglichkeiten der Kontingenzbewältigung141 und religiöser Beheimatung ist nach wie vor vorhanden, doch scheint es, daßviele Menschen nicht davon ausgehen, diese Bedürfnisse im christ- lichen Glauben stillen zu können. Es liegt an der Kirche, die religionsproduktiven Ten- denzen der Gegenwart zu erkennen, sie zu deuten und zu versuchen, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Sie mußsich fragen, wie es ihr gelingen kann, die Bot- schaft des Christentums den Menschen heute sowohl intelligibel zu machen, als auch den Mehrwert eines Lebens aus dem Evangelium142 aufzuweisen, wobei sie immer vom konkreten Menschen und seinen Bedürfnissen ausgehen muß, wenn ihre Bemühungen nicht ins Leere laufen sollen. Wie solche neuen Wege der Glaubensvermittlung ausse- hen sollten, wird im Folgenden noch zu erörtern sein.
3.1.5 Zur Situation der Kirche heute
Die katholische Kirche sieht sich heute einer für sie neuen Situation gegenüber. Nach Jahrhunderten, in denen sie ‘Volkskirche’ war und ihre Autorität (mehr oder weniger) unangetastet blieb, ist sie heute nur noch ein ‘Stand’ auf dem Markt der Sinnangebote, an dem viele Menschen allenfalls einmal vorbeischlendern, um sich dann wieder ande- ren Angeboten zuzuwenden. Die Zahl derer, die sich explizit der Kirche zurechnen und am kirchlichen Leben teilhaben, schrumpft beständig, während gleichzeitig viele Katho- liken bekunden, zwar gläubig zu sein, mit der Kirche jedoch keinen Kontakt wünschen und sich stattdessen auf ihrer Suche nach ihrem je eigenen Religionsstil anderweitig umsehen. Die erste Voraussetzung für eine angemessene Reaktion der Kirche auf diese Veränderungen ist, die Entwicklungen der vergangen Jahrzehnte als notwendigen Umstrukturierungsprozeßzu akzeptieren und durch ihre Analyse Handlungs- möglichkeiten zu erschließen. Keinesfalls sollte man sich der Illusion hingeben, zu volkskirchlicher Zeit sei ‘alles besser’ gewesen. Es ist vielmehr klar zu sehen, daßdie volkskirchliche Tradition auch zu diversen Entwicklungen geführt hat, die mit der christlichen Botschaft nichts zu tun haben. So führte, um nur ein Beispiel zu nennen, die Herausbildung des Klerus dazu, daßdas Amt nicht Amt in der Gemeinde blieb, sondern dem Volk gegenüberstand und die Kirche in einen lehrenden/sakramentenspendenden und einen hörenden/empfangenden Teil spaltete. Dies wiederum hatte zur Folge, daßdie Kirche in der Gesellschaft zu einer Autorität wurde, die den alleinigen Regelungs- anspruch für die ‘rechte Lebensführung’ für sich reklamierte, so daßder einzelne Glau- bende sich aus der Verantwortung für die Sendung der Kirche weitgehend entlassen sah und sich nur noch um das eigene Seelenheil und das seiner Angehörigen zu kümmern hatte.143 Mit einer geschwisterlichen Gemeinde Jesu dürfte diese solch eine ‘Versor- gungsanstalt’ auf weiten Strecken nicht mehr allzuviel gemein haben. Zwar ging es Jesus um alle Menschen, aber schon zu seinen Lebzeiten waren es nur wenige, die sich seiner Botschaft öffneten und die in die Nachfolge berufen wurden. Um der vielen willen begann er mit den wenigen, die seine Botschaft aufnahmen und sie anderen durch das Zeugnis ihres Lebens vermitteln sollten. Die christliche Botschaft enthält nicht den Auftrag, eine Volkskirche zu begründen, in der viele Mitglieder kaum willens oder imstande sind, ein glaubwürdiges Zeugnis christlicher Nächstenliebe abzugeben, und nur aus Gewohnheit und Bequemlichkeit oder gar aufgrund sozialer Zwänge blei- ben. Dennoch hat sich die Kirche lange schwer getan, sich mit der neuen, ‘nach- volkskirchlichen’ Situation produktiv auseinanderzusetzen. Dies zeigt sich vor allem auch in der Sakramentenpastoral. Auf der einen Seite besteht als Relikt aus volkskirch- licher Zeit noch die fragwürdige Tendenz eine ‘flächendeckende Versorgung’ mit Sak- ramenten gewährleisten zu wollen, auf der anderen Seite steht die Tatsache, daßviele Menschen aufgrund fehlender christlicher Sozialisation nicht mehr wissen, was in den Sakramenten eigentlich gefeiert wird. Dies wirft die Frage auf, ob es überhaupt einen Sinn hat, diesen Menschen Sakramente zu spenden. Denn Sakramente sind, wie im folgenden Kapitel noch zu erläutern sein wird, keine Handlungen, in denen sich ohne Mitwirken des Empfänger etwas an diesem vollzieht. Die im Sakrament enthaltene göttliche Gnade kann nur ankommen, wenn der Mensch sich dem Zuspruch und An- spruch Gottes öffnet. Das Sakrament ist ein Kommunikationsgeschehen (vgl. Kap. 4.2.7) - und wo nicht kommuniziert(!) wird, bleibt es ein leeres Ritual. Und wird es nicht, insofern in ihm eigentlich sowohl der Glaube bezeugt als auch der Wille bekundet wird, sich als Glied der Kirche Jesu Christi anfordern zu lassen, dort, wo es Menschen gespendet wird, die abgesehen von den Sakramentenspendungen an den Lebenswenden keinen Kontakt zur Kirche wünschen, nicht zu einem lügnerischen Zeichen, in dem der Empfänger ein falsches Zeugnis ablegt? Trotz solcher Fragen wäre ein undifferenzierter Rigorismus mit Sicherheit der falsche Weg, auf die derzeitige Situation zu reagieren. Es ist viel mehr zu erörtern, ob und wie die Tatsache, daßMenschen zu bestimmten Anläs- sen „bei der Kirche (noch) etwas suchen [...] positiv als Chance eines Austauschs mit ihnen“144 genutzt werden kann. Wie die Kirche sowohl der veränderten allgemein- und religionssoziologischen Situation als auch dem letztlich in Gott gründenden und damit von gesellschaftlichen Bedingungen unabhängigen Anspruch an sich selbst gerecht werden kann, wird Thema des Schlußkapitels sein.
4 ALLGEMEINE SAKRAMENTENLEHRE
In den vorangegangenen Kapiteln wurde versucht, die Situation der Ehe in unserer Gesellschaft darzustellen und aufzuzeigen, wo ihre Probleme liegen. Es wurde festge- stellt, daßdie Krise der Ehe ein Ergebnis gesellschaftlicher Umwälzungen, aber auch von einem damit einhergehenden Bewußtseinswandel ist. Deutlich wurde auch, daßder kirchliche Einflußauf Paarbeziehung und Ehe (wie auch auf die Lebensgestaltung insgesamt) inzwischen verschwindend gering geworden ist - selbst praktizierende Katholiken identifizieren sich heute nur noch höchst selten mit dem Gebot lebenslanger Treue oder dem Verbot des vorehelichen Geschlechtsverkehrs, um nur die beiden Schlagworte zu nennen, die dem ‘postmodernen’ Menschen wohl als erstes einfallen würden, wenn man ihn nach dem Eheverständnis der katholischen Kirche fragen würde. Natürlich wird eine solche Verkürzung der kirchlichen Eheauffassung in keinster Weise gerecht. Hier soll daher dargelegt werden, was ein Sakrament überhaupt ist, und was mit der Rede von der Ehe als Sakrament gemeint ist.
4.1 Geschichte der Sakramente
Um zu einem differenzierten Verständnis des Begriffes ‘Sakrament’ zu gelangen, er- scheint es sinnvoll, zunächst einen Blick auf dessen historische Entwicklung zu werfen. Die Untersuchung der Frage, wie die Sakramente zu dem geworden sind, was sie heute vorstellen, kann dazu dienen, die Sakramente in ihrer historischen Bedingtheit besser zu verstehen und eine falsche Ehrfurcht vor der ‘Tradition’, die sich als durchaus nicht einheitlich erweist, abzubauen. Die Sakramente sind Grundvollzüge einer Kirche, die neben ihrer eschatologischen und soteriologischen Dimension immer auch eine ge- schichtliche Größe darstellt und insofern auch historischen Bedingtheiten unterliegt. Auf Grund dessen war auch das Verständnis der Sakramente diesen ausgesetzt, was im Laufe der Jahrhunderte zu durchaus divergenten Auffassungen des Begriffs ‘Sakrament’ geführt hat.
Der folgende Abschnitt möchte die Entwicklung des Sakramentenverständnisses dar- stellen, selbstverständlich ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Vielmehr soll es darum gehen, die wichtigsten Stationen dieser Entwicklung schlaglichtartig zu beleuchten und einen kurzen Ausblick auf neuere Entwicklungen in der Sakramen- tentheologie zu geben.
4.1.1 Zum Begriff Mysterion
4.1.1.1 In Kult und Philosophie
Unser heutiger Begriff ‘Sakrament’ ist, sowohl sprach- als auch theologiegeschichtlich „aus dem vorchristlichen Mysterienbegriff hervorgegangen“145: das griechische musth/rion wurde in den Bibelübersetzungen der ersten christlichen Jahrhunderte überwiegend mit dem Begriff sacramentum, der dem antiken römischen Recht entlehnt wurde, übersetzt. Neben seiner Grundbedeutung ‘Geheimnis’ bezeichnet musth/rion insbesondere ‘Geheimlehren’ und das ‘Heilige’.
Der Plural, musth/ria, war die Bezeichnung für „eine ganze Reihe von Geheimkulten, die sich seit dem 7. Jahrhundert v. Chr. bei den Griechen (Eleusis, Dionysio, Orphiker) und im hellenisierten Orient (Adonis, Attis und Kybele, Isis und Osiris, Mithras) meist am Rande der allgemein befolgten Religionen verbreiteten.“146 Diese Geheimkulte stammten ab von „uralten Fruchtbarkeitskulten“, ihre rituellen Feiern vergegenwärtig- ten die Geschicke ihrer jeweiligen Gottheiten, um durch das „Miterleben des göttlichen Dramas“ die Teilhabe an demselben zu ermöglichen.147 Kennzeichnend für diese Kulte war, wie der Begriff ‘Geheimkult’ bereits nahelegt, daßnur Eingeweihte, die sogenann- ten Mysten, die bestimmte Rituale der Initiation absolviert hatten, zu diesem Feiern zugelassen waren. „Die den Göttern geweihten rit. Handlungen selber hatten den Zweck, den Mysten durch die geheimnisvollen Deutezeichen in die Sphäre des Heiligen zu versetzen“148, gleichzeitig verpflichteten sie den Eingeweihtem meist eidlich zu absolutem Stillschweigen gegenüber Nichteingeweihten (Arkandiziplin). Die Vorstel- lungen dieser Geheimkulte waren denen der Christen insofern ähnlich, als hier sowohl ein Kontakt zur göttlichen Sphäre im irdischen Leben ermöglicht werden sollte, als auch ein jenseitiges Heil versprochen wurde, dennoch kann man die christliche Sakra- mente nicht als Abwandlungen der Mysterien deuten, da zum einen die Götter der Mysterienkulte als einem höheren Gesetz unterliegend gedacht, und zum anderen das Heil nur einer kleinen Gemeinschaft von Eingeweihten zugesprochen wurde. Die Mys- terienkulte sind für eine Geschichte der christlichen Sakramente jedoch insofern wich- tig, als sie auch das Denken der antiken griechischen Philosophen beeinflußten, die wiederum später auf die christlichen Denker wirkten. In erster Linie ist hier Platon zu nennen, dessen dualistische Erkenntnistheorie ebenfalls den „Aufstieg von den sichtbar- wandelbaren Dingen zur unsichtbar-unveränderlichen Wirklichkeit“149 propagiert. Die sinnlich wahrnehmbaren Dinge sind für ihn unvollkommene Abbilder, Symbole der unwandelbaren Ideen, in denen allerdings das Urbild, wenn auch seinsschwächer prä- sent ist, ein Gedanke, der später für das Sakramentenverständnis der Kirchenväter von entscheidender Bedeutung war.150 Anzustreben ist jedoch das Erkennen der Urbilder, der Überstieg in das Reich der Ideen. Diese ist jedoch wiederum nur wenigen Menschen möglich, da auch hierfür eine Einweihung von Nöten ist, allerdings keine kultische, sondern eine philosophische Einführung in die „Geheimlehren einer wahrheitbringen- den Weisheit“151.
Außer in die Gnosis, die eine Mischform von kultischem und philosophischem Mysterienbegriff kannte, hielt das Mysterienvokabular schon in der Antike auch Einzug in den profanen Sprachgebrauch.
4.1.1.2 Im biblischen Sprachgebrauch
In der Septuaginta wird musth/rion nur in den Schriften aus hellenistischer Zeit verwendet152 und zwar „mehr im philosophischen und profanen als im kultischen Sinn“153, beispielsweise im Buch der Weisheit (2,22; 6,24; 14,15.23), in dem die Offen- barung der Geheimnisse Gottes den „gelehrigen Kennern und Befolgern der Weis- heit“154 verheißen wird, und im Buch Daniel (2,18f.47), wo das musth/rion in einer eschatologischen Dimension gesehen wird: „Es besteht in dem, was ‘am Ende der Tage geschehen wird’ (2,28ff.) und von Gott selbst aufgedeckt werden soll“155. Ähnliche Gedanken finden sich auch in der sonstigen apokalyptischen Literatur, die mit musth/rion den göttlichen „Plan der künftigen Geschichtsereignisse, der einzelnen »Sehern« in außergewöhnlichen Erfahrungen [...] geoffenbart wird, den aber auch sie wiederum nur in Bildern mitzuteilen vermögen.“156 Eine gewisse Nähe zu den Myste- rienkulten und zur Gnosis ist erkennbar, im Unterschied zu diesen wird jedoch hier die Souveränität Gottes betont.157
Im Neuen Testament findet sich der Begriff musth/rion vorwiegend in der paulini- schen und deuteropaulinischen Literatur158 (insgesamt 21 Stellen).159 Meint es bei Pau- lus meistens das Gottesgeheimnis (Röm 16,25; 1 Kor 2,1.7;4,1), wird dieses von Eph und Kol so deutlich auf Jesus Christus bezogen, daßbeide identifiziert werden (Kol 2,2). Musth/rion bezeichnet hier „wesentlich das Christusereignis“160 in dem sich das Geheimnis Gottes enthüllt. In Kol 1,27 und Eph 3,4ff wird dieses Mysterium Christi mit der Gemeinde in Verbindung gebracht: „die Kirche ist die Gestalt, in der dieser göttliche Heilsratschlußverwirklicht und offenkundig gemacht wird“161. Insofern ist in dem Begriff musth/rion die „sakramentale Heilsökonomie gegeben, insoweit, als sie Jesus Christus, die Kirche und deren Lebensvollzüge umfasst.“162 Zu bemerken ist noch, daßin der paulinischen Theologie von den Schweigegeboten der Mysterien- kulte in keinster Weise mehr die Rede ist. Zwar sieht sich der Apostel als Verwalter der Geheimnisse Gottes (1 Kor 4,1), dieses Geheimnis jedoch, das Christus ist, ist nicht wenigen Auserwählten vorbehalten, sondern soll durch Verkündigung allen Menschen zugänglich gemacht werden.
Festzuhalten ist allerdings, daßder Begriff musth/rion an keiner Stelle des Neuen Testamentes zur Bezeichnung von Taufe oder Abendmahl oder sonstigen liturgischen Vollzügen herangezogen wird; er ist dennoch insofern bedeutsam für die Sakramenten- lehre als mit seiner Hilfe der Zusammenhang der Sakramente mit dem Christus- Ereignis und mit dem Geheimnis seiner Gegenwart in der Kirche dargestellt werden können.
4.1.2 Sacramentum als theologischer Terminus
Auch bei den Apostolischen Vätern taucht der Mysterienbegriff nur selten und an keiner Stelle in Bezug auf Kult oder Sakramentalität auf; von den Apologeten des zweiten Jahrhunderts hingegen sind verschiedene Verwendungen des Mysterienbegriff überlie- fert. Justin und Tertullian benutzen ihn sowohl polemisch „zur Bezeichnung der helle- nistischen Geheimkulte [...] oder der gnostischen Geheimlehren“163, als auch für bib- lisch bezeugte Ereignisse, in denen der göttliche Heilsplan aufscheint. Ihr antignostisch motiviertes Anliegen war es, die Einheit von Altem und Neuem Testament, bzw. Altem und Neuem Bund aufzuzeigen, daher versuchten sie, in Geschehnissen und Institutionen des Alten Testaments solche aufzuspüren, die sich als Vorankündigungen oder gar Vorwegnahmen des Christusereignisses deuten ließen und betitelten diese als musth/ria. Ebenso verwandten sie den Begriff auch für manche Ereignisse im Leben des irdischen Jesus, vor allem für Geburt und Kreuzigung.164
Wie bereits erwähnt, wurde der Begriff des musth/rion in den afrikanischen Bibeln und in der Itala mit sacramentum übersetzt.165 Dieser Begriff wurde dem antiken römi- schen Militärrecht entnommen, in dem er einen ‘Fahneneid’ bezeichnet, den jeder Sol- dat zu leisten hatte.“166 Darüber hinaus bezeichnete der Begriff aber auch einen Geldbe- trag, der zu Beginn eines Prozesses von den prozessführenden Parteien im Tempel hinterlegt werden mußte. Die Partei, die den Prozeßverlor, bekam den Betrag nicht zurückerstattet, er fiel an den Tempel und wurde zum Kult verwendet.167
Es war Tertullian, der den Begriff des sacramentums erstmals auf Taufe und Herrenmahl anwendete, indem er auf die Analogie von (Erwachsenen!)taufe und der bedingungslosen Selbstverpflichtung des römischen Soldateneides hinwies. Eine allgemeine Sakramentenlehre entwickelten jedoch weder er noch einer seiner Zeitgenossen, so daßder Begriff sacramentum bis zu Augustin nicht klar bestimmt war, sondern sowohl diverse liturgische Symbolhandlungen, als auch Jesus Christus, die Kirche, den Glauben oder das Glaubensbekenntnis bezeichnen konnte.168
4.1.3 Das Sakramentenverständnis des Augustin
Der Einflußder Augustinischen Sakramentenverständnisses auf die abendländische Sakramententheologie ist kaum zu unterschätzen, obwohl auch diese noch keine allgemeine Sakramentenlehre darstellt, sondern lediglich Überlegungen hinsichtlich Taufe und Eucharistie umfaßt.
In seiner Schrift De Magistro geht Augustin von einer neuplatonisch geprägten Zei- chenlehre aus: er unterscheidet zunächst Sache (res) und Zeichen (signum). Sachen sind alle die Dinge, „die nicht existieren, um etwas zu bezeichnen, sondern für sich selbst stehen, wie Holz, Tier und dergleichen.“169 Davon unterscheidet er die Zeichen, die immer auch auf etwas anderes verweisen. Auch Sachen können Zeichen sein, wenn sie eine über sich hinausweisende Funktion haben, beispielsweise das Lamm als Zeichen für Christus. Die Zeichen wiederum zerfallen in die „natürlichen Zeichen“ (signa natu- ralia) und die „gegebenen Zeichen“ (signa data). Die natürlichen Zeichen haben ihren Verweischarakter aus sich selbst: Rauch z.B. weist, auch ohne daßihm eine bestimmte Bedeutung zugewiesen worden wäre, auf ein Feuer hin. Die gegebenen Zeichen hingegen sind, wie es die heutige Sprachwissenschaft formulieren würde, arbiträr, ihnen wird eine bestimmte Bedeutung absichtsvoll zugewiesen - Verkehrsschilder wären beispielsweise, um ein neuzeitliches Beispiel zu nennen, „gegebene Zeichen“. Das vornehmste der gegebenen Zeichen ist für Augustin das Wort, „denn durch es läßt sich die unsichtbare Wirklichkeit von sich aus vernehmen.“170
Nach Auffassung des Augustin sind alle materiellen Güter Zeichen höherer, geistiger Güter, die gesamte sichtbare Welt Zeichen des ewigen Universums. Die Aufgabe des Menschen besteht darin, sich um die Erkenntnis dieser Zeichen und der hinter ihnen stehenden Wirklichkeiten zu bemühen, die materiellen Güter zu gebrauchen, die geisti- gen hingegen zu genießen und „die Gebrauchsgüter stets auf die Genußgüter hin zu überschreiten, zu transzendieren.“171 Adam aber habe diesen korrekten Umgang mit den Zeichen pervertiert und sein Hauptaugenmerk auf die sichtbare Welt gelegt, so daßdie von Gott vorgesehene Ordnung gleichsam umgedreht worden sei. Um diese Ordnung wieder herzustellen, habe Gott den Menschen nicht nur den fleischgewordenen Logos, Jesus Christus, gesandt, sondern ihnen auch die Sakramente der Taufe und der Eucha- ristie gegeben, „die Göttliches anzeigen und in sich enthalten.“172 Diese bestehen aus dem äußeren Zeichen, d.h. einem sinnlich wahrnehmbaren Element (das Brot der Eu- charistie und das Wasser der Taufe) und dem deutenden Wort, das als das „vornehmste Zeichen“ dem Sakrament erst seine Wirksamkeit verleiht: „Es tritt das Wort zum Ele- ment, und es wird Sakrament.“173 Gemeint ist mit diesem entscheidenden sakramentalen Wort das Glaubenswort der Kirche. Wegen des hohen Stellenwertes des Wortes kann ein Sakrament auch als visibile verbum bezeichnet werden. Das in den Sakramenten Bezeichnete aber ist nicht nur die göttliche Gnade, sondern der „»Christus totus«, der ganze Christus aus Haupt und Gliedern im Heiligen Geist, der eigentlich Wirkende, der als der aktiv Handelnde in den Sakramenten Gnade bewirkt, aber so, daßes sich dabei immer auch um kirchliche Vollzüge handelt.“174 Da jedoch die eigentlich wirksame Aktivität von Christus als dem Spender ausgeht, sind die Sakramente auch dann wirk- sam, wenn sie von einem unheiligen Amtsträger gespendet werden. Mit der Augustini- schen Lehre erhält die Sakramententheologie der westlichen Kirche einen stark wort- und begriffsbestimmten Akzent, während sich in der Ostkirche durch die Wirkung der griechischen Kirchenväter ein stärker an Abbild und Nachahmung orientiertes Ver- ständnis durchsetzte.175 Es darf allerdings nicht übersehen werden, daßAugustin sich nicht eindeutig zwischen sakramentalem Realismus und Symbolismus entscheidet: die Sakramente sind nicht nur Symbole, die auf etwas anderes verweisen, sondern sie be- wirken, was sie anzeigen. Diese Schlußfolgerung läßt sich nicht aus rein platonisch- idealistischen Prämissen herleiten, sondern wird aus der Schrift und der kirchlichen Tradition begründet. Die Epigonen Augustins versuchten, diese Aporie aufzulösen, indem sie entweder einen massiven Realismus (Isidor von Sevilla) oder verschiedene Formen des Symbolismus (Scotus Eriugena, Berengar von Tours) als kontradiktorische Alternativen vertraten. Das Lehramt stand jedoch auf der Seite der Realisten, so daßdie symbolische Sakramentenauffassung nach und nach unterdrückt wurde.176
4.1.4 Mittelalter
Das Augustinische Erbe wurde ohne nennenswerte Vertiefungen bis ins 12. Jahrhundert weitertradiert. Zwar befassten sich auch die Theologen des Frühmittelalters mit der Sa- kramententheologie, ihr Hauptaugenmerk legten sie aber vor allem auf den richtigen Ritus. Aufgrund der Diskussion um die Gültigkeit der von den Simonisten gespendeten Weihen, sorgte man sich vor allem auch um die Frage nach der Wirksamkeit der Sak- ramente im Falle ihrer Spendung durch einen ‘unheiligen’ Amtsträger. Um diesem Dilemma zu entgehen, wurde im späten 12. Jahrhundert die Lehre vom opus operatum entwickelt, die die Bedingungen einer gültigen Sakramentenspendung festlegte: es meint das Handeln Gottes im Sakrament, das demselben ohne Ansehen von Spender und Empfänger seine Wirksamkeit verleiht. Das opus operantis hingegen bezeichnet das Handeln des Menschen im Vollzug des Sakramentes, welches nur Bedingung für das „Ankommenkönnen der Gnade“177, nicht aber für die Gnade selbst ist.
Von den frühscholastischen Denkern sind aufgrund ihres großen Einflusses auf die weitere Entwicklung der Sakramententheologie vor allem Hugo von St. Viktor und Petrus Lombardus zu nennen: Hugo von Sankt Viktor definierte die Sakramente als „Gefäße der Gnade“, die wie eine Medizin auf die Gläubigen wirken, durch die sie „zur Demut angehalten und in ihrem moralischen Lernprozeßgefördert werden.“178 Diese Auffassung führte letztlich dazu, daßder Empfänger und seine Mitwirkung beim Zu- standekommen des Sakramentes in den Hintergrund trat. Stattdessen setzte sich die Meinung durch, die Konsekration sei „der eigentlich konstitutive Akt beim Zustande- kommen des Sakramentes“179. Das Wasser der Taufe und das Brot der Eucharistie wurden nicht mehr als Symbole der göttlichen Gnade verstanden, sondern waren als Träger der Gnade selbst anbetungswürdig.
Der Einflußdes Petrus Lombardus, dessen Sentenzenkommentar das theologische Lehrbuch des Mittelalters wurde, bewirkte, daßdie Zahl der Sakramente auf sieben festgelegt wurde. Seine Definition von Sakrament lautet: „Sakrament im eigentlichen Sinne [...] wird genannt, was auf solche Weise Zeichen der Gnade Gottes ist, daßes deren Bild trägt und deren Ursache ist“. Die Frage nach der Ursache (causa) wurde zu einem der zentralen Probleme der scholastischen Theologie: wie war es ohne Ein- schränkung der göttlichen Souveränität denkbar, daßein Zeichen Ursache der göttlichen Gnade sein konnte?
Mit Beginn des 13. Jahrhunderts begann der Einflußdes aristotelischen Denkens auf die Sakramententheologie spürbar zu werden. Im Anschlußan den aristotelischen Hylemor- phismus, nach der „alle körperhaften, sinnlich faßbaren Dinge eine Wesenseinheit von Wandelbarem (=Materie) und Bestimmtsein dieses Wandelbaren durch ein gestaltge- bendes, bestimmendes Prinzip (=Form)“180 bilden, bezeichnete erstmalig Hugo von St. Cher das Element bzw. die Handlung im Sakrament als materia und das begleitende Wort als forma. Das Materie-Form-Schema übernahm auch Thomas von Aquin181: für ihn besteht ein Sakrament aus den äußeren, Form und Materie umfassenden Zeichen (sacramentum et non res) und dessen Inhalt, der Wirkung des Sakramentes (res sacra- menti, res et non sacramentum). Zwischen diese beiden Komponenten tritt noch ein Mittleres, „das unmittelbar vom äußeren Zeichen hervorgebracht wird, dem aber zugleich die Eigenschaft zukommt, selbst wiederum Zeichen eines anderen Gegenstan- des zu sein (res et sacramentum simul).“182 Bei den Sakramenten der Taufe, der Fir- mung und der Ordination wird dieses Mittlere identifiziert mit dem character indelebi- lis, d.h. dem Merkmal, welches durch das Sakrament verliehen wird und den Empfänger unwiderruflich prägt, „auch wenn dieser sich der Gnade verschließt oder sie durch Sünde wieder verliert.“183
Dem Dilemma der Kausalität der Sakramente begegnet Thomas mit seiner Idee der In- strumentalursächlichkeit: die Sakramente sind die Instrumentalursachen, die Gott als Prinzipalursache seiner eigenen Gnade seiner Kirche gegeben hat. Die Sakramente sind insofern quasi als Werkzeuge Gottes zu verstehen, derer er sich bedient, um dem ein- zelnen Menschen seine Gnade mitzuteilen, wobei er selbst jedoch absolut souverän bleibt, d.h. die Gnade ist nicht an die Sakramente gebunden, sondern kann den Men- schen auch auf anderem Wege mitgeteilt werden. „Doch liegt der normale, ‘ordentliche’ Weg der Heilsvermittlung in den sieben von Christus eingesetzten Sakramenten.“184
Auch die Lehre vom ex opere operato findet Eingang in die Schriften des Thomas: wo das Sakrament ‘korrekt’ vollzogen wird, bewirkt es unabhängig von Spender und Emp- fänger quasi unfehlbar die Gnade, vorausgesetzt, der Spender hat den Willen, das zu tun, was die Kirche tut, und der Empfänger steht dem Ankommen der Gnade nicht ablehnend gegenüber.
Auf dem Konzil von Florenz (1438-1445) wurde erstmals eine eingehenderen lehramtliche Darstellung der Sakramentenlehre erarbeitet und des Gedankengut des Thomas in das kirchliche Lehramt übernommen.185 Im Armenierdekret, das sich auf die thomasische Schrift De articulis fidei et Ecclesia sacramentis stützte, wurde die Sakramentenlehre formelhaft zusammengefaßt:
Es gibt sieben Sakramente des Neuen Bundes, nämlich: Taufe, Firmung, Eucharistie, Buße, Letzte Ölung, Weihe, Ehe, die sich sehr sich von den Sakramenten des Alten Bundes unterscheiden. Die- se nämlich bewirkten die Gnade nicht, sondern zeigten nur an, daßsie durch Christi Leiden gege- ben werden sollte; diese unsrigen Sakramente aber enthalten die Gnade und verleihen sie denen, die sie würdig empfangen.186
Blickt man resümierend auf die Entwicklung der Sakramentenlehre in der Scholastik, so fällt auf, daßüber den Reflexionen um Wirksamkeit und Kausalität, Gültigkeit und korrektem Vollzug des Ritus das Interesse am Sakrament als Vollzug innerhalb eines liturgischen Gesamtzusammenhanges völlig aus dem Blick geriet. Der Empfänger taucht nur noch in der Diskussion um die Minimalbedingungen wirksamer Sakramen- tenspendung auf, und selbst dort wird von ihm nicht mehr gefordert, als daßer der göttlichen Gnadenmitteilung kein Hindernis (obex) entgegensetze. Von liturgischen Symbolhandlungen und Lebensereignissen wurden die Sakramente zu „extrem kurzen, punktuellen Gesten“187, sie wurden kanonisiert und klerikalisiert und verloren dadurch ihren Bezug zur Lebenswelt der Gläubigen.
4.1.5 Reformation und Tridentinum
Martin Luther hat keine allgemeine Sakramentenlehre entwickelt, es lassen sich jedoch Ansätze zu einer solchen in seiner Schrift De captivitate Babylonica ecclesiae praeludi- um 188 von 1520 finden, in der sich der Reformator mit den sieben Sakramenten der mittelalterlichen Kirche befaßt.189 Für Luther ist, im Anschlußan den neutestamentli- chen Sprachgebrauch, Christus das eigentliche Sakrament Gottes. Zwar benutzt er das Wort ‘Sakrament’ auch für kirchliche Vollzüge, lehnt jedoch vier der sieben Sakramen- te als nicht von Christus eingesetzt ab, lediglich Taufe, Eucharistie und - eingeschränkt - die Buße läßt er als „sakramentliche Zeichen“ gelten. Als Kriterium für ein Sakrament nennt er „die göttliche Verhei ßung und ein mit dieser Verheißung verknüpftes sichtba- res Zeichen.“190 Die Sakramente sind für Luther nicht bloße Hinweiszeichen, sondern in ihnen bindet sich Gott an die betreffenden Elemente, so daßsie „zum Gegenstand des Glaubens werden, zu etwas, woran sich der Glaube hängen und festhalten kann, zu dem Schatz, durch den Gott uns sein Heil darbietet und zueignet.“191 Entscheidend ist aber, daßLuther den Glauben als Voraussetzung für die Heilswirksamkeit betrachtet. Ohne diesen könne es zwar gültig vollzogen werden, werde für den Empfänger aber nicht heilswirksam.192 Dementsprechend lehnt Luther, wie alle anderen Reformatoren, die Lehre vom ex opere operato ab. Seine Sakramentenlehre ist stark von der Augustini- schen Theologie des Wortes Gottes her bestimmt: im Wort Gottes ist Jesus Christus für den einzelnen Gläubigen und für die Gemeinde gegenwärtig, im Sakrament wird das Wort sichtbar.
Dem Konzil von Trient gelang es nicht, die reformatorische Kritik am lehramtlichen Sa- kramentenverständnis für Reformen fruchtbar zu machen. Zwar verurteilte es die Re- formatoren nicht ausdrücklich, anathematisierte aber in seinem Dekretüber die Sakra- mente vom 15. März 1547193 viele ihrer Lehren. Es bekräftigte die Lehre vom ex opere operato 194 und vom unauslöschlichen Merkmal (character indelebilis) den, wie er- wähnt, die Sakramente der Taufe der Firmung und der Weihe einprägen195. In Anleh- nung an Petrus Lombardus wurde Siebenzahl der Sakramente endgültig festgelegt;196 gleichzeitig wurde die Einsetzung aller Sakramente durch Christus197 und das Enthal- tensein der Gnade in den Sakramenten198 betont. Bezüglich der Gültigkeit der Sakra- mentenspendung wurde erneut auf die Notwendigkeit der Vollmacht und Intention des Spenders und die Wirksamkeit für den Empfänger, soweit er kein Hindernis entgegen- setze, hingewiesen. Eine katechetische Vorbereitung für den Sakramentenempfang wurde nicht gefordert, da dies die nun schon gängige Praxis der Säuglingstaufe ad absurdum geführt hätte, „die hier zur Norm für das Schema des Sakraments im allge- meinen wurde.“199 Damit wurden die Sakramente weiter aus ihrem liturgischen Ge- samtzusammenhang herausgelöst, denn Säuglinge sind ja aufgrund ihres mangelnden Selbstbewußtseins und der daraus resultierenden Unfähigkeit zur aktiven Teilnahme nicht liturgiefähig. Darüber hinaus sah sich das Konzil veranlaßt, erstmalig über die ‘Heilsnotwendigkeit’ der Sakramente zu sprechen200, um der reformatorischen These, sie seien überflüssig, „weil die Rechtfertigung des Sünders ‘durch den Glauben allein’ zustande komme“201 entgegenzutreten. Demgegenüber erklärte das Dekret, die Sakra- mente seien durchaus notwendig, allerdings nicht alle für jeden Gläubigen - ein erster Ansatz zu einer differenzierenden Betrachtung der Einzelsakramente - und relativierte diese Aussage noch, indem es auch das ‘Verlangen’ nach den Sakramenten als zurei- chende Bedingung zum Heil deklarierte.202 Was unter diesem Verlangen (votum) zu verstehen sei, erklärte das Konzil allerdings nicht.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daßmit dem Konzil von Trient keine neuen Impulse in die katholische Sakramentenlehre gekommen sind, sondern lediglich alte Lehrmei- nungen affirmiert und neue Ansätze abgewiesen wurden. In Verständnis und Praxis der Sakramente änderte sich nichts, sondern die mit der Scholastik einsetzende Entwicklung der Sakramente setzte sich fort, bis über dem Insistieren auf Minimalbedingungen und - voraussetzungen die Sakramententheologie zunehmend unter den Einflußdes Kirchen- rechts geriet.203
4.1.6 Neubesinnung im 20. Jahrhundert
Auch die nachtridentinische Theologie blieb scholastisch geprägt; in der Auseinandersetzung mit der protestantischen Theologie befaßte man sich verstärkt mit der Frage nach der Wirksamkeit der Sakramente und mit dem Problem der Einsetzungsfrage, welche das Tridentinum nicht thematisiert hatte.
Erst im 20. Jahrhundert zog, ausgelöst unter anderem durch die Liturgische Bewegung, ein neuer Geist in die Sakramententheologie ein. An erster Stelle ist hier die Mysterien- theologie Odo CASELs zu nennen. Casel geht aus von den Ergebnissen seiner liturgie- geschichtlichen Forschung über die Taufpraxis der Alten Kirche und rückt die Sakra- mente als Feiern einer Kultgemeinschaft wieder in den Blick. In den Sakramenten, vor allem in der Eucharistie, vollzieht sich ein dreistufiges Mysteriengeschehen,204 in dem das Heilshandeln Christi real gegenwärtig wird. Liturgie wird betrachtet als ein drama- tisches Spiel, „das die einzelnen Mitspieler selbst erfaßt und verwandelt.“205 Mit Odo Casels Mysterientheologie begann das Umdenken in der Sakramententheologie. Man setzte nicht mehr beim Sakrament als Gnadenmittel an, sondern beim Begriff des Sym- bols und verknüpfte die Sakramententheologie mit Ekklesiologie, Christologie und Anthropologie. Otto Semmelroth prägte den Begriff von der Kirche als Ursakrament, der großen Einflußauf spätere sakramententheologische Betrachtungen, insbesondere bei Karl RAHNER hatte, und inzwischen fester Bestandteil der katholischen Ekklesiolo- gie geworden ist.
Die Neuansätze der Theologen des 20. Jahrhunderts hielten auch Einzug in die Verlaut- barungen des II. Vatikanischen Konzils. So bezeichnet die dogmatische Konstitution über die Kirche, Lumen Gentium (LG), die Kirche als „Sakrament, das heißt gleichsam Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1), und als durch den Hl. Geist geeinten Leib Jesu Christi, in dem die Gläubigen „durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus (...) vereint werden“ (LG 7). In den Sakramenten vollzieht sich also das Wesen der Kirche (LG 11), als einer geschichtlichen Größe, die jedoch aufgrund ihrer Stiftung durch Christus die Begrenztheit menschlicher Geschichte übersteigt und den einzelnen Menschen in die Geschichte Gottes mit den Menschen hineinstellt. „Die ganze Menschheitsgeschichte wird als eine von Gott herkommende und in Gott ein- mündende Bewegung begriffen, wobei die Kirche die Erfahrung der Weg-Gemeinschaft vermitteln soll.“206
Darüber hinaus wurden in der dogmatischen Konstitution Sacrosanctum Concilium (SC) die Sakramente wieder in einen liturgischen Zusammenhang einordnet (SC 6,7,27) und auf das Leben der Gläubigen hin bezogen; nicht mehr Minimalbedingungen wurden als für die Wirksamkeit der Sakramente entscheidend hervorgehoben, sondern die „täti- ge Teilnahme“ (SC 11; 21/2; 27/I; 48; 50/I) und der personale Mitvollzug der sakra- mentalen Handlung. Das Konzil betonte außerdem die Bedeutung des Wortes Gottes und seiner Verkündigung207 und stellte wesentliche Gemeinsamkeiten mit dem protes- tantischen Sakramentenverständnis fest. Es wertet „alles Materielle, Bildhafte, Zeichen- hafte, Körpersprachliche als gottgewollte Bestandteile eines heilbringenden Kultes, in dem Wort und Sakrament miteinander in untrennbarer Wechselbeziehung stehen.“208
Die nachkonziliare Sakramententheologie versuchte, diese Gedanken weiterzuführen und befaßte sich vor allem auch mit der Frage nach der Teilnahme der Gläubigen am sakramentalen Geschehen. So faßt beispielsweise Edward Schillebeeckx Sakramente als Begegnungsereignis zwischen Gott und Mensch auf, das nur durch den antwortenden Selbsteinsatz der Gläubigen fruchtbar werden kann. Auch verschiedene andere Theolo- gen versuchten, Sakramente als kommunikative Handlungen zu beschreiben, „sei es mehr im allgemeinen als Kommunikationsräume der Wirklichkeit Gottes und der Wirk- lichkeit des Menschen, sei es in mehr kommunikationstheoretischen Ansätzen.“209 Zu nennen wären hier Ganoczy, Lies, Hünermann und Schilson. Darüber hinaus befaßte man sich mit der christologischen Fundierung des Sakramentenbegriffs (Schillebeeckx, Rahner) und mit den Sakramenten als Wortgeschehen (Rahner, Vorgrimler, Kühn). Die genannten Ansätze können hier nicht ausführlich dargestellt und erörtert werden, da dies den Rahmen dieses kurzen historischen Abrisses zur Entwicklung der Sakramen- tenlehre sprengen würde. In jedem Fall ist deutlich geworden, daßder moderne katholi- sche Sakramentenbegriff, wie er im folgenden Abschnitt näher zu erläutern sein wird, eine noch relativ junge Erscheinung ist. Vierhundert Jahre lang waren die Sakramente als ‘Gnadenmittel’ mißverstanden worden. Es scheint insofern kaum verwunderlich, daßauch heute noch einige Menschen der (irrigen) Ansicht sind, daßdie göttliche Gnade in den Sakramenten ohne ihr eigenes Zutun wirksam werde, ohne daßsie zu ‘tätiger Teil- nahme’ bereit wären. Was genau aber bewirkt denn nun nach heutigem Verständnis ein Sakrament, und unter welchen Voraussetzungen? Was ist mit der Rede von der ‘Kirche als Ursakrament’ gemeint und welche Rolle spielt die Gemeinde bei der Spendung eines Sakramentes? Diesen Fragen möchte ich in der folgenden systematischen Reflexion nachgehen.
4.2 Was ist ein Sakrament?
Im folgenden Abschnitt soll, im Bewußtsein der Tatsache, daßes „die katholische Sakramententheologie nicht gibt“210 und daßman überdies nicht alle sieben Sakramente „über denselben Kamm scheren“211 darf, versucht werden, möglichst präzise zu be- schreiben, was ein Sakrament ist. Es kann im folgenden nur darum gehen, den Versuch zu unternehmen, zusammenzufassen, was den sieben Sakramenten gemeinsam ist. Eine ausführlichere Beschäftigung mit der Ehe als Einzelsakrament soll im darauffolgenden Kapitel erfolgen.
4.2.1 Theologische Voraussetzungen einer Sakramententheologie
Betrachtet man die Sakramente als „Zeichen der Nähe Gottes“212, weil sich in ihnen Gott den Menschen tatsächlich mitteilt, so stellt sich die Frage, warum er dies nicht unmittelbar tut, sondern den Weg über die Zeichen wählt und ob wir überhaupt sicher sein dürfen, daßer wirklich das Bestreben hat, eine Verbindung zum Menschen aufzu- bauen, daßer sich uns tatsächlich mitzuteilen versucht. Die christliche Glaubenstraditi- on geht davon aus, daßGott den Menschen nicht nur geschaffen hat, sondern daßer auch eine Beziehung zu ihm haben will, daßer ihm liebend zugeneigt ist. Nun ist Gott aber vom Menschen so radikal verschieden, als daßer sich ihm ohne Vermittlung mit- teilen könnte, eine unvermittelte Ansprache des Menschen durch Gott scheint unmög- lich. Dennoch teilt sich Gott den Menschen mit: er ‘offenbart’ sich. Wo dies geschieht, geht den Menschen „eine innere Einsicht auf, oder sie werden von einem Impuls mitge- rissen, die sie auf ihre eigenen gewöhnlichen Erfahrungen nicht zurückführen können, in denen sie sich vielmehr über sich selbst hinausgetragen fühlen (sich selbst über- schreiten, selbstranszendieren)“213. Diese Erfahrungen können sich allein in der Inner- lichkeit eines Menschen abspielen, sie kann aber auch über den Austausch mit anderen Menschen vermittelt werden, Gottes Mitteilung kann sich manifestieren in anderen Menschen, in deren Taten oder in geschichtlichen Ereignissen. Diese Mitteilung Gottes aber ist nicht irgendein Inhalt, eine Information, sondern sie ist die Mitteilung seiner selbst. Indem Gott sich von den Menschen vernehmen läßt, als der, der die Menschen liebt, der eine gemeinsame Geschichte mit ihnen haben will und ihnen das Heil ver- spricht, ist er selber da. Wenn „sein Wort und seine Herrlichkeit beim Menschen sind, »vertreten« sie nicht einen abwesenden Gott, sie stellen vielmehr die Weise seiner intimsten Gegenwart in der Innerlichkeit des Menschen dar“214, d.h. es findet eine Be- gegnung von Gott und Mensch statt. Der Mensch jedoch hat die Freiheit, dieses Offen- barungshandeln zurückzuweisen, indem er seine Transzendenzerfahrung nicht als Selbstmitteilung Gottes deutet. Das ändert zwar nichts an der Gegenwart Gottes und an seinem Willen, das Heil des Menschen zu wirken, es vermindert jedoch die Wirksam- keit der göttlichen Selbstbezeugung, denn das „Insein Gottes [...] wird zur Selbstkund- gabe Gottes an den Menschen, zur Offenbarung Gottes erst, wenn und insofern es menschlichem Erkennen und Vernehmen (wenigstens bei einigen Menschen) als sol- ches aufgeleuchtet und eingeleuchtet ist.“215
Bevor erörtert werden soll, wie sich die christliche Deutung der Einzelsakramente als Selbstmitteilungen Gottes verstehen läßt, erscheint es sinnvoll, einen Blick auf den Begriff des Symbols zu werfen. Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, kann Gott sich dem Menschen nicht unmittelbar mitteilen. Seine Offenbarung nimmt daher den Weg über Symbole als Werkzeug seiner Selbstmitteilung.
Exkurs: Was ist ein Symbol?
Anthropologische Grundlagen
Der „moderne“, naturwissenschaftlich bis positivistisch denkende Mensch tut sich mit dem Begriff des Symbols häufig eher schwer216 und das Denken in Bildern und Symbo- len wird heute vielfach als infantil oder antiquiert abgetan. Dabei lehrt schon der Blick in die neuzeitliche Psychoanalyse, daßsymbolisches Denken niemals ‘überholt’ sein kann, weil die Grundstruktur menschlichen Denkens symbolhaft ist. Jeder Mensch geht täglich mit Zeichen und Symbolen um, nimmt symbolische Handlungen vor oder be- greift die symbolischen Handlungen seiner Mitmenschen. Das beginnt bei so einfachen Dingen wie einem Händedruck, einer Umarmung oder einer roten Rose, die Verliebte einander schenken. Diese Blume ist für Schenkenden und Beschenkten nicht einfach irgendein botanisches Objekt, sondern ein Zeichen der Liebe; sie erhält eine über sich selbst hinausweisende Bedeutung. Symbole ähnlicher Art, mit denen wir täglich umge- hen, ließen sich dutzendweise aufzählen, sie entstehen immer dort, wo der Mensch Gegenständen, die ihm in seiner Umwelt begegnen, eine über sich selbst hinausweisen- de Bedeutung zuschreibt. Abstrakte Wirklichkeiten wie Liebe, Freiheit oder Freund- schaft lassen sich nur durch Symbole sichtbar machen, sie werden durch den symboli- schen Ausdruck „nicht nur signalisiert, sondern auch realisiert, nicht nur erkannt, son- dern auch erfahren.“217 Voraussetzung symbolhaften Denkens ist die Einsicht, daß„die Wirklichkeit mehrdimensional ist, daßSichtbar-Vordergründiges auf Unsichtbar- Hintergründiges verweist, daßder Hintergrund sich im Sinnlich-Wahrnehmbaren wie in Bildern zeigt“218.
Wo sich Menschen über ihre Wahrnehmung der Wirklichkeit sprachlich austauschen, entstehen Gemeinschaften, die durch ihre gleiche Auffassung der Wirklichkeit zusam- mengehalten werden, d.h.: „Gemeinschaften stiften ihre Symbole und umgekehrt: Sym- bole stiften Gemeinschaften“219. Im Zuge der Ausbildung einer Kultur werden Symbolhandlungen entwickelt und ritualisiert, d.h. daßAbläufe in Form und Inhalt festgelegt werden, es entstehen sogenannte ‘Natursakramente’.220 Solche Natursakramente sind in nahezu allen Kulturen in menschlichen Grunderfahrungen bzw. in den Knotenpunken menschlichen Lebens verwurzelt. „Diese Knotenpunkte sind Geburt, Tod, die geschlechtliche Gemeinschaft und die Mahlzeit . 221 Indem der Mensch diese wesentlichen Situationen seines Lebens ritualisiert, vollzieht er ihren sakramentalen Gehalt, er empfindet, daßnicht er selbst Herr über sein Leben ist, sondern „daßer in das Geheimnis des Lebens eingefügt ist, [...] daßer es mit einer Kraft zu tun hat, die ihm überlegen ist, und von der er immer abhängt.“222 Denn gerade in diesen auf biologischen Notwendigkeiten (Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung, Tod) beruhenden Grunddaten des Lebens scheint dem Menschen seine Verwiesenheit auf ein höheres, ihn und sein Leben umfassendes Ganzes auf.
Der Symbolbegriff in der Theologie
Der Begriff des Symbols leitet sich ab von dem griechischen Verb sumba/llein, zusammenwerfen, ab und meint „das Zusammenbringen zweier Teile, die ursprünglich zusammengehörten, mit dem Ziel, etwas zu erkennen, es ist also ein »Erkennungszei- chen«“223. Bereits im vierten Jahrhundert wurde der Begriff auf das Erkennungszeichen der Christen, das Glaubensbekenntnis, angewandt. Ursprünglich aber hatte er den anti- ken Brauch bezeichnet, daßFreunde oder Geschäftspartner, wenn sie sich trennten, einen Gegenstand, beispielsweise einen Ring, eine Münze oder ein Knöchelchen, in zwei Hälften brachen, von denen jeder Partner eine behielt. Die Hälfte des Gegenstan- des diente dann ebenfalls als Erkennungszeichen, an dem man sich wiedererkennen oder mittels dessen man Boten ausweisen konnte.224 Der zerbrochene Gegenstand hatte also gleichzeitig die Funktion, an die frühere Freundschaft oder sonstige Beziehung zweier Partner zu erinnern und auf ihr Wiederaufleben in der Zukunft zu verweisen, er machte eine gleichzeitig erinnerte und antizipierte Wirklichkeit sinnhaft gegenwärtig.
Der Symbolbegriff ist kein ausschließlich theologischer, sondern auch in der Psycholo- gie, Sprachphilosophie und Soziologie von Bedeutung. Der evangelische Theologe Paul Tillich unterschied daher solche Symbole, die seiner Ansicht nach gar keine Symbole sind, von den „echten“ Symbolen, die er differenzierend „repräsentative Symbole“ nannte.225 Diese Symbole sind die „einzige Sprache, in der sich Religion unmittelbar ausdrücken kann.“226 Die Merkmale der repräsentativen Symbole sind: erstens ihre Eigenschaft, über sich selbst hinauszuweisen, zweitens, daßsie an der Wirklichkeit teilhaben, auf die sie hinweisen, drittens, daßsie nicht beliebig sind - sie mögen zwar der Erfindung eines einzelnen entspringen, können aber nur so lange existieren, wie sie von der Gemeinschaft anerkannt werden, sie „sterben mit dem Sinnzusammenhang, aus dem sie gewachsen sind“227 -, viertens, daßsie Dimensionen der Wirklichkeit erschlie- ßen, die ansonsten unsichtbar bleiben, und schließlich fünftens ihre Macht, sowohl aufzubauen und zu erhalten, als auch zu zerstören, die sich sowohl auf den einzelnen als auch auf Gemeinschaften auswirkt.228 Denn ebenso wie Symbole Gemeinschaft stiften führt ihr Verlust zur Auflösung der Gemeinschaft. Die katholische Theologie unter- scheidet zwischen Vertretungssymbol und Realsymbol. Ein Vertretungssymbol ist ein solches, das etwas Abwesendes nur vertritt. Es weist auf etwas hin, daßunabhängig von ihm existiert. Als Beispiel ließe sich etwa ein Baustellenschild auf einer Autobahn anführen, das auf eine Baustelle hinweist, die sich noch zwei Kilometer entfernt befin- det. Ein Realsymbol hingegen ist ein Symbol, in dem sich das, was symbolisiert wird, realisiert, oder anders gesagt: es bewirkt, was es bezeichnet. Hintergrund der rich- tungsweisenden Definition Karl RAHNERs von ‘Realsymbol’ ist seine philosophische Erkenntnis, daßalles Seiende an sich symbolisch ist, „weil es sich notwendig «aus- drückt», um sein eigenes Wesen zu finden.“229 Erst indem es sich ausdrückt, kommt es zu sich selbst. Ein Beispiel für ein Realsymbol ist der menschliche Leib: der Mensch ‘ist’ nicht sein Körper, aber sein Körper ist das ihn verwirklichende Zeichen seiner selbst, sein Geist findet Ausdruck und realisiert sich in der Leiblichkeit, durch die er überhaupt erst zu sich selbst finden kann. Das Symbol ist also „die Weise der Selbst er- kenntnis, der Selbstfindung überhaupt.“230 Realsymbol aber ist „der zur Wesenskonsti- tution gehörende Selbstvollzug eines Seienden im anderen“231, d.h. bezogen auf das Beispiel des menschlichen Körpers, daßdieser erst da zum Realsymbol wird, wo er „bewußt und gewollt zum Medium der Kommunikation gemacht ist“232.
Wenn sich also jedes Seiende notwendigerweise symbolisch Ausdruck schafft, so ist „alle menschliche Wirklichkeit Symbolwirklichkeit“233. Auch Gottes Gegenwart kann für den Menschen nur sichtbar werden, indem sie sich symbolisch ausdrückt, d.h. indem konkrete Ereignisse, Handlungen oder auch Dinge auf Gott hin transparent werden. Letztendlich bedeutet dies, daßdie gesamte Schöpfung Zeichen bzw. Sakrament der göttlichen Gegenwart ist, weil alles auf Gott verweisen kann. Auch der Mensch als Gottes Bild (Gen 1,26) ist ein bevorzugter Ort seiner Gegenwart.234
4.2.2 Christus als Ursakrament
Nach christlicher Auffassung ist die ganze Welt und jeder einzelne Mensch ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Das „dichteste Zeichen durch das Gott der Welt sein Gottsein of- fenbar machen will“ aber ist „der in Jesus, dem Christus, menschgewordene göttliche Logos“235. Diese Auffassung läßt sich an verschiedenen Stellen im Neuen Testament belegen, beispielsweise wenn im Johannesevangelium gesagt wird: „Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen“ (Joh 14,9). Jesus Christus ist als das menschgewordene Wort Gottes „das absolute Symbol Gottes in der Welt, das unüberbietbar mit dem Sym- bolisierten erfüllt ist, also nicht nur Anwesenheit und Offenbarung dessen in der Welt, was Gott in sich selbst ist, sondern auch das ausdrückende Da-sein dessen, was (oder besser wer) Gott in freier Gnade der Welt gegenüber sein wollte, und zwar so, daßdiese Haltung Gottes, weil so ausgedrückt, nicht mehr zurückgenommen werden kann, son- dern die endgültige unüberbietbare ist und bleibt.“236 Mit anderen Worten: Jesus Chris- tus ist das Realsymbol Gottes katexochen, in ihm hat der göttliche Logos nicht nur menschliche Gestalt angenommen, sondern ist Mensch geworden, und hat, wie es das Konzil von Chalzedon formulierte, als „wahrer Gott und wahrer Mensch“237 unter den Menschen gelebt und gewirkt. Er ist nicht mit anderen göttlichen Selbstbekundungen in der Geschichte zu vergleichen, denn an keinem Ort und zu keiner Zeit war Gott in höherem Maße präsent als in Jesus Christus, er ist „in seiner geschichtlichen Existenz in einem die Sache und ihr Zeichen, sacramentum und res sacramenti der erlösenden Gnade Gottes“238. In Christus hat Gott den Menschen endgültig das Heil zugesagt und sein letztes Wort „in die greifbare Geschichte der Menschheit als Wort der Gnade, der Versöhnung und des ewigen Lebens hineingesprochen“239.
Bereits die Kirchenväter, unter anderem auch Augustin, sprachen in Anlehnung an Eph 1,9; 2,11-3,13; Kol 1,20.26f; 2,2, wo die Heilsabsichten Gottes als musth/rion bezeichnet werden, von Christus als dem mysterium Dei, was später mit sacramentum übersetzt wurde. Auch Thomas von Aquin und Martin Luther nennen Christus ein Sakrament. Die Kirchentheologie des 19. Jhds. sprach Christus als das ‘große Sakra- ment’ an, im 20 Jahrhundert prägte Carl Feeckes den Begriff des ‘Ursakraments’, der in der neueren katholischen Theologie inzwischen allgemein akzeptiert ist.240 In welcher Beziehung aber stehen nun die Einzelsakramente zu Christus als dem Ursakrament? Um diese Frage zu klären, mußzunächst ein Blick auf die ekklesiologische Struktur der Sakramente geworfen werden.
4.2.3 Die Kirche als Grundsakrament
Wenn Jesus Christus das Ursakrament ist, in dem Gottes Heilszusage an den Menschen geschichtlich greifbar geworden ist, so kann seine Sendung nicht mit seiner Auferste- hung und Himmelfahrt beendet sein, sondern sein Wirken mußin der Geschichte wirk- sam bleiben, bis sich die Verheißung erfüllt (Joh 16,7.16). Der Ort oder besser das realisierende Zeichen, in dem Christus unter den Menschen gegenwärtig bleibt, ist die Kirche. Sie ist „als Heilsmittel, durch das Gott auch in der Dimension des Gesellschaft- lichen und Geschichtlichen greifbar sein Heil den einzelnen anbietet, das Grundsakra- ment.“241 Paulus hat die unauflösliche Verbindung zwischen Christus und der Kirche im Bild vom Leib und den Gliedern beschrieben (Eph 5,23): die Kirche als die Gesamtheit ihrer Glieder, deren Haupt Jesus Christus ist, will sein Wirken an den Menschen fort- führen, sie ist „in Christus gleichsam das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott für die Einheit der ganzen Menschheit“ (LG 1). Sie ist nicht nur als eine irdische Institution zu verstehen, sondern die „mit hierarchi- schen Organen ausgestattete Gesellschaft und der geheimnisvolle Leib Christi“ bilden „eine einzige komplexe Wirklichkeit, die aus göttlichem und menschlichem Element zusammenwächst“ (LG 8). Die Kirchenkonstitution Lumen Gentium verwendet zur Beschreibung des Verhältnisses von Jesu Dienst als „lebendigem Heilsorgan“ des gött- lichen Wortes und dem Dienst der Kirche „am Geist Christi“ den Begriff der „Analo- gie“ (LG 8). Hierzu mußallerdings angemerkt werden, daßAnalogie hier nicht Gleich- heit, sondern „Ähnlichkeit bei gleichzeitiger größerer Unähnlichkeit“242 meint. Denn während zwischen dem göttlichen Logos und der Menschlichkeit Jesu Christi das Ver- hältnis einer hypostatischen Union besteht, ist dies zwischen Geist Gottes und der Kir- che nicht der Fall, d.h. daßdie Kirche nicht im selben Sinne Zeichen Christi sein kann, wie Christus Zeichen des Allerhöchsten ist. Denn während Jesus Christus frei von aller Schuld war, ist die Kirche eine Kirche der Sünder, die stets Gefahr läuft, ihre innere gnadenhafte Wirklichkeit zu verstellen, wofür die Kirchengeschichte zahlreiche Bei- spiele liefert.243
4.2.4 Die Sakramente als Grundvollzüge der Kirche
Die Sakramentalität der Kirche realisiert sich in ihren drei Grundvollzügen der martyria (Wortzeugnis), der diakonia (dem geschwisterlichen Dienst der Liebe) und der leiturgia (Gottesverehrung), die einander gegenseitig bedingen und durchdringen. Wo die Kirche diese drei Grundvollzüge wahrnimmt und damit Jesu Christi Handeln in der Welt fort- setzt, da ist Christus in höchstem Grade in ihr gegenwärtig, da aktualisiert sie ihr eige- nes Sakramentsein, indem sie den wirksamen Heilswillen Gottes zum Ausdruck bringt. Die herausragende Form, in der der dritte Grundvollzug der Kirche, die leiturgia ver- wirklicht wird, ist „die Praxis der Einzelsakramente in den konkreten liturgischen Ver- sammlungen“244. Die Einzelsakramente lassen sich von daher als Vollzug, Ausfaltung und Aktualisierung des sakramentalen Grundwesens der Kirche verstehen, in denen Gott dem einzelnen individuell in besonderer Weise seine Gnade zusagt, deren Annah- me nur hier [d.h. im Subjekt] stattfinden kann, „da siegreiche Gnade nur dort ist, wo sich durch sie die subjektive Heiligkeit des einzelnen ereignet.“245 Diese absolute Zusa- ge Gottes, das opus operatum, trifft im sakramentalen Vollzug auf das opus operantis, das noch offene Wort des freien Menschen, der diese Zusage annehmen, aber auch zurückweisen kann, woraus erhellt, daßdie Einzelsakramente „nur in Glaube, Hoffnung und Liebe wirksam werden können“246. Das Sakrament ist also kein ‘magischer Voll- zug’, durch den ohne Einwilligung des Empfängers irgend etwas an diesem geschieht, sondern kann nur dann ‘fruchtbar’ empfangen werden, wo der Empfänger bereit ist, es als Selbstmitteilung Gottes anzunehmen und entsprechend darauf zu antworten. Inso- fern setzen die Einzelsakramente als „Verleiblichungen des Sichereignens der göttli- chen Gnade“247 den Glauben voraus, aber sie „nähren [...] ihn auch, stärken ihn und zeigen ihn an“ (SC 59) und werden damit Heilsereignisse in der konkreten und indivi- duellen Heilsgeschichte des einzelnen: der „glaubend sich hingebende Mensch begegnet dem sich gnadenhaft hingebenden Gott und wird dadurch heil.“248 Jedes Sakrament „zeigt eine persönliche Beziehung an und schafft sie“249, gleichzeitig aber wird der Empfänger auch als Glied der Glaubensgemeinschaft angefordert, und das wiederum bedeutet, daßer nicht nur etwas geschenkt bekommt, sondern gleichzeitig hineingerufen wird in die Nachfolge Jesu Christi und somit aufgefordert ist, sich „in kirchlich- gemeindlicher Glaubensgemeinschaft als Subjekt kirchlicher Berufung und Sendung zu verstehen“250 und seinen Willen, „ein lebendiges Mitglied der Kirche zu sein“251 zu bekunden. Sakramente sind also nicht nur Selbstvollzüge der Kirche als dem Sakrament Jesu Christi und auch keine beliebig interpretierbaren Riten, sondern sie enthalten die Aufforderung an den einzelnen, das eigene Sakramentsein anzunehmen und zu leben, und insofern an den kirchlichen Grundvollzügen teilzuhaben. Und obwohl sie jeweils nur an bestimmten Zeitpunkten im Leben eingreifen, wollen sie den Lebensvollzug insgesamt prägen und tragen, also ‘zeitlebens’ wirken.252
4.2.5 Sakramente als Feiern der Gemeinde
Die Auffassung von Sakramenten als aktualisierende Vollzüge des kirchlichen Wesens, die sich in der katholischen Sakramententheologie inzwischen weitgehend durchgesetzt hat, hat den Vorteil, daßsie nicht das (falsche) Verständnis nahelegt, die Sakramente seien „als starre Größe der Kirche gleichsam ausgehändigt worden“253, sondern deutlich macht, daßbeim Vollzug der Sakramente nicht durch einen Spender an einem Empfän- ger gehandelt wird, sondern alle Beteiligten, d.h. Priester und Gemeinde, an diesem Vollzug aktiv mitwirken. Denn Sakramente sind Feiern der Kirche, die in der konkreten Gemeinde gegenwärtig ist (LG 26). Insofern ist auch die Hinführung zu den Sakramen- ten eine Aufgabe der Gemeinde als der ‘Kirche am Ort’.254 Die Liturgiekonstitution (SC 26) verwendet den Begriff der Feier als Bezeichnung für alle liturgischen Handlun- gen, zu denen auch die Sakramente zählen. In den Sakramenten wird nicht nur auf Gott verwiesen, sondern das, was „die Mitte aller Sakramente [ist], nämlich das unbegreifli- che Mysterium der Liebe Gottes“255 wird in der Gemeinschaft gefeiert. Die Sakramente sind aus dem Alltag herausgehobenes Ereignisse, die es dem Menschen ermöglichen, in den „signifikanten Gesten des Lebens allmählich Gott und seine Gnade“256 zu entde- cken. Als Feiern sind sie zweckfrei und absichtslos, verweisen aber gerade dadurch auch wieder zurück in das alltägliche Leben, auf die Notwendigkeit des Engagements, der Fortführung der drei kirchlichen Grundvollzüge im Alltag, sie machen also „nicht das Ganze christlicher Existenz“257 aus, sondern sind Ereignisse in der konkreten Heils- geschichte des einzelnen, die sich auf dessen ganze Existenz auswirken. Wie für jede Feier ist auch für die sakramentliche Feier die durch eine gemeinsame Grundüberzeu- gung geeinte Gemeinschaft konstitutiv, daher ist die Feier in der Gemeinschaft „der vom einzelnen gleichsam privat vollzogenen vorzuziehen“ (SC 27). Jede Feier eines Sakramentes lebt „von einer Hoffnung, denn sie übersteigt mit ihrer Freude (oder ihrer Tröstung) die gegenwärtigen Verhältnisse“258 und antizipiert die erhoffte Zukunft, das in Jesus angebrochene Heil für die ganze Menschheit. Sakramente sind insofern auch „ Anbruchszeichen “259, in denen der Gläubige in seiner noch ‘heillosen’ Wirklichkeit die tröstende Nähe Gottes verspüren und erfahren kann, daßGottes Reich im Anbrechen ist. Das einzelne Sakrament verweist immer auch auf das Ganze der Verkündigung Christi, auf das „Immer-Mehr“260 des symbolisch Dargestellten.
Bei der Betonung der Tatsache, daßdie Gemeinde die Vergegenwärtigung des sakra- mentalen Grundwesens der Kirche ist, fällt sofort der hohe Anspruch ins Auge, der hier an die konkrete Gemeinde gestellt wird. Wenn sie es ist, die die Grundvollzüge der Kirche wahrzunehmen hat, die das sakramentale Wesen der Kirche erfahrbar machen muß, wenn sich also in der konkreten Gemeinde Kirche als Heilsgemeinschaft ‘ereig- nen’ soll, so muss sie selbst ebenfalls zum Sakrament Christi werden, indem sie in ihrem Leben den Zuspruch und Anspruch Jesu Christi veranschaulicht.
4.2.6 Wort und Sakrament
Vor dem Hintergrund, daßsich auch nach dem II. Vaticanum noch hartnäckig die Auf- fassung hält, die evangelische Kirche sei eine ‘Kirche des Wortes’, die katholische hingegen eine ‘Kirche der Sakramente’, mußbei dem Versuch einer Beschreibung dessen, was Sakramente sind, auch auf die Frage nach dem Verhältnis von Wort und Sakrament eingegangen werden. Bereits Augustin hat, wie dargelegt wurde, das Wort das „vornehmste Zeichen“ genannt, und in der Tat trifft das, was über die Symbole gesagt wurde, unter bestimmten Voraussetzungen auch auf das Wort zu: auch im verba- len Ausdruck läßt sich eine bloßinformierende und eine realisierende Funktion erken- nen. Ein Verbotsschild zum Beispiel verwendet Worte, um eine Information mitzutei- len, bei einer Gratulation hingegen vollziehe ich in dem Moment, da ich sie ausspreche, das, wovon ich spreche: ich gratuliere jemandem, ich realisiere das, wovon ich spreche. Die Sprachwissenschaft nennt diese Art der Rede performativ und benutzt als Beispiele für performative Äußerungen häufig den verbalen Akt einer Sakramentenspendung, in dem durch das Wort Wirklichkeit geschaffen wird: indem beispielsweise die Worte ‘Ich taufe Dich’ gesprochen werden, wird die Taufe vollzogen.
Das Wort Gottes hat nun, im Gegensatz zu dem des Menschen, immer exhibitiven, ereignishaften261 Charakter, es bewirkt, was es bezeichnet. Die Performativität des Wortes Gottes läßt sich anhand des biblischen Befundes vielfach belegen: das Wort Gottes bringt die Schöpfung ins Dasein, es stiftet den Bund zwischen JHWH und sei- nem Volk, „es trifft Menschen, verändert sie, überwältigt Widerstrebende, so daßsie Prophet sein »müssen«“262 (vgl. Gen 1; Jes 48,13; Ex 19,3; Jer 1,4; Am 7,14f.). Und wo immer sich Kirche in ihrem Grundvollzug der martyria realisiert, wo sie also das Wort Gottes verkündet, da ist Gottes Gnade gegenwärtig (SC 7). Dies gilt für alle Gestalten von Verkündigung und somit auch für die Einzelsakramente, denn Sakrament und Wort Gottes dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, das „Sakrament ist vielmehr selbst Wort Gottes, in gewisser Hinsicht sogar in dichtester Darbietung“263, es ist Wort Gottes in besonderer Gestalt. Seit es Sakramente gibt, sind die zeichenhaften Handlun- gen immer vom Wort begleitet gewesen, und zwar nicht nur von Fürbitte und Predigt, sondern auch vom „proklamierten Wort Gottes“264, das so unauflösbar mit dem sakra- mentalen Zeichen verknüpft ist, daßman sagen kann, daß„das Grundwesen des Sakra- ments das Wort ist.“265 Und da dort, wo sein Wort durch den Menschen verkündigt wird, Gottes Gnade immer gegenwärtig ist und wirksam wird, geschieht dies auch in den Sakramenten. Daher ist das Handeln der Gemeinde in dem Sinne zu verstehen, daß„die versammelte Gemeinde der vom Geist Berufenen und das Wort Glaubenden [...] sich hier dankend, bekennend und gedenkend auf das Christusgeschehen und die darin ergangenen göttlichen Verheißungen beruft und Gott sich dieses gemeindlichen Han- delns für sein erneutes den Verheißungen entsprechendes heilsames Kommen (für die Zuwendung seines Christuswortes) bedient.“266 D.h.: die Sakramente haben eine dialo- gische Struktur, in der Gottes Wort und die Antwort des Menschen aufeinandertreffen. Das Spezifische des Sakramentes gegenüber der Verkündigung liegt im gemeinschaftli- chen Handeln aus dem Glauben, „in welchem Grundsituationen des einzelnen und der Gemeinschaft zum Ausdruck kommen“267. Wichtig ist, in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, daßzu einem Sakrament nicht nur die kurze Proklamation einer Formel gehört, sondern daßein Sakrament Liturgie „und damit immer in einem worthaften Gesamtzusammenhang zu sehen“268 ist.
Aus dem Gesagten geht hervor, daßein Streit um den Vorrang von Wort oder Sakra- ment jeder Grundlage entbehrt. Er ist ein Ergebnis der scholastischen Engführung des Sakramentenbegriffs und kann mit den Aussagen des II. Vaticanums als ebenso über- wunden betrachtet werden wie der seit der Reformation zwischen katholischer und evangelischer Auffassung schwelende Dissens um die Einsetzung der Sakramente durch Christus (vgl. S. 44), seitdem nach den Einsichten der historisch-kritischen Exegese auch die Einsetzung von Taufe und Abendmahl durch den historischen Jesus fraglich geworden ist.269
4.2.7 Sakramente als kommunikative Handlungen
Der kommunikationstheoretische Ansatz in der Sakramententheologie erweitert das Kommunikationsmodell Edward Schillebeeckx’, das Sakramente als Begegnungsereig- nisse zwischen Gott und Glaubendem interpretiert, in Richtung auf die konkrete Ge- meinde.270 Zu nennen ist hier an erster Stelle Alexandre GANOCZY, der - ausgehend von den Aussagen der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium über die Kirche als Kommunikationsgemeinschaft - die „kommunikativen Handlungen als Grundstruktur der sakramentalen Handlungen deutet.“271 Da das Wesen Gottes an sich eine Kommunikationsstruktur besitzt, „wesentlich worthaft und tätig, mitteilend und bindend“272 ist und in Wechselbeziehungen zu sich selbst kommt, erscheint es konsequent zu sagen, daß„die ‘Sache’ der Sakramente, die Wirklichkeit, um die es bei ihnen letztlich geht, [...] durchaus kommunikativer Natur ist.“273 In Abgrenzung von „herkömmlichen“ Analysen der sakramentalen Heilsökonomie; setzt Ganoczy radikal beim Menschen an, bei seinem Sein als geistiges Wesen, das durch seinen Leib „sich selbst erzählt“274 und so die Begegnung mit den Mitmenschen oder auch mit Gott ermöglicht.275 Hierbei berücksichtigt er vor allem die Kommunikationstheorie, die die Person immer als in vorgegebenen (Kommunikations-)Systemen verflochten betrachtet. Dementsprechend faßt er auch die Sakramente auf als „Systeme verbaler und non- verbaler Kommunikation, durch welche zum Christusglauben berufene Menschen in die Austauschbewegung der je konkreten Gemeinde eintreten, daran teilnehmen und auf diese Weise, getragen von der Selbstmitteilung Gottes in Christus und aus seinem Geiste, auf dem Weg zu ihrer Selbstwerdung vorankommen.“276 Gott wird verstanden als „Schöpfer einer umfassenden Kommunikationsgeschichte, innerhalb derer die Kirche als sowohl örtliches wie universales Kommunikationskollektiv ihren Sinn hat“277. Ausdrücklich betont wird ihr Wesen als „ministra Dei“, die ihre Verkörperung nur in der konkreten Ortskirche findet, und ihre ‘brüderlich-kollegiale’ Grundstruktur. Die Sakramente sind konstitutive Handlungen der Gemeinde als komplexen Interaktionssystems, die „ganz und gar für Menschen da“278 sind. Es wird allerdings auch deutlich gemacht, daßdie Kommunikationstheorie der Sakramentenlehre nur dann tionstheorie der Sakramentenlehre nur dann dienlich sein kann, wenn „alles geheimnis- gerecht gedacht und formuliert wird“, und der Ansatz nicht „einer eindimensionalen Technizität zum Opfer fällt“279. Auch Peter HÜNERMANN versucht, die Sakramente als kommunikative Handlungen zu beschreiben, die für die Entstehung und den Zusam- menhalt von Gruppen von höchster Wichtigkeit sind: jede Gruppe benötigt zu ihrem eigenen Fortbestehen „Figuren gemeinsamen Lebens“280, in denen der die Gruppe einende gemeinsame Sinnhorizont für die Gruppe und nach außen hin sichtbar gemacht wird. Dementsprechend lassen sich auch die Sakramente verstehen als Vollzug eines Miteinanders von Menschen, der aber immer auf Gottes Handeln bezogen bleibt. „Der doppelt-eine Aspekt der sakramentalen Symbolhandlungen, nämlich das göttliche Heilshandeln in kirchlicher Vermittlung [...] wird durch die Verstehenskategorie der kommunikativen Handlung [...] verdeutlicht und in dieser untrennbaren wechselseitigen Verknüpfung einsichtig.“281 Die Stärke der kommunikativen Ansätze liegt darin, daßsie, ohne Leugnung des an sich theologischen Wesens des Ereignisses „Sakrament“, vom Menschen als dem „Subjekt des sakramentalen Geschehens“ und dem „Ziel Got- tes“282 ausgehen, und ihn mit seinen Eigenheiten als Partner des Dialoges zwischen Gott und Mensch ernstnehmen. Sie versuchen insofern nicht einfach, die Tradition zu kon- servieren, sondern die „durch die Tradition bedachten Begegnungsmöglichkeiten derge- stalt zur Kenntnis zu nehmen, daßsie vom zeitgenössischen Menschen verstanden“283 werden können. Der Kommunikationsbegriff eröffnet neue, zeitgemäße Zugänge zu dem, was schon immer Gottes Anliegen war, nämlich sich und seine bedingungslose Liebe mitzuteilen, den Menschen seiner vorauseilenden Gnade zu versichern. Darüber hinaus heben die kommunikationstheoretischen Ansätze in besonderer Weise die Funk- tion der konkreten Gemeinden hervor und eröffnen insofern die Chance, „die vielfälti- gen Isolationserscheinungen der Gemeinden heute (...) zugunsten einer sich öffnenden, evangelisierenden Gemeinde zu überwinden.“284
5 DAS SAKRAMENT DER CHRISTLICHEN EHE
Im Folgenden soll versucht werden, im Hinblick auf die derzeitige Krisensituation der christlichen Ehe aufzuzeigen, was das katholisch Ehesakrament ist und was es bewirken soll. Ich werde mich hier darauf beschränken zu erörtern, wie nach katholischem Ver- ständnis die Sakramentalität der Ehe begründet wird und unter welchen Voraussetzun- gen das Sakrament ‘gültig’ gespendet wird, wobei ich mich hauptsächlich auf die kirch- lichen Verlautbarungen zum Thema Ehe, insbesondere die Pastoralkonstitution des II. Vaticanums, Gaudium et Spes (GS), und das Eherecht nach dem Codex Iuris Canonicis (CIC) von 1983 beziehen werde. Es scheint mir allerdings geboten, zumindest in knap- per Form auf die Geschichte der christlichen Ehe einzugehen, da die Ehe, vielleicht in noch stärkerem Maße als die anderen Sakramente, eine „geschichtliche Ordnung“ ist, die im Laufe ihrer langen historischen Entwicklung beträchtliche Wandlungen erfahren hat und wohl weiterhin erfahren wird.285 Zudem resultieren aus der Tradition viele Vorbehalte und Vorurteile gegenüber dem Ehesakrament - etwa, daßdie Kirche leib- feindlich sei und die Ehe lediglich als Mittel zur Zügelung des menschlichen Ge- schlechtstriebes eingesetzt habe -, die zwar seit dem II. Vaticanum weitestgehend der Grundlage entbehren, sich aber dennoch in den Köpfen vieler Gläubiger - vor allen derer, die ein eher distanziertes Verhältnis zur Kirche haben und somit die im Blick- punkt dieser Arbeit stehende Gruppe darstellen - bis heute gehalten haben.
5.1 Zur Geschichte des Ehesakramentes
5.1.1 Die Ehe in biblischen Zeugnissen
In den allermeisten Kulturen hat die Eheschließung sakramentalen Charakter, als ein Knotenpunkt des Lebens zählt sie zu den „Natursakramenten“, d.h. das Institut der Ehe galt und gilt, unabhängig von den großen Differenzen in den Eheauffassungen286 der verschiedenen Zeiten und Kulturen, „allgemein als religiös.“287 Im Alten Testament werden die Ehe und die geschlechtliche Gemeinschaft von Mann und Frau als von Gott im Paradies gestiftet beschrieben (Gen 2,18-24; Gen 1,27ff.) und insofern durchweg positiv gesehen (Hohelied, Sp 5,18ff, Spr 31,10-31); „eine Sakralisierung und Mythisie- rung des Geschlechtlichen“, wie sie in der religiösen Umwelt der Zeit sehr verbreitet war, wird jedoch abgelehnt. Vielfach wird das Bild der Ehe auch auf die Beziehung Gottes zum Volk Israel angewendet (Hos 1-3; Jer 2,2;3,1; Ez 16,23; Mal 2,14-16), wobei JHWH stets den verzeihenden liebenden Gatten darstellt, der seiner Braut Israel trotz ihrer Untreue in unverbrüchlicher Treue und bedingungsloser Liebe zugeneigt bleibt. Dennoch war die Eheschließung im Alten Testament eine profane Angelegen- heit, sie wird an keiner Stelle als religiöser Akt beschrieben,288 sondern hatte eher den Charakter eines Vertrages, de facto eines Kaufvertrages, durch den der Mann die Ge- walt über seine angehende Frau von deren Vater erwarb, indem er den Brautpreis zahl- te. Damit erlangte er die volle Verfügungsgewalt über die Frau, und den alleinigen sexuellen Anspruch auf sie, „weibliche Sexualität und Reproduktionskraft erscheinen [...] als männliches Eigentum.“289 Umgekehrt galt dieser Alleinanspruch nicht, der Mann durfte sexuelle Kontakte außerhalb seiner Ehe haben, allerdings nicht mit verhei- rateten Frauen, da er sonst die fremde Ehe brach. Auch durfte der Mann die Frau jeder- zeit aus der Ehe entlassen, indem er ihr einen Scheidebrief ausstellte (Dtn 24,1-3). Beide waren dann frei, wieder zu heiraten (wobei die Chancen für die Frau, einen neuen Partner zu finden, nicht allzu hoch gewesen sein dürften). Polygynie scheint in alttesta- mentlicher Zeit zumindest nicht grundsätzlich verboten gewesen zu sein (vgl. z.B. die Erzelternerzählung), möglicherweise war „ihre Erlaubnis jedoch an enge Bedingungen (etwa Kinderlosigkeit) geknüpft“290.
Im Neuen Testament wird keine eigentliche Ehelehre entfaltet, es wird jedoch so selbst- verständlich von der Ehe gesprochen und ihre Bilderwelt verwendet, daßdie Ehe als In- stitution vorausgesetzt werden kann.291 Die Ehe wird im NT keinesfalls grundsätzlich negativ bewertet (wie es dennoch zu einer ehe- und leibfeindlichen Haltung der kirchli- chen Überlieferung kommen konnte, wird in der dogmengeschichtlichen Betrachtung zu thematisieren sein), sondern in Mk 10,29 auf Gottes ursprünglichen Schöpfungswillen zurückgeführt.292 In dieser Perikope, in der Jesus mit den Pharisäern über die Eheschei- dung spricht, kommt seine Einstellung zur Ehe deutlich zum Ausdruck: sie ist Bestand- teil der von Gott gegebenen Schöpfungsordnung und als solche grundsätzlich unauflös- lich, „denn was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen“ (VV 6-9). Das mosaische Gesetz, das die Ehescheidung zuläßt, wurde den Israeliten nur wegen ihrer Hartherzigkeit gegeben und entspricht nicht dem göttlichen Schöpfungswillen, den der Mensch allerdings nur zu erfüllen in der Lage ist, wenn Gott ihm ein neues Herz schenkt (Jer 31,33). „In der Verkündigung Jesu vom nahegekommenen Reich Gottes geht diese messianische Erwartung des »neuen Herzens« anfanghaft in Erfüllung.“293 Noch schärfer formuliert sind die Aussagen über die Unzulässigkeit der Ehescheidung in Mt 5,31f. und Lk 16,8: die Scheidung wird hier als Ehebruch bezeichnet.294 Ent- scheidend ist zu sehen, daßmit den Worten Jesu zur Ehescheidung nicht einfach das Gesetz verschärft wird, sondern daßsie prophetisch-messianisch im Hinblick auf das zugesagte Heil zu verstehen sind. „Damit gehört die Ehe in der Verkündigung Jesu sowohl der ursprünglichen Schöpfungsordnung wie der Ordnung des Heils in der Herr- schaft der Liebe und Treue Gottes an“295 und steht somit auch in einem direkten Bezug zu Christus als der Inkarnation des Kommens des Gottesreiches. Dieser christologische Bezug wird unter anderem im ersten Korintherbrief deutlich, wenn Paulus seine Adres- saten auffordert „im Herren“ zu heiraten (1 Kor 7,39). Das bedeutet, daßdie Ehe in das mit der Taufe beginnende ‘Sein in Christus’ hineingenommen ist. Mann und Frau sollen in der Ehe so aneinander handeln, wie Jesus an den Menschen, die an ihn glauben, handelt und so dieses Handeln und diese Gesinnung (Phil 2,5) aktualisieren.296 Noch expliziter wird dies im Epheserbrief: hier wird unter Bezug auf Gen 2,24 die Leibesein- heit von Mann und Frau mit der Einheit von Christus und Kirche, die Liebe Jesu zur Kirche mit der Liebe des Mannes zu seiner Frau verglichen - der Bezug auf die alttes- tamentlichen Vergleiche des Bundes JHWHs mit dem Volk Israel ist unverkennbar.297 So wie Christus die Kirche bis zur Selbsthingabe am Kreuz geliebt hat (h)ga/phsen kai pare/doken), soll der Mann seine Frau lieben;298 die Ehe „wird zum Abbild des höheren Liebesbündnisses, die dienende Hingabe des Mannes an seine Frau zum Abbild der Lebenshingabe Christi, die Hingabe der Frau an ihren Mann zum Abbild der Ange- wiesenheit der Kirche auf Christus.299 In V 32 heißt es dazu: „Dies ist ein tiefes Ge- heimnis (musth/rion), ich beziehe es auf Christus und die Kirche.“ Da die Vulgata musth/rion hier mit sacramentum übersetzte, ist diese Stelle in der Tradition z.T. als ‘Schriftbeweis’ für die Sakramentalität der Ehe behandelt worden,300 inzwischen besteht in der exegetischen Forschung jedoch Konsens darüber, daßsich aus der Stelle die Sakramentalität oder gar die Einsetzung des Ehesakramentes durch Christus keinesfalls zwingend ableiten lassen, denn das Geheimnis, von dem hier die Rede ist, bezieht sich eben nicht auf die Ehe der Menschen, sondern auf die Verbindung von Christus und Kirche: wie in Abschnitt 4.1.1.2 beschrieben, meint musth/rion in den neutestament- lichen Schriften zumeist den in Christus (und der Kirche) offenbar gewordenen gött- lichen Heilsplan. In diesen Heilsplan aber wird die Ehe hier hineingenommen, in ihr wird die Liebe Gottes, die er in Christus geoffenbart hat, nicht nur nachgeahmt, sondern realisiert, die „Liebe zwischen Mann und Frau ist [...] vergegenwärtigendes Zeichen, Epiphanie der in Christus ein für allemal geschenkten und durch die Kirche gegenwärti- gen Liebe und Treue Gottes.“301 Die Ehe wird hier also zum einen auf ihre Grundlegung in der Schöpfungsordnung zurückgeführt (V 31), andererseits aber wird die Schöp- fungsordnung gleichsam überstiegen auf die göttliche Heilsordnung hin: das, was schon immer der eigentliche Sinn der Ehe war, ist durch das Christusereignis offenbar gewor- den. Die weitere exegetische Diskussion um Eph 5, insbesondere auch vor dem Hinter- grund des Dissenses zwischen katholischer und evangelischer Auslegung, kann hier nicht mehr erörtert werden; festzuhalten gilt es, daßdie Sakramentalität der Ehe sich zwar nicht unmittelbar aus dieser Textstelle ableiten läßt, daßkatholische Exegeten jedoch der Auffassung sind, daßder Ehe als Abbild des Bundes Christi mit der Kirche durchaus Sakramentalität zugesprochen werden kann.
Die bisher erörterten Stellen vermitteln ausnahmslos ein positives Ehebild. Es finden sich im NT - vor allem bei Paulus - aber auch solche, die die Ehe negativ zu beurteilen scheinen, beispielsweise 1 Kor 7, wo es heißt: „Es ist gut für den Mann keine Frau zu berühren“ (V 2) oder, in Bezug auf die Unverheirateten und Witwen: „Es ist gut, wenn sie so [d.h. ehelos, Anm. d. Verf.] bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten.“ (V 8bf). Geht aus diesen Aussagen nicht klar hervor, daßes besser ist, ehelos zu bleiben, und daßdie Ehe nur als Mittel zur Vermeidung sexuel- ler Entgleisungen ihre Berechtigung hat? Die Kirchenväter jedenfalls beriefen sich neben Mt 19,10-12 auch auf diese Stelle, um den höheren Wert des neuen Standes der Jungfräulichkeit (im Judentum galt Ehelosigkeit keinesfalls als Gut, sondern als Schan- de) zu begründen, und prägten damit die kirchliche Tradition so stark, daßdas Tridenti- num schließlich erklärte:
„Wer sagt, der Ehestand sei dem Stand der Jungfräulichkeit oder des Zölibates vorzuziehen und es sei nicht besser und seliger, in Jungfräulichkeit und dem Zölibat zu bleiben, als sich in der Ehe zu verbinden, der sei mit dem Anathema belegt.“302
Und so hielt sich die Auffassung von der Ehe als ‘ remedium concupiscentiae ’, wie im folgenden Abschnitt noch zu zeigen sein wird, bis in unser Jahrhundert hinein. Die zeitgenössische Exegese hat allerdings den Aussagen des Ersten Korintherbriefes viel von ihrer Schärfe genommen, indem sie darauf hinwies, daßPaulus’ zurückhaltende Einstellung gegenüber der Ehe nicht zuletzt auf seiner Naherwartung (V 27) gründet und daßer für seine Aussagen zu dieser Frage keine Normativität beansprucht (V 25). Zudem versteht er die Ehelosigkeit als ein Charisma (V 7), das nicht jedem gegeben sein kann.303
Resümierend läßt sich sagen, daßdie Ehe im NT insgesamt als von Gott gestiftete und von Jesus geheiligte Institution gesehen wird, die jedoch keinen Fortbestand im Him- melreich haben wird (Mt 22,23-29par; 1 Kor 7,29-31). Dennoch bleibt Ehebruch eine schwere Sünde. Entsprechend dem patriarchalisch geprägten Umfeld, dem die Texte entstammen, werden vom Mann Fürsorge für die Frau, von der Frau aber Gehorsam gegen den Mann erwartet, doch werden an einigen Stellen diese Rollenzuweisungen religiös überwunden (Gal 3,28; 1 Petr 3,7). Auch finden sich keine Hinweise auf eine Verpflichtung zur Nachahmung der Ehelosigkeit Jesu für kirchliche Amtsträger (1 Tim 3,2-12; Tit 1,6).304
5.1.2 Theologiegeschichtliche Entwicklung des Ehesakramentes
5.1.2.1 Praxis und Theologie der Ehe in den ersten Jahrhunderten
Über die Eheschließungsriten von Christen in den ersten drei Jahrhunderten ist wenig bekannt, es darf aber davon ausgegangen werden, daßChristen in dieser Zeit gemäßden Usancen ihres jeweiligen Umfeldes geheiratet haben, also nach jüdischem Ritus oder dem der Völker des Mittelmeerraumes, worauf hier nicht im einzelnen eingegangen zu werden braucht.305 Weder das Neue Testament noch die Kirchenväter äußern sich ver- bindlich zum Procedere einer Eheschließung. Erste Hinweise auf eine kirchliche Mit- wirkung bei der Heirat finden sich bei Ignatius von Antiochien.306 Auch Tertullian, Origines und Ambrosius befassten sich mit der Ehe, ihrer Heilswirksamkeit und der in ihr ankommenden göttlichen Gnade, konkrete Anweisungen werden aber nicht gegeben, und wenn, sind sie seelsorglicher Natur und nicht rechtsverbindlich.307 Der jüdische Brauch der Elternsegnung wurde anscheinend bereits in den ersten beiden Jahrhunder- ten von Christen übernommen, ab dem dritten Jahrhundert wurde es Usus, in die häusli- che Segenshandlung einen Priester einzubeziehen, seit dem vierten Jahrhundert ist belegt, daßdie Segnung im Rahmen einer Brautmesse stattfand; auch wurden in kir- chenrechtlichen Kanones Ehehindernisse festgehalten (Religionsverschiedenheit, Blutsverwandtschaft). Im Osten begann sich ein kirchlicher Eheschließungsritus auszubilden. Im Westen hingegen dauerte es bis zur Frühscholastik, bis es zu einer Uniformierung der Verfahrensweisen kam. Die eigentliche Eheschließung blieb bis in die Frankenzeit eine „weltlich-rechtliche Angelegenheit“308.
In Bezug auf die Entwicklung der Eheauffasung der lateinischen Kirche war vor allem das antike römische Eherecht von Bedeutung, das monogam geprägt war und „auf dem Grundsatz freier Eheschließung und Beendigung der Ehe“309 basierte. Die Eheschlie- ßung galt als ein Vertrag, der rechtsgültig durch die Bekundung des Ehewillens von beiden Partnern geschlossen wurde (consensus facit nuptias). Allerdings hatte sie auch einen anderen Aspekt, nämlich den Beginn des gemeinsamen Lebens der Eheleute (nuptiae), der schon bei den Römern religiös gedeutet wurde. Die Kirchenväter des vierten und fünften Jahrhunderts anerkannten diese Form der Eheschließung als auch vor Gott gültig, forderten aber im Unterschied zum römischen Recht die absolute Un- auflöslichkeit der Ehe. Die Ehe, deren oberster Zweck in der Erzeugung von Nach- kommenschaft gesehen wurde, galt ihnen als positiv und heilswirksam, die Ehelosigkeit wurde jedoch höher geschätzt. Die Beurteilung der ehelichen Sexualität stellte für die Kirchenväter ein Problem dar. Auf der einen Seite mussten sie sich gegenüber der antiken sexuellen Libertinage abgrenzen, auf der anderen Seite hielten sie die Ehe und somit auch die in ihr stattfindende Sexualität für der Schöpfungsordnung gemäß, konn- ten also auch nicht kritiklos das Ethos der Stoa oder des Manichäismus übernehmen.310 Augustin, der mit seiner Lösung zu dieser Frage die kirchliche Tradition entscheidend prägte, war vom Manichäismus beeinflußt. Er ver-trat die These, daßAdam und Eva, der Schöpfungsordnung entsprechend, sich schon im Paradies sexuell betätigt hätten. Nach dem Sündenfall aber sei die sündhafte und schädliche ‘ungeordnete Begierde’ zur an sich guten Sexualität hinzugetreten.311 Daher bedarf es nach Ansicht des Augustin der drei Ehegüter (bona), um den ehelichen Akt zu rechtfertigen. Diese Güter sind: Nachkommenschaft (proles), (sexuelle) Treue (fides) und Sakrament (sacramentum).312 Ebenfalls von großer Bedeutung für die weitere Entwicklung des Ehebegriffs war die Augustinische Lehre vom Eheband (vinculum). Dieses kommt durch die Konsenserklä- rung der Partner und den Vollzug der Ehe zustande und besteht, unabhängig von der weiteren Entwicklung der Beziehung der Gatten zueinander, bis zu deren Tod, womit die Wiederverheiratung kategorisch ausgeschlossen wird.
Ein lange diskutiertes Problem der frühen Ehetheologie war die Frage, ob die Ehe durch den Konsens der Partner, oder, wie es in der germanisch geprägten Welt angenommen und durch den Erzbischof Hinkmar von Reims in die theologische Diskussion eingebracht wurde, durch den Beischlaf (copula) gültig werde. Der Streit um Konsens- (u.a. Ivo von Chartres, Hugo von St. Viktor, Pariser Schule) oder Kopulatheorie (Kanonistenschule von Bologna) zog sich bis ins 12. Jahrhundert hin, dann erst gelang es Papst Alexander III. einen Kompromißherbeizuführen: eine Ehe wird gültig durch den Konsens der Brautleute, doch erst der Vollzug macht sie unauflöslich. Diese Auffassung hat sich im katholischen Sakramentenrecht bis heute erhalten.313
5.1.2.2 Mittelalter
Im Mittelalter erlangte die Kirche nach und nach die Autorität, Bedingungen und Form der Eheschließung zu bestimmen, das weltliche Eherecht wurde durch das kirchliche er- setzt. In den lehramtlichen Aussagen lässt sich verfolgen, wie die Kirche allmählich ihren Einflußauf die Eheschließung ausdehnte: bereits die pseudo-isidorischen Dekreta- lien (um 847) forderten die öffentliche Eheschließung in der Kirche; das bedeutende kanonistische Lehrbuch Decretum Gratianum (um 1140) übernahm diese Forderung. 1215 untersagte das IV. Laterankonzil ausdrücklich die klandestinen (nicht- öffentlichen) Eheschließungen und wies die Priester an, das Vorliegen von Ehehinder- nissen zu prüfen.314 Dennoch blieb die nicht öffentlich geschlossene Ehe weiterhin gültig, da der einmal gegebene Ehekonsens respektiert werden musste. „Um 1200 be- gegnet nur noch die kirchliche Eheschließung, in einem vor der Kirchentür vollzogenen Ritus, in dem der Priester nicht mehr optativ bittet »Gott gebe euch zusammen« (deo vos coniungat), sondern indikativisch erklärt: »ich gebe euch zusammen« (ego vos coniungo); diesem Ritus folgt eine Hochzeitseucharistiefeier in der Kirche.“315 Ab 1300 fand dann auch die eigentliche Eheschließung in der Kirche statt.
Ein großes Problem der mittelalterlicher Ehetheologie war die Begründung der Sakra- mentalität der Ehe, die bereits von Petrus Damiani, später von Petrus Lombardus be- hauptet worden war. Die frühscholastischen Theologen hatten die Ehe zwar zu den Sa- kramenten gezählt, ihr die Gnadenwirkung jedoch abgesprochen.316 Erst im 13. Jahr- hundert befassten sich Albertus Magnus und sein Schüler Thomas von Aquin mit der Frage, ob und in welcher Hinsicht der Ehe eine Gnadenwirkung zuzuschreiben sei. Die Definition von Sakrament lautete schließlich efficiunt quod figurant, insofern konnte ein Sakrament, das nicht bewirkt, was es bezeichnet, eigentlich gar nicht Sakrament ge- nannt werden. Thomas versuchte dieses Problem folgendermaßen zu lösen: der im gesprochenen Wort offenbarte Konsens der Ehegatten sei die forma des Ehesakraments. Durch diese verba de praesenti wird in den Eheleuten eine Disposition zum Empfang der göttlichen Gnade geschaffen. Die Sache, die im Sakrament dargestellt wird, ist z.T. in Form von Hilfe zur Erfüllung der ehelichen Pflichten im Sakrament enthalten, z.T. aber auch lediglich dargestellt und nicht enthalten, nämlich die Einheit von Christus und Kirche. Eine Verlegenheitslösung: „das Sakrament bewirkt zwar die Gnade, aber Zei- chen und Wirkung decken sich nicht“317. Den priesterlichen Segen über das Brautpaar verstand Thomas lediglich als Sakramentale - damit wurde es möglich, nicht den Pries- ter, sondern die Brautleute selbst als Spender des Sakramentes der Ehe zu sehen. Hier- durch und durch die fortschreitende Verrechtlichung des Ehesakramentes geriet der liturgische Aspekt der Eheschließung nahezu in Vergessenheit.
5.1.2.3 Reformation und Tridentinum
1516 übersetzte Erasmus von Rotterdam erstmals den Begriff musth/rion in Eph 5,32 nicht mehr mit sacramentum und leitete daraus die Forderung nach Lockerungen des kirchlichen Eherechtes ab, indem er argumentierte, daßdie Herzenshärte, die Jesus als Grundvoraussetzung des mosaischen Rechtes zur Ehescheidung benannt hatte, bei den Christen nach wie vor gegeben sei. Diese Forderungen übernahmen später die Reforma- toren, deren Kritik sich zum einen an der kirchlichen Höherbewertung der Askese ge- genüber dem ehelichen Leben, zum anderen an der beherrschenden Stellung des Kir- chenrechts entzündete. Zuvörderst Luther insistierte darauf, daßdie Ehe ein von Gott gewollter und somit anzustrebender Stand sei, wohingegen die Askese das Charisma einiger weniger sei, in den meisten Fällen aber zur Hurerei führe. So schrieb er in seiner Schrift Vom ehelichen Leben 1522:
„Alleine den Lästermäulern habe ich wollen wehren, die den ehelichen Stand so weit unter den Stand der Jungfräulichkeit stellen, daßsie sagen können: Selbst wenn die Kinder heilig würden - Keuschheit wäre dennoch besser! Man soll keinen Stand vor Gott besser sein lassen als den eheli- chen.“318
Bei aller Hochschätzung der Ehe als Bestandteil der Schöpfungsordung und Zeichen für göttliches Gnadenhandeln und Einheit von Christus und Kirche spricht er ihr die Sak- ramentalität jedoch ab, da sich in der Schrift kein Verheißungswort Jesu finde (vgl. Kap. 4.1.5). Daher war die Ehe für Luther, gemäßseiner Zwei-Reiche-Lehre, ein „welt- lich Ding“319, das nicht unter die Herrschaft des Kirchenrechtes gehöre, sondern eine staatliche Angelegenheit sei; der Kirche komme keinesfalls die Kompetenz zu, über eherechtliche Fragen zu entscheiden. Er forderte daher die öffentliche Eheschließung vor Zeugen und, im Falle böswilligen Verlassens oder Ehebruchs, die Möglichkeit zur Scheidung der ansonsten unauflöslichen Ehe.
Das Konzil von Trient (vgl. S. 44) legte die Siebenzahl der Sakramente fest und nannte unter ihnen auch die Ehe, deren Gnadenwirkung es in Eph 5,25 und 32 „angedeutet“ sieht, ohne dies näher zu erläutern.320 Es verteidigte die kirchlichen Anspruch, Eheangelegenheiten rechtlich zu regeln,321 und übernahm die Lehre vom unauflöslichen Eheband,322 wobei es allerdings bezüglich der Unauflöslichkeit sehr vorsichtig formulierte, da man sowohl die griechische Praxis, Zweitehen zuzulassen als auch „Abweichungen in der eigenen Tradition nicht ausdrücklich verurteilen“323 wollte.
Darüber hinaus verfügte das Konzil in seinem Dekret Tametsi (1563), daßsich die Katholiken fürderhin bei der Eheschließung an eine bestimmte Form halten sollten: die Ehe müsse vor einem Priester und in Anwesenheit von zwei Zeugen geschlossen wer- den, sonst sei sie nicht gültig.324 Hintergrund der Einführung der Formpflicht war die Erfahrung, daßmit der Möglichkeit zur gültigen klandestinen Eheschließung die kir- chenrechtlichen Bestimmungen ohne Weiteres unterlaufen werden konnten. Sakrament und gültige Eheschließung (Konsenserklärung) wurden rechtstheologisch miteinander verbunden, eine Lehre, die im 19. Jahrhundert noch weiter ausgebaut wurde, um der säkularen Zivilehe die Rechtsgrundlage zu entziehen; das Ehesakrament wurde faktisch mit dem Ehevertrag identifiziert:325 zwischen Christen kann kein gültiger Ehevertrag zustande kommen, ohne daßer zugleich ein Sakrament wäre (can. 1012 §1 CIC 1917). Damit konnte (und kann) die Kirche die Sakramentalität der Ehe als Argument für den eigenen Autoritätsanspruch in Fragen des Eherechtes verwenden, die Ehe als umfassen- de Lebensgestalt trat über dem kirchenrechtlichen Aspekt in den Hintergrund.326 Ent- sprechend wird in den päpstlichen Verlautbarungen zwischen 1796 und dem II. Vaticanum (1962-65)327 der juridisch-vertragliche Charakter des Ehesakramentes herausgestellt.328 Auf die Problematik dieser Sicht wird im Kapitel zum Eherecht noch einzugehen sein.
Einflußbereiches liegt. Vielmehr hat auch der Staat seine Macht von Gott und damit die Kompetenz, über äußere Dinge wie den Ehestand zu urteilen.
5.1.2.4 Die Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils
Mit der ‘emotionalen Revolution’ der Romantik kam im 19. Jahrhundert ein neues Eheverständnis auf: die Ehe wurde nicht mehr sachlich-objektiv unter dem Aspekt der Fortpflanzung und der Wirtschaftlichkeit gesehen, sondern als Liebesbund, der in der Hauptsache die subjektive ‘Erfüllung’ der Ehegatten zum Ziel hatte. Auch in der E- hetheologie gab es Ansätze zu einem personalen Verständnis der Ehe (Barth, Dohms, Michel), die sich aber, nachdem die Kirchenväter sich zunächst sehr skeptisch gegen- über den stattfindenden geistigen und gesellschaftlichen Umwälzungen des 18. und 19. Jahrhunderts gezeigt hatten, erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts auch in kirchenamtli- chen Verlautbarungen Bahn brechen konnten, insbesondere in den Äußerungen des II. Vaticanums zum Ehesakrament.
Primär ist in diesem Zusammenhang auf die Artikel 47-52 der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes einzugehen, in denen das erneuerte kirchliche Eheverständnis deutlich zum Ausdruck kommt: vor dem Hintergrund der sozialen und kulturellen Veränderun- gen in Welt und Gesellschaft und der daraus resultierenden Krise der christlichen Ehe wird hier versucht, das Sakrament der Ehe den veränderten Umständen gemäßneu zu beschreiben. Augenfällig wird sofort die stark personale Ausrichtung der konziliaren Eheauffassung: Artikel 48 bietet eine Zusammenfassung des kirchlichen Eheverständ- nisses, in dem die Ehe sowohl aus schöpfungs-, wie aus heilstheologischer Sicht darge- stellt wird. Sie wird bezeichnet als „innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe“, die „durch ein unwiderrufliches personales Einverständnis“ gestiftet wird. Das Bemü- hen, vom verrechtlichten Eheverständnis abzukommen und die Ehe als „personal freien Akt, in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und annehmen“ aufzufassen, ist offenkundig. Der Akzent liegt auf der gegenseitigen Hingabe und Annahme, nicht mehr auf dem Recht eines Ehepartners auf den Leib des anderen. Desweiteren spricht der Artikel davon, daßdie Ehe zwar auf Nachkommen hingeordnet sei, stellt aber keine Rangfolge der Ehegüter auf. Hervorgehoben wird indessen die zentrale Bedeutung der gegenseitigen Liebe als unabdingbarem Wesensbestandteil der Ehe. Von hier wird auch die sakramentale Dimension der Ehe begründet:
„Wie nämlich Gott einst durch den Bund der Liebe und Treue seinem Volk entgegenkam, so begegnet nun der Erlöser der Menschen und der Bräutigam der Kirche durch das Sakrament der Ehe den christlichen Gatten. Er bleibt fernerhin bei ihnen, damit die Gatten sich in gegenseitiger Hingabe und ständiger Treue lieben, so wie er selbst die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Echte eheliche Liebe wird in die göttliche Liebe aufgenommen und durch die erlösende Kraft Christi und die Heilsvermittlung der Kirche gelenkt und bereichert...“(GS 48).
Die sakramentale Ehe eröffnet also den Eheleuten die Möglichkeit, die Liebe Christi zu seiner Kirche als sakramentales Heilszeichen zu erfahren329 - damit gewinnt die Ehe „eine geistliche Dimension, wird genuin als Sache des personalen Glaubensvollzuges kenntlich gemacht“330, wobei die Sakramentalität der Ehe nicht auf den Akt der Ehe- schließung reduziert erscheint, sondern deutlich gemacht wird, daßdas gesamte eheli- che Leben sakramentalen Charakter hat: im Vollzug wird die eheliche Liebe und Treue „wirksames Zeichen, erfülltes Symbol, wirkliche Vergegenwärtigung und Epiphanie der [...] Liebe Gottes“331. Damit wird die gelebte Ehe als Zeichen der Gegenwart göttlicher Liebe durch die aktive Beteiligung der Ehepartner zur Heilssituation. Die Wirkung des Sakramentes ist, daßdie Ehepartner Unterstützung für ihre Aufgaben in der Ehe erhal- ten:
„So werden die christlichen Gatten in den Pflichten und der Würde ihres Standes durch ein eige- nes Sakrament gestärkt und gleichsam geweiht. In der Kraft dieses Sakramentes erfüllen sie ihre Aufgabe in Ehe und Familie. Im Geist Christi, durch den ihr ganzes Leben mit Glaube, Hoffnung und Liebe durchdrungen wird, gelangen sie mehr und mehr zu ihrer eigenen Vervollkommnung, zur gegenseitigen Heiligung und so gemeinsam zur Verherrlichung Gottes“ (GS 48).
In bezug auf die Unauflöslichkeit der Ehe wird nicht mehr mit ihrer Sakramentalität argumentiert, sondern „die innige Vereinigung als gegenseitiges Sichschenken zweier Personen wie auch das Wohl der Kinder verlangen die unbedingte Treue der Gatten und fordern ihre unauflösliche Einheit“ (GS 50).
Die Liebe als Grundlage der christlichen Ehe wird beschrieben als eine ganzheitliche, personale und selbstlose Liebe, die das ganze Leben der Eheleute durchdringe und sich gerade durch „ihre Selbstlosigkeit in Leben und Tun verwirkliche [...] und wachse.“332 Von Gott „geheilt, vollendet und erhöht“ findet sie in der Sexualität ihren Ausdruck. Leibfeindlichen Tendenzen, die den Geschlechtsverkehr in der Ehe als „legalisierte Unzucht“333 sehen, wird entschieden widersprochen, vielmehr kommt dem ehelichen Akt, „durch den die Eheleute innigst und lauter eins werden“ (GS 49), als dem eigentli- chen Vollzug der Ehe eine eigene Würde zu (sofern er human vollzogen wird). Die Ehe und die eheliche Liebe sind zwar auf die Zeugung von Kindern hingeordnet, in der sie „gleichsam ihre Krönung“ (GS 50) finden, aber die Fortpflanzung ist nicht der Allein- zweck eines geschlechtlichen Aktes. Auch wird deutlich hervorgehoben, daßder ‘Ehe- zweck’ der Fortpflanzung keinesfalls dem der gegenseitigen Liebe vorgeordnet ist. Die Eheleute als „Interpreten der Liebe Gottes“ sollen selber entscheiden, wie sie den Auf- bau einer Familie planen, indem sie jeweils die eigenen Rahmenbedingungen bedenken. Aus diesem Abschnitt läßt sich (obwohl der Hinweis auf die Eheleute, die „eine größere Zahl von Kindern [...] hochherzig auf sich nehmen“ diese Aussagen zumindest partiell relativiert) die Aufforderung zu verantworteter Elternschaft und sinnvoller Familienpla- nung herauslesen - dies war über lange Zeit keine Selbstverständlichkeit im katholi- schen Eheverständnis. Auch wird die Ehe Kinderloser als „volle Lebensgemeinschaft“ anerkannt, die ihren Wert und ihre Unauflöslichkeit behält. Artikel 51 spricht von den Problemen, mit denen sich Paare bei ihrer Familienplanung konfrontiert sehen, von den Gefahren ehelicher Enthaltsamkeit und vom „Ausgleich zwischen ehelicher Liebe und verantworteter Weitergabe des Lebens“. Wie eine solche verantwortete Weitergabe des Lebens allerdings funktionieren soll - profaner gesprochen: die Frage nach der Emp- fängnisverhütung - wird ausgespart, lediglich die Abtreibung wird als „verabscheu- ungswürdiges Verbrechen“ gegeißelt. Auch ergibt sich ein Widerspruch aus der Tatsa- che, daßeinerseits die Entscheidung über Empfängnisverhütung in die persönliche Verantwortung der Gläubigen gelegt wird, indem anerkannt wird, daßunter bestimmten Umständen die Zahl der Kinder - mindestens zeitweise - „nicht vermehrt werden kann“, andererseits jedoch am Schlußdes Artikels de facto verboten wird, „in der Ge- burtenregelung Wege zu beschreiten, die das Lehramt in Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft“, und in einer Fußnote auf die sehr strengen Aussagen Pius XI., Pius XII. und Pauls VI. zu dieser Frage verwiesen wird.334
Artikel 52 befaßt sich mit dem Wesen der Familie und der Aufgabe der Menschen in ihr bzw. für sie: angesprochen werden die Politiker, die christlichen Laien, die Wissen- schaftler, die sich mit ihr beschäftigen, die Seelsorger und die institutionellen Einrich- tungen, wie z.B. Familienvereinigungen. Sie alle sollen Ehe und Familie fördern und die Ehepaare und jungen Familien mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln unterstüt- zen, die Eheleute selber aber sollen „durch ihre treue eheliche Liebe Zeugen jenes Liebesgeheimnisses werden, das der Herr durch seinen Tod und seine Auferstehung der Welt geoffenbart hat.“
Es ist sicher nicht übertrieben, die Aussagen des II. Vaticanums als die ‘kopernikani- sche Wende’ im Eheverständnis der katholischen Kirche zu bezeichnen. Endlich wird hier die Ehe als auf der gegenseitigen Liebe gründender Bund gleichberechtigter Partner (GS 52), die Fruchtbarkeit dagegen lediglich als „natürliche Folge“ dieser Liebe gese- hen und der Jahrhunderte alte katholische Sexualpessimismus überwunden. In den späteren kirchenamtlichen Verlautbarungen, die dieses neue, personal akzentuierte Eheverständnis rezipieren, werden jedoch die Schwierigkeiten sichtbar, die sich bei der Umsetzung des neuen Eheverständnisses ergeben. Ein entscheidendes Problem ist z.B. die Frage nach der Glaubensdimension bei der christlichen Eheschließung. Im BeschlußEhe und Familie der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland heißt es dazu: „die Kirche kann sinnvollerweise das Ja-Wort nur von sol- chen Partnern entgegennehmen, die in ihrer Mitte den ernsthaften Willen bekunden, sich dem Gebot des Herren in freiem Gehorsam zu verpflichten und sich von der Ge- meinschaft der Kirche in dieser Verpflichtung stärken und mahnen zu lassen“ (1.4.1), und weiter: „Solange das Brautpaar keinerlei Konsequenzen aus dem christlichen Cha- rakter der Ehe übernehmen will, fehlt der kirchlichen Trauung eine notwendige Grund- lage von Seiten der Ehepartner.“ Eine nur standesamtlich geschlossene Ehe von Katho- liken ist aus kirchlicher Sicht ungültig. Andererseits wird aber gemäßdem Grundsatz, daßes keinen Ehevertrag zwischen Getauften geben kann, ohne daßdieser zugleich auch Sakrament wäre (can. 1055 §2 CIC 1983), der nicht kirchlich geschlossenen Ehe ebenfalls eine Gültigkeit zugesprochen, die zumindest so weit geht, daßsolche Christen, die schon einmal nicht-kirchlich verheiratet waren, und nun einen anderen Partner kirchlich heiraten wollen, nicht ohne weiteres zum Ehesakrament zugelassen werden sollen. Der Widerspruch liegt auf der Hand: die Ehe eines Paares, das vielleicht ganz bewußt auf die Sakramentenspendung verzichtet hat, wird gewissermaßen „zwangs- sakramentalisiert“. Ein Sakrament ist aber, wie im ersten Teil der Arbeit dargelegt wurde, kein magischer Vollzug, es kann nicht ‘automatisch’ zustande kommen; eine Ehe kann nur dann Zeichen der Liebe Gottes sein, „wenn sie sich immer wieder von Gottes Geist zur Umkehr rufen läßt und Versöhnung lebt“335. Weder der Würzburger Synode noch dem Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio (FC) gelingt es, die- sen Widerspruch aufzulösen.
5.1.2.5 Die Enzyklika Familiaris Consortio
Wie schwierig es ist, die Versprechen des II. Vaticanums einzulösen, zeigt sich an der Enzyklika Familiaris Consortio Papst Johannes Pauls II. vom 22. November 1981, dem letzten großen Lehrschreiben zu Ehe und Familie. Ebenso wie die Konzilstexte geht der Papst in dieser Enzyklika von einem stark personalischen Eheverständnis aus. Nach die- ser Auffassung ist der Mensch aus Liebe geschaffen worden und somit von Gott zur Liebe berufen, die Liebe ist die „grundlegende und naturgemäße Berufung jedes Men- schen“ (FC 11), die sich sowohl auf den Geist bezieht, als auch den Leib umfaßt. Sexualität wird insofern als „leibliche Ganzhingabe“ positiv bewertet, sofern sie die „personale Ganzhingabe“ (FC 11) mit einschließt. Doch darf der Partner niemals zum Zwecke der Lustbefriedigung ‘benutzt’ werden, sondern jeder Akt mußbegründet sein durch eine bräutliche, sich dem anderen ganz schenkende Liebe, und dies bedeutet auch, daßjeder eheliche Akt für die Zeugung von Kindern offen sein muß(vgl. FC 11). Mit Ausnahme der ‘natürlichen Verhütung’ werden daher alle Methoden der Kontrazep- tion, in Anlehnung an die Aussagen Pauls VI. in Humanae vitae (Artikel 16), katego- risch abgelehnt, denn „durch sie liefern sie [die Eheleute, Anm.d.V.] den Plan Gottes ihrer Willkür aus; sie ‘manipulieren’ und erniedrigen die menschliche Sexualität - und damit sich und den Ehepartner -, weil sie ihr den Charakter der Ganzhingabe nehmen.“ (FC 32) Johannes Pauls II. Befürchtung, daßdurch die modernen Möglichkeiten der Kontrazeption ein utilitaristisches Benutzen des Körpers des anderen aus purer Sinnes- lust um sich greifen könnte, entbehrt gewißnicht jeglicher Grundlage, dennoch ist zu fragen, ob solche Aussagen vor dem Hintergrund der heutigen gesellschaftlichen Situa- tion in den Industrieländern nicht am Menschen vorbeigehen. Darüber hinaus erscheint auch die strikte Unterscheidung von ‘natürlicher’ und ‘künstlicher’ Verhütung diskussi- onsfähig, zum einen, weil eine ‘natürliche’ Geburten planung genau genommen einen Widerspruch in sich darstellt, zum anderen weil die Wahl der Verhütungsmethode nichts darüber aussagt, in welchem Geiste ein Geschlechtsakt vollzogen wird, d.h. auch ein Verkehr, bei dem der Fortpflanzungsaspekt mittels natürlicher Verhütung ausge- schlossen wird, kann lieblos und utilitaristisch sein, während umgekehrt allein die Tatsache, daßmechanisch, chemisch oder hormonal eine Befruchtung verhindert wird, noch nichts darüber aussagt, ob eine personale Ganzhingabe stattfindet oder nicht.336 Ein weiterer problematischer Punkt ist die Idealisierung von Liebe, Ehe und Sexualität. Ausgehend von Mt 10,39 und Hos 2f entwickelt Johannes Paul II. in Analogie zur Liebe Christi sein Verständnis einer rein altruistischen ‘bräutlichen’ Liebe der Ehegatten. „Diese Form der Liebe, diese Tiefe der Selbstübereignung allein verleiht [...] der sexu- ellen Hingabe zwischen Mann und Frau ihre ethische Legitimität.“337 Eine solche Auf- fassung von der menschlichen Liebe übersieht die psychologisch und humanwissen- schaftlich erwiesene Tatsache, daßSelbstlosigkeit im Menschen immer mit den eigenen Bedürfnissen konkurriert und daßes insofern rein altruistische Liebe nicht geben kann.338 Die Ehe sieht Johannes Paul II. als ein „Zeichen [...] für die unerschütterliche Treue, mit der Gott in Jesus Christus alle Menschen und jeden Menschen liebt“ (FC 20) und begründet von daher ihre Unauflöslichkeit. Gegen eine solche Sicht der Ehe ist an sich nichts einzuwenden. Problematisch aber ist, daßhier nicht zwischen Ideal - der unerschütterlichen Treue Gottes - und der Wirklichkeit - des Menschen - getrennt wird, daßdie Zielvorstellung zur Normvorstellung wird und außer acht bleibt, daßdie Zeichenhaftigkeit der Ehe „nicht ethisch, sondern ontologisch gemeint“339 ist. Damit besteht die Gefahr, daßdie konkrete Beziehung überfordert wird.
Von den bislang skizzierten fragwürdigen Punkten abgesehen, ließen sich noch einige andere nennen, etwa die „Überbetonung von Zeugung und Elternschaft auf Kosten des Wertes der ehelichen Lebensgemeinschaft“340 oder auch die Tatsache daßsich innerhalb des Dokumentes Spannungen finden, etwa wenn Johannes Paul II. in Artikel 5 der Enzyklika vom consensus fidei, dem Glaubenssinn aller Gläubigen spricht, der nicht irren kann, auf der andern Seite den Gehorsam gegenüber dem kirchlichen Lehramt in den Vordergrund stellt (FC 34). Auch der Artikel 68, der sich mit der Trauungsfeier für Getaufte ohne Glauben befaßt, erscheint auf den ersten Blick fragwürdig, da Johannes Paul II. hier empfiehlt, alle Menschen zur Trauung zuzulassen, „die nicht ausdrücklich und formell zurückweisen, was die Kirche bei der Eheschließung von Getauften meint.“ (FC 68). Diese Offenheit wird sich aber im Schlußkapitel noch als eine der Grundvoraussetzungen moderner Ehepastoral erweisen (vgl. Kap. 6.2).
5.2 Einige Anmerkungen zum Eherecht
Die Aussagen von Gaudium et Spes 341 und Familiaris Consortio wurden zur Grundlage für das neue kanonische Eherecht von 1983. Vor allem beim Vergleich mit dem CIC von 1917/18 wird augenfällig, daßauch in das Kirchenrecht ein neuer Geist eingezogen ist. Während der CIC von 1917 die Ehe ausschließlich als Vertrag beschreibt,342 dessen Inhalt das ius in corpus, also das beiderseitige recht auf den Körper des andern war, wird die Ehe im CIC von 1983 zwar immer noch als Vertrag bezeichnet, gleichzeitig aber ist auch die Rede von einem Lebensbund, der durch die Konsenserklärung beider Partner zustande kommt - hier wurde offenbar versucht, dem neuen, personalen Ver- ständnis der Ehe Rechnung zu tragen, auch wenn dies augenscheinlich nicht durchge- hend gelungen ist.343 Inhalt des Ehevertrages ist nicht mehr das ius in corpus, sondern das gegenseitigen Sich-Schenken und -Annehmen der Ehepartner, das die Ehe begrün- det (can. 1057 §2). Als oberster Zweck der Ehe wird nicht länger die Zeugung von Nachkommen, sondern das „Wohl der Ehegatten“ (can. 1055 §1) gesehen. Festgehalten wird hingegen an der Einheit und Unauflöslichkeit der christlichen Ehe (Eheband) und an der Identität von Vertrag und Sakrament zwischen Getauften. Auf die Problematik dieses Passus (can. 1055 § 2) des aktuellen Kirchenrechts wurde bereits hingewiesen, da sie aber für unsere Themenstellung von Belang ist, soll hier nochmals kurz davon die Rede sein: Die Schwierigkeit liegt darin, daßhier Getauftsein und Disposition zum gültigen Empfang des Sakramentes gleichgesetzt werden, allerdings „nicht in der Wei- se, daßauf der Taufe die sakramentale Ehe aufgebaut werden kann, sondern so, daßaus der Taufe die Ehe sakramentalen Charakter erhält.“344 Nur der ausdrückliche Ausschlußdes sakramentalen Charakters durch die Eheleute verhindert das Zustandekommen des Sakraments (can. 1099 CIC 1983) Dies ist vor allem vor dem Hintergrund bedenklich, daßin heutiger Zeit die meisten Menschen bereits in den ersten Lebensmonaten - in einem Alter also, da sie sich der Bedeutung des Sakramentes nicht bewußt werden können - getauft werden. Vielfach verlieren sie dann mehr oder weniger bald den Kon- takt zur Kirche, so daßsie zu sogenannten ‘Taufscheinchristen’ heranwachsen, die zwar formell Christen sind, denen aber jeglicher Zugang zu kirchlichen Vollzügen fehlt. Wenn nun aber jedes Sakrament ein Sakrament des Glaubens ist, das den Glauben sowohl anzeigt als auch stärkt, wenn sich in den Sakramenten das Wesen der Kirche vollzieht, wie kann es dann angehen, die Taufe allein für ausreichend zu halten, um das Sakrament der Ehe gültig zu empfangen? Voraussetzungen für die Gültigkeit der Ehe sind Ehefähigkeit345, Ehewille und korrekter Vollzug des Eheschließungsritus, d.h. die Einhaltung der Formpflicht. Ehe. Nun kann natürlich ein Rechtstext schlecht den per- sönlichen Glauben als Voraussetzung für den gültigen Empfang des Ehesakramentes anführen, da dieser nicht objektivierbar ist, es bleibt aber dennoch die Frage, ob ange- sichts der angedeuteten Probleme, der Passus über die ‘Eo-ipso-Sakramentalität’ des Ehevertrages vor dem Hintergrund des gewandelten Sakramentenverständnisses noch als zeitgemäßbezeichnet werden kann. Auch unter Kirchenrechtlern mehren sich die Stimmen, die die Auffassung vertreten, daßes wenige Argumente gibt, die für seine Beibehaltung sprechen.346 Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch auf ein weiteres Problem, nämlich, daßein Paar, soweit es getauft ist und, aus welchen Grün- den auch immer, nach dem Ehesakrament verlangt, gemäßcan. 213 und can. 1056 des aktuellen Kirchenrechts einen Anspruch auf dessen Spendung hat, der Priester darf also prinzipiell die Sakramentenspendung nicht verweigern. Es liegt auf der Hand, daßvor dem Hintergrund der allgemeinen Tradierungskrise und der zunehmenden Ausbreitung des ‘Taufscheinchristentums’ diese Regelung den Amtsträger in schwere Konflikte stürzen kann.347 Auf der anderen Seite aber ist er auch verpflichtet, den Eheleuten Hilfe zu bieten, „durch die der Ehestand im christlichen Geist bewahrt wird und in seiner Vollkommenheit vorankommt“ (can. 1063 CIC 1983), und zwar sowohl durch Predigt und Katechese, als auch durch „persönliche Vorbereitung auf die Eheschließung“ und durch eine „fruchtbringende liturgische Feier“ derselben. Die Verpflichtung des Amts- trägers zu Katechese und persönlicher Vorbereitung ist grundsätzlich positiv zu bewer- ten, doch stellt sie in der heutigen Zeit, da viele Menschen nahezu ohne jegliches Wis- sen um den Sinngehalt des Ehesakramentes dessen Spendung begehren, auch eine Über- forderung des einzelnen Amtsträgers dar, denn was hier gefordert wird, ist mit Sicher- heit nicht in ein oder zwei der Trauung vorausgehenden Gesprächen mit den Brautleu- ten zu leisten.
Doch wenden wir uns wieder den grundsätzlichen Aussagen des CIC über die Ehe zu: entsprechend der eben diskutierten Canons, behält sich die Kirche den Kompetenzan- spruch für alle Ehen vor, an denen mindestens ein Katholik beteiligt ist. Dieser ist auch weiterhin an die Formpflicht gebunden, wenn er eine kirchlich gültige und sakramentale Ehe schließen will, er kann sich aber aus schwerwiegenden Gründen von ihr dispensie- ren lassen (can. 1125; 1127 §2 CIC 1983). Für Paare, in denen beide Partner aus der katholischen Kirche ausgetreten sind, gilt allerdings jede öffentliche Eheschließung als kirchlich gültig und sakramental (can 1117; 1108; 1055) - die Kirche betrachtet also die standesamtliche Eheschließung bei kirchentreuen Katholiken als ungültigen Formalakt, bei Ausgetretenen hingegen als konstitutiv für das Zustandekommen einer sakramenta- len Ehe. Dies mutet geradezu grotesk an, wenn man sich vor Augen hält, daßes keinen ‘Automatismus’ des Sakramentenempfangs geben kann, versteht sich jedoch von daher, daßdas katholische Kirchenrecht ansonsten eo ipso alle nicht katholischen Eheschlie- ßungen als defizitär abqualifizieren würde.
Auf weitere Einzelheiten348 braucht hier nicht mehr eingegangen zu werden. Es bleibt festzuhalten, daßdie Gesetzgeber im CIC von 1983 versucht haben, Ehevertrag und Ehe als Liebes- und Lebensgemeinschaft zusammenzubringen und die Ehe nicht nur als Rechtsakt, sondern auch als Sakrament wahr- und ernstzunehmen. Es ist aber auch deut- lich geworden, daßes durchaus noch Ansatzpunkte berechtigter Kritik gibt. Die Zu- kunft wird zeigen, ob sich begonnene positive Entwicklungen im Eherecht fortsetzen.
5.3 Systematische Reflexion
Wie beschrieben, haben sich gerade im Verständnis des Ehesakramentes in der katholi- schen Theologie der letzten Jahrzehnte große Umwälzungen ereignet. Es erscheint mir daher notwendig, nochmals kurz zu referieren, was das Sakrament der Ehe nach heuti- gem Verständnis ausmacht. Aus Gründen der gebotenen Kürze wird es nicht möglich sein, die verschiedenen ehetheologischen Ansätze der letzten Jahrzehnte einzeln zu erörtern, es soll lediglich kurz dargestellt werden, was man derzeit als Konsens in der Ehetheologie bezeichnen kann.
5.3.1 Die eheliche Liebe
In Kapitel 4 wurde gezeigt, daßdie Sakramente realsymbolische Handlungen sind, in denen menschliche Grunderfahrungen auf Gott hin transparent werden. Desweiteren wurde deutlich, daßin den christlichen Sakramenten die Heilszusage Gottes dem ein- zelnen erfahrbar wird und daßdie Einzelsakramente unlösbar mit dem Grundsakrament, der Kirche, und durch sie mit Jesus Christus als dem Ursakrament in Berührung stehen. Was aber bezeichnet und bewirkt das Ehesakrament? Um diese Frage zu klären er- scheint es sinnvoll, zunächst einige Worte über den Zeichencharakter ehelicher Liebe zu verlieren.
In der Schöpfungserzählung heißt es: „Es ist nicht gut, daßder Mensch allein bleibt“ (Gen 2,18), und in der Tat ist jeder Mensch, um überleben zu können, auf die Zuwen- dung anderer Menschen angewiesen. Ohne ein Gegenüber kann er nicht zu sich selber finden, ohne Liebe kann er kein Vertrauen in sich oder die Welt entwickeln. „Er lebt da- von, daßandere ihm bezeugen: Es ist gut, daßes dich gibt“349, und zwar nicht nur um bestimmter Leistungen oder Eigenschaften, sondern um seiner selbst willen. Ein Mensch, der diese lebenswichtige Grunderfahrung des unbedingten Angenommenseins entbehren mußte, wird später große Probleme haben, selbst Liebe zu schenken oder anzunehmen, da ihm das Grundvertrauen in den anderen Menschen fehlt. Echte Liebe aber erfordert grenzenloses Vertrauen, denn sie nimmt den Menschen an, wie er ist, mit all seinen Fehlern und Schwächen, sie bleibt auch bestehen, wenn ihr Objekt sich ver- ändert, sie nimmt den geliebten Menschen als Person in seiner Ganzheit wahr und sagt sich ihm für immer zu. Genau das soll in der Ehe geschehen.
Die Ehe ist, wie bereits angesprochen, ein ‘natürliches’ Sakrament, insofern sie auch ohne den liturgischen Vollzug im kirchlichen Raum sakramentalen Charakter hat: sie ist das sichtbare Zeichen der Liebe zweier Menschen, die bedingungslos zueinander ja gesagt haben. Da aber der menschlichen Liebe immer „eine Forderung und eine transzendente Dimension“350 immanent sind, weist sie „in unreflektierter Analogie [...] auf die Liebe und Treue Gottes“351 hin, der sie überhaupt erst ermöglicht, indem er dem Menschen die Sehnsucht, nach der erfüllenden ewigen Liebe als einen seiner grundle- genden Wesenszüge mitgegeben hat, eine Sehnsucht, die letztlich selbst der Partner nicht stillen kann, die Sehnsucht nach ewigen und unverbrüchlichen Liebe Gottes (vgl. Kap. 2.3). Die Absolutheit personaler Liebe verweist auch den nichtgläubigen Men- schen auf Gott als dem Ende und dem Ursprung des „Loslassen(s) seiner selbst, das in der Liebe geschieht und nur darin sich ereignen kann.“352 Daher wird in der Liebe zwi- schen zwei Menschen immer auch die göttliche Liebe sichtbar, die sie ermöglicht und erhält. „Alle Sinnerfahrung in der Liebe unter Menschen kann als Erfahrung der sinn- stiftenden Begegnung mit Gott gedeutet werden.“353 Somit bewahrt die „eigentliche Struktur der Ehe [...] wenn sie echt gelebt wird, die dauernde Bezugnahme auf Gott und seine Einbeziehung in sich“354, auch ohne daßdie Partner sich diese Bezogenheit ins Bewußtsein rufen, wie es in der christlichen Ehe geschieht: hier anerkennen die Eheleu- te Gott als den tragenden Grund ihrer Liebe. Denn der Mensch als bedingtes Wesen kann ein unbedingtes Ja zu einem anderen Menschen verantwortet nur im Vertrauen auf die göttliche Gnade und unter Berufung auf Gottes unbedingtes Ja zu diesem Menschen sprechen.355
5.3.2 Ehe als Realsymbol der Liebe Gottes
Wie die anderen Sakramente, so ist auch die Ehe ein realisierendes Zeichen, und zwar ein Zeichen für immerwährende liebende Annahme des Menschen durch Gott. Es läßt sich eine mehrfach gestufte Symbolik ausmachen: der Ursprung des Sakramentes ist der Bund Gottes mit der Menschheit, sichtbar geworden in seiner bräutlichen Verbindung zum Volk Israel. Realisierendes Zeichen dieses Bundes ist die Liebe Christi zu seiner Kirche, für die er sich hingegeben hat. „Realsymbol [...] kann dieses Verhältnis Jesu zu seiner Kirche genannt werden, weil sich in ihm das Verhältnis Gottes zur Menschheit erstens zeigt [...] und zweitens gerade darin auch sich verdichtet, zu neuer Wirklichkeit wird.“356 Die liebende Annahme der Kirche durch Jesus wiederum findet ihren Aus- druck in der immer auf Gott hin offenen Erfahrung der Liebe von Menschen unterein- ander (vgl. 1 Joh 4,12), die in der Ehe, in der zwei Menschen sich bedingungslos auf Lebenszeit aneinander binden, in einer ihrer höchsten Formen auftritt. Wo zwei Chris- ten ihre Liebe ‘in guten und in bösen Tagen’ miteinander leben, wird zeichenhaft der Bund Christi mit der Kirche dargestellt und vergegenwärtigt. Insofern ist das „Sakra- ment der Ehe eine »Ausgliederung«, »Konzentration« und »Konkretion« des Ursakra- mentes Christus-Kirche“357, und von daher ist es möglich, von Ehe und Familie als einer Kirche im Kleinen, oder einer „Hauskirche“ (LG 11) zu sprechen. Allerdings macht nicht die Eheschließung das eigentliche Sakrament aus, sondern die Ehegatten „realisieren das eigentliche Zeichen des Sakramentes, ihre Lebensgemeinschaft täglich neu.“358 In der Eheschließung jedoch konkretisiert sich das Sakrament der gelebten Ehe, indem das Brautpaar vor Gott und der Gemeinde seinen Willen bekundet, einen ‘Bund fürs Leben’ zu schließen und diesen Bund auf Christus zu gründen, denn dies ist ge- meint mit dem paulinischen Ausspruch, die Ehe „im Herrn“ zu schließen (1 Kor 7,39). Im Ja-Wort als einer performativen Äußerung findet die gegenseitige Annahme der Eheleute statt, ihre gegenseitige Liebe, die vorher schon vorhanden war und später fortdauert, verdichtet sich in dieser zeichenhaften Handlung und schafft Verbindlichkeit.359 Der Eheschlußläßt sich dementsprechend als Auftrag verstehen, die Ehe als Sakrament, als realisierendes und antizipierendes Zeichen der Liebe Gottes, die sie trägt, zu leben. Realisierend in bezug auf die Liebe Christi, antizipierend insofern, als die Ehe, wie alle Sakramente, ein eschatologisches Hoffnungszeichen ist, das auf das „jetzt schon“ und „noch nicht“ des Reiches Gottes hinweist.360
5.3.3 Das Ehesakrament und seine kirchliche Dimension
Wie alle anderen Sakramente ist auch das Ehesakrament, „ein wesentlicher Selbstvoll- zug der Kirche, der in die konkrete entscheidende Situation eines Menschen hinein zur Wirkung kommt“361. Denn wo zwei (getaufte) Menschen vor der Gemeinde ihren Wil- len bezeugen, mit Gottes Hilfe durch ihren Glauben zum Sakrament, zur „Hauskirche“ zu werden, ist immer auch der Verweis auf die Kirche als Grundsakrament impliziert.362 Das Ehesakrament fordert die Brautleute als Menschen der Kirche an und beauftragt sie, Zeichen der Liebe Gottes zu sein - zunächst einmal für einander und die aus der Ehe hervorgehenden Kinder, aber auch für ihre Schwestern und Brüder im Glauben und für alle anderen Menschen. Sie erhalten damit Anteil an den kirchlichen Grundvollzü- gen (vgl. Kap. 1.2.6.). Denn das Ehesakrament fordert nicht, daßzwei Menschen sich nur noch auf sich selbst beziehen und nur noch umeinander kreisen, sondern ist immer auch „Bereitschaft, Einübung, Verheißung und Auftrag, ‘ den Menschen zu lieben ’“363. Die Ehe darf trotz ihres exklusiven Charakters nicht in Egoismus zu zweit umschlagen. Ehe entsteht aus der Gemeinschaft und ruft in die Gemeinschaft, sowohl der Gläubigen als auch der Menschen allgemein, hinein, sie ist quasi ein Übungsprogramm, dessen Ziel es ist, die Möglichkeit der Liebe zu erfahren, um offen zu werden für die Liebe zu allen anderen Menschen, die ebenfalls von der Liebe Gottes umfangen und gehalten sind.
Um der ekklesiologischen Dimension der Ehe Rechnung zu tragen, sollte eine Ehe immer vor der Gemeinde geschlossen werden. Die Gemeinde aber ist gleichzeitig auf- gerufen, ihre in Ehe und Familie lebenden Glieder zu unterstützen: „als Orte, in denen Familien Heimat haben und Kontakte finden, als Glaubensgemeinschaft, in denen Fami- lien Orientierung finden, als Netze, die in schweren Situationen tragen und halten.“364
5.3.4 Die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe
Das Gebot der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe wird in unserer Gesellschaft viel- fach als anachronistisch empfunden, da sich durch die Emotionalisierung der zwischen- geschlechtlichen Beziehungen (vgl. Kap. 2.2.3) die Ansicht durchgesetzt hat, daßjegli- che Institutionalisierung der Liebe eher ab- als zuträglich sei. Zwar existiert weiterhin das Ideal lebenslanger Liebe und Treue (wirkliche Liebe ist immer auf Dauer aus), und die weitaus meisten Partnerschaften werden monogam gelebt, doch hat sich inzwischen eine Art ‘sukzessiver Monogamie’ eingebürgert, d.h. daßviele Menschen nacheinander in jeweils monogamen Beziehungen mit verschiedenen Partnern leben.365 Eine solche Praxis wiederspricht dem christlichen Eheverständnis, das absolute Treue fordert, da ohne den Willen zu unbedingter Treue auch keine unbedingte Annahme des Partners stattfinden kann. Nach katholischem Verständnis macht aber erst die unbedingte Bin- dung der Eheleute aneinander diese wirklich frei, denn wenn „das Vertrauen uneinge- schränkt und vorbehaltlos geschenkt wird, entbindet es ungeahnte Kräfte der Zuneigung und der Treue, die Belastungen gewachsen sind und Konflikte meistern“366, sie befreit die Partner, indem sie die Verbindung der Launenhaftigkeit und Beliebigkeit der reinen Gefühlsebene entzieht. Anders gesagt: durch die Treue wird der „innerste Wille der Liebe dem Wechsel der Gefühle und der Willkür entzogen“367 und so der Liebe Dauer verliehen.
Es dürfte deutlich geworden sein, warum die sakramental geschlossene Ehe in der Sicht der katholischen Kirche absolut unauflöslich ist: zum einen, weil bereits im Alten Tes- tament die unauflösliche Verbundenheit von Mann und Frau als gottgewollter Zustand dargestellt wird (Gen 2,24) und dementsprechend auch Jesus selbst die Ehescheidung kategorisch abgelehnt hat, zum anderen, weil die Ehe, wäre sie beliebig lösbar, kein wirksames Zeichen der unaufhebbaren Einheit von Christus und Kirche mehr darstellen könnte. Nun finden sich allerdings selbst im Neuen Testament Hinweise darauf, daßhier durchaus Konzessionen gemacht wurden, etwa in 1 Kor 7,10; 7,15 oder Mt 5,32; 19,9. Sowohl der Apostel als auch der Evangelist ließen unter bestimmten Bedingungen die Auflösung von Ehen zu. Auch die Kirchengeschichte ist reich an Beispielen, da vom Unauflöslichkeitsgebot abgerückt wurde, wenn auch nur als Notlösung in schwierigen Fällen.368 Nach heutigem Kirchenrecht sind sakramental geschlossene Ehen absolut unauflöslich; sie können allenfalls unter bestimmten Voraussetzungen369 für nichtig erklärt werden. In unserer Zeit, da fast jede zweite Ehe geschieden wird, ist vielfach der Ruf laut geworden, die Kirche möge von ihrer rigorosen Haltung, die als „ungeschicht- licher Legalismus“370 aufgefaßt wird, abrücken und Wiederverheirateten, wenn schon nicht die Möglichkeit einer zweiten sakramentalen Trauung, so doch wenigstens die zum Empfang der Eucharistie eröffnen. Dies ist bislang nicht geschehen, wohl auch aus Furcht vor einem „Dammbrucheffekt“371 bei leichter Lockerung der Regel, d.h. der Befürchtung, daßbereits bei geringen Zugeständnissen der (falsche) Eindruck entstehen könnte, die Kirche heiße die Ehescheidung und Wiederverheiratung ihrer Glieder gut, so daßdie Gefahr bestünde, daßsakramentale Ehen ohne den erforderlichen religiösen Ernst geschlossen werden. In der neueren sakramententheologischen Diskussion sind aber auch Stimmen laut geworden, die fordern, den Einzelfall abzuwägen, das radikale Wort Jesu nicht „zum Alibi dafür zu machen, sich den konkreten Nöten der gescheiter- ten Ehen zu verschließen“372 und auch an Menschen, die in ihrer Ehe gescheitert sind, Versöhnung und Barmherzigkeit zu üben, wie es dem Grundauftrag der Kirche ent- spricht.373 In der Tat stellt sich die Frage, ob es wirklich zwingend ist, auch bei schwe- rer Zerrüttung einer Ehe von einem unauflösbaren Eheband auszugehen, bzw. ob es dem Auftrag Jesu zu Versöhnung und Barmherzigkeit entspricht, Menschen, die in ihrer Ehe gescheitert sind, zu verurteilen (Mt 7,1). Immerhin finden sich in den lehramtlichen Aussagen zur Pastoral der letzten Jahre häufig Aufforderungen, bei wiederverheirateten Geschiedenen den Einzelfall zu prüfen und ihnen „in fürsorgender Liebe beizustehen, damit sie sich nicht als von der Kirche getrennt betrachten, da sie als Getaufte an ihrem Leben teilnehmen können, ja, dazu verpflichtet sind.“374 Dennoch sind sie kirchenrecht- lich nicht zur Eucharistie zugelassen, ein Umstand, durch den sich gewißnicht wenige Christen ausgeschlossen oder als ‘Gemeindeglieder Zweiter Klasse’ behandelt fühlen.
In den vorhergehenden Abschnitten wurde versucht, darzustellen, was das Sakrament der Ehe ausmacht, welche Voraussetzungen für seinen fruchtbaren (nicht nur den kirchenrechtlich „gültigen“) Empfang gegeben sein müssen und welche Forderungen es an die Eheleute stellt. Leider kann hier nicht in ausgedehnterem Maße auf Einzelfragen eingegangen werden, weder war es Ziel, die Sakramentalität der Ehe zu diskutieren noch, die kirchliche und kirchenrechtliche Eheauffassung einer umfassenden Kritik zu unterziehen. Hier konnten nur wenige Punkte kurz problematisierend aufgegriffen werden. Dies versteht sich jedoch von daher, daßes in dieser Arbeit letztendlich um die konkrete Situation des Ehesakramentes in unserer Gesellschaft und die daraus erwach- senden Anforderungen an die Pastoral gehen soll. Eine grundsätzliche Infragestellung der kirchlichen Eheauffassung hat von daher wenig Sinn, obwohl verschiedene Punkte durchaus einer kritischen Betrachtung wert wären. Im folgenden Kapitel soll es darum gehen, wie dem faktischen Auseinaderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit christlicher Ehe von kirchlicher Seite her begegnet werden könnte.
6 EHEKATECHESE
6.1 Strukturen einer ‘postmodernen’ Katechese
In der religionssoziologischen Untersuchung der gegenwärtigen Situation (vgl. Kap. 3) ist deutlich geworden, daßviele Menschen, die mit der Bitte um ein Sakrament an die Kirche herantreten, aufgrund fehlender religiöser Sozialisation nicht wissen, was es mit dem diesem überhaupt auf sich hat. Es ist von daher nicht verwunderlich, daßim Zu- sammenhang mit der ‘Krise der Sakramentenpastoral’ immer wieder der Ruf nach einem Katechumenat vor der Sakramentenspendung laut geworden ist. Und in der Tat scheint sich hier eine Chance aufzutun, Menschen, die vielleicht nur diffus gläubig sind oder die Kirche aus unreflektierten Vorurteilen heraus ablehnen, den christlichen Glau- ben nahezubringen. Wie aber mußEhekatechese aussehen, damit sie den ‘postmodernen Menschen’ überhaupt noch erreicht? Was sind ihre Inhalte und Ziele? Wer ist ihr Trä- ger? Da der durch die Tradierungskrise verursachte grundlegende Mangel an Glau- benswissen und Kenntnissen christlicher Lebensformen sich nicht auf das Sakrament der Ehe beschränkt - obwohl er sich hier besonders deutlich zeigt -, ist es wichtig, daßzunächst nach einem zeitgemäßen Grundverständnis von Katechese überhaupt gefragt wird.
6.1.1 Probleme der Katechese heute
Katechese als solche geht zurück auf den Sendungsauftrag Jesu, alle Menschen zu Jüngern zu machen (Mt 28,19f), und gehört daher seit Bestehen der Kirche zu deren „unverzichtbaren Grundvollzügen“375. Ihre Geschichte beginnt mit der Wandermission der Apostel und setzt sich fort über die selbstverständliche Übernahme des Glaubens durch Nachahmen und Mitleben in den Urgemeinden und das organisierte Taufkate- chumenat der frühen Kirche bis zu einer verschulten Form von Katechese, wie sie bis in unser Jahrhundert prägend geblieben ist.376 Obwohl in diesem Rahmen auf Einzelaspek- te der Geschichte der Katechese nicht eingegangen werden kann, lassen sich zwei Din- ge festhalten: im Verlauf der Entwicklung der Katechese hat eine Verschiebung sowohl auf inhaltlicher Ebene - von der auf das konkrete Gemeindeleben bezogenen Einwei- sung in den Glauben zur hauptsächlich kognitiv geprägten Unterweisung in Glaubens- wahrheiten - und auf der Ebene des Adressatenkreises - vom Erwachsenen- katechumenat zur Kinder- und Jugendkatechese - stattgefunden. Es ist allerdings zu betonen, daßdie Kinder- und Jugendkatechese eine noch relativ junge Erscheinung ist, während in der Geschichte des Christentums insgesamt die Erwachsenenkatechese weit größeres Gewicht hatte. Dennoch ist die Alltagswirklichkeit von erwachsenen Männern und Frauen in ihrer je eigenen biographischen Ausprägung in der Katechese lange Zeit weithin unberücksichtigt geblieben,377 wohl nicht zuletzt, weil man davon ausging, daßdie in der Kindheit erfolgten katechetischen Unterweisungen zusammen mit der Prä- gung durch Familie und soziales Umfeld eine Erwachsenenkatechese überflüssig mach- ten.378 Erwachsene wurden insofern im Hinblick auf Katechese allenfalls noch als Kate- cheten wahrgenommen, nicht aber als der Katechese Bedürfende. Heute kann man nicht mehr davon ausgehen, daßdie religiöse Sozialisation in der Kindheit, wenn eine solche denn stattgefunden hat, den Glauben eines Erwachsenen dessen Leben lang tragen kann. Der ‘moderne Mensch’ ist nicht mehr so fest in sein religiöses Umfeld eingefügt und zu vielen anderen Sozialisationseinflüssen ausgesetzt, als daßer seine Glaubensüberzeu- gungen nicht irgendwann hinterfragen würde. Und wo der Kinderglaube sich mit zu- nehmendem Reflexionspotential eines heranwachsenden Menschen auflöst, glauben viele Menschen sich dem Christentum entwachsen und geben den Kontakt zur Glau- bensgemeinschaft auf (vgl. CT 19).
6.1.2 Kirchliche Neubesinnung in der Katechese
Vor diesem Hintergrund und in Anbetracht der Tatsache, daßheute vielen Erwachsenen die religiöse Sozialisation gänzlich fehlt - eine Folge der zunehmend geringen Wert- schätzung die Eltern der religiösen Erziehung ihrer Kinder beimessen379 - ist in den letzten Jahren die Erwachsenenkatechese wieder in den Blick gerückt. Papst Johannes Paul II. bezeichnete sie als „hauptsächliche Form der Katechese“, da sie sich an die Personen richte, die „die größte Verantwortung und Fähigkeit besitzen, die christliche Botschaft in ihrer voll entwickelten Form zu leben“ (CT 43). Eine neue Sicht der Kate- chese hatte sich bereits in den Konzilsdokumenten Sacrosanctum Concilium, Ad Gen- tes, Lumen Gentium und Christus Dominus angedeutet und erfuhr 1975 in dem Aposto- lischen Schreiben Evangelii Nuntiandi ihre Konkretion. Kennzeichnend für das neue Verständnis von Katechese ist, daßnun der erwachsene Christ als verantwortliches Mitglied der Kirche im Vordergrund steht. Es hat sich ein „Bedeutungswandel der Katechese vom Anfangsunterricht für Unmündige hin zu einer umfassenden, lebenslan- gen Begleitung des Menschen mit dem christlichen Glauben unter Ernstnahme seines Menschseins “380 vollzogen. Das bedeutet, daßkatechetische Unternehmungen nicht mehr primär auf die Vermittlung von Glaubenswissen abzielen, sondern daßversucht werden soll, von den Erfahrungen des Katchumenen auszugehen und sie selbst als Ort der Glaubens- und Gotteserfahrung zu erschließen. Dieser anthropologisch-erfahrungs- zentrierte Ansatz, der schwerpunktmäßig von Adolf Exeler geprägt wurde, war grund- legend für das Arbeitspapier Das katechetische Wirken der Kirche (KW) der Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, das als wegweisend für eine Neuori- entierung der Katechse bezeichnet werden kann. Diesem zufolge besteht „das oberste Ziel des katechetischen Wirkens [...] darin, dem Menschen zu helfen, daßsein Leben gelingt, indem er auf den Zuspruch und Anspruch Gottes eingeht“ (KW A 3). Entspre- chend gehört zur Katechese „alles, was im Laufe eines christlichen Lebens für die Förderung eines reflektierten Glaubensbewußtseins und einer diesem Glauben entspre- chenden Lebensgestaltung nötig ist.“ (KW A 3.6). Katechese wird verstanden als ein „lebenslanger Prozeß“ (KW A 1), in dem sich eine „immer wieder neue Auseinander- setzung mit den Fragen des Glaubens“ vollziehen kann. Sie hat sich von daher (ohne daßdie Notwendigkeit von Kinder- und Jugendkatechese bestritten würde) hauptsäch- lich an Erwachsene zu richten, und zwar nicht nur an diejenigen, die sich ohnehin schon zur Kirche rechnen, sondern auch an Distanzierte und Au ßenstehende jeglicher Cou- leur, seien es „bekümmerte Ungläubige, überzeugte Atheisten, Gleichgültige oder Ausgetretene“ (KW B 5.1), wobei der Tatsache einer gestuften oder fluktuierenden Kirchenzugehörigkeit akzeptiert und mitbedacht werden muß(KW B 2.3.2). Das Ziel der katechetischen Bemühungen darf deshalb nicht in erster Linie darin bestehen, die Fernstehenden „in die Kirche hineinzuholen“ (ebd.), sondern dem Glauben ist Vorrang einzuräumen. Entscheidend aber ist, daßes in der Katechese nicht primär darum gehen soll, Lehrsätze zu vermitteln, sondern daßsie den Katchumenen dazu verhelfen soll, auch in Situationen des Leidens und des Scheiterns sich und die Welt von der un- endlichen Liebe, die Gott selbst ist, getragen zu wissen (vgl. KW A 3.1); sie soll Trans- zendenzerfahrungen ermöglichen, die „notfalls auch unabhängig von der Gemeinde der Gläubigen wirksam bleiben können“ (KW A 3.1). Dabei mußdie Katechese immer von den Erfahrungen der einzelnen Menschen ausgehen, damit ein Bezug von Glaube und Leben hergestellt werden kann und der Katechumene die Möglichkeit erhält, die „ei- gene Lebensgeschichte immer tiefer als Glaubensgeschichte, d.h. als Leben in Bezie- hung zu Gott, verstehen zu lernen und so in ihren ‘Lebenstexten’ die Nähe Gottes wahrzunehmen.“381
6.1.3 Praktische Konsequenzen
Um dieses Ziel zu erreichen, scheint ein katechetischer Frontalunterricht durch einen theologisch gebildeten Amtsträger (Priester, Pastoral- und Gemeindereferenten) kein gangbarer Weg zu sein. Es mußvielmehr versucht werden, die Gemeinde als Trägerin der Katechese zu aktivieren. Christliches Glauben-Lernen bedeutet schließlich immer auch, daßder Katechumene lernt, seinen Glauben in der Gemeinschaft zu leben und zu feiern und aktiv an der Gemeinschaft teilzunehmen (vgl. KW A 3.5). Dies kann nur ge- lingen, wenn die Gemeinde sich selbst als Trägerin von Katechese wahrnimmt und den Neuhinzukommenden Räume „der Entdeckung, Erprobung und Bewahrheitung des Evangeliums“382 bietet, in denen sie sich den Glauben ihren persönlichen Vorausset- zungen entsprechend aneignen können. Von daher sollen sich auch die Katecheten nicht als die ‘Wissenden’, die ‘Fertigen’ verstehen, die den ‘Unwissenden’ etwas beibringen müssen, sondern Katechese mußverstanden werden als gemeinsamer Lernprozeß, in dem es primär um den Austausch von Erfahrungen des Glaubens geht. Katecheten und Katechumenen begeben sich auf einen gemeinsamen Weg des Glauben-Lernens, auf dem beide von einander Anregungen erhalten. Auf diese Weise kann das Glauben- Lernen der „Glaubensschüler zum Erneuerungsimpuls für die Gemeinde werden, so wie umgekehrt der gelebte und gefeierte Glaube der Gemeinde zur korrigierenden und komplementierenden, glaubenspraktischen Instanz für die Entdeckung der Glaubens- schüler wird.“383
Alle katechetischen Unternehmungen müssen überdies der Tatsache Rechnung tragen, daßsich das Glaubensverständnis der Menschen heute grundlegend gewandelt hat. Eugen BISER hat diese Wandlungsprozesse in drei Punkten konkretisiert: er konstatiert einen Übergang vom Wissens- zum Erfahrungsglauben, vom Satz- zum Vertrauens- glauben und vom Gehorsams- zum Verstehensglauben.384 Für die Katechese bedeutet dies, daßerstens motivierende Glaubenserfahrung den Vorrang vor der Wissensvermitt- lung erhält, daßzweitens von magistralen Wegen abgewichen werden muß, zugunsten mystagogischer Pfade die an „Gott nicht als Zielpunkt einer christlichen Religion oder als Mitte einer theologischen Theorie“385 heranführen, sondern ihn als die „Gnade unseres Daseins“386 erfahrbar machen, drittens, daßsie ein langsames, forschendes Überprüfen des neuen Lebenskonzeptes aus dem Glauben zulassen und fördern sollte. Der neue Lebensstil ‘Glaube’ mußsich im Alltag erproben lassen und bewähren.387
6.2 Das Ehesakrament zwischen Ausverkauf und Rigorismus
In den Kapiteln 5.1.2.5 und 5.2 ist bereits angesprochen worden, daßdie Sakramen- tenspendung an ‘Fernstehende’ aus lehramtlicher und kirchenrechtlicher Sicht kein Problem darstellt (vgl. FC 68). Insofern zudem das Ehesakrament nicht vom Priester, sondern durch die Brautleute selbst gestiftet wird, ist hier auch die Verantwortung des Amtsträgers eine andere als bei den Sakramenten, wo er selbst der Spender ist. Es mußletztlich den Eheleuten überlassen werden, inwiefern und in welcher Weise sie den Anspruch, einander und der Welt in ihrer Ehe ein Zeichen der Liebe Gottes zu sein, nachkommen wollen. Wo die Ehe von Christen als Sakrament gelebt wird, „wächst dieses Sakrament im Laufe der Jahre.“388 Es ist von daher legitim, auch solchen Men- schen das Sakrament der Ehe zu ‘spenden’, die die Zeichenhaftigkeit ihrer Ehe grund- sätzlich anerkennen und leben wollen, auch wenn sie aus irgendwelchen Gründen (noch?) nicht am gemeindlichen Leben teilnehmen wollen oder können und auch (noch) nicht in weiterem Umfange über die theologischen Aspekte der Ehe unterrichtet sind, sofern sicher gestellt ist, daßkirchlicherseits geeignete Strukturen vorliegen, die sowohl der Berührung mit der Gemeinde als auch der weiteren katechetischen Begleitung för- derlich sind (s.u.). Denn man darf auch nicht die Augen davor verschließen, daßheute viele christliche Ehen „scheitern, weil sie kaum oder gar nicht aus der Kraft des Glau- bens gewollt und gelebt werden“389. Zwar ist die Zahl der Eheschließungen in der ka- tholischen Kirche in den letzten vierzig Jahren rapide zurückgegangen - heirateten 1960 noch 75,1% der Paare, an denen mindestens ein Katholik beteiligt war, kirchlich, so waren es 1997 nur noch 36,8%390 - aber nichtsdestotrotz betrug die Zahl der katholi- schen Trauungen im Jahre 1998 immer noch 69.032,391 und es darf wohl unterstellt werden, daßsich bei einem nicht unerheblichen Teil dieser Paare um ‘Kirchenferne’ gehandelt haben dürfte, bei denen nicht ohne weiteres vorauszusetzen ist, daßsie ihre Ehe im Glauben leben wollten.
6.2.1 Mögliche Motive für den Wunsch nach dem Ehesakrament
Warum aber wünschen sich Menschen, deren Glauben mehr oder weniger verschüttet ist und deren Verbindung zur Kirche und zum gemeindlichen Leben seit langem abge- rissen ist, überhaupt eine kirchliche Trauung? Es sind hier in der Hauptsache drei mög- liche Motivationen auszumachen, die z.T. auch ineinander verschränkt zu denken sind. Viele der Menschen, die, obwohl kirchenfern, das Ehesakrament empfangen möchten, hoffen insgeheim oder offen auf Schutz und Segen Gottes für ihren beginnenden ge- meinsamen Lebensweg. Das ist natürlich legitim, doch sind Schutz und Segen nicht der alleinige Sinn des Ehesakramentes. Sakramente sind nicht „neutrale Riten, in denen alles wofür der Mensch Schutz und Hilfe sucht, gesegnet wird“ oder „beliebig interpre- tierbare religiöse Handlungen“392. Ein diffuser „Hingabeglauben“393, so intensiv er auch sein mag, kann kein Sakrament begründen, denn dieses fordert immer auch die Zustim- mung zur Glaubensgemeinschaft (vgl. S. 53). Auf der anderen Seite zeigt aber allein die Tatsache, daßdiese Menschen im Angesicht einer Lebensentscheidung nach dem Segen Gottes verlangen, daßsie sich letztlich ihrer Angewiesenheit auf Gott für das Gelingen ihrer Ehe und ihres Lebens zumindest in verschwommener Weise bewußt sind. Hier könnten ehekatechetische Bemühungen ansetzen. Andere Paare wollen aus dem Grunde kirchlich heiraten, weil es in ihren Familien nun einmal ‘Tradition’ ist. Zwar steht außer Frage, daß„ein solch diffuses und kaum bewußt reflektiertes Motiv noch kein hinrei- chender Grund, keine tragende Grundlage für eine christliche Ehe sein“394 kann, den- noch ist auch diese Begründung nicht per se zu verwerfen, zeigt sie doch, daßzumin- dest noch eine rudimentäre Verbindung zum ‘Glauben der Väter’ besteht. Der dritten Gruppe schließlich kommt es bei der kirchlichen Trauung in der Hauptsache auf eine ‘schöne Feier’ an, für die das Kirchengebäude einen stimmungsvollen Rahmen zu bie- ten und an der der Priester quasi als Statist mitzuwirken hat. Die Kirche wird als Dienst- leistungsunternehmen gesehen, das den gewünschten Ritus auf Bestellung liefert. Aber selbst hier können sich Anknüpfungspunkte ergeben, zeugt doch das Motiv der ‘Feier- lichkeit’ zumindest von „einer Ahnung der Bedeutsamkeit von Festen und Feiern für die Sinngestaltung menschlichen Lebens.“395
6.2.2 Die Frage nach einem obligatorischen Ehekatechumenat
Soll das Ehesakrament nicht auf lange Sicht zu einem leeren Ritus verkommen, so mußes, so weit besteht in der sakramentenkatechetischen Diskussion, Konsens, erstes An- liegen der Kirche sein, den Fernstehenden durch katechetische Unternehmungen den Sinn des Sakramentes (wieder?) nahezubringen. Daher wurde verschiedentlich vorge- schlagen, ein obligatorisches, der Trauung vorausgehendes Ehekatechumenat (nach dem Vorbild von Erstkommunion und Firmung) einzuführen, wie es schon in Familiaris Consortio und im Schreiben des Päpstlichen Rates für die Familie über Die Vorberei- tung auf das Sakrament der Ehe (VS) angemahnt wurde. Auf der einen Seite wäre eine solche Praxis im Hinblick auf das Unbehagen, das durch das Gefühl des ‘Ausverkaufs’ der Sakramente entsteht, zweckmäßig, auf der anderen Seite könnte bei den Fernste- henden, die es aus volkskirchlicher Zeit gewohnt sind, die Sakramentenspendung als ihr genuines Recht anzusehen (was es für sie als getaufte Katholiken, rein kirchenrechtlich betrachtet, ja auch ist! Vgl. S. 74) der Eindruck einer Kirche entstehen, die immer erst fordert, bevor sie gibt. Und dies kann kaum im Sinne der Kirche sein, die ja gerade zeigen will, daßsie ein offener Raum der Glaubenserfahrung und Lebenshilfe sein will. Ich halte daher einen obligatorischen Katechumenat für Brautpaare, selbst wenn man von den organisatorischen Schwierigkeiten absieht, die sich hierdurch ergeben würden, für wenig sinnvoll, zumal ein Katechumenat, das nur aus Zwang absolviert wird, auch geringe ‘Erfolgsaussichten’ verheißt. Die Menschen, die mit der Bitte um das Ehesak- rament an die Kirche herantreten, sollen sich zur Katechese eingeladen und nicht genö- tigt fühlen. Sie sollen das Katechumenat - besser spräche man in diesem Zusammen- hang in Anbetracht der Tatsache, daßder Begriff des Katechumenats aufgrund seiner Geschichte eher negativ konnotiert ist, vielleicht von einem ‘Ehevorbereitungskurs’ - als ein Angebot sehen, daßihnen Hilfe für das Gelingen ihrer Ehe anbieten will. Auf diese Weise würde es möglich, daßdie Brautleute die Katechese nicht als ‘Schikane’ betrachten, sondern als das, was sie sein will: Lebens- bzw. Ehehilfe durch Glaubenshil- fe. Lehnen die Brautleute die Teilnahme an der Katechese dennoch ab, so gäbe es noch die Möglichkeit, im Gespräch mit ihnen zu erörtern, ob es eventuell sinnvoller sein könnte, keine Sakramentenspendung vorzunehmen und statt dessen eine gottesdienstli- che Segensfeier abzuhalten, um auch den Bedürfnissen der Brautleute Rechnung zu tragen, die zwar ihre Taufberufung nicht ergreifen konnten, „sich als Paare aber doch mit letztem Ernst in ihrer Liebe beschenken und beanspruchen lassen wollen.“396 Dieser Weg wurde im Jahre 1977 in einigen Bistümern Frankreichs erprobt, indem eine stu- fenweise Begleitung zum Ehesakrament praktiziert wurde, an deren Beginn eine Ge- betsfeier ohne sakramentale Eheschließung stand, woran sich ein Katechumenat anschloß, das jeweils von einem Priester und einem gläubigen Ehepaar geleitet wurde, das schließlich zur sakramentalen Eheschließung führen sollte. Es zeigte sich jedoch, daß„nur wenige Brautleute, die die erste Stufe auf dem Weg zum Ehesakrament gefei- ert haben, [...] den Weg bis zur Feier des Ehesakramentes“397 zu Ende gingen, und die meisten es bei der Segensfeier beließen. Nun ist eine Ehe, die nicht sakramental ge- schlossen wurde, zwar kichenrechtlich ungültig, doch ist sie deswegen menschlich und christlich nicht einfachhin nichts.398 Sogar eine rein bürgerlich geschlossene Ehe kann rückwirkend als kanonisch anerkannt werden, „indem man sie in der ‘Wurzel’, d.h. aufgrund des vorhandenen Ehewillens ‘heilt’“399. Jede Eheschließung, auch eine stan- desamtliche, ist zumindest eine anfanghafte Realisation des Bundes von Christus und Kirche. Und hält man sich zudem vor Augen, daßbei ausgetretenen Katholiken die standesamtliche Trauung ebenfalls als sakramental gültig anerkannt wird, weil diese nicht mehr an die Formpflicht gebunden sind, so kann dies davor bewahren, eine „Er- fassungspastoral“400 betreiben zu wollen, die es sich zum Ziel setzt, möglichst vielen Katholiken das Ehesakrament spenden zu wollen. Die Kirche, und dies mußauch den Kirchenfernen klar sein, schließt, indem sie keine Sakramentenspendung vornimmt, nie- manden von der Gnade Gottes aus, über die sie nicht verfügt. Dennoch halte ich das Vorgehen, zunächst ‘nur’ eine Segensfeier abzuhalten und an diese ein (im Prinzip obligatorisches) Katechumenat anzuschließen, an deren Ende gleichsam als Lohn der Mühen die Spendung des Sakramentes steht, für wenig aussichtsreich. Denn mit einer solchen Praxis schwingt sich die Kirche zur Richterin über den persönlichen Glauben der sogenannten Kirchenfernen auf und fördert das Entstehen einer Zwei-Klassen- Gesellschaft von ‘richtig’ Verheirateten und ‘nur’ Gesegneten.
6.2.3 Kirchenferne als Glieder der Kirche
Vergegenwärtigt man sich, was die theologische Qualität eines Sakramentes ausmacht, verbietet es sich m.E. von selbst, Anwärter auf das Ehesakrament in solche einzuteilen, die das Sakrament ‘verdienen’ und solche, die es ‘nicht verdienen’. Auch die sogenann- ten Kirchenfernen sind Mitglieder der Kirche, wie auch immer ihre innere Bindung an sie aussehen mag. Ihren Anliegen mußdaher Rechnung getragen werden. Diese Men- schen haben noch eine Verbindung zur Kirche, sie nehmen sie, wenn auch nur an den Knotenpunkten ihres Lebens, noch als Kirche wahr, sie wollen noch etwas mit ihr zu tun haben - so man ihnen nicht unterstellen will, sie wären nur ‘aus Versehen’ noch nicht aus der Kirche ausgetreten. Priester und Gemeinde sollten sie von daher als Glie- der der Kirche und der Gemeinde wahr- und ernstnehmen. Die rigorose Gangart eines Pflichtkatechumenats scheint mir hier wohl eher nicht der geeignete Weg zu sein, zumal wenn ein solches als ‘Eignungstest’ wahrgenommen werden könnte. Hier werden die Aspiranten von vorneherein nicht auf ihre Kirchenzugehörigkeit, sondern auf ihre Kir- chendistanz hin angesprochen. Eine solche Vorgehensweise ist nicht nur taktisch un- klug, sondern steht mit ihrer Tendenz, den Anwärtern mangelndes Christsein zu un- terstellen, im Widerspruch sowohl zu dem faktischen (Noch-)Christsein dieser Men- schen, als auch zu einem ‘partnerschaftlichen’ Verständnis von Katechese, die in gleichberechtigter Begleitung Glaubenserfahrung vermitteln will. Stattdessen mußdie Kirche sich selber fragen, wie sie ihrem diakonalen Auftrag auch bei ‘Fernstehenden’ gerecht werden kann. Will sie aber den Anwärtern tatsächlich Hilfe zum Gelingen ihrer Ehe anbieten, so kann dies nur geschehen, wo sie die Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen wahrnimmt und entsprechende Angebote macht. D.h. sie darf sich nicht in einem der Sakramentenspendung vorausgehenden ‘Ehevorbereitungskursus’ - so sinnvoll dieser grundsätzlich sein kann - erschöpfen, sondern mußden Eheleuten durch ihr ganzes Eheleben, das ja das eigentliche Sakrament ist, hindurch, immer wie- der Hilfen anbieten.401 Diese katechetischen Angebote sollten m.E. grundsätzlich von der Frage nach der Zulassung zum Sakrament abgekoppelt werden, damit gar nicht erst der Eindruck eines ‘Brautexamens’ im Sinne einer ‘Eignungsprüfung’ entsteht. Außer- dem würden so die eherelevanten katechetischen Angebote aus dem zu engen Kontext der Trauung herausgenommen.
Kirchenfernen Menschen das Sakrament der Ehe zu spenden, bedeutet nicht, es ‘auszu- verkaufen’, sondern, die Wünsche von Menschen ernstzunehmen, die vielleicht ohne ei- gene ‘Schuld’ keine echte Bindung an die Gemeinde vor Ort aufbauen konnten. Die Al- ternative ‘Ausverkauf oder Rigorismus’ ist m.E. eine Scheinalternative. Schon in Das katechetische Wirken der Kirche wurde nachdrücklich auf die Notwendigkeit, auch die Fernstehenden anzusprechen, hingewiesen. Im folgenden soll zunächst das Ehekateche- semodell des Päpstlichen Rates für die Familie kritisch daraufhin betrachtet werden, inwiefern es unter den heutigen Voraussetzungen in den Industrieländern realisierbar ist. Anschließend möchte ich, das Modell einer ‘projektorientierten Katechese’ als Ergänzung dieses Katechesemodells vorstellen.
6.3 Konzepte der Ehekatechese
6.3.1 Ehekatechese in kirchlichen Verlautbarungen
Schon im Jahre 1981 hat sich Papst Johannes Paul II in seiner Enzyklika Familiaris Consortio (vgl. S. 71) für eine Intensivierung der kirchlichen Bemühungen um die Ehevorbereitung ausgesprochen. In enger Anlehnung an diese Enzyklika steht die Ver- lautbarung des Päpstlichen Rates für die Familie Die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe vom 13. Mai 1996. In beiden Verlautbarungen wird die Ehevorbereitung als ein „stufenweiser, stetiger Prozeß“ (FC 66) gesehen, der bereits in der Kindheit mit der Familienerziehung beginnt. In dieser entfernteren Vorbereitung (FC 66; VS II, A) wer- den die Vorstellungen des Kindes von Liebe und Partnerschaft im Sinne eines christli- chen Lebensstiles durch das Vorbild der Ehe seiner Eltern geprägt; darüber hinaus wird gefordert, daßbereits in Kindheit und Jugend eine „solide spirituelle und katechetische Ausbildung“ erfolgen soll, die es den Heranwachsenden ermöglicht, die „wahre Beru- fung und Sendung christlicher Ehe“ (FC 66) zu erfassen. Das oberste Ziel der entfernte- ren Vorbereitung ist nach Auffassung des Päpstlichen Rates, daßjeder zur Ehe berufene Gläubige zutiefst verstehen soll, daß„die menschliche Liebe im Lichte der Liebe Gottes in der christlichen Ethik einen zentralen Platz einnimmt“ (VS 25). Als weitere Ziele werden die „Erziehung zur Keuschheit, zur Liebe als Selbsthingabe“ (VS 24) und die „Einführung in die erzieherische Sendung“ genannt. Orte der Unterweisung sind neben der Familie auch die Gemeinde, die Schule, anderweitige Bildungseinrichtungen und die katholischen Verbände (vgl. VS 29). Die ‘entferntere Ehevorbereitung’ stellt einen hohen Anspruch an die Ehekatechese insgesamt, auf der anderen Seite aber relativiert sich auch der Anspruch an die spätere Ehevorbereitung und -begleitung, da sich die Versäumnisse in der Kindheit402 auch durch eine lebenslange, ehebegleitende Katechese oft nicht völlig ausgleichen lassen.403
An die entferntere Ehevorbereitung in Kindheit und Jugend soll sich dann die nähere Vorbereitung anschließen, die in der Verlobungszeit erfolgt. In ihr sollen die Brautleute die Möglichkeit erhalten, zu prüfen, ob sie in „jenen menschlichen Werten gereift sind, die der Freundschaft und dem Dialog eigen sind“, sowie die Gelegenheit „das Glau- bensleben und vor allem die Kenntnis über die Sakramentalität der Kirche zu vertiefen“ (VS 32). Ziel der näheren Vorbereitung ist ein umfassenderes Verständnis des Glaubens und das Zeugnis im konkreten Leben (VS 34) sowie die Vorbereitung auf das Leben zu zweit, welche „die Ehe als eine personale Verbindung von Mann und Frau darstellt, die ständig weiterentwickelt werden mußund so dazu anregt, die Fragen ehelicher Sexuali- tät und verantwortlicher Elternschaft zu vertiefen, zusammen mit den damit verbunde- nen Grundkenntnissen von Medizin und Biologie, welche ferner die Voraussetzung für ein gutes Familienleben richtige Methoden der Kindererziehung vermittelt und auch dazu anleitet, sich die Grundlage für einen geregelten Unterhalt der Familie zu beschaf- fen“ (FC 66). Zudem wird die Vermittlung des Wissens um die Verpflichtung vor der Gesellschaft und der Kirche betont. Im Mittelpunkt dieser Vorbereitung mußjedoch „die Glaubensüberlegung über das Sakrament der Ehe anhand des Wortes Gottes und unter Führung des Lehramtes stehen“ (VS 47). In diesem Sinne sollen vor allem auch die Fragen der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe und die Bedeutung der Sexualität und der Weitergabe des Lebens in der Ehe gemäßder Enzyklika Humanae vitae behan- delt werden. Ort der Unterweisung soll eine Glaubensgemeinschaft von Familien im Bereich der Pfarrgemeinde sein, die regelmäßig in einer „Atmosphäre des Dialogs, der Freundschaft [und] des Gebets [...] unter Teilnahme von Hirten und Katecheten“ zu- sammenkommt. Der Umfang dieser näheren Vorbereitung darf zweckmäßigerweise nicht zu kurz bemessen werden, vorgeschlagen werden z.B. vier Wochenenden, eine volle Woche oder Treffen in einmonatigen Abständen über ein Jahr hin.
An die nähere Vorbereitung wiederum soll sich die unmittelbare Vorbereitung an- schließen, die in den letzten Wochen oder Monaten vor der Feier des Sakramentes stattfinden soll. Sie erweist sich als besonders dringlich für „diejenigen Verlobten, die noch Mängel und Schwierigkeiten in christlicher Praxis“ (FC 66) aufweisen, weshalb sie „ nur aus verhältnism äßig schwerwiegenden Gründen “ (VS 51, Hervorhebung im Original) unterbleiben darf. Ihre Ziele sind die Zusammenfassung der bisher erworbe- nen „theologischen, moralischen und spirtuellen Inhalte“, die Erneuerung der bereits gemachten Gebetserfahrungen, die Durchführung einer angemessenen liturgischen Vorbereitung auf den Traugottesdienst, die die tätige Teilnahme der Brautleute zum Ziel hat, und die Aufwertung der kirchenrechtlich vorgeschriebenen Gespräche mit dem Pfarrer (VS 50). Den Brautleuten soll einen „vertiefte Erkenntnis des Geheimnisses Christi und der Kirche wie der Bedeutung von Gnade und Verantwortung einer christli- chen Ehe“ (FC 66) vermittelt werden, sie „sollen wissen, daßsie sich in der Ehe als Getaufte in Christus verbinden, daßsie sich in ihrem Familienleben vom Heiligen Geist leiten lassen müssen“ (VS 53). Die unmittelbare Vorbereitung soll zudem als Gelegen- heit genutzt werden, eine fortwährende Ehe- und Familienpastoral auf den Weg zu bringen. „Vor diesem Hintergrund gilt es zu bewirken, daßdie Eheleute ihre Sendung in der Kirche kennen“ (VS 57). Träger der Ehevorbereitung in den verschiedenen Phasen sind sowohl die christlichen Familien als auch die gesamte kirchliche Gemeinschaft (FC 66).
Beide kirchlichen Dokumente sehen sehr klar die Notwendigkeit zu einer Ehekatechese in Anbetracht der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation (vgl. FC 66; VS I). Positiv zu bewerten ist das Verständnis der Ehekatechese als eines lebenslangen Prozesses. Ge- mäßdem weiten Katecheseverständnis der Würzburger Synode gehört zur Ehekatechese „alles, was vor der Ehe und im Laufe eines Ehelebens für die Förderung eines reflektierten Glaubensbewußtseins der Ehepartner und einer aus diesem Glaubensbewußtsein der Ehepartner gelebten Familie nötig ist“404. Insofern ist die Ehekatechese in der Tat ein Prozeß, der die gesamte Biographie eines Menschen umfaßt. Sie ist von daher nicht auf eine der Sakramentenspendung vorangehende Unterweisung engzuführen, sondern beinhaltet auch die Begleitung der Eheleute vor und nach der Trauung. Sowohl Papst Johannes Paul II. als auch der Päpstliche Rat für die Familie betonen überdies die Funktion der Gemeinde für die Ehekatechese. Erfreulich ist auch der Versuch zur Aufwertung der Gespräche mit dem Pfarrer, die sich heute in manchen Fällen schon nur noch auf die Feststellung der Ehefähigkeit beziehen und insofern kaum den Titel der Katechese verdienen. Auf der anderen Seite aber mußklar gesehen werden, daßdas hier vorgezeichnete Modell einer lebenslangen Ehekatechese den gesellschaftlichen Tatsachen zumindest in den Industrieländern nicht gerecht wird. Viele Brautpaare nehmen heute erst dann Kontakt mit der Kirche auf, heute erst dann Kontakt mit der Kirche auf, wenn der Termin für die Hochzeit schon feststeht, der Festsaal vielleicht schon gebucht und die Einladungen verschickt sind. Inwiefern sie in ihrer Kindheit bereits auf eine christliche Ehe vorbereitet wurden, kann sehr unterschiedlich sein, die Phase der näheren Vorbereitung während der Verlo- bungszeit405 ist bereits übersprungen, und ein Ehekatechumenat, das lediglich bereits vorhandenes Glaubenswissen vertiefen soll, greift unter solchen Voraussetzungen in jedem Falle zu kurz. In vielen Fällen werden hier nämlich nicht nur „Lücken in der Grundausbildung auszufüllen“ (VS 50) sein, sondern es wird nahezu vollkommen neu an den Glauben, an ein Leben aus dem Evangelium heranzuführen sein. Ehekatechese darf nicht von Voraussetzungen ausgehen, die bei einem großen Teil der Christen ein- fach nicht mehr gegeben sind, wenn sie nicht vollkommen an den tatsächlichen Le- benswerten dieser Menschen vorbeigehen und somit wirkungslos bleiben will. Insofern wird das Katechese-Modell des Päpstlichen Rates, so viele erfreuliche Ansätze darin auch zum Tragen kommen, nur noch auf einen Bruchteil der Christen in den Industrie- ländern anwendbar sein. Der Wille zu einer lebenslangen Bindung an eine Institution wie die Kirche ist dem postmodernen Menschen abhanden gekommen, und wir können nicht die Augen vor der Tatsache verschließen, daßeine christliche Sozialisation, wie der Päpstliche Rat sie beschreibt, in vielen Fällen nicht stattgefunden hat. Alle kateche- tischen Bemühungen müssen daher einkalkulieren, daßdie Brautleute möglicherweise nur rudimentär über die Bedeutung des Ehesakramentes bzw. über christliche Glaubens- inhalte informiert sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es wenig sinnvoll, Menschen mit sakramententheologischen Ausführungen zu ‘erschlagen’ oder ihnen die Aussagen über Sexualität und verantwortete Weitergabe des Lebens gemäßHumanae vitae nahe- bringen zu wollen (vgl. VS 48) mit denen sich der überwiegende Teil der jungen Leute nicht mehr identifizieren kann. Es mußden Brautleuten vielmehr deutlich gemacht werden, daßes darum geht, ihnen zu „helfen, daßihre Ehe und dadurch ihr Leben ge- lingt, indem sie auf den Zuspruch und Anspruch Gottes für ihre Ehe eingehen.“406 In diesem Sinne darf nicht das Sachwissen im Vordergrund der Ehekatechese stehen, sondern die Vermittlung von Lebenswissen. Anteil an christlich-kirchlichem Lebens- wissen aber bekommt ein Mensch dann, „wenn er damit vertraut wird, wie er sein Le- ben als Christ in der Ehe so verstehen und gestalten kann und soll, daßihm sein Leben auch durch sein Eheleben gelingt.“407 Für das auch und gerade notwendig nachzulie- fernde Sachwissen bedeutet das, daßes als in Lebenszusammenhänge eingebettet auf- gewiesen werden und die Relevanz für das je eigene Leben aufgezeigt und im Blick gehalten werden muß.
6.3.2 Projektorientierte (Ehe)katechese
Wie aber kann eine Ehekatechese aussehen, die auch nicht kirchlich sozialisierte Men- schen erreicht und anspricht? Eine Ehekatechese die sich nach dem Vorbild des Kom- munion- oder Firmunterrichtes über einen längeren Zeitraum erstreckt, scheint hier keine gangbare Vorgehensweise zu sein. Zum einen, weil die Brautpaare häufig im Berufsleben stehen und eventuell aufgrund von Schichtdiensten o.ä. regelmäßige Tref- fen nicht in ihren Lebensrhythmus integrieren können, zum anderen, weil durch eine längerdauernde, regelmäßig stattfindende Katechese bei den Brautleuten das Gefühl entstehen könnte, in ungerechtfertigter Weise vereinnahmt zu werden. Zwar ist in der Entscheidung für den christlichen Glauben immer auch ein Anspruch enthalten, der den ganzen Menschen anfordert, doch wo der Glaube kaum vorhanden ist, erscheint es wenig sinnvoll bei den Ansprüchen anzufangen. Es ist nun einmal Fakt, daßsich das postmoderne Individuum nicht gerne vereinnahmen läßt, es zieht es häufig vor, in der Anonymität zu bleiben, sich in den „privat-familiären Lebensraum“ zurückzuziehen und den „Fragen des Glaubens und der Wahrheit des Lebensgrundes“408 auszuweichen. Vor diesem Hintergrund scheint es, um die Kirchenfernen anzusprechen, geschickter zu sein, eine ‘projektorientierte’ Ehekatechese zu betreiben, die den Menschen als eigen- verantwortliches Individuum respektiert. Projektorientierte Katechese meint, daßje- weils zeitlich begrenzte Veranstaltungen abgehalten werden, die sich zwar gegenseitig ergänzen können, jedoch als Einzelveranstaltungen in sich abgeschlossen sind.409 Auf diese Weise würde es möglich, eine lebenslange Begleitung gemäßFamiliaris Consor- tio anzubieten, die sich jeweils auf die konkreten Situationen von Braut- und Eheleuten bezieht, ohne eine dauerhafte Bindung an das gemeindliche Leben vorauszusetzen. Als eherelevante Katecheseprojekte wären denkbar: die bereits angesprochenen Ehevorbe- reitungskurse, Veranstaltungen für Familien mit Kleinstkindern, für Familien mit Kin- dern in der Pubertät, für Eheleute in der postfamilialen Phase und für verwitwete Men- schen, aber auch Angebote für Geschiedene, Alleinerziehende oder Paare in nichteheli- chen Lebensgemeinschaften sowie für junge (noch) unverheiratete Erwachsene. Durch ein solch breitgefächertes und nicht auf die Eheschließung fixiertes Angebot werden auch jene Gruppen angesprochen, die bisher in den Bemühungen um Ehekatechese und -pastoral außen vorgeblieben sind, gleichwohl auch sie Mitglieder der Kirche sind und als solche ernstgenommen werden sollten. Wichtig bei all diesen Unternehmungen wäre, daßsie von den Teilnehmern nicht als ‘Kundenfängerei’ aufgefaßt werden, son- dern daßsie Angebote sind, die die Kirche, um es zeitgeistkonform zu formulieren, ‘ohne Vertragsbindung’ anbietet. Die Veranstaltungen sollen Gelegenheit sein, sich über Fragen des Lebens und Glaubens auszutauschen, ohne gleich ‘festgenagelt’ zu werden. Dies bedeutet natürlich nicht, daßdiese punktuellen, zeitlich begrenzten An- gebote - denkbar wären etwa ‘Workshops’, die ein Wochenende umfassen, ‘Projekt- tage’ oder regelmäßige Treffen über einen eng begrenzten Zeitraum - nicht auf eine eventuelle spätere Teilnahme am gemeindlichen Leben offen sein sollten. Sie müssen im Gegenteil auch Erstkontakte mit der Gemeinde ermöglichen - von daher ist es auch besonders wichtig, daßsich Gemeindeglieder bei diesen Projekten einbringen - und den Teilnehmern so die Chance bieten, zu prüfen, ob sie nicht doch in dem von ihnen allein zu bestimmenden Maße am gemeindlichen Leben teilhaben wollen. Wenn sich im Rahmen dieser punktuellen Angebote Menschen zusammenfinden, die gerne miteinan- der auf dem Weg des Glaubens weitergehen möchten, so mußdie Kirche dies mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln (z.B. indem sie geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellt) zu fördern suchen. Eine solche projektorientierte Katechese ist natür- lich nur als Ergänzung zu den dauerhaft bestehenden und gemeindenäher stattfindenden Angeboten zu denken. Das gemeindliche Leben, in dem sich Menschen dauerhaft in der Gemeinde engagieren, soll ja keinesfalls zum Erliegen gebracht, sondern viel mehr neu belebt werden. Die Gemeinde mußdaher Sorge dafür tragen, sich den Teilnehmern der verschiedenen Projekte nicht als ‘geschlossene Gesellschaft’ darzustellen, sondern als eine offene Gemeinschaft von Menschen, in der der einzelne frei erproben darf, ob er hier eine Heimat finden kann.
Nach dem Ausverkauf der Sakramente nun also auch noch der Ausverkauf der Kateche- se? Keineswegs! Worum es hier geht, ist nicht, die Inhalte zu ‘verwässern’, indem man sie dem Zeitgeist anpaßt, sondern darum, eben diese Inhalte in zeitgemäßer Form an den ‘postmodernen Menschen’ zu bringen. Bei aller Unverbindlichkeit solcher Angebote kann auch hier gezeigt werden, daßdie Kirche verbindlich für bestimmte Inhalte steht und gerade in ihrer Verbindlichkeit als besondere ‘Anbieterin’ neben anderen wahrge- nommen werden will. Auch soll nicht angestrebt werden, daßKirchenferne kirchenfern bleiben, sondern - ganz im Gegenteil - daßeine größere Berührungsfläche zwischen Kirche und Kirchenfernen entsteht, die eine ‘Diffusion ins Kircheninnere’ fördert. Die katechetischen ‘Projekte’ dürfen jedoch nicht als ‘Crash-Kurse’ mißverstanden werden. Es geht nicht darum, den Teilnehmern in möglichst kurzer Zeit ein möglichst umfassen- des Wissen, beispielsweise über das Ehesakrament, zu vermitteln, sondern darum, daßsie, gemäßden Empfehlungen der Würzburger Synode, Räume finden, in denen sie sich weitgehend eigenständig an das ‘Lebenskonzept Glauben’ herantasten können. Auf diese Weise könnten die kirchenfernen Christen in ihrer Distanz und Eigenverantwort- lichkeit ernstgenommen werden und durch Maximierung punktueller Berührungsmög- lichkeiten der Kontakt zur Kirche in unverkrampfter Weise gefördert werden.
6.4 Konkretion
6.4.1 Ziele der Ehekatechese
Wenn aber nicht primär die Einbindung in das Gemeindeleben und auch nicht allein die Vermittlung von ‘Sachwissen’ erreicht werden sollen, was sind dann die Ziele der Ehekatechese? Alle ehekatechetischen Bemühungen müssen, entsprechend dem diako- nalen Auftrag der Kirche, zuerst den Menschen und sein Wohl im Blick haben. Daher mußes in der Ehekatechese hauptsächlich darum gehen, den Katechumenen zu ermög- lichen, die „Frohbotschaft Jesu Christi, die ihnen die Kirche verkündet [...] als Lebens- hilfe“410 zu erfahren. Die Brautleute sollen erkennen, daßglaubend eine Ehe einzuge- hen bedeutet, sich darauf zu verlassen, daßGott ihnen auch in schweren Zeiten ihrer Beziehung helfend beisteht und daßsie darauf hoffen dürfen, „für ihre gemeinsame Zukunft all das an Liebe, Kraft, Geduld und Liebe von Gott her immer wieder zu emp- fangen, was sie füreinander brauchen“411, daßer ihre Ehe ermöglichen wird, indem er ihnen die Gabe der Liebe immer wieder neu schenkt. Wo eine Ehe solchermaßen in ‘Glaube, Hoffnung und Liebe’ eingegangen und gelebt wird, ist sie zwar nicht davor gefeit zu scheitern, aber die Brautleute können die übergroße Verantwortung einer gelingenden Beziehung im Vertrauen auf Gottes Kraft und Gnade hoffnungsvoll auf sich nehmen, weil sie sich zu allen Zeiten ihrer Ehe von Gott geliebt und gehalten wis- sen. Die Ehe auf diese Weise zu verstehen entlastet gleichzeitig die Partner von der Überforderung, einander ‘alles’ sein zu müssen (vgl. Kap. 2.3) und befähigt sie dazu, den jeweils anderen und die eigene Liebe zu ihm als Geschenk Gottes anzunehmen und die Ehe als ein Zeichen der liebenden Zuwendung Gottes zu den Menschen anzuerken- nen und zu leben.
Insofern Ehekatechese also eine Hilfe für die Eheleute darstellen soll, daßihre Ehe gelingt, darf sie nicht auf einen Ehevorbereitungskurs beschränkt werden, sondern sollte nach Möglichkeit schon früher ansetzen und die Eheleute, sofern sie dies wünschen, in allen Phasen ihrer Ehe (vgl. Kap. 2.2.7) begleiten und unterstützen.
6.4.2 Ehekatechese als Aufgabe der Gemeinde
Ein wichtiger Aufbruch des II. Vaticanums war der Wandel des kirchlichen Selbstver- ständnisses im Hinblick auf die konkrete Gemeinde in dem Sinne, daßnun die Ortsge- meinde als die „intensivste Aktualisierung der Kirche“412 gesehen wird. Aus diesen Aussagen ergibt sich ein tiefgreifender Wandel in der Struktur der Gemeinde, die sich nun nicht mehr als eine vom Amtsträger mit allem Notwendigen versorgte Glaubens- gemeinschaft verstehen kann, sondern sich erstmals als „Raum der Entdeckung, Erpro- bung und Bewahrheitung des Evangeliums“413 betrachten soll, in dem dessen Heilskraft erfahren werden kann. Damit geht auch die Verantwortung für katechetische Unterneh- mungen zu einem großen Teil vom Amtsträger auf die Gemeinde über, sie wird „von der versorgten Gemeinde zur sorgenden Gemeinde“414. Da die Gemeinde immer auch Nutznießerin katechetischer Unternehmungen ist, kommt der Katechese in der gemeind- lichen Arbeit höchste Priorität zu. Sie darf daher den Priester nicht länger mit der Auf- gabe der Sakramentenpastoral alleine lassen, sondern mußin die Entscheidungen, die getroffen werden, miteinbezogen werden, „ die Sakramentenpastoral [...] mu ßin ge- sprächs- und verantwortungsfähigen Gruppen der Gemeinde besprochen werden, um zu einem verantwortlichen Handeln in und mit der Gemeinde zu kommen “415. Dies gilt auch für die Ehekatechese. Insofern das Sakrament der Ehe immer auch eine Feier der Gemeinde sein sollte, ist es wichtig, daßdie Gemeinde sich ihrer Zuständigkeit für die Ehekatechese und -pastoral bewußt wird. Derzeit ist die Situation leider die, daßdas Ehesakrament, neben der Taufe, das wohl am stärksten ‘privatisierte’ kirchliche Sakra- ment ist, bei dessen Feier üblicherweise lediglich Freunde, Verwandte und Bekannte des Brautpaares anwesend sind, die ggf. von weither anreisen. Die konkrete Gemeinde vor Ort hingegen nimmt Trauungen oft gar nicht zur Kenntnis und überläßt die Verant- wortung allein dem Amtsträger. Ob dieser Praxis stellt sich die Frage, wie man ange- henden Eheleuten glaubhaft vermitteln soll, daßsie durch das Sakrament in die Ge- meinde hineingenommen werden, wenn diese in keinster Weise in Erscheinung tritt. Die Gemeinde mußsich fragen lassen, ob ihr Leben „dem, was in den Sakramenten zuge- sagt wird“416, entspricht. Können die Verheißungen von der Aufnahme in eine Glau- bensgemeinschaft, in der der Glaube gemeinschaftlich gefeiert wird, in denen die Mit- glieder an den Feiern der einzelnen teilnehmen, in denen menschliche Nähe entstehen kann, überhaupt eingehalten werden? Mit Sicherheit kann von den Sakramenten- empfängern, selbst wenn sie prinzipiell willens sind, sich in eine Gemeinde einzubrin- gen, nicht erwarten werden, daßsie selbst aktiv werden und sich ihren Platz in der Gemeinde suchen, wenn diese sich ihnen als eine ‘geschlossene Gesellschaft’ darstellt, in der sie augenscheinlich entbehrlich sind.
Nun ist wohl nichts daran zu ändern, daßdie konkrete Gemeinde vor Ort bei der eigent- lichen Trauzeremonie nicht in Erscheinung tritt. Den Brautleuten mußzugestanden wer- den, daßsie ihre Feier mit den Menschen begehen, die für sie und ihre gemeinsame Geschichte von Bedeutung sind - und die sind heute eben eher selten identisch mit Gemeindemitgliedern vor Ort. Um so wichtiger aber wird es, daßsie in der eherelevan- ten Katechese zumindest mit einigen Gliedern der Gemeinde in Berührung kommen, damit sie das gemeindliche Leben als Ort des Austauschs und der gegenseitigen Unter- stützung im Glauben wie im Leben kennenlernen können. Insofern erscheint es zweck- mäßig, wenn an den ehekatechetischen Projekten immer auch ein oder mehrere Ge- meindeglieder teilnehmen. So könnten z.B. an den Ehevorbereitungskursen Ehepaare aus der Gemeinde mitwirken, die ihre Ehe im Glauben zu leben versuchen und hiervon Zeugnis ablegen können; selbstverständlich nicht im Sinne einer Belehrung, sondern um den Katechumenen zu vermitteln, wie das gehen könnte, ‘die Ehe aus dem Glauben zu leben’. Wichtig ist, daßdiese Ehepaare den Katechumenen „wirklich als Menschen mit ihren Stärken und Schwächen, mit ihrem Fragen und Suchen“417 begegnen und nicht fertige Antworten auf die Frage zu liefern versuchen, wie christliche Ehe ‘funktioniert’.
Gerade zeitlich begrenzte ehekatechetische Projekte sind auch von der Gemeinde als Anbieterin, die heutzutage häufig bis zur Schmerzgrenze mit anderweitigen Aufgaben ausgelastet ist, leichter zu realisieren. Denn auch was ehrenamtliche Mitarbeit betrifft, wird die Hemmschwelle zum Engagement erniedrigt, wenn es sich um überschaubare und begrenzte Projekte handelt. Daneben aber sollten immer auch dauerhafte Angebote bestehen, zu denen im Rahmen der ‘katechetischen Projekte’ eingeladen werden könnte. Denkbar wären etwa Familien- und Ehepaarkreise, in denen „Frauen und Männer im Sinne einer ‘narrativen Theologie’ einander mitteilen und bezeugen, wie es ihnen bei dem Versuch ergeht, ihre Ehe bewußt als Christin und als Christ zu leben und wie ihnen ihr Glaube an den Gott und Vater Jesu dabei hilft, sie trägt, beansprucht und sie inspi- riert“418. Im Optimalfall sollten diese Kreise weitestgehend ohne den Amtsträger oder anderweitige hauptamtliche Katecheten auskommen, denn sie wollen ja nicht Orte der Unterweisung sein, sondern Gemeinschaften, in denen sich Menschen, die sich in ähnli- chen Lebenssituationen befinden, über ihre Versuche, ihren Glauben zu leben, austau- schen können. Zwar wird der Anstoßfür solche Gesprächskreise üblicherweise von ‘offizieller’ Seite erfolgen müssen, da die Selbstorganisation von Christen ohne solche Anstöße leider noch nicht überall gelingt - zu sehr sind viele Gemeindemitglieder immer noch dem vorkonziliaren ‘Versorgungsschema’ verhaftet, demzufolge sie pasto- ral versorgt werden wollen, ohne selber Verantwortung zu übernehmen. Langfristig aber mußes das Ziel sein, das solche Gruppen zu ‘Selbstläufern’ werden, die ihre Tref- fen und eventuelle Unternehmungen zeitlich und inhaltlich selbst organisieren. Auf diese Weise könnte ein buntes, breit gefächertes und offenes gemeindliches Leben entstehen, das vielleicht auch die ‘Kirchenfernen’ anzulocken in der Lage ist.
6.4.3 Die Rolle des Amtsträgers
Falsch wäre es jedoch trotzdem, die Rolle des Pfarrers als herunterzuspielen. Gerade für gemeindeferne Brautleute ist der Pfarrer die erste Person, und oft leider auch die einzi- ge, mit der sie in Kontakt kommen. Für das Paar ist der Pfarrer der Ansprechpartner. Er mußdie Ehefähigkeit feststellen und ist zudem zuständig für die Terminabsprache und die Besprechung der Liturgie. Um so wichtiger ist es, daßdas (oder die) Gespräche mit dem Pfarrer in freundlicher, kollegialer Atmosphäre stattfinden und die Aspiranten nicht direkt mit Forderungen abschreckt.419 Jeder und jede, der bzw. die Mitglied der Kirche ist und den Wunsch hat zu heiraten und dies auch kirchlich ‘begehen’ möchte, sollte sich bei dem Gemeindepfarrer als dem Repräsentanten der Gemeinde an der richtigen Adresse wissen.
Bedingungen für die Feier des Ehesakramentes in der Gemeinde sollten, über die forma- le Kirchenzugehörigkeit (besser: Gemeindezugehörigkeit), die Ernsthaftigkeit des Ehe- wunsches und eines wie auch immer gearteten, in dem Wunsch nach einer kirchlichen Trauung sich ja manifestierenden, positiven Verhältnis zur christlichen Ehe hinaus nicht gestellt werden, wie es - notgedrungen - ohnedies schon praktiziert wird. Ist die Ehekatechese nicht ‘Bedingung’ für das Sakrament, sondern begeleitende Ergänzung, so kann der Pfarrer auch in ganz anderer Weise darauf zu sprechen kommen. Er mußsich nicht genötigt fühlen, zu betonen, daßes ‘eigentlich’ Pflicht sei, an Ehevorbereitungskursen teilzunehmen, sondern kann auf das Angebot von eherelevanten Projekten in der Gemeinde hinweisen, daßden Brautleuten vor und nach ihrer Trauung zur Verfügung steht.
6.4.4 Ehekatechese als gemeinsames Erproben des Glaubens
Um Menschen zu erschließen, daß„der Glaube für die Sinngebung und für die Gestal- tung des Lebens in Ehe und Familie eine einzigartige Hilfe“420 sein kann, ist es auch in der Ehekatechese von fundamentaler Wichtigkeit, von deren konkreten Erfahrungen und Fragen der auszugehen. Im Horizont einer so einschneidenden Entscheidung wie es die zur Schließung einer Ehe oder auch die Geburt eines Kindes ist, brechen auch bei nicht religiös geprägten Menschen Fragen auf, die in der Katechese zur Sprache ge- bracht werden können und sollen. So kann etwa die Erfahrung der Sehnsucht nach einer dauerhaften, gelingenden Beziehung gerade vor dem Hintergrund des vielfachen Schei- terns von Ehen in der heutigen Zeit auf den Schöpfungswillen Gottes hin geöffnet wer- den. Gott hat den Menschen aus Liebe und zur Liebe erschaffen, der Mensch mußsich auf die Liebe einlassen, wenn ihm sein Leben gelingen soll. Es ist deshalb bei allen katechetischen Projekten von fundamentaler Wichtigkeit, daßbei allem ‘Programm’ immer auch genug Zeit und Raum für das Gespräch bleibt, in dem die Brautleute oder Ehepaare ihre persönlichen Fragen, die ihnen im Kontext ihrer Eheschließung oder ihrer Ehe kommen, formulieren und zur Disposition stellen können. Um gesprächsfähig zu bleiben sollten die Gruppen daher aus nicht mehr als sieben Paaren bestehen.
Entscheidend bei den katechetischen Unternehmungen ist, daßsie sich als „Test- und Erfahrungsraum für die Tauglichkeit der ausgerufenen Lebensofferte »Evangelium«“421 erweisen, in dem die Braut- und Eheleute sich langsam und ausgehend von ihren eige- nen Fragen und Erfahrungen dem ‘Lebensstil Glauben’ annähern können. Sie dürfen in keiner Weise das Gefühl bekommen, indoktriniert zu werden, sondern sollen die Kate- chese als Gelegenheit sehen, gemeinsam mit anderen ihr Lebenskonzept zu überdenken und sich über Fragen der Sinngestaltung ihres Lebens auszutauschen. Die Katechume- nen müssen, im Gegensatz zum veralteten Verständnis von Katechese, eben nicht an der Hand genommen und geleitet werden, sondern als erwachsene Menschen mit einem entsprechenden Reflexionsbewußtsein ernstgenommen werden. Auch ihre Glaubens- zweifel, auch ihre Angst, die Ehe könne scheitern, müssen im Kreise der TeilnehmerIn- nen thematisiert werden dürfen. Keinesfalls dürfen die Augen vor der Tatsache ver- schlossen werden, daßauch Ehen, die christlich gelebt werden, scheitern können. Auch wenn die Kirche nach wie vor an der Unauflöslichkeit der Ehe festhält, mußdie Mög- lichkeit des Scheiterns einer Ehe angesprochen werden können. Die Gründe, weshalb Ehen scheitern, sind gerade in der heutigen Zeit vielfältig (vgl. Kap. 2.2). Es kann daher nicht angehen, den Braut- oder Eheleuten ein ‘Rezept’ für eine gelingende Ehe vermit- teln zu wollen, sondern es ist darauf hinzuarbeiten, daßsie aus dem Glauben Kraft für ihre Ehe gewinnen, die sie auch dann nicht verlieren, wenn die Ehe scheitern sollte. Die Katechese wäre auch überfordert, wenn sie Menschen sagen wollte, wie sie ihre Ehe zu leben haben, damit sie in jedem Falle gelingt. Dies ist auch nicht gefragt: viele der Paare leben bereits seit Jahren zusammen, sie kennen sich und ihre Beziehung zueinan- der und haben oft bereits eine ‘fertige’ Vorstellung von ihrer Ehe. Aber viele von ihnen werden vielleicht doch aufmerksam, „wenn diese mit einem Gottesbild konfrontiert wird, das genau die Sehnsüchte nach Heilsein und beglückenden Erfahrungen in der Ganzheit der Beziehung, wie sie schon gelebt wird, will und gutheißt, in allen, auch den sexuellen Entfaltungen.“422
Ehekatechese ist ein Versuch neben anderen, Menschen zu einer gelingenden und erfül- lenden Beziehung zu verhelfen. Manche Paare können vielleicht mehr Nutzen aus anderweitigen kirchlichen oder sonstigen Angeboten ziehen, etwa aus Paartherapien. Bei allen katechetischen Bestrebungen mußstets die Tatsache in Rechnung gestellt werden, daßGlaube nicht wie eine Sache ‘weitergereicht’ werden kann. Er ist ein „per- sonales Geschehen, eine Beziehungsgemeinschaft zwischen Gott und Mensch“423, die nicht jeder aufbauen kann oder will. Katechese kann diese Beziehung zwar fördern, sie kann sensibel machen für die „Liebesgeschichte Gottes mit uns und helfen, ihre Spuren in allen menschlichen Liebes- und Lebensgeschichten zu entdecken“424, aber sie kann die Entscheidung eines Christen, den Zuspruch und Anspruch Gottes wahrzunehmen, nicht herbeiführen.
6.4.5 Dimensionen einer projektorientierten Ehekatechese
Zum Schlußmöchte ich nochmals resümierend versuchen, anhand der Trias ‘Erfahren’, ‘Vertrauen’ und ‘Verstehen’ (vgl. S. 85) die verschiedenen Dimensionen einer projektorientierten Ehekatechese stichwortartig aufzuzeigen:
- Biographieorientiertheit (Erfahren): Die einzelnen überschaubaren Projekte können besser auf die verschiedenen Fragen und Bedürfnisse von Menschen in unterschied- lichen Phasen ihres Lebenslaufes ausgerichtet werden. Ältere Paare oder gar Ver- witwete haben nicht nur andere Fragen (z.B. Stichwort ‘Tod’), sondern auch andere Bedürfnisse. Sie werden eher an Erfahrungsaustausch denn an Informationsvermitt- lung interessiert sein. Ihnen sollen Räume eingerichtet werden, in denen sie ihre per- sönlichen Eheerfahrungen, oder auch Erfahrungen mit dem Alleinsein, mit dem Tod des Partners etc. zur Sprache bringen können. Junge Erwachsene oder Jugendliche z.B. haben wiederum ihre eigenen Fragen, die sie weniger von ihren schon gewon- nenen Erfahrungen aus stellen, sondern eher aus Neugier auf ein noch unerprobtes Gelände.
- Offenheit zur Welt (Vertrauen): Es ist klar, daßdie einzelne Gemeinde alleine nicht in der Lage ist, ein genügend breites Spektrum an Veranstaltungen flächendeckend anzubieten. Durch die Konzentration auf Einzelprojekte wird auch die Möglichkeit zur Kooperation mit Nachbargemeinden, auch anderer Konfession und sogar mit nichtkirchlichen Organisationen möglich. Als Beispiel sei hier etwa an Angebote zum Thema ‘Konfliktbewältigung in der Partnerschaft’ gedacht, die zusammen mit kirchlichen oder nichtkirchlichen psychologisch beratenden Einrichtungen angeboten werden könnten. So würde die theologische Sicht neben einer andern weltlichen Sicht stärker ihr eigenes Profil zeigen können. Kirche kann, indem sie sich so ohne Berührungsängste einer breiten Öffentlichkeit zeigt, auch Menschen erreichen, die ein Grundvertrauen in die ihnen vielleicht suspekt gewordene Institution und ihre Botschaft erst wieder gewinnen müssen.
- Inhaltliche Elementararisierung (Verstehen): Es sollte in den einzelnen Projekten versucht werden, sich auf wenige, wenn nicht sogar einzelne Aspekte aus dem Um- feldes der Ehe zu konzentrieren. Durch diese Elementarisierung kann nicht nur das einzelne Thema tiefergehender behandelt werden, sondern auch den Kirchenfernen überhaupt erst die Möglichkeit gegeben werden, sich verstehend einem für sie über- schaubaren Thema zu widmen. Außerdem können durch eine in eine Vielzahl unter- schiedlicher Angebote mit je eigenen Profil aufgesplitterte Ehekatechese, verschie- dene Zielgruppen gezielter angesprochen werden. Ehekatechetisch relevante Ele- mente für solche Projekte finden sich mannigfaltig, sie können bei Stichworten an- setzen, wie ‘Mann und Frau’ (Schöpfung); ‘Liebe und Sexualität’; ‘Liebe und Ewig- keit’; ‘Verantwortung’; ‘Treue’ (des Menschen und Gottes); ‘Verlust(-ängste)’ u.v.a.m.
6.5 Schlußwort
Ich bin mir bewußt, daßder hier beschriebene Ansatz einer ‘projektoreintierten’ Kate- chese als Ergänzung zu bestehenden katechetischen Unternehmungen das Problem des Auseinanderklaffens von Anspruch und Wirklichkeit bei der Spendung des Ehesakra- mentes nicht wird lösen können. Man wird sich damit abfinden müssen, daßauch wei- terhin viele Paare das Sakrament empfangen werden, die nicht entsprechend darauf vorbereitet sind. Dies mag schmerzlich für diejenigen sein, die den Anspruch des Sak- ramentes wahr- und ernstnehmen, für die Amtsträger ebenso wie für manche Gemein- demitglieder, die ein solches Vorgehen als ‘Ausverkauf’ kirchlicher Grundvollzüge empfinden. Auf der andern Seite besteht aber gerade bei der Ehe als Dauersakrament die Chance, daßes auch später noch, im Laufe des Ehelebens wirksam werden kann, denn die bedingungslose liebende Bindung zweier Menschen aneinander hat immer sakramentalen Charakter. Wir sollten wegkommen von einem Verständnis des Sakra- mentes, das die in diesem enthaltenen Anforderungen an den einzelnen in den Vorder- grund stellt, und versuchen, es mehr als die einladend ausgestreckten Arme der Kirche zu sehen, in denen sie in speziellen Lebenssituationen des einzelnen und der Gemeinde „sinnenfällig und konkret die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes“425 zeigt, ohne Bedingungen zu stellen oder Gegenleistungen zu erwarten. Dies mußauch die primäre Aufgabe aller katechetischen Bemühungen sein. Die Kirche darf ihre Anstrengungen um die Verkündigung der Frohen Botschaft nicht auf einige ausgewählte Menschen beschränken, sondern mußversuchen, auch den Menschen, die ihr aus wie auch immer gearteten Gründen fernstehen, nahezubringen, daß„Glauben gut tut“. Daßdies im Horizont der gegenwärtigen gesellschaftlichen und religionssoziologischen Entwick- lungen schwierig geworden ist, bleibt unbestritten. Um so wichtiger aber ist es, daßdie Kirche sich in ihren Methoden der Glaubensvermittlung auf den ‘postmodernen’ Men- schen einstellt. Dies hat nichts zu tun mit der Aufgabe ihrer Authentizität oder Identität, sondern steht in der Tradition des Apostels Paulus, der den Juden ein Jude, den Grie- chen ein Grieche geworden ist, nicht um seiner Sendung untreu zu werden, sondern gerade um seine Sendung zu erfüllen.426 Heute bedeutet es, daßwir uns damit abfinden müssen, daßviele Menschen nur noch sehr partiell am kirchlichen Leben teilnehmen möchten. Deshalb dürfen sie aber nicht ‘abgeschrieben’ werden. Die Funktion der Kirche in der Welt ist es, Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes zu den Menschen zu sein, und zwar nicht für einige wenige Berufene, sondern für alle Menschen. Diese ihre Aufgabe kann und soll sie auch durch eine Katechese wahrnehmen, die durch ein viel- gestaltiges Angebot versucht, ihre Berührungsfläche mit der Gesellschaft möglichst großzu halten. Wobei die Rückbesinnung auf die Einsicht der Urkirche,427 daßes Gott selbst ist, der die Menschen der Kirche zuführt,428 ihren Repräsentanten bei katecheti- schen Unternehmungen helfen kann, die nötige Gelassenheit zu entwickeln, um auch das ‘Scheitern’ ihrer Bemühungen im Sinne einer langfristigen Bindung der Katechu- menen an die Kirche aushalten zu können. Es kann nicht Aufgabe der Katechese sein, zu garantieren, daßdie enge Bindung möglichst vieler Menschen an die Kirche gelingt. Sondern die Kirche hat je in der Welt, in die sie gesandt ist, die jeweils geeigneten Strukturen zu schaffen, die es ermöglichen, daßdas, was sie zu sagen hat, eine mög- lichst große Anzahl von Menschen überhaupt erst erreicht. Da Christsein nicht „die Folge und das Ergebnis katechetischer Anstrengungen oder religiöser Erziehung“429 ist, sondern aus der freien Entscheidung des berufenen Menschen resultiert, erfüllt die Kirche ihre katechetische Aufgabe genau dann, wenn sie authentisch, offen und für jedermann vernehmbar das Evangelium von der unbedingten Liebe Gottes in die Welt spricht.
Die Ehe stellt einen besonders geeigneten Verknüpfungspunkt mit dem kirchenfernen und nichtkirchlichen Milieu dar, weil das Zusammenleben von Mann und Frau die Frage nach Grund und Ziel menschlicher Liebe je schon in sich trägt. Das Kerygma der Kirche kann und will gerade hier vom ‘orientierungslosen’ postmodernen Menschen als verheißungsvolle und sinngebende Botschaft wahrgenommen werden.
LITERATUR
Quellen:
II. VATICANISCHES KONZIL, Vollständige Ausgabe der Konzilsbeschlüsse, zusammen- gestellt von W.Kraemer, H.Reiring, B.Otto, Osnabrück 1966:
− Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium (SC)
− Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen Gentium (LG)
− Pastorale Konstitution über die Kirche in der Welt von heute Gaudium et Spes (GS)
GEMEINSAME SYNODE der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschlüsse der Vollversammlung, Offizielle Gesamtausgabe Bde. I+II, hg. v. L.Bertsch u.a. Frei- burg i.Br. 1976/1977:
− Beschluß: Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral, Bd. I, S. 238-275.
− Beschluß: Christlich gelebte Ehe und Familie, Bd. I, S. 423-457.
− Beschluß: Die pastoralen Dienste der Gemeinde, Bd. I, S. 597-636.
− Arbeitspapier: Das katechetische Wirken der Kirche, Bd. II, S. 37-97. (KW)
PAPST PAUL VI., Apostolisches Schreiben Humanae vitae, in: B.Häring/V.Schurr (Hgg.), Krise um Humanae vitae, (Text der Enzyklika in der bischöflich geneh- migten Übersetzung im Anhang), Frankfurt a.M. 1968.
PAPST JOHANNES PAUL II., Apostolisches Schreiben Catechesi Tradendae über die Katechese in unserer Zeit, 16. Oktober 1979, in: Sekretariat der Deutschen Bi- schofskonferenz (Hg.), Arbeitshilfen 66, 1998. (CT)
DERS., Familiaris Consortio, Apostolisches Schreiben über die Aufgaben der christli- chen Familie in der Welt von heute, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe- renz (Hg.), Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 33, 22. November 1981. (FC)
DERS., Codex Iuris Canonici, Codex des kanonischen Rechtes, lat.-dt. Ausgabe, heraus- gegeben im Auftrag der deutschen Bischofskonferenz u.a., Kevelaer 1994 4. (CIC 1983)
PÄPSTLICHER RAT FÜR DIE FAMILIE, Die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Verlautbarungen des aposto- lischen Stuhls 127, 13. Mai 1996.
SEKRETARIAT der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.):
− Orientierungsrahmen für die Ehe- und Familienpastoral, Arbeitshilfen 42, 26. August 1985.
− Sakramentenpastoral im Wandel. Überlegungen zur gegenwärtigen Praxis der Feier der Sakramente - am Beispiel von Taufe, Erstkommunion und Firmung, Die Deutschen Bischöfe - Pastoralkommission - 12, 3. korrigierte Auflage 1996.
− Katholische Kirche in Deutschland, Statistische Daten 1996; 1997; 1998.
− Ehe und Familie - in guter Gesellschaft, Die deutschen Bischöfe 61, 17. Januar 1999.
Literatur:
ALLENSBACHER INSTITUT für Demoskopie (Hg.), Allensbacher Jahrbuch der Demosko- pie 1978-83.
AUER, Johann/ RATZINGER, Josef, Kleine katholische Dogmatik, Bd. VII: Die Sakra- mente der Kirche, Regensburg 1972.
BAUER, Walter, Wörterbuch zum Neuen Testament, 6. völlig neu bearbeitete Auflage, hg. v. K. und B.Aland, Berlin u.a. 1988. (BAUER/ALAND)
BAUMANN, Urs, Die Ehe - ein Sakrament?, Zürich 1988.
DERS., Utopie Partnerschaft. Alte Leitbilder - neue Lebensformen, Düsseldorf 1994.
DERS., Art. ‘Ehe, Ehesakrament’: VI. Historisch-theologisch u. VII. Systematisch- theologisch, in: LThK, Bd. 3, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1995, Sp. 471- 474.
BECK, Ulrich, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt a.M. 1986.
DERS./BECK-GERNSHEIM, Elisabeth, Das ganz normale Chaos der Liebe, Frankfurt a. M. 1990.
BECK-GERNSHEIM, Elisabeth, Das halbierte Leben. Männerwelt Beruf Frauenwelt Fami- lie, Frankfurt a. M. 1990.
BEINERT, Wolfgang, Braucht Liebe (noch) die Ehe?, in: Ders. (Hg.), Braucht Liebe (noch) die Ehe?, Regensburg 1988, S. 115-146.
BELOK, Manfred, Zur Aufgabe und Chance kirchlicher Ehevorbereitung und - begleitung, in: LebKat 14 (1992), S. 236-241.
BIEMER, Günther, Art. ‘Katechese’, in: NHThG, Bd. 3, erweiterte Neuausgabe 1991.
BITTER, Gottfried, CSSP, Feiern des Neuen Lebens, Situationen - Erwartungen - Mög- lichkeiten des gegenwärtigen Sakramentenverständnisses, in: KatBl 107 (1982), S. 482-496.
DERS., Glaube und Symbol. Überlegungen zum religionspädagogischen Alltag, in: KatBl 109 (1984), S. 7-19.
DERS. Katechese. Entwicklungen und Aufgaben der Glaubensvermittlung, in: Pastoral- theologie 78 (1989), S. 495-518.
DERS., Von der Notwendigkeit der Erwachsenenkatechese heute, in: KatBl 116 (1991), S. 238-244.
BLASBERG-KUHNKE, Martina, Erwachsene glauben. Voraussetzungen und Bedingungen des Glaubens und Glaubenlernens im Horizont globaler Krisen, St. Ottilien 1992.
BÖCKLE, Franz, Geschlechterbeziehung und Liebesfähigkeit, in: Ders. u.a. (Hgg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd. 6, Freiburg i.Br. u.a. 1981, S. 109-153.
BOFF, Leonardo, Das Sakrament der Ehe, in: Concilium 9 (1973), S. 459-465.
DERS., Kleine Sakramentenlehre, Düsseldorf 19836.
BONS, Eberhard, Art. ‘Ehe, Ehesakrament’: IV. Im Alten Testament, in: LThK, Bd. 3, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1995, Sp. 469f.
BROER, Ingo, Art. ‘Ehe, Ehesakrament’: V. Im Neuen Testament, in: LThK, Bd. 3, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1995, Sp. 470f.
BUNDESMINISTERIUM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hg.):
− Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik, Lebensformen, Familienstruktu- ren, wirtschaftliche Situation der Familien und familiendemographische Entwick- lung in Deutschland, erstellt von Heribert Engstler, Bonn 1999.
− Familien und Familienpolitik im geeinten Deutschland - Zukunft des Humanver- mögens - Fünfter Familienbericht, Bonn 1995.
− Familie und Erziehung in Deutschland. Kritische Bestandsaufnahme der sozial- wissenschaftlichen Forschung, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Fami- lie, Senioren, Frauen und Jugend, Band 177, Stuttgart u.a. 1995.
BURKART, Günter, Die Entscheidung zur Elternschaft. Eine empirische Kritik von Individualisierungs- und Rational-Choice-Theorien. Stuttgart 1994.
DEGENHART, Johannes Joachim, Tradierungskrise des Glaubens, in: E.Feifel/ W.Kasper (Hgg.), Tradierungskrise des Glaubens, München 1987.
DEMEL, Sabine, Der Empfang des Ehesakramentes - bewußter Glaubensakt oder auto- matische Folge der Taufe? Zum Konzept einer Stufung des Ehesakramentes, INTAMS Review 5 (1999), S. 36-51.
DENZINGER, Heinrich, Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehr- entscheidungen, verbessert, erweitert, ins Deutsche übertragen und unter Mit- arbeit von Helmut Hoping hg. v. Peter Hünermann, Freiburg i.Br. u.a. 1991 37. (DH)
EBELING, Gerhard, Dogmatik des christlichen Glaubens III, Tübingen 1979.
EMEIS, Dieter, Ehekatechese als Lebenshilfe und Glaubenshilfe, in: KatBl 3 (1981), S. 89-94.
DERS., Des Lebens Ruf heißt Liebe. Liebe, Ehe, Partnerschaft, überarbeitete und er- gänzte Neuausgabe, Freiburg i.Br. 1988.
DERS., Sakramentenkatechese, Freiburg i.Br. 1991.
DERS., Zwischen Ausverkauf und Rigorismus. Zur Krise der Sakramentenpatoral, Frei- burg i.Br. 1993 4.
DERS., Mit den Sakramenten leben. Ein kleiner Katechismus, Freiburg i.Br. u.a. 1993.
EISENBACH, Franziskus, Einleitung zu Schwerpunkte heutiger Sakramentenpastoral, in: Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, Beschlüs- se der Vollversammlung, Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg i.Br. u.a. 1976, S. 227-238.
ENGLERT, Rudolf, Sakramente und Postmoderne - ein chancenreiches Verhältnis, in: KatBl 121 (1996), S. 155-163.
ERNST, Wilhelm, Ehe als Institution und ihre heutige Infragestellung, in: Communio 8 (1979), S. 393-414.
ESTOR, Marita, Art. ‘Arbeit’, in: A.Lissner u.a. (Hgg.), Frauenlexikon, Freiburg i.Br. u.a. 1988, S. 61-68.
EXELER, Adolf, Katechese im Blick auf die Kirche, in: K.Tillmann/G.Stachel (Hgg.), Katechese und Gesamtseelsorge, Würzburg 1966, S. 38-62.
DERS., Chancen des Miteinander - Ausblick in die Zukunft, in: KatBl 108 (1983), S. 781-791.
FEIFEL, Erich/KASPER, Walter, Tradierungskrise des Glaubens, München 1987.
FEIFEL, Erich, Katechese in der katholischen katechetischen Diskussion. Eine Problem- skizze, in: JRP 4 (1988), S. 100-117.
FIGURA, Michael, Christus und die Kirche - das große Geheimnis, Zur Sakramentalität der christlichen Ehe, in: Communio 26 (1997), S. 33-43.
FINKENZELLER, Josef, Die Lehre von den Sakramenten im Allgemeinen. Von der Schrift zur Scholastik, in: M.Schmaus u.a. (Hgg.), Handbuch der Dogmengeschichte, Bd. IV, Freiburg i.Br. u.a. 1980.
GABRIEL, Karl, Christentum zwischen Tradition und Postmoderne (QD 141), Freiburg i.Br. u.a. 1992.
GANOCZY, Alexandre, Einführung in die katholische Sakramentenlehre, Darmstadt 1979.
DERS., Art. ‘Sakrament’, in: NHThG, Bd. 5, erweiterte Neuausgabe 1991, S. 7-16.
GERHARDS, Albert, Stationen der Gottesbegegnung. Zur theologischen Bestimmung der Sakramentenfeiern, in: M.Klöckner/W.Glade (Hgg.), Die Feier der Sakramente in der Gemeinde, Festschrift für Heinrich Rennings, Kevelaer 1986, S. 17-30.
GNILKA, Joachim, Der Epheserbrief, Freiburg i.Br. u.a. 1971.
GRUBER, Hans-Günther, Christliche Ehe in moderner Gesellschaft. Entwicklung - Chancen - Perspektiven, Freiburg i.Br. 1994.
HAUSEN, Karin, Die „Frauenfrage“ war schon immer eine „Männerfrage“. Überlegun- gen zum historischen Ort von Familie in der Moderne, hg. v. Dieter Dowe, Ge- sprächskreis Geschichte, Heft 7, 1994.
HÖHN, Hans-Joachim, Gegen-Mythen. Religionsproduktive Tendenzen der Gegenwart (QD 154), Freiburg i.Br. u.a. 1994.
DERS., Sinnsuche und Erlebnismarkt, in: ThPQ 143 (1995), S. 361-71.
HOHEISEL, Karl, Art. ‘Ehe, Ehesakrament’: III. Religions- und kulturgeschichtlich, in: LThK, Bd. 3, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1995, Sp. 468f.
HONDRICH, Karl Otto, Zur Dialektik von Individualisierung und Rückbindung am Bei- spiel der Paarbeziehung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochen- zeitung Das Parlament, B53/98 (1998).
HÜNERMANN. Peter, Sakrament - Figur des Lebens, in: R.Schaeffler/P.Hünermann, Ankunft Gottes und Handeln des Menschen. Thesen über Kult und Sakrament, Freiburg i.Br., 1977, S. 51-87.
JELLOUSCHECK, Hans, Die Kunst als Paar zu leben, Stuttgart 1992.
KASPER, Walter, Zur Theologie der christlichen Ehe, Mainz 1977.
KAUFMANN, Franz-Xaver, Zur gesellschaftlichen Verfassung der Ehe - heute, in: F.Böckle u.a. (Hgg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Bd. 7, Freiburg i.Br. u.a. 1981, S. 44-59.
DERS. Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Perspektiven, Tübingen 1989.
DERS., Familie und Modernität, in: K.Lüscher u.a. (Hgg.), Die postmoderne Familie, Konstanzer Beiträge zur Sozialwissenschaft, Bd. 3, 1990 2, S. 391-415.
DERS. Zukunft der Familie im vereinten Deutschland. Gesellschaftliche und politische Bedingungen, Schriftenreihe des Bundeskanzleramtes 16, München 1995.
DERS., Die Zukunft der Familie im gesellschaftlichen Wandel, in: Interne Studien 168/1998, hg. v. der Konrad-Adenauer-Stiftung, St. Augustin 1998.
KIEFER, Thomas, Ehekatechese. Ein didaktisches Modell zur Ehevorbereitung und - begleitung (FThSt 156), Freiburg i.Br. 1994.
KINDLERs LITERATUR LEXIKON im dtv, Band 4, München 1986.
KLEINHEYER, Bruno u.a. Sakramentliche Feiern II, in: H.B.Meyer u.a. (Hgg.), Gottes- dienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft, Bd. 8, Regensburg 1984.
KÜHN, Ulrich, Sakramente, Handbuch Systematischer Theologie, Bd. 11, Gütersloh 1985.
LEHMANN, Karl, Die christliche Ehe als Sakrament, in: Communio 8 (1979), S. 384- 392.
DERS., Nichteheliche Lebensgemeinschaften und christliche Ehe. Der Fastenhirtenbrief des Bischofs von Mainz, in: HK 38 (1984), S. 171-175.
DERS. Überlegungen zu einigen Brennpunkten in der Ehepastoral, in: LebKat 3 (1981), S. 81-89.
LÜBBE, Hermann, Religion nach der Aufklärung. Vortrag 1978, in: W.Oelmüller u.a., Philosophische Arbeitsbücher 3, Diskurs: Religion, Paderborn u.a. 1979, S. 315- 333.
LUCKMANN, Thomas, Privatisierung und Individualisierung. Zur Sozialform der Religi- on in spätindustriellen Gesellschaften, in: K.Gabriel (Hg.), Religiöse Individuali- sierung oder Säkularisierung: Biographie und Gruppe als Bezugspunkte moderner Religiosität, Veröffentlichungen der Sektion Religionssoziologie in der DGS, Bd. 1, Gütersloh 1996, S. 17-28.
LÜDECKE, Norbert, Eheschließung als Bund. Genese und Exegese der Ehelehre der Konzilkonstitution „Gaudium et spes“ in kanonistischer Auswertung, Forschun- gen zur Kirchenrechtswissenschaft 7, 2. Bde., Würzburg 1988/89.
LÜDICKE, Klaus, Zur Rolle des Kirchenrechts in der Sakramentenpastoral, in: F.P.Tebartz-van Elst (Hg.), Katechese im Umbruch. Positionen und Perspektiven. Festschrift für Dieter Emeis, Freiburg i.Br. u.a. 1998, S. 209-221.
LUKESCH, Helmut, Ehe, nichteheliche Lebensgemeinschaft und Ehescheidung, in: W.Beinert (Hg.), Braucht Liebe (noch) die Ehe?, Regensburg 1988, S. 66-92.
LUTHER, Martin, Werke, Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883ff. (WA)
MANDEL, Karl Herbert, Psychologie und Therapie der Ehe im Spannungsfeld von Zeit- geist, Wissenschaft und Glauben, in: F.Böckle u.a. (Hgg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Teilband 7: Familie, Freiburg i.Br. u.a. 1981, S. 60-75.
MERKLEIN, Helmut, „Es gut für den Menschen, eine Frau nicht anzufassen“, Paulus und die Sexualität nach 1 Kor 7, in: Ders., Studien zu Jesus und Paulus (WUNT 43), Tübingen 1987, S. 385-408.
MEUFFELS, Hans Otmar, Kommunikative Sakramententheologie, Freiburg i.Br. u.a. 1995.
NAVE-HERZ, Rosemarie, Die Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland, hg. v. der Bundeszentrale für politische Bildung, 5. überarbeitete und ergänzte Auflage, Bonn 1997.
NOCKE, Franz-Josef, Sakramententheologie, Düsseldorf 1997.
DERS., Liebe, Tod und Auferstehung. Über die Mitte des Glaubens, 3. erweiterte Aufla- ge, München 1993.
OHST, Martin, Zur Geschichte der christlichen Eheauffassung von den Anfängen bis zur Reformation, in: ThR 61 (4/1996), S. 372-387.
PASCHKE, Monika, Ehevorbereitung in der Gemeinde, in: LebKat 14 (1992), S. 132- 135.
PAUS, Ansgar, Art. ‘Sakrament’: I. Religionsgeschichtlich, in: LThK, Bd. 9, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1999, Sp. 1437f.
POHLE, Lutz, Zwischen Verkündigung und Verrat. Zur Gewissenskrise des Priesters heute, in: GuL 60 (1987), S. 334-354.
RAHNER, Karl, Zur Theologie des Symbols, in: Schriften zur Theologie IV, Einsiedeln 1960, S. 275-311.
DERS., Intellektuelle Redlichkeit und christlicher Glaube, Schriften zur Theologie VII, Einsiedeln 1978, S. 54-76.
DERS., Kirche und Sakramente (QD 10), Freiburg i.Br. u.a. 1960.
DERS., Die Ehe als Sakrament, in: GuL 40 (1967), S. 177-193.
DERS., Was ist ein Sakrament?, StZ 188 (1971), S. 16-25.
DERS., Grundkurs des Glaubens, Einführung in den Begriff des Christentums, Freiburg i.Br. u.a. 1976.
RATZINGER, Josef, Die sakramentale Begründung christlicher Existenz, Meitingen 1966.
RIECKS, Brigitte, Das Ehesakrament. Die Liebe christlicher Ehegatten als Analogie göttlicher Liebe, Dissertation, München 1996.
RUH, Ulrich, Nicht voneinander lassen. Ein Blick auf das Verhältnis von Christentum und Moderne, in: EB 42 (1996), S. 7-10.
SCHILSON, Arno, Das Sakrament als Symbol, in: F.Böckle u.a. (Hgg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, Teilband 28, Freiburg i.Br. 1987, S. 122-150.
SCHMITT, Karl-Heinz, Sakramentenpastoral für Kirchendistanzierte, in: LebSel 35 (1984), S. 140-151.
DERS. Katechese im Schwung des Zweiten Vaticanums und der Würzburger Synode. Theologische Erinnerungen und praktische Konsequenzen - wieder die Resigna- tion, in: F.P.Tebartz-van Elst (Hg.), Katechese im Umbruch. Positionen und Per- spektiven, Festschrift für Dieter Emeis, Freiburg i.Br. 1998, S. 18-31.
SCHNEIDER, Robert, Schlafes Bruder, Leipzig 1996 7.
SCHNEIDER, Theodor, Zeichen der Nähe Gottes, Grundriss der Sakramententheologie, Mainz 1998 7.
SEIFERT, Elke, Tochter und Vater im Alten Testament, Eine ideologiekritische Untersu- chung zur Verfügungsgewalt von Vätern über ihre Töchter, Neukirchener Theo- logische Dissertationen und Habilitationen, Bd. 9, Neukirchen-Vluyn 1997.
STRÄTZ, Hans Wolfgang, Art. ‘Ehe, Ehesakrament’, VIII. Rechtshistorisch, in: LThK, Bd. 3, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1995, Sp. 479-482.
TILLICH, Paul, Symbol und Wirklichkeit, 3. ergänzte Auflage, Göttingen 1986.
TYRELL, Hartmann, Wandel im Stil der Intimbeziehung, in: Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesellschaft (Hg.), Nichteheliche Lebensgemeinschaften in der Bundesrepublik Deutschland, Schriftenreihe des Bundesministeriums für Ju- gend, Familie und Gesellschaft, Stuttgart u.a. 1985, S. 93-140.
VORGRIMLER, Herbert, Sakramententheologie, Düsseldorf 1987.
Ders., Art. ‘Sakrament’, III. Theologie- und dogmengeschichtlich, in: LThK Bd. 9, 3. völlig neu bearbeitete Auflage 1999, Sp. 1440-1445.
WACHINGER, Barbara und Lorenz, Art. ‘Ehe/Familie’, in: NHThG, Bd. 1, erweiterte Neuausgabe 1991, S. 7-16.
WENZ, Gunther, Art. ‘Sakrament’, in: TRE, Bd. 29, Berlin/New York 1998, S. 663-684. Wingen, Max, Einführung in die Thematik, in: S.Rupp u.a. (Hgg.), Eheschließung und Familienbildung heute, Wiesbaden 1980, S. 11-21.
ZIMMERMANN, Dietrich, Stufenweise Begleitung zum Sakrament der Ehe. Anregungen aufgrund von Erfahrungen mit dem „Ehekatechumenat“ in Frankreich, in: LebKat 3 (1981), S. 126-131.
[...]
1 Vgl. das Interview mit Ulrich BECK in der Zeit, Nr. 15, 06.04.2000, S. 33f.
2 Vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 58f.
3 Vgl. BEINERT, S. 123.
4 KAUFMANN, Verfassung, S. 45. Erst in den letzten hundert Jahren wurde es üblich, daßjeder gesunde Erwachsene eine Ehe einging (vgl. BEINERT, S. 124).
5 Auf frühere Eheformen, beispielsweise die germanische, die Ehe im Römischen Reichs oder des Mittelalters, wird hier nicht eingegangen, da dies m. E. zur Charakterisierung des neuzeitlichen Eheverständnisses nicht zwingend ist (vgl. dazu z.B. KIEFER, S. 25f).
6 GRUBER, S. 45.
7 Ebd., S. 47.
8 Ebd., S. 58.
9 ESTOR, Sp. 63.
10 KAUFMANN, Zukunft, S. 21.
11 Vgl. HAUSEN, S. 13.
12 Die ‘Alte Frauenbewegung’ setzte in Deutschland in den Vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts ein, obwohl die organisierte Frauenbewegung erst 1865 durch den formalen Zusammenschlußentstand. Die ‘Neue Frauenbewegung’ nahm ihren Ausgang von der Studentenbewegung der Jahre 1967/1968. Leider fehlt hier der Raum, auf die Frauenbewegung und ihre Wirkungen einzugehen (vgl. hierzu: NAVE-HERZ).
13 GRUBER, S. 48.
14 Ebd., S. 50.
15 Vgl. Kindlers Literaturlexikon, S. 2984f.
16 KAUFMANN, Zukunft, S. 22.
17 Ebd., S. 24.
18 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 40 [Beck].
19 RIEKS, S. 68.
20 BEINERT, S. 122.
21 Vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 58-64. Es mußan dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daßnichteheliche Lebensgemeinschaften statistisch nur schwer zu erfassen sind, so daßvon einer noch höheren ‘Dunkelziffer’ ausgegangen werden kann.
22 Ebd., S. 88-93.
23 KIEFER, S. 54.
24 TYRELL, S. 123.
25 Vgl. GRUBER, S. 65.
26 BAUMANN, Utopie, S. 41 (Hervorhebungen im Original).
27 WINGEN, S. 19.
28 BUNDESMINISTERIUM, Familienbericht, S. VI.
29 BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 32.
30 Ebd., S. 54-57.
31 Besonders in Ostdeutschland ist die Zahl der Eheschließenden, die bereits gemeinsame Kinder haben, mit 24,4% im Jahre 1996 relativ hoch (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 83).
32 Vgl. KAUFMANN, Modernität, S. 395.
33 65% der geschiedenen Frauen und 58% der geschiedenen Männer in den alten Bundesländern heiraten erneut, in den neuen Bundesländern liegt die Wiederverheiratungsquote bei Männern und Frauen bei 53% (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 87).
34 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 226 (Hervorhebung im Original)[Beck].
35 Auf die Kritik an Beck wird hier nicht eingegangen, da m.E. das Individualisierungstheorem trotz einiger sicher berechtigter Kritikpunkte (vgl. dazu z.B. die Diskussion zwischen BECK/BECK-GERNSHEIM und Günther BURKART in: Zeitschrift für Soziologie 3 (1993), S. 159-177; 178-187; 188-199, sowie BURKART, 1994) geeignet erscheint, die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte zu be- schreiben.
36 Vgl. HONDRICH, S. 3.
37 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 12 [Beck].
38 BECK, Risikogesellschaft, S. 206 (Hervorhebungen im Original).
39 Vgl. EMEIS, Ausverkauf, S. 15.
40 Vgl. BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 13 [Beck].
41 Vgl. GRUBER, S. 74.
42 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 67 [Beck-Gernsheim].
43 Ebd., S. 14[Beck].
44 LÜKEN, S. 507.
45 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 15 [Beck].
46 Ebd., S. 16.
47 KIEFER, S. 34.
48 GRUBER, S. 52.
49 Ebd., S. 53.
50 SCHIERSMANN, S. 96.
51 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 34 [Beck].
52 Ebd., S. 117.
53 BECK/BECK-GERNSHEIM, Risikogesellschaft, S. 162 [Beck].
54 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 35 [Beck].
55 Ebd., S. 89 [Beck-Gernsheim].
56 1996 waren in Deutschland zwei Drittel aller Mütter mit Kindern über sechs Jahren erwerbstätig (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 110).
57 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 75 [Beck-Gernsheim].
58 BECK-GERNSHEIM, Leben, S. 248.
59 WACHINGER, S. 322.
60 Vgl. hierzu z.B. KAUFMANN, Familie, S. 57-60.
61 Der Anteil kinderloser Ehen, der seit ca. 1965 bis zu den in der Mitte der 70er Jahre geschlossenen Ehen gestiegen war, ist inzwischen wieder kleiner geworden: von den 1990 geschlossenen Ehen hatten 1996 nur 24% noch keine Kinder. Dies bedeutet einen Rückgang der Kinderlosenquote von Ehen um 8 Prozentpunkte gegenüber 1975 (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 107).
62 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 137 [Beck-Gernsheim].
63 GRUBER, S. 55.
64 Vgl. ebd., S. 56ff.
65 Im 19. Jahrhundert ging mit dieser Entwicklung auch eine Aufwertung der Mutterrolle einher, derweil die Rolle des Vaters auf die des ‘Familienernährers’ reduziert wurde - die extreme Emotionalisierung auch der Beziehung des Vaters zum Kind ist eine Erscheinung der vergangenen Jahrzehnte (vgl. ebd., S. 58f).
66 Nicht zuletzt deshalb steigt auch das Alter der Erstgebärenden stetig an - es lag 1996 im Durchschnitt bei 28,4 (alte Bundesländer) bzw. 27,3 (neue Bundesländer) Jahren (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 101) - obwohl hier natürlich auch andere Faktoren (z.B. verlängerte Ausbildungszeiten) in Betracht gezogen werden müssen.
67 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 139 [Beck-Gernsheim].
68 Ebd., S. 141.
69 Vgl. BUNDESMINISTERIUM, Erziehung, S. 56.
70 Diese historisch einmalige Emotionalisierung der Beziehung zum Kind ist neben der hohen wirtschaft- lichen Belastung, die Kinder heute darstellen, auch ein Grund für den Rückgang der Kinderzahl. Wo die Beziehung zum einzelnen Kind einen derartig hohen Stellenwert erhält, wird die Kinderzahl beschränkt, um sich verstärkt dem einzelnen Kind widmen zu können. Allerdings läßt sich an den (insgesamt rück- läufigen) Geburtenziffern der letzten Jahre kein Trend zur Ein-Kind-Familie ablesen, sondern daßim Gegenteil die Paare, die sich für Kinder entscheiden, wieder häufiger zwei oder mehr Kinder haben (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 94f).
71 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 182 [Beck-Gernsheim].
72 Vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 83.
73 BAUMANN, Utopie. S. 30.
74 Ebd., S. 32.
75 Ebd.
76 Ebd., S. 91.
77 Vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 91.
78 Vgl. KIEFER, S. 50-53.
79 1996 waren 43,3% der Mütter mit Kindern zwischen sechs und vierzehn Jahren bei einer Wochenarbeitszeit von unter 36 Stunden erwerbstätig (vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 114).
80 KIEFER, S. 52.
81 BAUMANN, Utopie, S. 35.
82 Vgl. BEINERT, S. 130.
83 Vgl. BUNDESMINISTERIUM, Statistik, S. 92.
84 Vgl. BEINERT, S. 128f.
85 SCHNEIDER, S. 204.
86 PESCH, S. 236.
87 Vgl. NOCKE, Liebe, S. 44.
88 RAHNER, Ehe, S. 181.
89 BOFF, S. 461.
90 EMEIS, Katechismus, S. 93.
91 NOCKE, Liebe, S. 45.
92 Ebd., S. 159.
93 JELLOUSCHECK, S. 133.
94 Ebd., S. 134.
95 BAUMANN, Utopie, S. 77.
96 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 233 [Beck].
97 JELLOUSCHECK, S. 138.
98 BECK/BECK-GERNSHEIM, Chaos, S. 238 [Beck].
99 BAUMANN, Utopie, S. 49.
100 Ebd., S. 70.
101 Ebd., S. 89.
102 MANDEL, S. 69.
103 BAUMANN, Utopie, S. 93.
104 Vgl. ebd., S. 94.
105 Auf die Darstellung von Liebe in den Medien, insbesondere den visuellen, kann hier nicht weiter eingegangen werden. Es ist aber in diesem Zusammenhang durchaus bedenkenswert, daßsich sowohl die berühmten ‘Hollywood-Schnulzen’ als auch Fernsehproduktionen vom Schlage der ‘Traumhochzeit’ oder ‘Nur die Liebe zählt’ (beide RTL) vor einem gesellschaftlichen Hintergrund, der in krassem Gegen- satz zu dem hier dargestellten Liebesideal zu stehen scheint, weiterhin großer Beliebtheit erfreuen.
106 BAUMANN, Utopie, S. 93.
107 SEKRETARIAT, Sakramentenpastoral im Wandel, S. 5.
108 Die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche ist in den letzten 40 Jahren insgesamt angestiegen. Höhepunkte dieser phasenweise verlaufenden Entwicklung waren die Jahre 1974/75 und nach 1990. In den Jahren 1996/97 war ein leichter Rückgang der Austritte zu verzeichnen, doch blieb die Zahl mit 123 813 ausgetretenen Katholiken im Jahre 1997 auf einem sehr hohen Niveau (vgl. SEKRETARIAT, Statisti- sche Daten 1997, S. 14ff).
109 Vgl. SEKRETARIAT, Statistische Daten 1997, S. 17f.
110 Waren im Jahre 1965 noch 93,3% der katholischen Eheschließungen Trauungen von zwei katholischen Partnern, so waren es im Jahre 1994 noch 63% (vgl. SEKRETARIAT, Statistische Daten 1995).
111 POHLE, Gewissenskrise, S. 343.
112 GABRIEL, S. 124.
113 HÖHN, Gegen-Mythen, S. 19.
114 GABRIEL, S. 193.
115 RUH, S. 7.
116 GABRIEL, S. 194.
117 Ebd., S. 195.
118 Vgl. den Aufsatztitel von HÖHN, Sinnsuche.
119 GABRIEL, S. 170.
120 Ebd., S. 144.
121 Vgl. FEIFEL/KASPER.
122 DEGENHART, S. 11.
123 KAUFMANN, Religion, S. 223 (Hervorhebung im Original).
124 Vgl. BLASBERG-KUHNKE, S. 27.
125 Vgl. KAUFMANN, Religion, S. 225.
126 Vgl. EXELER, Chancen, S. 782.
127 GABRIEL, S. 150.
128 Ebd., S. 156.
129 Vgl. ebd., S. 179-192.
130 Ebd., S. 183.
131 POHLE, Gewissenskrise, S. 339.
132 Auf die Geschichte der modernen Weltauffassung, die ihre Wurzeln bereits in der Aufklärung hatte und sich, wenn auch nicht kontinuierlich (man denke etwa an die Romantik als Gegenbewegung zu aufklärerischen Tendenzen), bis heute fortentwickelt hat, kann hier nicht eingegangen werden, da ein Durchzug durch die europäische Geistesgeschichte der letzten vier Jahrhunderte den Rahmen dieser Arbeit um ein Vielfaches übersteigen würde.
133 HÖHN, Gegen-Mythen, S. 31.
134 BECK, Risikogesellschaft, S. 68.
135 Vgl. GABRIEL, S. 158.
136 HÖHN, ebd., S. 32.
137 GABRIEL, S. 158.
138 Ebd., S. 159.
139 RUH, S. 9.
140 LUCKMANN, S. 18.
141 Die soziologische Definition von Religion als ‘Kontingenzbewältigungspraxis’ geht zurück auf den Soziologen Hermann Lübbe, der damit im Rückgriff auf den Kontingenzbegriff Niklas Luhmanns „diejenige Funktion der Religion“ benannt haben will, „die sowohl aufklärungs- wie auch säkularisierungsresistent ist.“ (LÜBBE, S. 324, vgl. auch Niklas Luhmann, Funktion der Religion, Frankfurt 1977).
142 Vgl. BITTER, Katechese, S. 505.
143 Vgl. EMEIS, Ausverkauf, S. 10ff.
144 Ebd., S. 38.
145 GANOCZY, S. 5.
146 Ebd.
147 Vgl. ebd., S. 6.
148 PAUS, Sp. 1438.
149 GANOCZY, S. 7.
150 Vgl. NOCKE, S. 53.
151 GANOCZY, S. 7.
152 Außer in den Schriften aus hellenistsicher Zeit kommt musth/rion im Alten Testament überhaupt nicht vor, was auf gewisse Vorbehalte gegenüber diesem Begriff schließen läßt, deren Erörterung hier jedoch zu weit führen würde (vgl. FINKENZELLER, S. 8).
153 GANOCZY, Sakrament, S. 7.
154 Ebd.
155 GANOCZY, S. 9.
156 NOCKE, S. 45.
157 Vgl. dazu: FINKENZELLER, S. 8.
158 In den Evangelien findet sich der Begriff des musth/rion nur ein einziges Mal und zwar an der Stelle, als Jesus den Jüngern auf die Frage nach dem Sinn der Gleichnisse antwortet (Mk 4,11 parr). Er ist hier eindeutig eschatologisch akzentuiert: den Jüngern ist, im Gegensatz zu allen anderen, bei denen die Gleichnisrede zur Verstockung führt, das Geheimnis des Gottesreiches gegeben, „d.h. das gläubige Wissen um die endzeitliche Gnade der basile/ia“, die im Christusereignis ihren Anfang nimmt (Ganoczy, S. 8).
159 Röm 11,25; 16,25; 1Kor2,1.7; 4,1; 13,2; 14,2; 15,51; Eph 1,9; 3,3.4.9; 5,32; 6,19; Kol 1,26.27; 2,2; 4,3. Vgl. Artikel musth/rion, in BAUER/ALAND, Sp. 1073f.
160 GANOCZY, S. 9.
161 VORGRIMLER, S. 58.
162 Ebd., S. 59.
163 GANOCZY, S. 11.
164 Vgl. ebd.
165 Vgl. ebd., S. 12.
166 Dieser berechtigte ihn, als „Geweihter des Kriegshandwerkes“ Feinde zu töten, und beinhaltete zudem eine religiöse „Selbstverfluchung od. Selbstverwünschung, durch die er den zerstörerischen Todesmäch- ten für den Fall des Eidbruchs verfallen war. Damit gewann die römische Rechtspraxis den rel. Charakter der uneingeschränkten Bindung und Weihe (devotio) an die göttl. unterird. Mächte, an die gefolgschaft- lich organisierte sancta militia des jeweiligen Kultgottes u. an die Dienstleistungen für ihn (vgl. PAUS, Sp. 1437f).
167 Vgl. VORGRIMLER, S. 59.
168 Vgl. VORGRIMLER, Sakrament, Sp. 1440.
169 NOCKE, S. 54.
170 VORGRIMLER, S. 65.
171 GANOCZY, S. 16.
172 VORGRIMLER, S. 65.
173 AUGUSTIN, Tractatus in Joanis evangelium, 80,3.
174 VORGRIMLER, S. 65f.
175 Vgl. NOCKE, S. 55.
176 Vgl. GANOCZY, S. 18f.
177 Ebd., S. 68.
178 Ebd., S. 19.
179 VORGRIMLER, S. 67.
180 Ebd., S. 68f.
181 Vgl. THOMAS VON AQUIN, S.th.,p.III,q.60,ad 2.
182 FINKENZELLER, S. 143 (eigene Hervorhebung).
183 NOCKE, S. 59f.
184 GANOCZY, S. 20.
185 Bereits 1274 äußerte sich das Konzil von Lyon affirmierend zur Siebenzahl der Sakramente.
186 DH 1310.
187 VORGRIMLER, S. 71.
188 WA 6, 497-573.
189 Vgl. KÜHN, S. 67.
190 Ebd., S. 68. (Hervorhebungen im Original). Genau jenes sichtbare Zeichen fehlt bei der Buße.
191 KÜHN, S. 71.
192 Vgl. VORGRIMLER, S. 72.
193 Vgl. DH 1600-1630.
194 Vgl. DH 1612; 1617.
195 Vgl. DH 1609.
196 Vgl. DH 1601.
197 Vgl. ebd.
198 Vgl. DH 1606.
199 VORGRIMLER, S. 77.
200 Vgl. DH 1603; 1639.
201 GANOCZY, S. 43.
202 Vgl. DH 1524; 1543.
203 VORGRIMLER, S. 79.
204 Vgl. GANOCZY, S. 27.
205 NOCKE, S. 67.
206 Vgl. GERHARDS, S. 21.
207 Vgl. Dei Verbum.
208 GANOCZY, Sakrament, S. 14.
209 VORGRIMLER, S. 81.
210 MEUFFELS, S. 7 (Hervorhebung im Original).
211 Vgl. RAHNER, Kirche, S. 46.
212 Vgl. den Buchtitel von SCHNEIDER.
213 VORGRIMLER, S. 17.
214 Ebd., S. 18.
215 SCHNEIDER, S. 16.
216 Obwohl sich in jüngster Zeit, nicht zuletzt gefördert durch die Massenmedien, eine neue Offenheit für symbolisches Denken herauszukristallisieren scheint (vgl. z.B. ENGLERT, S. 158-161).
217 NOCKE, S. 69.
218 Ebd., S. 68 (im Original hervorgehoben).
219 BITTER, Glaube, S. 10.
220 Vgl. RATZINGER, S. 7-13.
221 SCHNEIDER, S. 10 (im Original hervorgehoben).
222 BOFF, Ehe, S. 460.
223 VORGRIMLER, S. 86.
224 Vgl. SCHNEIDER, S. 7.
225 Vgl. TILLICH, S. 3.
226 Ebd.
227 BITTER, Glaube, S. 10.
228 Vgl TILLICH, S. 4f.
229 RAHNER, Symbol, S. 278.
230 Ebd., S. 285.
231 Ebd., S. 290.
232 SCHNEIDER, S. 10.
233 VORGRIMLER, S. 22.
234 Vgl. ebd., S. 24.
235 SCHNEIDER, S. 13.
236 RAHNER, Symbol, S. 294.
237 Vgl. DH 301.
238 RAHNER, Kirche, S. 15.
239 Ebd., S. 14.
240 Vgl. VORGRIMLER, S. 46.
241 RAHNER, Grundkurs, S. 397.
242 NOCKE, S. 80.
243 Vgl. VORGRIMLER, S. 49.
244 Ebd., S. 55.
245 RAHNER, Kirche, S. 68.
246 RAHNER, Grundkurs, S. 399.
247 RIEKS, S. 46.
248 GEMEINSAME SYNODE, Sakramentenpastoral, Teil A, S. 241.
249 Ebd.
250 EMEIS, Sakramentenkatechese, S. 61.
251 VORGRIMLER, S. 112.
252 Vgl. SCHNEIDER, S. 40.
253 VORGRIMLER, S. 57.
254 Vgl. EISENBACH, S. 231.
255 GERHARDS, S. 25.
256 BOFF, Sakramentenlehre, S. 102.
257 NOCKE, S. 78.
258 Ebd., S. 77.
259 EMEIS, Sakramentenkatechese, S. 55.
260 BITTER, Glaube, S. 10.
261 Vgl. RAHNER, Sakrament, S. 20.
262 NOCKE, S. 71.
263 EBELING, S. 296.
264 VORGRIMLER, S. 96.
265 RAHNER, Sakrament, S. 18.
266 KÜHN, S. 218.
267 Ebd., S. 219.
268 VORGRIMLER, S. 97.
269 Vgl. RAHNER, Sakrament, S. 16.
270 Vgl. GANOCZY, Sakrament, S. 15.
271 BITTER, Feiern, S. 487.
272 GANONCZY, S. 108.
273 Ebd.
274 Vgl. ebd., S. 110f.
275 Ebd., S. 111.
276 Ebd., S. 116.
277 Ebd.
278 Ebd., S. 131.
279 Ebd., S. 135.
280 HÜNERMANN, S. 55.
281 SCHILSON, S. 137.
282 MEUFFELS, S. 72.
283 Ebd., S. 336.
284 BITTER, Feiern, S. 487.
285 Vgl. KASPER, S. 13ff.
286 Die Monogamie ist ja, wenn auch die menschheitsgeschichtlich vorherrschende, so doch keinesfalls die einzige Form von Ehe, zumal selbst in an sich monogamen Kulturen für Begüterte und Einflußreiche häufig die Polygamie zulässig war, wobei die Polygynie wesentlich stärker verbreitet war als die Polyandrie (vgl. HOHEISEL, Sp. 468f).
287 Ebd., Sp. 469.
288 In Gen 24,60 und Tob 11,17 finden sich allerdings Segenssprüche der Eltern über die Braut oder das Brautpaar.
289 SEIFERT, S. 205.
290 BONS, Sp. 470.
291 Vgl. BROER, Sp. 470.
292 FIGURA, S. 35.
293 Ebd., vgl. auch KASPER, S. 38.
294 Die sogenannte ‘Unzuchtsklausel’ in Mt 5,32, die die Ehescheidung im Falle von ‘Unzucht’ (por- nei/a - in der Einheitsübersetzung nicht unproblematisch mit Ehebruch übersetzt) hat eine sehr bewegte Auslegungsgeschichte erfahren; Hieronymus und Augustin übersetzten ‘Ehebruch’, die Väter mit Ausnahme von Ambrosiaster interpretierten dahingehend, daßmit ‘Scheidung’ hier lediglich eine Trennung von Tisch und Bett gemeint sei. Ott und Staab versuchten, die Stelle mit „nicht einmal im Falle von Ehebruch“ zu übersetzen. Vorgrimler weist darauf hin, daßpornei/a hier auch ‘Götzendienst’, vermutlich im Sinne von Sakralprostitution bedeuten, könne. Vielfach wurde aber auch angenommen, daßes sich bei der Unzuchtsklausel um einen Zusatz des Evangelisten handelt, mit dem er ein Zuge- ständnis an seine judenchristlichen Leser macht (vgl. AUER/RATZINGER, S. 256).
295 KASPER, S. 38.
296 Vgl. ebd., S. 38f.
297 Vgl. dazu: GNILKA, S. 290ff, siehe auch Offb 21,2.
298 Ein großes Problem der Exegese dieser Stelle liegt darin, daßder Verfasser hier mit den Analogien Christus/Mann und Kirche/Frau arbeitet. Nur dem Mann wird die bedingungslose Liebe anbefohlen, die Frau hingegen soll sich unterordnen (V 22). Ein solches Verständnis von der Liebe zwischen Mann und Frau darf für unseren Kulturkreis als überwunden betrachtet werden. Aber: kann man den Epheserbrief ohne weiteres aus seinem kulturgeschichtlichen Umfeld herauslösen, ohne seine ursprüngliche Aussage zu beschädigen? (Vgl. hierzu: BAUMANN, Ehe, S. 150-157).
299 GNILKA, S. 289.
300 Bereits das Tridentinum war sich jedoch bewußt, daßdie Sakramentalität der Ehe hier allenfalls „angedeutet“ (inuit) werde (DH 1799).
301 KASPER, S. 40.
302 Vgl. DH 1810.
303 Zur Exegese des Korintherbriefes, vgl. MERKLEIN.
304 Vgl. VORGRIMLER, S. 318f.
305 Vgl. hierzu: KLEINHEYER, S. 77-80.
306 Vgl. OHST, S. 374.
307 Vgl. SCHNEIDER, S. 289.
308 VORGRIMLER, S. 321.
309 STRÄTZ, Sp. 479.
310 Vgl. NOCKE, S. 263f.
311 AUGUSTIN, De civitate Dei., XIV,16.
312 AUGUSTIN, De Genesi ad litteram, 9,7 12. Ab dem 16. Jahrhundert wurden diese Güter als Wesensbestandteile (‘Wesensgüter’) der Ehe verstanden.
313 Vgl. can. 1061 § 1 CIC 1983.
314 Vgl. NOCKE, S. 264f.
315 VORGRIMLER, S. 322.
316 Vgl. NOCKE, S. 266.
317 Ebd., S. 267. Entsprechend fehlt auch im Armenierdekret des Konzils von Florenz bei der Ehe als einzigem der sieben Sakramente die Angabe seiner Wirkung! (vgl. DH 1327).
318 WA 10 II, S. 302.
319 N.B.: Luther unterscheidet mit dem ‘Reich Christi’ und dem ‘Reich der Welt’ zwei verschiedene Herrschaftsweisen Gottes, d.h. daßdie Ehe als „weltlich Ding“ nicht etwa außerhalb des göttlichen
320 Vgl. DH 1799f.
321 Vgl. DH 1801; 1803f.
322 Vgl. DH 1805.
323 NOCKE, S. 268.
324 Vgl. DH 1813-1816.
325 Vgl. BAUMANN, LThK 3, Sp. 473.
326 Vgl. die Enzyklika Arcanum Divinae Sapientiae Leos des XIII. von 1880, die zur Grundlage für den CIC von 1917/18 wurde.
327 Auctorem Fidei (1796), Arcanum Divinae Sapientiae (1880); Lamentabili (1907); Casti Conubii (1930).
328 Vgl. RIEKS, S. 141.
329 Vgl. BAUMANN, LThK 3, Sp. 474.
330 BAUMANN, Utopie, S. 96.
331 RIEKS, S. 205.
332 GRUBER, S. 137.
333 VORGRIMLER, S. 331.
334 Vgl. GRUBER, S. 143.
335 SCHNEIDER, S. 294f.
336 Vgl. LEHMANN, Ehepastoral, S. 87.
337 GRUBER, S. 186.
338 Vgl. ebd., S. 203, vgl. dazu auch NOCKE, Liebe, S. 40ff.
339 BAUMANN, Ehe, S. 111.
340 Vgl. GRUBER, S. 210.
341 Zum Einflußvon Gaudium et Spes auf das Kirchenrecht vgl. die umfassende Darstellung bei LÜDE- CKE.
342 Zur Kritik des Vertragsbegriffs als Zentralkategorie des altkodikarischen Eherechts vgl. ebd., S. 79-92.
343 Vgl. hierzu VORGRIMLER, S. 333.
344 DEMEL, S. 38.
345 Auf die genauen Voraussetzungen der Ehefähigkeit, die der Codex ausführlich darlegt, [z.B. Fehlen eines Hinderungsgrundes vgl. Ehehindernisse (can. 1073 und 1083-1094); Mindestwissen (can. 1096), Freiheit von Zwang (can. 1103), psychische Gesundheit (can. 1095) etc.] braucht in diesem Zusammenhang nicht eingegangen zu werden.
346 Vgl. BAUMANN, Ehe, S. 117.
347 Vgl. LÜDICKE, S. 211f.
348 Von Interesse wäre eventuell noch eine Sichtung der kirchenrechtliche Regelungen für die Ehen von Katholiken mit Partnern anderer Konfession (can. 1124), mit Ungetauften (can. 1186; 1129) oder mit ausgetretenen Katholiken (can. 1117) gewesen, doch würde dies den Rahmen dieser kurzen Betrachtung über die Problematik des kirchlichen Eherechtes sprengen.
349 GEMEINSAME SYNODE, Ehe, 1.2.1.1.
350 BOFF, Ehe, S. 461.
351 RIEKS, S. 203.
352 RAHNER, Ehe, S. 181.
353 NOCKE. Liebe, S. 45.
354 BOFF, Ehe, S.461.
355 Vgl. BÖCKLE, S. 143.
356 NOCKE, S. 271.
357 LEHMANN, S. 389.
358 SCHNEIDER, S. 283. Die Auffassung vom ehelichen Leben als Sakrament ist nicht unumstritten, da z.T. geltend gemacht wird, daßmit einer solchen Sicht die Sakramentenspendung zu einer ‘Sakramentale’ verkomme (vgl. KIEFER, S. 157ff). M.E. ist es jedoch, ohne die Sakramentalität des Eheschlußes zu verwässern, möglich, von der Ehe als einem ‘Dauersakrament’ zu sprechen, das mit der Eheschließung seinen Anfang nimmt und seine sakramentale Zeichenhaftigkeit in der Ehe behält.
359 Vgl. NOCKE, S. 271.
360 Vgl. SCHNEIDER, S. 296.
361 RAHNER, Grundkurs, S. 403.
362 Vgl. RAHNER, Ehe, S. 178.
363 Ebd., S. 184 (Hervorhebungen im Original).
364 SEKRETARIAT, Ehe und Familie, S. 23.
365 Vgl. KAUFMANN, Modernität, S. 394f.
366 LEHMANN, Fastenhirtenbrief, S. 173.
367 GEMEINSAME SYNODE, Ehe, 1.2.2.1., S. 427.
368 Vgl. SCHNEIDER, S. 299f.
369 Irrtum in der Person (can. 1097), arglistige Täuschung (can. 1098), Ausschlußeiner Wesenseigenschaft der Ehe (can. 1101 §2), Eheschließung in Folge von Zwang (can. 1103).
370 ERNST, S. 396.
371 Vgl. VORGRIMLER, S. 336.
372 SCHNEIDER, S. 299f.
373 Vgl. EMEIS, Katechismus, S. 102.
374 Familiaris Consortio, 84, vgl. auch: GEMEINSAME SYNODE, Ehe, 3.4.1.3; 3.4.2.3f.
375 BIEMER, S. 82.
376 Vgl. hierzu: FEIFEL, S. 99-104.
377 Vgl. BLASBERG-KUHNKE, S. 10.
378 Diese Sicht mag in volkskirchlicher Zeit eine gewisse Berechtigung gehabt haben, da man hier noch davon ausgehen konnte, daß, wer einmal katholisch sozialisiert war auch für den Rest seines Lebens der katholischen Kirche verbunden blieb, da durch die soziale Kontrolle eine Abwendung vom Glauben, die auch nach außen hin sichtbar gemacht worden wäre, erschwert wurde. Sie wird aber in keinster Weise der Tatsache gerecht, daßGlauben nicht statisch ist, sondern Glaubensgeschichte immer prozessualen Charakter hat (vgl. BISER, S. 173).
379 Gaben 1967 immerhin noch 39% der befragten Eltern eine feste religiöse Bindung als Erziehungsziel an, so waren es 1983 nur noch 27% (vgl. ALLENSBACHER INSTITUT, S. 93).
380 KIEFER, S. 16 (eigene Hervorhebung).
381 SEKRETARIAT, Sakramentenpastoral im Wandel, S. 27.
382 BITTER, Katechese, S. 507.
383 Ebd., S. 516.
384 BISER, S. 177-199.
385 BITTER, Katechese, S. 510.
386 RAHNER, Redlichkeit, S. 68.
387 Vgl. BITTER, Glauben-Lernen, S. 920f.
388 EMEIS, Ausverkauf, S. 117.
389 Ebd., S. 118.
390 Vgl. SEKRETARIAT, Statistische Daten 1997, S. 11.
391 Ebd.
392 EMEIS, Ausverkauf, S. 52f.
393 Vgl. ebd., S. 50.
394 SCHMITT, S. 146.
395 Ebd., S. 147.
396 EMEIS, Ausverkauf, S. 119.
397 ZIMMERMANN, S. 128.
398 Vgl. KASPER, S. 90f.
399 ZIMMERMANN, S. 129 (vgl. cc. 1161-1165 CIC 1983; speziell: wg. Formmangels ungültige Ehe, can. 1163 §1).
400 SCHMITT, S. 150.
401 Vgl. die Vorschriften in can. 1063, besonders 4°.
402 So sind zum Beispiel die Ehen von ‘Scheidungskindern’, obwohl (oder weil?) diese sich zumeist bezüglich des Gelingens ihrer Ehe unter besonders hohen ‘Erfolgsdruck’ setzen, in signifikant höherem Maße von Scheidungen betroffen als Ehen von Kindern, deren Eltern zusammengeblieben sind. Vgl. LUKESCH, S. 84.
403 Vgl. KIEFER, S. 21.
404 Ebd.
405 Falls es eine solche denn überhaupt gegeben hat, denn da heute ein Großteil der Paare bereits vor der Eheschließung zusammenlebt, ist die Verlobung weitgehend aus der Mode gekommen bzw. hat eine völlig andere Bedeutung als zu früheren Zeiten.
406 EMEIS, Ehekatechese, S. 90 (im Original hervorgehoben).
407 Ebd.
408 SCHMITT, Katechese, S. 20.
409 Solche projektorientierte Arbeit ist ja keineswegs neu, sie wird z.T. im Kommunions- und Firmunterricht schon angewandt. Die Erfahrungen aus der katholischen Erwachsenenbildung lehren, daßsolche Angebote auch von Kirchenfernen wahr- und angenommen werden.
410 SEKRETARIAT, Ehe- und Familienpastoral , S. 5 .
411 EMEIS, Liebe, S. 91.
412 EXELER, Katechese, S. 43.
413 BITTER, Katechese, S. 507.
414 Vgl. GEMEINSAME SYNODE, Dienste, 1.3.2.
415 EMEIS, Ausverkauf, S. 69 (Hervorhebung im Original).
416 SCHMITT, S. 143.
417 PASCHKE, S. 134.
418 BELOK, S. 239.
419 Ich bin mir darüber im Klaren, daßes meist die Brautleute sind, die z.T. mit abstrusesten Vorstellun- gen zum Pfarrer kommen. Hier hat der Pfarrer freundlich, aber bestimmt klarzustellen, was möglich ist und was nicht.
420 SEKRETARIAT, Ehe- und Familienpastoral, S. 6.
421 BITTER, Erwachsenenkatechese, S. 243.
422 PASCHKE, S. 135.
423 SCHMITT, Katechese, S. 23.
424 Ebd.
425 Ebd., S. 27.
426 Vgl. 1 Kor 9, 19-23.
427 Die sich in einem wesentlich ‘kirchenferneren’ Umfeld befand als wir heute!
428 Vgl. Act 2,47b „Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten.“
Häufig gestellte Fragen zum Thema "INHALT"
Was ist der zentrale Gegenstand dieser Analyse?
Diese Analyse beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten der Ehe in der heutigen Zeit, der Rolle der Kirche in der Postmoderne und der Bedeutung des Ehesakraments. Sie untersucht, wie sich gesellschaftliche Veränderungen auf Ehe und Partnerschaft auswirken und wie die Kirche auf diese Veränderungen reagieren kann.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Themen: Einleitung, die Situation der Ehe heute, die Kirche in der Postmoderne, allgemeine Sakramentenlehre, das Sakrament der christlichen Ehe und Ehekatechese. Jedes dieser Themen wird in Unterkapiteln weiter detailliert.
Welche gesellschaftlichen Veränderungen beeinflussen die heutige Ehe?
Die Analyse nennt mehrere Faktoren: Die Individualisierung der Biographie, die Intimisierung und Privatisierung der Paarbeziehung, die gewandelte Stellung der Frau, die neue Einstellung zum Kind und Veränderungen im Lebenszyklus.
Wie hat sich das Eheverständnis im Laufe der Zeit verändert?
Früher war die Ehe oft eine Produktionsgemeinschaft mit klaren Rollenverteilungen, die auf ökonomischen oder dynastischen Gründen basierte. Heute wird die Ehe idealerweise als eine Partnerschaft von Gleichberechtigten auf der Basis von Liebe und emotionaler Verbundenheit betrachtet.
Was versteht man unter Individualisierung im Kontext der Ehe?
Individualisierung bedeutet, dass die Biographie des Einzelnen weniger von traditionellen Vorgaben und Sicherheiten bestimmt wird und stattdessen von individuellen Entscheidungen und Lebensentwürfen geprägt ist. Dies wirkt sich auf die Paarbeziehung aus, da zwei Wahlbiographien miteinander in Einklang gebracht werden müssen.
Welche Rolle spielt die Kirche in der Postmoderne?
Die Kirche hat an Bedeutung für das Leben des Einzelnen verloren und sieht sich einer zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung innerhalb des Christentums gegenüber. Die Sakramentenpastoral befindet sich in einer Krise, da viele Menschen keinen Bezug mehr zu den kirchlichen Vollzügen haben.
Was ist ein Sakrament im Allgemeinen?
Ein Sakrament ist ein Zeichen der Nähe Gottes, durch das er sich den Menschen mitteilt. Es besteht aus einem äußeren Zeichen (z.B. Wasser oder Brot) und dem deutenden Wort. Christus selbst wird als das Ursakrament betrachtet, und die Kirche als Grundsakrament.
Wie wird die Ehe als Sakrament verstanden?
Die Ehe als Sakrament ist ein Realsymbol der Liebe Gottes. Sie ist ein Zeichen der Einheit und Unauflöslichkeit, die auf der gegenseitigen Liebe der Eheleute basiert. Diese Liebe soll ein Abbild der Liebe Gottes zu den Menschen sein.
Was ist Ehekatechese?
Ehekatechese ist ein Prozess der Glaubensvermittlung und -begleitung, der sich an Paare richtet, die heiraten möchten oder bereits verheiratet sind. Sie soll helfen, das Ehesakrament besser zu verstehen und die Ehe im christlichen Glauben zu leben.
Welche Konzepte der Ehekatechese werden diskutiert?
Es wird die traditionelle, stufenweise Ehevorbereitung diskutiert, die mit der Kindheit beginnt. Weiterhin wird ein projektorientierter Ansatz vorgeschlagen, der auf zeitlich begrenzten Veranstaltungen basiert, um auch kirchenferne Menschen anzusprechen.
Was sind die Ziele der Ehekatechese?
Die Ziele sind, den Menschen zu helfen, ein gelingendes Leben zu führen, indem sie auf den Zuspruch und Anspruch Gottes eingehen, die Frohbotschaft Jesu Christi als Lebenshilfe zu erfahren und die Ehe als ein Zeichen der liebenden Zuwendung Gottes zu den Menschen zu erkennen und zu leben.
Was ist eine projektorientierte Ehekatechese?
Eine projektorientierte Ehekatechese bietet zeitlich begrenzte Veranstaltungen zu verschiedenen Themen an, die für Ehe und Familie relevant sind. Sie zielt darauf ab, Menschen in verschiedenen Lebensphasen anzusprechen und ihnen zu ermöglichen, sich mit dem Glauben auseinanderzusetzen, ohne eine dauerhafte Bindung an die Gemeinde vorauszusetzen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2000, Die Ehe - Sakramententheologischer Anspruch und gesellschaftliche Wirklichkeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106917