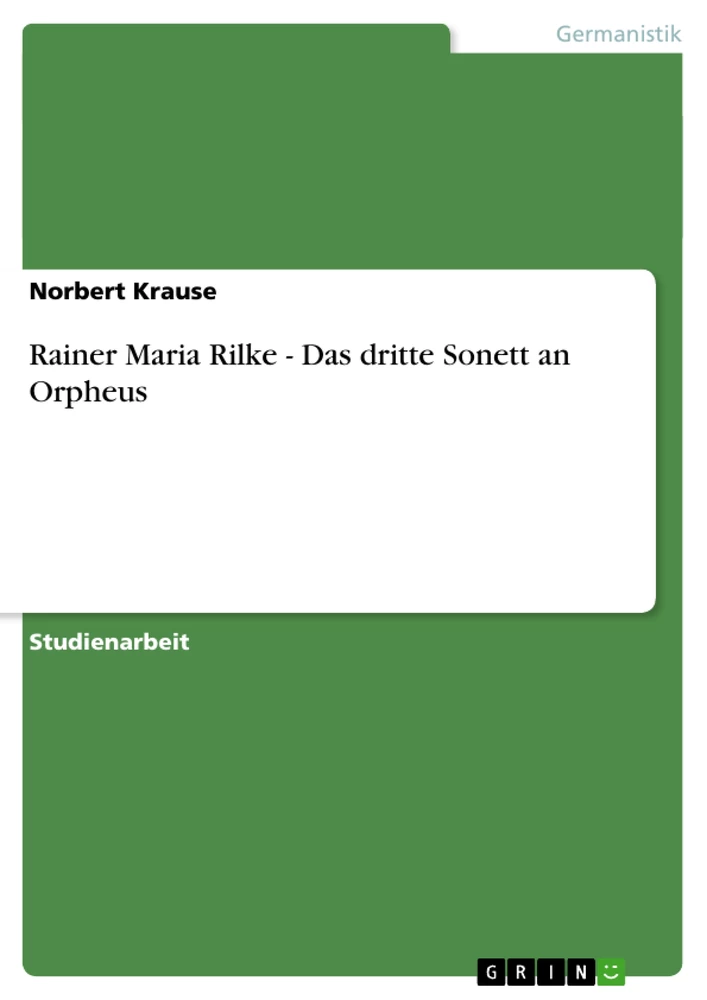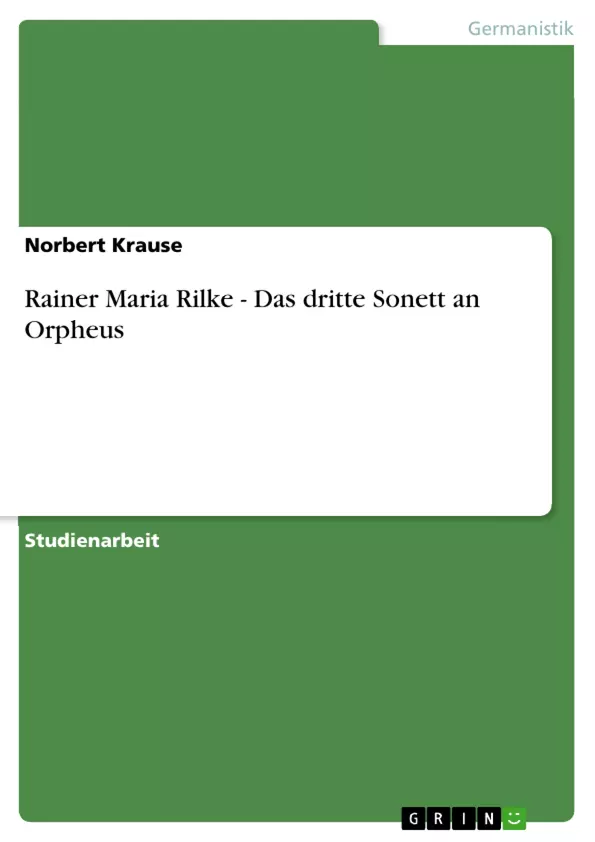Was bedeutet es, wirklich zu sein, und wie finden wir unseren Platz in einer Welt voller Zwiespalt und vergänglicher Werte? Diese tiefgründige Analyse von Rainer Maria Rilkes "Sonette an Orpheus" entführt Sie in eine Welt der Poesie, die weit mehr ist als bloße Wortkunst. Sie ist eine Einladung, das Wesen des Seins zu erforschen, die Liebe in ihrer reinsten Form zu entdecken und die Kraft des Gesangs als Ausdruck unserer innersten Wahrheit zu erkennen. Tauchen Sie ein in Rilkes meisterhafte Sonettform, die er nutzt, um die Rückkehr zur großen Dichtung und die Besinnung auf Schönheit zu fordern. Entdecken Sie, wie er den Mythos des Orpheus, des Sängers, der die Götter der Unterwelt verzauberte, als Sinnbild für den vollkommenen Dichter einsetzt, dessen Gesang zweckfrei ist und dessen Dichtung einfach ist. Ergründen Sie die tiefere Bedeutung von Rilkes berühmten Versen "Gesang ist Dasein" und wie sie uns auffordern, über die bloße Existenz hinauszugehen und unser wahres Potenzial zu entfalten. Lassen Sie sich von der Interpretation des dritten Sonetts inspirieren, das die menschliche Suche nach dem wahren Gesang im Vergleich zu Orpheus' göttlicher Mühelosigkeit beleuchtet. Erfahren Sie, wie die Liebe, die oft von Begehren und Endlichkeit geprägt ist, sich von der reinen, zweckfreien Liebe des Orpheus unterscheidet. Wagen Sie es, die alten Formen der Dichtung neu zu entdecken und die Frage zu stellen, ob die neuen Formen, die im Krieg entstanden sind, wirklich in der Lage sind, die existenzielle Heimatlosigkeit und die Angst des modernen Menschen auszudrücken. Diese Auseinandersetzung mit Rilkes Werk ist nicht nur eine literarische Analyse, sondern eine Reise zu den Wurzeln der menschlichen Erfahrung, ein Aufruf zur Selbstfindung und eine Hymne an die unsterbliche Kraft der Kunst. Ein Muss für jeden Liebhaber der Lyrik, der Philosophie und der tiefgründigen Fragen des Lebens, der nach Orientierung und Inspiration in einer komplexen Welt sucht. Es ist eine Einladung, den eigenen "Hauch um nichts" zu finden, den eigenen "Wind" im Inneren zu entfesseln und das Dasein in seiner ganzen Fülle zu erfahren. Die "Sonette an Orpheus" sind mehr als nur Gedichte; sie sind ein Spiegel der Seele und ein Kompass für den Geist, der uns auf dem Weg zu einem authentischen und erfüllten Leben leitet. Lassen Sie sich von Rilkes zeitloser Botschaft berühren und entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten, die in Ihnen schlummern. Ein tiefgründiges Werk für Leser, die bereit sind, sich den großen Fragen des Lebens zu stellen und die Kraft der Poesie als Wegweiser zu nutzen.
Inhalt
1. Biographische Einleitung
2. „Sonette an Orpheus“ - Die zeitliche Einordnung
3. Das dritte Sonett - Interpretation
1. Einordnung im Sonettzyklus
2. Die sprachliche Form
3. Der Anspruch an die Dichtung
4. Der Gesang - des Alltags
5. Literaturangaben
1. Biographische Einleitung
Im Februar 1922 überkam ein Sturm Rainer Maria Rilke. Er schrieb innerhalb von drei Tagen den ersten Teil der Sonette an Orpheus nieder, vollendete seine Elegien und schloß die Sonette mit dem zweiten Teil ab. Euphorisch schrieb er von „einem namenlosen Sturm, einem Orkan im Geist“ in seinem Brief an die Fürstin von Thurn und Taxis.1 Alles war darauf hinaus gegangen, mit seiner ganzen Seele hatte er diesen Sturm herbeigesehnt. Nach dem Anfang der „Duineser Elegien“ auf dem Schloß Duino im Jahre 1912 schien eine Krise ihn, auch in äußerer Form des ersten Weltkrieges, zu erreichen. Er zog sich zurück, schrieb wenig, meist nur Briefe. Zu tief hatte ihn dieser Menschlichkeitsverlust inmitten Europas getroffen, als daß er dichten könnte. Er war in München nahezu gefangen, hatte zwar diese Stadt ausgesucht, vielleicht aus dem Gefühl heraus, daß in er in dieser Zeit den Menschen nahe sein, die Meldungen hoffend erwarten müßte, jedoch war fand er dort nicht, die von ihm gewünschte Heimat. Deshalb begab er sich nach dem Kriege wieder auf die Suche nach einem Ort, der dem Schlosse Duino gleichen mochte, aber ihm doch andere Gefühle gab, die seiner neuen Gemütslage entsprachen oder auch entsprechen würden, an dem also ein wechselseitiger Prozeß stattfinden könnte: die Heimatfindung und der daraus folgenden Gefühle, der Entdeckung und Entfaltung der noch in ihm schlummernden Kräfte. Er spürte den Sturm in sich und ahnte, daß es nur noch an einem Ort fehlte um diesem freien Lauf zu lassen. Nach langer Suche in der Schweiz fand er ihn in Muzot, einem kleinen Schloß in Wallis, auf einer gemeinsamen Wanderung mit Merline, mit der er am Beginn einer leidenschaftlichen Beziehung stand. Auch ihre Liebe sollte seine Schöpfungskraft beflügeln, und ihre Geschenke stehen wohl in direkter Beziehung zu den Sonetten: Sie schenkte ihm ein Bild aus dem 16.Jhd. auf dem Orpheus abgebildet war und das direkt als Vorlage gedient haben kann für das allererste Sonett und sie gab ihm zu Weihnachten eine Ovid-Übersetzung, die er in Muzot las und in der die mythologischen Grundlagen für die Figur des Orpheus zu finden sind. Bei Rilke finden sich auch die drei Teile Ovids wieder: Orpheus spielt vor Tieren und Bäumen, was das spielerische Sein und das Verhältnis zur Natur andeutet, Orpheus und Eurydike, als Liebende und das Ende, als Orpheus durch die Mänaden getötet wird. All diese Motive finden sich auch in den Sonetten wieder, wobei Rilke den Stoff jedoch selbst annimmt und ihn seinem eigenen Bild einfügt, einpaßt, ihn dadurch auch erweitert und ihm neue Dimensionen des Wirkens eröffnet.
Bei Paul Valery, dessen Werk Rilke im Sommer 1921 entdeckte, fand er eine sprachliche und stilistische Offenbarung. Er übertrug das Gedicht „Der Friedhof am Meer“ in einer meisterhaften Übersetzung ins Deutsche. Nach der Lektüre schrieb er in einem Brief: „Ich war allein, ich wartete, mein ganzes Werk wartete. Eines Tages las ich Valery; und ich wußte, daß mein Warten zu Ende war.“2 Dessen Form und Stil beeinflußten Rilke sehr stark bei der Vollendung der Elegien und der Sonette.
Als letztes prägte die Bekanntschaft mit Wera Ouckama Knoop seinen Orpheusbezug besonders. Seit sie ein Kind war, kannte Rilke sie und sie wurde für ihn zu dem Inbegriff des Mädchens, sie tanzte und liebte. Sie starb jedoch schon im jungen Alter von 19 Jahren. Sie nahm also ihr Mädchen-Sein mit in den Tod. Das machte sie zu seiner Eurydike, deren Leben noch nicht einmal in voller Blüte, in voller Reife war und durch den Tod abgeschnitten wurde, die das Für-Sich-Sein sich aber gerade dadurch bewahrt und durch den Tod mit in die Ewigkeit nimmt. Sie steht dadurch den Sonetten sehr nahe, so daß auch die Widmung ihr gilt: „Geschrieben als ein Grab-Mal für Wera Ouckama Knoop“
All das bewegte ihn, all das lag in ihm und wartete darauf endlich hervortreten zu können. Die Bilder hatten sich gesammelt und mußten nur noch an die Oberfläche gebracht werden. Wie sollte das besser geschehen als durch einen Sturm, der die ganze See durchwühlt, aufwühlt und auch Tiefstes zum Vorschein bringt, durch den die täglichen Wellen sich aufbäumen und sich einen neuen Grund schaffen, neues Wasser heraufwirbeln, in einem Sturm, in dem verrostete Kähne mit altem Ballast unter den Wogen der Gedanken aus der Tiefe zerbersten und erfahrene Steuermänner wieder schwimmen lernen (müssen)? Wie könnte das alles anders herausbrechen - sollte man einen Perlentaucher auf die lebenslange Suche hinabschicken auf einen Grund, der einem Perlenteppich gleicht, würde dieser nicht verzweifelt aufgeben und jegliches Suchen als sinnlos empfinden? Ein Sturm, in dem die Perlen vom Boden gehoben und in den Wellen zerrieben, das Wasser zu Perlenwasser machen.
Ein Sturm offenbart die Gedanken, die Gefühle Rilkes über die Kunst, über die Dichtung, über das Leben, die Liebe: In den Sonetten an Orpheus.
2. „Sonette an Orpheus“ - die zeitliche Einordnung
Es ist ein sprechender Titel, den Rilke für seinen Zyklus wählte: Sonette an Orpheus gerichtet, diesem gewidmet. Das Sonett entstand im 13. Jahrhundert in Italien und gelangte im 16.Jahrhundert nach Deutschland. Es ist durch seine strenge Form, seinen klaren Aufbau gekennzeichnet: Zwei Quartette und zwei Terzette, mit dem Reimschema ABBA und CDE. In der klassischen Form beinhalteten die beiden Quartette These und Antithese, die Terzette beides konzentriert und als Abschluß eine Synthese aus beidem. Rilke jedoch nutzte sie in freierer Form, er übernahm die äußere Form, variierte jedoch das Reimschema häufig, wie es dem Gedicht angemessen war. Doch schon mit der Auswahl dieser klassischen Gedichtform deutete Rilke seine Absicht an: Eine Rückkehr zur großen Dichtung, eine Besinnung auf deren Formen, auf deren Schönheit. So ist auch Orpheus ein Mythos der Schönheit, besonders des Gesanges und der Dichtung. Sein Gesang und sein Leierspiel war so wundervoll, daß es selbst die Götter der Unterwelt verzauberte und sie die Rückkehr seiner Geliebten Eurydike erlaubten. Orpheus war kein Gott, er war ein Mensch, doch durch sein Leierspiel wurde er zum mythischen Stammvater der abendländischen Dichtung. Rilke wünscht also in seiner Dichtung an Orpheus die Rückkehr zu den Wurzeln des Gesangs, zu dem ersten Sänger, zu dem der noch rein gesungen hat. Für ihn wird Orpheus zu einem Sinnbild für den Sänger, er ist der perfekte Dichter, der perfekte Leierspieler, der rühmt, dessen Gesang zweckfrei, ohne Ziel ist, dessen Dichtung ist. In Rilkes Gegenwart waren gerade der Dadaismus und der Expressionismus zu Ende gegangen, und hatten jegliche Form, jegliches klassische Element der Dichtung nicht nur abgelehnt, sondern entfremdet und zerstört. Man müsse neue Formen finden, neue Möglichkeiten des Ausdrucks, die alten Formen entsprachen nicht mehr dem Gefühl dieser Generation, sie waren überkommen, konnten nicht mehr das ausdrücken, was sie fühlten. Wie sollte man auch in eine Sonettform das existentialistische Gefühl der Heimatlosigkeit, der Angst vor dem Krieg, vor der Entfremdung, vor der Abgestumpftheit des Menschen pressen? War die Form diesem Inhalt nicht unangemessen? Doch gerade nach dem ersten Weltkrieg forderte nun Rilke die Rückbesinnung auf die alten Formen, auf den Ursprung der Dichtung. Die neuen Formen hatten sich am Kriege verausgabt, sie hatten den Krieg nur schwer verletzt überstanden. Nach solch einem Verlust der Menschlichkeit mußte der Sinn der Dichtung neu ausgelotet werden. So wie nach dem zweiten Weltkrieg Adorno sagte: „Nach Auschwitz gibt es keine Dichtung mehr.“, so nahm auch Rilke Stellung indem er seine eigene Kunstauffassung offenbarte. Und diese wandte sich wieder den Wurzeln zu und der klassischen Form des Gedichts: Dem Sonett. Zwei Sonettzyklen zeigen, was Dichtung sein kann, daß Dichtung sein kann. Aber es geht nicht nur um die Kunst, es geht um das Leben an sich, das Da-Sein, denn „Gesang ist Dasein.“
3. Das dritte Sonett - Interpretation
III.
1 Ein Gott vermags. Wie aber, sag mir, soll
2 ein Mann ihm folgen durch die schmale Leier?
3 Sein Sinn ist Zwiespalt. An der Kreuzung zweier
4 Herzwege steht kein Tempel für Apoll.
5 Gesang, wie du ihn lehrst, ist nicht Begehr,
6 nicht Werbung, um ein endlich noch Erreichtes;
7 Gesang ist Dasein. Für den Gott ein Leichtes.
8 Wann aber sind wir? Und wann wendet er
9 an unser Sein die Erde und die Sterne?
10 Dies ists nicht, Jüngling, daß du liebst, wenn auch
11 die Stimme dann den Mund dir aufstößt, - lerne
12 vergessen, daß du aufsangst. Das verrinnt.
13 In Wahrheit singen, ist ein anderer Hauch.
14 Ein Hauch um nichts. Ein Wehn im Gott. Ein Wind.
3. 1. Einordnung im Sonettzyklus
Der Zyklus beginnt mit dem mythologischen Gesang des Orpheus vor den Tieren. Im ersten Sonett singt Orpheus vor diesen und sie schweigen, sie hören. Zwar ist in ihrem Herzen schreien, brüllen und röhren, und doch errichtet ihnen Orpheus einen Tempel durch seinen Gesang in ihrem Ohr. Keine Hütte war vorhanden, kein Unterschlupf aus dem heraus ein Mensch den Gesang hätte sicher genießen können. Die Ferne der bezweckenden Menschen und ihrem Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen schafft diese Idylle, vermag dem Gesang des Orpheus die Kraft verleihen, einen Tempel im Gehör zu schaffen. Dieses Bild erscheint auch wieder im zweiten Sonett in Form eines Mädchens, das aus dem orphischen Gesang hervorgegangen ist und sich ein Bett in seinem Ohr macht. Sie schläft; die Welt, die Natur, alles ist dem Mädchen Schlaf: Denn alles ist ohne Sinn, ohne Zweck im Schlaf. Erst aufgewacht hat man Bewußtsein, Gedanken, Wünsche, Ziele. Doch dieses Mädchen schläft, sie schläft in seinem Ohr, wie im ersten Sonett dort im Gehör der Tiere ein Tempel für Orpheus entstand so entsteht hier ein Bett im Ohr. Das zweite Sonett erschafft die Eurydike, das Mädchen, das für sich ist, das noch keine Frau geworden ist, also noch die innige Liebe, das innere Feuer bewahrt hat, bevor diese Fähigkeit durch das zielgerichtete Lieben verschwindet, verstummt: Sie zu einer Frau wird. Doch gerade das Mädchen-Sein ist hier noch nicht vollendet, es wird abrupt beendet, durch den Tod, der sie dem ewigen Schlaf, also dem ewigen Sein überantwortet.
Die ersten beiden Sonette gelten den mythologischen Hauptfiguren der Orpheusdichtung, sie werden vorgestellt: Er, dessen Gesang Tempel erschafft, die Tiere, die Natur zum Schweigen bringt, noch in einer Welt frei von Zweck, noch frei von bewußten Menschen; sie, aus seinem Gesang hervorgetreten, nicht erst erwacht, sondern schlafend erstanden, und auch schlafend dem Tode entgegentreten. Die Liebe der beiden, das nächste mythologische Motiv, das nächste antike Thema, wird im dritten Sonett angedeutet. Jedoch treten hier erstmals die Menschen auf, als Gegenthema zu der reinen Liebe der beiden, als Gegensatz zu dem Gesang des Orpheus: Ihr Gesang ist durch die Liebe, durch das Begehren entstanden; ihre Liebe ist voller Endlichkeit, voller Zielgerichtetheit. Ihnen zeigt das Sonett den wahren Gesang, vergessen sollen sie den Liebesgesang, dichten und lieben sollen sie wie Orpheus, obwohl die eigene Schwere sie daran hindert. Doch sie hindert auch die beiden Liebenden des vierten Sonetts, Orpheus und Eurydike, sie lastet auch schwer auf ihren Schultern, doch müssen sie sie nur der Erde zurückgeben. Auch die große Liebe, der Anfang aller Liebe war voller Tränen, voller Angst. Das eigene Gewicht hält sie auf dem Boden, der eigene Baum wurzelt im Boden, der Raum jedoch, die Luft ist frei von solcher Last, von solchen Fesseln. Die Liebe muß sich befreien von der Schwere der Gedanken des Bewußtseins, sie muß wieder sein.
Somit bildet das dritte Sonett eine Art menschliches Zwischenspiel, es zeigt den Menschen im Vergleich zum singenden und liebenden Orpheus. Jedoch erweist sich im vierten Sonett selbst seine Liebe als schwierig und stellt damit die Menschen vor eine der schwersten Aufgaben: Singen, lieben und sein - zu lernen.
3.2. Die sprachliche Form
Das Sonett besteht aus zwei Quartetten und zwei Terzetten. Die Verse sind fünfhebige Jamben, ein klassischer, ruhiger Rhythmus, der Spannungen nachdenklicher behandelt und zu erklären sucht. Erklärend ist auch die Syntax: Viele kurze Sätze zeigen das Feststehende („Ein Gott vermags“ Z.1, „Sein Sinn ist Zwiespalt.“ Z.3). Es steht nicht in Frage, so wie die langen Fragen, die sich sogar über die Strophen hinaus ausdehnen, nicht nur ein Zeilensprung sondern ein Sprung vom zweiten Quartett zum ersten Terzett und von diesem wiederum zum letzten Terzett. Dieses Enjambement verbindet die Strophen miteinander, es zeigt, daß der Sinn nicht abgeschlossen ist, sondern, daß all diese Strophen zusammenhängen. Dies steht nun wiederum im Gegensatz zu den prägnanten, kurzen abgeschlossenen Sätzen. Dieser Gegensatz ist durch das Verhältnis des Gottes, also Orpheus und der Menschen zu dem Gesang, ja zu ihrem ganzen Dasein bestimmt. Es ist entgegengesetzt, der Gott kann singen und lehrt es sogar, der Mensch muß es noch lernen, sein Lernen ist noch nicht abgeschlossen, es führt weiter und vieles ist noch unklar, was die rhetorischen Fragen symbolisieren: „Wann aber sind wir?“ (Z.8) und „Wann aber wendet er an unser Sein die Erde und die Sterne?“ (Z.8/9). Doch diese Unklarheit wird durch den Gedankenstrich am Ende des ersten Terzetts genommen und dem Jüngling wird eine Aufgabe gestellt: „lerne“ (Z.11). Das könnte nun für sich stehen wird jedoch durch den Zeilensprung im nächsten Terzett weitergeführt und konkretisiert: „zu vergessen, daß du aufsangst“(Z.12). Dann ist die Unsicherheit beseitigt, die Hoffnung kehrt ein und „in Wahrheit singen“(Z.13) wird offenbart, „ein anderer Hauch“(Z.13). Noch scheint dieses Singen sich durch das anders zu definieren, durch Negation, doch durch Wiederaufnahme des „Hauches“ und Steigerung wird der Hauch einem eigenen Sein zugeführt, er beginnt zu leben. Das Lernen-Müssen des Jünglings verliert sich in dieser liebevollen Klimax und setzt somit voraus, daß er lernen oder nicht sein wird. Diese Hoffnung zeigen auch die Laute der letzten beiden Zeilen „w“, „h“, „m“ und „n“, weiche Laute, das „h“ entspricht sogar dem Hauch als gehauchter, aspirierter Laut. Die Vokale wechseln fließend: „a“, „ei“, „i“, „au“ (Z.13) und verdeutlichen das in Wahrheit singen durch sich selbst, durch ihren eigenen Fluß.
In der ersten Strophe herrscht „Zwiespalt“, die ersten beiden Zeilen zeichnen sich eher durch warme Vokale aus, durch „a“ und „o“, wobei schon nach der ersten Aussage ein „ie“ folgt im „Wie“, das all diese warmen Laute schon in Frage stellt und das sich dann konkretisiert im „Zwiespalt“, aber auch schon der Reim auf „ei“- „Leier“ und „zweier“ verdeutlicht das. Daher auch folgen auch in den nächsten beiden Zeilen kalte Laute „e“, „i“ und „ie“, erst zum Abschluß wird es wieder freundlicher durch die Erwähnung des Apoll, ein warmer Klang, dessen Name schon für den Träger steht. Diese kalte Lautung wird in dem nächsten Quartett fortgeführt, die zweifache Verneinung durch „nicht“, die langen „e“ in „lehrst“ und „Begehr“, der Gesang wird erst durch Verneinung definiert und erst in der dritten Zeile wird er durch das warme, positive „Dasein“ erhellt. Aber auch in diesem Quartett werden die beiden mittleren Verse wieder auf „ei“ gereimt, was wiederum den Widerspruch, den Gegensatz zwischen Gott und Mensch aufzeigt, im ersten Quartett war es die Leier des Gottes, auf der er so wunderbar spielt und die zwei auseinanderführenden Herzwege, die dem Menschen den Sinn zerspalten; im zweiten Quartett nun ist es die Negation des von den Menschen angestrebten, zu Erreichenden, und die Leichtigkeit mit der ein Gott zu sein vermag. Auch der zweisilbige, klingende Reim zeigt die Parallelität, obwohl dessen Trennung nun nicht mehr direkt nach dem „ei“ erfolgt, also der Widerspruch nicht mehr so stark ist. Auch der umarmende Reim „Begehr“ und „er“ zeigt den Gegensatz zwischen den begehrenden Menschen und dem Gott, der die Sterne an uns wenden könnte. Der Übergang vom weiblichen zum männlichen Reim zeigt, daß die Menschen gerade das begehren: Daß der Gott „an unser Sein die Erde und die Sterne“ wendet und daß dieses Verlangen, dieses Wollen sie so sehr davon entfernt, sie so sehr abhält vom „Sein“. Hier taucht nun die ganze Menschheit auf, es wird von „unser“ und von „wir“ geredet. Es geht um das Dasein, dafür wird sogar das lyrische Ich einbezogen, das bis dahin nur in der ersten Zeile in der alles in Zweifel ziehenden Frage, den Menschen dem Gott gegenüberstellt und im zweiten Quartett den Gott, Orpheus direkt anruft und ihn anspricht. Nun aber geht es um den nächsten Schritt, die große Schlußfolgerung: „Gesang ist Dasein“ und hier kann sich das lyrische Ich nicht aus den Menschen herausnehmen, denn es kann zwar alle diese Negationen annehmen und versuchen zu singen, doch gerade diesen letzten Schritt vermag es nicht von selbst zu vollziehen, der Gott muß sich, muß die Welt an die Menschen wenden. Erst dann kann wieder das Liebesmotiv aufgegriffen werden und der singende Jüngling belehrt werden. In jeder der nächsten folgenden Zeilen wird der Jüngling direkt angeredet, es wird noch einmal beschrieben, wie dieser sang und daß er lernen solle, diese Anrede verstärkt den Anspruch an den Jüngling. Bis dann zum Abschluß niemand mehr angesprochen wird und frei das wahre Singen verdeutlicht wird. Die letzte Zeile des zweiten Quartetts und die erste Zeile des ersten Terzetts waren noch geprägt von warmer Hoffnung, voller „w“ und „a“, gleichzeitig jedoch auch voller Angst und Sorge, durch die kalten „i“ und „e“, wann wird er die Erde und die Sterne an uns wenden. Das überhaupt steht nicht in Frage, er wird sie uns offenbaren, doch der Zeitpunkt ist noch ungewiß. Die nächsten Zeilen sind wieder eher kühl gehalten, das zeigt sich am „lerne vergessen“(Z.11/12) und am „Das verrinnt“(Z.12). die Zeilen bereiten darauf vor, welche Dichtung die wahre, welcher Gesang dem Dasein entspricht und das erfolgt auch durch langsames Ändern der Lautung, bis sie zum Abschluß voller Wärme und Fluß ist. Die Reime wiederum verbinden diese beiden Teile, das „auch“ das für das Unbewußte steht, für das Nicht-anders-Können, wird mit dem anderen unbewußten Hauch verbunden, und zeigt schon die Möglichkeit der Umwandlung vom reflexhaft aufgestoßenen zum wahrhaft singenden Mund. Im ersten Terzett wird dies nun von „Sterne“ und „lerne“ umrahmt, Sterne noch ein Ausdruck des An-uns-Wendens des Gottes, also etwas Passives, wobei wohl gerade durch diese Passivität die Größe des Seins erreicht wird, die Größe der Schenkung des Gottes, im Gegensatz dazu steht nun das „lerne“, etwas Aktives, jedoch in diesem Rahmen etwas kleineres. Dieser Widerspruch wird nun durch das folgende Terzett entkräftet: Lernen zu vergessen, lernen, um wieder frei zu sein, damit man singen kann, ohne Zweck, nicht aktiv und auch nicht passiv, einfach singen. Und die Sterne werden dem Menschen offenbart, nachdem er vergaß und zu singen begann. Im letzten Terzett scheint wieder ein Widerspruch zu sein, zwischen „verrinnt“ und „Wind“, denn das erste ist stark negativ belegt und das zweite ist Ausdruck des wahren Gesangs. Verrinnen wird das Aufgesungene, wird das voller Begehr Gesungene, es wird vergehen und bleiben wird der Hauch um nichts. Doch gerade dieses Verrinnen ist ein Ausdruck der aus der Natur stammt, ein Fluß verrinnt in Felsspalten, und auch der Wind ist aus der Natur entwendet und diesem Bild eingefügt. Somit löst sich der Gegensatz in der Natur auf, denn dieser Wind, dieses Unbewußte, diese höchste Steigerung des Gesanges, ist wie die Natur, ist aus der Natur, ist Natur. Und auch das Vergehen, das Versickern ist voller Unbewußtheit, voller natürlichem Sein. Der Wind und das Verrinnen sind beides wie natürlicher Gesang, in der Natur heben sich die menschlichen Gegensätze auf und sind wieder vereint. Dort ist es möglich zwei Aussagen voller unterschiedlichem Klang zu einer Harmonie zu führen.
3.3. Der Anspruch an die Dichtung
„Ein Gott vermags.“(Z.1) Dieser erste Satz steht dort ohne Bezug, ohne Erklärung. Das „es“ sogar an das Vermögen angegliedert, als ob es die Leichtigkeit dessen anzeigen soll. Doch was ist nun dieses „Es“? Angedeutet wird es in den ersten Strophen nur durch den Gegensatz, der erzeugt wird, zwischen Mensch und Gott. Die nächste Frage stellt das Vermögen des Menschen in Frage, es dem Gott nach zu tun, dem Gott zu folgen. Der Gott geht durch die Leier, er spielt auf ihr, sein ganzes Wesen ist frei und spielt. Keine physische Form, kein irdischer Zweck hält ihn, sich der Musik ganz hinzugeben, den Gesang, die Töne durch die Leier fließen zu lassen und sich selbst mit ihnen, durch sie. Der Mann jedoch ist dem Gott entgegengesetzt, schon sein ganzes Wesen ist schwer und behäbig, schon allein die Vorstellung eines Mannes und dessen Versuch sich durch eine Leier zu quetschen, erscheint lächerlich. Auf den Gott bezogen ist dieses durch „die Leier gehen“ eine Metapher, auf den Mann, der aus dem Leben genommen wurde, wird dieses Bild real und komisch. Wenn es jedoch auch auf die bildliche Ebene gehoben wird, zeigt sich, daß der Mann dort ebenfalls nicht dem Gott folgen kann, er ist zu fest verwurzelt, er kann seinen Geist nicht befreien: „Sein Sinn ist Zwiespalt“ (Z.3). Welchen Sinn gibt der Mensch seinem Leben? Zwischen welchen Sinnen steht er gespalten? Natur und Gesellschaft, dem Gotte und dem Menschen, Sein und Existieren, Lieben und Geliebtwerden? Liegt es nicht vielmehr in seiner Natur, Gegensätze, Zwiespälte zu suchen, sich selbst zu schaffen. Wenigstens in der westlichen Welt hat die Logik die Harmonie besiegt und die Menschen denken „polar“. Die Gegensätze werden nicht als Pole einer Einheit erkannt und lösen sich nicht im wahren Sein auf. Auch im Sonett wird ein Gegensatz zwischen Mensch und Gott erzeugt, durch die bloße Beschreibung und den daraus entstehenden Anspruch an den Menschen. Aber sie fallen zusammen im menschlichen Wesen, alles ist darin vorhanden, angelegt: Das Irdische und das Göttliche. Doch die Grenzen - wenn es sie gibt - verlaufen. Der Mensch stützt sich nur auf das Irdische, vernachlässigt sein Fähigkeit zum Göttlichen, zur Selbsterkenntnis, zum wahren Sein. Dadurch entsteht der Gegensatz im Sonett, dadurch entsteht der Zwiespalt. Deshalb kann er dem Gott nicht durch die Leier folgen, kann er nicht singen, nicht dichten. Doch er versucht es trotzdem, wenn er eine göttliche Fähigkeit in sich spürt: Das Lieben. „An der Kreuzung zweier Herzwege“ (Z.3/4) beginnt er zu dichten. Zwei Menschen, zwei Herzen treffen sich. Oder ist es nur ein Mensch, dessen Herz nicht weiß welchen Weg es einschlagen soll, welcher ist der richtige? Hier wäre der Mensch wieder Zwiespalt. An dieser Stelle seines Weges will der Mensch nun dichten, will durch die Leier. Doch dort „steht kein Tempel für Apoll“ (Z.4), dort wird nicht dem Gott der Musen geopfert, dieser nicht gehuldigt und verehrt. Denn dort ist und wird keine wahre Dichtung, das hat die Dichtung nicht zum Inhalt: Lieben. Jedenfalls nicht in der Form der Menschen, die voller Begehr, voller Werbung um etwas Erreichbares ist. Das ist nicht der Gesang, wie Orpheus ihn lehrt. Der Gesang muß zweckfrei, frei von Wollen und Wünschen sein. Die Liebe ist für die Menschen „ein endlich noch Erreichtes“, etwas Erreichbares, ein Ziel, und das Mittel dieses Ziel zu erreichen ist die Werbung mit Gesang, mit Gedichten. Mit der Leier in der Hand versuchen sie das geliebte Wesen zum Zurücklieben überreden, sie offenbaren ihre Gefühle, meinen mit dem Herzen zu sprechen, was vielleicht ungewohnt aus ihrem Munde klingt, jedoch nicht ungewöhnlich im Allgemeinen ist. Denn dafür gibt es schon genug Bilder, genug Symbole, genug Phrasen, genug Pathos, der genau zu diesem Zwecke erdacht wurde. Jede Liebesbekundung, nach dem Motto „Ich liebe dich“ ist nur eine dieser Phrasen, wie auch schon der Volksmund im Sprichwort „Gesten sagen mehr als Worte erkannt hat“. In Wirklichkeit werden tausend verschiedene Gefühle zu diesem einen Wort zusammengepreßt, in dieses Wort „Liebe“ gedrängt, daß dabei das Individuelle nur auf dem Weg bleiben kann. Liebe ist kein Ziel, man kann Liebe nicht haben3, Liebe ist etwas All umfassendes. So schreibt auch Rilke in einem seiner Briefe: „Wer Liebe verloren hat, hat nie geliebt“4. Man könnte auch sagen: „Wer liebt, der ist.“. Denn Lieben ist auch ein Ausdruck des Seins, genauso wie der Gesang, wie das Dichten. Und auch das ist „für den Gott ein Leichtes“ (Z.7), denn er steht außerhalb der Welt, er kann durch die Leier gehen, sein Gesang ist voller Leichtigkeit, voller himmlischer Freiheit, sein Gesang ist Dasein. Doch wann werden die Menschen sein? „Wann aber sind wir?“(Z.8)? Wie können wir den Zwiespalt überwinden, die irdische Schwere hinter uns lassen? Alleine ist das dem Menschen nicht möglich, doch er hat so vieles, für ihn oft Unsichtbares um sich, das schon in vollen Zügen ist: Die Erde und die Sterne, die Natur und den Kosmos. Doch noch braucht er den Gott, der ihm dies alles zuwendet, der ihn zu der Erkenntnis der wahren Natur, des unendlichen Kosmos bringt. Selbst ist der Mensch nicht mehr in der Lage dazu, er hat beides schon seinen Zwecken unterworfen und erkennt nun nicht mehr deren Eigenexistenz, deren Für-sich-Sein. Er glaubt alles würde nur durch seinen Blick, durch seinen Verstand, sein Ordnen sein. Er braucht wieder den interesselosen, den beobachtenden, den schauenden Blick, um das Sein der Erde, der Sterne zu erkennen. Daraus könnte er lernen zu sein, zu lieben, zu singen. Doch zuerst muß er vergessen lernen, das seine irdische Liebe ihm den Mund öffnete und er zielgerichtet sang. Dieses Aufsingen zu einem Zweck, zu einer Liebe, zu einem anderen Herzen steht nun im Gegensatz zu dem „in Wahrheit singen“(Z.13). Zu dem Zwiespalt zwischen Mensch und Gott findet sich nun die Entsprechung in ihren Gesängen, die jedoch durch ihr Wesen bestimmt sind und daher miteinander verknüpft sind. Doch dieser Gegensatz löst sich schon auf, durch den Anspruch an den Menschen zu lernen. Dort zeigt sich die Fähigkeit zum wahren Singen auch im Menschen. Und auch die Verbindung der Menschen mit dem Gott, der die Natur an sie wendet und sie somit zur Existenz, zum Sein führt, überbrückt diesen Widerspruch. Das wahre Singen gleicht „ein[em] Hauch um nichts.“(Z.14), dem sanften Atem eines Menschen ohne Zweck. Die Frage nach dem Zweck wird hier endgültig beendet, das Zweckwort „um“ wird mit dem „Nichts“ konfrontiert, mit der Sinnlosigkeit, und verliert seine Bedeutung. „Ein Wehn im Gott. Ein Wind.“ (Z.14) steigert dieses Singen über das göttliche Singen, zum natürlichen Gesang des Windes. Alle Motive erscheinen hier vereint, stärken und steigern sich: Der Mensch, der Gott, die Natur. Die Widersprüche sind im wahren Gesang, im wahren Sein gelöst, überall kann gesungen werden, im Hauche des Menschen, dem Wehn im Gott, dem Wind in der Natur. Überall ist die Fähigkeit zum Sein, zum Gesang vorhanden. Und beide werden hier verknüpft: Der Gesang kann den Menschen aus dem Zwiespalt seines Sinns zum Sein führen. So wie Rilke Malte5 sagen läßt: „Der Gesang soll seiend machen.“ Doch kann er das nur, wenn die Menschen lieben lernen. Denn solange sie nicht lieben können und ihr Lieben nur Weg zu einem Ziel ist, werden sie auch die Dichtung, den Gesang mißbrauchen und ihn nicht verstehen, nicht aufnehmen können. Das Vergessen genügt hier nicht, um den wahren Gesang aufzunehmen und durch ihn zum Sein geführt zu werden. Lieben lernen ist ein anderer Weg zum Sein, als der des Gesangs. Ist er wirklich anders? Vielleicht sind es nur verschiedene Worte für ein und denselben Weg?
4. Der Gesang - des Alltags
Nach Rilke sollte die Dichtung niemals nur Mittel zu einem Zweck sein. Sie solle den Menschen seiend machen oder zum Ausdruck seines Seins werden. Dies ist kein irdischer, alltäglicher Zweck mehr, es ist der Allzweck, das Ziel dem jeder Mensch entgegenstreben sollte. Doch warum machen dies die wenigsten, warum sind so wenige auf dem Wege zu dem wahren Sein? Es ist ein Ausdruck von jugendlichem Übermut, die Welt verbessern zu wollen, und nach deren Kopfschütteln, sich selbst finden zu wollen. Es wird lächelnd als eine Phase des Lebens aufgefaßt, „so war ich auch mal,“ sagt man „aber das gibt sich“. Der Eintritt ins Arbeitsleben, in die wahre Welt markiert den Wandel - oder gerade die sich verlierende Fähigkeit zum Wandel, die beginnende Sicherheit, den eintretenden Alltag. Der einmal ausgestaltete Persönlichkeitsentwurf wird manifestiert, wird mit Familie, Arbeit und Hobby zementiert. Welch Hohn einen fertigen Menschen zu sagen, daß seine Suche oder sein Finden noch nicht beendet sei, er würde lachen, eher glaubt er noch an „das ewige Lernen“. Die Persönlichkeit wird immer als nach der Jugend als ausgeformt betrachtet, in Wirklichkeit sind es die Menschen, die sie nicht weiter gestalten wollen. Der Alltag, die Gewohnheit gibt die Sicherheit. Vielleicht ist das das wahre Sein unserer Zeit: Das Sein im Alltag. Vielleicht hat Rilke davon so geschwärmt? Denn Sicherheit braucht der Mensch, ohne sein selbst gesponnenes Netz würde er in Abgründe aus Angst, Schwäche und Zweifel hinabstürzen. Das dieses Netz seine Flügel einspannt, sie verkleben und verkümmern läßt, wird immer erst im Angesicht des letzten Abgrundes, des letzten Himmels bewußt: Viele erkennen erst dort, daß sie Flügel hatten. Doch das Fliegen wagen nur wenige. Rilke ist geflogen, vielleicht höher, als je ein Mensch vor ihm. Aber lag das nicht an seiner Situation, die ihm diese Möglichkeit wohl erst in die Hand gab: Er mußte sich nicht um seinen Lebensunterhalt sorgen, er konnte auf einem Schloß leben, hatte eine Haushälterin, die ihn umsorgte, Freunde und Geliebte, die ihn besuchten und verehrten. Er stand außerhalb dieser Gesellschaft, daher konnte er sie verlassen und in die Himmel aufsteigen. Seine Dichtung zeugt von diesem wahren Singen, besonders in den „Sonette[n] an Orpheus“ hört man die klare göttliche Stimme, man erkennt die Dichtung von der Rilke schwärmt, die er sich von den Menschen erhofft. Doch wie soll ein Mensch ihm durch die Leier folgen? Ein Arbeitender, der täglich acht Stunden schafft, der abends erschöpft in sein Bett sinkt und sich nichts sehnlicher wünscht, als so zu leben wie Rilke es tat. Doch was würde er tun, wenn es ihm wirklich vergönnt wäre, würde er dichten, würde er finden, würde er lieben wollen? Wann dichten die Menschen? In der Liebe, in den schweren Herzstunden ihres Lebens. Aber das gilt nicht für das ganze Leben, eigentlich nur für die Jugendzeit. Je unsicherer die Gefühle, das eigene Wünschen, das neu entflammte Lieben ist, desto eher wird es zur Festigung zu Papier gebracht. Nach der Jugend sind die Gefühle meist schon gefestigt, lassen sich auch nicht mehr so leicht durcheinander wirbeln, sie sind stabiler durch Worte, Versprechen, Ringe und geteilten Alltag. Gerade dort wäre die wahre Dichtung möglich, sie wird keinem Zweck mehr untergeordnet, sie stünde für sich. Doch erscheint es bei den meisten so, daß auch die Stärke der Gefühle nachläßt, die Stärke, mit der sie zum Ausdruck gebracht werden. Sie werden anderen Bereichen, in denen andere Gefühlsebenen hervortreten, zugewandt: Politik, Organisationen, Wirtschaft. Es ist auch ein Phänomen des Alltags, daß man sich immer nur den Themen zuwendet, die einen persönlich betreffen und wenn die Liebe schon gesichert ist, warum daran Gefühle verschwenden. Lieber wieder die Lage der Nation anklagen, auf den Staat schimpfen, die Wirtschaft anprangern. Was an der Jugend verpönt ist, wird nun wieder, jedoch ohne Hoffnung, neu aufgenommen und als kleiner Kampf nebenbei geführt. Die Dichtung, die entstehen könnte, wäre, wie die der Jugend, nur Mittel zum Zweck. Das System zu entlarven, Klarheit zu schaffen, es wäre keine Dichtung, die überdauern würde, sie würde verrinnen mit dem Problem, das sie offenbart. Doch war nicht gerade solche Dichtung prägend, hat sie nicht die Zustände gezeigt, Veränderungen hervorgerufen, erzwungen. Dichtung des Moments, der Vergänglichkeit. Aber sie ist auch unvergänglich in historischen, jedoch nicht im dichterischen Sinne. Dort lebt sie nur durch ihre Sprache, durch ihre Form weiter. Die Dichtung der Ewigkeit, die Dichtung des Seins überdauert durch beides: Inhalt und Form. Und auch in tausend Jahren wird man noch die Freiheit, das Lieben, den reinen Hauch eines solchen Werkes spüren. Vielleicht wird man es nicht mehr verstehen, aber auch heute verzweifeln die Forscher schon an Rilke und seinesgleichen, wahrscheinlich weil sie nie solch hohe Luft geatmet haben. Vielleicht weil sie selbst nicht mehr dichten, nicht mehr singen. Aber auch wenn jemand ist, warum sollte er dann dichten? Sollte er nicht viel eher in die Welt hinausgehen und leben. Es entsteht wohl erst aus der Erinnerung an diese Augenblicke, die Dichtung des Seins. Es scheint jedoch wenige solche Momente im Leben der Menschen zu geben und dementsprechend auch wenig wahren, rilkeschen Gesang.
5. Literaturangaben
Primärliteratur:
- Rainer Maria Rilke: „Sämtliche Werke - Band 2 - Die Sonette an Orpheus“, hg. v. B. Neugebauer, Neuedition, Mundus-Verlag, 1999
Sekundärliteratur:
- Ernst Leisi, „Rilkes Sonette an Orpheus“, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1987
- Hans Egon Holthusen, „Rilke - Rororo-Monographie“, hg. v. W. Müller u. U. Neumann, Rowohlt Taschenbuchverlag, Hamburg, 1958
- Sigrid Killenter „Das Sonett bei Rilke“, New Yorker Studien zur neueren dt. Literaturgeschichte, hg. v. J. Strelka, Verlag Peter Lang, Bern, 1982
Zitierte Literatur:
- Erich Fromm „Die Kunst des Liebens“, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1995
- Rainer Maria Rilke: „Sämtliche Werke - Band 3 - Die Aufzeichnungen des Laurents Malte Briggs“, hg. v. B. Neugebauer, Neuedition, Mundus-Verlag, 1999
- Rainer Maria Rilke „Lektüre für Minuten“
- Rainer Maria Rilke und Marie von Thurn und Taxis „Briefwechsel“, 2. Band, Insel Verlag, Memmingen, 1986
[...]
1 Rainer Maria Rilke „Briefwechsel“
2 Vgl. Holthusen „Rilke-Monographie“ S.140: Zitiert von Monique Saint Helier in „A Rilke pour noel“
3 Vgl. dazu E. Fromm „Die Kunst des Liebens“
4 R.M.Rilke „Gedanken für Minuten"
Häufig gestellte Fragen zu "Inhalt"
Worum geht es in der biographischen Einleitung?
Die biographische Einleitung beschreibt die Entstehung der "Sonette an Orpheus" im Kontext von Rainer Maria Rilkes Leben. Sie erwähnt den "Orkan im Geist", der ihn 1922 erfasste, die vorherige Schaffenskrise nach dem Beginn der "Duineser Elegien", seinen Rückzug und die Suche nach einem inspirierenden Ort wie Schloß Duino. Die Bekanntschaft mit Paul Valéry und Wera Ouckama Knoop werden als weitere prägende Einflüsse genannt.
Wie sind die "Sonette an Orpheus" zeitlich einzuordnen?
Die "Sonette an Orpheus" entstanden nach dem Ersten Weltkrieg, einer Zeit, in der traditionelle Formen der Dichtung durch Strömungen wie Dadaismus und Expressionismus in Frage gestellt wurden. Rilke kehrte bewusst zur klassischen Sonettform zurück, um an die Wurzeln der Dichtung anzuknüpfen. Orpheus wird als Sinnbild für den idealen Dichter dargestellt, dessen Gesang zweckfrei ist.
Was ist die zentrale Aussage des dritten Sonetts?
Das dritte Sonett thematisiert den Unterschied zwischen göttlichem und menschlichem Gesang. Während der Gott mühelos singen kann, ist der Mensch durch Zwiespalt und Begehren gehindert. Das Sonett fordert dazu auf, den Liebesgesang zu vergessen und das wahre Singen zu erlernen, das aus einem Hauch um nichts, einem Wehn im Gott, einem Wind besteht.
Wie ist das dritte Sonett im Gesamtzyklus einzuordnen?
Die ersten beiden Sonette führen die mythologischen Hauptfiguren Orpheus und Eurydike ein. Das dritte Sonett stellt den Menschen als Gegenbild dar, dessen Gesang durch die Liebe und das Begehren geprägt ist. Es dient als Zwischenspiel, das die Schwierigkeit des Singens, Liebens und Seins für den Menschen im Vergleich zu Orpheus aufzeigt.
Welchen Anspruch stellt Rilke an die Dichtung?
Rilke fordert, dass Dichtung nicht nur Mittel zum Zweck sein soll, sondern den Menschen seiend machen oder zum Ausdruck seines Seins werden soll. Der Zwiespalt des Menschen entsteht, weil er sich zu sehr auf das Irdische stützt und seine Fähigkeit zum Göttlichen vernachlässigt. Das wahre Singen gleicht einem Hauch um nichts und kann den Menschen aus dem Zwiespalt zum Sein führen.
Was bedeutet der Gesang des Alltags nach Rilke?
Rilke schwärmte vom Sein im Alltag. Die Gewohnheit kann dem Mensch Sicherheit geben, führt aber dazu, dass seine Gefühle in andere Bereiche abgelenkt werden und nicht im Dichten Ausdruck finden. Die Dichtung, die dann entsteht, ist oft nur Mittel zum Zweck.
Welche Literaturangaben werden in dem Text genannt?
Es werden Primär- und Sekundärliteratur von und über Rainer Maria Rilke genannt. Dazu gehören Werke wie "Sämtliche Werke - Die Sonette an Orpheus", Sekundärliteratur u.a. von Ernst Leisi und Hans Egon Holthusen, sowie Werke von Erich Fromm.
- Citation du texte
- Norbert Krause (Auteur), 2001, Rainer Maria Rilke - Das dritte Sonett an Orpheus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106958