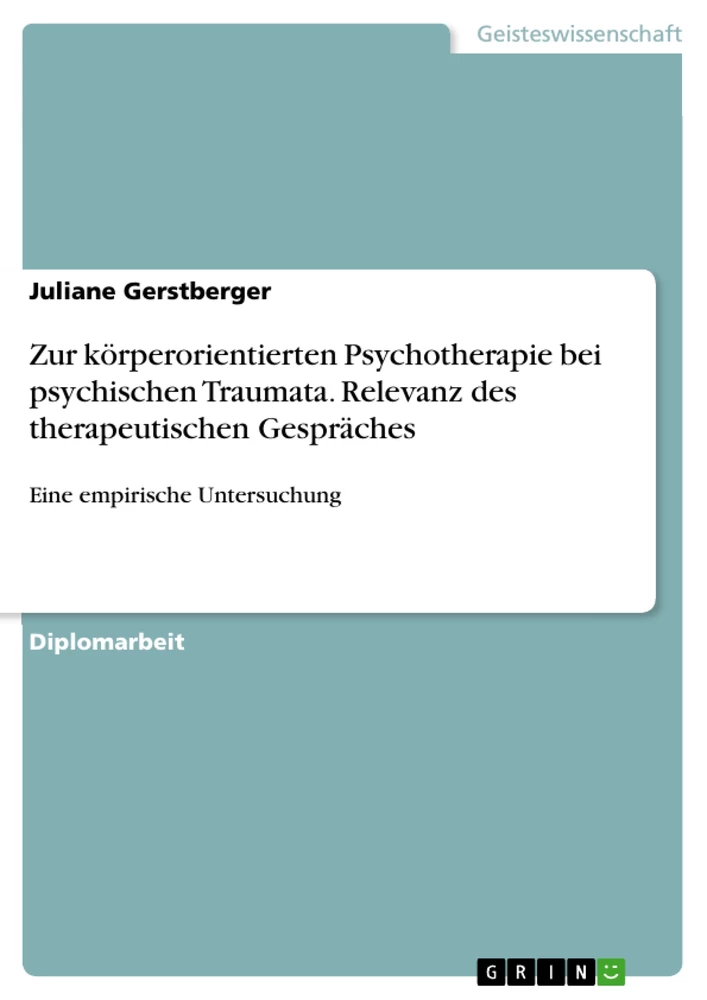Sexuelle und gewalttätige Übergriffe auf Kinder sowie Vernachlässigung sind ein sehr aktuelles Thema, welches aber oft entweder über- oder unterschätzt wird in seinen kurz- und langfristigen traumatischen Auswirkungen.
„Es fehlt noch vieles an einer verbreiteten Therapiepraxis mit dem Schwerpunkt auf Missbrauchs- und Misshandlungserleben. Sowohl für die Behandlung der kurzfristigen Folgen bei Kindern und Jugendlichen, als auch für die Langzeitfolgen mangelt es an ausgearbeiteten Therapiekonzepten. (....) Therapieevaluation, Effizienzkontrolle und Qualitätssicherung müssten von Anfang an gerade für jene innovativen, die Folge von Psychotraumen zu therapieren beanspruchenden neuen Ansätze selbstverständlich sein. Sonst reinszeniert die Therapie den Missbrauch der Biographie“.
(Egle et al.,1997, S. 420)
Mein persönliches Interesse für die von Egle et al. (1997) beschriebene Problematik entstand im Rahmen einer Körperpsychotherapieausbildung, die sich speziell der Behandlung sexualisierter Gewalterfahrungen widmete. Hier wurde ich auf ein integratives Verfahren aufmerksam, welches bei der Behandlung von Erwachsenen, die als Kinder einen sexuellen Miss-brauch erlitten, köper- und gesprächstherapeutische Elemente verbindet. In diesem Zusammenhang erfuhr ich, welche Relevanz dem Gespräch in der Therapie zukommt und wie wichtig gleichzeitig die Einbeziehung des Körpers ist, insbesondere in der Traumatherapie.
Mein Anliegen mit dieser Diplomarbeit besteht darin, der Körperpsychotherapie als einer The-rapierichtung, der bisher wenig wissenschaftliche Beachtung zuteil wurde, öffentliches Gehör zu verschaffen. Außerdem möchte ich eine Synthese erstellen zwischen meiner körperpsychotherapeutischen Ausbildung, die eher praktisch orientiert war und meinem akademischen Studium an der Universität, welches den theoretischen Aspekt stark betont.
Inhaltsverzeichnis
- Begriffsverwendung
- Einleitung
- Mein persönliches Interesse an dem Thema
- Überblick über die Diplomarbeit
- I. Theoretischer Teil
- Was ist ein psychisches Trauma?
- Physiologische Grundlagen eines Traumas
- Folgesymptome psychischer Traumatisierungen
- Die akute und die posttraumatische Belastungsstörung
- Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen)
- Regression
- Die Rolle des Stressors - Traumata mit unterschiedlichen Ursachen
- Gedächtnisforschung und traumabedingte Amnesie
- Das „heiße" und das „kühle" Gedächtnis
- Traumatische Erinnerungen
- Wann entsteht ein Trauma und wann nicht?
- Ressourcen
- Gedächtnisforschung und traumabedingte Amnesie
- Traumata mit unterschiedlicher Intensität und Dauer
- Traumata die auf sexualisierter Gewalt in der Kindheit beruhen
- Definitionen von sexuellem Missbrauch
- Häufigkeit des Vorkommens von sexuellem Missbrauch
- Opfer
- Täter
- Spätfolgen anhaltender Traumatisierungen in der Kindheit - insbesondere sexueller Übergriffe durch Erwachsene
- Definitionen von sexuellem Missbrauch
- Der verhaltenstherapeutische Ansatz zur Behandlung von Psychotraumata
- Therapeutische Ansätze bei der Behandlung psychischer Traumata
- Der Ansatz der systemischen Familientherapie in der Behandlung psychischer Traumata, die durch sexuellen Missbrauch hervorgerufen wurden
- Der psychoanalytische Ansatz zur Therapie psychischer Traumata
- Die Einbeziehung des Körpers in die Psychotherapie
- Definitionen der Termini: „körperorientierte Psychotherapie"/ „Körpertherapie"/ „Psychotherapie"
- Geschichte der Körperpsychotherapie
- Körperbilder in der Therapie
- Die Bedeutung des Nervensystems im körperorientierten Ansatz
- Biopsychologische Zusammenhänge in der Wirkung der Körperpsychotherapie
- Die Bedeutung des vegetativen Nervensystems in der körperorientierten Psychotherapie
- Die Bedeutung von Amygdala (Mandelkern) und limbischem System auf emotionale Vorgänge
- Ansatz W. Reichs- Die Wirkung der Körpertherapie, basierend auf dem Konzept der Pulsation
- Die Begründung Reichs für das Nichtbenutzen der Wortsprache
- Der Ansatz P. Levines - Somatic Experinecing - Körperliches Erfahren
- Die Rolle des ganzheitlichen inneren Empfindens
- Transformation eines Traumas
- Eva Reich und die sanfte Bioenergetik
- Massage und Berührung
- Die Bedeutung von Katharsis, Regression und Grenzen in der körperorientierten Psychotherapie von Psychotraumata
- Katharsis
- Grenzen
- Regression als therapeutisches Medium
- Haltetherapie - Bonding
- Die Rolle des verbalen Austausches zwischen Therapeutin und Klientin, in der körperorientierten Therapie von Psychotraumata
- Die Rolle und Relevanz des therapeutischen Gesprächs in der Körperpsychotherapie bei sexuellen Missbrauchstraumata
- Was ist ein psychisches Trauma?
- II. Empirischer Teil
- Forschungsfragen
- Methode
- Entscheidung für eine qualitative Forschungsmethode
- Die Methode des ExpertInneninterviews
- Die Anwendung von ExpertInneninterviews
- Der Interviewleitfaden
- Die InterviewpartnerInnen
- Die Auswertung der Interviews
- Gütekriterien in der qualitativen Forschung
- Entscheidung für eine qualitative Forschungsmethode
- Ergebnisdarstellung
- Block I: Definitionen und Symptome von Missbrauch/Trauma
- Definitionen von Trauma
- Definitionen von Missbrauch
- Wo fängt der Missbrauch an?
- Symptome von Trauma/Missbrauch
- Auswirkungen und Überlebensstrategien
- Missbrauch als Verlassenheit
- Dissoziation
- Block II: Generelle Aspekte in der Therapie von sexuellem Missbrauch/Trauma
- Generalisierbarkeit in der Therapie
- Diagnostik
- Therapiebeginn
- Therapeutisches Setting
- Männer und Frauen
- Relevante Aspekte im therapeutischen Vorgehen bei sexuellem Missbrauch und Trauma generell
- Das Thema Missbrauch ansprechen
- Integration des Familiensystems
- Vertrauensbasis
- Akzeptanz als Wirkfaktor in der Therapie
- Intuition
- Arbeit mit Kindern, die sexuell missbraucht wurden
- Arbeit mit Müttern und Babys
- Die Relevanz der eigenen Erfahrung/Eigentherapie der TherapeutIn
- Block III: Körperpsychotherapie bei KlientInnen, die sexuell missbraucht wurden; und die Relevanz des therapeutischen Gesprächs
- Massage und Berührung
- Die Neo-Reichianische Therapie
- Katharsis
- Gestalttherapie und Psychodrama
- Wasser - Schwimmen
- Haltetherapie/Bonding in der Praxis
- Aquafloating
- Flushing
- Haltetherapie von Frau Montag – Grundbedürfnisse erfüllen
- Frau Donnerstags Haltetherapie mit Müttern und Babys – Rückenstärke vermitteln
- Entspannungsübungen/Körperbewusstseinsübungen
- Block I: Definitionen und Symptome von Missbrauch/Trauma
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die körperorientierte Psychotherapie bei psychischen Traumata, insbesondere die Rolle des therapeutischen Gesprächs. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über verschiedene Ansätze der Körperpsychotherapie zu geben und deren Wirksamkeit im Kontext von Traumata zu beleuchten. Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf die Erfahrungen von ExpertInnen.
- Körperorientierte Psychotherapie bei psychischen Traumata
- Rolle des therapeutischen Gesprächs in der Körperpsychotherapie
- Verschiedene therapeutische Ansätze (z.B. Reichianisch, Somatic Experiencing)
- Auswirkungen sexueller Traumatisierung in der Kindheit
- Empirische Untersuchung mittels ExpertInneninterviews
Zusammenfassung der Kapitel
Begriffsverwendung: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet werden, um Missverständnisse zu vermeiden und eine einheitliche Terminologie zu gewährleisten. Die präzise Definition von Begriffen wie "Trauma," "körperorientierte Psychotherapie," und "sexueller Missbrauch" legt den Grundstein für eine fundierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und beschreibt das persönliche Interesse der Verfasserin an der Thematik. Darüber hinaus bietet sie einen Überblick über den Aufbau und die Struktur der Arbeit, um dem Leser einen klaren Rahmen für das Verständnis des dargestellten Inhalts zu bieten. Der Überblick strukturiert die Arbeit thematisch und methodisch.
Was ist ein psychisches Trauma?: Dieses Kapitel definiert den Begriff des psychischen Traumas und beleuchtet die physiologischen Grundlagen traumatischer Erlebnisse. Es beschreibt detailliert die Folgesymptome, darunter akute und posttraumatische Belastungsstörungen, dissoziative Störungen und Regression. Die Erläuterung der physiologischen Prozesse liefert eine wichtige Grundlage für das Verständnis der therapeutischen Ansätze, die in den folgenden Kapiteln vorgestellt werden. Die unterschiedlichen Auswirkungen auf das Nervensystem werden erläutert.
Die Rolle des Stressors - Traumata mit unterschiedlichen Ursachen: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Arten von Traumata und deren Ursachen, einschließlich der Rolle des Gedächtnisses und der traumabedingten Amnesie. Es differenziert zwischen „heißem" und „kühlem" Gedächtnis und beleuchtet die Entstehung und Speicherung traumatischer Erinnerungen. Der Einfluss von Ressourcen und die Frage, wann ein Ereignis als Trauma erlebt wird und wann nicht, werden eingehend behandelt. Die verschiedenen Stressoren und deren Auswirkungen werden detailliert betrachtet.
Traumata mit unterschiedlicher Intensität und Dauer: Dieses Kapitel widmet sich den unterschiedlichen Intensitäten und Dauerhaftigkeiten traumatischer Erlebnisse und deren Auswirkungen auf die Betroffenen. Es beschreibt, wie die Intensität und Dauer eines Traumas die Art und den Schweregrad der psychischen und körperlichen Folgen beeinflusst. Die Analyse dieser Faktoren ist wichtig für die Entwicklung individueller Therapieansätze. Das Kapitel beleuchtet, wie die Dauer des Traumas die Verarbeitung und die daraus resultierenden Folgen beeinflusst.
Traumata die auf sexualisierter Gewalt in der Kindheit beruhen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Traumata, die durch sexualisierte Gewalt in der Kindheit verursacht werden. Es beinhaltet Definitionen von sexuellem Missbrauch, statistische Daten zur Häufigkeit, sowie Beschreibungen von Opfern und Tätern. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt auf den Spätfolgen solcher Traumatisierungen, wie sexuellen Dysfunktionen, Beziehungsproblemen, Angststörungen, und Substanzmissbrauch. Der Zusammenhang zwischen dem Trauma und den langfristigen psychischen und physischen Konsequenzen wird eingehend beleuchtet.
Der verhaltenstherapeutische Ansatz zur Behandlung von Psychotraumata: Dieses Kapitel beschreibt den verhaltenstherapeutischen Ansatz bei der Behandlung von Psychotraumata. Es erläutert die Grundprinzipien dieser Therapieform und wie sie spezifisch auf die Bewältigung traumatischer Erfahrungen ausgerichtet ist. Die Stärken und Schwächen dieser Methode im Vergleich zu anderen Ansätzen werden diskutiert. Es wird eingegangen auf die spezifischen Techniken und deren Anwendung im Kontext von Traumata.
Therapeutische Ansätze bei der Behandlung psychischer Traumata: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene therapeutische Ansätze bei der Behandlung psychischer Traumata. Es vergleicht und kontrastiert unterschiedliche Methoden und deren jeweilige Vor- und Nachteile. Die Auswahl und die Begründung für die jeweiligen Methoden wird erläutert. Der Fokus liegt auf der Vielfalt an Therapiemöglichkeiten und deren jeweilige Eignung für unterschiedliche Arten von Traumata.
Der Ansatz der systemischen Familientherapie in der Behandlung psychischer Traumata, die durch sexuellen Missbrauch hervorgerufen wurden: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die systemische Familientherapie im Kontext von durch sexuellen Missbrauch verursachten Traumata. Es untersucht, wie die Familie als System in die Therapie eingebunden werden kann und welche Rolle sie bei der Verarbeitung und Bewältigung des Traumas spielt. Die Einbindung der Familie in den Therapieprozess und die daraus resultierenden Vorteile werden eingehend beleuchtet. Es werden konkrete Beispiele angeführt und die Effektivität des Ansatzes diskutiert.
Der psychoanalytische Ansatz zur Therapie psychischer Traumata: Dieses Kapitel beschreibt den psychoanalytischen Ansatz bei der Behandlung psychischer Traumata. Es erläutert die grundlegenden Prinzipien dieser Therapieform und wie sie die Verarbeitung traumatischer Erfahrungen fördert. Der Fokus liegt auf den unbewussten Prozessen und der Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart. Die Stärken und Grenzen dieses Ansatzes werden diskutiert.
Die Einbeziehung des Körpers in die Psychotherapie: Dieses Kapitel befasst sich mit der Einbeziehung des Körpers in die Psychotherapie. Es definiert "körperorientierte Psychotherapie" und "Körpertherapie" und beleuchtet deren historische Entwicklung. Es analysiert die Bedeutung von Körperbildern und der Rolle des Nervensystems, insbesondere des vegetativen Nervensystems und der Amygdala im Umgang mit Emotionen und Traumaverarbeitung. Die Bedeutung der Körperwahrnehmung im therapeutischen Prozess wird betont.
Ansatz W. Reichs- Die Wirkung der Körpertherapie, basierend auf dem Konzept der Pulsation: Dieses Kapitel beschreibt den Ansatz von Wilhelm Reich und die Bedeutung der Körpertherapie, basierend auf dem Konzept der Pulsation. Die Begründung Reichs für das Nichtbenutzen der Wortsprache wird erläutert und der Fokus auf die körperlichen Ausdrucksformen und deren therapeutische Bedeutung gelegt. Der Zusammenhang zwischen körperlicher Anspannung und psychischen Blockaden wird analysiert.
Der Ansatz P. Levines - Somatic Experiencing - Körperliches Erfahren: Dieses Kapitel erläutert den Ansatz von Peter Levine, Somatic Experiencing, mit Schwerpunkt auf dem ganzheitlichen inneren Empfinden und der Transformation von Traumata. Es wird detailliert erklärt, wie durch körperliche Wahrnehmung und Achtsamkeit Traumata verarbeitet werden können. Die Bedeutung von körperlichen Empfindungen für die Trauma-Bewältigung und die Methoden des Somatic Experiencing werden umfassend beschrieben.
Eva Reich und die sanfte Bioenergetik: Dieses Kapitel beschreibt die sanfte Bioenergetik nach Eva Reich und deren Anwendung bei der Behandlung von Traumata. Es werden die spezifischen Techniken und Methoden der sanften Bioenergetik erläutert, die im Vergleich zur klassischen Bioenergetik sanfter und behutsamer vorgehen. Die Integration von Körperarbeit und emotionaler Verarbeitung wird im Detail dargestellt.
Massage und Berührung: Dieses Kapitel behandelt die Bedeutung von Massage und Berührung in der körperorientierten Psychotherapie von Traumata. Es erörtert die therapeutische Wirkung von taktiler Stimulation und deren positive Einflüsse auf die Entspannung und die Körperwahrnehmung. Die verschiedenen Arten von Berührung und deren Anwendung im therapeutischen Kontext werden beschrieben.
Die Bedeutung von Katharsis, Regression und Grenzen in der körperorientierten Psychotherapie von Psychotraumata: Dieses Kapitel diskutiert die Bedeutung von Katharsis, Regression und der Setzung von Grenzen in der körperorientierten Psychotherapie von Psychotraumata. Es analysiert die Rolle dieser Konzepte im therapeutischen Prozess und deren Auswirkungen auf die Traumaverarbeitung. Es werden die potenziellen Risiken und die Bedeutung einer sicheren und kontrollierten therapeutischen Umgebung erläutert.
Haltetherapie - Bonding: Dieses Kapitel erläutert den therapeutischen Ansatz der Haltetherapie (Bonding) und dessen Anwendung bei der Behandlung von traumatisierten Personen. Es beschreibt die positiven Auswirkungen von körperlicher Nähe und Unterstützung auf die emotionale Verarbeitung und die Stabilisierung des Selbst. Es wird im Detail auf die Anwendung und die therapeutische Bedeutung der Haltetherapie eingegangen.
Die Rolle des verbalen Austausches zwischen Therapeutin und Klientin, in der körperorientierten Therapie von Psychotraumata: Dieses Kapitel untersucht die entscheidende Rolle des verbalen Austausches zwischen Therapeut und Klient in der körperorientierten Therapie von Psychotraumata. Es analysiert die Interaktion von verbaler und nonverbaler Kommunikation und deren Bedeutung für den Erfolg der Therapie. Die Notwendigkeit einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung wird betont und deren positive Auswirkungen auf den Therapieerfolg analysiert.
Schlüsselwörter
Körperorientierte Psychotherapie, psychische Traumata, sexueller Missbrauch, therapeutisches Gespräch, Somatic Experiencing, Bioenergetik, Katharsis, Regression, Traumaverarbeitung, ExpertInneninterviews, qualitative Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Körperorientierte Psychotherapie bei psychischen Traumata
Was ist der Hauptfokus dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die körperorientierte Psychotherapie bei psychischen Traumata, insbesondere die Rolle des therapeutischen Gesprächs. Sie bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Ansätze der Körperpsychotherapie und deren Wirksamkeit im Kontext von Traumata, mit besonderem Fokus auf sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Die empirische Untersuchung basiert auf ExpertInneninterviews.
Welche Themen werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil definiert zunächst den Begriff des psychischen Traumas, beleuchtet die physiologischen Grundlagen und Folgesymptome (inkl. PTSD und dissoziativer Störungen). Er behandelt verschiedene Arten von Traumata (verschiedene Ursachen, Intensitäten und Dauer), mit einem Schwerpunkt auf sexualisierter Gewalt in der Kindheit. Weiterhin werden verschiedene therapeutische Ansätze vorgestellt (verhaltenstherapeutisch, systemisch, psychoanalytisch und vor allem körperorientierte Ansätze wie die Ansätze von Reich, Levine und Eva Reich). Die Bedeutung von Körperwahrnehmung, Katharsis, Regression und Grenzen in der Therapie wird ebenfalls detailliert erläutert.
Welche Methoden wurden im empirischen Teil angewendet?
Der empirische Teil verwendet eine qualitative Forschungsmethode, nämlich ExpertInneninterviews. Es wird beschrieben, wie die Interviews durchgeführt, ausgewertet und die Gütekriterien sichergestellt wurden. Die Ergebnisse sind in drei Blöcken strukturiert: Definitionen und Symptome von Missbrauch/Trauma; generelle Aspekte in der Therapie von sexuellem Missbrauch/Trauma; und Körperpsychotherapie bei KlientInnen, die sexuell missbraucht wurden, sowie die Relevanz des therapeutischen Gesprächs. Spezifische Techniken wie Haltetherapie/Bonding, Massage, Aquafloating etc. werden im Detail behandelt.
Welche Forschungsfragen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Wirksamkeit körperorientierter Therapieansätze bei Traumata, insbesondere die Rolle des therapeutischen Gesprächs. Sie analysiert die Erfahrungen von ExpertInnen bezüglich der Behandlung von sexuellem Missbrauch und Traumata und beleuchtet die Relevanz verschiedener therapeutischer Techniken und Methoden.
Welche therapeutischen Ansätze werden im Detail betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene therapeutische Ansätze, darunter verhaltenstherapeutische, systemische und psychoanalytische Ansätze. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf körperorientierten Ansätzen. Die Ansätze von Wilhelm Reich (Bioenergetik), Peter Levine (Somatic Experiencing) und Eva Reich (sanfte Bioenergetik) werden detailliert beschrieben und deren Anwendung bei der Behandlung von Traumata erläutert. Die Bedeutung von Massage, Berührung und Haltetherapie wird ebenfalls behandelt.
Welche Rolle spielt das therapeutische Gespräch in der körperorientierten Psychotherapie?
Die Arbeit betont die entscheidende Rolle des verbalen Austausches zwischen Therapeut und Klient in der körperorientierten Therapie von Psychotraumata. Sie analysiert die Interaktion von verbaler und nonverbaler Kommunikation und deren Bedeutung für den Therapieerfolg. Eine vertrauensvolle therapeutische Beziehung wird als essentiell für die erfolgreiche Traumaverarbeitung dargestellt.
Welche Arten von Traumata werden untersucht?
Die Arbeit befasst sich mit verschiedenen Arten von psychischen Traumata, legt aber einen besonderen Schwerpunkt auf Traumata, die durch sexualisierte Gewalt in der Kindheit verursacht wurden. Es werden aber auch andere Traumata und deren unterschiedliche Intensitäten und Dauer betrachtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Körperorientierte Psychotherapie, psychische Traumata, sexueller Missbrauch, therapeutisches Gespräch, Somatic Experiencing, Bioenergetik, Katharsis, Regression, Traumaverarbeitung, ExpertInneninterviews, qualitative Forschung.
- Citar trabajo
- Juliane Gerstberger (Autor), 2001, Zur körperorientierten Psychotherapie bei psychischen Traumata. Relevanz des therapeutischen Gespräches, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/106