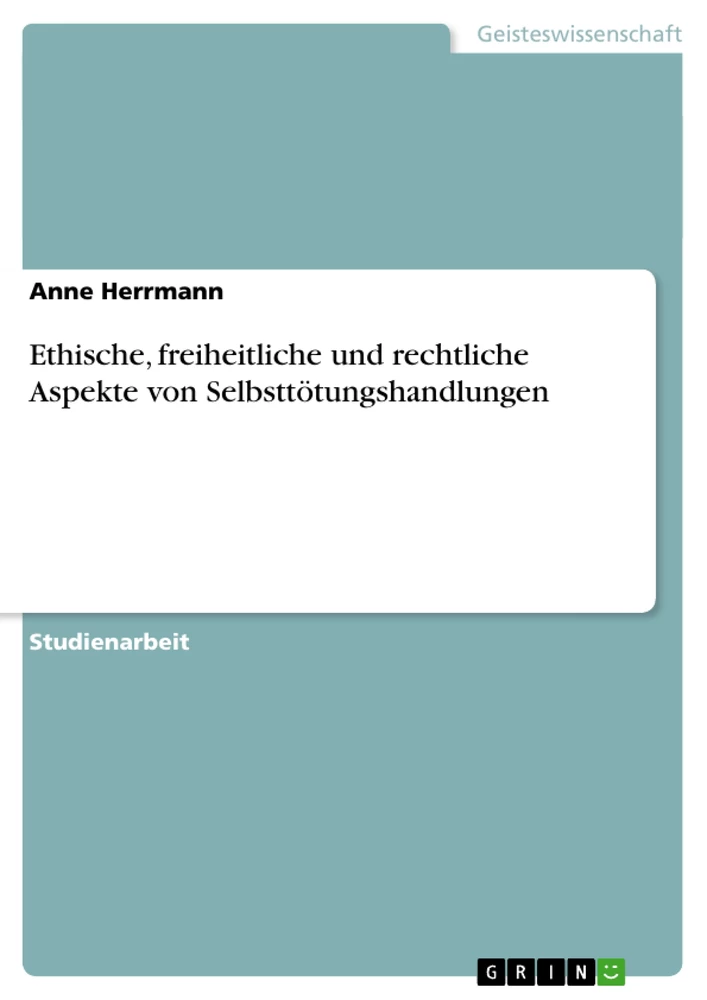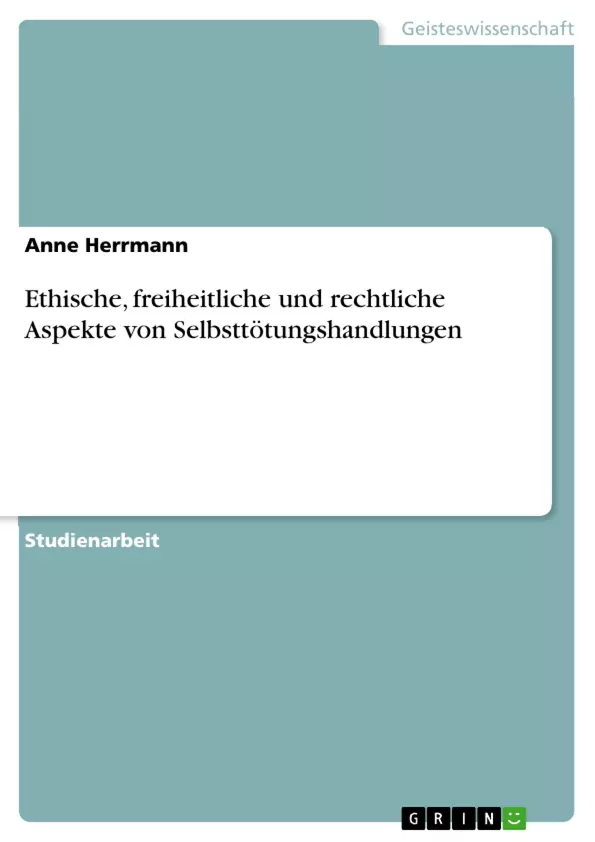Was treibt einen Menschen dazu, sich das Leben zu nehmen? Diese Frage, so alt wie die Menschheit selbst, verwebt sich in diesem Werk mit den ethischen, moralischen, freiheitlichen und rechtlichen Aspekten des Suizids und Suizidversuchs. Abseits des gesellschaftlichen Tabus, das dieses Thema umgibt, beleuchtet die Analyse die komplexen Motive und Umstände, die zu einer solch radikalen Entscheidung führen können. Von den philosophischen und theologischen Betrachtungen der Antike, die das Recht auf Selbsttötung in bestimmten Situationen forderten, bis hin zu den modernen Auffassungen, die den Suizid als Ausdruck von Verzweiflung und Verlust der Humanität sehen, wird ein breites Spektrum an Perspektiven aufgezeigt. Dabei werden die Einflüsse von Religion, Gesellschaft und individuellen Lebensumständen auf das Suizidverhalten ebenso thematisiert wie die Rolle von psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den rechtlichen Konsequenzen und der Frage, inwieweit Dritte für die Verhinderung eines Suizids verantwortlich sind. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Rechtsprechung, die sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Schutz des Lebens und der Achtung der persönlichen Freiheit bewegt, offenbart die Schwierigkeit, eine angemessene Balance zwischen Hilfeleistung und Selbstbestimmung zu finden. Dieses Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Enttabuisierung des Suizids und regt zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit diesem komplexen und sensiblen Thema an. Es richtet sich an alle, die sich beruflich oder privat mit Suizidalität auseinandersetzen oder einfach nur mehr über die Hintergründe und Ursachen dieser tragischen Lebensentscheidung erfahren möchten. Die kritische Betrachtung ethischer Dilemmata und rechtlicher Grauzonen macht dieses Werk zu einer unverzichtbaren Lektüre für Juristen, Mediziner, Psychologen, Theologen und alle, die sich für die Frage nach dem Wert und der Würde des menschlichen Lebens interessieren. Erfahren Sie, wie sich gesellschaftliche Normen und individuelle Schicksale in der Entscheidung für oder gegen das Leben widerspiegeln, und gewinnen Sie neue Einsichten in die Abgründe der menschlichen Seele. Die fundierte Analyse regt zur Reflexion über unsere eigene Haltung zum Leben und Sterben an und fordert eine humanere und verständnisvollere Auseinandersetzung mit Menschen in existenziellen Krisen.
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines / Einleitung
2 Ethische und moralische Aspekte von Suizidhandlungen
3 Freiheitliche und rechtliche Aspekte von Suizidhandlungen
4 Zusammenfassung
1 Allgemeines / Einleitung
Bis heute gehört der Suizid zu den Tabuthemen der Gesellschaft. Zum Beispiel ist nur weni- gen bekannt, dass in der Bundesrepublik Deutschland die Zahl der Toten durch Suizid höher ist als der Verkehrstoten. Der Suizid ist für die Menschen eine seltsame und mysteriöse Weise des Sterbens. Er besitzt keine Klarheit, das heißt die Ursachen für diese Art zu sterben sind meist nur spekulativ erfassbar, da sich alles nur im Kopf des Suizidenten abspielt, auch wenn er bei seinen Mitmenschen Hilfe sucht, wirkt er oft wirr und verzweifelt, so dass man nicht recht weiß was zu tun ist um ihm zu helfen. Nicht selten wird der Ernst der Situation nicht wahrgenommen oder falsch einschätzt. Da in einem solchen Augenblick zu viele ver- schiedene psychologische Komponenten auf den Selbstmordgefährdeten und auf den “Helfer“ einwirken. So wird eine nüchterne Einschätzung der Lage im Normalfall unmöglich, charak- terliche und geistige Fehleinschätzung sowie Über - und Unterschätzung des Helfers sich selbst gegenüber. Jedoch ist man schockiert, wenn der Betroffene seine Existenz tatsächlich selbst beendet, um endlich frei zu sein von seinen meist inneren Qualen.
Suizid und Suizidversuch sind Verhaltensweisen, das heißt der Mensch setzt ein bewusstes Handeln ein, mit der Konsequenz beziehungsweise mit dem Versuch die eigene Existenz aus- zulöschen. Drei Begriffe sind hier zu definieren, die Suizidideen, der Suizidversuch und der Suizid selbst. Die Suizidideen sind die Gedanken an den Tod und das Nachdenken über das Sterben bis hin zur konkreten Vorstellung der Selbstmordhandlung. Eine präzise Definition zu suizidalen Verhaltensweisen bringt STENGEL (1970): “Eine auf einen kurzen Zeitraum begrenzte absichtliche Selbstschädigung, von der der Betreffende, der diese Hand- lung begeht, nicht wissen konnte, ob er sie überleben wird oder nicht.“ (Bronisch, S.11) Für einen Suizidversuch muss eine aktive Intention zur Beendigung des eigenen Lebens vorhan- den sein. Der Suizid ist ein letztendlich zum Tod führender Selbstmordversuch. Er wird nicht als gewaltsam angesehen, da in jedem Menschen selbstzerstörerische Elemente vorhanden sind. Eine indirekte Gewalt wirkt jedoch auf jeden Suizidenten - die Gewalt der Gründe, die auf den Suizidenten einwirken und ihn in die Hoffnungslosigkeit treiben. So gut wie jeder bekommt mal Wut auf sich selber und fängt an gegen Wände zu schlagen, vielleicht sogar so lang bis man sich ernsthaft dabei verletzt hat. Der Kopf schaltet sich aus und Schmerzen spürt man nicht mehr. Man will sich selber für seine Fehler bestrafen. Dies kann bis zu extremen fast krankhaften Verhalten führen. Es existieren drei Phasen der suizidalen Handlung. Die parasuizidale Pause, d.h. der betreffen- de Mensch will “nur einschlafen und wieder aufwachen, wenn alles vorbei ist. Die meisten kennen dieses Gefühl, z.B. nach einem schlimmen Streit mit einem geliebten Menschen, während welchem Worte fielen, die verletzend und nicht mehr rückgängig zu machen sind. Oder nach einem anstrengenden Arbeitstag, an dem alles schief ging was nur schief gehen kann. Wünschte man sich da nicht, alles seie nur ein schlechter Traum aus dem man erwacht und alles ist normal. Das dies die Phase einer suizidalen Handlung sein kann, wäre wohl zu- mindest für den auf diesem Gebiet unerfahrenen Menschen zu bezweifeln. Es folgt die para- suizidale Geste, welche ein Appell (Hilfeschrei) an die Mitmenschen ist. Letztendlich erfolgt die parasuizidale Handlung, welche die Ausführung des Selbstmordes bedeutet. Die Metho- den für die Ausführung des Suizids sind sehr verschieden, da sie aus den Vorstellungen des Suizidenten entstehen. Hinzu kommt noch die Nachahmung von Selbttötungsversuchen. Männer bringen sich häufig um bzw. versuchen es mit sogenannten harten Methoden, wie z.B. sich die Pulsadern sich aufzuschneiden. Während Frauen lieber die weiche Methode wählen, z.B. die Einnahme von Medikamenten, wie Schlafmittel. Verschiedene Faktoren wirken auf die suizidale Handlung ein: Das Geschlecht, Männer be- gehen öfter den Suizid, während Frauen eine höhere Suizidversuchsrate aufweisen. Das Alter spielt ebenfalls eine große Rolle, 15 - 34 jährige neigen eher zu Selbstmordversuchen, während bei Menschen jenseits des 50. Lebensjahres bis ins hohe Alter der Tod durch Suizid häufiger ist. Der Personenstand, unverheiratete Männer sind fünf mal mehr gefährdet sich selbst zu töten als verheiratete. Der Arbeitsstand, Arbeitslosigkeit steht in engen Zusammen- hang mit Suizid und dessen Versuch. Ebenso wirken jahreszeitliche Schwankungen auf die Suizidrate ein. Im Frühling und im Sommer tritt der Suizid und der Suizidversuch häufiger auf als in den anderen Jahres- zeiten. Die Erklärung hierfür ist allerdings nicht gegeben. Außerdem gibt es Stadt - Land - Unterschiede. In den meisten Ländern befindet sich eine hohe Suizidrate in städtischen Gebieten, während in ländlichen Gegenden die Rate niedrig ist. Weiterhin spielt auch die Religionszugehörigkeit eine Rolle, in katholischen Ländern und Gebieten sind die Suizid - und Suizidversuchsraten niedrig. Nicht selten wird das anscheinend Unerklärliche des Suizids auf Krankheit und Suchtverhalten zurückgeführt. Eine zentrale Rolle spielt in diesem Zusammen- hang die Depression. (Kaiser, S.28) Eine Theorie von Freud beschäftigt sich mit der psycho- analytischen Auffassung der Depression. Er vergleicht zwischen depressiven Zustanden und Trauer, die durch den Tod eines geliebten Menschen zustande kommen. Trotz der Unvollständigkeit dieser Theorie, scheinen einige Suizidfälle dadurch erklärbar. Offenbar geht meistens eine Depressionsform dem Suizidversuch vor raus. Dennnoch gibt es einige Fälle, bei denen dies nicht der Fall ist. Aber Freuds Theorie zur Depression ist trotz alledem relevant für die Suizidforschung.
2 Ethische und moralische Aspekte von
Selbstmordhandlungen
Die Gesellschaft hat einen großen Einfluss auf den Suizidenten, wie schon im vorherigen Kapitel angrführt. Doch sie schweigt über das Thema und hat ethische, moralische Bedenken. Aber der Selbstmord wird immer ein Bestandteil menschlichen Seins bleiben. Er ist zeitunab- hängig. AMÉRY (1976) meinte,dass der Suizid dem Menschen Humanität, Würde und Freiheit be- wahrt und ihn somit vor einem inhumanen, unwürdigen und unfreiem Leben schützt, welches von der Gesellschaft geprägt wird. Die Freiheit selbst zu bestimmen, wann und wie man sterben will, kann und sollte man niemanden nehmen. Jeder will in Würde ster- ben, für die einen ist es der Selbstmord für die anderen der natürliche Tod. Dies sollte man akzeptieren und nicht verurteilen. Das Leben wird von der Gesellschaft bestimmt, aber den Tod sollte man selber wählen dürfen. Schließlich beschreibt schon die Antike das würdige Sterben mit Hilfe des Suizids. Dazu jedoch später. Ethische und rechtliche Probleme der Selbsttötungshandlungen sind eng miteinander ver- knüpft. Insofern müssen sich rechtliche bzw. strafrechtliche Bewertungen von Suizidhand- lungen und deren Begleitumständen auf ethische Normen stützen.
Das ethische Problem des Suizids beschäftigte durch alle Zeiten hindurch die Philosophen und
Theologen. Es ist wie CAMUS schon sagte, ein vorrangiges Problem der Philosophie. Theolo- gen und Philosophen kamen oft zu verschieden, einander ausschließenden Resultaten, die bestimmt waren von verschiedenen zeit - und systemgebundenen Voraussetzungen. Worauf jetzt näher eingegangen wird. In der Frühzeit galt die Überzeugung, der Mensch verstoße mit der sogenannten Selbstentleibung gegen die Gottheit. Kontroverse Standpunkte wurden schon in der philosophischen Frühgeschichte aufgezeichnet. Zum Beispiel PLATON vergleicht den Suizidenten mit einem Wächter, der ungebeten seinen Posten verlässt. Doch für Platon ist der Suizid unter bestimmten Umständen gerechtfertigt wie bei “unheilbarem Leiden oder schlim- men Leidenschaften“, die es dem Menschen erlauben in seine Schicksalsbestimmung einzu- greifen und den eigenen Tod zu wählen. (Holderegger, S.128) Doch wer definiert “unheilbares Leiden“ und “schlimme Leidenschaften“? Jeder Mensch empfindet anders. Deshalb wäre jede Definition viel zu subjektiv. Foglich wird durch ein Gericht oder die Gemeinschaft festgelegt was unheilbar, schlimm, Leid und Leidenschaft ist. ARISTOTELES meint dazu bestimmter, “nur ein Feigling, der sich aus der Gemeinschaft stehle, könne sich selbst umbringen.“ (Holderegger, S.129) Hier kommt erneut der Einfluss der Gesellschaft zum Ausdruck. Der “Feigling“ flieht vor der Gesellschaft und deren Vorstellungen. Ein Mensch mit seinem Ver- stand und Emotionen kann und will auf Dauer der Gesellschaft und deren Normen nicht entgegenwirken, da er sich ihr aber auch nicht fügen will, bleibt ihm letztlich nicht anderes übrig als “sich aus der Gemeinschaft zu stehlen“. Dies sei ein Verstoß gegen die Gesellschaft sowie gegenüber dem Staat. (Lungershausen, S.173)
In der römischen Antike dagegen forderte man das Recht auf Selbsttötung. Es galt regelrecht als eine Tugend. Selbstmord galt weder als Vergehen gegen die eigene Person noch gegen die Götter. Die Stoiker sagten: “Jedem stehe die Tür offen, das Leben zu verlassen, wenn ihn Ungemach und geistige Umnachtung ereile.“ (Holderegger, S.129) ZENON, der Gründer der Stoa (Philosophenschule) sieht in krisenhaften, unüberwindbaren Situationen des Lebens den Selbstmord nicht nur als erlaubt, sondern geradezu als Notwendigkeit an. Dieser Gedanke wird in der späteren Stoa fortentwickelt und findet besondere Priorität bei SENECA. Er bewertet den Freitod, als die Tat der menschlichen Freiheit. (Lungershausen, S.173) Somit heißt die sogenannt Losung der Stoiker: “Die Natur hat nur einen Eingang in das Leben geschaffen, aber viele Ausgänge, und dies ist der Vorzug des vernünftigen Menschen vor dem Tier ... Sie (die Philosophie) lehrt, den selbstgewählten Tod dem natürlichen vorzuziehen, den nur Toren einen schönen Tod nen- nen mögen.“ (Holderegger, S.129) Diese und zahlreiche weitere Argumente tauchten in den darauf folgenden Jahrhunderten immer wieder in neuer abgewandelter Form bei den Diskus- sionen über das ethische Problem des suizidalen Handels auf. Dazu sagt GOETHE: “Der Selbstmord ist ein Ereignis der menschlichen Natur, welches mag noch so viel darüber gesagt und geschrieben sein in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß.“ (Lungershausen, S.173)
In der Neuzeit verneinen Philosophen unter anderem KANT und HEGEL, die in christlicher
Tradition stehen, das Recht der Menschen sich selbst das Leben zu nehmen. Kant behauptete aber nicht, dass die Selbsttötung verboten sei, weil Gott dies so wollte, sondern weil es ein- fach unmoralisch und verwerflich sei seine eigene Existenz selber zu beenden. “Das Subjekt der Sittlich- keit in seiner eigenen Person zu vernichten, ist ebensoviel als die Sittlichkeit selbst ihrer Exi- stenz nach, soviel an ihm ist, aus der Welt zu schaffen.“ (Holderegger, S.129) Kant meint, Selbsttötung sei eine ausgezeichnete Möglichkeit bzw. Freiheit des Menschen, doch dies dürfe nicht zur Selbstvernichtung missbraucht werden, da dies der Weisheit der Natur widerspräche. HUME, ein Zeitgenosse Kants ist anderer Meinung. Selbstmord sei weder ein Verstoß gegen Gott noch gegen die Gesellschaft, sondern es ist ein gegebenes Recht der menschlichen Natur. (Holderegger, S.129) Denn nur das intelligenteste Wesen auf der Erde, der Mensch hat die Wahl zwischen selbstgewähltem und natürlichem Tod. Daher sollte er mit Hilfe seines Verstandes diese Möglichkeiten auch nutzen können.
Ein bedeutender Autor unserer Zeit ist JEAN - PAUL AMÉRY. Er bezeichnet den Suizid äußerst konsequent und bewusst als “Freitod“. Es ist “[...] eine Möglichkeit des gescheiterten Menschen, in einem Akt letzter und höchster Freiheit, in Humanität und in Dignität, dieses Scheitern zu enden.“ (Lungershausen, S.173) Nach seiner Überzeugung wählte Améry selbst den Suizid als seine letzte Freiheit.
Die Antwort auf die Suizidfrage zu finden, wird durch die tiefgreifenden Überlegungen der Neuzeit nicht leichter. Da mehr und mehr Faktoren zum Vorschein kommen, die mit dem Selbstmordproblem verknüpft sind. Es werden in diesem Zusammenhang verschiedene Fragen nach der Wertigkeit, Bedeutung und Sinn des Lebens berührt. Über die Bedeutung oder den Sinn des Lebens lässt es sich jedoch endlos philosophieren, so das es unmöglich ist eindeutig festzulegen, ob man sich selbst töten darf, weil man eine angeblich bestimmte Rolle auf dieser Welt spielt. Wie soll einem Selbstmordgefährdeten erklärt werden, dass er etwas Einzigartiges auf unserer Erde ist und das Gott noch viel mit ihm vor hat, wenn er schon alles, Familie, Freunde, Arbeit verloren hat. Die Stellung des Menschen zu seiner eigenen Existenz sowie zu Gott und der Welt werden hinterfragt. Ein Argument des Suizidenten ist, dass Keiner ihn, auch Gott nicht gefragt hat, ob er geboren werden will, wenigstens die Entscheidung, die Welt zu verlassen wann er will, soll ihm überlassen werden. Dies weist ein weiteres Problem auf: Ist das Suizidproblem überhaupt rational lösbar? Ein kurzer Blick auf die theologische Problematik des suizidalen Verhaltens. Es gibt wohl kaum eine Religion, die Selbstmord befürwortet, abgesehen von der Selbstaufopferung für andere. Der Krieg und die Todesstrafe sind generell durch christlichen Glauben negativ behaf- tet. Doch Krieg ist auch eine Aufopferung für andere, sogar für einen Staat, aber ob dies ein würdiger Tod ist, mag bezweifelt sein. Außerdem sollte man beachten, wie viele Kriege in Gottesnamen geführt wurden sind. Und dennnoch verurteilen die Christen den Krieg, als Verstoß gegen das 5. Gebot. Vor allem die beiden großen christlichen Konfessionen lehnen den Suizid ab. Allerdings in einer differenzierten und zurückhaltenderen Betrachtung- weise im Gegensatz zur früheren kategorischen Ansicht. Wie schon das 5. Gebot besagt: “Du sollst nicht töten!“ Dazu meint der christliche Kirchenvater Augustin: “Denn wer sich selbst tötet, der tötet auch nichts anderes als einen Menschen. (De civitate die)“ (Ebeling, S.219) Nur mit dem Unterschied, dass der Selbstmörder eigenständig entscheidet, wann und wie er sterben möchte. Ein Opfer eines Mörders dagegen hatte keine Wahl zwischen Leben und Tod. Es sei auch HÄRING erwähnt: “Schon natürlicherweise ist der Selbstmord eine Verirrung, ein Zuwiderhandeln gegen den stärksten Naturtrieb, den Selbsterhaltungstrieb. Religiös gesehen ist der Selbstmord der Ausdruck, der höchsten Eigenmächtigkeit, des Trotzes und der Verzweiflung.“(Lungershausen, S.174) Er stellt aber auch fest, dass es kaum möglich sein wird über die subjektive Schuld des Einzelnen zu urteilen. “Das mildere Urteil ist nicht nur menschlich und christlich richtiger sondern wahrscheinlich auch zutreffender.“ (Lungershausen, S.174) Ein weiteres Argument der Christen ist, dass Gott das Leben gegeben hat und nur er es nehmen darf. Ist damit das Suizidproblem mit Hilfe des Glaubens an Gott gelöst?
3 Freiheitliche und rechtliche Aspekte von Selbstmordhandlungen
Mit moraltheologischen Überlegungen, wie zum Beispiel die von Häring, beschäftigten sich auch der Deutsche Bundesgerichtshof (BGH), als er am 10.03.1954 zur Entscheidung kam, dass in Zukunft die “strenge Mißbilligung des Selbstmordes generell durch das Sittengesetz“ zum Ausdruck kommen soll. Es kam daraufhin zu Diskussionen und Kritik, z. B. erklärt SIMON: “In einer toleranten, freiheitlichen, pluralistischen Gesellschaft ist dies unzulässig. In ihr ist der Richter nicht legitimiert, Moralvorstellungen der religiösen Gemeinschaften mit harten Strafdrohungen bei Andersdenkenden durchzusetzen. Dies verletzt seine Plicht, als Sittennormen nur allgemeine ( und nicht nur theologische) Wertsetzungen von eindeutiger Erkenntnisfähigkeit, zweifelsfreier Gewißheit und feststellbaren Grenzen zugrundezulegen. Dies kränkt vor allem das hohe demokratische Prinzip der Achtung vor sittlich vertretbaren Weltanschauungen anderer Gruppen.“ (Lungershausen, S.174) Hiermit könnte das Fehlen oder sogar das Missachten der Meinungs - und Religionsfreiheit gemeint sein. Dement- sprechend wäre es wohl nicht sinnvoll Moralvorstellungen zu verurteilen oder sogar zu be- strafen. Genauso absurd ist es sie theologisch abhängig zu machen. Da man den Glauben nicht verallgemeinern kann.
Die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung zum Suizid ist sehr umstritten, bewegt sie sich doch in einem “Zick - Zack - Kurs“. Dies begann schon in der Nachkriegszeit, durch die vielen Selbstmorde der Beteiligten im Krieg, die diesen schrecklichen Zustand, den der Krieg hervorgerufen hatte nicht ertragen konnten - viele verloren ihre Lebensgrundlage und Lebens- sinn. Sie wurden ihrer Familien beraubt oder kamen mit der neuen Situation, die sie vorfan- den, nicht zurecht. Ein Leben ohne Krieg schien vielen unmöglich und eine Eingliederung in die normale Gesellschaft mit ihren alltäglichen Problemen war für sie wohl nicht mehr vor- stellbar. Außerdem konnten sie sicher all die Ängste, denen sie im Schützengraben oder im Lazarett ausgesetzt waren nie vollständig oder auch nur Ansatzweise verarbeiten, da es an psychologischer Betreuung fehlte und auch nie daran gedacht wurde durchzuführen. Folgendes gilt aber gesichert: im deutschem Strafrecht sind der Suizid und der Suizidversuch seit 1751 keine strafbaren Handlungen mehr. So müsste aber zwangsläufig das Mitwirken Dritter durch ihr Tun oder Unterlassen, dies entspräche Anstiftung oder Beihilfe, auch straflos bleiben, denn diese beiden Arten der Teilnahme setzen eine strafbare Haupttat und damit die Selbsttötung oder dessen Versuch vor- aus. Dies besagen die Paragraphen 26 und 27 des Strafgesetzbuches (StGB). (Lungershausen, S.174) Dieses 'Problem' des Tuns und Unterlassens eines Dritten betraf meistens Ehepartner bzw. auch Lebensgefährten, die eine Schutz - und Fürsorgepflicht in einer Partnerschaft eingehen auch ohne rechtliche Grundlagen. Hier könnte es zu Diskussionen kommen, ob das Zulassen eines Suizids des Partners nicht auch zu diesen Pflichten gehört. Da es der Wille des Suizidenten ist und er nur so glücklich sein kann, das heißt man schützt die Freiheit des Partners, oder sollte man den Partner lieber vor sich selber schützen, in dem man den Suizid verhindert und ihn einer “Therapie“ unter- zieht, die den Willen sich zu töten in einigen Fällen noch verstärken könnte.
In diesem Zusammenhang führt der Bundesgerichtshof den Begriff des “Garanten“ aus dem bürgerlichen Recht ein. Garant ist von Garantie abgeleitet und soll dafür sorgen, dass be- stimmte Schäden nicht eintreten. Beispielsweise sind verschiedene Garantenstellungen, die Arbeit eines Polizisten oder eines Anwaltes zur Wahrung des Rechts oder ein Arzt hinsicht- lich der Wahrung der Gesundheit. Somit ist auch der Ehegatte verpflichtet seinem Partner in Gefahren beizustehen und ihn von Straftaten abzuhalten und abzuraten. Was jedoch verwir- rend ist, da der Suizid an sich keine Straftat sein sollte. Dennnoch bedeutet es, im Falle einer suizidalen Handlung oder dessen Vorhaben wird erwartet, dass der Ehepartner versucht dies zu verhindern und somit dessen Folgen einzuschätzen. Was beinahe unmöglich ist. Zum Bei- spiel bei einer Schlafmittelintoxikation sollte der Partner eine Einweisung in die Klinik veran- lassen oder zu mindest einen Arzt heranziehen. Genauso sollte er bei Verletzungen, so weit es ihn möglich ist, Erste Hilfe leisten. Tut er dies nicht, fördert er durch Unterlassen die Suizid- handlung. Da er sich aber in einer Garantenstellung zu seinem Partner befindet, die rechtlich unterstützt ist, macht er sich damit strafbar. Doch die Rechtsprechung weist Lücken auf. Sie geht dahin, dass der Ehepartner, trotz der Billigung der Selbstmordhandlung freigesprochen werden kann, wenn er angibt, dass er sich dem Willen des Anderen (Suizident) untergeordnet hat. Gibt er dagegen an, dass der Ausgang der Suizidhandlung ihm gleichgültig gewesen sei, macht er sich infolge des Eventualvorsatzes des Totschlages für schuldig. Es kommt “minder schwerer Form des Totschlags“ zu einer Bestrafung nach Paragraph 213 des StGB. Doch solche Anklagen sind selten, denn der Beweis lässt sich kaum auf den einen oder anderen Schachverhalt bezogen, führen. Fazit ist die erstaunliche Tatsache, dass Anstifftung und Beihilfe zum Selbstmord, zu denen man die Internetseiten, die Anleitungen zum Suizid geben, hinzuzählen kann, straflos bleiben. Die Förderung jedoch durch Unterlassen der Hilfeleistung ist strafbar. Ein Beispiel dazu: Das Herumliegen lassen von Medikamenten (z.B. Schlafmittel) mit denen eine Selbsttötung durchgeführt wird, ist eine fahrlässige Mitverursachung, dies bliebe straffrei. Ebenso wie Gespräche über Selbstmord, die man auch weltweit im Internet führen kann, die für jeden zugänglich sind und welche man als Anstiftung auslegen könnte, werden nicht bestraft. Es sei denn es handelt sich bei diesen Gesprächen um erpresserische Drohungen.
Bei diesen Beispielen wurde davon ausgegangen, dass es sich bei den Suizidenten um erwach- sene und zurechnungsfähige Menschen handelt. Im Falle der Zurechnungsunfähigkeit oder Minderjährigkeit ist auf jeden Fall die Pflicht der Verhinderung der suizidalen Handlung ge- geben, dabei ist eine Garantenstellung nicht relevant. (Lungershausen, S.175) Nach einer Ent- scheidung 1952 des Bundesgerichtshofes handelt es sich bei einem Versuch sich das Leben zu nehmen um einen “Unglücksfall“. Wobei sich jeder und nicht nur der Garant strafbar macht, wenn er keine Hilfe leistet, um den Suizid zu verhindern oder er keinerlei Maßnahmen er- greift, um dem verletzten Suizidenten zu helfen. Nach dieser Entscheidung vertrat der BGH in einem Urteil von 1954 die Ansicht, dass der Sinn der Entscheidung durch den Para- graph 330c des Strafgesetzbuches festgelegt wird. Dieser Paragraph besagt dementsprechend folgendes: “Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, ob- wohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erheb- liche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft.“ (Lungershausen, S. 175) Dieses Gesetz wendet sich somit grundsätzlich an jeden Staatsbürger. Vor allem trifft dieses Urteil auf Ärzte zu, die Eingreifen und Helfen müssen, insbesondere dann wenn der Patient keinen verantwortlichen Willen mehr bilden kann, das heißt Förderung und das Nicht - Helfen macht den Arzt strafbar. Hier könnte man die umstrittene Sterbehilfe anbringen. Die Pflicht, die der Arzt hat, das Leben des Patienten zu schützen, gilt vor allem für psychisch Kranke sowie Personen, die zum Zeitpunkt der suizidalen Handlung unzurechnungsfähig waren und Jugendliche von 10 - 18 Jahren. (Lungershausen, S.175) Man sollte das Vorbeugen nicht vom Alter abhängig machen, denn wie erwiesen ist, begehen Ältere speziell jenseits des 50. Lebensjahres häufiger Suizid als 10 - 18 Jährige. Diese müssen doch nicht gleich zu den Unzurechnungsfähigen zu geordnet werden. Die Prävention sollte keine Grenzen kennen. Hat zum Beispiel ein Arzt, dem ihm anvertrauten Selbstmordversuch eines psychisch Kranken bzw. eines Kindes oder Jugendlichen nicht vorgebeugt, weil er aus Nachlässigkeit nicht an die Möglichkeit eines Suizids gedacht hat oder er auf dessen Ausbleiben vertraut hat, so könnte er nach Paragraph 222 des Strafgesetzbuches wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden. Kri- tisch wird es vor allem für dem Arzt, wenn schon Selbstmordversuche in der Vorgeschichte des Patienten auftauchten. (ROXIN)
1975 kam es zu einem Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt. Hiernach verletzt ein psychatrisches Krankenhaus seine Sorgfaltspflicht gegenüber dem Patienten, wenn es bei ihm die Möglichkeit eines Suizidversuches gibt und der Patient sich nicht in einer offenen Abtei- lung befindet. Doch es ist paradox, dass laut Gericht in einer offenen Abteilung kein Patient unbemerkt seine Station oder gar das Haus verlassen kann Also im Grunde genommen ebenfalls eine geschlossene Abteilung. Es kam zu Unruhen bei den Psychatern, sowie zu Diskussionen und Widersprüchen. (Lungershausen, S.176-177) Darauf soll hier nicht weiter eingegangen werden, denn dies würde zu weit führen.
4 Zusammenfassung
Der Suizid ist ein vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Problem der Gesellschaft und es beschäftigt Disziplinen wie z.B. der Psychologie oder Biologie. Trotz alle dem bleibt es ein Tabuthema. Obwohl Angehörige sowie die Gesellschaft mit ihren Moralvorstellungen und Normen sich mit dem Thema des Selbstmordes auseinandersetzen sollten und nicht darüber schweigen. Außerdem sollten sie weiterhin den Willen des Verständnisses und der Toleranz gegenüber dem Betroffenen (ob nun Suizident oder Angehörige) aufbringen. Sie sollten nach Ursachen suchen und es sich nicht einfach machen, in dem sie den Suizidenten einfach verur- teilen für seinen Weg aus dem Leben zu scheiden, weil er keine andere Lösung sah. Desweiteren sollte man sich mit der Prävention beschäftigen, ob dies Nutzen bringt und die Suizidrate senken könnte, denn der größte Teil der Selbstmörder kündigen ihr Vorhaben an. Denn Fakt ist, dass so gut wie jeder Mensch schon mal an Selbstmord gedacht hat und die Gründe sind meistens von gesellschaftlicher Natur und dennnoch unterschiedlich, ob nun Probleme in der Familie, Beruf oder Ausbildung oder weil der Betroffene gegen die sogenan- nte Norm verstößt, wie Homosexualität, Transvestit ect. Doch die Mitmenschen schließen oftmals die Augen, weil sie es nicht wahrnehmen können oder gar nicht wollen. Schließlich gehören sie ja auch nur zur Gesellschaft.
Einen großen Teil zur Abneigung des Suizids in der Gesellschaft trägt auch die Bibel bei, sie ist Weltliteratur und Kulturerbe, da nicht nur Christen mit Passagen der Bibel vertraut sind. In ihr wird die Suizidhandlung abgelehnt, aber Gott hat dem Menschen doch das Recht der freien Entscheidung über sein Leben, seine Umwelt und was er daraus macht gegeben. Wie sind sonst die ganzen Kriege und auch Fortschritte der Menschheit zustande gekommen? Ist der Selbstmord nicht mit einbezogen in die Möglichkeit frei zu entscheiden? Man könnte hier je- doch aber gleich entgegen bringen, wenn Selbsttötung zur Entscheidungsfreiheit gehört, warum nicht auch das töten von anderen Menschen? Hier kommt man auf den juristischen Aspekt zu sprechen. Töten von anderen Menschen ist verboten. Schließlich ist es ja auch möglich den Mörder zu bestrafen nach seiner Tat, da ja meistens er zumindest noch lebt. Außerdem konnte der Ermordete nicht selbst entscheiden, dies ist ein relevanter Punkt. Doch wie will man einen Selbstmörder bestrafen? Also kann man im Grunde niemanden verbieten sich umzubringen, da er ja sowieso nichts zu verlieren hat. Doch der Versuch einem anderen Menschen das Leben zu nehmen ist doch auch schon strafbar, aber der Versuch seinem eige- nen Leben selbst ein Ende zu setzen, ist nicht strafbar. Es würde wohl wenig Sinn haben einen Suizidenten zu bestrafen, denn dem würde er gleichgültig gegenüber stehen und alles daran setzen diese Schande zu beenden mit Hilfe des Suizids. Es wäre absurd ihn in ein Ge- fängnis oder psychatrische Anstalt einzusperren, dies würde wie schon gesagt das Gefühl zu sterben nur verstärken, vielleicht kann man später wieder darauf zurück kommen, wenn keine Suizidgefahr mehr besteht, aber trotzdem sollte man ein mildes Urteil fällen. In erster Linie braucht der Selbstmordgefährdete fachliche Hilfe (aber keine psychatrische Anstalt) und auf jeden Fall die Unterstützung der Familie und der Freunde und keine Strafen oder Vorwürfe, auch wenn er durch sein (suizidalem) Handeln andere Menschen in Gefahr gebracht hat.
Wie schon AMÉRY (1976) meinte, ist der Suizid, die Möglichkeit human, in Würde und in Freiheit zu sterben. Aber oftmals sind Suizid und Suizidversuche keine abgewogene Hand- lungen. Es sind meistens Impulshandlungen, die in einem Affekt erfolgen. Einerseits ist der Suizidbetroffene oftmals froh, wenn der Suizidversuch misslungen ist und er sieht eine neue Perspektive für ein humanes, würdiges und relativ freies “neues“ Leben. Andernseits ist je- doch der Weg vor dem Suizid oder dessen Versuch schon gepflastert mit Erlebnissen und Er- fahrungen, die eine Einengung des Selbst hervorrufen, die wiederum zu einer Aggression gegen das eigene Ich führen. Es folgt die Flucht in die Irrrealität. In solchen Fällen ist es nicht möglich für den Suizidenten freie Entscheidungen zu treffen. Dies trifft vor allem auf Men- schen mit Depression, Sucht, Panik und Schizophrenie zu. Deshalb ist das Beisein und die Beihilfe, sowie das Helfen und Verhindern einer Selbsttötung ein umstrittenes Thema. Ja, jeder sollte versuchen den Selbstmord eines Anderen zu Verhin- dern, auch auf die Gefahr hin, dass der gerettete Suizident seinen Retter verachtet und / oder sogar aggressiv ihm gegenüber reagiert, da er dem Betroffenen die “letzte Freiheit“ genom- men hat. Dieser selbstmordgefährdete Mensch wird es immer weiter versuchen sich zu töten, bis er vielleicht nach unzähligen Versuchen und Rettungsmaßnahmen sein Ziel endlich er- reicht hat, durch den selbst gebrachten Tod in Frieden zu ruhen. Doch diese Personen schei- nen oftmals körperlich sowie geistig völlig abwesend zu sein. Sie reagieren weder auf Fami- lienangehörige noch auf Freunde und schon gar nicht auf psychatrische Fachkräfte. Dies weist auf eine Unzurechnungsfähigkeit hin.Man sollte nicht einfach nur wegschauen oder meinen, dass es einem nichts anginge, da man die betreffende Person kaum oder gar nicht kennen würde. Was ist das für eine Gesellschaft und für ein Zusammenleben, wenn die Menschen sich gleichgültig gegenüberstehen? Dies hat Gott auch nicht gewollt. Schließlich ist oftmals der Suizident glücklich, wenn er gerettet wor- den ist, da ihm klar wird, das sich jemand und sei es “nur“ ein Fremder für ihn bzw. für das was er tut interessiert. Er wird sich dann nicht mehr unverstanden, verlassen und einsam füh- len, sondern er wird neu motiviert zu Leben. Doch dies ist leider von Fall zu Fall verschieden und man kann meistens den Suizident nicht konkret zu der einen oder anderen Gruppe zuord- nen, was die Vorbeugung und die Therapie der Suizidproblematik sehr erschwert. Aber die Allgemeinbevölkerung sollte auf jeden Fall aufgeklärt werden, denn die meisten Suizidgefähr- deten geben Signale, sogenannte Hilfeschreie über ihr Vorhaben an ihr Umwelt, die mit Vor- sicht zu geniesen sind und mit erhöhter Aufmerksamkeit betrachtet werden sollten, das heißt man sollte den Betroffenen beobachten vielleicht sogar ansprechen, aber dies mit viel Gefühl. Man sollte genau abwägen, das heißt die Situation des Hilfeschreis weder über noch unter bewerten.
Literaturverzeichnis
Bronisch, T. (1995): Der Suizid. München: Beck
Holderegger, A. (1986): Ethische Probleme des Suizids. In: Haesler, w.t. & Schuh, J. (1986) (Hrsg.): Der Selbstmord - Le Suicide. Grüsch. Rüegger; S.125 - 140
Kamlah, W. (1984): Meditation mortis - Kann man den Tod 'verstehen' und gibt es ein Recht auf den eigenen Tod? In: Ebeling, H. (Hrsg.): Der Tod in der Moderne. Frankfurt a.M.: Syndikat; S.216
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptgegenstand dieser Sprachvorschau?
Diese Sprachvorschau behandelt das Thema Suizid, seine ethischen, moralischen, freiheitlichen und rechtlichen Aspekte. Sie umfasst eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, Schlüsselwörter und ein Inhaltsverzeichnis.
Welche Definitionen von Suizid werden in der Einleitung gegeben?
Die Einleitung definiert Suizidideen, Suizidversuche und den Suizid selbst. Suizidideen sind Gedanken an den Tod, Suizidversuche sind absichtliche Selbstschädigungen mit unklarem Ausgang bezüglich des Überlebens, und Suizid ist der letztendlich zum Tod führende Selbstmordversuch.
Welche Faktoren beeinflussen suizidales Verhalten laut der Einleitung?
Die Einleitung nennt verschiedene Faktoren, die suizidales Verhalten beeinflussen, darunter Geschlecht, Alter, Personenstand, Arbeitsstand, jahreszeitliche Schwankungen, Stadt-Land-Unterschiede und Religionszugehörigkeit.
Welche ethischen Aspekte des Suizids werden im zweiten Kapitel diskutiert?
Das zweite Kapitel diskutiert ethische und moralische Bedenken der Gesellschaft bezüglich des Suizids. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Menschen das Recht haben, selbst über ihren Tod zu bestimmen.
Wie haben Philosophen und Theologen das ethische Problem des Suizids betrachtet?
Das Kapitel beleuchtet unterschiedliche Standpunkte von Philosophen wie Platon, Aristoteles, Kant und Hume, sowie die theologische Sichtweise, die Selbstmord oft ablehnt.
Welche rechtlichen Aspekte des Suizids werden im dritten Kapitel behandelt?
Das dritte Kapitel behandelt die freiheitlichen und rechtlichen Aspekte von Selbstmordhandlungen in Deutschland, insbesondere die Rolle des Bundesgerichtshofs (BGH) und die Strafbarkeit der Mitwirkung Dritter.
Ist Suizid in Deutschland strafbar?
Nein, Suizid und Suizidversuch sind in Deutschland seit 1751 keine strafbaren Handlungen mehr.
Welche Rolle spielt die Garantenstellung im deutschen Recht in Bezug auf Suizid?
Der BGH führt den Begriff des "Garanten" ein, der verpflichtet ist, bestimmte Schäden zu verhindern. Ehepartner haben eine Schutz- und Fürsorgepflicht, aber die Rechtsprechung ist umstritten, ob das Zulassen eines Suizids des Partners auch zu diesen Pflichten gehört.
Was passiert, wenn ein Arzt einem psychisch Kranken oder einem Jugendlichen nicht bei der Verhinderung eines Suizids hilft?
Wenn ein Arzt einem ihm anvertrauten Selbstmordversuch eines psychisch Kranken bzw. eines Kindes oder Jugendlichen nicht vorgebeugt, könnte er nach Paragraph 222 des Strafgesetzbuches wegen fahrlässiger Tötung verurteilt werden.
Was ist die Hauptaussage der Zusammenfassung?
Die Zusammenfassung betont, dass Suizid ein vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges Problem der Gesellschaft ist und dass es wichtig ist, sich mit Prävention zu beschäftigen und den Betroffenen Verständnis und Toleranz entgegenzubringen.
- Quote paper
- Anne Herrmann (Author), 2001, Ethische, freiheitliche und rechtliche Aspekte von Selbsttötungshandlungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107097