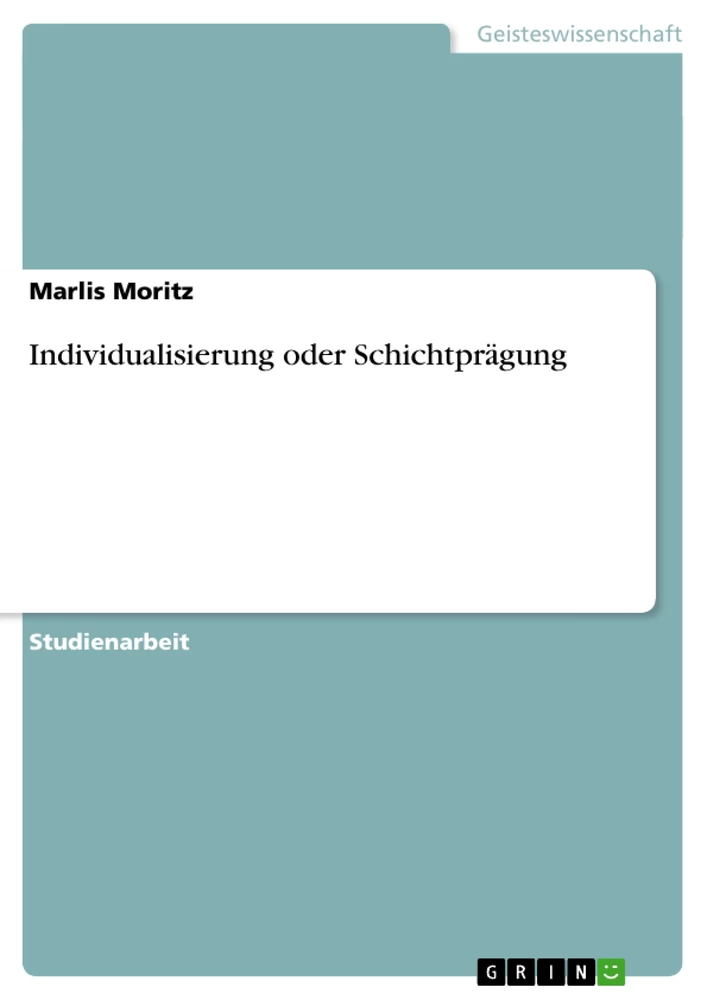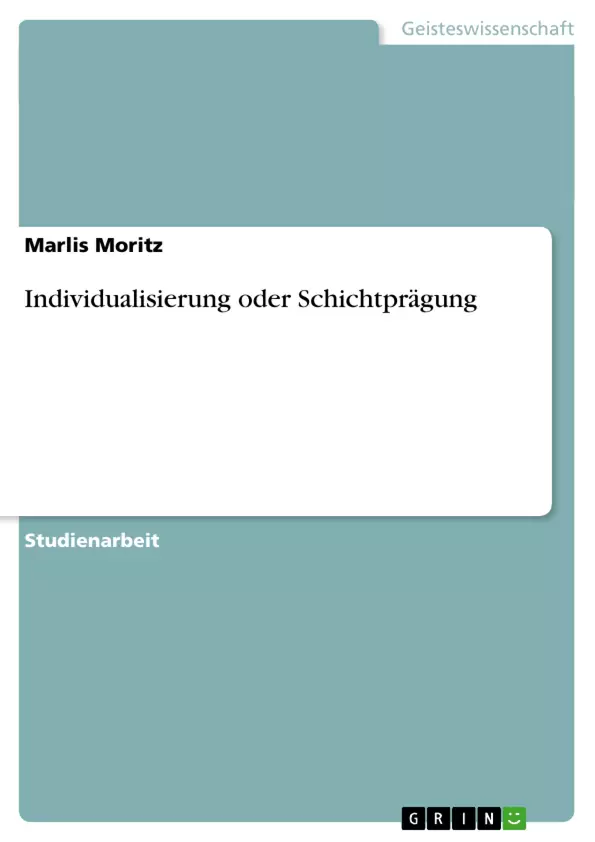INHALTSÜBERSICHT
Einleitung
1 Definitionen
1.1 Individualisierung
1.2 Mobilität
1.2.1 Soziale Mobilität
1.2.2 Vertikale Mobilität
1.2.3 Strukturelle Mobilität
2 Historische Wandlungen des Aufstiegsbewußtseins
3 Soziale Bestimmungsgründe der Aufstiegschancen
3.1 Personenbezogene Beeinflussungsfaktoren
3.2 Systembezogene Beeinflussungsfaktoren
3.3 Gesamtgesellschaftlich wirkende Beeinflussungsfaktoren
4 Bildung als Individualisierungsfaktor?
4.1 Soziale Schichtung, Bildungsweg und Bildungsziel
5 Der Beruf als Stabilisator sozialer Schichten
6 Schlußfolgerungen
6.1 Individualisierung als Zauberwort?
6.2 Was bringt die Zukunft?
Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach der Individualisierung in unserer Gesellschaft. Sind nicht alle Menschen von vornherein so stark durch ihre jeweilige „Schicht“ geprägt, daß ihnen sowohl der Mut als auch die Möglichkeiten fehlen, aus dem vertrauten Milieu auszubrechen? Welchen Einfluß hat die Herkunft auf persönliche Entscheidungen? Ist ein individualisiertes, selbstbestimmtes Leben, ohne vorgegebene Lebensführung überhaupt erstrebenswert? Wo liegen die Risiken der Individualisierung?
Das Selbstverständnis des modernen Menschen wird sehr stark durch den Aufstiegswunsch und durch den Glauben an seine prinzipielle Erfüllbarkeit geprägt. Dies ist nicht eine durch individuelle Veranlagung bedingte Erweiterung des sozialen Erwartungshorizonts, sondern eine durch Überzeugung und Erfahrung gefestigte Vorstellung einer positiv variablen Soziallage.
Sozialer Aufstieg aus der Arbeiterschicht war lange Zeit an das Kollektiv der Arbeiterschaft gebunden. Der Aufstieg einzelner wurde von den Gleichgestellten fast immer als „Verrat an der Herkunft“ – aber andererseits aus einer höheren Schicht - auch als Indiz für eine „offene und liberale Gesellschaft“ gewertet.[1]
In den folgenden Ausführungen sollen Beeinflussungsfaktoren dargelegt werden, die auf die Individuen einwirken und die Selbstbestimmtheit und den sozialen Aufstieg in Frage stellen. Im Anschluß daran werde ich der Frage nachgehen, ob Bildung einen wichtigen, wenn nicht gar den wichtigsten Individualisierungsfaktor darstellt. Nach einer kurzen Analyse, inwieweit Berufe Stablisatoren der sozialen Schichten sind, schließe ich mit einer kritischen Stellungnahme und einem Ausblick in die Zukunft.
1 Definitionen
1.1 Individualisierung
Unter Individualisierung versteht man das selbständige Herauslösen aus traditionellen Her- kunfts- und Rollenbindungen. Der Mensch als Individuum versucht, durch Abgrenzung sozial aufzusteigen und dadurch Ansehen zu erlangen und der nachwachsenden Generation neue Möglichkeiten zu eröffnen.
1.2 Mobilität
„In allgemeiner Formulierung wird unter Mobilität die Bewegung von Personen aus einer Position in eine andere innerhalb jeder möglichen Gliederung einer Gesellschaft verstanden.“ (Bolte 1959)
1.2.1 Soziale Mobilität
Bewegungen von einer Position zur anderen, so z. B. Berufswechsel oder Umzüge, werden in der Soziologie als „soziale Mobilität“ bezeichnet.
1.2.2 Vertikale Mobilität
Bewegungen zwischen ungleich gut ausgestatteten Positionen, also Statusveränderungen, heißen „vertikale Mobilität“. Unter solchen Auf- und Abstiegen werden intergenerationelle (d. h. im Verhältnis zum Berufsstatus der Eltern, meist des Vaters) und intra-generationelle (Karriere-)Mobilität unterschieden. Was die Bestimmungsgründe vertikaler Mobilität betrifft, so trennt man zwischen strukturell „erzwungenen“ Auf- und Abstiegen und individuell „geleisteten“.
1.2.3 Strukturelle Mobilität
Zwei Beispiele für strukturelle Mobilität: In den vergangenen Jahrzehnten wurden abertausende selbständiger Bauern zur Aufgabe gezwungen und oft in den Status des angelernten Fabrikarbeiters hinabgedrückt. Andererseits zog die Ausweitung des Dienstleistungssektors viele Tausende (meist Fach-)Arbeiter in einen Aufstieg zu besser bezahlten und angeseheneren Angestellten.[2]
2 Historische Wandlungen des Aufstiegsbewußtseins
Damit sich in breiten Bevölkerungsschichten ein Aufstiegsbewußtsein herausbilden konnte, waren besondere Vorbedingungen teils ideeller, teil materieller Art erforderlich. Zunächst mußte der Prozeß der Individualisierung so weit vorangeschritten sein, daß dem einzelnen die Bedeutung und Wichtigkeit seines persönlichen Schicksals bewußt werden konnte und die Bindungen an soziale Gemeinschaften sich so lockerten, daß ein Verharren in den herkömmlichen Lebenskreisen nicht mehr unausweichlich war. Darüber hinaus war es notwendig, ein umfassendes Erfolgsstreben zu wecken.
Die mittelalterliche Gesellschaft besaß durch ihre ständische Gliederung eine relativ stabile hierarchische Grundstruktur, deren Barrieren von einzelnen nur in Ausnahmefällen, von sozialen Gruppen, insbesondere von Familienverbänden, nur durch generationenlange Bemü- hungen überschritten werden konnten. Schon die großen Wanderungsbewegungen zeigen deutlich, daß z. B. die Chance, vom nicht erbberechtigten Sohn zum freien Bauern aufzusteigen, durchaus wahrgenommen wurde, wenn sie sich bot.
So zeigt die mittelalterliche Gesellschaft durchaus eine ihr eigene Dynamik, in der Aufstiegsprozesse zwar nachweisbar sind, die Aufstiegshoffnung der breiten Bevölkerungsschichten jedoch in erheblichem Maße in den überirdischen Bereich verlagert wurde. Hierdurch und nicht zuletzt durch die geringe soziale Differenzierung bei gleichzeitiger kastenartiger Trennung der bestehenden Sozialschichten konnte ein allgemeines Aufstiegsbewußtsein nicht entstehen.
In der Renaissance begegnen uns erstmals diejenigen Ideal- und Realfaktoren, die eine neue Bewertung der Aufstiegsprozesse herbeiführen sollten. Die durch Weiterentwicklung des Handels und Handwerks ausgelöste wachsende Arbeitsteilung brachte eine Dynamisierung der Gesellschaft mit sich. Die ständischen Gemeinschaftsbindungen lockerten sich und öffneten den Weg für eine individualisierte Zielstrebigkeit. Auch in den hierarchischen Grundstrukturen setzte sich anstelle der Vorstellung einer strikten Bindung an den „natürlichen Stand“ der Wunsch nach persönlichem Vorwärtskommen stärker durch.
In der Renaissance entwickelte sich erstmals ein Aufstiegsbewußtseins – zumindest in den Kreisen des städtischen Großbürgertums – und das Aufstiegsstreben erlangte eine bisher nicht gekannte Bedeutung. In der Folgezeit verstärkten sich diese Tendenzen; die Reformation leitete eine Individualisierung im religiösen Bereich ein. Allmählich setzte sich auch in breiten Bevölkerungsschichten der Gedanke durch, daß der Mensch nicht nur im Himmel, sondern auch auf Erden ein ganz persönliches Schicksal habe, für das er vor Gott die Verantwortung trage, das er aber auch mitgestalten könne. Das persönliche Glück wurde mehr und mehr in dieser Welt gesucht.
Individualisierung und Erfolgsstreben wären auf die Dauer nicht haltbar gewesen ohne die entsprechende Ausweitung des individuellen und sozialen Erwartungshorizonts. An die Stelle der vom Menschen nicht beeinflußbaren Vorsehung trat allmählich die Fortschrittsidee.[3]
[...]
[1] Friedrich Fürstenberg - Das Aufstiegsproblem in der modernen Gesellschaft – Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1969
[2] Karl Ulrich Mayer – Ungleichheit und Mobilität im sozialen Bewußtsein – Westdeutscher Verlag Opladen 1975
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Schwerpunkt dieser Arbeit über Individualisierung und Mobilität?
Die Arbeit untersucht die Frage der Individualisierung in der Gesellschaft, insbesondere ob Menschen durch ihre soziale Schicht so stark geprägt sind, dass ihnen der Mut und die Möglichkeiten fehlen, aus ihrem Milieu auszubrechen. Sie betrachtet den Einfluss der Herkunft auf persönliche Entscheidungen und die Risiken der Individualisierung.
Welche Definitionen werden im Text behandelt?
Die Arbeit definiert Individualisierung als das selbstständige Herauslösen aus traditionellen Herkunfts- und Rollenbindungen. Mobilität wird als die Bewegung von Personen von einer Position in eine andere innerhalb einer Gesellschaft verstanden. Weiterhin werden soziale, vertikale und strukturelle Mobilität definiert.
Was versteht man unter sozialer Mobilität?
Soziale Mobilität bezeichnet Bewegungen von einer Position zur anderen, wie z. B. Berufswechsel oder Umzüge.
Was ist vertikale Mobilität?
Vertikale Mobilität beschreibt Bewegungen zwischen ungleich gut ausgestatteten Positionen, also Statusveränderungen. Hierbei wird zwischen intergenerationeller (im Verhältnis zum Berufsstatus der Eltern) und intragenerationeller (Karriere-) Mobilität unterschieden.
Was bedeutet strukturelle Mobilität?
Strukturelle Mobilität bezieht sich auf Auf- und Abstiege, die durch gesellschaftliche oder wirtschaftliche Veränderungen "erzwungen" werden. Beispiele sind der Übergang von Bauern zu Fabrikarbeitern oder der Aufstieg von Facharbeitern zu Angestellten im Dienstleistungssektor.
Wie hat sich das Aufstiegsbewusstsein historisch gewandelt?
Im Mittelalter war die Gesellschaft ständisch gegliedert, und Aufstiegshoffnungen wurden oft in den überirdischen Bereich verlagert. In der Renaissance entwickelten sich durch Handel und Handwerk individualisierte Zielstrebigkeit und ein Aufstiegsbewusstsein, besonders im städtischen Bürgertum. Die Reformation trug zur Individualisierung im religiösen Bereich bei.
Welche Faktoren beeinflussen die Aufstiegschancen?
Die Arbeit geht davon aus, dass es personen-, system- und gesamtgesellschaftlich wirkende Faktoren gibt, die die Aufstiegschancen beeinflussen. Es wird die Frage untersucht, ob Bildung einen wichtigen Individualisierungsfaktor darstellt.
Welche Rolle spielt Bildung bei der Individualisierung?
Die Arbeit untersucht, ob Bildung einen wichtigen, wenn nicht gar den wichtigsten Individualisierungsfaktor darstellt. Dies wird im Kontext von sozialer Schichtung, Bildungsweg und Bildungsziel analysiert.
Inwiefern stabilisiert der Beruf soziale Schichten?
Die Arbeit analysiert, inwieweit Berufe Stabilisatoren der sozialen Schichten sind, d.h. ob die Berufswahl dazu beiträgt, die soziale Position einer Person zu festigen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit schließt mit einer kritischen Stellungnahme zur Individualisierung als "Zauberwort" und einem Ausblick in die Zukunft, in dem die möglichen Entwicklungen und Herausforderungen beleuchtet werden.
- Citation du texte
- Marlis Moritz (Auteur), 1999, Individualisierung oder Schichtprägung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107144