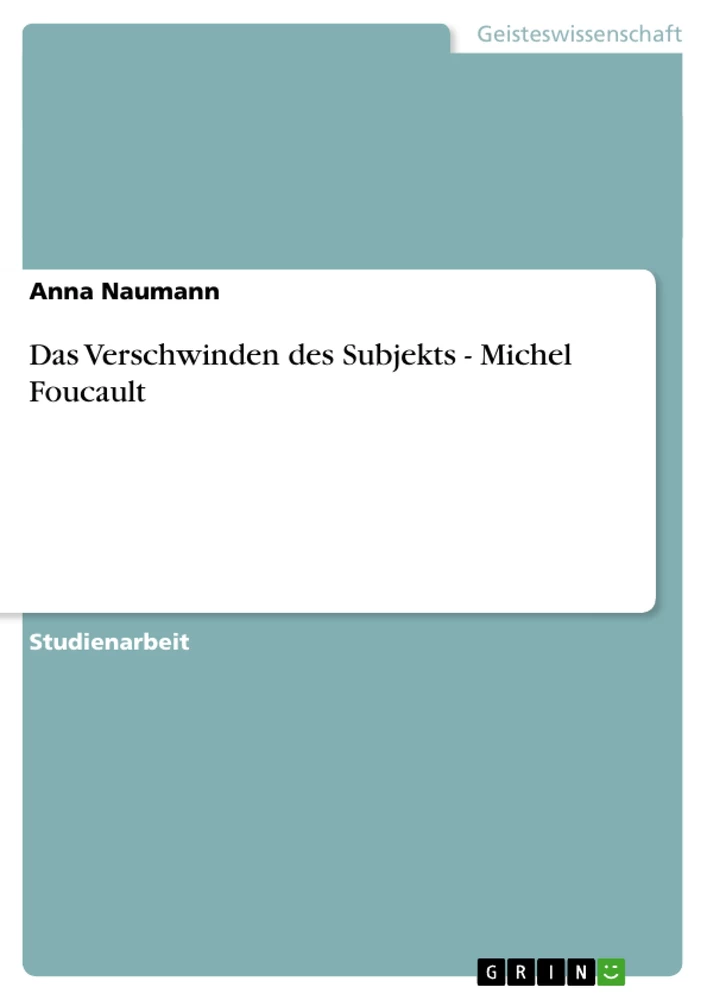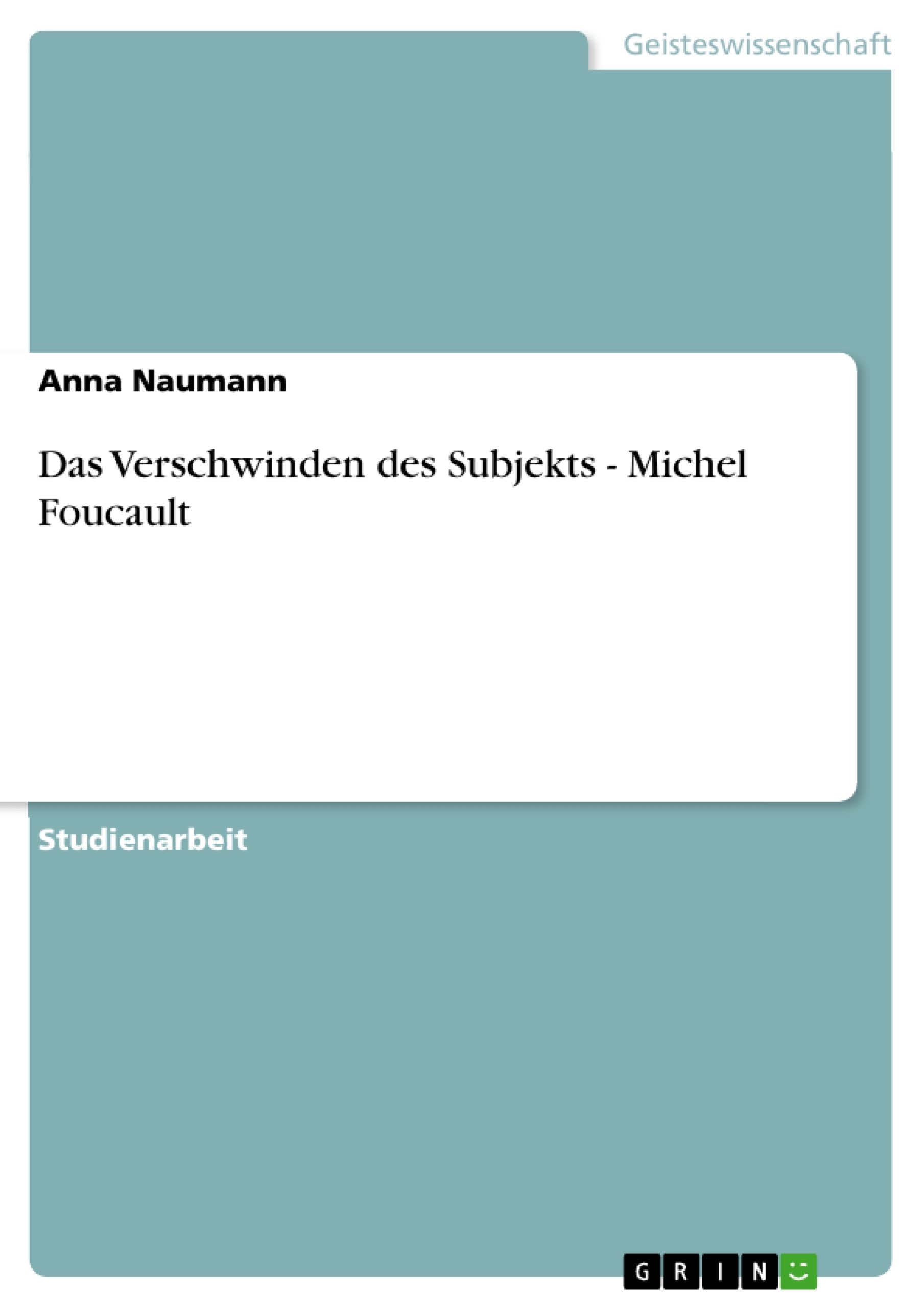Was bedeutet es, Mensch zu sein in einer Welt, die von unsichtbaren Mächten geformt wird? Diese tiefgründige Analyse entführt den Leser in die komplexen Gedankengebäude Michel Foucaults, einem der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, und seziert dessen revolutionäre Subjekttheorie. Beginnend mit einer umfassenden Darstellung von Foucaults Leben und Werk, von seinen akademischen Anfängen bis zu seinen bahnbrechenden Hauptwerken, beleuchtet dieses Buch die Entwicklung seiner Ideen und ihren Einfluss auf unser Verständnis von Macht, Wissen und Wahrheit. Im Zentrum steht die Frage nach dem Subjekt: Ist es ein autonomes, denkendes Wesen oder vielmehr ein Produkt von Diskursen und Machtstrukturen, ein Gefangener der Sprache und gesellschaftlicher Normen? Die detaillierte Auseinandersetzung mit Foucaults Diskursbegriff, seinen Machtanalysen und der literaturwissenschaftlichen Diskursanalyse enthüllt, wie tiefgreifend unsere Wahrnehmung der Welt von unbewussten Regeln und Konventionen geprägt ist. Dabei wird auch Foucaults kontroverse These vom "Verschwinden des Subjekts" kritisch hinterfragt und die Auswirkungen auf das Verständnis von Autorschaft und künstlerischer Schöpfung untersucht. Doch diese Reise durch Foucaults Denken endet nicht in Resignation. Vielmehr wird die überraschende "Rückkehr des Subjekts" in seinen späteren Werken beleuchtet, in denen er die Bedeutung der Selbstgestaltung und der "Ästhetik der Existenz" betont. Eine fesselnde Lektüre für alle, die sich mit den großen Fragen der Philosophie auseinandersetzen und die Mechanismen der Macht in unserer Gesellschaft verstehen wollen. Dieses Buch bietet nicht nur einen umfassenden Überblick über Foucaults Subjekttheorie, sondern regt auch zum kritischen Nachdenken über unsere eigene Rolle in der Welt an. Es ist eine Einladung, die Grenzen des Denkens zu überschreiten und die verborgenen Kräfte zu erkennen, die unser Leben bestimmen – ein unverzichtbarer Beitrag zur Philosophie, Sozialtheorie und Literaturwissenschaft, der auch für interessierte Leser außerhalb des akademischen Bereichs zugänglich ist. Tauchen Sie ein in die Welt von Michel Foucault und entdecken Sie neue Perspektiven auf das Menschsein im 21. Jahrhundert, ein Jahrhundert geprägt von Identitätssuche, Machtstrukturen und dem Streben nach Wahrheit. Lassen Sie sich von Foucaults scharfsinnigen Analysen inspirieren, um die Welt um Sie herum neu zu verstehen und Ihre eigene Position darin zu definieren.
Gliederung
I. Einleitung
II. Michel Foucault
1. Leben und Werk des Philosophen
1.1. Studium
1.2. Professuren und erste Werke
1.3. Hauptwerke
2. Foucaults Subjekttheorie
2.1. Der Diskurs
2.1.1. Definition
2.1.2. Diskursregeln
2.1.3. Der Machtbegriff
2.1.4. Die Wahrheit
2.2. Die Diskursanalyse
2.2.1. Allgemeine Definition
2.2.2. Literaturwissenschaftliche Diskursanalyse
2.3. Das Verschwinden des Subjekts
2.3.1. Das Subjekt
2.3.2. Die Literaturwissenschaft als Beispiel
2.3.2.1. Der Autor
2.3.2.2. Der Autorname
2.3.3.3. Die Autorfunktion
III. Die Rückkehr des Subjekts
I. Einleitung
Zur näheren Untersuchung des Begriffs «Subjekt» ist zunächst die etymologische Betrachtungsweise von Bedeutung: Subjekt heißt sowohl «das Zugrundeliegende» als auch «das Unterworfene». Der Satz Descartes‘ «cogito ergo sum» ist wohl eine der bekanntesten Aussagen in diesem Zusammenhang. Tatsächlich war Descartes, aber auch Fichte, Hegel und Kant der Auffassung, alles komme aus dem Subjekt, denn alles existiere nur in diesem und sei außerhalb davon nichts.1 Während des deutschen Idealismus wurde also von der zugrundeliegenden Eigenschaft des Subjekts ausgegangen und „daß sich die menschliche Subjektivität im Denken als solches vollzieht.“2 Im 19. Jahrhundert brach Nietzsche mit dieser Tradition und stellte den Subjektbegriff radikal in Frage. Er, und später auch Philosophen der Moderne und Postmoderne, betonten die Unterworfenheit des «Ichs», „als Produkt von Machtkonstellationen oder Ideologien, als Spielball von unbewußten, libidinalen Impulsen, als Opfer von Diskontinuität und Kontingenz.“3. Nietzsche war als „Herausforderer der Metaphysik“4der erste, welcher dem Geist den Körper gegenüberstellte und stark an Begriffen wie Subjekt und Wahrheit zweifelte. Seine Partikularisierungstendenz und Gedanken zum «Körper» übten auf die französischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, wie z. B. Foucault, einen starken Einfluß aus. So bezeichnete Gilles Deleuze, ebenfalls ein französischer Philosoph dieser Zeit, Foucaults Philosophie u.a. als „die genealogische, nietzscheanische Rückführung des Universellen auf das Partikulare: Der Wahrheit auf die Macht und das Spiel, des Subjekts auf die reglementierte Körperlichkeit des Einzelnen.“5
Auch die Machtkonstellationen nehmen bei Foucault eine zentrale Rolle ein, denn durch sie erscheint die Wahrheit, sowie die Vernunft, als nur mehr zufälliges Ergebnis. So gesehen ist auch der Mensch nicht mehr der «homo cogitans», denn eine Vernunft ist dadurch willkürlich geworden. Alles, was bleibt ist eine „manipulierte Körperlichkeit“6, d.h. ein unterworfenes Subjekt.
Die folgende Arbeit ist ein Versuch, die Subjekttheorie Foucaults zu erleuchten. Jedoch können seine Gedanken zu diesem Thema nicht isoliert von seinen anderen Anschauungen, wie beispielsweise seiner speziellen Interpretation der Geschichte oder die des Bestrafungssystems der modernen Gesellschaft, gesehen werden. Auf diese Aspekte wird zwar im Zusammenhang mit Foucaults Biographie kurz eingegangen, Hauptanliegen ist es jedoch den Subjektbegriff im Kontext der Diskurstheorie und Diskursanalyse zu untersuchen.
II. Michel Foucault
1. Leben und Werk des Philosophen
1.1. Studium
Michel Foucault wurde am 15. Oktober 1926 in Poitiers, Frankreich geboren. Mit 21 Jahren entschließt er sich Historiker zu werden und tritt 1946 in die École normale supérieure, eine französischen Eliteschule ein. Bereits drei Jahre später schreibt er eine philosophische Diplomarbeit über Hegel.
Foucault sucht den Schutz des Akademikermilieus.
„Wissen ist für mich das, was als Schutz der individuellen Existenz funktionieren soll und was zum Verständnis der Außenwelt dient.“7
Er wendet sich stark der Philosophie zu, auch wenn er sich selbst nicht als Philosoph bezeichnen möchte. „... die Philosophie, verstanden als autonome Tätigkeit, ist verschwunden [...] die Philosophie ist heute nicht mehr als der Beruf eines Universitätslehrers.“8. In den Fünfziger Jahren beschäftigt er sich viel mit der Psychologie, unter anderem mit der Psychoanalyse Freuds, und besucht in diesem Zusammenhang Seminare von Jacques Lacan. Hier kam er schon früh mit Lacans Subjekttheorie in Berührung. Foucault bemerkte den Widerspruch darin, das Subjekt einerseits als etwas vollkommen freies zu sehen und andererseits aber von den Beschränkungen der sozialen Bedingungen auszugehen. Er beschreibt das Subjekt als „eine komplexe, zerbrechliche Angelegenheit, worüber sich nur schwer sprechen läßt und ohne welche wir nicht sprechen können.“9In dem späteren Vortrag «was ist ein Autor?», will er dem Subjekt seine Ursprungsfunktion nehmen und es statt dessen als eine variable und komplexe Funktion des Diskurses analysieren.10 Foucault weist damit die bisherige Auffassung der Humanwissenschaft zurück, das Subjekt sei konstitutiv. Sein philosophischer Betreuer an der École normale supérieure, Louis Althusser, der eine ähnliche Stellung zur Theorie des Subjekts eingenommen hatte, beeinflußte Foucault ebenfalls sehr.
1.2. Professuren und erste Werke
Foucault schließt sein Philosophiestudium 1948 ab, ein Jahr darauf folgt das Diplom in Psychologie und 1952 in Psychopathologie. Seine ersten veröffentlichen Schriften, eine Einleitung zu dem Buch «Traum und Existenz» von Ludwig Binswanger11 und sein eigenes Buch «Psychologie und Geisteskrankheit»12, erscheinen 1954. Es sind jedoch beides Werke, auf die der Philosoph später nicht wieder zu sprechen kommt.
Die Begegnung mit Nietzsches Werken Anfang der fünfziger Jahre, stellt ein einschneidendes Erlebnis für Foucault dar.
„Im Hinblick auf den Einfluß, den Nietzsche auf mich gehabt hat, könnte ich diesen nur schwer präzisieren. Denn ich weiß, wie tief er gewesen ist. Ich möchte [...] nur sagen, daß ich ideologisch «Historizist» und Hegelianer gewesen bin, bis ich Nietzsche gelesen habe.“13
Auch Heidegger beeinflußte ihn neben Hegel im Hinblick auf seine philosophische Ausbildung erheblich. Vor allem jedoch ermöglichte dieser ihm den Zugang zu Nietzsche. Er bezeichnet die Kombination der zwei Philosophen als „philosophischen Schock“14, denn er hatte schon früher begonnen Nietzsche zu lesen, aber erst nachdem Foucault sich mit der Lektüre Heideggers auseinandergesetzt hatte, konnte Nietzsche einen derartigen Einfluß auf ihn bewirken.
Im Oktober 1952 übernimmt Foucault an der geisteswissenschaftlichen Fakultät in Lille eine Assistentenstelle für Psychologie, doch er hegt den Wunsch Frankreich zu verlassen. 1955 ergibt sich die Gelegenheit dazu, denn Foucault wird Leiter der Maison de France in Uppsala, Schweden. Er gibt dort französischen Sprachunterricht, hält Seminare und veranstaltet diverse Vortragsreihen, u.a. über «die Liebe von de Sade bis Genet»15. Hauptsächlich arbeitet er in dieser Zeit jedoch an «Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft»16, seiner Doktorarbeit und erstem größeren Werk. Er analysiert unterschiedliche Einstellung zum Wahnsinn in zwei verschiedenen historischen Epochen. In der Klassik war der Wahn die bloße Verneinung der Vernunft und ein rein negatives Phänomen. Er symbolisierte die Umkehrung der Ordnung. Im 19. Jahrhundert dagegen änderte sich diese pessimistische Sichtweise. Der Wahnsinn wurde zur rätselhaften Größe, dessen unbekannte Eigenschaften ermittelt werden müssen und bekam so auch eine positive Eigenschaft zugeschrieben.17In seinem Buch untersucht Foucault mittels der Diskursanalyse, auf die später noch genauer eingegangen wird, die Beziehung zwischen den Diskursen des Wahnsinns und den sozialen Praktiken, die im Umgang mit den ‘Wahnsinnigen’ eingesetzt wurden.
1958 leitet er das Centre français an der Universität von Warschau bevor er sich nach Hamburg begibt, wo er als Direktor des institut français arbeitet. Anfang der sechziger Jahre kehrt er zurück nach Frankreich und wird Privatdozent und Professor für Psychologie und Philosophie an der Universität Clermont-Ferrand. Von 1965 bis 1968 hält er als Gastprofessor Vorlesungen in Tunis. Doch auch hier hält es ihn nicht lange und er beteiligt sich als Professor für Philosophie an der Gründung des Centre universitaire expérimental de Vincennes. Schließlich übernimmt Foucault 1970 die Professur der Denksysteme am Collège de France, die er bis zu seinem Tod 1984 inne hat. Während der islamisch- fundamentalistischen Revolution im Iran, berichtet Foucault als Korrespondent für den «Corriere della Sera».
1.3. Ausgewählte Hauptwerke
Nach den beiden Büchern «Die Geburt der Klinik: Eine Archäologie des ärztlichen Blicks»18und «Raymond Roussel»19, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann, erscheint 1965 «Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaft»20. In dieser Diskursarchäologie beschreibt Foucault den Weg, den das abendländische Denken seit der Antike genommen hat. Er geht von Ordnungen aus, die sich in sprachlichen Zeichen manifestieren. Im Laufe der Geschichte lösen sich verschiedene derartige Ordnungssysteme ab. Bis zum 16. Jahrhundert herrscht die allgemeine Auffassung, dass die Zeichen und Dinge austauschbar sind, da sie sich sehr ähnlich sind. Im 17. Jahrhundert wird das Zeichen vom Gegenstand allerdings wieder getrennt. Es wird nun angenommen, dass die Dinge selbst in einer logischen Ordnung zueinander stehen, der Bezug zu den Zeichen jedoch willkürlich ist. Schließlich geschieht im 19. Jahrhundert eine „völlige Umkehrung der klassischen Ordnung“21. Die Zeichen erscheinen dunkel und rätselhaft und den Dingen werden „metaphysische[n] dynamische[n] Kräfte[n] in der Tiefe“22zugeschrieben, welche den nicht sichtbaren Teil des Seins bezeichnen. Foucault bietet mit seiner Ordnung des Denkens eine Alternative zur traditionellen Geistesgeschichte. Statt der Betonung einzelner Ideen, faßt er jedes Wissen zu einem übergreifenden System zusammen und verändert somit die bisherige Beziehung zwischen den Dingen.
Sein weiteres Buch «Die Archäologie des Wissens»23 stellt einen wesentlichen Beitrag zur Frage nach methodologischen Problemen dar. Er präsentiert eine neue Methodik für die Forschung, die sich an Diskursen orientiert und „weder formalistisch noch interpretativ ist.“24
In den siebziger Jahren zeigt sich bei Foucault eine neue Arbeitsrichtung, die intensive Auseinandersetzung mit der Macht. Er schreibt mehrere Werke25dazu, welche v.a. auf die französische Strafjustiz eingehen. Bedeutend ist, dass er die Begriffe Macht und Wissen in Beziehung zueinander setzt.
„Der in seiner (Foucault, Anm. d. A.) Sicht empirische Befund, daß nicht nur Wissen Macht ist, sondern daß Macht ebenso Wissen bedeutet, Macht also wissensproduktiv ist, bildet den maßgeblichen theoretischen Anspruch von Überwachen und Strafen.“26
Aus Foucaults Schriften geht hervor, dass die Macht den Willen zur Wahrheit regiert und den Kern allen Denkens bezeichnet. Er geht ferner davon aus, dass Diskurse von Machkonstellationen bestimmt sind, d.h. von Kräften und Vorgängen, die jenseits der Sprache liegen. Sein letztes großes Werk sind die drei Bände zu «Sexualität und Wahrheit»27, auf welches später in einem anderen Zusammenhang noch näher eingegangen wird.
Ein zentraler Begriff in Foucaults Schriften ist immer wieder das Subjekt. Aufbauend auf Lacans Konzept des durch die Sprache konstituierten Subjekts, beschäftigte sich auch Louis Althusser28, wie oben schon erwähnt mit der Problematik des Subjekts. Auch er hinterfragt kritisch die rational-autonome Eigenschaft des Subjekts und kommt zu dem Schluß, dass „weit davon entfernt, ein freies und unabhängiges Wesen zu sein, [...] der Einzelne in das Netz imaginärer Beziehungen eingebunden...“29ist. Nicht zuletzt davon aber auch durch seine Nietzsche-Lektüre beeinflußt, galt Foucault als vehementer Kritiker des Subjekts. Für ihn ist es nur eine Fiktion, daß das Subjekt als der Ursprung aller Wahrheit und Wahrheitserkenntnis genannt wird. Statt dessen ist es nur ein Element in einem ihn stets umgebenden Regelwerk.30In folgendem Kapitel wird diese Reduzierung des Subjekts, bis hin zu seinem Verschwinden im Kontext von Foucaults Diskurstheorie noch einmal genauer untersucht.
2. Wichtige Elemente zu Foucaults Subjekttheorie
2.1. Der Diskurs
2.1.1. Definition:
Michel Foucault entwickelt den Diskursbegriff in mehreren Werken. In „Ordnung der Dinge“31ist der Diskurs
„die klassische Ordnung der Repräsentation in der Form einer Transparenz, die sich der wechselseitigen Überlagerung von Signifikant und Signifikat verdankt.“32
In „Archäologie des Wissens“33erweitert Foucault den Diskurs zur „Gesamtheit aller möglichen und wirklichen Aussagen. Er erhebt den Anspruch auf eine in sich selbst begründete Autonomie, die sich in der singulären Ereignishaftigkeit ihres eigenen Erscheinens ausdrücken soll.“34
In „Ordnung des Diskurses“35 „... bricht Foucault jedoch wieder mit dem Postulat der vollständigen Autonomie des Diskurses und berücksichtigt vor allem die äußeren Mechanismen der Diskurskontrolle.“36
Allgemein läßt sich sagen, dass der Diskurs eine Menge von Äußerungen ist, die aufgrund spezifischer, epochenbedingter Diskursordnungen eine bestimmte Struktur aufweisen. Es gehören hierzu alle Äußerungen, die zu dem thematischen Aspekt des Diskurses Wissenselemente beitragen. Der Diskurs besteht nun einerseits aus Aussagen, welche die kleinste Einheit des Diskurses darstellen. Diese sind weder mit dem grammatikalischen Satz noch mit einer logischen Proposition zu verwechseln.
2.1.2. Diskursregeln
Ferner spricht Foucault von einem Regelwerk, welches eine entscheidende Rolle spielt. Es bestimmt unterschiedliche Formationen - daher auch der Begriff Formations-Regeln - wie zum Beispiel die Formation der Gegenstände, also die Frage, über welche Sachverhalte überhaupt geredet wird und welche Gesellschaftsgruppen diese in den Diskurs einbringen etc. Foucaults These zufolge, existieren in der Geschichte zu unterschiedlichen Zeitpunkten verschiedene Regelwerke. Innerhalb dieser finden viele relativ homogene Diskurse statt, welche einen sehr großen Bereich in jeder Kultur abdecken. Davon abzugrenzen sind jedoch zwei andere Bereiche nämlich den “des 1968 (frz. 1966)
wissenschaftlichen Wissens und die primären Kodierungen (Sprache, Wahrnehmung, Techniken etc.), die jeder kulturellen Organisation zugrunde liegen.“37. Homogen sind diese Diskurse aufgrund ihres gemeinsamen grundlegenden Regelsystems, welches Foucault auchepistemenennt. Er unterteilt die (französische) Geschichte in dreiepisteme: Mittelalter, Rennaissance und Aufklärung, wozu er auch die Moderne zählt. In einerepistemeexistiert nicht nur ein Diskurs, sondern viele verschiedene, welche sich durch den Inhalt voneinander unterscheiden.
2.1.3. Der Machtbegriff
Die Individuen unterwerfen sich dem Regelwerk, obwohl es, wie oben erwähnt, keinen Urheber gibt, der sie aufstellt oder kontrolliert. Foucault geht von einer zu jeder Zeit existierenden, redebeherrschende Macht aus, welcher sämtliche Weltdeutungs- und Erkenntnismuster unterworfen sind. Diese Macht schreibt sich selbst fort und basiert dabei auf nicht leicht zu durchschauenden Grundsätzen. Jede Äußerung, die menschliches Wissen archiviert, wird davon bestimmt, denn die Ordnung manifestiert sich in der Sprache, d.h. in ihren feststehenden Zwängen, nach denen sich jeder richten muß. Jede Ordnung in der Kultur wird nur durch Zeichen geäußert. Daher hat der Diskurs über seinen Zeichencharakter die Macht das Verhältnis der Zeichen zu den Dingen zu bestimmen. Die Grenzen des Zeichensystems sind somit zugleich die Grenzen des Diskurses. Es kann darüber hinaus nichts ausgedrückt oder beschrieben werden.
Foucaults Macht muss von einem traditionellen Verständnis von Macht abgegrenzt werden. Macht war bisher rein negativ, von oben nach unten verlaufend, d.h. von jemandem (z.B. dem Staat) besessen und ausgeübt. Statt dessen ist der Machtbegriff bei Foucault eine umfassende, einschließende und integrierende Macht.
Foucaults Macht ist ein Kräfteverhältnis, dass verschiedene Kräfte miteinander in Beziehung setzt. Sie ordnet, schafft Beziehungen und Verhältnisse und überführt diese in eine bestimmte Ordnung. Sie ist im Gegenteil zum früheren Machtbegriff produzierend, schöpferisch und auch positiv. Macht operiert über die Produktion von Wissen und Wahrheit (bisher ging man eher davon aus, dass Macht Wissen und Wahrheit verschleiert). „Das Wissen über den Körper hat man sich mit Hilfe einer Anzahl militärischer und schulischer Disziplinen angeeignet.“38
Wahrheit und Wissen werden in Diskursen geäußert und da Macht Wahrheit und Wissen produziert, schafft Macht auch die Diskurse, mit dem Ziel neue Machtbeziehungen herzustellen. Ferner faßt Foucault Macht nicht als starres Eigentum auf, sondern als eine Summe aus Techniken, Strategien, Manövern usw. zu denen auch das System der Bestrafung gehört.
Ein Beispiel hierfür findet sich in seinem Werk „Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“. Foucault klassifiziert die Strafe in der Geschichte in drei Machttypen. Der erste Machttypus ist die Ausschließung, das heißt Aussetzung und Folterung. Der zweite ist die innere Einschließung (Reintegration) und der dritte schließlich das Gefängnis. Dieses bezeichnet er als produktive Disziplin mit dem Ziel des Einschließens, Isolierens, Überwachens und Transformierens. Das Panopticum ist ein Entwurf von Bentham für ein Gefängnis, der dieses Prinzip veranschaulicht. Dieses Gefängnis ist rund und in dessen Mitte steht ein Turm, von dem aus, der Gefängniswärter in jede Zelle Einblick hat. Er ist jedoch so verdunkelt, dass die Sträflinge nicht sehen können, ob sie bewacht werden oder nicht. Die Gefangenen müssen sich daher immer so verhalten, als wären sie beobachtet. Das bedeutet, sie überwachen sie selbst.
2.1.4. Wahrheit
Je nach Gesellschaftsgruppe gibt es unterschiedliche Diskurse, die mehr oder weniger stark die Öffentlichkeit beeinflussen. Das bedeutet, dass es keine verallgemeinernden Tatsachen gibt, sondern nur in den historischen Kontext eingebundene Wahrheiten, welche, durch die Gesellschaft bedingt, von partikularen Macht Interessen bestimmt werden. Obwohl Diskurse die Gesamtheit der jeweiligen Gesellschaft erfassen, spiegeln sie diese nicht wieder, sondern besitzen eine eigene Materialität.
2.2. Die Diskursanalyse
2.2.1. Allgemeine Definition
Die Diskursanalyse hat es sich zur Aufgabe gemacht, die genannten Regeln zu bestimmten historischen Zeitpunkten herauszufinden und fördert auf diese Weise weitreichende Annahmen über eine Ordnung der Welt im allgemeinen zutage.
Dabei kann auch ein triviales Ordnungsmuster Bedeutung erlangen, was auf den ersten Blick sehr fremd erscheint, da sie bis zu ihrer Entdeckung „aus dem Archiv der Hochkultur herausgefallen ist oder nie darin aufgenommen wurden.“39Es gilt hierbei nicht vermeintliche Tiefenstrukturen aufzudecken, sondern vielmehr die Menge der Äußerungen im Kontext des historischen Erscheinens, also der Aufdeckung von Diskursen, welchen dasselbe Regelwerk zugrunde liegt, zu interpretieren. Mit anderen Worten prüft die Diskursanalyse „mit welchen Praktiken der Wissenschafts- und Alltagsrede die Vorstellung eines ‚normalen‘ Zustands konstruiert wird.“40Mit Hilfe der Diskursanalyse wandelt Foucault die Rezeption der Geschichte in ein subjekt-anonymes Geschehen und liefert somit eine Alternative zur traditionellen Geistesgeschichte
2.2.2. Die literaturwissenschaftliche Diskursanalyse
Im Gegensatz zur Hermeneutik, die nach einer tieferen Bedeutung des Textes sucht, geht die Diskursanalyse nicht über die Materialität des Diskurses hinaus. Sie entfernt sich von den Methoden der Hermeneutik, in dem sie zum Beispiel auch den Trias von Autor, Werk und Leser gänzlich ablehnt. Der literarische Diskurs hat vielmehr eine die bestehenden Diskurse verarbeitende, umschreibende und auch verknappende Funktion. Wie schon erwähnt richtet sich das Hauptaugenmerk der Diskursanalyse eher auf das, was „in der Tradition der Textauslegung bisher vernachlässigt worden ist, was in Archiven verstaubte, [...] achtlos Weggeworfenes [...] Behördenprotokolle, Landkarten [...] juristische Gutachten [...] alle Arten von Zeichensystemen.“41
Auf diese Weise können die Regeln festgestellt werden, welche die Aussagen der Wissenschaftler, Politiker oder Schriftsteller determiniert haben. Aus einer Ansammlung von Texten können Netzwerke erstellt werden, wobei der literarische Text als Mittelpunkt gesehen wird, in dem die Diskurse zusammenlaufen. Foucault hatte eigentlich keine eigens literarische Diskursanalyse vorgesehen. Er betrachtet den literarischen Diskurs vielmehr als Gegendiskurs, „der aufgrund der ihm eigenen sprachlichen Souveränität den Tendenzen der modernenepisteme zuwiderlaufe.“42
Die Diskursanalyse stellt kein Instrument zur vollständigen Erfassung eines Textes dar. Es werden jedoch Aspekte, z.B. wie stark unser Denken und unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit von der Sprache geprägt sein kann, genauer untersucht. Andererseits deckt die Diskursanalyse auch auf, wie unsere Sprache an ganz bestimmte, feste Regeln gebunden ist.
2.3. Das Verschwinden des Subjekts
2.3.1. Das Subjekt
Nach Foucault ist „das individuelle Subjekt [...] ein Produkt von Machtkonstellationen, die als diskursive Formationen beschreibbar sind.“43Das Subjekt ist also den Diskursregeln unterworfen. Die Macht der Regeln erlauben kein abweichendes Verhalten und nehmen den Subjekten somit ihre Selbständigkeit, denn Foucault sieht „in der Sprache nicht ein Instrument des denkenden Subjekts [...], sondern im denkenden Subjekt ein Produkt von sprachlich vermittelten
Machtkonstellationen, das sein eigenes Produkt-Sein nicht durchschaut.“44
Foucault hebt den Widerspruch zwischen den Ansichten, dass das Subjekt ein freies Wesen ist und zugleich von den Beschränkungen bestimmter Bedingungen bestimmt ist, auf. Er nimmt dem Subjekt nicht nur seine Ursprungsfunktion, sondern auch jeden freien Willen, so dass es lediglich einen austauschbaren anonymen Charakter im Diskurs hat. Das begründende Subjekt hätte die Funktion den Dingen einen Sinn zu verleihen oder tiefere Bedeutungen zu entdecken. Da dies aber nicht nötig ist, weil „vorgängige, gewissermaßen schon gesagte Bedeutungen die Welt durchdrungen haben, sie um uns herum angeordnet und von vornherein einem ursprünglichen Wiedererkennen geöffnet haben.“45Das Subjekt ist demnach nicht mehr frei, denn es ist eingebunden in eine schon vorbestimmte Welt und determiniert durch die sie beherrschenden Machtstrukturen. Es verliert vor diesem Hintergrund schließlich an Bedeutung. So ist das Subjekt auch nicht mehr das Zugrundeliegende, sondern ein sozialisiertes und der Gesellschaft angepaßtes und unterworfenes Wesen, welches abhängig und bestimmt ist von einer aus herrschenden Machtkonstellationen entspringenden Vernunft.46Ein Beispiel findet sich hierfür in Foucaults Werk „Geburt der Klinik“: Ein Patient wird in der Klinik zum Objekt seiner Krankheit gemacht. Es handelt sich für die behandelnden Ärzte nur um einen Krankheitsfall und die Persönlichkeit des Erkrankten wird dabei nicht geachtet. Das bedeutet, dass die Krankheit in diesem Fall das Subjekt ist, welches sich eines Objektes, nämlich den Menschen, bemächtigt hat.
2.3.2. Einfluß auf die Literaturwissenschaft
2.3.2.1. Der Autor
Das Verschwinden des Subjekts hatte im Poststrukturalismus weite Kreise gezogen. So wie vorher das Subjekt Macht ausübte und über andere bestimmen konnte, wurde auch der Autor als Schöpfer und Herrscher über sein Werk gesehen. Doch auch der Autor büßte in Folge Foucaults Gedanken seine herausragende Stellung ein.
Der Autor ist im wesentlichen ein Prinzip der Verknappung des Diskurses. Texte werden nicht mehr auf die Absicht des Autors hin analysiert, sondern es wird vielmehr darauf geachtet, welche Themen ausgewählt werden, d.h. welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Thema in die Diskurse eingeht. Ferner wird untersucht, wie diese behandelt werden und auch welche Sachverhalte keine Rolle spielen. Foucault sieht „den Autor als Prinzip der Gruppierung von Diskursen [...] als Mittelpunkt ihres Zusammenhalts.“47Dem Autor wird seine schöpferische Leistung als produzierendes Subjekt abgesprochen, d.h. „der Urheber eines Textes wird nicht mehr im Licht seiner individuellen Genialität gesehen, sondern auch im Schatten seiner institutionellen Bedingtheit.“48Dies läßt sich damit erklären, dass die Urheber eines Textes angesichts der Tatsache, dass die Diskursregeln die Ordnung der Texte bestimmen, an Bedeutung verlieren und ihm das Urheberrecht somit streitig gemacht wird. Der Autor wird zu einem Ordnungsfaktor reduziert, zu einem Funktionsträger im Diskurs, dessen Aufgabe das Selektieren und Kombinieren der sie umgebenden Diskurse ist.
2.3.2.2. Der Autorname
Foucault will dem Autor nicht seine schreibende und erfindende Existenz rauben. Vielmehr deutet er darauf, dass immer mehr Autoren zu ihrer Funktion als Autor greifen und sich damit selbst ‚zerstreuen‘. Das Autor-Subjekt ist demnach nicht mehr zu fassen, ihm kann kein Platz in der Analyse zugesprochen werden und bleibt somit unberücksichtigt. In der Vorlesung «Was ist ein Autor?»49, die Foucault vor der französischen Gesellschaft für Philosophie 1969 gehalten hat, ist sein Anliegen in erster Linie die Leerstellen ausfindig zu machen, die zuvor der Autor ausgefüllt hat. Denn das Fehlen des Autors muß schließlich irgendwo zu spüren sein. Foucault beginnt bei der offensichtlichsten Leerstelle, dem Autornamen. Dieser ist weder ein gewöhnlicher Eigenname, denn er ist nicht mit einer Person, sondern mit einem Text verbunden, noch kann er als feste Beschreibung gelten, da der Name allein so gut wie nichts über den Text aussagt.
„Der Eigenname und der Autorname liegen zwischen den beiden Polen der Beschreibung und der Bezeichnung. Jedoch [...] die Verbindung des Eigennamens mit dem benannten Individuum und die Verbindung des Autornamens mit dem, was er benennt, sind nicht isomorph und funktionieren nicht in gleicher Weise.“50
Ganz einfach läßt sich dies an folgendem Beispiel erklären: «Maria Müller gab es nicht» hat eine ganz andere Bedeutung als «William Shakespeare gab es nicht». Die Funktion des Namens besteht lediglich in der Tatsache, dass einem solchen Namen eine bestimmte Zahl von Texten zugeordnet werden kann, die sich wiederum von Texten eines anderen Namens abgrenzen. Texte können so in Bezug zueinander gesetzt werden. Der Autorname ist nicht einer Person zuzuordnen, „sondern in dem Bruch, der eine bestimmte Gruppe von Diskursen und ihre einmalige Seinweise hervorbringt.“51
Bonn 2001, S.144
Foucault stellt den ‚bloßen‘ Buchautoren gewisse Diskursivitätsbegründer gegenüber, wie z.B. Freud oder Marx. Diese haben selber auch Werke geschaffen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit und die Bildungsgesetze für andere Texte geschaffen und Raum für etwas anderes als sie selbst gegeben, das jedoch zu dem gehört, was sie begründet haben.52
2.3.2.3. Die Autorfunktion
Im Verhältnis zu Werk und Text erläutert Foucault die Funktion des Autors. Diskurse, die Träger der Autorfunktion sind, weisen folgende vier Merkmale auf. Erstens haben Autoren eine Eigentumsbeziehung zum Text, welche sogar seit Jahren rechtlich geschützt ist, wie z.B. Gesetze über Autorenrechte, wie das Urheberrecht oder Gesetze über die Beziehungen zwischen Autor und Verleger etc. Der Autor kann sich jedoch nicht als Urheber eines Textes bezeichnen noch kann er für diesen verantwortlich gemacht werden. Die Autorfunktion gilt zweitens nicht für alle Diskurse einer Gesellschaft. Im Mittelalter war es üblich, dass literarische Texte keinen Bezug zum Autor aufwiesen, wissenschaftliche Texte aber ohne Autor keine Gültigkeit besaßen. Heute ist das eher andersherum. Man beschäftigt sich in der Regel mit literarischen Texten, wenn der Autor bekannt ist. Drittens ist die Autorfunktion das „Ergebnis einer Konstruktion, die das Vernunftwesen Autor erst erschafft.“53Diese Konstruktionen sind zwar abhängig von derepisteme, es lassen sich aber dennoch einige gemeinsame Punkte aufzeigen. Der Autor ist derjenige, durch den die Eigenarten und Veränderungen in einem Werk erklärt werden können. Man kann dem Autor eine gewisse Einheit des Schreibens in seinen Werken zusprechen. Ausgehend von diesen lassen sich auch Widersprüche in verschiedenen Texten des Autors lösen. Das letzte Merkmal der Autorfunktion ist die Tatsache, dass ein Text zwar durch Personalpronomina und Adverbien der Zeit und des Ortes auf den Autor verweist, diese Verweise in Diskursen mit Autorfunktion aber anders als in denen ohne wirken. „So verweist das Ich im Roman weder auf den empirischen Schriftsteller noch auf die Schreibgeste allein.“54
Die Autorfunktion ist ebenfalls an die Diskursregeln gebunden und wird von ihnen determiniert. Sie wirkt jedoch nicht gleichmäßig auf alle Diskurse, mal ist sie stärker mal schwächer ausgeprägt und vor allem ist sie nicht auf ein einzelnes Individuum zurückzuführen.
III. Rückkehr des Subjekts
Die Theorie des vollständigen Verschwindens des Autors konnte sich jedoch weder in der Philosophie noch in der Literaturwissenschaft durchsetzen. Dem Autor wird nach wie vor eine bedeutendere Rolle zugeschrieben, als Foucault es ihm zugestehen wollte. Doch selbst Foucault nahm in späteren Werken wieder Abstand von der Idee der radikalen Unterwerfung des Subjekts und „führte“ es in seinem Werk, den drei Bänden von «Sexualität und Wahrheit» wieder ein. War Foucault vorher der Meinung, dass nicht der Mensch selbst entscheidet über was er nachdenkt und spricht, sondern die ihn beherrschenden Wissens- und Machtstrukturen, so berücksichtigte er nun, dass das Lebens doch wirklich gelebt wird und man nicht nur wie eine Marionette gelenkt wird. Er betont auch, dass der Mensch trotzdem Verantwortung für sein Leben trägt und eine Art ‚Sinn des Lebens‘ finden muss.
„Aber Entwertung des menschlichen Daseins zu einem ohnmächtigen Anhängsel von unverfügbaren Natur- und Geschichtsereignissen, anonymen Kräften und Machtverhältnissen bedeutet für einen bewußt lebenden Menschen eben nicht Entlastung von der Sorge um sich oder Befreiung von der Suche nach orientierenden Werten und Lebensdeutungen.“55
Im Zentrum von «Sexualität und Wahrheit» steht die Selbstgestaltung des eigenen Lebens, einem Leben, dem man nicht mehr so hilflos ausgeliefert ist. Sein besonderes Augenmerk richtet Foucault auf die Antike und untersucht diese unter dem Standpunkt, dass der Mensch für sich selbst sorgen sollte und nur das ist, was er selbst aus sich macht, im Sinne einer «Kultur seiner selbst», in der sich der
Mensch zu formen, gestalten und erschaffen in der Lage ist. Foucault nennt dies auch „Technologien des Selbst“.56
Das Individuum wird in seinen Schriften also wieder entdeckt. Er spricht in diesem Zusammenhang auch von einer „Ästhetik der Existenz“, welche bedeutet „aus seinem Leben ein schönes Werk zu machen, das Halt geben kann, wo die ethischen Leitlinien von Religion und Moderne keine Überzeugungskraft mehr besitzen.“57Dies gelingt mit der Beherrschung der „Kunst der Existenz“, die besagt, dass das Leben eines Menschen wie ein Kunstwerk angeordnet werden soll, was zur Folge hat, dass man frei von jeder Machtstruktur leben kann.
Zusammenfassend läßt sich sagen, dass es Foucault für eine Zeit lang fast gelungen wäre, das Subjekt, den zugrundeliegenden Ausgangspunkt des menschlichen Seins, verschwinden zu lassen. Aber er mußte zuletzt selber einsehen, dass eine radikale Eliminierung trotz herrschender Machtkonstellationen, nicht möglich ist. Foucault war im Gegensatz zu anderen Philosophen seiner Zeit, wie Derrida oder Deleuze, auch Gesellschaftstheoretiker und Historiker, der sich mit den Problemen unserer sozialgeschichtlichen, politischen und kulturellen Wirklichkeit befaßt hat. Er befaßte sich nicht nur mit abstrakten Theorien, sondern suchte immer wieder den Bezug zur Realität, wie auch an den Themen seiner Bücher ersichtlich ist. Nicht zuletzt deswegen gilt Foucault als einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts.
Literaturverzeichnis:
-Baasner, R. / Zens, M.: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft - Eine
Einführung. 2. Auflage, Bonn 2001, S.137-146
-Eicher, T. / Wiemann, V.: Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft. Paderborn 1996,
S.36-38
-Fink-Eitel, H.: Foucault zur Einführung. 2. Auflage, Hamburg 1992
-Foucault, M.: Was ist ein Autor? In: J. Fotis; G. Lauer; M. Martinez; S. Winko (Hrsg.):
Texte zur Theorie der Autorschaft. Stuttgart 2000, S. 194-229
-Foucault, M. / Seitter, W.: Das Spektrum der Genealogie. Bodenheim o.D., S.7-47
-Foucault, M.: Schriften zur Literatur. München 1974
-Foucault, M.: Die Ordnung des Diskurses. 3. Auflage, Frankfurt a. M. 1997
-Grübel, R. / Grüttemeier, R. / Lehten, H. (Hrsg.): Orientierung
Literaturwissenschaft. Hamburg 2001, S.153-163
-Kammler, C.: Michel Foucault. Eine kritische Analyse seines Werkes: Studien
zur französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Band 12, Bonn 1986
-Kleiner, M. (Hrsg.): Michel Foucault. Eine Einführung in sein Denken. Frankfurt a. M. 2001
-Marchand, S.: Foucault, die moderne Individualität und die Geschichte der humanistischen Bildung. In: Mergel, T. / Welskopp, T. (Hrsg.): Geschichte zwischen Kultur und Gesellschaft. Beiträge zur Theoriedebatte. München 1997, S.323-346
-Nünning, A. (Hrsg.): Michel Foucault. in: Metzler Literaturlexikon Literatur und Kulturtheorie. 2. Auflage, Stuttgart 2001, S.189-190
-Ortega, F.: Michel Foucault: Rekonstruktion der Freundschaft. München 1997
-Taureck, B.: Michel Foucault. Hamburg 1997
-Wetz, F.: Wie das Subjekt sein Ende überlebt: Die Rückkehr des Individuums in
Foucaults und Rortys Spätwerk. In: R. Fetz; R. Hagenbüchle; P. Schulz (Hrsg.): Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität. Berlin 1998, S.1277- 1290
-Zima, P.: Theorie des Subjekts: Subjektivität und Identität zwischen Moderne und Postmoderne. Tübingen 2000
-Zima, P.: Das literarische Subjekt: Zwischen Spätmoderne und Postmoderne. Tübingen 2001, S.227-237
[...]
1Kant, I.: Kritik der einen Vernunft, Hamburg 1998
2Zima, P.: Theorie des Subjekts: Subjektivität und Identität zwischen Moderne und Postmoderne, Tübingen 2000, S.3
3ders. S.4
4Zima, P.: Das literarische Subjekt: Zwischen Spätmoderne und Postmoderne, Tübingen 2001, S.229
5ders. S.231
6 ders. S.230
7Taureck, B.: Michel Foucault, Hamburg 1997, S. 18
8ders. S.19
9 ders. S. 22
10vgl. Foucault, M. Was ist ein Autor? In: J. Fotis u.a.: Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, S. 219
11Binswanger, L. : Traum und Existenz, Bern, Berlin 1992
12Foucault, M.: Psychologie und Geisteskrankheit. Frankfurt a. M. 1968 (frz. 1954)
13Taureck 1997, S.33
14 ders. S.33
15ders. S.36
16Foucault, M.: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt a.M. 1973 (frz. 1961)
17Nünning, A.: Michel Foucault. In: Metzler Literaturlexikon. Literatur- und Kulturtheorie, 2. Auflage, Stuttgart 2001, S.190
18 Foucault, M.: Die Geburt der Klinik: Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. München 1973 (frz. 1963)
19Foucault, M.: Raymond Roussel. Frankfurt a. M. 1988 (frz. 1963)
20Foucault, M.: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften. Frankfurt a. M. 1969 (frz. 1966)
21Nünning 2001, S.190
22ebd.
23Foucault, M.: Die Archäologie des Wissens. Frankfurt a. M. 1973 (frz. 1969)
24Taureck 1997, S. 81
25Foucault, M.: Der Fall Rivière. Materialien zum Verhältnis von Psychatrie und Strafjustiz. Frankfurt
a. M. 1975 (frz. 1973)
ders.: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt a. M. 1976 (frz. 1975) ders.: Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychatrie und Medizin. Berlin 1976
26Taureck 1997, S.96
27Foucault, M.: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. Frankfurt a. M. 1977 (frz. 1976) ders.: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheit 2. Frankfurt a. M. 1986 (frz. 1984) ders.: Die Sorge um sich. Sexualität und Wahrheit 3. Frankfurt a. M. 1986 (frz. 1984)
28Althusser, L.: L’avenir dure longtemps, Paris 1994
29Nünning 2001, S. 613
30ders. S.190
31 Foucault, M.: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der humanwissenschaften. Frankfurt a. M.
32Geisenhanslükke, A.: Literatur und Diskursanalyse. In: M. Kleiner (Hrsg.): Michel Foucault. Eine Einführung iin sein Denken, Frankfurt a. M. 2001, S. 62
33Foucault, M.: die Archäologie des Wissens. Frankfurt a.M. 1973 (frz. 1969)
34ders. S.62
35 Foucault, M.: Ordnung des Diskurses. Frankfurt a. M. 1991 (frz. 1971)
36 Geisenhanslükke 2001 S. 63
37 Baasner 2001, S.138
38Zima 2000, S. 234
39Grübel, R. u.a.: Orientierung Literaturwissenschaft, Hamburg 2001, S.154
40ders. S. 158
41 ders. S.161
42Geisenhanslükke 2001, S.67
43Zima 2000, S. 238
44Zima 2001, S.236
45 Foucault 1997, S.31-32
46vgl. Zima 2000, S. 231
47Foucault 1997, S. 20
48 Baasner, R. u.a.: Methoden und Modelle der Literaturwissenschaft - Eine Einführung, 2. Auflage,
49Foucault, M.: Was ist ein Autor ? In: J. Fotis; G. Lauer; M. Martinez; S. Winko (Hrsg.): Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000
50ders. S.208
51 ders. S.211
52vgl. ders. S.219
53ders. S.195
54 ders. S.195
55Wetz, F.: Wie das Subjekt sein Ende überlebt: Die Rückkehr des Individuums in Foucaults und Rortys Werk. In: R. Fetz / R. Hagenbüchle / P. Schulz (Hrsg.): Geschichte und Vorgeschichte der modernen Subjektivität 2. Berlin / New York 1998, S.1283
56vgl. ders. S.1285
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Gliederung"?
Der Text untersucht die Subjekttheorie von Michel Foucault, insbesondere im Kontext seiner Diskurstheorie und Diskursanalyse. Er beleuchtet Foucaults Ansichten zum Verschwinden des Subjekts und die spätere Rückkehr des Subjekts in seinen Werken.
Wer ist Michel Foucault und welche Rolle spielt er in diesem Text?
Michel Foucault ist ein zentraler Philosoph, dessen Leben, Werk und Subjekttheorie im Mittelpunkt des Textes stehen. Der Text untersucht seine Studien, Professuren, Hauptwerke sowie seine Ansichten zu Diskurs, Macht und Wahrheit.
Was versteht Foucault unter dem Begriff "Diskurs"?
Foucault definiert den Diskurs als eine Menge von Äußerungen, die aufgrund spezifischer, epochenbedingter Diskursordnungen eine bestimmte Struktur aufweisen. Es gehören hierzu alle Äußerungen, die zu dem thematischen Aspekt des Diskurses Wissenselemente beitragen.
Was sind Diskursregeln nach Foucault?
Foucault spricht von einem Regelwerk, welches eine entscheidende Rolle im Diskurs spielt. Es bestimmt unterschiedliche Formationen, wie zum Beispiel die Formation der Gegenstände, also die Frage, über welche Sachverhalte überhaupt geredet wird und welche Gesellschaftsgruppen diese in den Diskurs einbringen.
Wie definiert Foucault den Begriff "Macht"?
Foucaults Machtbegriff ist ein Kräfteverhältnis, dass verschiedene Kräfte miteinander in Beziehung setzt. Sie ordnet, schafft Beziehungen und Verhältnisse und überführt diese in eine bestimmte Ordnung. Sie ist im Gegenteil zum früheren Machtbegriff produzierend, schöpferisch und auch positiv.
Was bedeutet die "Diskursanalyse" nach Foucault?
Die Diskursanalyse hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Regeln des Diskurses zu bestimmten historischen Zeitpunkten herauszufinden und fördert auf diese Weise weitreichende Annahmen über eine Ordnung der Welt im Allgemeinen zutage.
Was bedeutet "das Verschwinden des Subjekts" im Kontext von Foucaults Theorie?
Nach Foucault ist "das individuelle Subjekt [...] ein Produkt von Machtkonstellationen, die als diskursive Formationen beschreibbar sind." Das Subjekt ist also den Diskursregeln unterworfen, was seine Selbstständigkeit einschränkt.
Welchen Einfluss hatte Foucaults Theorie auf die Literaturwissenschaft?
Foucaults Theorie führte dazu, dass der Autor nicht mehr als Schöpfer und Herrscher über sein Werk gesehen wurde, sondern als ein Prinzip der Verknappung des Diskurses. Texte werden nicht mehr auf die Absicht des Autors hin analysiert.
Was bedeutet die "Rückkehr des Subjekts" in Foucaults späteren Werken?
Foucault nahm in späteren Werken wieder Abstand von der Idee der radikalen Unterwerfung des Subjekts und betonte, dass der Mensch trotzdem Verantwortung für sein Leben trägt und eine Art ‚Sinn des Lebens‘ finden muss.
Welche Bedeutung haben die "Technologien des Selbst" im Zusammenhang mit Foucaults Theorie?
Die "Technologien des Selbst" beziehen sich auf die Selbstgestaltung des eigenen Lebens. Foucault betont, dass der Mensch für sich selbst sorgen sollte und nur das ist, was er selbst aus sich macht, im Sinne einer «Kultur seiner selbst», in der sich der Mensch zu formen, gestalten und erschaffen in der Lage ist.
Wo finde ich die im Text zitierte Literatur?
Eine detaillierte Auflistung der zitierten Literatur, einschliesslich der jeweiligen Autoren und Titel, findet sich im Literaturverzeichnis am Ende des Textes.
- Citation du texte
- Anna Naumann (Auteur), 2002, Das Verschwinden des Subjekts - Michel Foucault, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107362