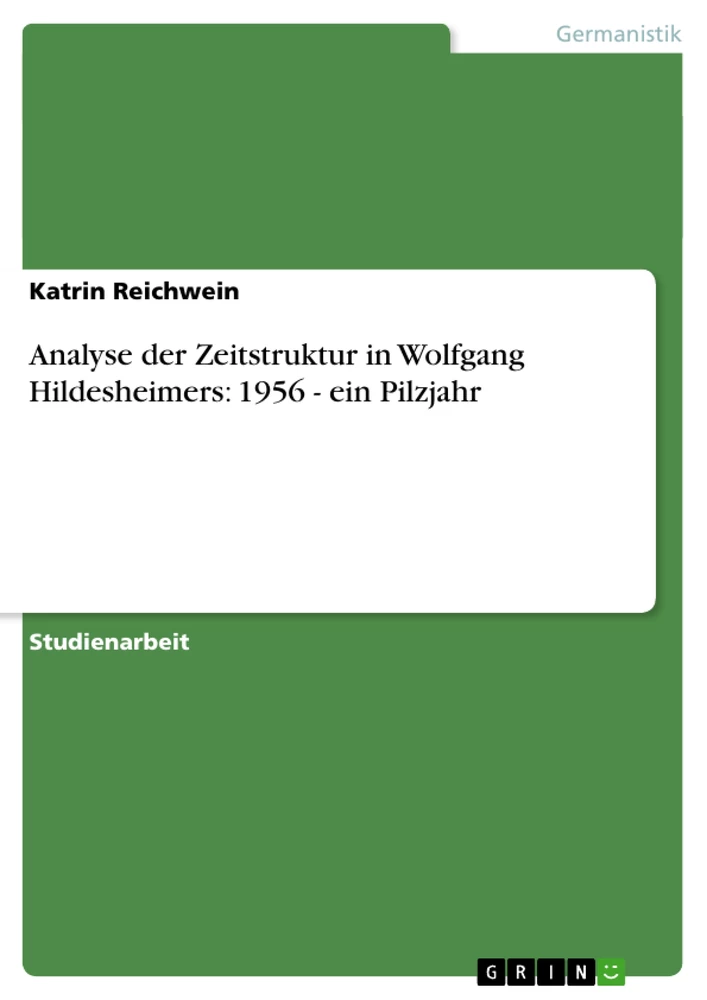Inhalt
1. Einleitung
2. Hauptteil - Analyse der Zeitstruktur
2.1 Erzählzeit und erzählte Zeit
2.2 Ordnung
2.3 Dauer
2.3.1 Pausen
2.3.2 Ellipsen
2.3.3 Raffungen
2.3.4 Szenen
2.4 Frequenz
3. Schluss
Literatur
1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit ist mein Versuch, das im Einführungsseminar erarbeitete Wissen über die Erzähltextanalyse, in die Praxis umzusetzen. Ich werde in dieser Arbeit den Text nach Matias Martinez und Michael Scheffels „Einführung in die Erzähltheorie“1 in der Kategorie Zeit (Ordnung, Dauer, Frequenz) analysieren. Weiterhin ist zu sagen, dass es sich bei dem Text „1956 - ein Pilzjahr“2 von Wolfgang Hildesheimer zwar um eine fiktive Erzählung handelt, da von erfundenen Vorgängen berichtet wird, der fiktive Erzähler aber Fußnoten und Quellenangaben anfügt, was dem Text den Charakter eines Lexikoneintrages verleiht und die Erzählung somit faktual bzw. real erscheinen lässt. Des Weiteren treten real existierende Personen auf. Diese Tatsachen machen es schwer den Text nach einer Kategorie, wie etwa der Zeitstruktur, zu analysieren.
Ich verwende die bereitgestellte Kopie der Frankfurter Ausgabe (1962) von Wolfgang Hildesheimer: „Lieblose Legenden“ (1952). Zitiere ich aus dem Werk selbst, werden die Seitenzahlen gleich nach dem Zitat angegeben.
2. Analyse der Zeitstruktur
2.1 Erzählzeit und erzählte Zeit
Die Erzählzeit ist nicht genauer bemessen, sie hat in der Frankfurter Ausgabe von 1962 einen Umfang von vierzehn Seiten, während die erzählte Zeit einen Zeitraum von etwa 167 Jahren umfasst. Der fiktive Erzähler beginnt seine Erzählung im Jahr 1956 und geht in dieser bis ins Jahr 1789, dem Geburtsjahr der Hauptfigur Gottlieb Theodor Pilz‘, zurück.
2.2 Ordnung
Die Erzählung beginnt mit einer Einleitung im Jahr 1956, in der der fiktive Erzähler erklärt, warum er über Gottlieb Theodor Pilz berichten bzw. schreiben will. Dieses in der Erzählgegenwart Erzählte bildet den Rahmen für die weitere Geschichte.
In Form einer Analepse mit einer Reichweite von etwa 167 Jahren und einem Umfang von 67 Jahren (1789-1856) beginnt auf Seite 21 ab Zeile 20 die Erzählung des Lebens von Gottlieb Theodor Pilz. Es handelt sich hierbei um eine partielle Analepse, da der Einschub nicht lückenlos bis an die Erzählgegenwart heran führt; die Jahre 1856 bis 1956 werden ausgespart.
Auf Seite 33, Zeile 25 springt die narrative Instanz wieder vom Tod Gottlieb Theodor Pilz‘ am 12. September 1856 in die Gegenwart der erzählten Zeit, also ins Jahr 1956, zurück.
2.3 Dauer
Der Text zeichnet sich vor allem durch summarisches Erzählen, viele Zeitsprünge (Ellipsen) und Pausen durch Kommentare des fiktiven Erzählers aus. Von diesen seien im Folgenden einige Beispiele gegeben.
Die Briefe Gottlieb Theodor Pilz‘ an seine Mutter, seinen Vater oder Beethoven kann man als eingeschobenes Erzählen betrachten. Dies fällt aber unter die Kategorie Stimme und deshalb will ich hier nicht genauer darauf eingehen.
2.3.1 Pausen
Die erste Pause in der Erzählung findet sich bereits zu Beginn. Der fiktive Erzähler verweist dabei auf ein Werk über die Hauptfigur:
„(Vergleiche G.S. Grützbacher: ‘Ist Pilz Dinkelsbühler? Beiträge zu einer Streitfrage.‘ Blätter für angewandte Kultur, Jahrgang XXII, 1881.)“ (S. 21, Z. 24ff. )
Ähnliche Verweise finden sich häufiger. Dabei schreitet die Erzählung zwar weiter, aber das Geschehen steht still. So auch auf Seite 22, Zeile 24ff:
„(Vergleiche: ‘Die sieben Briefe des Gottlieb Theodor Pilz‘, herausgegeben von Karl Ferdinand Gutzkow, Cottasche Verlagsbuchhandlung 1864.)“
Es findet sich auch noch eine weitere Form der Pause in der Erzählung, diese erfolgt in Form von direkten Kommentaren des fiktiven Erzählers. Diese Kommentare haben nichts direkt mit dem erzählten Geschehen zu tun bzw. sind für dieses nicht unbedingt wichtig, sie sind lediglich Einschätzungen, Beschreibungen oder Reflexionen des Erzählers.
Hier einige Beispiele:
„[...] - Pilz darf als ein Pionier des In-der-Sonne-Sitzens gelten -, [...]“ (S. 24, Z. 11f.)
„Hermannsschlachten gäbe es schon und würde es auch in Zukunft zur Genüge geben. (- Prophetische Worte! -) “ (S. 25, Z. 17ff., Hervorhebung von mir)
„Über den Eindruck, den diese Oper dem damals Fünfundzwanzigjährigen hinterlassen hat, ist nichts bekannt. Es ist anzunehmen, dass er sich zu diesem Werk nicht äußerte. Wir wissen jedoch, dass er während seiner Wiener Zeit persönlichen Verkehr mit Beethoven pflegte, und die unproduktive Periode des Meisters, die bekanntlich von 1814 bis 1818 währte, mag wohl auf diese Begegnungen zurückzuführen sein; aber das ist lediglich eine These, die wohl der Belegung durch zukünftige Forscher bedarf.“ (S. 26, Z. 7ff)
„Es ist anzunehmen, dass er sich schlafend stellte, denn ihre Gesellschaft bot ihm nichts Verlockendes. Auch darin unterschied sich Pilz von zahlreichen Männern seiner Zeit.“ (S.27, Z.8ff.)
2.3.2 Ellipsen
„Man zählte das Jahr 1804, Pilz war fünfzehnjährig.“ (S. 23, Z. 6f.)
Hier spricht der fiktive Erzähler noch von der fünfzehnjährigen Hauptfigur Pilz. Im nächsten Absatz springt er aber sofort um einige Jahre in Pilz‘ Leben nach vorne, wobei nicht geklärt werden kann, um wie viele Jahre, da nicht explizit gesagt wird, wann Pilz‘ Schulzeit endete.
„Nach beendeter Schulzeit reiste er nach Italien, wo er bis 1809 blieb“ (S.23, Z. 8f.)
Somit handelt es sich hier um einen Zeitsprung bzw. eine implizite Ellipse. Die Erzählung steht an dieser Stelle still, das Geschehen geht aber weiter. Diese Aussparung betrifft, um mit Martinez/Scheffel zu sprechen, ein Geschehen, das für die eigentliche Geschichte nicht von Bedeutung ist.3
Auf Seite 26, Zeile 3f. berichtet der fiktive Erzähler über die Erbauung eines Turnplatzes für die Figur Jahn, welche sich im Jahre 1811 ereignete. Darauf springt der Erzähler ins Jahr 1814 und erwähnt:
„Wo Pilz die nächsten drei Jahre verbrachte, ist unbekannt“ (S. 26, Z. 5f.)
Da die ausgesparte Zeit mit drei Jahren genau bemessen ist, handelt es sich hier um eine explizite Ellipse.
2.3.3 Raffungen
Der Text „1950 - ein Pilzjahr“ arbeitet viel mit zeitraffendem bzw. summarischem Erzählen. Die Erzählzeit ist dabei kürzer als die erzählte Zeit, in anderen Worten, das Geschehen dauert länger als die Erzählung dessen.
„Die Eindrücke seiner Jugend trugen Wesentliches zu Gottlieb Theodors Entwicklung bei.[I] Von seiner Mutter wurden ihm Choräle von Buxtehude an der Wiege gesungen, und kaum war er dieser entwachsen, las ihm sein Vater Tacitus und Milton in eigenen Übersetzungen vor.“ (S. 22, Z. 3ff.)
Kindheit und Jugend Pilz‘ werden in zwei Sätzen zusammengefasst. Da sie für den Fortschritt der Geschichte nicht von allzu großer Bedeutung sind, muss der fiktive Erzähler nicht weiter auf sie eingehen.
„Schlegel schreibt, dass sie ihn auf der Via Appia antrafen, wo dieser in der Sonne saß [...] und ihn nach dem Weg zu den Caracalla-Thermen fragten, dem Ziel ihres Spaziergangs. Pilz erwiderte, dass er hier selbst fremd sei. So war das Gemeinsame der Situation festgestellt, und man kam ins Gespräch.“ (S. 24, Z. 10ff.)
Hierbei handelt es sich um die Zusammenfassung eines Dialogs zwischen den Figuren Schlegel, Madame de Staël und Pilz. Die Begegnung und der darauf folgende Dialog der drei sind stark gerafft.
„Die Jahre von 1842 bis 1850 verbrachte Pilz auf Reisen in Italien, der Schweiz und Deutschland, wo er Schumann und Mendelssohn begegnete, denen er seine Theorie, nach welcher ein Komponist nicht mehr als vier Symphonien schreiben sollte, mit Erfolg vortrug.“ (S. 32, Z. 9ff.)
In einem Satz fasst der Erzähler die Ereignisse der Jahre 1842 bis 1850 in Pilz‘ Leben zusammen. Das Geschehen beansprucht eine längere Dauer, nämlich acht Jahre, als die Erzählung davon.
2.3.4 Szenen
Bei szenischem bzw. zeitdeckendem Erzählen stimmen Erzählzeit und erzählte Zeit überein. Es tritt vorwiegend in Form von Dialogen auf. Da Hildesheimer fast vollkommen auf Dialoge verzichtet, sind nur wenige szenische Elemente im Text vorhanden.
„Pilz wehrt nicht nur energisch ab, sondern beginnt, bei dieser Gelegenheit, dem Älteren ins Gewissen zu reden: Jahn sei auf der falschen Bahn. Hermannsschlachten gäbe es schon und würde es auch in Zukunft genüge geben. [...] Nein, so argumentiert Pilz, ohne das Maß seiner geistigen Gaben in irgendeiner Weise schmälern zu wollen, lägen vielleicht seine wirklichen Fähigkeiten doch auf einem anderen Gebiet - ja, habe er denn nicht überhaupt einen geheimen Hang zu Leibesübungen?“ [...] (S. 25, Z. 15ff.)
In dieser Szene hält sich der Erzähler so weit zurück, dass der Eindruck einer Übereinstimmung von Erzählzeit und erzählter Zeit entsteht. Der Dialog zwischen den Figuren Jahn und Pilz wird in indirekter Rede wiedergegeben, man weiß dabei aber nicht, wie die wirklich gesprochenen Worte lauten.
„Plötzlich sinkt er leblos zu Boden. Die Anwesenden klatschen Beifall. Sie glauben, diese Geste kröne den Vortrag. Erst allmählich überzeugen sie sich unter großer Erschütterung von dem Ableben des Siebenundsechzigjährigen.“ (S. 33, Z. 18)
Dieser Abschnitt erscheint szenisch, da sich der Erzähler hier ebenfalls zurück hält und nur das vorgefallene Ereignis im Präsens wiedergibt. Der Leser hat somit das Gefühl direkt im Geschehen zu sein.
2.4 Frequenz
Bei fast dem gesamten Text handelt es sich um eine singulative Erzählung. Es wird jeweils nur einmal erzählt, was sich einmal ereignet hat.
Die einzigen Ausnahmen bilden die Erzählung Pilz‘ Todes und die Cafébesuche mit Schlegel und Madame de Staël.
Bei der Erzählung vom Tode Pilz‘ handelt es sich um eine repetetive Erzählung, die sich jedoch auf zwei Sätze in der gesamten Erzählung beschränkt: Pilz stirbt nur einmal, der fiktive Erzähler berichtet jedoch zweimal von dessen Tod. In der Einleitung erzählt der fiktive Erzähler nur die Tatsache, dass Pilz gestorben ist, um deutlich zu machen, um wen sich die weitere Erzählung drehen soll:
„Einen aber hat man vergessen: Gottlieb Theodor Pilz, der, vor hundert Jahren, am 12. September 1856 starb.“ (S. 21, Z. 8f.)
Ein weiters Mal wird am Ende der Erzählung vom Tode Pilz‘ berichtet, an dieser Stelle jedoch ausführlicher und ausgeschmückter:
„Am zwölften September 1856, bei einer seiner Abendgesellschaften, ereilt ihn sein dramatischer Tod.“ (S. 33, Z. 12f.)
Bei den Cafébesuchen mit Schlegel und Madame de Staël handelt es sich dagegen um eine iterative Erzählung. Hier wird nur einmal erzählt, was sich mehrmals ereignet hat:
„Man traf sich noch einige Male im Café Greco.“ (S. 24, Z. 26, Hervorhebung von mir)
3. Schluss
Der Text „1959 - ein Pilzjahr“ von Wolfgang Hildesheimer stellt eine Ausnahme unter den Erzähltexten dar. Er bedient sich nur weniger erzähltexttypischer Elemente. In der Regel finden in Erzähltexten viele Wechsel von summarischen und szenischem Erzählen statt, z.B. um das Erzähltempo zu beschleunigen. Auf die Form des Dialogs wird in Hildesheimers Kurzgeschichte weitestgehend verzichtet, so finden sich auch nur wenige szenische Elemente.
Des weiteren bilden Pausen als rhetorische Figur eher eine Ausnahme. Hildesheimer benutzt diese jedoch sehr häufig und geht sogar noch weiter, in dem er Fußnoten anfügt. Dies macht es auch so schwer den Text erzähltheoretisch zu analysieren. Hildesheimer hält sich bei seinem Text nur an wenige gängige Elemente: Es handelt sich, von zwei Ausnahmen abgesehen, um eine singulative Erzählung und er verwendet in dieser Zeitsprünge, die einen Regelfall eines Erzähltextes darstellen.
Literatur
- Hildesheimer, Wolfgang: Lieblose Legenden (1952). Frankfurt: 1962.
- Martinez, Matias/ Scheffel, Michael: Einführung in die Erzählanalyse. 3.
Auflage. München: C.H. Beck 2002.
[...]
1 Matias Martinez/Michael Scheffel: Einführung in die Erzählanalyse. 3. Auflage. München: C.H. Beck 2002.
2 Wolfgang Hildesheimer: Lieblose Legenden (1952). Frankfurt: 1962.
Häufig gestellte Fragen zu Wolfgang Hildesheimers "1956 - ein Pilzjahr"
Was ist das Hauptthema der Analyse in dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Text "1956 - ein Pilzjahr" von Wolfgang Hildesheimer unter dem Aspekt der Zeitstruktur, basierend auf dem Ansatz von Matias Martinez und Michael Scheffel in "Einführung in die Erzähltheorie". Dabei werden Ordnung, Dauer und Frequenz untersucht.
Wie wird die Erzählzeit und erzählte Zeit im Text behandelt?
Die Erzählzeit umfasst vierzehn Seiten in der Frankfurter Ausgabe von 1962, während die erzählte Zeit einen Zeitraum von etwa 167 Jahren abdeckt. Die Erzählung beginnt im Jahr 1956 und geht bis zum Geburtsjahr der Hauptfigur Gottlieb Theodor Pilz (1789) zurück.
Welche Art von Analepse wird im Text verwendet?
Es wird eine partielle Analepse verwendet, die eine Reichweite von etwa 167 Jahren (bis 1789) hat und einen Umfang von 67 Jahren (1789-1856) umfasst. Die Jahre 1856 bis 1956 werden jedoch ausgespart.
Welche Techniken der Zeitgestaltung werden im Text verwendet?
Der Text zeichnet sich durch summarisches Erzählen, viele Zeitsprünge (Ellipsen) und Pausen durch Kommentare des fiktiven Erzählers aus. Es gibt sowohl explizite als auch implizite Ellipsen.
Was sind Beispiele für Pausen im Text?
Pausen treten in Form von Verweisen auf andere Werke über die Hauptfigur oder durch direkte Kommentare des fiktiven Erzählers auf, die nichts direkt mit dem erzählten Geschehen zu tun haben.
Was sind Beispiele für Ellipsen im Text?
Ein Beispiel für eine implizite Ellipse ist der Übergang vom fünfzehnjährigen Pilz zu seiner Reise nach Italien, wobei die Zeit zwischen dem Ende der Schulzeit und der Reise nicht explizit genannt wird. Eine explizite Ellipse findet sich in der Aussage, dass unbekannt ist, wo Pilz die nächsten drei Jahre nach 1811 verbrachte.
Wie wird die Frequenz der Erzählung im Text gehandhabt?
Der Text ist hauptsächlich singulativ, d.h., es wird jeweils nur einmal erzählt, was sich einmal ereignet hat. Ausnahmen bilden die Erzählung von Pilz' Tod und die Cafébesuche mit Schlegel und Madame de Staël.
Was ist eine iterative Erzählung und wo findet sie sich im Text?
Eine iterative Erzählung liegt vor, wenn einmal erzählt wird, was sich mehrmals ereignet hat. Ein Beispiel dafür sind die Cafébesuche von Pilz mit Schlegel und Madame de Staël, bei denen es heißt: "Man traf sich noch einige Male im Café Greco."
Welche Schlussfolgerungen werden in Bezug auf den Text gezogen?
Der Text "1956 - ein Pilzjahr" stellt eine Ausnahme unter den Erzähltexten dar, da er nur wenige erzähltexttypische Elemente verwendet. Es gibt wenig Dialog, viele Pausen, und Fußnoten, was die erzähltheoretische Analyse erschwert.
Welche Literatur wird in der Analyse verwendet?
Es werden folgende Werke zitiert: - Hildesheimer, Wolfgang: Lieblose Legenden (1952). Frankfurt: 1962. - Martinez, Matias/ Scheffel, Michael: Einführung in die Erzählanalyse. 3. Auflage. München: C.H. Beck 2002.
- Citar trabajo
- Katrin Reichwein (Autor), 2003, Analyse der Zeitstruktur in Wolfgang Hildesheimers: 1956 - ein Pilzjahr, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107462