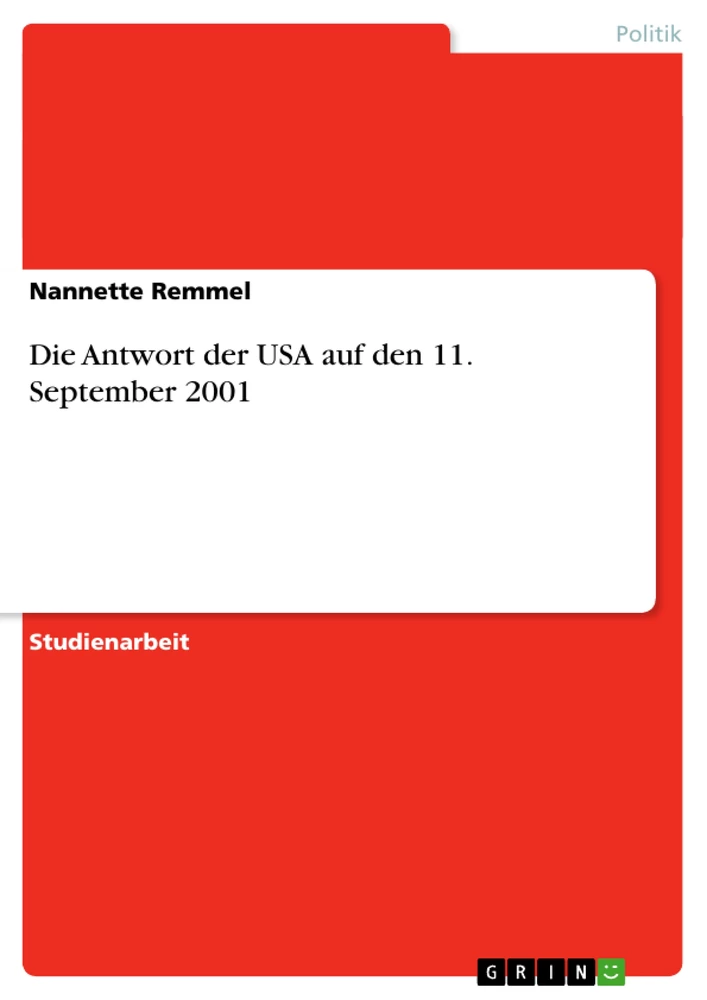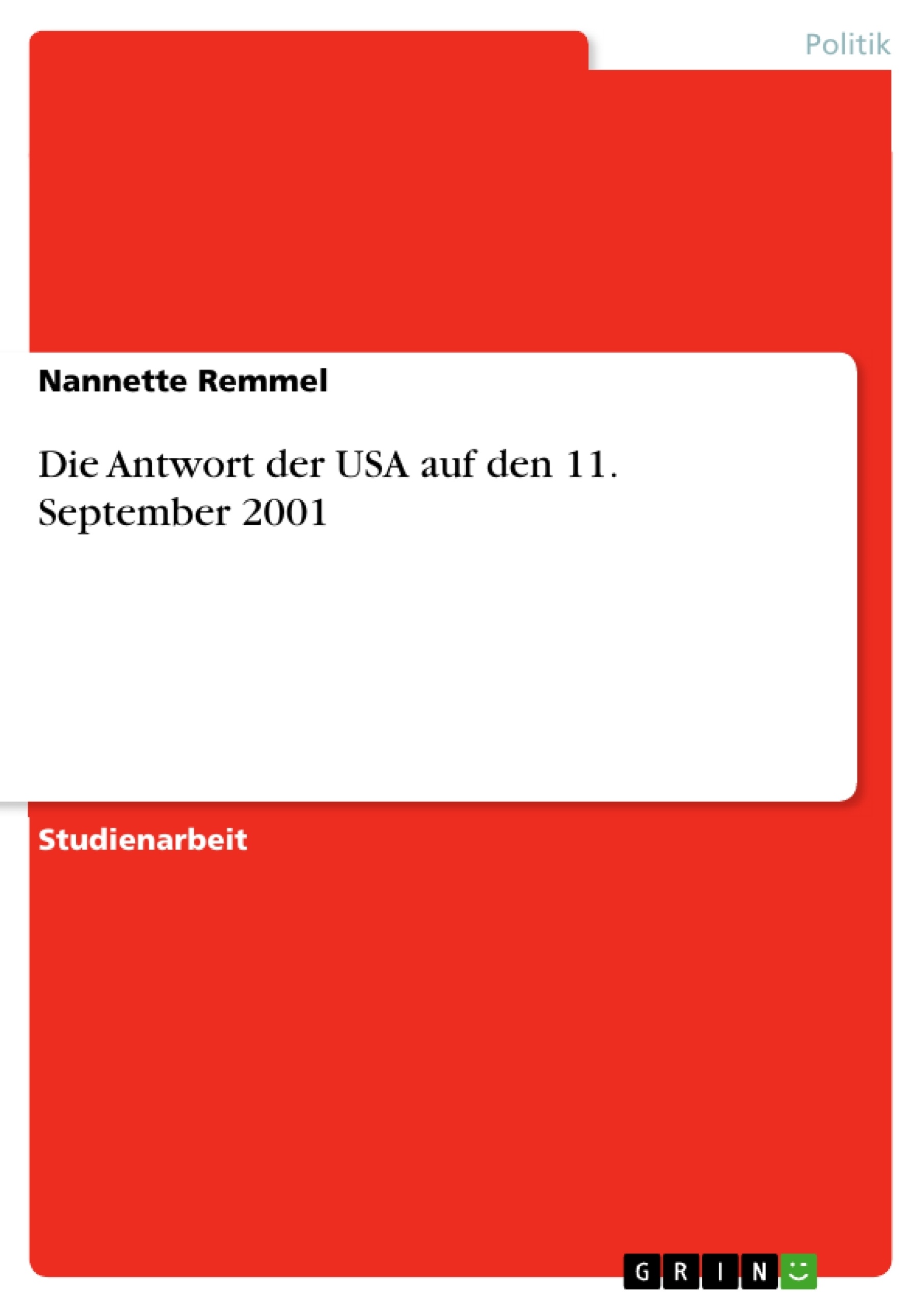„Die Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und das Pentagon bei Washington haben für immer den Blick der USA auf sich selbst und die Welt verändert.“1 Quasi über Nacht erlangt der internationale Terrorismus eine größere Dimension als je zuvor. Die inneramerikanische Bedrohung dominiert die amerikanische Sicherheitspolitik und wird sie auch noch für einige Zeit beherrschen. Innerhalb von nur zwei Tagen reduziert die USA das hochkomplexe Ereignis auf drei Säulen:
„Osama Bin Laden und seine Organisation „Al Quaida“ haben die Anschläge ausgeführt. Ihre Basis liegt in Afghanistan und muss in einem Krieg beseitigt werden. Der Krieg muss sich danach auch auf andere Länder erstrecken, die Terroristen einen Hafen bieten.“2
Innenpolitische Themen wie Bildungsreform und Steuersenkungen traten nach den Anschlägen eindeutig in den Hintergrund. Die politische Agenda wird ab diesem Zeitpunkt durch das neue organisatorische Prinzip der US-amerikanischen (Außen)Politik, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus und die Landesverteidigung, gestellt.3
Die US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik definiert Terrorismus aber nicht als transnational, sondern als international. Die Bedrohung, die von einem gesellschaftlichen Akteur ohne herkömmliche Massenvernichtungswaffen ausging4, wird so auf Staaten übertragen, die den Terrorismus unterstützen. Man versucht, den Terrorismus greifbar zu machen, um ihn mit den Mitteln der Staatenwelt bekämpfen zu können. Der Krieg gegen sogenannte Schurkenstaaten, die Terroristen Unterschlupf gewähren oder sie mit atomaren, chemischen oder biologischen Waffen versorgen (könnten), ist das Ergebnis dieses Außenpolitikverständnisses.5
Es liegt aber im Wesen des Terrorismus, dass er nicht in großen organisierten Formationen auftritt, die sich mit Krieg eliminieren lassen, sondern in kleinen Gruppen und über viele Länder verteilt.6 Dem internationalen Terrorismus ist mit dem traditionellen Mittel der Staatenwelt, nämlich Krieg, nicht beizukommen.
„Eine absolut zuverlässige Sicherheitsstrategie könnte es (...) in einer offenen Gesellschaft nur durch deren Abschaffung geben. Beim Thema Terrorismus drängt sich der Vergleich mit der Bekämpfung der Malaria auf. (...) Malaria bekämpft man nicht, indem man Fliegengitter vor die Fenster hängt oder ein paar lästige Mücken erschlägt. Man muss vielmehr Massenimpfungen vornehmen und vor allem Sümpfe der Brutstätten trockenlegen.“ 7
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neorealismus von Kenneth Waltz
- Struktur des internationalen Systems
- Internationale Anarchie und Selbsthilfe
- Balance-of-Power
- Die neue Bedrohung und die Antwort der USA
- Sicherheitsbegriff
- "Verstaatlichung" des Terrorismus
- Sicherheit durch erweiterte Fähigkeiten
- Krieg gegen Afghanistan im Ad-hoc Bündnis mit Großbritannien
- Bestätigung der Ergebnisse: Die neue Nationale Sicherheitsdoktrin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Reaktion der USA auf die Terroranschläge vom 11. September 2001. Sie argumentiert, dass die USA bei ihrer Interpretation der Anschläge und ihrer Reaktion darauf weiterhin an den traditionellen Bedeutungsstrukturen der Staatenwelt orientiert sind und sogar verstärkt eine neorealistische Außenpolitik betreiben. Die Arbeit beleuchtet, wie die USA die Gefahr des Terrorismus im Kontext der Staatenwelt interpretiert und mit neorealistischen Strategien und Mitteln darauf reagiert.
- Der Neorealismus von Kenneth Waltz und seine zentralen Elemente
- Die US-amerikanische Interpretation des internationalen Terrorismus als Bedrohung
- Die Reaktion der USA auf die Bedrohung durch den Terrorismus mit neorealistischen Maßnahmen
- Die Kritik an der neorealistischen Sichtweise und der Notwendigkeit einer angepassten Sicherheitsstrategie
- Die US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik im Kontext der internationalen Anarchie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Hintergrund der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung der Terroranschläge vom 11. September 2001 für die US-amerikanische Sicherheitspolitik. Sie zeigt, wie die USA die Anschläge interpretiert und welche Folgen sie für die politische Agenda hatten.
- Neorealismus von Kenneth Waltz: Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Elemente der neorealistischen Theorie von Kenneth Waltz und erläutert zentrale Begriffe wie die Struktur des internationalen Systems, internationale Anarchie und Selbsthilfe. Der Neorealismus wird als theoretischer Rahmen für die Analyse der US-amerikanischen Reaktion auf die Terroranschläge eingeführt.
- Die neue Bedrohung und die Antwort der USA: Dieses Kapitel analysiert die US-amerikanische Sicht auf die Bedrohung durch den Terrorismus. Es untersucht, wie die USA den Terrorismus in den Begriffen der Staatenwelt begreift und mit welchen Maßnahmen sie darauf reagiert. Dabei werden der Sicherheitsbegriff, die "Verstaatlichung" des Terrorismus, die Erweiterung der Fähigkeiten und der Krieg gegen Afghanistan im Kontext des Neorealismus betrachtet.
- Bestätigung der Ergebnisse: Die neue Nationale Sicherheitsdoktrin: Dieses Kapitel analysiert die neue Nationale Sicherheitsdoktrin der USA, die als Bestätigung der neorealistischen Interpretation des internationalen Terrorismus betrachtet wird. Die Doktrin spiegelt die US-amerikanische Reaktion auf die Bedrohung durch den Terrorismus wider und verdeutlicht die Kontinuität der neorealistischen Denkweise.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die diese Arbeit prägen, sind: Neorealismus, Internationale Beziehungen, Terrorismus, Sicherheitspolitik, USA, Afghanistan, Nationale Sicherheitsdoktrin, Anarchie, Selbsthilfe, Staatenwelt, Krieg, Balance-of-Power, Sicherheitsbegriff.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierten die USA auf die Anschläge vom 11. September?
Die USA definierten den Kampf gegen den internationalen Terrorismus als neues zentrales Prinzip ihrer Außenpolitik und reagierten mit militärischer Intervention, insbesondere dem Krieg in Afghanistan.
Was bedeutet die „Verstaatlichung“ des Terrorismus?
Da Terrorismus ein transnationales Phänomen ist, übertrugen die USA die Bedrohung auf Staaten (sog. Schurkenstaaten), die Terroristen Unterschlupf gewähren, um ihn mit traditionellen militärischen Mitteln bekämpfbar zu machen.
Was ist der neorealistische Ansatz nach Kenneth Waltz?
Der Neorealismus geht davon aus, dass Staaten in einem anarchischen internationalen System nach Sicherheit und Selbsterhalt streben, wobei Machtbalance und militärische Stärke entscheidend sind.
Warum ist Krieg ein problematisches Mittel gegen Terrorismus?
Terrorismus agiert in kleinen, dezentralen Gruppen und nicht in organisierten Formationen. Kritiker vergleichen die Bekämpfung eher mit dem Trockenlegen von Brutstätten als mit herkömmlicher Kriegsführung.
Was besagt die neue Nationale Sicherheitsdoktrin der USA?
Sie bestätigt die neorealistische Ausrichtung, indem sie auf erweiterte militärische Fähigkeiten und Präventivschläge setzt, um die nationale Sicherheit in einer instabilen Welt zu garantieren.
- Citation du texte
- Nannette Remmel (Auteur), 2003, Die Antwort der USA auf den 11. September 2001, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10749