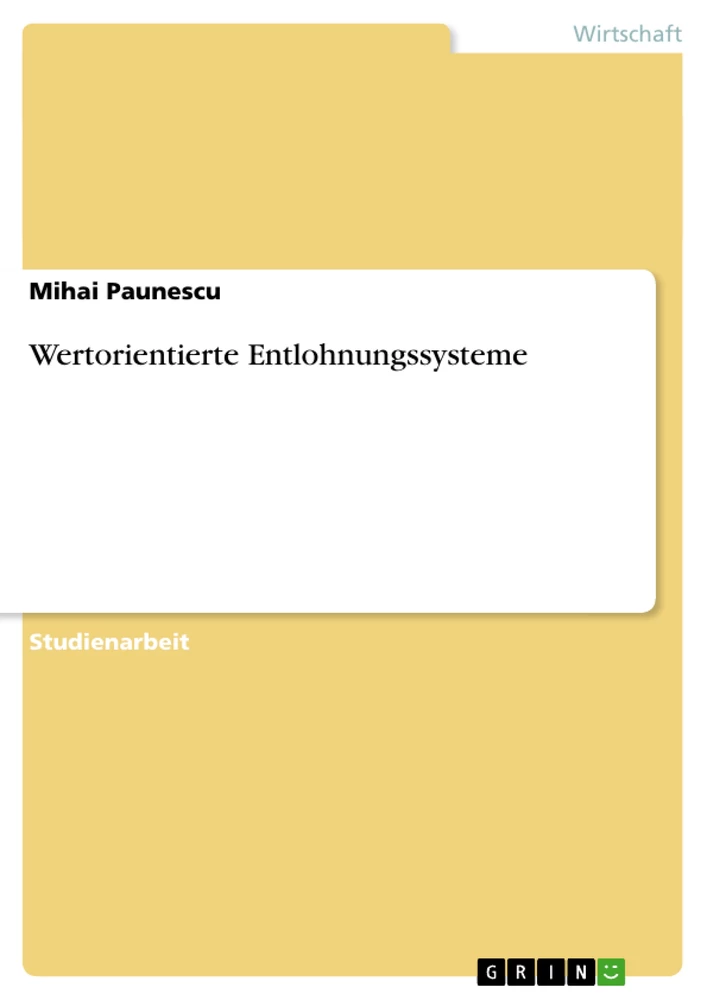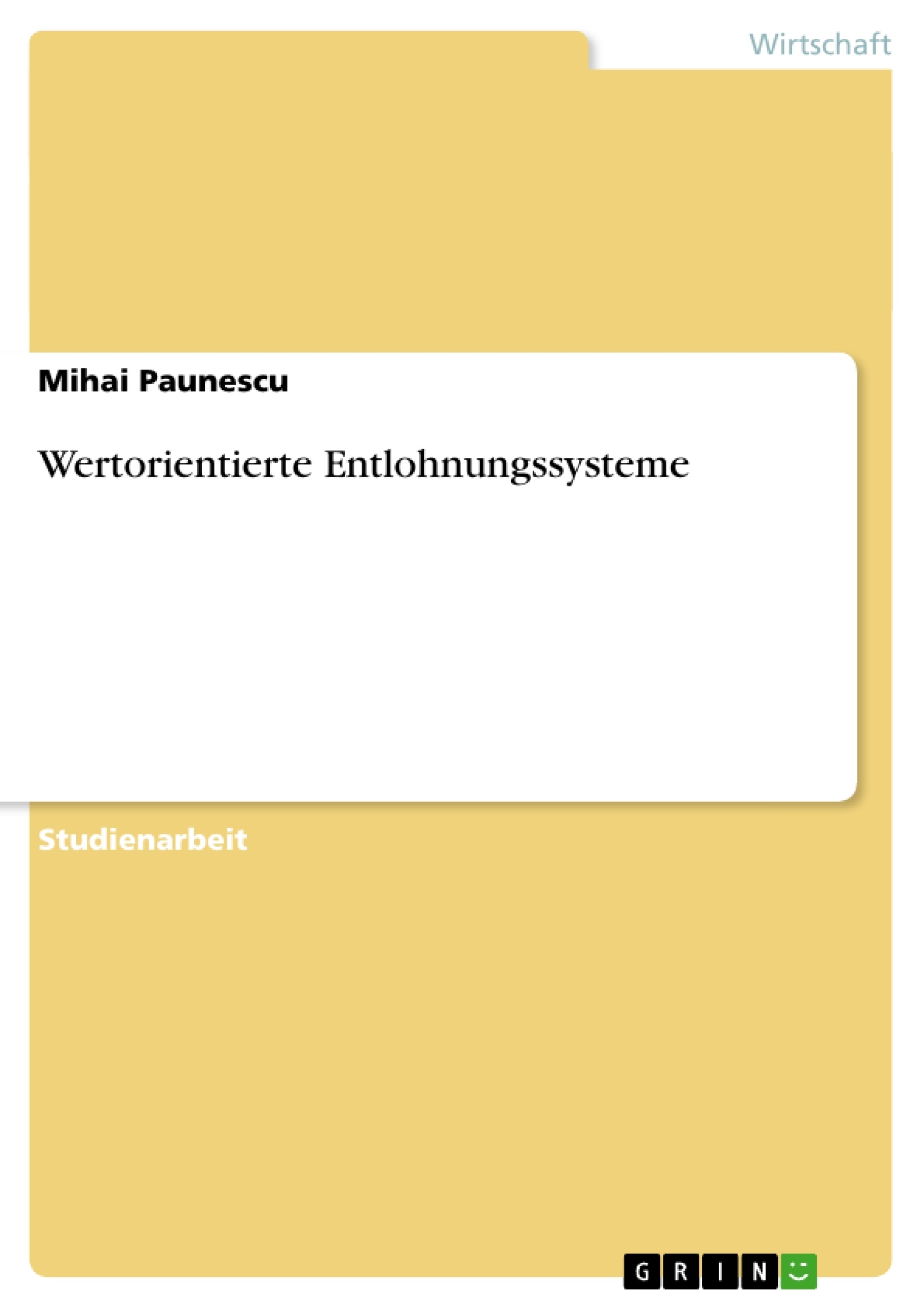Inhaltsverzeichnis
III. Abkürzungsverzeichnis
IV. Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung
2 Aufbau eines wertorientierten Entlohnungssystems
2.1 Beteiligungsbasis
2.2 Beteiligungsfrequenz
2.3 Globalund Individualquote
2.4 Anteilsverwendung
3 Beteiligungsbasis
3.1 Finanzielle, operative Erfolgsfaktoren
3.2 Marktindizes
3.3 Ökonomische Werte
3.3.1 Economic Value Added (EVA)
3.3.2 Discounted Cash Flow (DCF)
3.3.3 Cash Flow Return of Investment (CFROI)
4 Anteilsverwendung
4.1 Investition ins Eigenkapital
4.1.1 Belegschaftsaktien (Restricted Stock)
4.1.2 Aktienoptionen (Stock Options)
4.1.3 Genussscheine
4.1.4 Virtuelle Aktien (Shares of Phantom Stock) /Virtuelle Optionen (Stock Appreciation Rights)
4.2 Investition ins Fremdkapital
4.2.1 Mitarbeiterdarlehen / Schuldverschreibung
4.2.2 Stille Beteiligung
4.3 Externe Verwendung
5 Schlussbemerkung
V. Quellenverzeichnis
VI. Elektronisches Quellenverzeichnis
III Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieserLeseprobenichtenthalten
IV. Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 : Implementierung der wertorientierten Unternehmensführung ( aus: Pellens/ Crasselt/ Rockholtz 1998, 4)
Abbildung 2 : Arten der Erfolgsbeteiligung (aus: H. J. Schneider 1997, 235)
Abbildung 3 : Berechnung des EVA ; Eigene Abbildung in Anlehnung an ( Greth 1998, 77ff. ; Ehrbar 1998, 27)
Abbildung 4 : Berechnung des Discounted Cash Flow nach dem angepassten Barwert Ansatz; Eigene Abbildung in Anlehnung an (Ballwieser 1998, 91)
Abbildung 5 : Berechnung des Cash - Flow - Return on Investment; Eigene Abbildung in Anlehnung an (Lewis 1994, 45; Krumnow / www.gabler.de)
1 Einleitung
Seit Beginn der neunziger Jahre fordern immer mehr Kapitalanleger von ihren Unternehmen eine wertorientierte Unternehmensführung. Nach dem Shareholder Value Prinzip, sollte sich die Unternehmensführung stärker an den Ansprüchen der Anteilseigner orientieren. Um das Ziel, den Wert des Unternehmens zu steigern und die Gewinnausschüttungen zu maximieren, zu erreichen, entwickelte man entsprechende Planund Kontrollinstrumente.
Folglich erwuchs auch die Notwendigkeit, die Vergütung des Managements bzw. aller Mitarbeiter an dem Wert des Unternehmens zu orientieren. Als Ergebnis dieser Entwicklung sollen die wertorientierten Entlohnungssysteme in dieser Arbeit näher untersucht werden.
Abbildung in dieserLeseprobenichtenthalten
Abbildung 1 - Implementierung der wertorientierten Unternehmensführung (Pellens/ Crasselt/ Rockholtz 1998, 4)
In dieser Seminararbeit soll ein Überblick über den Aufbau solcher Systeme gegeben werden. Dabei wird zum einen auf die Struktur solcher Systems eingegangen, und zum anderen auf die einzelnen Gestaltungsoptionen der einzelnen Strukturkomponenten.
Bei der Struktur liegt der Schwerpunkt auf den Bezugsgrößen und auf der Anteilsverwendung, weil diese beiden die am stärksten erfolgsbestimmenden Komponenten sind.
Die einzelnen Gestaltungsoptionen werden dann auf ihre Vorteile und Nachteile hinsichtlich der Wertorientierung, Transparenz, Beeinflussbarkeit durch die Mitarbeiter oder Führungsebenen, die Wirtschaftlichkeit und weitere Faktoren untersucht.
2 Aufbau eines wertorientierten Entlohnungssystems
Ein eindimensionales wertorientiertes System wird durch folgende Komponenten beschrieben.
Die Beteiligungsbasis, die beschreibt woran die Mitarbeiter im Unternehmen beteiligt werden. Die Beteiligungsfrequenz, die Aussagen darüber fällt, wie oft die Mitarbeiter beteiligt werden. Die Globalquote, welche die Höhe der Beteiligung für alle Mitarbeiter, die daran teilnehmen bestimmt. Die Individualquote, die den Gesamtbetrag der Beteiligung auf die einzelnen Mitarbeiter individuell verteilt. Und als letztes die Anteilsverwendung, die Aussagen über die Ausschüttungsform der Mitarbeiterbeteiligung macht (Aschermann 1998, 88f.).
In den folgenden Ausführungen wird auf die einzelnen Komponenten näher eingegangen.
2.1 Beteiligungsbasis
Die Beteiligungsbasis ist jene Bezugsgröße, von deren Höhe bzw. Entwicklung die Erfolgsbeteiligung abhängt (vgl. Becker 1991, 581).
Zu den am häufigsten verwendeten Bezugsgrößen gehören Größen aus dem Rechnungswesen. Weitere Größen können auf Marktindizes oder auf ökonomischen Werten beruhen. Als eine der wichtigsten Komponenten wird diese schwerpunktmäßig unter Kapitel 3 behandelt.
2.2 Beteiligungsfrequenz
Die Beteiligungsfrequenz legt die Dauer der Beurteilungsperiode und damit auch den Rhythmus der Beteiligungsfrequenz fest. Die Auswahl der Beteiligungsfrequenz wird im hohen Maße bereits durch die Wahl der Beteiligungsbasis bestimmt. Grundsätzlich unterscheidet man aber zwischen einperiodischen, mehrperiodischen und aperiodischen Beteiligungsfrequenzen.
Die einperiodischen Frequenzen beziehen sich meistens auf die letzte Jahresperiode. Positiv bei dieser kurzen Periode ist, dass eine Aktualisierung der Beteiligungsbasis zu einer hohen Flexibilität führt, und durch die kurze Zeit zwischen Handlung und Belohnung zu einer hohen Transparenz und einer stärkeren Motivationswirkung führt.
Bei den mehrjährigen Perioden, wird eine stärkere Bindung des Arbeitnehmers an das Unternehmen gewährleistet. Diese harmonieren besser mit den langfristigen Zielen des Unternehmens.
Bei der aperiodischen Beteiligungsfrequenz wird die Beteiligungsperiode durch die Erfolgserzielung determiniert. (Aschermann 1998, 106ff.)
2.3 Global und Individualquote
Bei der Globalquote geht es um die Frage, welcher Anteil am Unternehmensgewinn an den Mitarbeiter ausgeschüttet werden soll. Insgesamt kann man festhalten, dass es keinen allgemeingültiger Verteilungsschlüssel gibt. Grundsätzlich sollten aber folgende Aspekte beachtet werden:
- Die Höhe der Ausschüttung darf den Fortbestand sowie die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht gefährden.
- Die Höhe des Leistungsanreizes muss für die Mitarbeiter spürbar sein. Als Faustregel gelten mindestens 5% des Jahresgehaltes (Boehm-Kochanski 1996, 128).
- Der zur erzielende Gesamtbetrag sollte unbestimmt bleiben, um eine höhere Motivationswirkung zu erreichen (Kappel / Uschatz 1992, 102f.).
Die Individualquote beschreibt das Verfahren zur Ermittlung des Anteils jedes Mitarbeiters an der Globalquote. Man unterscheidet im Allgemeinen folgende drei Prinzipien:
Das Gleichheitsprinzip – Bei der Verteilung nach diesem Prinzip entfällt auf jeden Mitarbeiter der gleiche absolute Betrag.
Das Sozialprinzip – Die Verteilung erfolgt in diesen Fall nach sozialen Daten, wie z.B. Alter, Betriebszugehörigkeit, Fehlzeiten (Vgl. Berthel / Becker 1984, 390).
Das Leistungsprinzip – Nach dem Leistungsprinzip soll jeder Mitarbeiter seinen Anteil durch seine Leistung beeinflussen können.
2.4 Anteilsverwendung
Bei der Anteilsverwendung geht es darum, wie die durch die Globalund Individualquote errechneten Anteile anzulegen sind. Man unterscheidet eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten. Hier erfolgt die Unterteilung nach internen Investitionsmöglichkeiten, bei denen die Gelder im Unternehmen verbleiben und externen Möglichkeiten, bei denen die Auszahlungen das Unternehmen verlassen. Diese Komponente bildet den zweiten Schwerpunkt der Arbeit und wird in Kapitel 4 näher erläutert.
3 Beteiligungsbasis
Im Folgenden werden die wichtigsten Bezugsgrößen erklärt und die Vorteile und Nachteile benannt. Die wichtigsten Bezugsgrößen aus dem Rechnungswesen beziehen sich auf den Ertrag, auf den Gewinn und auf Leistung. Von den ökonomischen Werten sind die wichtigsten das Economic Value Added (EVA), der Discounted Cash Flow (DCF) und der Cash Flow Return of Investment (CFROI).
3.1 Finanzielle, operative Erfolgsfaktoren
Die Erfolgsbeteiligung nach finanziellen und operativen Erfolgsfaktoren wird in der Literatur wie folgt unterteilt:
Abbildung in dieserLeseprobenichtenthalten
Abbildung 2 - Arten der Erfolgsbeteiligung (H. J. Schneider 1997, 235)
Bei der Ertragsbeteiligung werden die Mitarbeiter an Steigerungen oder an der Erreichung von Zielvorgaben des Umsatzes, der Wertschöpfungen oder des Nettoertrags beteiligt:
Umsatzbeteiligung: Der bereinigte Bruttoertrag wird in diesen Fall als Bezugsgröße verwendet.
Wertschöpfung: Hier wird vom bereinigten Umsatz noch die Aufwendungen für die betriebliche Leistungserstellung abgezogen.
Nettoertragsbeteiligung: Die Bezugsgröße wird aus dem Bruttorertrag minus Aufwendungen für Fremdleistungen, Steuern und kalkulatorische Kosten errechnet.
Auf der einen Seite bietet die Ertragsbeteiligung große Transparenz und Einfachheit. Auf der anderen Seite wird aber bei dieser Beteiligung die wirtschaftliche Situation nicht mitberücksichtigt (Vgl. Klötzl / Schneider 1989, 501ff.).
Bei der Gewinnbeteiligung wird der Ausschüttungsbetrag an der Entwicklung des Gewinns gekoppelt:
Bei der Ausschüttungsgewinnbeteiligung, kann der Dividendensatz oder die Dividendensumme als Maßstab für die Ausschüttung gelten.
Bei der Substanzgewinnbeteiligung wird die Globalquote nach dem gleichen Prinzip ermittelt wie die Höhe des einbehaltenen Gewinns, z.B. für Rücklagen.
Bei der Bilanzgewinnbeteiligung werden die Ausschüttungen in Abhängigkeit von der Entwicklung des Bilanzgewinns ermittelt.
Die Gewinnbeteiligung ist die am häufigsten verwendete Art der Erfolgsbeteiligung. Sie bietet nicht nur eine hohe Transparenz, sondern passt sich durch die Orientierung am Gewinn der wirtschaftlichen Situation an (vgl. Schneider / Zander 1990, 60).
Die Leistungsbeteiligung macht den Ausschüttungsbetrag von Effizienzsteigerungen abhängig, die durch eine höhere Produktionsmenge, eine höhere Produktivität oder Kostenersparnisse erreicht werden.
Die Produktionsbeteiligung nimmt ein Überschreiten einer Normalleistung als Bezugsgröße.
Die Produktivitätsbeteiligung basiert auf der Arbeitsproduktivität der Beschäftigten. Sie wird durch den Koeffizienten, aus den hergestellten, verkaufsfähigen Einheiten in einer bestimmten Zeit durch die täglich geleisteten Arbeitsstunden, ausgedrückt.
Bei der Kostenersparnisbeteiligung wird die Basis aufgrund der Senkung der Kosten von den Produktionsmaterialien, des Absinken der durchschnittlichen Fehlzeiten und der Erhöhung der Flexibilität der Arbeiter errechnet. (vgl. http://www.flexibleunternehmen.com)
Der Vorteil der Leistungsbeteiligung liegt in der stärkeren Motivationswirkung. Die Mitarbeiter können die Produktivität oder die Kostenersparnisse viel stärker, direkter beeinflussen, als den Umsatz oder den Gewinn des Unternehmens.
3.2 Marktindizes
Marktindexierte Mitarbeiterbeteiligungen nehmen als Bezugsgröße den Börsenkurs / die Dividende des Unternehmens und beabsichtigen dadurch eine Beteiligung der Mitarbeiter am Marktwert des Unternehmens. Man erhofft sich dadurch von den Mitarbeitern eine Änderung ihres Verhaltens dahingehend, dass sie zukünftig stärker zum Wertzuwachs des Unternehmens beitragen und dadurch das Principle Agent Problem gemildert wird (vgl. Becker 1990, 32).
Dieser Ansatz schränkt das Beteiligungssystem auf börsennotierte Unternehmen ein. Als vorteilhaft zeigt es sich bei einem marktindexierten Beteiligungssystem, dass die
Börse nicht nur die aktuelle Ertragslage bewertet, sondern auch die zukünftigen Erfolgserwartungen des Unternehmens. Daher eignet sich dieses Beteiligungssystem für eine längerfristige Strategie.
Das Problem beim Börsenkurs liegt aber in der Undurchschaubarkeit und Komplexität der Kursentwicklung. Zwar ist das Ergebnis transparent, aber die Kursentwicklung beinhaltet nicht nur den Erfolg des Unternehmens, sondern wird auch durch andere Faktoren beeinflusst. Hier ließen sich weltpolitische Lage, konjunkturelle Schwankungen, die wirtschaftlichen und politischen Erwartungen, das allgemeine Zinsniveau oder bestimmte Börsentrends nennen.
Um dem entgegenzuwirken ist es notwendig eine Indexierung vorzunehmen, d.h. dass man den Börsenkurs des Unternehmens immer im Bezug zu einem entsprechenden Branchenindex setzt. Nur dadurch lassen sich so genannte „windfall profits“ oder „windfall losses“ vermeiden. (vgl. Pellens/ Crasselt/ Rockholtz 1998, 17)
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die ein Inhaltsverzeichnis, Ziele, Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält. Es behandelt den Aufbau eines wertorientierten Entlohnungssystems, verschiedene Beteiligungsbasen (finanzielle, operative Erfolgsfaktoren, Marktindizes, ökonomische Werte wie EVA, DCF, CFROI) sowie die Anteilsverwendung (Investition ins Eigenkapital, Fremdkapital, externe Verwendung).
Welche Beteiligungsbasen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt finanzielle und operative Erfolgsfaktoren (Ertrags-, Gewinn-, Leistungsbeteiligung), Marktindizes und ökonomische Werte. Zu den ökonomischen Werten gehören Economic Value Added (EVA), Discounted Cash Flow (DCF) und Cash Flow Return of Investment (CFROI).
Welche Arten der Anteilsverwendung werden diskutiert?
Das Dokument behandelt die Investition ins Eigenkapital (Belegschaftsaktien, Aktienoptionen, Genussscheine, Virtuelle Aktien/Optionen), die Investition ins Fremdkapital (Mitarbeiterdarlehen/Schuldverschreibung, stille Beteiligung) und die externe Verwendung.
Was sind die Komponenten eines wertorientierten Entlohnungssystems?
Ein wertorientiertes Entlohnungssystem besteht aus der Beteiligungsbasis, der Beteiligungsfrequenz, der Globalquote, der Individualquote und der Anteilsverwendung.
Was ist die Beteiligungsbasis?
Die Beteiligungsbasis ist die Bezugsgröße, von deren Höhe bzw. Entwicklung die Erfolgsbeteiligung abhängt.
Was ist die Beteiligungsfrequenz?
Die Beteiligungsfrequenz legt die Dauer der Beurteilungsperiode und damit auch den Rhythmus der Beteiligung fest.
Was ist die Globalquote?
Die Globalquote bestimmt die Höhe der Beteiligung für alle Mitarbeiter, die daran teilnehmen.
Was ist die Individualquote?
Die Individualquote verteilt den Gesamtbetrag der Beteiligung auf die einzelnen Mitarbeiter individuell.
Was ist die Anteilsverwendung?
Die Anteilsverwendung legt die Ausschüttungsform der Mitarbeiterbeteiligung fest.
Welche verschiedenen Arten der Erfolgsbeteiligung werden im Zusammenhang mit finanziellen und operativen Erfolgsfaktoren genannt?
Es werden Ertragsbeteiligung (Umsatz-, Wertschöpfungs-, Nettoertragsbeteiligung), Gewinnbeteiligung (Ausschüttungsgewinn-, Substanzgewinn-, Bilanzgewinnbeteiligung) und Leistungsbeteiligung (Produktions-, Produktivitäts-, Kostenersparnisbeteiligung) genannt.
Welche Vor- und Nachteile hat die Erfolgsbeteiligung nach Marktindizes?
Vorteilhaft ist, dass die Börse nicht nur die aktuelle Ertragslage, sondern auch zukünftige Erfolgserwartungen bewertet. Problem ist die Undurchschaubarkeit und Komplexität der Kursentwicklung, die nicht nur den Unternehmenserfolg widerspiegelt.
Was ist Economic Value Added (EVA)?
Economic Value Added (EVA) ist ein ökonomischer Wert, der zur Messung des Unternehmenswertes verwendet wird.
Was ist Discounted Cash Flow (DCF)?
Discounted Cash Flow (DCF) ist eine Methode zur Bewertung von Investitionen, bei der die erwarteten zukünftigen Cashflows auf ihren Barwert abgezinst werden.
Was ist Cash Flow Return of Investment (CFROI)?
Cash Flow Return of Investment (CFROI) ist eine Kennzahl, die die Rentabilität einer Investition auf Basis der Cashflows misst.
- Citation du texte
- Mihai Paunescu (Auteur), 2001, Wertorientierte Entlohnungssysteme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107505