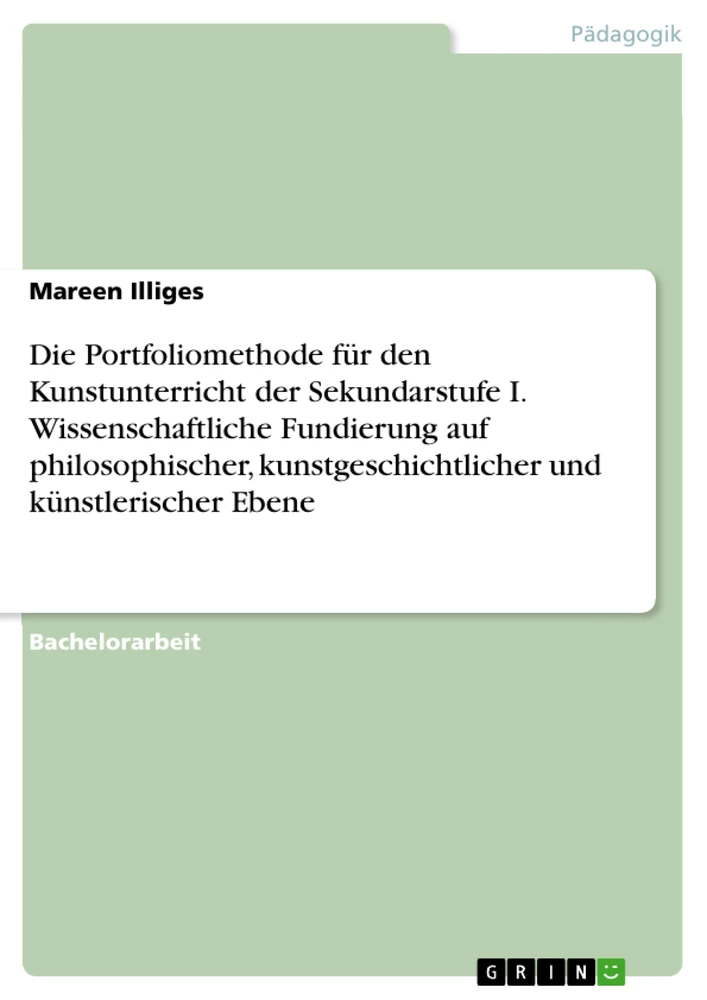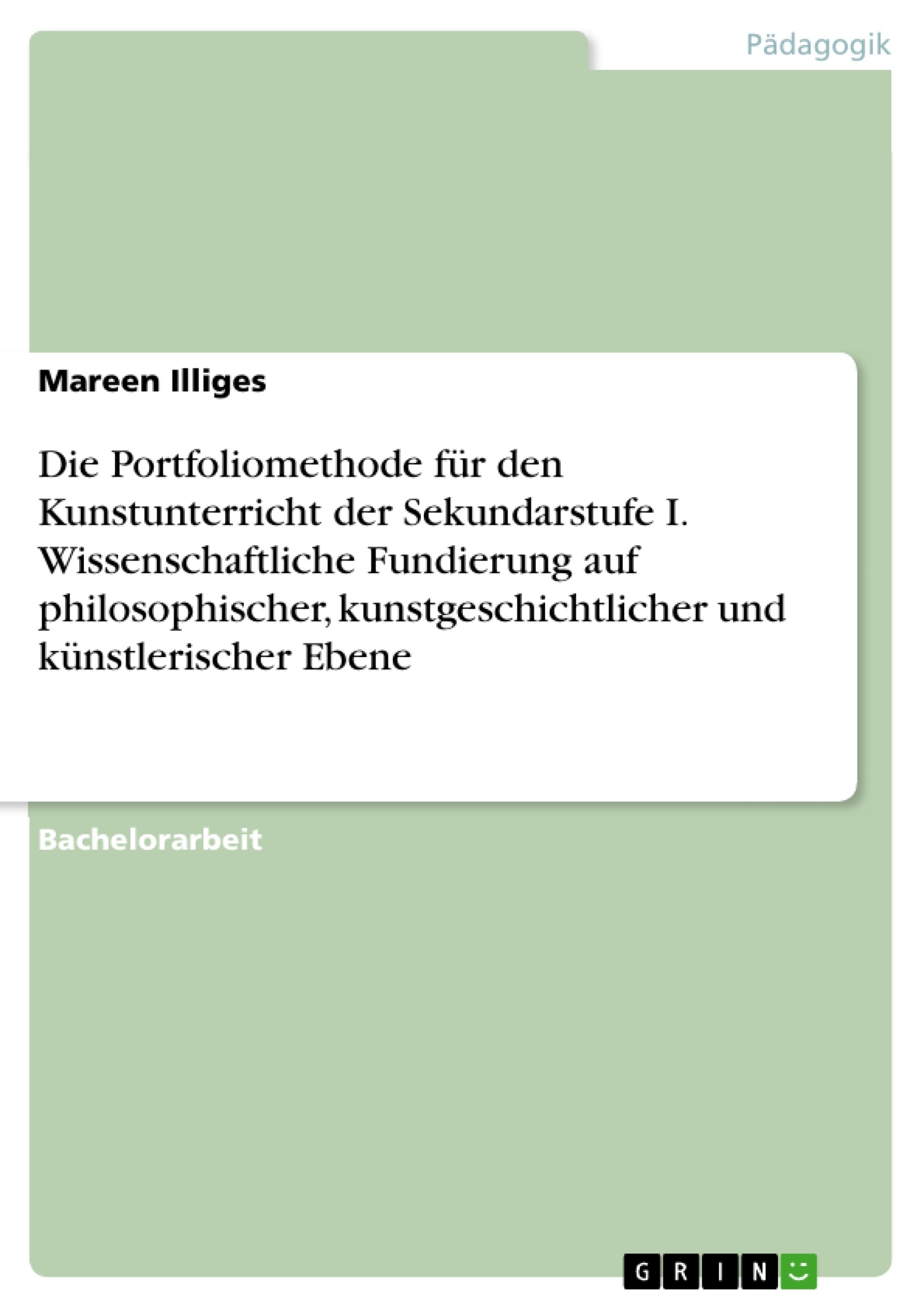Die Arbeit beschäftigt sich mit der wissenschaftlichen Fundierung der Portfoliomethode für den Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Obwohl die Portfoliomethode Einzug in die Schule im Rahmen der Schreibdidaktik fand und heutzutage vermehrt in linguistischen Fächern zum Einsatz kommt, hat das Prinzip des Portfolios, losgekoppelt von der didaktischen Komponente, seinen Ursprung im künstlerischen Bereich. In der Renaissance bewarben sich Künstler mit Portfolios für Aufträge.
Gerade im Kunstunterricht eignet sich die Methode, denn sie kann mit dem Portfolio als Medium praktische Arbeitsprozesse mit der theoretischen Auseinandersetzung von Inhalten des Unterrichtsgegenstandes vereinen. Da Anknüpfungspunkte des Portfolios in der Kunstgeschichte liegen, ist es besonders spannend zu schauen, welches Potential in der Portfolioarbeit gezielt für den Kunstunterricht steckt. Ebenso groß ist das Interesse zu untersuchen, welche weiteren wissenschaftlichen Verankerungen sich herausstellen lassen, um die Portfolioarbeit für den Kunstunterricht zu fundieren.
Folglich sucht die Arbeit Anschluss an Konzepte der Kunstgeschichte, philosophische Erkenntnistheorien und kunstdidaktische Positionen. In einem umfangreichen Lesen wird die Breite des Portfolioeinsatzes für die Schule erschlossen und herausgearbeitet, was neben den Motivationen auch für Herausforderungen bei der Implementierung der Methode für den Kunstunterricht entstehen. Vor allem aber wird im Rahmen einer komplexen Analyse ergründet, wie das didaktische Konzept sich wissenschaftlich fundieren lässt. Im Gesamtkonzept der Arbeit ist dabei die Verknüpfung von Alltag, Wissenschaft und Kunst zentral, um die didaktische Wirksamkeit der Methode für den Kunstunterricht umfangreich und kritisch zu beurteilen. Bezüglich des Kunstunterrichts wird hier ein kompetenzorientierter impliziert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Portfolio
- 2.1 Ursprünge
- 2.2 Definition und Portfolioarten
- 2.3 Portfolios im kompetenzorientierten Unterricht – Eine Verortung in der Unterrichtsentwicklung und Lerntheorie
- 2.4 Potentiale der schulischen Portfolioarbeit
- 2.5 Kritische Beleuchtung - Auswirkungen auf die Lehrerrolle
- 3. Curriculare Anforderungen an das Fach Kunst – Einblicke in den Kernlehrplan
- 3.1 Ziele des Kunstunterrichts
- 3.2 Kompetenzbereiche und Inhalte des Faches
- 3.3 Leistungsbewertung
- 3.4 Exkurs: Sprache und Kommunikation im Kunstunterricht und der Portfolioarbeit – Busses methodisches Skript des Mitteilens
- 4. Philosophische Fundierung der schulischen Portfolioarbeit
- 4.1 Konstruktivismus
- 4.2 Die Bedeutung von Reflexion in erkenntnistheoretischen Ansätzen
- 5. Kunstgeschichtliche und künstlerische Fundierung der schulischen Portfolioarbeit
- 5.1 Skizzenbuchgeschichte(n) – Das Portfolio als Skizzenbuch?
- 5.2 Künstlerische Fundierung - Das Buch und der Atlas als Kunstobjekt
- 5.2.1 Künstlerbücher
- 5.2.2 Atlas Warburg und Richter
- 5.2.3 Das schulische Portfolio als Kunstobjekt
- 6. Kunstdidaktische Fundierung der schulischen Portfolioarbeit
- 6.1 Die Otto-Selle-Debatte
- 6.2 Busse - Kunstunterricht zwischen Spielraum und Festlegung
- 6.3 Der Atlas und das Mapping als kunstdidaktische Handlungsapparate
- 6.4 Ästhetische Forschung
- 6.5 Das Portfolio als kunstdidaktisches Instrument
- 7. Exkurs: Bezugsfeld Alltag – Sammeln und ästhetische Biografie
- 7.1 Schülerindividualität bei alltagsästhetischen Erkundungen
- 7.2 Dinge sammeln
- 7.3 Das Portfolio als Sammlung
- 8. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der wissenschaftlichen Fundierung der Portfoliomethode im Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Die Arbeit untersucht die didaktische Wirksamkeit des Portfolios und analysiert seine Anwendbarkeit in einem kompetenzorientierten Unterricht. Die Arbeit strebt an, ein umfassendes Verständnis des Portfolios als didaktisches Instrument zu vermitteln, indem sie verschiedene Wissenschaftsbereiche miteinbezieht und die Relevanz des Portfolios für den Kunstunterricht unterstreicht.
- Das Portfolio als didaktisches Instrument im Kunstunterricht
- Wissenschaftliche Fundierung der Portfoliomethode
- Kompetenzorientierter Unterricht und die Rolle des Portfolios
- Künstlerische, kunstgeschichtliche und philosophische Perspektiven auf das Portfolio
- Der Bezug des Portfolios zum Alltag und die Förderung von Schülerindividualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Portfoliomethode und ihre Bedeutung für den Kunstunterricht vor. Sie beleuchtet den Ursprung des Portfolios, die Verbindung zum analogen Sammeln und Dokumentieren im Alltag und die Entwicklung der Methode in der Schulpraxis.
- Das zweite Kapitel beleuchtet den Begriff des Portfolios und seine Vielschichtigkeit. Es werden Ursprünge, verschiedene Definitionen und Einsatzgebiete aufgezeigt, um das Portfolio im schulischen Kontext einzuordnen.
- Kapitel drei beleuchtet die curricularen Anforderungen des Faches Kunst in der Sekundarstufe I. Es werden die Ziele des Kunstunterrichts, Kompetenzbereiche und Inhalte sowie die Leistungsbewertung näher betrachtet.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit der philosophischen Fundierung der Portfolioarbeit. Der Konstruktivismus und die Bedeutung von Reflexion werden in diesem Kontext beleuchtet.
- Das fünfte Kapitel setzt sich mit der kunstgeschichtlichen und künstlerischen Fundierung der Portfolioarbeit auseinander. Hierbei werden die Verbindung zum Skizzenbuch, der Atlas Warburg und das Portfolio als Kunstobjekt untersucht.
- Kapitel sechs verortet das Portfolio im Bereich der Kunstdidaktik. Verschiedene Ansätze zur Integration des Portfolios im Kunstunterricht werden beleuchtet.
- Der siebte Kapitel beleuchtet den Bezugsfeld Alltag und die Rolle des Sammelns in der ästhetischen Biografie.
Schlüsselwörter
Portfolio, Kunstunterricht, Sekundarstufe I, Kompetenzorientierter Unterricht, Didaktik, Konstruktivismus, Reflexion, Kunstgeschichte, Skizzenbuch, Atlas, Ästhetische Forschung, Sammeln, Alltag, Schülerindividualität.
- Quote paper
- Mareen Illiges (Author), 2021, Die Portfoliomethode für den Kunstunterricht der Sekundarstufe I. Wissenschaftliche Fundierung auf philosophischer, kunstgeschichtlicher und künstlerischer Ebene, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1075125