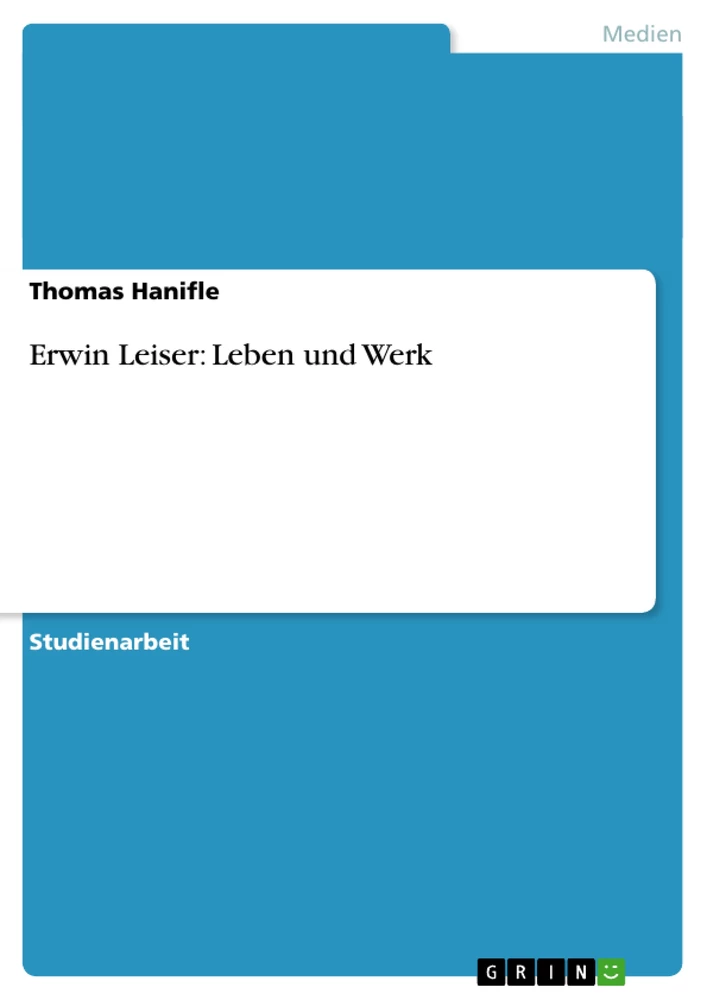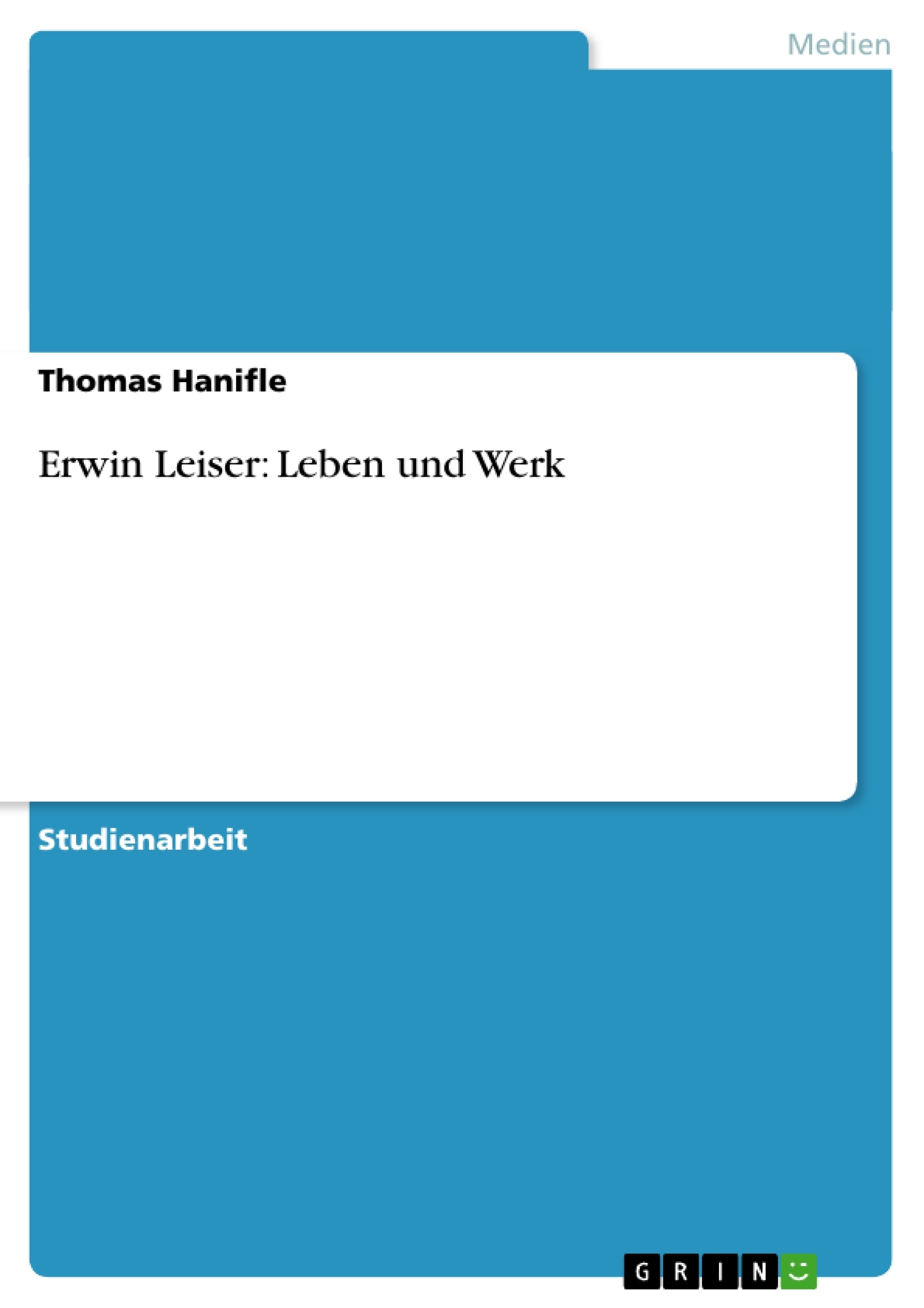Inhaltsverzeichnis
1. EINLEITUNG
2. ERWIN LEISER: EINE KURZE BIOGRAPHIE
2.1 WARUM FILM?
2.2 FILMOGRAPHIE (AUSWAHL)
3. MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES DOKUMENTARFILMS
3.1 DER DOKUMENTARFILM: OBJEKTIVE DARSTELLUNG DER WIRKLICHKEIT?
3.2 DER DOKUMENTARIST: EIN GRENZGÄNGER?
3.3 LEISER, DER DOKUMENTARFILMER
4. „MEIN KAMPF“
4.1 „NACHT UND NEBEL“
4.2 EXKURS: GESCHICHTE IM DOKUMENTARFILM: DER KOMPILATIONSFILM
4.3 DAS STAATLICHE FILMARCHIV DER DDR
4.4 GESTALTUNG UND INHALT
4.5 DIE REAKTIONEN
4.6 DER FILM IM SPIEGEL DER KRITIK
5. „DEUTSCHLAND ERWACHE!“
5.1 EXKURS: PROPAGANDA IM FILM: DIE UFA
5.2 DIE VORBEREITUNGEN
5.3 DER FILM
6. FILME „MIT“ KÜNSTLERN
6.1 AUF DER SUCHE NACH DEM GESICHT DES MENSCHEN
6.2 FILM UND KUNST
6.3 „DIE WELT DES FERNANDO BOTERO“
7. RESÜMEE
8. LITERATURVERZEICHNIS:
1. Einleitung
„Der Aufstieg und der Fall des Hitlersystems, der große Aufmarsch und sein unausbleiblichesEndziel, das Wesen der‚Neuordnung Europas auf rassischer Grundlage‘und die brutale Eintönigkeit des Krieges werden in meinem Film in wesentlichen und typischen Episodengeschildert. Ein vollständiges Bild dieser blutigen Jahre können allerdings weder ein Film nochein Buch geben. Hier galt es, das Gesicht des Menschen zu zeigen, des bekannten und desnamenlosen, des Führers und des Verführten, des Henkers und des Opfers.
(...) Für mich galt es vor allem, alle persönlichen Gefühle auszuschalten und mich dieser Wahrheit unterzuordnen. Deshalb versuchte ich auch, die Aussage des Bildes nicht durchaufdringliche Kommentare und harte Effekte zu schwächen.“1
Dieser Ausschnitt aus dem Buch zum Film „Mein Kampf“ gibt eine kurze Einsicht in das dokumentarische Schaffen Erwin Leisers. Seine große Leistung bestand hier im Vermögen, aus den schier unüberschaubaren Bilderfluten zeitgenössischer Wochenschauen und Spielfilme Ausschnitte so auszuwählen und zusammenzufügen, dass etwas sichtbar wurde, was mehr als die Summe der Einzelteile war. Er vermittelte mit seinen Kompilationen nicht bloß emotionale Betroffenheit, sondern durch die Präzision von Kommentar und Montage eine viel weiter reichende Betroffenheit des Denkens.
In dieser Seminararbeit möchte ich mich dem Lebenswerk Erwin Leisers widmen, der sich wie kein anderer für den Aufstieg des Dokumentarfilms in der Nachkriegszeit verantwortlich zeigte. Seine Arbeit ist deshalb interessant für mich, weil er sich ausgiebig mit dem Thema „Drittes Reich“ beschäftigt hat, das mir im Laufe meines Studiums immer wieder begegnet ist. Leiser, der oft mit seinem wohl bekanntesten Film „Mein Kampf“ in Verbildung gebracht wird, schuf im Laufe seines Lebens eine Vielzahl von dokumentarischen Werken. Mit Hilfe der Darstellung seiner Filme „Mein Kampf“, „Deutschland erwache!“ und „Die Welt des Fernando Botero“ werde ich einerseits versuchen die „Besonderheiten“ und Hintergründe seiner Werke darzustellen. Andererseits möchte ich dabei die Zusammenhänge zwischen seinem Leben und seiner Arbeit darlegen, die ihn bei seiner Themenwahl und Herangehensweise an seine Filme beeinflusst haben. Die Analyse der Filme des Dokumentarfilmers sollen mir außerdem dabei helfen, seine persönliche Handschrift zu erarbeiten. Ein Kapitel wird das Genre Dokumentarfilm und die Stellung Leisers zu dessen Möglichkeiten und Grenzen einnehmen, mit denen sich der Regisseur Zeit seines Lebens befasste. Darüberhinaus möchte ich auch verschiedene Kritiken am Werk und die kommunikative Wirkung seiner Arbeit aufzeigen.
2. Erwin Leiser: eine kurze Biographie
„‘Wer bin ich?‘so betitelte Erwin Leiser, der in der Nacht zum Freitag in Zürich verstorbene Filmemacher und Buchautor, das erste Kapitel seiner 1993 erschienenen Lebenserinnerungen ‚Gott hat kein Kleingeld‘. Und in den ersten zwei Sätzen schon blendet er aus der Gegenwart zurück ins Berlin seiner Kindheit, in jene blühende Stadt, in die hinein er am 16. Mai 1923 geboren worden war. Schicksal?‚Ich glaube nicht an den Zufall‘, ist das zweite Kapitel überschrieben.‚Aber daran, dass die Gegenwart mit dem in Verbindung steht, was war. Was ich bin, hat etwas mit dem zu tun, was ich war.‘Und was Erwin Leiser für sich sagt, meint er auch für die Gesellschaft.“2
Erwin Leiser wurde 1923 in Berlin/Hohenschönhausen geboren. Sein Vater war als Rechtsanwalt tätig, seine Mutter arbeitete für die „Liga der Menschenrechte“. Beide waren jüdischer Herkunft, ihre Familien lebten aber seit Jahrhunderten in Preußen. Von 1932 bis 1938 besuchte er das „Berlinische Gymnasium zum Grauen Kloster“ und erlebte in den Straßen den Terror und die erstarkende Macht der Nazis, bekam mit, wie jüdische Mitschüler und ganze Familien von einem Tag auf den anderen verschwanden.
Leiser war gerade einmal zehn Jahre alt, als Hitler in Deutschland an die Macht kam. Auch Leisers Vater blieb von dieser Tatsache nicht verschont: der einzige jüdische Rechtsanwalt in Hohenschönhausen durfte seine Tätigkeit als Notar nicht mehr ausüben. Er starb 1933 in Folge einer Venenentzündung im Alter von 57 Jahren. Mit seiner Mutter emigrierte Erwin Leiser im November 1938 nach Schweden. Später erinnerte sich der Regisseur:„Auch ich wäre deportiert worden, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, das Dritte Reich noch vor Kriegsanbruch zu verlassen. Ich war zehn Jahre alt, als Hitler Reichskanzler wurde, und erinnere mich noch sehr genau an die allmähliche Steigerung der Maßnahmen gegen die deutschen Juden. Am 10. November 1938, als die Synagogen in ganz Deutschland brannten, als Zehntausende von der Gestapo verhaftet und in Konzentrationslager gebracht wurden, war ich auf einem Dachboden in Berlin versteckt. Wie viele jüdische Kinder hatte ich versucht, mich im Deutschland der dreißiger Jahre seelisch auf den Tod vorzubereiten. Ich wusste, dass Juden im Dritten Reich nicht‚lebensberechtigt‘waren, und rechnete nicht damit, gerettet zu werden.“3
Den Zweiten Weltkrieg erlebte Leiser in Schweden, fühlte sich aber auch dort vor der „nationalsozialistischen Bedrohung“ nicht sicher. Er lernte schwedisch, machte sein Abitur und studierte an der Universität von Lund Deutsch und Literaturgeschichte. 1945 begann er, regelmäßig Artikel in schwedischen Zeitungen und Zeitschriften zu veröffentlichen. Von 1950 an arbeitete er als Feuilletonredakteur beim Regierungsorgan „Morgon Tidningen“ und übersetzte nebenbei deutschsprachige Autorinnen und Autoren, von Nelly Sachs über Bert Brecht bis zu Friedrich Dürrenmatt. 1958 stellte die Zeitung ihr Erscheinen jedoch ein.
2.1 Warum Film?
Wie Leiser selbst sagte, wäre er nie zum Film gegangen, wenn er nicht arbeitslos geworden wäre. Nach Einstellung der „Morgon Tidningen“ nahm er an einer Art Ausbildung beim Schwedischen Fernsehen teil. Dieser zweiwöchige Kurs ermöglichte es ihm, Sendungen für eine geringe Gage zu gestalten. Leiser lernte jedoch sein „neues“ Handwerk als Autodidakt: indem er Filme machte.
Seine Erinnerungen an das „Dritte Reich“ ließen den Publizisten nicht los: er stellte sich in seinen Artikeln immer wieder die Frage, was von der Ideologie und Methoden des Nationalsozialismus übriggeblieben und inwiefern die neue westdeutsche Demokratie effektiv demokratisch war. Außerdem empfand er seine Machtlosigkeit gegenüber einem Geschehen, das er mit seinen Artikeln nicht beeinflussen konnte. Hier entdeckte Leiser die Macht des filmischen Materials. Er trug verschiedene filmische Dokumente zusammen und „schuf“ 1960 eine Geschichte über die Geschichte: „Mein Kampf“ war sein erster und wohl bekanntester Film. Gleichzeitig war es der Beginn einer langen und erfolgreichen Filmkarriere.
1961 zog Erwin Leiser nach Zürich, wo er im gleichen Jahr seinen zweiten Film „Eichmann und das Dritte Reich“ herstellte. Leisers Arbeit beschränkte sich nicht nur mit der filmischen Aufarbeitung der Geschichte „Nazi-Deutschlands“, er gestaltete unter anderem etliche Fernsehportraits mit Künstlern wie Fernando Botero, Edward Kienholz, Hans Falk ... Auch das Thema Holocaust ließ er in sein dokumentarisches Schaffen einfließen.
Von 1966 bis 1969 war Leiser künstlerischer Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin. 1991 verlieh ihm die Humanistische Fakultät der Universität Stockholm die Würde eines Ehrendoktors der Philosophie. Seit 1991 hatte er einen Lehrauftrag an der Universität Konstanz. 1992 ernannte ihn der Senat von Berlin zum Professor ehrenhalber. Er war Direktor der Film- und Medienkunst der Akademie der Künste in Berlin-Brandenburg und Mitglied der Europäischen Filmakademie sowie Erster Vorsitzender des Vereins Freunde der Deutschen Mediathek e.V. 1994 erhielt er die goldenen Ehrenmedaille für kulturelle Verdienste des Kantons Zürich. Am 23. August 1996 verstarb Erwin Leiser im Alter von 73 Jahren in Zürich.
2.2 Filmographie (Auswahl)
1960 „Mein Kampf"; Preise: San Francisco, Berlin, Warschau, Paris + 1961 Eichmann und das Dritte Reich; Filmpreis der Stadt Zürich + 1963 „Wähle das Leben!"; Qualitätsprämie des Schweizer Bundesrates; Preis in Melbourne + 1968 „Deutschland, erwache!" + 1968 Der lange Marsch der NPD + 1972 Keine Welt für Kinder; Preis in Moskau + 1972 Opfer der Gewalt + 1973 „Ich lebe in der Gegenwart" - Versuch über Hans Richter + 1974 Von Bebel bis Brandt - Die Geschichte der SPD + 1975 Weil sie Frauen sind + 1975 Frauen in der Dritten Welt + 1976 Die Welt des Fernando Botero + 1977 Bram van velde et son silence + 1978 Männer im besten Alter + 1978 Die versunkenen Welten des Roman Vishniac + 1979 Willem de Kooning und das Unerwartete; Gran Prix Asolo, Preis in Montreal + 1981 Die Leidenschaften des Isaac Bashevis Singer + 1981 Stille Stellen - Hans Fischli + 1981 Raphael Soyer - New York Painter + 1982 Leben nach dem Überleben + 1983 Vor 50 Jahren war alles dabei + 1984 Die Kunst ist das Leben - De Kooning 1984; Preis Montreal: Beste Regie + 1984 Erde Schatten Stein - Rolf Iseli; Grand Prix Padua + 1984 Liebe und Exil - Isaac Bashecis Singer und New York + 1985 Botero als Bildhauer + 1985 Berenice Abbott - American Photographer + 1985 Hiroshima - Erinnern und Verdrängen + 1985 Die Mitläufer + 1986 James Rosenquist + 1986 Boteros Corrida + 1986 Im Zeichen des Feuers - Elie Wisel + 1987 Licht zwischen den Bäumen - Gunnar Norman + 1987 Welt im Container - Hans Falk + 1987 Hitlers Sonderauftrag Linz + 1988 „Ich habe immer Schutzengel gehabt" - Die ungewöhnliche Film karriere des Lothar Wolff + 1988 Die Feuerprobe - Novemberpogrom 1938 + 1988 Kunstszene Los Angeles + 1990 Das hungrige Auge - Avigdor Arikha + 1991 Wer war Hugo Weber? + 1991 Al Hirschfeld + 1992 1937 - Kunst und Macht + 1992 Werner Weber + 1992 Memories of Harlem I-III + 1993 „Pimpf war jeder" + 1993 Die Ufa - Mythos und Wirklichkeit I-III + 1993 „Ich lebe dieses magische Leben in meinem Atelier" - Jose de Guimaraes + 1994 Ein Schlips steht Kopf - Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen + 1995 Otto John - eine deutsche Geschichte; Preis Leipzig: Egon-Erwin- Kisch-Preis + 1995 Feindbilder + 1995 „Mein ganzes Leben war Kunst" - Ein Film über Otte Sköld + 1996 „Zehn Brüder sind wir gewesen" - Der Weg der Juden in die Ver nichtungslager des NS-Staates
3. Möglichkeiten und Grenzen des Dokumentarfilms
3.1 Der Dokumentarfilm: objektive Darstellung der Wirklichkeit?
„Die Opfer hatten keine Kameras. Es existieren einige Bilder, die von der SS aufgenommen wurden, aber die meisten Photographien und Filmaufnahmen von den Vernichtungslagern stammen von den Alliierten. Als diese in die Lager kamen, fanden sie ein Stück unvorstellbarer Wirklichkeit, und um diese Wirklichkeit festzuhalten, auch um das Gesehene zu beweisen, nahmen sie Kameras mit. Sie filmten die Halbtoten und die Toten, die Berge von Leichen, die von Bulldozern umgeschichtet wurden. Zum Teil wurden diese Dokumentaraufnahmen noch in den Entnazifizierungsprogrammen gezeigt, sie sollten aufklären, zeigen,‚wie es wirklich war‘.“4
Wenn man den lateinischen Terminus „documentum“ ableitet, erhält der Begriff Dokumentarfilm etwas von der Qualität des Beweises und der Beglaubigung. Der Dokumentarfilm liefert also mit Hilfe der Filmkamera einen Beweis für die Realität. Dass die Wirklichkeit sowohl subjektiv wie objektiv vorhanden ist, wird jedoch meistens vergessen. Man könnte also höchstens feststellen, dass der Dokumentarfilm Beweise für eine These liefert, die der jeweiligen Argumentation zugrundeliegt. Mit dieser Feststellung bewege ich mich auf der Spur Erwin Leisers, der eine objektive Darstellung der Wirklichkeit nicht anstrebte.
Auch Leiser stellte fest, dass mit dem Begriff „Dokumentarfilm“ gerne die Vorstellung verbunden wird, dass Dokumentaristen die Wirklichkeit wiedergeben würden, ohne dabei ihre eigenen Ansichten einfließen zu lassen. Demnach zeigt das Dokumentarische die Welt so, wie sie ist. Doch ebenso beharrlich wird die Auffassung vertreten, dass es sich bei dem Dokumentarfilm um einen Versuch des Dokumentaristen handelt, die Wirklichkeit so darzustellen, wie er sie sieht. Jeder Filmemacher, jeder Autor hat Ansichten und Absichten. Schon für den Erfinder des Begriffes „documentary“, John Grierson, war der Dokumentarfilm kein Spiegel, sondern ein Werkzeug zur Veränderung der Wirklichkeit. Der Dokumentarist versucht zu zeigen, was er für Wirklichkeit hält, was er in die Wirklichkeit hineinliest, und was er von der Wirklichkeit wahrnimmt. Er kann deshalb nur sichtbar machen, was von dieser Interpretation und Wahrnehmung filmisch gestaltet werden kann. Demnach kann der Dokumentarist die Wirklichkeit nur durch den Eingriff in die Realität darstellen, indem er beispielsweise das zu Zeigende durch Montage hervorhebt und das im fotografischen Bild nicht Sichtbare durch ästhetische Strategien sichtbar macht. Dem Dokumentaristen wird damit eine organisierende Kraft zugewiesen, die der eines Erzählers gleichkommt. Wie jeder Film ist auch der Dokumentarfilm nur ein Film: ein Zeichen der Zeit, aber niemals die Wirklichkeit selbst. Deshalb kann man auch nicht vom „direkten Film“ sprechen, da zwischen der Wirklichkeit und dem Zuschauer das Temperament und das Bewußtsein des Filmemachers steht. Jeder Dokumentarist ist subjektiv und soll auch dazu stehen, denn diese Subjektivität ist Ausdruck ihrer schöpferischen Qualität und ihres Engagements. So sehen sich die meisten Dokumentarfilmer bis heute als Mittler zwischen Realität und Menschheit. Der Dokumentarfilm wird als Ausdruck der Wahrnehmung des Dokumentaristen gesehen. Was er für die Realität oder die Wahrheit ausgibt, ist jeweils nur seine eigene, und es ist alleine Sache des Zuschauers zu entscheiden, ob er sich dessen Konstruktion anschließt oder nicht. Über den Realitätsgehalt kann demnach immer nur jeder einzelne Zuschauer, Betrachter oder Leser für sich alleine entscheiden.
„Der Zuschauer sieht mit den Augen der Kamera - und bezieht das Gesehene auf sich selbst. Der Film stellt Fragen und ermöglicht dem Zuschauer, seine eigene Antwort zu finden.“5Leiser sieht sich außerdem als Produzent einer neuen Wirklichkeit. Die Menschen und Milieus in Dokumentarfilmen sind zwar authentisch und stammen aus der äußeren Wirklichkeit, der Dokumentarist reproduziert diese aber nicht, sondern stellt eine neue Realität her, indem er neue Bezüge schafft.
3.2 Der Dokumentarist: ein Grenzgänger?
Dem Dokumentarfilmer sind keine Grenzen gesetzt - fast keine. Die einzige Grenze, die im allgemeinen anerkannt wird ist die, dass kein Film definitiv sein kann. Jeder einzelne Film muss als Beitrag zur Erforschung der Wirklichkeit verstanden werden. Es ist bestimmt nicht die Aufgabe des Dokumentaristen, fertige Aufgaben vorzulegen: er informiert den Zuschauer, der seine eigene Stellungnahme entwickeln soll.
Wo die Filmsprache nicht ausreicht, um Gedankengänge ins Visuelle zu übersetzen, muss man sich anderer Ausdrucksmittel bedienen. Leiser meint hier die Dramaturgie und Ästhetik des Dokumentarfilms, die heute die Möglichkeiten des Dokumentaristen dank der technischen Entwicklung verbessert haben. Nicht nur, dass die Kamera leichter und beweglicher geworden ist, auch das lichtempflindliche Material ermöglicht Aufnahmen, die früher nur mit einem umfangreichen Beleuchtungsapparat möglich gewesen wären. Darüberhinaus können mit dem direkten Ton längere Szenen gedreht werden.
Die Einstellung Leisers zu seinen Beruf zeigt sich mitunter an der Kritik an die Überheblichkeit vor allem jungen Kollegen, die oft auf diese technische Hilfsmittel verzichten und den Film nur „als Waffe eines politischen Glaubenbekenntnisses“6sehen. Nur ihre Sicht der Wirklichkeit ist die richtige. Dabei unterschätzen sie jedoch die Bedeutung der handwerklichen Geschicklichkeit jeden Dokumentaristen und die Adressaten ihrer primitiven Agitation. Hier sieht Leiser die wahre Essenz des Filmemachens:„Es gilt nicht, die Welt so zu sehen, wie sie sein müßte, sondern die Vorstellung in ein Verhältnis zur Wirklichkeit zu setzen, wie sie ist. Das ist nur möglich, wenn man keine Angst vor der Wirklichkeit hat, sondern nahe an die Menschen herangeht und ein persönliches Verhältnis zu ihnen etabliert, bevor sie Gegenstand eines Filmes werden.“7 Man kann nur dann von einem guten Dokumentarfilm sprechen, wenn die Zusammenarbeit zwischen den Menschen hinter und vor der Kamera klappt. Dokumentarfilm bedeutet Kunst -die Kunst besteht aber darin, dass man sie nicht merkt.
3.3 Leiser, der Dokumentarfilmer
Erwin Leiser bezeichnete sich Zeit seines Lebens als Besessener des Mediums Films. Vorbilder hatte er keine, er sah sich als Autodidakt des Films. Für ihn war es viel spannender und schwieriger, Filme zu machen als Artikel zu schreiben. Der Non-Fiction-Film beschäftigte sich außerdem mit der Wirklichkeit und nicht mit erfundenen Figuren oder Situationen. Die Suche nach der Wirklichkeit barg für ihn immer neue Überraschungen, sei es beim Einfangen historischer Wirklichkeit oder der Darstellung von aktueller Wirklichkeit. Bereits im Hörfunk, bei dem er auch einige Zeit tätig war, ließ er den Hörer an seine Assoziationen und sinnlichen Wahrnehmungen teilnehmen. Die Musik benutzte er dazu, Gegenakzente zu setzen oder in Widerspruch zum gesprochenen Text treten zu lassen. Als Redakteur fühlte er sich aber vom Wort abhängig und fand so nur Zugang zu einem begrenzten Leserkreis. Der Film bescherte ihm Unabhängigkeit, da ein Bild mehr als tausend Worte aussagt. Endlich konnte der Zuschauer das gleiche sehen wie er. Dabei wendete er sich mit seinen Filmen immer an ein großes Publikum und versuchte die Ereignisse immer so direkt wie möglich darzustellen. So erhielt die Darstellung eine große Ausdruckskraft.„In jedem meiner Filme gibt es eine Szene, die für mich eine Zusammenfassung der Aussage des Films bedeutet, ohne dass dies direkt gesagt wird. Es kann eine Sequenz sein, in der Bild und Text einander akzentuieren, oder in der eine unerwartete Verbindung zwischen zwei Ereignissen sichtbar wird.“8Dabei wies der Filmemacher darauf hin, dass man damit rechnen muss, dass nicht jeder Zuschauer alles mitbekommt, was ihm angeboten wird.
Leiser arbeitete als freier Produzent immer gleichzeitig an mehreren Projekten: diese gleichzeitige Beschäftigung mit verschiedenen Themenkreisen sah er als Erholung. Als freier Produzent war seine Freiheit aber nie unbegrenzt, es war ihm jedoch immer möglich seine Themen, Produktionsmittel und Mitarbeiter selbst auszuwählen - ohne sich an Richtlinien von Fernsehanstalten zu halten. Seine Beziehung mit Fernsehanstalten gestaltete sich oft schwierig: es bedurfte oft eines „langen Ringens“, um sog. unerwünschte Beiträge im Fernsehen unterzubringen. Als Auftragsproduzent war er es jedoch meistens, der neue Projekte vorschlug und deren Finanzierung sichern musste. Dies verlieh der Kontinuität seiner Arbeit eine gewisse Unsicherheit, weil er oft das Gefühl hatte, Filme zu machen, die weder den Fernsehanstalten, noch dem Publikum willkommen waren. Die Motivation für sein Schaffen holte sich Leiser beim Zuschauer, bei denen seine Arbeit Spuren hinterlassen hatte, oft gerade da, wo er es nicht erwartet hatte. Für ihn war es vor allem wichtig verstanden zu werden, das gab ihm das Gefühl, weiter Akzente zu setzen, von denen er meinte, dass sie wichtig sind.
4. „Mein Kampf“
„In meiner politischen Entwicklung hat mich noch der Faschismus beeinflusst - wir haben in der Schule nichts darüber gelernt,überhaupt nichts, aber dann habe ich mal ein Buch darüber in die Finger gekriegt, da hat mich ein Schock getroffen, und dann habe ich noch einen Film gesehen, ‚Mein Kampf‘von Leiser - als ich da rauskam, zitterten mir die Knie, mir war schlecht, ich lehnte an einer Hauswand, mußte michübergeben ... Danach war für mich die Welt in zwei Hälften geteilt, einmal die Leuteüber dreißig und dann die jüngeren, die nichts damit zu tun haben konnten.“9
Die Geschichte und die Erinnerungen an das nationalsozialistische Deutschland beschäftigten den Autor in seiner journalistischen Tätigkeit. Außerdem entdeckte Leiser die Kraft des filmischen Materials, die es ihm erlaubten, mehr Einfluss auf sein „Publikum“ zu nehmen. Als der Film „Mein Kampf“ entstand, tauchten in Westeuropa immer mehr Hakenkreuze auf, jüdische Friedhöfe wurden geschändet, die extreme Rechts-Bewegung wurde aber nicht wirklich ernstgenommen. Deshalb kritisierte Leiser vor allem das Schweigen von Eltern, Großeltern und Lehrern, die die „neue Generation“ nicht an die schreckliche Vergangenheit teilnehmen ließen. Ihm ging es darum, Bilder zu zeigen, die authentisch waren und die Geschichte des Dritten Reiches mit so einer Kraft beschrieben, dass die Wahrheit den Zuschauer zu einer Stellungnahme herausforderte.
Vor allem war der Film aber an die Jugend gerichtet, denen er zeigen wollte, dass jeder Mensch ein Recht zu leben hat.
4.1„Nacht und Nebel“
1959 überredete der Dokumentarfilmer den Filmverleiher Tore Sjöberg, den Film „Nacht und Nebel“ über deutsche Konzentrationslager von Alain Resnais zu kaufen. Darüberhinaus bot er ihm an, eine Montage von historischem Filmmaterial über die Schlacht von Stalingrad als Ergänzung herzustellen, da der Film von Resnais zu kurz für einen Hauptfilm im Kino war. Leiser war es hier wichtig, das Leiden der Häftlinge in den Lagern den deutschen Kriegsgefangenen gegenüberzustellen, um das Projekt nicht als antideutsch herabsetzen zu lassen.
„Nacht und Nebel“ wurde zusammen mit der Montage Leisers unter dem Titel „Nie wieder“ als einstündiges Kinoprogramm gezeigt und entpuppte sich als als großer Erfolg. Für Sjöberg stand fest, die Einnahmen in ein neues Film-Projekt zu investieren. Leiser schlug vor, einen Kompilationsfilm mit dem Titel „Mein Kampf“ zu drehen, der sich mit der Wahrheit über Adolf Hitler und dem NS-Staat auseinandersetzen sollte. Zwar hatte Leiser noch nie einen Film über das Dritte Reich gesehen, der auf historischen Filmaufnahmen beruhte, er wußte aber genau welche Ereignisse nicht fehlen durften. Schließlich hatte er die Geschichte von 1933 bis 1939 selbst miterlebt und wollte die Wirklichkeit von damals den Floskeln Hitlers gegenüberstellen.
4.2 Exkurs: Geschichte im Dokumentarfilm: der Kompilationsfilm
Aufnahmen, die für einen aktuellen Zweck gedreht werden, sind schon nach Tagen oder Monaten historisches Material. Filmische Darstellungen der Geschichte basieren zum größten Teil auf Archivmaterial, zu dem allerdings neu gedrehte Aufnahmen kommen. Sogenannte Kompilationsfilme, die fremdes Material montieren - und vielleicht mit Selbstgedrehtem kombinieren - erleben ihre Blütezeit während des Zweiten Weltkriegs. Beide Seiten benutzten derartige Filme zur Darstellung und Festigung ihrer Position. Kompilationen wie „Feuertaufe“ (Bertram 1939), „Sieg im Westen“ (Noldan 1940) oder „The World in Action“ (Kanada 1942) zeigen zugleich die grundsätzlichen Probleme dieser Gattung. Häufig sind Aufnahmen nicht mehr genau zu datieren oder einem bestimmten Ereignis zuzuordnen. Cutter benutzten oft bewußt falsche Bilder, achten z.B. nur darauf, dass ein Panzer von links nach rechts fährt, nicht ob er im Polen-Feldzug oder in Frankreich aufgenommen wurde. Auch Kriegsszenen, die nur unter Gefahr zu drehen sind, werden oft durch Manöverbilder ersetzt. Andere Sequenzen, die man nirgendwo - weder dokumentarisch noch inszeniert - in einem Stück gefunden hat, montiert man aus Aufnahmen verschiedener Filme.
Helmut Regel hat 1977 die Authentizität dokumentarischer Filmaufnahmen untersucht und dabei die Methoden einer kritischen Prüfung systematisiert. Aufnahmen sind im Normalfall nicht authentisch,
- wenn sie Ereignisse zeigen, die nicht filmbar waren, weil sie geheimgehalten, unzugänglich oder unvorhergesehen waren;
- wenn sie mit einer Technik operieren, die zum angeblichen Zeitpunkt der Aufnahmen noch nicht entwickelt war;
- wenn sie Kamerapositionen oder -fahrten benutzten, die nur in Spielfilmen möglich sind.10
Eine zusätzliche Form inszenierter Wirklichkeit sind die bewußt verfälschenden PseudoDokumentarfilme. Als Beispiel kann man den Wahlwerbefilm „Wohin wir treiben“ der Deutschnationalen Volkspartei nennen, der 1931 in Studios der UFA arrangiert wurde. Dieser Film über die Novemberrevolution von 1918 zeigt Szenen, in denen „rote Revolutionäre“ hinterhältig über harmlose Bürger und regierungstreue Truppen herfallen. In den USA und Grossbritanien entstanden hingegen zahlreiche Kompilationen, die mit den Mitteln der Satire versuchten, das NS-Regime lächerlich zu machen.
„Vollendsüberzeugt davon, dem Regime durch Spott zu schaden, verschnitt der Brite CharlesRidley 1941 den Partei-„Triumph“ zu einem Zwei-Minuten-Trick: In präziser RücklaufZeitraffer- und Wiederholungsmontage ließer Hitlers geschniegelte Kohorten zum Takt des„Lambeth Walk“(Filmtitel) wie bei einer Springprozession hüpfen.“11
4.3 Das Staatliche Filmarchiv der DDR
Leiser wußte, dass es sich im Zuge des Kalten Krieges schwierig gestalten würde, aus den Archiven der Bundesrepublik authentisches historisches Material für einen antifaschistischen Film zu bekommen. Deshalb wandte er sich an das Staatliche Filmarchiv der DDR. Nach Gesprächen mit dem Direktor, Herbert Volkmann, und der Versicherung, für den Frieden und gegen den Nationalsozialismus zu sein, bekam er Zugang zu den Schätzen des Archivs. Hier sichtete er vierhunderttausend Meter Filmmaterial und wählte zweiundreißigtausend aus.
Aus diesem Material wurden Kopien und Dupenegative hergestellt, die in der Mitte einen dicken, weißen, senkrechten Strich hatten, das vor der unberechtigten Auswertung von Fernsehen und Kino schützen sollte.12Außerdem wurde für eine Synopsis von Leiser, die die ausschlaggebenden Stationen auf dem Wege des Nazisystems aufzeigte, französische, sowjetische, amerikanische, englische, österreichische und polnische Bildstreifen ausgewählt.
Das wichtigste Material kam aber aus den Sammlungen des alten Propagandaminsteriums des Staatlichen Filmarchivs der DDR.
Leiser verwendete ausschließlich authentisches Material. Neben Aufnahmen aus Wochenschauen und Propagandafilmen - so z.B. Sequenzen aus Leni Riefenstahls Parteifilm „Triumph des Willens - enthält Leisers Dokumentation auch zahlreiche, bis dahin unveröffentlichte Aufnahmen. So zeigt er einen ursprünglich zu Propagandazwecken gedrehten Film über das Warschauer Ghetto, der die kontinuierliche Verwandlung eines Stadtteils in eine Hölle beschreibt. Einige im Film gezeigten Bilder sind zum Symbol geworden: der kleine Junge im Warschauer Ghetto, der wie ein gestellter Verbrecher seine Arme hebt, das angstvolle Gesicht eines Mädchens, das aus dem Spalt einer sich schließenden Wagontür blickt - der Zug fährt nach Auschwitz.
„Im Januar 1960 begann ich mit dem Schnitt. Der Cutter verstand kein Wort Deutsch und führte nur meine Anweisungen aus. Ich verbrachte den ganzen Januar mit ihm im Schneideraum, arbeitete sehr schnell, denn als Anfänger wußte ich nichts von den Fallen, die auf einenRegisseur bei einem Film dieser Art lauern.“13
Im April 1960 lagen zwei Fassungen des Films vor, einer schwedischen und einer deutschen. Ende April wurde die schwedische Version von „Mein Kampf“ in Göteborg uraufgeführt.
4.4 Gestaltung und Inhalt
Vorspann: (mit Trommelwirbeln unterlegt)
„Jedes Bild in diesem Film ist authentisch. (...)
Für eine vollständige Schilderung der Tyrannei Hitlers reicht die Zeit nicht aus. Entscheidendeund typische Episoden werden aufgezeigt - als Antwort auf die Fragen: Was geschah damals?Wie war es möglich? Was Hitlers Programm einer Neuordnung Europas bedeutete, zeigt diepolitische Tragödie. Das am meisten heimgesuchte Land steht für alle besetzten Gebiete. Dieser Filmüber die blutigen Jahre ist die Erinnerung an die Opfer des Hitlerregimes gewidmet, in Deutschland, in der Welt. Es ist eine Warnung an die Lebenden und mahnt uns an das Recht jedes Menschen, als ein Mensch zu leben.“14
Nach diesem Vorspann beginnt der Film mit einer Aufnahme des brennenden Berlin von 1945, dann wird zurückgeblendet auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Von nun an werden die Geschehnisse dieser Zeit in chronologischer Abfolge gezeigt. Leiser stellt die Person Adolf Hitler in Zusammenhang mit der politischen Entwicklung von 1914 bis 1945. Leiser schildert Aufstieg und Fall des Hitler-Systems; im Unterschied zu anderen Filmen zum Thema klammert er die Vorgeschichte nicht aus. Er beginnt mit dem Ersten Weltkrieg, zeigt auch, welchen Anteil die Großindustrie an Hitlers Emporkommen hatte, gibt den Jahren vor dem Krieg breiten Raum, in denen die Nazis auf der Grundlage des Rassismus Europa neu „ordnen“ wollten. Bei den Kriegsjahren setzt Leiser die richtigen Akzente: die Aufnahmen aus dem Warschauer Ghetto mit seinem unendlichen Leid und seinem Übermaß an Grausamkeit, Bilder aus den Folter- und Todeskammern des KZs nehmen mehr Raum ein als die Darstellung des Kriegsverlaufes.
Leiser arbeitet mit Leitmotiven und Kontrastmontagen. Unter Leitmotiven versteht der Dokumentarist, dass gewisse Szenen zueinander in einem Verhältnis stehen. Die Motive werden zwar nicht wiederholt, sondern kehren in einer veränderten Form wieder. So erklärt z.B. der „Führer“ in einer Rede an die Hitlerjugend: „Wir müssen einen neuen Menschen erziehen.“ Hitler wollte eine Jugend, die „schlank und rank“ ist, „schnell wie Windhunde, zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl.“ In einer Montage zeigt Leiser eine andere Rede, in der Hitler zu der Jugend sagt, er sei nicht „der Fürchtende“, sondern der „Vorbereitende“. Diese Rede stellt der Filmer chronologisch direkt vor dem Ausbruch des Krieges:„Und ihr, ihr werdet neben mir stehen, hinter mir, seiten und vor mir, und wir werden wieder in unserem Zeichen siegen.“15Am Ende des Filmes sieht man schließlich die letzten Bilder von Hitler, der Kinder an die Front schickt, als schon längst jedem klar war, dass Deutschland den Krieg verloren hatte.
Die von Leiser kontrapunktisch bezeichnete Gestaltung des Films basiert hauptsächlich auf der Gegenüberstellung von Wahrheit und Propaganda. „Hier wird die Wahrheit gegen Hitlers Floskeln in seinem Buch „Mein Kampf“ gestellt. (...) Propagandamaterial, das die Machthaber des Dritten Reiches selber hergestellt haben, sagt gegen sie aus.“16
In manchen Sequenzen werden zur Kontrastierung von Wahrheit und Propaganda O-Ton- Passagen gegen das Bild gesetzt. Zu den Aufnahmen deutscher Kriegsgefangener, die durch Moskau geführt werden, ertönt noch einmal der Dialog der Arbeitsdienstler aus Riefenstahls „Triumph des Willens“: „Kamerad, woher kommst du?...“ Bei der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde durch Keitel hört man Hitlers Stimme, der darauf pocht, dass er das Wort Kapitulation nie kennengelernt habe. Leisers Konzeption gibt somit zugleich auch Antwort auf die im Vorspann gestellte Frage: „Wie war es möglich?“ Die propagandistische Verblendung führte zur Niederlage von Stalingrad, zum Zusammenbruch. Um zu verdeutlichen, wie Hitler auch andere Nationen täuschte, verwendet Leiser auch die Kontrastmontage. Vor dem Einmarsch der deutschen Truppen in die Sowjetunion wird ein Foto eingeblendet, das Stalin und Hitlers Außenminister Ribbentrop dabei zeigen, wie sie sich die Hände geben. Der folgende Kommentar erinnert an den Nichtangriffspakt, dann ist Hitlers Stimme zu hören:„Rußland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren.“17Das Dritte Reich erscheint als gigantisches Lügenkonstrukt, das auch das Ausland täuschte.
Auch bei der Musik verwendet Leiser Leitmotive, die sich wiederholen. So ertönt bei der Tragödie jedes einzelnen Opfers, ein Thema aus dem zweiten Streichquartett von Janácek, „Intime Briefe“; sobald Tote auf den Straßen im Warschauer Ghetto auftauchen, hört man das Beten eines Kantors, der in einem Sabbat-Gottesdienst um Leben bittet. Musik und Text stehen hier in direktem Widerspruch zum Bild.
Der Sprechertext im Film ist hingegen nüchtern und beschränkt sich ausschließlich auf sachliche Informationen:„Ich schrieb einen sachlichen Drehbuchtext und betonte weder den kontrapunktischen Aufbau des Films noch den Wechsel im Bildrhythmus allzu sehr. Um die Wirkung gewisser Abschnitte zu erhöhen, wurde nur dort ein Text gegen das Bild direkt ausgespielt.“18
Den Schluss des Filmes möchte ich durch eine Sequenzliste in Stichwörtern darstellen, die den Grundton des Werkes unterstreichen:
- „Lebensmittelverteilung; Bilder zeigen Not der Menschen.
- Nürnberger Prozess: die Angeklagten bekennen sich alle nicht schuldig.
- KZ-Häftlinge hinter Stacheldraht:‚Machte Hitler alles selber?‘
- Aufnahmen von der Öffnung der Konzentrationslager; Kindergruppe verläßt ein KZ.‚Diese Kinder kamen nicht in die Gaskammer. Die SS-Ärzte hatten sie für Experimente aufgespart, weil sie Zwillinge sind.‘
- Unüberschaubares Leichenfeld: ‚In Sonnenburg hat die SS, bevor sie vor den
heranrückenden Alliierten floh, die Insassen des Lagers niedergemäht. (...) Neuen MillionenMenschen sind in den Konzentrationslagern umgekommen, darunter 5 978 000 Juden, 72Prozent aller Juden Europas.‘
- Berge von Koffern, Kleidern, Schuhen, Brillen, Spielsachen, Frauenhaare, Zähnen.
- Offenes Massengrab. ‚25 Millionen Soldaten sind gefallen. Die Opfer der zivilen
Bevölkerung werden auf 24 Millionen geschätzt.‘
Die Schlussaufnahme zeigt ein Meer von Kreuzen: „Unzählige Massengräber zeugen von dem,was geschehen ist. Es darf nie wieder geschehen! Nie wieder!“19
4.5 Die Reaktionen
Als der Film in Göteborg uraufgeführt trug er den schwedischen Originaltitel „Den blodiga tiden“, was übersetzt „Blutige Zeiten“ bedeutete. Eine direkte Übersetzung von „Mein Kampf“ war nicht möglich, da „Min kamp“ neben „Mein Kampf“ auch „Mein alter Gaul“ bedeutete. Der Titel „Mein Kampf“ war von Leiser als Provokation gedacht und so wurde er auch wahrgenommen. Es war auch kein Zufall, dass der Film in Schweden entstand. Leiser erklärte, dass das die nötige Distanz für solch ein Projekt nur in einem Land möglich war, das vom Krieg verschont worden war.
Als der Film auch in den deutschen Kinos anlief, kam dies einem Tabubruch gleich: obwohl der Autor ganz ähnliches Dokumentarmaterial über das Dritte Reich verwendet hatte wie früher entstandene Montagefilme auch, war dies doch das erste Werk, das„nicht die weitverbreiteteAuffassung nährte, Hitlers eigentliches Verbrechen sei es gewesen, den Krieg verloren zuhaben“20, wie die Zeitschrift „Filmkritik“ damals schrieb.
Leiser brachte vielmehr Dinge zur Sprache, die etwa in bundesdeutschen Schulbüchern der 50er Jahre weitgehend ausgeklammert blieben - so den Anteil der Großindustrie an Hitlers Aufstieg, die Hintergründe des spanischen Bürgerkriegs oder das tatsächliche Ausmaß der Judenvernichtung.
„Mein Kampf“ war von Anfang an ein großer Erfolg. Zwar hatte Leiser damit nicht wirklich gerechnet, begründete diese Tatsache aber damit, dass die Einfachheit des Konzeptes und die bewußte Kunstlosigkeit der Gestaltung eine unbequeme Wahrheit so direkt zum Publikum sprechen ließen, dass sie wie ein Schock wirkte. Außerdem darf man nicht vergessen, dass vom Mythos Hitler immer noch eine Faszination ausgeht, die bis heute kaum an Kraft verloren hat. „Mein Kampf“ wurde Anfang der 60er-Jahre in über 100 Ländern aufgeführt und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. In vielen sozialistischen Ländern wurde der Titel durch einen anderen ersetzt, da man nicht einen von Hitler formulierten Titel haben wollte. In vielen anderen Ländern wurde der Film hingegen verboten. Auch in der Bundesrepublik wurde „Mein Kampf“ von einer einstweiligen Verfügung bedroht, da es Probleme mit der Lizensierung des Filmes gab. Als Leiser die deutsche Fassung des Filmes in Berlin zum ersten Mal sah, mußte er feststellen dass er „verstümmelt“ wurde: Szenen fehlten, er entdeckte weitere Striche und Textänderungen, die der Verleiher ohne sein Wissen vorgenommen hatte. Auch in kommunistischen Ländern wurden Änderungen vorgenommen: sie hielten sich aber an die Abmachung, die jüdische Tragödie nicht anzutasten. Leiser mußte feststellen, dass er nicht Herr seines eigenen Werkes war. Diese Tatsache trug dazu bei, dass er selbst Produzent seiner Filme wurde und über das Schicksal der Filme verfügen konnte.
Der Film trug in Deutschland zu einem politischen Erwachen der damaligen Jugend bei: Leiser hatte also sein Ziel erreicht, endlich das Schweigen zwischen den Generationen zu brechen. Deswegen war die Kritik, dass „Mein Kampf“ ein Film für Volksschulen sei, kein Vorwurf für Leiser, sondern ein Lob. In anderen europäischen Ländern kam es zu heftigen Diskussionen zwischen Rechten und Linken, Kollaborateuren und Widerstandskämpfern.
4.6 Der Film im Spiegel der Kritik
„Mein Kampf“ war nach Ende des 2. Weltkrieges der erste großangelegte Versuch eines Dokumentaristen, die Geschichte des Dritten Reiches zu gestalten. Der Film verzichtete nicht nur auf sensationelle Momente, sondern vermied auch jede beschwichtigende Geste gegenüber dem Publikum. Leiser wußte, dass ein Gegenpol zur Unmenschlichkeit nur durch den Verzicht auf die Ästhetik der Überrumpelung durch Montage zu erreichen war. Die negative Kritik von Kollegen beschränkte sich deshalb auch nicht auf die Methode Leisers, da der Inhalt gar keine andere Form verträgt als die des nüchternen und schmucklosen Essays.
Die Mängel des Films liegen im Genre: es ist klar, dass die Verwendung dokumentarischen, authentischen Materials nicht die Authentizität sichert und schon gar nicht die volle Wahrheit. Gerade deshalb nicht, weil es nicht zu allem authentische Bilder gibt. Viele Kritiker sehen die Stärke des Films in seinem moralischen Anspruch, eine „Erinnerung an die Opfer“ und eine „Warnung an die Lebenden“ zu sein. Diese Pioniersituation Leisers erklärt auch den Einfluss auf nachfolgende Filme über das Dritte Reich: „Mein Kampf“ war ein Ansporn die politische Analyse über das Dritte Reich zu vertiefen. Leiser schuf die Grundlage, auf der andere Dokumentaristen weiterarbeiten konnten: so wie z.B. Paul Rothas „Das Leben Adolf Hitlers“ (1961) oder Michail Romms „Der gewöhnliche Faschismus“. Beide nutzten dabei das Bildmaterial Erwin Leisers und verschärften die Analyse.
Leiser sah sich außerdem der Kritik ausgesetzt, dass er dem Klischee, dass die Deutschen „Hitlers Opfer“ waren, neuen Nährstoff gab. Im Vorspann zum Film ist vom „Hitlerregime“ und der „Tyrannei Hitlers“ die Rede. Dieses Bild von der durch Propaganda verführten deutschen Nation wurde auch von der damaligen Filmkritik aufgegriffen:„(...)die schmähliche Irreführung des deutschen Nationalbewußtseins (...)“,„gibt es nur ein Schaudern darob, in welche Händesich unser Volk einmal begeben hat. (...)“21
Wie auch die Zeitschrift „Filmdienst“, nahmen sich auch andere Zeitschriften dem Film „Mein Kampf“ an. Hier einige Ausschnitte daraus:
„Ein in Schweden erarbeiteter, hervorragend geformter Dokumentarfilm ... hat er mit virtuoser filmtechnischer Beherrschung einen Film hergestellt, der unter dem provokatorischen aufzufassenden Titel nicht nur Hitler und seinen Unmenschlichkeitsstaat, sondern auch die Ursachen der Hitlerschen, für Europa so folgenschwere„Machtergreifung“aufzeigen will.
Der Film ist von heilsamer Wucht undÜberzeugungskraft, wenn er uns in den Bildwirbel der nationalsozialistischen Massenaufmärsche, der Großkundgebungen mit ihren Hitlerreden hineinreißt.“22
„Die Grenzen des Films liegen in seiner Beschränkung auf dokumentarisches Material. Die soziologischen und ideologischen Gründe für den Aufstieg Hitlers bleiben außerhalb der
Perspektive des Films. Der gestalterischen Bemühung, die die Einbeziehung des Ungefilmten bedeuten würde, versagt sich der Film.“23
„Leiser vermochte sein Opus zudem mit Szenen von solch unheimlicher Intensität auszustatten, daßsich selbst abgebrühte Kritiker-Routiniers beklommen zeigten:‚Ich werde von diesen Aufnahmen mein Leben lang heimgesucht werden,‘bekannte etwa der Rezensent der WELT. Die Kritiker bescheinigen dem schwedischen Dokumentarfilmer, der mit‚Mein Kampf‘sein Debüt als Filmregisseur gab, daßer Bildrhythmus und Schnitt-Technik mit Meisterschaft beherrsche.“24
5. „Deutschland erwache!“
Erwin Leiser, der sich 1961 nach dem großen Erfolg seines Debütwerks in Zürich niedergelassen hatte, drehte in weiterer Folge die Filme „Eichmann und das Dritte Reich“ (1961) und „Wähle das Leben“ (1963). Diese Filme über den Schreibtischtäter Eichmann und das Schicksal von Opfern im Atomzeitalter waren zusammen mit „Mein Kampf“ Teil von Leisers„Trilogieüber die Unmenschlichkeit, und die ständige Möglichkeit des Menschlichen.“251963 wurde Leiser von ATLAS-Film damit beauftragt, eine Auswahl von deutscher Stummfilme zu bearbeiten. Außerdem überlegte ATLAS, Filme aus dem Dritten Reich mit Einleitungen zu versehen und in die Kinos zu bringen. Leiser sträubte sich jedoch dagegen, weil er der Ansicht war, dass diese Propagandafilme von 1933-45 nicht an Wirkung verloren hätten und keineswegs durch Gegendarstellungen entkräftet werden würden. Trotzdem versuchte der Dokumentarist den Durchhaltefilm „Kolberg“ dahingehend zu verändern, dass er eine Einleitung über Berlin in den letzten Kriegsmonaten und kurze, satirische Sequenzen vor und nach den krassesten Propagandaszenen einfügte. Für Atlas waren diese Szenen jedoch zu hart. Deshalb legte Leiser seine Arbeit nieder. In Gesprächen mit dem Firmeninhaber Hanns Eickelkamp einigte er sich aber darauf, dass er einen Film über die Propaganda im Film des Dritten Reiches machen würde, der den Titel „Deutschland erwache!“ tragen sollte.
5.1 Exkurs: Propaganda im Film: Die Ufa
Am 18. Dezember 1917 wurde die UFA (Universum-Film AG) gegründet. Das deutsche Reich war mit sieben Millionen Mark beteiligt. Die für damalige Verhältnisse äußerst kapitalkräftige Firma legte schon seinerzeit Wert auf Unabhängigkeit und gliederte neben den Filmtheatern auch Produktionsstätten und Verleihfirmen in das Unternehmen ein.
Der Spielraum für künstlerische und thematische Gestaltungsfreiheit wurde mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten immer enger.
Die UFA sollte nicht nur politische Propaganda betreiben, sondern auch Filme von hohem künstlerischem Niveau herstellen, damit der deutsche Film mit dem Ausland konkurrieren könne. In der Ägide der Ufa entstanden bis 1933 Filme wie „Der blaue Engel“, „Metropolis“ oder Amphitryon“, aber auch Filme wie „Friedericus Rex“ und „Morgenrot“.
Unter der Ägide des Ministers für Volksaufklärung und Propaganda, Joseph Goebbels, entstanden von 1933 bis 1945 ca 1.150 Spielfilme. Nur bei einem Sechstel davon handelte es sich um direkte Propaganda; der Rest war vermeintlich unpolitische Unterhaltungsware, die jedoch, so das Kalkül des Ministers, wesentlich besser als die offene Agitation für die Steuerung von Werturteilen und Verhaltensnormen geeignet sei.
5.2 Die Vorbereitungen
Zusammen mit einer Arbeitsgruppe begann der Dokumentarist die Besichtigung von alten deutschen Spielfilmen. Diese fand er vor allem im Staatlichen Filmarchiv der DDR und westdeutschen Archiven vor. In den Archiven der DDR fand Leiser keine Schwierigkeiten vor, auch an verbotenes Material zu gelangen, da man dort wußte, dass er keine Propaganda für das Dritte Reich machen würde. In den westdeutschen Archiven gestaltete sich das ganze schwieriger: Leiser wurde vor der Bedingung gestellt, an mehreren Stellen des Films kurze Gegendarstellungen zur Propaganda einzusetzen.„Ich tat es, obgleich ich sie für unnötig undunwirksam hielt, da sie gerade dort die Propaganda entlarvte.“26
Nachdem ATLAS-Film in Konkurs ging, bot Leiser das Projekt verschiedenen Fernsehanstalten an, stieß jedoch auf taube Ohren. Letztlich gelang es ihm jedoch, den Norddeutschen Rundfunk (NDR) von seinem Film zu überzeugen. Leiser mußte den Film als Auftragsproduzent machen, da keiner im Sender „Zeit“ hatte, sich um die benötigten Senderechte zu kümmern. So wurde Leiser Auftragsproduzent.
5.3 Der Film
„Deutschland erwache!“ ist eine Montage von Ausschnitten faschistischer PropagandaSpielfilme, in denen Erwin Leiser das Konzept der NS-Filmpolitik trasparent und kritisch beurteilbar macht.
Der Titel „Deutschland, erwache!“ stammt aus den Anfängen des Nationalsozialismus. In der kurzen Einführung, die er seiner Dokumentation voranstellt, weist Erwin Leiser auf die Paradoxie dieses Mottos hin: „Hinter einer Parole wie‚Deutschland, erwache!‘verbarg sich das entgegengesetzte Ziel: Einschläfern des Gewissens, des selbständigen Denkens, des Gefühls für
Freiheit und Menschenwürde.“27Diese ideologische Massenkonditionierung wurde in erster Linie vorangetrieben durch den geschickten Einsatz von Presse, Rundfunk und Film.
Das erklärte Ziel von „Deutschland, erwache!“ ist es, Funktion und Instrumentarium direkter und vor allem indirekter Propaganda im Film des Nationalsozialismus offenzulegen. Anhand von Ausschnitten aus insgesamt 26 Spielfilmen deckt Erwin Leiser die komplexen Zusammenhänge zwischen nationalsozialistischem Gedankengut und den Inhalten der Drehbücher auf und verdeutlicht die eklatanten Widersprüche zwischen Filmwelt und Wirklichkeit. Leiser hat die Szenen so aneinandergereiht, dass die Methoden der damaligen Filmpropaganda am deutlichsten auftreten: er hat die Propaganda-Szenen gekennzeichnet und erklärt im Sprechertext, welchen Zweck sie erfüllen. Auf diese Weise haben sie nicht mehr die ursprünglich beabsichtigte Wirkung.
Der Sprechertext macht dabei nur kurze Angaben zu den zitierten Ausschnitten und läßt ausreichend Platz für eigene Überlegungen des Publikums. Für Leiser versetzt sich der Zuschauer in ein gefühlsmäßiges Vakuum, das Zeit zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Stoff ermöglicht.
Die nur an wenigen Stellen um zusätzliches Dokumentarmaterial ergänzte Ausschnittsammlung ist durch Zwischentitel deutlich in elf Teile gegliedert. Diese entsprechen in etwa der Geschichte des Dritten Reichs und setzen sich mit den wesentlichsten Aspekten der NS-Ideologie auseinander. Durch Art und Anordnung der Filmauswahl wird ein Bogen geschlagen von der antikommunistischen Parteiwerbung des Beginns über Führerkult, Judendeportation und Euthanasieprogramme bis hin zur Durchhaltepropaganda des letzten Kriegsjahrs.
Für den Dokumentarfilmer ist Propaganda nur in dem Maße wirksam und gefährlich, indem sie unerkannt bleibt. Hinweise auf die Entstehungsbedingungen führen zu einer Selbstentlarvung selbst subtilster Manipulationsversuche. In seinem parallel zu „Deutschland, erwache!“ erschienen gleichnamigen Buch schreibt Erwin Leiser über seine Arbeitsmethode:„Der Kommentar ist sehr sparsam eingesetzt, die Beziehung zwischen der Lüge des Spielfilms und der Wirklichkeit wird nur an ganz wenigen Stellen hergestellt(...) Eine ausführliche Gegendarstellung hätte nur eine Art von Emotionen durch andere ersetzt, dadurch bei vielen Zuschauern Abwehrmechanismen erzeugt und eine Verdrängung ermöglicht.“28
„Tests an vielen Orten haben bewiesen, dass die Knappheit der Information und der Spielraum, den der Film für freie Assoziationen des Zuschauers offen läßt, einen unreflektiertenÜbergang
von der Goebbelsschen Gartenlaube in meine nicht zulassen, und einen selbständigen
Denkprozeßermöglichen, zu dem ich anregen wollte.“29
Folglich beschränkt sich der Regisseur auf Kurzinformationen zu den politischen Hintergründen und den rhetorischen Taktiken, die verwendet wurden. Häufig genügt auch schlicht der Hinweis auf das, was ihm Film unerwähnt bleibt, z.B. die zahlreichen Opfer der Luftangriffe auf England, die die Stukas flogen. Im Vordergrund steht vor allem die sprachlich-inhaltliche Analyse. Auf Kommentare zu Besetzung, Szenenaufbau, Musik und Bildgestaltung wird fast völlig verzichtet, da die verwendeten Strategien in den gezeigten Ausschnitten ohnehin evident sind. Bei aller Knappheit und Objektivität sind Ausdruck und auch Materialmontage gelegentlich nicht frei von bitterer Ironie. So zeigt Leiser am Schluß eine Szene aus „Die große Liebe“, in der man zu den Klängen von „Davon geht die Welt nicht unter“ einen gefangenen, jungen deutschen Soldaten vor einem verlassenen Tank auf dem Schlachtfeld sitzen sieht, der den Kopf schüttelt.
Wie in „Mein Kampf“ ging es Leiser in „Deutschland erwache!“ um die Überwindung der unbewältigten Vergangenheit: durch Sichtbarmachung der Anfänge und Spuren des Dritten Reiches. Die Auseinandersetzung des Publikums mit dem Film und der NS-Filmpropaganda führte zu intessanten Reaktionen: so haben Diskussionen an amerikanischen Universitäten 1976 gezeigt, dass es unausgesprochene Parallelen zu entsprechenden Erscheinungen in der Nachkriegszeit gibt und der Stoff auf die Gegenwart und andere Länder als Deutschland bezogen werden kann. Die internationale politische Entwicklung sorgt dafür, dass sich bei neuen Vorführungen des Films „Deutschland erwache!“ vor einem jungen Publikum immer wieder ungeahnte aktuelle Bezüge ergeben.
„Deutschland erwache!“ wurde vom Norddeutschen Rundfunk am 31. Jänner 1968 im Dritten Programm (Norddeutsches Fernsehen) uraufgeführt und am 27. August 1968 vom Ersten Programm (ARD) ausgestrahlt.
6. Filme „mit“ Künstlern
6.1 Auf der Suche nach dem Gesicht des Menschen
Erwin Leiser verbindet man mit Filmen über Totalitarismus, die nukleare Bedrohung, die jüdische Tragödie oder die deutsche Zeitgeschichte. Im Laufe seiner Karriere entstanden jedoch sehr viele Filme „mit“ Künstlern, die dem großen Publikum verborgen blieben. In diesen Filmen versucht der Dokumentarist die Möglichkeit des Menschlichen in einer Welt des Unmenschlichen aufzuzeigen. Für ihn beweist der schöpferische Akt bei der Entstehung eines Kunstwerkes einen Höhepunkt des Positiven, zu dem der Mensch fähig ist.
Seine intensive Beziehung zur bildenden Kunst erklärt Leiser so:„Auf der Suche nach demGesicht des Menschen, bei meinen Bemühungen, mich im geistigen Labyrinth unserer Zeitzurechtzufinden, erlebe ich gerade Werke der bildenden Kunst sehr stark, weil ich in Bilderndenke und durch sie angeregt - und aufgeregt - werde.“30
Im Erlebnis mit der Kunst wird der schwedische Filmer auf den Menschen hinter dem Bild neugierig, er fühlt sich mit ihm verwandt. Zugleich hat Leiser auch das Bedürfnis dieses visuelle Erlebnis filmisch umzusetzen: er möchte das Werk differenziert sehen, zum schöpferischen Prozeß vordringen, Zusammenhänge entdecken und darstellen, den Menschen zeigen, der hinter diesem Werk steht. Dabei darf er sich aber niemals zwischen dem Künstler und dem Publikum stellen. Leiser kann sich also nur durch den Film artikulieren, wenn sich der Künstler vor der Kamera artikuliert. Außerdem beschreibt der Dokumentarist seine Filme als eine Chronik der menschlichen Beziehung, die sich während der Zusammenarbeit verändert. Das einzige was all seinen Filmen mit Künstlern gemein ist, ist der Versuch, sich in die Welt des anderen einzufühlen und diesen Prozeß sichtbar zu machen.
6.2 Film und Kunst
Leisers Filmarbeit mit Künstlern - nicht über Künstler - läßt sich durch zwei Worte charakterisieren: Planung und Zufall. Er wußte was er suchte, aber nicht, was er finden würde.
Der Filmer bereitete sich zwar immer gewissenhaft auf ein neues Projekt vor, beim Zusammenspiel aller Beteiligten am Drehort entstand aber etwas, das er nicht voraussehen konnte. Das machte den Reiz seiner Arbeit erst aus: für Leiser war eine gute Vorbereitung die Voraussetzung für Improvisation.
Nur durch Partnerschaft ist ein Film mit Künstlern möglich. Das Miteinander ermöglicht es dem Künstler Türen zu öffnen, die sonst verschlossen bleiben würden. Deshalb war ein fertiger Film immer mehr, als das was der Dokumentarist plante. Dieses Vertrauensverhältnis bedeutete aber nicht, dass Leiser von den Künstlern „abhängig“ war: als Filmgestalter war er ihm gegenüber unabhängig.
Leiser legte erst im Schneideraum die Reihenfolge der einzelnen Abschnitte der Filme fest. Dabei entdeckte er bei der Montage, dass gewisse Sequenzen nicht die erwartete Wirkung erzielten und erkannte neue Übergänge. Bevor er alle Elemente eines Bildes erfasste, stellte sich der Filmer alle Möglichkeiten der Kamerawanderung über dieses Bild vor - und wählte die Details aus, auf die er verweilen wollte.
Die Darstellung eines Kunstwerks kann nicht als bloße Reproduktion angesehen werden. Der Film zeigt Bilder so, wie man sie sonst nicht sehen würde. Das Medium geht sogar weiter als die Malerei selbst, weil ganze Bilder als Teile einer Sequenz in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Man darf hier auch nicht vergessen, dass die Kamera den Blick des Zuschauers lenkt. Leiser faszinierte gerade diese Tatsache, da er im Film immer neue Bezüge herstellen konnte, sei es zwischen Bild und Bild, Bild und Ton oder Innen- und Außenwelt. Dabei fragte er sich immer, ob der Zuschauer „seine“ Wirklichkeit genauso erleben würde wie er selbst.
Für ihn begannen die Möglichkeiten des Filmes gerade da, wo die Sprache versagte. Er konnte mit seiner Interpretation im Film etwas leisten, was kein anderes Medium vermochte. Dass er Menschen erreichte, die niemals ein Kunstbuch kaufen oder anschauen würden, war für Leiser der ausschlaggebende Grund für seine Arbeit mit Künstlern. Kompliziertes so zu zeigen, das es auch ein Laie versteht, war die nächste Herausforderung. Denn er konnte nicht annehmen, dass seine Filme nur von Kunstexperten gesehen würden. Die Subjektivität machte ihm dabei keine große Sorgen, da er viel Mühe darauf verwendete, dass sein Publikum ihn kontrollieren konnte. Er zeigte die Details, die ihm wichtig erschienen anschließend immer in der Totalen als Kontrollmöglichkeit. Subjektiv war natürlich auch, wie lange der Filmer das Kunstwerk im Film zeigte. In einem Museum kann man sich ein Bild so lange ansehen, wie man will, im Film wird man dazu „gezwungen“. Das Filmen der schöpferischen Arbeit von Künstlern verknüpft zudem zwei voneinander unabhängige Schaffensprozesse: der Künstler und der Filmgestalter mit ihren jeweiligen Werkzeugen. Deshalb setzt der Dokumentarist bei seinen Filmen - charakteristisch für alle seine filmischen Projekte - wenig Text ein, der nur als Information dienen soll. Die wichtigsten Aussagen macht der Künstler selbst, der von Leiser Stichworte bekommt, provoziert oder entspannt wird. Der Hauptdarsteller soll zu einem Selbstportrait verführt werden. Viele Zuschauer werden sich fragen, wie authentisch der schöpferische Akt ist, den sie im Film beiwohnen dürfen. Diese kritische Bemerkung ist berechtigt. Für Leiser gab es Künstler, die bei ihrer Arbeit die Anwesenheit eines Filmteams total vergaßen und sich voll ihrer Arbeit hingaben. Andere hingegen zogen eine Show ab. Am wenigsten erhob der Dokumentarist den Anspruch, dass er den geistigen Prozess, der bei der Entstehung eines Werkes vollzogen wird, auf irgendeiner Weise festhalten kann. Für ihn war es trotzdem immer wieder faszinierend, einen Künstler bei der Arbeit zu filmen.
Wenn Erwin Leiser Musik oder Geräusche als Untermalung benutzte, hatten diese immer eine Funktion zum Bild. Er hatte auch keine Angst, auf Musik und Kamerabewegungen zu verzichten, wenn er damit die Wirkung des Bildes steigern konnte. Das Kunstwerk mußte aber lange genug als ganzes gezeigt werden.
Bei seiner Arbeit mit Künstlern benutzte Leiser niemals ein Drehbuch: wichtig waren vor allem die Fragen, die er stellen, und die Bilder, die er zeigen wollte. An dem jeweiligen Projekt nahmen meistens neben ihm und dem Künstler, ein Kameramann und ein Toningenieur teil. Öfters war auch seine Frau Vera dabei, die ihm bei der Regiearbeit half. Während dem Dreh wurde in der Regel kaum gesprochen, da vorher alles abgesprochen war. Außerdem arbeitete Leiser fast ausnahmslos mit den gleichen Kameramännern, die genau wußten, was er wollte und das sahen, was er sah. Aufgenommen wurde immer auf Synchronton, auch wenn nicht gesprochen wurde. Wenn z.B. im Hintergrund Autos, die U-Bahn oder eine Waschmaschine zu hören waren, gehörte das einfach zu der Wirklichkeit, in dem der Künstler arbeitete.
Bei seiner Auswahl der zu portraitierenden Künstler agierte Leiser intuitiv. Im nachhinein stellte er jedoch ein gewisses Muster fest:„Ich bin ein Berliner mit einem schwedischen Paßund lebein Zürich. Es ist sicher kein Zufall, daßviele der von mir portraitierten Künstler ebenfallsWanderer zwischen verschiedenen Ländern sind. (...) Hans Richter ist ein Deutscher, der nach1933 in der Schweiz und den USA lebte. Fernando Botero ist ein Kolumbianer, der in Paris, New York und Pietrasanta wohnt und arbeitet.“31
6.3„Die Welt des Fernando Botero“
Das schwierigste bei allen seinen Filmen mit Künstlern war die Finanzierung. Die für Kultur zuständigen Abteilungsleiter im Fernsehen waren nicht an Kunst interessiert und hielten das Künstlerportrait für eine unnötige Gattung, die das Publikum nicht interessieren würde. Leiser blieb aber immer hartnäckig und ließ sich von einzelnen Meinungen nicht entmutigen. Genauso gestaltete sich das ganze beim geplanten Portrait mit Fernando Botero: niemand war für das Projekt zu begeistern. Zwar sicherte der Ressortleiter des Schweizer Fernsehen Leiser zu einen Produktionsbeitrag zu leisten, aber nur unter der Voraussetzung, dass er auch einen deutschen Partner finden würde. Der Dokumentarist verbrachte lange Zeit damit, Ressortleiter verschiedener Fernsehanstalten zu kontaktieren, stieß aber immer auf Beton. Schlußendlich hatte er Glück: der Zuständige beim ZDF akzeptierte das Projekt, weil ihn Botero an Rubens erinnerte und es gerade ein Rubens-Jubiläumsjahr gab.
Erwin Leiser wurde zum ersten Mal in einer Villa eines hohen UNO-Beamten in Peru auf Fernando Botero aufmerksam. Während er auf den Gastgeber wartete, entdeckte er ein großes Ölgemälde. Sein Gastgeber machte ihn später auf andere Bilder Boteros aufmerksam, die in einem Nebenzimmer hingen. Leiser war sofort von dieser Kunst gefangen und begann Bilder von Botero zu suchen. Er schrieb ihm und besuchte ihn in seinem Ateilier in Paris. Der Dokumentarist begeisterte sich vor allem an den Themen Boteros, die immer aus seiner lateinamerikanischen Heimat stammten.
Der Film „Die Welt des Fernando Botero“ ist ein Querschnitt durch sein Werk als Maler. Die Kamera bleibt während des ganzen Filmes im Studio und konzentriert sich auf den zeichnenden Botero und seinen Bildern. Der Zuschauer wird so an die Optik Boteros gewöhnt. Die Dreharbeiten, die im November 1975 in der Ausstellung Boteros bei Marlborough in New York begannen, gestalteten sich schnell und konzentriert. Leiser zeigt Botero vor dem „Selbstportrait mit Ludwig XIV“ und läßt ihn um sein Bild „Die Botero-Ausstellung“ herumgehen. Dabei spricht der Künstler über seine Arbeit. Außerdem wird gezeigt, wie Botero mit einer schnellen Bleistiftzeichnung eine Idee festhält, aus der später ein Kunstwerk entstehen soll. Für Leiser war in diesem Entwurf alles enthalten, was er seinem Publikum sagen wollte.
Anfangs war Botero nicht wirklich davon begeistert, dass er selbst im Film vorkommen sollte. Er machte den Vorschlag, ihn durch jemanden zu ersetzen, der dem Klischee „Botero“ entsprechen würde. Leiser ging darauf zwar nicht ein, wurde aber zu einer neuen Idee inspiriert: am Anfang versucht er den Zuschauer zu verwirren, indem der Film mit einer Spielszene beginnt, in der ein
Zwerg hinter der Staffelei Boteros sitzt und ein „Riesenweib“ abmalt.„Wie auf vielen Bildern
Boteros lagen Zigarettenstummelüber den Fußboden verstreut (...), von irgendwoher kam eineHand (meine), und die Stimme des unsichtbaren echten Botero. Den Zwerg spielte Pieral, dervor allem aus Bunuel-Filmen bekannt ist. In einem Nachtlokal hatte ich ihn als Amor gesehen, er richtete jetzt in Boteros Atelier seine Pfeile auf einen blonden Transvestiten, der aus einem grünen Kleidchen quoll. Jetzt stellten die beiden‚Botero und sein Modell‘dar.“32Den Übergang zum wirklichen Botero schaffte Leiser zufällig: Botero nahm Pieral den Pinsel aus der Hand und malte weiter. Botero merkte nicht, dass das Filmteam weiterdrehte. Am Schneidetisch wurden die beiden Szenen später mit einem Sprechertext verknüpft, der auch auf die Zwerge Bezug nahm, die Botero gemalt hat.
Der Film beginnt und endet mit einem Selbstportrait Boteros und wichtigen Aussagen über die Elemente seiner Kunst:„Die Selbstportraits sind immer Satirenüber mich. Ich habe niemals ein Selbstportrait imüblichen Sinne gemalt.(...) Meine Malerei ist voller Prototypen von gewissen Personen, die wie Klischees wirken, aber nur ein Künstler kann ihnen Leben geben. In Wirklichkeit sind diese Klischees fast immer wahrer als die Wirklichkeit, oder sie enthalten eine reichere Wirklichkeit.“33
Leiser drehte zwei weitere Filme mit Botero. In „Botero als Bildhauer“ (1982) verfolgt die Kamera die Entstehung einer überlebensgroßen Frauenfigur und in „Boteros Corrida“ (1986) werden die Bilder gezeigt, in denen Botero 1984-86 das Thema „Stierkampf“ auf seine ganz eigene Weise behandelt.
7. Resümee
Erwin Leiser drehte Filme mit und über Menschen: ob mit Künstlern, Opfern oder Täter. Das Menschliche begeisterte ihn genauso wie das Unmenschliche. Er versuchte, in Einzelschicksalen ein kollektiven Geschehen sichtbar zu machen. Der gemeinsame Nenner all seiner Arbeiten lag darin, in einer unmenschlichen Welt die Möglichkeiten des Menschlichen darzustellen. Seine Vergangenheit als Flüchtling des Nationalsozialismus prägten ihn bei seiner Themenwahl dabei sehr. Filmisch ging er kaum Risiken ein, er war kein Draufgänger vom Schlage eines Marcel Ophüls, pflegte vielmehr sein solides Handwerk. So war die Anfangsszene in „Die Welt des Fernando Botero“, in der er den Zuschauer verwirren wollte, eher eine Ausnahme für sein dokumentarisches Schaffen. Seine Filmkarriere spielte sich viel mehr in Archiven ab, in der er aus einer Vielzahl von authentischem Filmmaterial und Bildern seine Filmprojekte vorbereitete und dann schließlich im Schneideraum fertigstellte. So wird er auch immer mit seinen ersten Film „Mein Kampf“ in Erinnerung bleiben, weil er als erster Material verwendete, das teilweise verboten war und für großes Aufsehen sorgte. Außerdem wird er als Pionier für die Aufklärung der Verbrechen des Nazi-Regimes gesehen, der das Medium Film dazu benutzte, ein großes Publikum zu erreichen. Er gab so vielen seiner Kollegen den Ansporn, das „totgeschwiegene“ Thema aufzugreifen und zu vertiefen.
Die in dieser Arbeit dargestellten Filme „Mein Kampf“, „Deutschland erwache!“ und „Die Welt des Fernando Botero“ können nur einen kleinen Einblick in die Arbeit von Erwin Leiser geben. Es war mir nicht möglich, jeglichen Aspekt seines dokumentarischen Schaffens herauszuarbeiten. Das würde ich mit Worten auch nicht schaffen, es ging mir viel mehr darum, eine kurze Einsicht in die „Wirklichkeit“ des Dokumentarfilmers Erwin Leisers zu geben. Für Leiser bedeutete der Dokumentarfilm Kunst: diese bestand aber darin, dass man sie nicht merkt. Ich glaube, das ist ihm ziemlich gut gelungen.
8. Literaturverzeichnis:
Bücher:
- Hattendorf, Manfred, Dokumentarfilm und Authentizität. Ästhetik und Pragmatik einer
Gattung. 1. Aufl. Konstanz, UVK Medien Verlagsgesellschaft mbH, 1994. (Schriften der Close-Up-Reihe aus dem Haus des Dokumentarfilms 4)
- Heller, Heinz-B./Zimmermann, Peter (Hg.): Bilderwelten - Weltenbilder. Dokumentarfilm
und Fernsehen. Marburg, 1990.
- Leiser, Erwin: Mein Kampf. Eine Bilddokumentation der Jahre 1914-45. Weinheim, Beltz,
Athenäum, 1995.
- Leiser, Erwin: Deutschland erwache! Propaganda im Film des Dritten Reiches. Reinbek bei
Hamburg, Rowohlt, 1968.
- Leiser, Erwin: Gott hat kein Kleingeld. Erinnerungen. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1993.
- Leiser, Erwin: Auf der Suche nach Wirklichkeit. Meine Filme 1960-1996. Konstanz, UVK
Medien Verlagsgesellschaft mbH, 1996. (Schriften der Close-Up-Reihe aus dem Haus des Dokumentarfilms 7)
- Leiser, Erwin: Nahaufnahmen. Begegnungen mit Künstlern unserer Zeit. Reinbek bei
Hamburg, Rowohlt, 1990.
- Meißner, Guido: Mein Kampf. Materialien zu einem Film von Erwin Leiser. Duisburg, Atlas
Film + av, 1988.
- Regel, Helmut: Die Authentizität dokumentarischer Filmaufnahmen. Methoden einer
kritischen Prüfung. In: Möglichkeiten des Dokumentarfilms. Hg. V. den Westdeutschen Kurzfilmtagen im Auftrag der Stadt Oberhausen 1979, S. 165-176.
Filme/Video:
- Leiser, Erwin: Deutschland erwache! Propaganda im Film des Dritten Reiches. Absolut Medien, 1996. (35 mm, s/w, 90 Min., 1968)
- Leiser, Erwin: Mein Kampf. Universum Film, 1996. (35 mm, s/w, 122 Min., Schweden 1959/60)
Zeitschriften:
- Leiser, Erwin: Szenen des Unfaßbaren: Der Holocaust im Film. In: In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Magazin, H. 777, 20.01.1995, S. 16.
- Filmdienst, Nr. 32, 1960, S. 259.
- Filmkritik, Nr. 8, 1960, S. 230.
- Der Spiegel, Nr. 32, 1960, S. 57.
Internetquellen:
http://mitglied.lycos.de/thomfried/erwin_leiser.htm vom 27.11.02
[...]
1Leiser, Erwin: Mein Kampf, 1995, S.5.
2http://mitglied.lycos.de/thomfried/erwin_leiser.htm vom 27.11.02
3http://mitglied.lycos.de/thomfried/erwin_leiser.htm vom 27.11.02
4Leiser, Erwin: Szenen des Unfaßbaren: Der Holocaust im Film. In: In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Magazin, H. 777,
20.01. 1995, S. 16.
5Leiser, Erwin: Auf der Suche nach Wirklichkeit, 1996, S. 21.
6Leiser, 1996, S. 22.
7Leiser, 1996, S. 22.
8Leiser, 1996, S. 28.
9Leiser, 1995, S. 8-9.
10Vgl. Regel, Helmut: Die Authentizität dokumentarischer Aufnahmen, 1979, S. 165-176.
11Meißner, Guido: Mein Kampf, 1988, S. 35.
12Vgl. Leiser, Erwin: Gott hat kein Kleingeld, 1993, S. 149.
13Leiser, 1993, S. 149.
14Leiser, Erwin: Mein Kampf (Film), 1996.
15Leiser: Mein Kampf (Film), 1996.
16Leiser, 1995, S. 3.
17Meißner, 1988, S. 9.
18Leiser, 1995, S. 6.
19Leiser, Mein Kampf (Film), 1996.
20Meißner, 1988, S. 42.
21In: Filmkritik, 1960, Nr. 8, S. 230.
22In: Filmdienst, 1960, Nr. 32, S. 259.
23In: Filmkritik, 1960, Nr. 8, S. 230.
24In: Der Spiegel, 1960, Nr. 32, S. 57.
25Leiser, 1996, S. 35.
26Leiser, 1996, S. 54-55.
27Leiser, Erwin: Deutschland erwache!, 1968, S. 15.
28Leiser, 1968, S. 13.
29Leiser, 1968, S. 12.
30Leiser, 1996, S. 125.
31Leiser, 1996, S. 128.
32Leiser, 1996, S. 136-137.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dieser Seminararbeit über Erwin Leiser?
Diese Seminararbeit widmet sich dem Lebenswerk Erwin Leisers, insbesondere seinem Beitrag zur Entwicklung des Dokumentarfilms in der Nachkriegszeit. Die Arbeit analysiert seine Filme, Hintergründe seiner Werke und die Zusammenhänge zwischen seinem Leben und seiner Arbeit. Es werden die Filme „Mein Kampf“, „Deutschland erwache!“ und „Die Welt des Fernando Botero“ näher betrachtet, um Leisers persönliche Handschrift zu erarbeiten. Die Arbeit befasst sich auch mit dem Genre des Dokumentarfilms und Leisers Haltung zu dessen Möglichkeiten und Grenzen.
Wer war Erwin Leiser?
Erwin Leiser (1923-1996) war ein Filmemacher, Buchautor und Publizist. Er ist bekannt für seine Dokumentarfilme über das Dritte Reich, insbesondere für „Mein Kampf“. Leiser emigrierte 1938 nach Schweden und kehrte später in die Filmwelt zurück, wo er sich als einer der wichtigsten Dokumentarfilmer der Nachkriegszeit etablierte.
Was sind die Hauptthemen in Leisers Film „Mein Kampf“?
Der Film „Mein Kampf“ behandelt den Aufstieg und Fall des Hitler-Systems. Leiser stellt die Person Adolf Hitler in Zusammenhang mit der politischen Entwicklung von 1914 bis 1945. Der Fokus liegt auf dem Leiden der Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere im Warschauer Ghetto und den Konzentrationslagern. Der Film kontrastiert die Wahrheit mit der Propaganda des Dritten Reiches.
Was ist ein Kompilationsfilm und welche Rolle spielt er in Leisers Arbeit?
Ein Kompilationsfilm montiert fremdes, historisches Material, oft in Kombination mit neu gedrehtem Material. Leiser nutzte dieses Format, um aus zeitgenössischen Wochenschauen und Spielfilmen Ausschnitte auszuwählen und zusammenzufügen. Ein bekanntes Beispiel ist sein Film "Mein Kampf".
Was behandelt Leisers Film „Deutschland erwache!“?
„Deutschland erwache!“ ist eine Montage von Ausschnitten aus Propagandafilmen des Nationalsozialismus. Der Film legt die Funktion und das Instrumentarium direkter und indirekter Propaganda im Film des Dritten Reiches offen und verdeutlicht die Widersprüche zwischen Filmwelt und Realität.
Worin besteht die Besonderheit von Leisers Filmen „mit“ Künstlern?
In seinen Filmen „mit“ Künstlern versucht Leiser die Möglichkeit des Menschlichen in einer Welt des Unmenschlichen aufzuzeigen. Er zeigt den schöpferischen Akt bei der Entstehung eines Kunstwerkes als einen Höhepunkt des Positiven, zu dem der Mensch fähig ist. Er porträtiert Künstler wie Fernando Botero und versucht, deren Welt und Arbeitsweise zu verstehen und darzustellen.
Wie gestaltete sich Leisers Arbeit mit Fernando Botero?
Leisers Film „Die Welt des Fernando Botero“ ist ein Querschnitt durch das Werk des Malers. Die Kamera konzentriert sich auf Botero bei der Arbeit in seinem Studio und auf seine Bilder. Der Film zeigt Botero vor seinen Werken und lässt ihn über seine Kunst sprechen. Leiser verwendet auch spielerische Elemente, um den Zuschauer zu verwirren und die Vielschichtigkeit von Boterers Kunst darzustellen.
Was sind die wichtigsten Aussagen von Erwin Leiser über den Dokumentarfilm?
Leiser glaubte, dass der Dokumentarfilm keine objektive Darstellung der Wirklichkeit ist, sondern eine Interpretation des Filmemachers. Er sah sich als Produzent einer neuen Wirklichkeit und als Mittler zwischen Realität und Menschheit. Für ihn war der Dokumentarfilm eine Kunstform, bei der die handwerkliche Geschicklichkeit des Filmemachers und die Zusammenarbeit mit den Menschen vor der Kamera von großer Bedeutung sind.
Welche Rolle spielten Leisers persönliche Erfahrungen in seinen Filmen?
Leisers Erfahrungen als jüdischer Emigrant, der den Terror des Nationalsozialismus miterlebt hat, prägten seine Themenwahl und Herangehensweise an seine Filme stark. Seine Filme über das Dritte Reich waren ein Versuch, die Vergangenheit zu verarbeiten und die Zuschauer über die Gefahren von Totalitarismus und Unmenschlichkeit aufzuklären.
Welche Botschaft wollte Erwin Leiser mit seinen Filmen vermitteln?
Leisers Botschaft war, in einer unmenschlichen Welt die Möglichkeiten des Menschlichen darzustellen. Er wollte die Zuschauer aufrütteln, zum Nachdenken anregen und ihnen die Notwendigkeit von Toleranz, Freiheit und Menschenwürde bewusst machen.
- Quote paper
- Thomas Hanifle (Author), 2002, Erwin Leiser: Leben und Werk, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107526