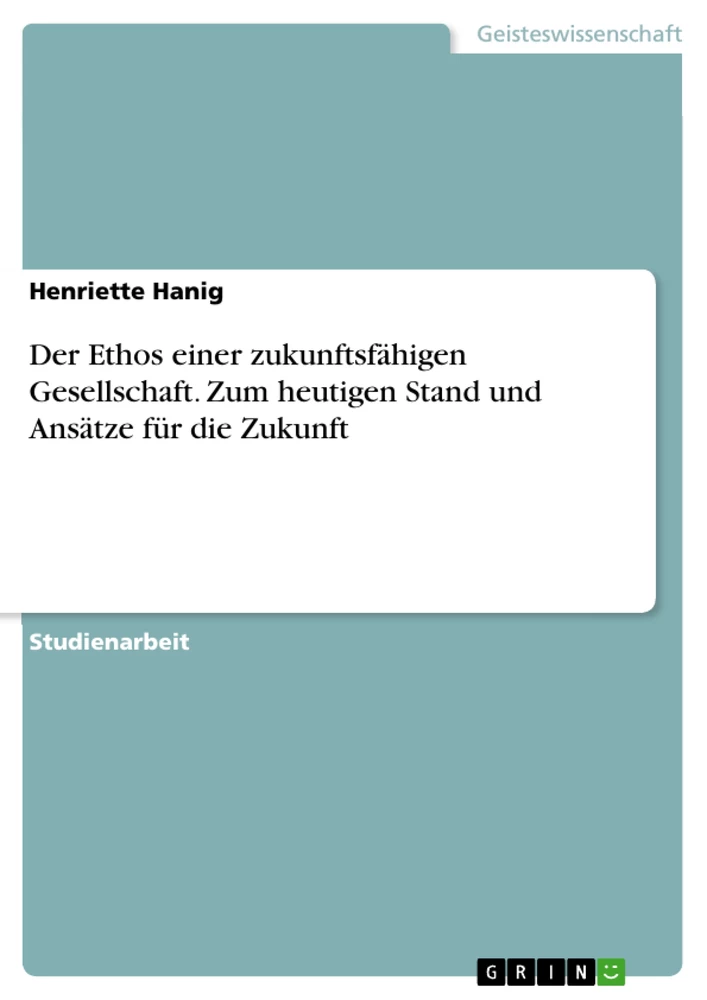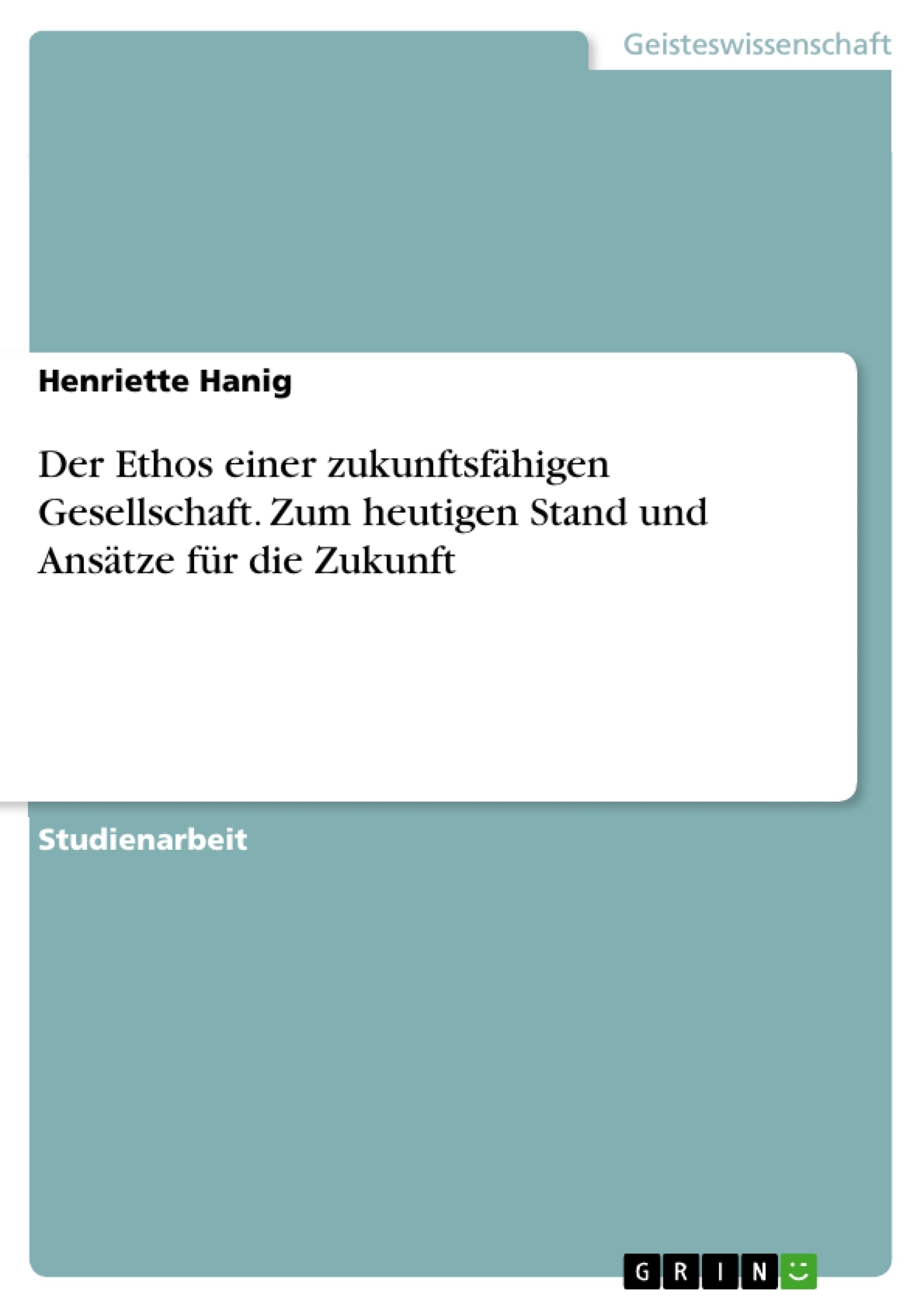Inhaltsverzeichnis
1. Kleiner Prolog
2. Vom Ethos an sich
3. Vom Ethos heute und wie er gebildet wird
3.1. Der Individualismus als höchste Form der Freiheit in unserer Gesellschaft
3.2. Der Globalisierungsprozess in der Weltwirtschaft und seine Auswirkungen
3.3. Die perverse Normalität der großen Unterschiede
3.4. Das Bildungssystem als hemmender Faktor
4. Vom Ethos wie er sein sollte
4.1. Wir brauchen eine weltweite Lösung
4.2. Internationalismus als Lebensart für eine tolerante Welt
4.3. Der Symbolismus als wichtiger Beitrag zum Neuanfang
4.4. Ziviler Ungehorsam – an drei Beispielen erläutert
Lokal – ein Beispiel aus Dresden
Regional – ein Beispiel ausBolivien
Global – ein Beispiel aus Seattle
5. Zusammenfassung und persönliche Konsequenzen
Literaturverzeichnis
1. Kleiner Prolog
Wir schreiben das Jahr 2000 der christlich geprägten Welt und sind damit in der herbeigesehnten aber auch oft befürchteten Zukunft angekommen. Die Welt ist nicht unter- gegangen. Warum sollte sie sich auch nach dem christlichen Kalender und dessen Ängsten richten, wo doch noch ganz andere Arten von Zeit und deren Berechnung auf der Erde existieren. Nein, sie dreht sich noch. Und das mit all ihren Lasten und existenzbedrohenden Problemen.
Ich frage mich, bin ich als angehende Sozialarbeiterin verpflichtet oder gezwungen, die Zukunft positiv zu sehen? Ich tue es nicht, aber ich möchte auch nicht still dasitzen, wenn ich die Chance habe, mit kleinen Schritten Dinge zu verbessern und andere schlimmere vielleicht sogar zu verhindern. Ich glaube an das Gute im einfachen Menschen und an dessen Freiheitsdrang und Gerechtigkeitssinn. Ich glaube daran, dass er die Dinge für sich entscheiden und sich aus seiner Abhängigkeit befreien kann, wenn er sich stark macht. Und ich glaube, dass von ihm die Zukunft dieser Welt abhängt.
Nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, die vorliegende Hausarbeit, die unter dem Überthema „Ethos einer zukunftsfähigen Gesellschaft“ steht, dieser Problematik zu widmen und aufzuzeigen, wo ich die Ansatzpunkte für den Ethos einer Gesellschaft der Zukunft sehe.
2. Vom Ethos an sich
Um vom Ethos einer zukunftsfähigen Gesellschaft zu sprechen, möchte ich als erstes den Begriff an sich erklären. Meyers großem Taschenlexikon kann ich unter dem Stichwort „Ethos“ folgendes entnehmen: Das Wort entstammt dem Griechischen und bedeutet übersetzt soviel wie Gewohnheit, Herkommen, Sitte. In unserem Sprachraum ist es die Umschreibung für eine sittliche Grundhaltung und Gesinnung bzw. die moralische Gesamthaltung eines einzelnen oder einer Gemeinschaft.
Der Ethos auf den einzelnen bezogen, kann also vieles bedeuten, da jeder Mensch aufgrund seiner persönlichen Lebensgeschichte, die ihn geprägt hat, eine andere Grundhaltung in sich trägt. Wenn aber vom Ethos einer Gesellschaft gesprochen wird, so betrifft dies die von einer breiten Masse getragenen Werte und Vorstellungen. Es sind also Dinge, die eine Gesellschaft ausmachen und die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Hier sehe ich die große Gefahr, denn wenn wir unsere heutigen Probleme, Lasten und fatalen Irrtümer an unsere Kinder weitergeben, dann ist die Gesellschaft nicht mehr als ein Krebsgeschwür, das zwar in sich lebt und existieren kann, jedoch seine Umwelt und Lebensgrundlage und damit sich selbst zerstört.
3. Vom Ethos heute und wie er gebildet wird
Wenn ich vom Ethos in unserer heutigen Gesellschaft sprechen will, so muß ich mir darüber im Klaren sein, dass sich mein Betrachtungsfeld weit über die Grenzen Deutschlands hinweg erstrecken muß, denn wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Die Verbreitung der westlichen Kultur in vielen Teilen der Welt bringt eine Annäherung der einst so differierenden Denk- und Lebensweisen mit sich, die aber in ihrer Intensität landesspezifisch variiert. Ich werde mich in meinen Ausführungen meist auf die sogenannten Industrieländer und die USA beziehen, möchte damit aber gleichzeitig die weltweiten Entwicklungen in anderen Ländern assoziiert wissen, die sich im Zuge der Globalisierung an unserer Gesellschaft stark orientieren bzw. sie aus marktwirtschaftlichen Gründen des Überlebens teilweise übernehmen müssen oder auferlegt bekommen. Außerdem möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich nicht alle Bereiche der Gesellschaft im Folgenden abdecken werden kann und deshalb nur auf ein paar ausgesuchte Bereiche eingehen möchte.
3.1. Der Individualismus als höchste Form der Freiheit in unserer Gesellschaft
Während im real existierenden Sozialismus das Kollektiv als sehr wichtig angesehen wurde, wird heute in allen Bereichen der Gesellschaft der Individualismus gepriesen. Die Werbung, welche durch ihre Manipulation unser Leben heute stark prägt, schreibt ihn groß und lebt ihn vor: „ Just do it “ (Nike), „Weil ich es mir wert bin“ (L’Oreal) oder „ Wir machen den Weg frei“ (Volksbanken Raiffeisenbanken). Diese Werbeslogans sind nur ein paar Beispiele für die vielen im Sinne der Vermarktung gemachten Versprechungen und Anregungen, die uns ein Gefühl von höchster Freiheit vermitteln sollen. Ich bin am wichtigsten und meine Wünsche kann ich mir erfüllen. Nur um für mich das Beste zu bekommen, kann ich mich nicht allzu viel um andere kümmern. Ich würde mich zulange aufhalten und möglicherweise meine große Chance verpassen.
Der Individualismus funktioniert als Gesetz der Marktwirtschaft sehr gut: Nur der Beste gewinnt, also sorge ich zuerst für mich. Image ist das wichtigste, denn mein Auftreten und mein Aussehen bestimmen, wie ich behandelt und respektiert werde. Meine Kleidung verrät den anderen, ob ich gut verdiene oder nicht, also ob ich etwas leisten kann oder nicht. Ich kann also auch mit meinem Äußeren meine eigentlichen Defizite an Persönlichkeit, Geld oder Macht kaschieren. Diese Spielregeln heben die Kaufkraft, auch wenn sie eigentlich nicht in dem Maße vorhanden wäre. Außerdem kann man durch die Erziehung zum Individualismus verhindern, dass sich starke widerständische Tendenzen gegen diese Art von Manipulation oder gar gegen andere bestehende Strukturen bilden. Individualisten tun sich schwer damit, anderen entgegenzukommen oder gar einen gemeinsamen Konsens zu finden. Also trägt das „Ich-Denken“ stark zu einer Spaltung der gesellschaftlichen Schichten bei. Diese Spaltung wird zusätzlich begünstigt durch den sogenannten Fortschritt und technische Neuerungen, die zwar eine Erleichterung der Arbeit und des Lebens versprechen aber gleichzeitig die sozialen Kontakte schrumpfen lassen. Früher stand man z.B. gemeinsam am Lohnbüro, an der Sparkasse oder in manchen Läden an oder traf sich beim Einkauf und so ergab sich Zeit für soziale Kontakte und gemeinsame Besprechungen. Heute jedoch wird vieles elektronisch geregelt und man kommt mit denjenigen, die hinter dieser Arbeit stecken kaum in Berührung. Auch hier sehe ich als Nebenwirkung wieder eine „Vermeidung von zuviel Zusammenrottung zur Vermeidung von Widerstandsbildung“.
Die aufgezeigten unendlichen Möglichkeiten des Individualismus gepaart mit dem Gefühl der großen Freiheit ermuntern viele zur Selbstverwirklichung. Allgemein betrachtet, denke ich, dass dies ein positiver Aspekt ist, jedoch sind auch hier viele negative Faktoren zu verzeichnen. Speziell in Deutschland leben wir im Vergleich zu anderen Ländern sehr dicht gedrängt. Das bedeutet, dass im täglichen Leben viel Rücksicht genommen werden muss, um einander „nicht auf die Füße zu treten“. Die oft angepriesenen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung für jeden, wie z.B. durch Verselbständigung, Firmengründung oder plötzlichen Reichtum durch das Finden und Vermarkten einer Marktlücke in anderer Form, erfordern viel Durchsetzungsvermögen. Zur Not muss man dafür auch einmal „über Leichen gehen“. Der Gedanke daran, das große Geld verdienen zu können, wirkt dabei oft als persönliche Legitimation. Dann spielen Mitmenschen oder die eigene Umwelt nur noch eine kleine oder gar keine Rolle mehr. So wird für den eigenen Profit der Rest der Welt vergessen. Sicher ist das nicht immer so, wenn man aber die Aufmerksamkeit auf größere Konzerne lenkt, nehmen die aufgezählten Faktoren viel größere und meist auch unmenschliche Ausmaße an. So wirkt sich, was im Kleinen anfängt, im Großen noch viel schlimmer aus.
Fazit: Der Ethos dieser Gesellschaft ist stark vom Individualismus geprägt und fördert dadurch egoistische Tendenzen. Da Gemeinschaften jedoch immer vom Zusammenhalt und der Zusammenarbeit ihrer Mitglieder leben, wirkt sich das bei uns sehr stark vorhandene Ich-Denken negativ auf die unsrige Gesellschaft aus.
3.2. Der Globalisierungsprozess in der Weltwirtschaft und seine Auswirkungen
Die Welt zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist vor allem von einer Sache geprägt: der Globalisierung. Der Begriff Globalisierung ist hauptsächlich ein wirtschaftlicher. Er beschreibt einen Prozess der weltweiten Liberalisierung und Ausweitung der Märkte, der Ausbreitung der sogenannten westlichen Kultur und der Bildung einer neuen Weltordnung, die hauptsächlich an der ökonomischen und politischen Vormachtstellung der USA festgemacht wird. Damit einher geht die organisierte Ausbeutung und Unterdrückung der indigenen Völker der Welt bzw. derer, die Widerstand gegen diese Ordnung leisten. Des Weiteren ist eine konform zum mitunter gnadenlosen Profit- und Investitionsdenken ansteigende Verschmutzung und Zerstörung der Umwelt und unserer Ressourcen zu verzeichnen, die immer und zuerst auch die in solchen Gegenden ansässigen, meist indigenen Völker, treffen. Als Beispiel seien hier nur die indianischen Bewohner verschiedenster Regenwaldgebiete genannt, deren Heimat vielerorts bedroht ist von Erdölgesellschaften oder einfach vom Raubbau der für uns lebenswichtigen Wälder. Auch das in Nigeria lebende Volk der Ogoni fiel einem regelrechten Holocaust zum Opfer, als sie nicht von ihrem Land weichen wollten, auf dem SHELL Erdölbohrungen vornehmen lassen wollte und dies später auch tat. Die weltweite Öffnung der Märkte, die Schaffung neuer Möglichkeiten für gesteigerte Absätze und beispielsweise die Errichtung von Freihandelszonen, die ein zollfreies und gering versteuertes Handeln möglich machen, mögen weltweit für Investoren und Konzerne positiv erscheinen, jedoch bringen sie für die Mehrheit der Menschen eher Nachteile.
Nehmen wir ein lokales Beispiel: Während in Borthen bei Dresden die einst riesigen Apfelplantagen abgeholzt werden, da sie nicht mehr rentabel sind, werden gleichzeitig Äpfel aus Chile eingeführt, da diese viel preiswerter sind. Hier muss ich mich fragen, ob das seine Richtigkeit hat. Die durch den großen Umweg erzeugten zusätzlichen Abgase sind Gift für die Umwelt. Sie bedeuten natürlich zusätzliche Einnahmen für die an diesem Handel beteiligten Konzerne aber auch einen Lohn für die Erntenden, der weit unter unseren Vorstellungen von Mindestlohn liegt. Dadurch, dass es in Deutschland die weltweit höchsten Lohnnebenkosten und die geringste Pro-Kopf-Jahresarbeitszeit (vgl. Windfuhr, 1995, „Zum Beispiel Welthandel“, S.10) gibt, können hiesige Arbeitskräfte nicht mit den Billigarbeitskräften der Entwicklungsländer konkurrieren. Bei uns steigt also die Arbeitslosigkeit und anderswo sinken die sowieso schon niedrigen Löhne noch mehr. Alles im Namen des globalen Wettbewerbs. Nur der, der das beste und billigste bietet, kann gewinnen. Und auch hier, wo wir uns schon auf der nicht mehr transparenten globalen Ebene befinden, wird für Geld und Gewinn wieder über Leichen gegangen. Allerdings sind auf dieser Ebene die Toten auch nachweisbar. Die Globalisierung ist das Spielfeld der internationalen Konzerne und ihrer Mittelsmänner.
Doch Globalisierung bringt auch positive Aspekte mit sich. So ist die weltweite Vernetzung von Daten und Medien auch von Vorteil für diejenigen, die sich gegen eine solche Raubtiergesellschaft verbünden wollen.
Am 01.01.1994 erklärten beispielsweise die Zapatisten - eine große Vereinigung mexikanischer Indianer, die, hauptsächlich im Bundesstaat Chiapas leben und sich an ihrem Vorbild Emilio Zapata, einem 1917 erschossenen mexikanischen Revolutionär, orientieren - ihrer Regierung und deren neoliberalistischem Kurs den Krieg. Sie besaßen nicht viel und hatten dadurch auch nicht viel zu verlieren. Aber sie machten und machen sich die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, hauptsächlich das Internet, zunutze und erreichen dadurch Massen. Oft ist zu lesen und zu hören, dass mit den Zapatisten eine neue Art des Widerstandes gegen die ausbeuterische Weltordnung anfing.
Diese neue Weltordnung wird vom „Gendarm USA“ kontrolliert und jedes Land, das sich nicht nach diesen Vorgaben richten will, hat mit Sanktionen zu rechnen. Da ist zum Beispiel das kleine Kuba, das einen anderen Weg gehen will. Seit mehr als 35 Jahren legen die Vereinigten Staaten von Amerika dafür Sanktionen auf Kuba, versuchen mittels verschiedener Sabotageakte die sowieso angegriffene Infrastruktur des Inselstaates zu zerstören und legen sogar per Gesetz fest, dass Hilfe von anderen Staaten oder Firmen für Kuba ebenfalls bestraft wird.
Durch Demonstrationen ihrer Macht versuchen die Vereinigten Staaten weltweit einzuschüchtern, um ihre Vormachtstellung zu sichern, dabei werden mittels Politik Wirtschaftsinteressen durchgesetzt. Der von März bis Juni 1999 auf die Republik Jugoslawien ausgeübte Krieg, diente wirtschaftlichen Interessen, wie der Aufwertung des Dollars und der Abwertung des EURO, sowie der über die Kriegsdiskussion erfolgten Spaltung und damit Schwächung der Europäischen Union, die sich im Laufe der Zeit zu einer realen Konkurrenz entpuppt hatte. Im Namen der Erhaltung der Menschenrechte der Kosovo-Albaner wurden die Republik Jugoslawien zerbombt und jugoslawische Zivilisten getötet. Ganz nebenbei ist durch das im Kosovo entstandene Protektorat eine strategisch günstige Stellung der USA gegen Russland entstanden. Es ist in meinen Augen eine neue militärische Weltordnung, die den Kampf um Ressourcen und Märkte fördert und kontrolliert. In Afrika lodern zur Zeit 19 Kriege. Es ist nicht verwunderlich zu sehen, dass davon 13 Kriege nach dem Zusammenbruch der alten „Drei-Welten-Welt“ entstanden sind. Man kann sagen, dass der „Kalte Krieg“ durch einen „Heissen Frieden“ abgelöst wurde (vgl. Mayor und Bindé, „Eine bessere oder glücklichere Welt?“ in Granma internacional, 04/2000). Die Globalisierung, die speziell die westlichen Kulturen weltweit verbreitet und damit andere Lebensweisen zerstört, hat den Ethos, der heute in vielen, aber glücklicher Weise nicht allen Gebieten dieser Erde das Denken bestimmt, stark geprägt. Auch dort, wo es wenig zu Essen gibt, existiert doch immer noch das Fernsehen. So wird durch die Fernseher die Kultur der Industrienationen in die Millionen „Wohnzimmer“ der Armen getragen und eine „McDonaldisierung“ (vgl. Pater, 1994, „Zum Beispiel McDonald’s“, S.49) der Welt vorgenommen. Wem all diese Beispiele nicht genügen, der halte sich nur die amtierende Weltsprache vor Augen. Die Sprache einer ehemaligen und noch nicht toten Kolonialmacht gilt vielerorts als Allgemeinwissen. Englisch wird von vielen selbstverständlich als weltweite Kommunikationsgarantie angesehen, was andere, kleinere Völker zur Anpassung zwingt oder sie „den Anschluß verpassen“ läßt. Auch so kann eine gewisse Vormachtstellung allein durch sprachliche Mittel gehalten werden.
Fazit: Die durch die Globalisierung geprägte neoliberalistische Weltordnung baut hauptsächlich auf wirtschaftliche Interessen einer reichen Minderheit und die dadurch entstehende und sich ausbreitende Abhängigkeit und Verelendung einer armen Mehrheit auf. Dabei spielen der Wirtschaftsgigant USA und die Verbreitung des Ethos der westlichen Kulturen die entscheidende Rolle. Der sich global ausbreitende gnadenlose Wettbewerb bringt die Zerstörung von Menschen, deren Kulturen und der Natur mit sich und gefährdet somit alle. Gleichzeitig globalisiert sich der Widerstand gegen diese Realität und versucht, einen ganz eigenen Ethos zu schaffen.
3.3. Die perverse Normalität der großen Unterschiede
Die kapitalistische Gesellschaft ist geprägt von der Vielfalt der unterschiedlichen Lebensstandards, die nebeneinander in ihr existieren können. Dabei bilden die Menschen mit den meisten Besitztümern eine kleine Minderheit und die, die wenig besitzen die Mehrheit. Natürlich muss hier noch unterschieden werden zwischen den Ländern Westeuropas sowie einigen anderen Industrienationen und dem Rest der Welt. Während z.B. in Deutschland eine relativ kleine Schicht als für uns arm zu bezeichnen ist, gibt es eine große Mittelschicht mit einem für uns normalen Lebensniveau und eine kleine Minderheit mit viel Besitz. Trotzdem vergrößert sich die arme Schicht stetig. In Ländern der sogenannten 3. Welt sieht das anders aus. Es existiert ebenfalls eine kleine Minderheit, die über einen Großteil der Reichtümer verfügt, dafür gibt es aber eine verschwindend geringe Mittelschicht und eine Masse an Armen. Am Rande sei hier vermerkt, dass die 3 reichsten Männer der Welt mehr besitzen als das Bruttosozialprodukt der ärmsten 48 (!) Länder der Welt beträgt (vgl. Wonne, in Sax 05/2000, S.5).
Natürlich kann so eine Weltordnung nur aufrecht erhalten werden, wenn man die reichen Länder mit sogenannten Demokratien besänftigt, in denen diejenigen, die ein anderes System wollen zwar demokratisch wählen, aber niemals gewinnen können und indem man die Armen der armen Länder, die genug sind, um ein System zu stürzen mit Repressionen einschüchtert und mit Diktaturen am Boden hält. Wächst man in eine solche Gesellschaft hinein, so nimmt man die Umstände erst einmal als gegeben hin. Diejenigen, die sie in Frage stellen, sind leider immer zu wenige. So ist die Realität in Deutschland Normalität, das heißt, das Gegebene ist für die meisten normal und „man kann es ja sowieso nicht ändern“.
Mitten in einer solchen Realität, muss manchmal eine „allgemeine Wachrüttelung“ erfolgen. Als Beispiel möchte ich hier einen Artikel anführen, der in der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung vom 01./02. April 2000 erschienen war: „Obdachlose als Lobbyisten – Wohnungslose stürmen Foyer eines Berliner Luxus-Hotels“. Es wurde von einer Protestaktion durch Wohnungslose erzählt, die aus Protest gegen die Schließung von Berliner Notunterkünften und Nachtasylen unter dem Motto „Es sind noch Betten frei“ das Kempinski-Hotel stürmten. Mit Plakaten und Sirenen machten sie auf sich und ihre Lage aufmerksam. Sie forderten „Keine Hütten mehr – Paläste für alle“ bis die Polizei sie aus dem Hotel drängte. Das Hotel, so der Artikel, wolle auf Strafanzeige verzichten.
War es das schlechte Gewissen der (zuviel) Besitzenden? Wurde hier nicht einfach nur etwas öffentlich gemacht, was ganz offensichtlich nicht zusammenpaßt? Wie normal sind derart perverse Unterschiede in einer Stadt?
Fazit: Der Ethos in unserer Gesellschaft ist stark von einer Akzeptanz der großen und meist ungerechten Unterschiede zwischen den Menschen und ihren Besitztümern geprägt. Die Demokratie wirkt hierbei als besänftigendes Mittel für alljene, „denen es immer noch zu gut geht“. Widerstand wird somit auf kleiner Flamme gehalten und kontrollierbar gemacht.
3.4. Das Bildungssystem als hemmender Faktor
Das Bildungssystem eines Landes sagt viel darüber aus, welche Zustände in ihm herrschen. Es vermittelt den jüngsten einer Gesellschaft schon sein Gedankengut und prägt dadurch den vorherrschenden Ethos entscheidend mit. Nimmt man das Bildungssystem in Deutschland einmal unter die Lupe, so kann man einige Mängel feststellen. Sicher wird dafür gesorgt, dass jedes Kind lesen, schreiben, rechnen und in der Regel auch eine gewisse Allgemeinbildung lernt, jedoch wird die Leistungsgesellschaft schon in die Reihen der Jüngsten übertragen. So muss schon früh, meiner Meinung nach zu früh, entschieden werden, welchen Bildungsweg ein Kind einmal einschlagen wird. Um dem Kind die bestmöglichen Chancen für die Zukunft einzuräumen, versuchen viele Eltern, ihr Kind an die höchstmögliche Bildungseinrichtung zu geben. Dadurch entsteht für die Kinder schon im frühen Alter ein Leistungsdruck, ein Zwang und das Gefühl, für Anerkennung und eigenes Bestehen der oder die Beste sein zu müssen. Bildung sollte zur Befähigung eines jeden dienen, sich kundig zu machen, die Welt und ihre Abläufe zu verstehen und die Möglichkeit zu haben, das was ihn interessiert zu vertiefen. Wie wichtig Bildung ist, kann man an Beispielen aus Ländern der sogenannten 3. Welt sehen, wo sie zum Teil ein Luxus ist, den man sich aus Gründen des Überlebens nicht leisten kann. Da ist z.B. die Arbeit auf dem Feld oder die Arbeit der Kinder beim Verkauf wichtiger, da sie ein paar zusätzliche Pfennige einbringt, die Schule jedoch Zeit und Geld kostet. Und dabei wäre diese Bildung genau das Nötigste, um einen Ausstieg aus diesem Elend wenigstens in erreichbare Ferne zu stellen.
Nun soll aber das so bitter errungene Recht eines jeden auf Bildung in Deutschland stark beschnitten werden. Wenn Studiengebühren gezahlt werden müssen oder nur das Einhalten der Regelstudienzeiten ein kostenloses Studium ermöglicht, wird dann Bildung nicht zum Privileg der Besserverdienenden und deren Kinder? Sollte Bildung nicht ein Grundrecht sein und immer und für jeden zugänglich?
Fazit: Bildung ist auf dieser Welt kein Grundrecht und für viele nicht zugänglich. Das trägt dazu bei, dass die Masse der Armen immer „an der kurzen Leine gehalten werden kann“, da sie es sich nicht möglich machen kann, sich aus ihrer Abhängigkeit zu befreien. Anderswo wird darauf hingearbeitet, dass sich eben jene Minderbemittelten durch mangelnde Bildung nicht mehr selbst als solche erkennen und ihre Möglichkeiten des Widerstands möglichst gering gehalten werden. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass Bildung in Schulen und auch in Universitäten die herrschenden Umstände und Denkweisen weiterträgt und damit aufrecht erhält, also einen sehr entscheidenden Faktor für den Ethos einer Gesellschaft bildet.
4. Vom Ethos wie er sein sollte
Der gesamtgesellschaftliche Ethos wird von vielen Faktoren geprägt, die alle wiederum in der Gesellschaft begründet liegen. Die Gesellschaft prägt also die Gesellschaft, prägt also die Gesellschaft, prägt also die Gesellschaft... Wie soll man da Veränderungen schaffen? Das ist alles andere als leicht, darf aber dennoch nicht unversucht bleiben.
Ich denke, dass alles von der Schaffung eines neuen, anderen Bewußtseins im Menschen abhängt - die Schaffung eines neuen Menschen. Das klingt zugegebener Maßen sehr diktatorisch, jedoch existiert dieser Wunsch schon lange und es wurde bereits einige Male versucht, ihn in die Tat umzusetzen, beispielsweise durch die sozialistische Erziehung in der DDR. Dass es auf diese Weise nicht zu realisieren war, bleibt eine Tatsache, aber den Versuch, Menschen durch Menschen zu mehr Bescheidenheit, Solidarität und Gemeinschaftssinn zu bringen, halte ich nach wie vor für ein gutes, vielleicht aber etwas zu utopisches Ziel. Doch Oscar Wilde hatte einst gesagt: „Keine Landkarte ist eines Blickes wert, wenn sie das Land Utopia nicht enthält“. Ich denke, er hat Recht.
Ich möchte im Folgenden auf Möglichkeiten der Schaffung eines neuen Ethos eingehen, werde aber wiederum nur einige Bereiche der Gesellschaft abdecken können.
4.1. Wir brauchen eine weltweite Lösung
Da die Probleme, die uns heute belasten, weltweit auftreten, benötigen wir auch eine weltweite Lösung. Dabei müssen wir uns vier wichtigen Herausforderungen stellen: der Erhaltung des Friedens, der Abschaffung der Armut, die Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung und die Behandlung grenzüberschreitender Probleme mit einem globalen Blick (vgl. Mayor und Bindé, „Eine bessere oder glücklichere Welt?“ in Granma internacional, 04/2000).
Als Grundvoraussetzung dafür muss eine globale, ganzheitliche Sicht der Menschen auf die Erde gefördert werden, um ihnen die Zusammenhänge und unsere Abhängigkeit von einer intakten Umwelt und von friedlichem Zusammenleben aufzuzeigen. Wie kann man so etwas erreichen? Als Schlüssel hierfür sehe ich eine Änderung der Bildungsinhalte in allen Bildungseinrichtungen unserer Gesellschaft. Wenn Kinder mit Themen wie „Eine Welt“, Internationalismus oder Umweltschutz aufwachsen, so ist die Chance, dass sie in Zukunft auch nach diesen Vorstellungen leben werden, groß. Sicher werden solche Themen – besonders der Umweltschutz - auch heute schon in Kindergärten und Schulen behandelt, aber sie kommen meiner Meinung nach zu kurz, um ernsthafte Spuren zu hinterlassen zu können. Außerdem spielen ja noch Faktoren wie z.B. das Vorbildverhalten der Eltern eine große Rolle. Doch wenn diese es nicht vorleben, wie sollen Kinder sich für derlei Themen interessieren, da sie auch in der Schule eine untergeordnete Rolle spielen? Wenn Generationen heranwachsen, die diese Themen als Lebensart verinnerlicht haben, so werden diese wiederum ihren Kindern als Vorbilder dienen. Sicher gibt es noch sehr viele andere Faktoren, die den globalen Gedanken fördern könnten oder von denen er abhängt; in den Inhalten der Grundbildung sehe ich jedoch den wichtigsten.
Fazit: Um weltweite Lösungen zu finden, muss das globale Denken gefördert werden. Hier existiert momentan ein Defizit, welches durch eine Verschiebung der Schwerpunktinhalte der Grundbildung in Kindergärten und Schulen erreicht werden könnte. Um eine nachhaltige Entwicklung zu garantieren, sollte das Motto: „Global denken, lokal handeln“ schon in den ersten Einrichtungen unserer Bildungssysteme einen wichtigen Platz finden. Konkrete Aktionen des Umweltschutzes oder der Solidarität untereinander oder mit Bedürftigen können den Kindern schon früh den Inhalt dieser Lebensart aufzeigen.
4.2. Internationalismus als Lebensart für eine tolerante Welt
Als entscheidenden Teil des Versuchs der Erhaltung der Welt sehe ich die Notwendigkeit, die Toleranz zwischen den Menschen zu fördern. Und auch hier spielt für den Ethos einer zukunftsfähigen Gesellschaft die länderübergreifende Toleranz eine wichtige Rolle. Das Heranführen von Kindern und Jugendlichen an die Gedanken des Internationalismus sind in meinen Augen dabei von entscheidender Bedeutung. Nun stellt sich die Frage, wie man z.B. in den neuen Bundesländern Deutschlands, wo Rechtsradikalismus unter der Jugend oft zum Alltag gehört, die Kinder und Jugendlichen an dieses Thema heranführen kann.
Ich möchte an dieser Stelle ein sozialarbeiterisches Projekt vorstellen, welches in dem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom Samstag/Sonntag dem 1./2. April 2000 „Fußwege statt Jugendarbeit“ beschrieben wurde. In diesem Artikel ist also die Rede von einem Projekt gegen Gewalt, welches im brandenburgischen Milmersdorf von Filippo Smaldino, einem 36-jährigen italienischstämmigen Sozialarbeiter ins Leben gerufen wurde. Er arbeitet in einem Jugendklub, der für viel Geld saniert und 1997 für die Jugendlichen der Umgebung eröffnet wurde. Smaldino wurde eingestellt, um die jungen Menschen aus dem Umkreis von der Nazi-Wehrsportgruppe aus dem Wald zu locken, um sie wegzuholen von den Orten, an denen sie „rumlungern“ und trinken und um ihnen die Aggressionen, die in dieser toten Gegend mit der horrend hohen Arbeitslosigkeit gefördert werden, ein Stück zu nehmen. Auch der Rechtsradikalismus ist hoch in Milmersdorf und Umgebung, so hat Filippo Smaldino mit viel Aufwand einen Bus, Sponsoren- und Stiftungsgelder und eine kleine Weltreise organisiert. Den Bus haben die Jugendlichen selber „auf Touren gebracht“ und so sind 21 von ihnen im Herbst 1999 ins indische Kalkutta gefahren und haben in einem Slum einen Steg gebaut, um auf dem sumpfigen Boden für die Bewohner ein besseres Laufen zu ermöglichen. Inzwischen war sogar der Bürgermeister von Kalkutta in Milmersdorf und indische Studenten bei Familien aus dem Ort zu Gast. Auf die Frage was ihm diese Reise gebracht habe, meinte einer der Jugendlichen: „Weltoffenheit“. Auf diese Art hat es Smaldino geschafft, den jungen Menschen einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen, den sie von zu Hause nie bekommen hätten. Vielleicht hat er ja den Grundstein für mehr Toleranz, globaleres Denken oder mehr Offenheit gegenüber anderen Kulturen gelegt? Fakt ist, dass diesem Jugendklub und seinen Projekten der Geldhahn zugedreht werden wird, da die Kommune angeblich kein Geld hätte bzw. die vorhandenen Finanzen lieber in die Infrastruktur, genauer gesagt in den Bau von Fußwegen, investieren wolle.
Das Projekt von Milmersdorf zeigt mir, dass es erfolgreiche Ansätze gibt, den Jugendlichen eine globalere Sicht auf die Welt zu vermitteln oder ihnen einen Blick über den Tellerrand zu ermöglichen. Die Zukunft dieses Projekts zeigt mir aber auch, dass solche Ansätze nicht ernst genug genommen werden und damit eine große Chance verspielt wird.
Durch die Vermittlung einer globaleren, internationalistischeren Sicht kann man Kindern und Jugendlichen zeigen, dass nur „das Ziehen von allen an einem Strang“ unsere Zukunft positiv bestimmen und sichern kann. Dabei ist der Internationalismus, als Teil der Erziehung, als Chance der Globalisierung zur Zusammenarbeit und Vernetzung zu verstehen. Vielleicht gelingt uns dann ja auch die Schaffung einer interkulturellen Gesellschaft, in der aggressive, rassistische Tendenzen wie sie heute existieren, keinen Nährboden mehr finden können?
Fazit: Die Erhaltung der Erde für den Menschen kann nur durch weltweites Verständnis und globale Zusammenarbeit erfolgreich sein. Deshalb muss Internationalismus in meinen Augen Teil der Erziehung sein. Kindern und Jugendlichen sollten Blicke über den Tellerrand der eigenen Kultur und des eigenen Lebens nicht nur als Möglichkeit gegeben sondern geradezu zur Pflicht gemacht werden. Hierbei stelle ich mir zum Beispiel die Einführung eines Auslandsjahres während der Schulzeit vor, welches für Familien aller Schichten bezahlbar sein sollte bzw. großzügig unterstützt wird.
4.3. Der Symbolismus als wichtiger Beitrag zum Neuanfang
Der Mensch ist im Allgemeinen empfänglich für Symbole als Zeichen für bestimmte Lebensarten, Denkweisen oder Gefühlswelten. Als Beispiel möchte ich nur die Liebe zu verschiedenen Musikarten nennen, die für den Hörenden oft eine Lebensart oder Kultur darstellen und vertreten, mit der er sich verbunden oder durch die er sich an etwas erinnert fühlt. Ein anderes Beispiel wäre die berühmte Abbildung des Kopfes von Ernesto Che Guevara, die in vielen eine gewisse Revolutionsromantik weckt. Solcherlei symbolische Handlungen oder Zeichen können natürlich im guten wie auch im schlechten Sinne verwendet und zur Manipulation genutzt werden. Doch gerade hier könnte man ansetzen, um den Neuanfang für ein anderes Bewußtsein zu schaffen, welches globaler, internationaler, friedlicher und gerechter ist.
Als geschichtliches Beispiel möchte ich hier die symbolischen „Tausche Maschinenpistole gegen Nähmaschine-Aktionen“ nennen, die in Mosambik Anfang der 90er Jahre zur Beendigung des jahrelang andauernden Bürgerkrieges durchgeführt wurde. Die Abgabe des Kriegsgerätes Maschinengewehr bedeutete die symbolische persönliche Beteiligung an der Beendigung des Krieges, die Nähmaschine hingegen bedeutete den Neuanfang – etwas menschliches, was zu rein menschlichen, humanen Zwecken, nämlich zur Bekleidung, diente. Vielleicht fühlten sich die Menschen dadurch wirklich an einem Kriegsende beteiligt? Vielleicht hat es ihnen wirklich das Fundament für einen Neuanfang gegeben? Vielleicht können symbolische Aktionen wie diese ein neues Bewusstsein schaffen?
Fazit: Veränderungen, Beendigungen und Neuanfänge müssen für Menschen sichtbar sein, um in ihnen auch ein Stück Bewußtsein dafür zu schaffen. Symbolische Aktionen können ein Mittel sein, Prozesse oder Bewegungen in Bilder zu fassen und damit greif- und vorstellbar zu machen.
4.4. Ziviler Ungehorsam - an drei Beispielen erläutert
Ziviler Ungehorsam bedeutet, das sich-dem-Gegebenen-Verweigern, meist also den herrschenden Strukturen und ihrer Autorität oder ihrem Stumpfsinn und ihrer Unmenschlichkeit. Hier sehe ich ein wichtiges Mittel des „kleinen Mannes“ zur Veränderung der herrschenden Zustände zu seinen Gunsten. Ich möchte das an den drei folgenden Beispielen erläutern.
Lokal: Die Verbrauchergemeinschaft Dresden – ein Modell des antikommerziellen Einkaufs
Die Verbrauchergemeinschaft (VG) Dresden ist eine der größten Lebensmittelkooperativen Deutschlands. Sie hat mehr als 1100 Mitglieder und unterhält zwei kleine Läden in Dresden. Die VG ist eine Einkaufsgemeinschaft, die sich dem normalen kommerziellen Einkaufen verweigert. Es existiert ein breites Angebot an allem, was als Lebensmittel, Kosmetika oder anderem nötig ist. Jedoch stammen alle diese Produkte soweit möglich von umliegenden Bauern oder von Betrieben aus der Region bzw. aus dem Fairen Handel/Eine-Welt-Handel. So sollen unnötige Anfahrtswege soweit möglich vermieden und lokale Kleinanbieter unterstützt werden. Die VG-Mitglieder zahlen einen Monatsbeitrag für jedes ihrer Familienmitglieder, hier wird auf Vertrauen gebaut, da keine Kontrolle passiert. Von diesem Geld werden Ladenmiete, Reparatur-, Transport- und andere Kosten gezahlt. Die angebotenen Waren haben ihren Selbstkostenpreis, der natürlich trotzdem höher liegt als der in einem Supermarkt. Wichtiger Bestandteil der VG sind die sozialen Kontakte der Mitglieder untereinander. Es werden dafür gemeinsame Veranstaltungen organisiert bzw. muss jedes Ladenmitglied eine bestimmte Anzahl von Ladendiensten ableisten, um selber einmal der Verkäufer zu sein und für andere Verantwortung zu übernehmen. Alleinstehende Mütter beispielsweise, die für Ladendienste wirklich keine Zeit haben, können einen zusätzlichen kleinen Betrag anstelle des Dienstes zahlen. Die Mitgliedschaft in der VG geschieht meist aus Idealismus. Man will sich dem Kommerz entziehen und aktiv in anderer Form sein, denn auch und gerade Einkaufen verändert die Welt.
Regional: Bolivien – ein aktuelles Beispiel für regionalen Widerstand und zivilen Ungehorsam
Ich möchte für dieses Beispiel auf ein jüngstes Ereignis aus Bolivien eingehen. Im April 2000 sollten im lateinamerikanischen Bolivien im Rahmen eines Strukturan-passungsprogrammes des Internationalen WährungsFonds die staatlichen Wasser-werke an einen US-amerikanischen Konzern verkauft werden. Das sollte eine Er-höhung der Wasserpreise um 35% mit sich bringen. Doch schon vorher war ein Wasseranschluß für viele Familien überhaupt nicht tragbar gewesen, eine Ver-teuerung würde noch mehr Menschen betreffen. Auf diese Bekanntmachung hin kam viel Bewegung ins Land. Es wurden landesweit Straßenblockaden errichtet, Regierungsgebäude, Autos und ein Treibstofflager angezündet und die labile Infrastruktur des Landes außer Kraft gesetzt. Daraufhin rief die Regierung einen 3-monatigen Ausnahmezustand mit nächtlicher Ausgangssperre und Einschränkung von Reisefreiheit und politischer Betätigung aus, doch es konnte ein großer Erfolg verzeichnet werden: die Wasserpreise wurden nicht erhöht.
Global: Seattle – ein Beispiel für den Kampf gegen die bestehende Weltwirtschaftsordnung und ihre Hüter
Im November/ Dezember 1999 sollte in Seattle/USA eine Konferenz der Welthandelsorganisation WTO stattfinden, wo Industrie- und Entwicklungsländer über die Zukunft des Welthandels diskutieren wollten. Monate vorher war im Internet schon ein Bündnis von Organisationen und AktivistInnen entstanden, das weltweit zu Protesten aufrief und die dafür nötigen Fäden in der Hand hielt und verknüpfte. Als es dann endlich soweit war, sahen sich die Verhandlungspartner und die Presse einer breiten Masse von Demonstranten, Protesten und Aktionen gegenüber, die sich gegen bestehende Weltordnung, die Ausbeutung der Südhalbkugel und unserer Umwelt durch die großen Konzerne dieser Welt richteten. In Seattle herrschte für ein paar Tage Ausnahmezustand. Vertreter verschiedenster Industrienationen wurden an der Teilnahme gehindert und die Benutzung der Konferenzräume hinausgezögert. Die in der „Gruppe der 77“ zusammengeschlossenen Entwicklungsländer, die sich durch die ihnen entgegengebrachte Solidarität ermutigt fühlten, machten der EU und der USA viele Vorwürfe ob ihrer Handelspolitik und wehrten sich gegen deren Forderungen. Nachdem sich die 135 Verhandlungspartner weder auf eine Tagesordnung noch auf die konstruktive Weiterführung eines Dialogs einigen konnten, galt die Konferenz als ergebnislos gescheitert. So hatten Tausende von Demonstranten durch gewaltsame und friedliche Aktionen und aufsehenerregende Proteste einen neuen Höhepunkt in der Geschichte des Widerstandes gegen die ausbeuterische Globalisierung erreicht. Das „Forum Umwelt und Entwicklung“ erklärte im Nachhinein, dass „das Herausragende Ereignis dieser Ministertagung die Proteste gewesen seien und dass sie zeigten, dass die Menschen ihre Interessen nicht länger einer undemokratischen Wirtschaftsdiplomatie überlassen wollen“.
Fazit: Ziviler Ungehorsam kann ein gutes Mittel gegen Ungerechtigkeit sein und ist nachweislich an großen und kleinen Erfolgen auf dieser Welt beteiligt. Wenn er andere wachrüttelt oder auf Ungerechtigkeit und Unfaßbares aufmerksam macht, so ist er entscheidend an der Bildung eines Ethos einer gerechteren Welt beteiligt.
5. Zusammenfassung und persönliche Konsequenzen
Es ist schwierig für mich, die vorliegende Hausarbeit noch einmal zusammenzufassen. Ich habe versucht, an einigen Beispielen aufzuzeigen, wo ich Probleme sehe bzw. wie und wo man sie meiner Meinung nach „anpacken“ könnte. Sicher wäre noch viel mehr zu sagen, jedoch reicht eine Hausarbeit dafür nicht aus.
Ich versuche nun aus all dem Gesagten und dem, was mich sonst noch an dieser Problematik bewegt, persönliche Konsequenzen zu ziehen bzw. habe sie schon gezogen. Der Hauptgrund, warum ich ein Studium der Sozialarbeit begann, war, dass sie für mich sehr viel mit gesellschaftlichem und politischem Engagement verbunden war und ich mich auf jeden Fall gesellschaftlich beteiligen wollte und will. Ich versuche, globale Zusammenhänge zu erkennen und mit kleinen Schritten Dinge auf der lokalen Ebene zu ändern und zu verbessern und somit einen Stein ins Rollen zu bringen. Ich versuche, meine Überzeugungen zu leben und damit anderen ein hoffentlich gutes Beispiel zu sein.
Später möchte ich gern im Bereich der Ausländerarbeit oder der Vernetzungsarbeit von z.B. Eine-Welt-Initiativen arbeiten und dort meinen Beitrag zur besseren Verständigung, Toleranz, „Interkultur“ und Gerechtigkeit leisten.
Literaturverzeichnis
Windfuhr, M. (1995), Zum Beispiel Welthandel, Göttingen: Lamuv Verlag GmbH
Pater, S. (1994), Zum Beispiel McDonald’s, Göttingen: Lamuv Verlag GmbH
Evangelisches Missionswerk in Deutschland (Hrsg.) (1997), Weltmission heute. Länderheft 28: Mosambik
Mayor, F., Bindé J. (2000), Eine bessere oder glücklichere Welt?, Granma internacional, 4, 16
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text behandelt den Ethos einer zukunftsfähigen Gesellschaft, wobei die Analyse des gegenwärtigen Ethos, geprägt durch Individualismus, Globalisierung und Ungleichheit, im Vordergrund steht. Es werden auch Lösungsansätze für einen neuen, zukunftsfähigen Ethos diskutiert, der auf globalem Denken, Internationalismus, Symbolismus und zivilem Ungehorsam basiert.
Welche Bereiche der Gesellschaft werden im Hinblick auf den Ethos analysiert?
Der Text analysiert den Einfluss von Individualismus, Globalisierung, wirtschaftlicher Ungleichheit und des Bildungssystems auf den Ethos der heutigen Gesellschaft. Es werden auch Beispiele für zivilen Ungehorsam und alternative Lebensweisen vorgestellt.
Wie wird der Individualismus in der Gesellschaft kritisiert?
Der Individualismus wird als eine treibende Kraft egoistischer Tendenzen in der Gesellschaft kritisiert, die den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft beeinträchtigen. Werbeslogans und die Betonung des persönlichen Erfolgs werden als Mittel zur Förderung des Individualismus dargestellt.
Welche negativen Auswirkungen der Globalisierung werden hervorgehoben?
Der Text kritisiert die Globalisierung für die Ausbeutung von Ressourcen, die Zerstörung von Kulturen, die zunehmende Abhängigkeit der Entwicklungsländer von Industrienationen und die Verbreitung einer "McDonaldisierung" der Welt.
Wie wird das Bildungssystem als hemmender Faktor dargestellt?
Das Bildungssystem wird kritisiert, da es bereits in jungen Jahren Leistungsdruck erzeugt und den Zugang zu Bildung als Privileg behandelt. Es wird auch argumentiert, dass das Bildungssystem die herrschenden Denkweisen perpetuiert und somit den Ethos der Gesellschaft beeinflusst.
Welche Lösungsansätze für einen neuen Ethos werden vorgeschlagen?
Als Lösungsansätze werden eine weltweite Lösung auf Basis von Frieden, Armutsbekämpfung und nachhaltiger Entwicklung, die Förderung von Internationalismus und Toleranz, der Einsatz von Symbolismus zur Schaffung eines neuen Bewusstseins und die Anwendung von zivilem Ungehorsam zur Veränderung ungerechter Zustände vorgeschlagen.
Welche Beispiele für zivilen Ungehorsam werden genannt?
Es werden drei Beispiele für zivilen Ungehorsam genannt: die Verbrauchergemeinschaft Dresden als Modell des antikommerziellen Einkaufs, der Widerstand gegen die Privatisierung der Wasserversorgung in Bolivien und die Proteste gegen die Welthandelsorganisation (WTO) in Seattle.
Was sind die persönlichen Konsequenzen des Autors/der Autorin aus der Analyse?
Der/die Autor/in hat die Konsequenz gezogen, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren, globale Zusammenhänge zu erkennen und auf lokaler Ebene Veränderungen anzustoßen. Er/sie möchte im Bereich der Ausländerarbeit oder der Vernetzung von Eine-Welt-Initiativen tätig werden, um zur besseren Verständigung, Toleranz und Gerechtigkeit beizutragen.
- Citation du texte
- Henriette Hanig (Auteur), 2000, Der Ethos einer zukunftsfähigen Gesellschaft. Zum heutigen Stand und Ansätze für die Zukunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107546