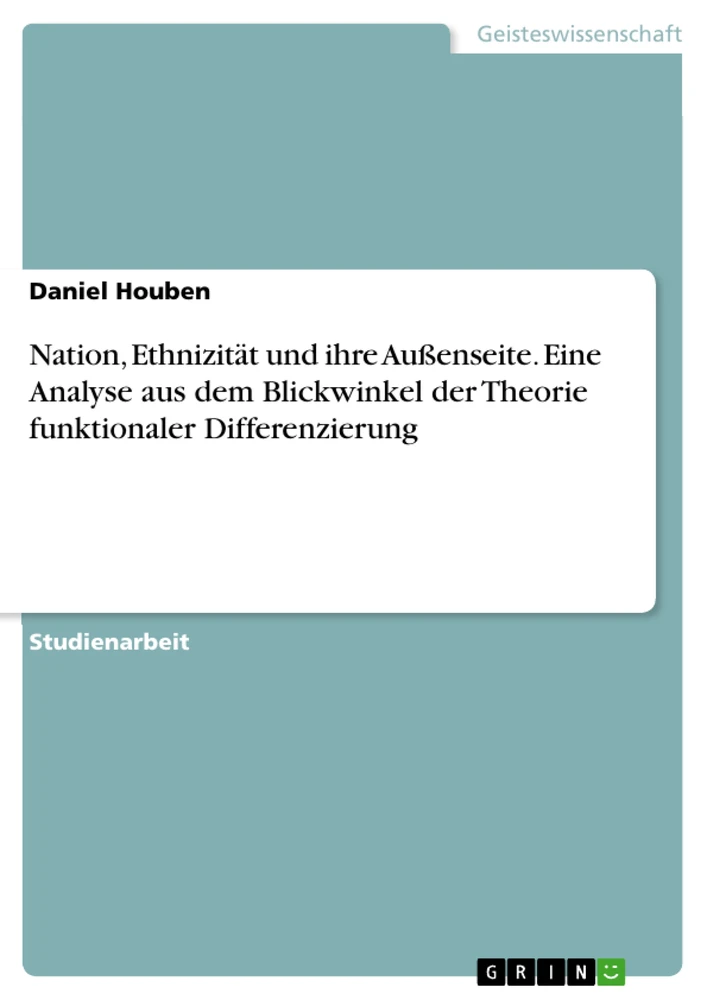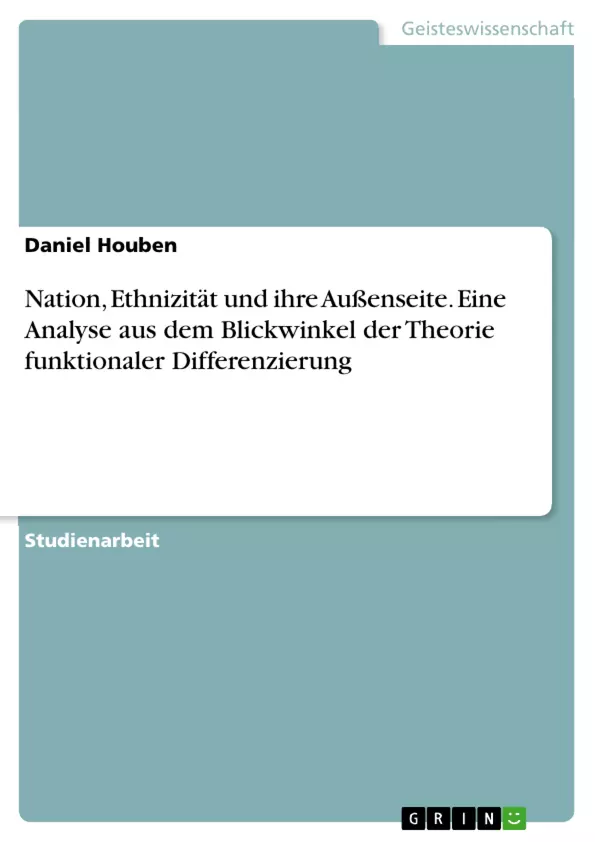Die Arbeit widmet sich dem Thema kollektiver Identitäten und dem des Fremden aus einem eher systemtheoretischen, von der Theorie der funktionalen Differenzierung geleiteten Blickwinkel. Dabei orientiert sie sich im Wesentlichen an den Arbeiten von Armin Nassehi, welche die Gestalt der modernen Welt und den Erfolg von kollektiven Identitäten wie Ethnizität und Nation als Folge des (funktionalen) Differenzierungsprozesses der modernen Gesellschaft verstehen. Die Argumentation der Arbeit und die wichtigsten Thesen bewegen sich dabei auf der Makroebene und empirische Daten werden außen vor gelassen.
Inhaltsverzeichnis
0. Vorwort
1. Einführung in ausgewählte Begriffe der Systemtheorie und der Theorie der funktionalen Differenzierung
1.1 Funktionale Teilsysteme:
1.2 Kommunikation, binäre Codierung und Beobachtung:
1.3 Inklusion/Exklusion:
1.4 Die Folgen der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft: Exklusionsindividualität, Desintegration und strukturelle Fremdheit
2. Ethnizität und Nation
2.1 Ethnizität
2.1.1 Begriffsbestimmung und Bedeutung
2.1.2 Ethnizität und die Theorie funktionaler Differenzierung
2.2 Zur Genese des Nationalismus in Europa
2.2.1 Vormoderne Verhältnisse
2.2.2 Beginnende sprachliche Vereinheitlichungsprozesse
2.2.3 Politische und ethnische Vereinheitlichungsprozesse
2.3 Ethnischer Nationalismus und das Konzept der Staatsbürgerschaft
2.3.1 Ethnischer Nationalismus
2.3.2 Das Konzept der Staatsbürgerschaft
2.4 Nation als Form
2.4.1 Systemtheoretische Vorannahmen
2.4.2 Politische Implikationen
2.4.3 Nation als Personenäquivalent im Kommunikationsprozess
2.4.4 Askriptionen, Konkurrenz und Nationalismus
2.5 Fazit
3. Die Außenseite: Analysen zur Soziologie des Fremden
3.1 Die Klassiker: Simmel und Schütz
3.1.1 Der Fremde als Prototyp der Moderne? Georg Simmels Bestimmung des Fremden
3.1.2 Wissenssoziologisch beobachtete Assimilation: Der Fremde bei Alfred Schütz
3.2 Das ewig Unentscheidbare als Feind der modernen Ordnung: der Fremde bei Zygmunt Baumann
3.3 Der Fremde als Vertrauter (Feind) bei Armin Nassehi
3.4 Lösungsansätze: "Mulit-Kulti", Generalisierung und Vergegnung
3.4.1 Zur Multikulturalismus Debatte
3.4.2 Generalisierung der Fremdheit
Literaturliste:
0. Vorwort
Die Arbeit widmet sich dem Thema kollektiver Identitäten und dem des Fremden aus einem eher systemtheoretischen, von der Theorie der funktionalen Differenzierung geleiteten Blickwinkel. Dabei orientiert sie sich im wesentlichen an den Arbeiten von Armin Nassehi, welche die Gestalt der modernen Welt und den Erfolg von kollektiven Identitäten wie Ethnizität und Nation als Folge des (funktionalen) Differenzierungsprozesses der modernen Gesellschaft verstehen. Die Argumentation der Arbeit und die wichtigsten Thesen bewegen sich dabei auf der Makroebene und empirische Daten werden außen vorgelassen.
Das erste Kapitel bestimmt lediglich die systemtheoretischen Termini, die in den folgenden Kapiteln benutzt werden. Die Darstellung besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern betrachtet nur diejenigen Aspekte, die in der folgenden Diskussion eine Rolle spielen. Abschließend werden dann dort schon einmal einige Folgen der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft skizziert und damit verbundene Frage- und Problemstellungen in die Diskussion eingebracht.
Das zweite Kapitel beginnt mit einer Bestimmung des Begriffs Ethnizität und untersucht daran anschließend die Bedeutung im Zusammenhang mit der Theorie der funktionalen Differenzierung. Danach wird anhand von Benedict Andersons Ansatz, Nationen als imaginierte Gemeinschaften zu verstehen, die Genese des Nationalismus mit der besonderen Betonung sprachlicher Vereinheitlichungsprozesse eingegangen. Darauf folgend werden dann die Wesensmerkmale des ethnischen Nationalismus und des darauf aufbauenden Staatsbürgerschaftskonzepts wiedergegeben. Das Kapitel schließt mit Dirk Richters Analyse der Nation als Form. Dieser Ansatz ist sehr an Luhmanns Systemtheorie orientiert und leistet es, eine brauchbare Analyse des Phänomens der Nation und seiner Begleiterscheinungen zu geben. Als ein wesentliches Ergebnis dieses Kapitels bleibt die Feststellung, dass Fremdenfeindlichkeit eine emergente Folge der Anwendung der Nation als Form betrachtet werden kann, also in den gesellschaftlichen Strukturen selbst bedingt ist.
Das dritte Kapitel meiner Arbeit beschäftigt sich dann mit der Soziologie des Fremden und untersucht, in wie weit dort Lösungs- oder Erklärungsansätze für die emergente Problematik der Nation mit den Fremden zu finden sind.
Dabei widme ich zuerst auch kurz den Klassikern zur Soziologie des Fremden von Georg Simmel und Alfred Schütz, ohne ihre Konzepte en detail zu erläutern. Es werden nur punktuell einzelne Aspekte mit Bezug auf den Kontext der Arbeit hervorgehoben. Danach beschäftige ich mich mit Baumans Erklärungsansatz für das Problem zwischen Nationen und den Fremden. Im Anschluss daran folgt Nassehis Untersuchung in der er zeigt, wie der Fremde zum Feind wird.
Tiefgreifende Lösungsansätze liefern diese vier Arbeiten aber m.E. nicht, und somit frage ich danach, in wie fern denn Lösungen in der Multikulturalismusdebatte enthalten sind, oder ob sich durch eine Generalisierung der Fremdheit das Problem von selbst auflöst.
Ich schließe mit einer Schlussbetrachtung deren Ziel nicht eine Zusammenfassung der in der Arbeit vorgestellten Thesen ist, sondern die einige Diskussionspunkte aus der Arbeit aufgreift und nach Lösungsmöglichkeiten und Ansatzpunkten zum Umgang mit Fremdenfeindlichkeit sucht.
1. Einführung in ausgewählte Begriffe der Systemtheorie und der Theorie der funktionalen Differenzierung
"Die moderne Gesellschaft ist eine primär funktional differenzierte Gesellschaft." So in etwa könnte auf den Punkt gebracht der aktuelle soziologische Mainstream als Antwort auf die Frage nach dem wesentlichsten Konstitutionsmerkmal der modernen Gesellschaftsform wiedergegeben werden (vgl. Nassehi 1999:105, Schimank/Volkmann 1999:6). Diese Behauptung wird so weit ich es beurteilen kann auch nicht ernsthaft bestritten. Diskussionen gibt es allenfalls über die Folgen dieser Entwicklung oder ihre konkrete Ausgestaltung. Diskussionen dieser oder ähnlicher Art werde ich an dieser Stelle allerdings bewusst vernachlässigen. Stattdessen soll der folgende Abschnitt vielmehr zur Bestimmung der in der Arbeit verwendeten systemtheoretischen Begrifflichkeiten dienen. Dabei bleibt die Darstellung aus Platzgründen bewusst oberflächlich und lückenhaft. Es wird ausschließlich auf die Elemente und Begriffe der Luhmannschen Systemtheorie eingegangen die eine unmittelbare Relevanz für die folgenden Kapitel haben.
1.1 Funktionale Teilsysteme:
Funktionale Teilsysteme bilden sich als[1] gesamtgesellschaftlich relevante institutionalisierte, funktionsspezifische Handlungszusammenhänge, deren wesentliches Konstitutionsmerkmal ein spezieller Sinn, oftmals auch als funktionaler Imperativ beschrieben, ist. Neben diesem funktionalen Imperativ werden den funktionalen Teilsystemen in der Luhmannschen Systemtheorie auch noch spezifische Leistungen zugeschrieben, die diese für die anderen Teilsysteme zusätzlich erbringen. Allerdings bleibt der Hauptzweck der funktionellen Teilsysteme ihre Funktion für die gesamte Gesellschaft[2]. (vgl. Mayntz 1988:17f) Die explizite, im funktionalen Imperativ zum Ausdruck kommende Funktionsspezifität der Teilsysteme als konstituierendes Merkmal führt auf der Makroebene zur Herausbildung mehrerer verschiedener spezialisierter Teilsysteme, bspw. Politik, Wissenschaft, Wirtschaft etc., die alle eine jeweils eigene, für die Gesamtgesellschaft unersetzliche Leistung erbringen. So führt die Wissenschaft - und kein anderes System - Forschungen durch und teilt die Ergebnisse daraus der Welt mit. Das Verlagswesen publiziert Literatur, die Politik erlässt Verordnungen, usw. (vgl. Schimank/Volkmann 1999:6f).
Durch ihre Verschiedenheit und die Spezialisierung auf den jeweiligen funktionalen Imperativ ergibt sich eine Gleichrangigkeit unter den Systemen, denn kein funktionales Teilsystem kann die Aufgabe eines anderen übernehmen (täte es das, dann wäre es nicht mehr das gleiche Teilsystem) und es somit auch nicht ersetzen. Jedes bringt seine spezielle Leistung und bearbeitet mehr oder weniger autark seinen Relevanzbereich (vgl. ebd.). Aus dieser Spezialisierung entwickeln sich aber notwendigerweise Interdependenzen: jedes Funktionssystem ist unabhängig von den anderen Teilsystemen, aber gerade deshalb von den Leistungen der anderen Funktionssysteme wiederum abhängig. Funktionsverlust und Spezialisierung bedingen daher einander unausweichlich (vgl. Esser 2000:66f). Diese Interdependenzen werden als strukturelle Kopplung bezeichnet (vgl. Schimank/Volkmann 1999:12).
Nun könnte es den Anschein haben, dass die einzelnen Teilsysteme doch nicht - wie eingangs dargestellt - ausschließlich selbstreferentiell agieren. Denn wenn es wechselseitige Abhängigkeiten gibt, dann entsteht auch wechselseitige Beeinflussung und die Selbstreferentialität wird verwässert. Eine solche Behauptung ließe allerdings außer Acht, dass Teilsysteme zwar in einem Kommunikationsprozess zueinander stehen (dazu siehe Abs. 1.2), aber diese Kommunikation durch sog. legitime Indifferenz (Schimank 1995:158) gekennzeichnet ist. Das heißt, dass die einzelnen Teilsysteme im reziproken Kommunikationsprozess ihren, durch ihren funktionalen Imperativ geprägten, speziellen Blickwinkel nicht verlassen, oder sich gar in die Position des anderen Teilsystems versetzen. (vgl. ebd.)
Funktionale Teilsysteme sind also als selbstreferentielle (oder autopoietische[3] ) Kommunikationszusammenhänge nach außen hin abgeschlossen, stehen aber gleichzeitig via Kommunikation mit ihrer Umwelt in Kontakt. Diese fremdreferentiellen Einwirkungen (der Umwelt) verursachen dann so gesehen eine Umweltoffenheit, die aber immer parallel zur selbstreferentiellen Geschlossenheit, also der einzigartigen Verfolgung des speziellen funktionalen Imperativs, existiert. Somit bleibt die klare Grenze zwischen den Systemen erhalten. (vgl. Schimank/Volkmann 1999:11)
Für Luhmann ist die Genese der einzelnen Teilsysteme ein (u.a.) evolutionärer und emergenter Prozess: demnach bilden sich einzelne Teilsysteme zu Beginn semantisch heraus, erhalten also quasi eine sprachliche und somit kommunizierbare Autonomie und können im Laufe der Zeit zu selbstständigen, schließlich ausschließlich selbstreflexiven Handlungszusammenhängen werden (vgl. Nassehi 1999:109). Durch diese auf die eigene Funktion fokussierte Sichtweise entwickeln die verschiedenen funktionalen Teilsysteme
„Ihre eigene, sich wechselseitig ausschließende Form der Beobachtung der Welt.“
(ebd.)
1.2 Kommunikation, binäre Codierung und Beobachtung:
Wie bereits angedeutet konstituieren sich die einzelnen Systeme nicht, wie in stratifikatorischen oder segmentären Gesellschaften analog zu der Struktur der Gesellschaft, sondern im Wesentlichen als kommunikative Systeme. Funktionale Teilsysteme sind demnach also spezifische kommunikative Handlungszusammenhänge. (vgl. Nassehi 1999:113, Mayntz 1988:21) Handlung darf hier aber nicht etwa im Sinne einer Handlungstheorie à la Parsons oder Coleman verstanden werden. In unserem Zusammenhang bedeutet Handeln, bzw. Handlungszusammenhang schlicht Kommunikation. Demnach ist der grundlegende soziale Vorgang für Luhmann auch Kommunikation. Soziale Systeme, also auch funktionale Teilsysteme, sind nach diesem Verständnis primär Kommunikationssysteme. (vgl. Schimank 1995:148) Kommunikation erzeugt als solche wieder Kommunikation (Handeln erzeugt aber nicht zwangsläufig Handeln) und ist somit die wesentliche operative Garantie der Autopoiesis sozialer Systeme[4]. Handeln ist in dieser Lesart also lediglich eine "kontingente Perspektive" auf Kommunikation (vgl. Schimank 1995:148f). Dieser selbstreferentielle Kommunikationszusammenhang ist natürlich nicht das Einzige, was in den Teilsystemen stattfindet. Der Ansatz negiert also in keiner Weise nicht-kommunikatives Handeln. Alles andere Handeln, oder im ersten Moment nicht-kommunikatives Handeln ist aber nur dann gesellschaftlich relevant, wenn es an den Kommunikationsprozess anschlussfähig ist. (So bringen bspw. nicht publizierte wissenschaftliche Daten die Wissenschaft als Teilsystem nicht weiter.) (vgl. Schimank 1995:158f)
Die autopoietische Geschlossenheit der Teilsysteme verlangt aber nach klaren, distinkten Leitdifferenzen an denen sich die systemspezifischen Kommunikationszusammnenhänge orientieren können. Diese Funktion wird in der Systemtheorie den Codes zugeschrieben. (vgl. Schimank 1995:155) Codes determinieren die Sinngrenzen der Teilsysteme, indem sie ihren funktionalen Imperativ zwischen zwei definierten Extremen eingrenzen. Etwas weniger theoretisch formuliert bedeutet dies, dass alle Funktionssysteme mittels einer binären Codierung ihre spezifischen Zugriffsweisen auf die Welt regeln. (vgl. Schimank/Volkmann 1999:11, ebd.) So orientiert sich die Wissenschaft an den Codes von "wahr/falsch" oder Moral an "gut/böse". An Hand dieser Codes lässt sich Kommunikation auf ihre Anschlussfähigkeit für die Systeme prüfen. (vgl. Sieprath 2001:51)
Auf diese Art wird also sichergestellt, dass nur etwas für die Systeme Relevantes auch tatsächlich innerhalb der Systeme kommuniziert wird. So etwas wie dritte Werte gibt es nicht. Alles was sich nicht in den Binärcode einordnen lässt ist lediglich noch nicht entschieden (vgl. Schimank 1995:157). Wenn wir diesen Gedanken wieder an unserem Wissenschaftsbeispiel verdeutlichen, dann könnten wir sagen, dass die Codierung dafür sorgt, dass Tätigkeiten in akademischen Gremien bei Forschern im Labor wohl keinen Einfluss auf ihre Forschungsarbeiten haben werden, und umgekehrt hat die aktuelle Forschung nichts mit dem akademischen Wahlamt zu tun. Innerhalb der jeweiligen Teilsysteme (hier Wissenschaft und Verwaltung) erzielen sie aber gemäß dem Code die erforderten Leistungen.
Diese Codes werden noch durch Programme ergänzt, denn für die Feinbeobachtung der Umwelt reichen die abstrakten Codes alleine nicht aus (vgl. Richter 1997:6). Programme sind Spezifizierungen der Codes, also gewissermaßen Begleitsemantiken, die angeben wie die Codes zu verstehen, bzw. anzuwenden, etc, sind. In unserem Beispiel wären dass z.B. methodologische Regeln zur Interviewdurchführung für das Teilsystem Wissenschaft innerhalb der Codierung von "wahr/falsch". (vgl. Schimank/Volkmann 199:10f)
Neben der Codierung ist auch noch ein weiterer Punkt in der Systemtheorie Luhmanns durch eine binäre Unterscheidung gekennzeichnet: die Beobachtung. Die Beobachtung setzt sich aus einer Unterscheidung einerseits und einer Bezeichnung andererseits zusammen. Die Beobachtung als Operation bedeutet dementsprechend, dass der zu beobachtende Bereich in zwei Bereiche unterschieden wird, um den relevanten Bereich zu bezeichnen. Dabei stellt der bezeichnete Teil quasi das Innere und der nicht-bezeichnete Teil das Äußere, im Moment der Beobachtung Nicht-Relevante dar. So können durch die Unterscheidung und Bezeichnung im inneren, relevanten Teil Informationen erzeugt werden, die es im äußeren Teil nicht gibt. (vgl. Sieprath 2001:46)
1.3 Inklusion/Exklusion:
Generell wird in der Soziologie Inklusion als der Eintritt, die Teilnahme oder die Mitgliedschaft von Personen in soziale Systeme oder funktionale Teilsysteme bezeichnet. Exklusion ist demnach die natürliche Gegenseite, also die Nicht-Mitgliedschaft, die Nicht-Teilnahme oder der Nicht-Eintritt in soziale oder funktionale Teilsysteme. Auch hier finden wir erneut, ähnlich zu den binären Codes, einen natürlichen Antagonismus, in dem die eine Seite nicht ohne die andere existieren kann. Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob Inklusion und Exklusion freiwillig geschehen, oder ob nur die Möglichkeit dazu gegeben ist, denn in beiden Fällen kann von Inklusion und Exklusion gesprochen werden. Überdies sie angemerkt, dass es Inklusion und Exklusion in allen sozialen Bereichen, nicht nur in funktionalen Teilsystemen gibt (vgl. Esser 2000:233ff). An dieser Stelle soll aber, wie gesagt, vorrangig das Konzept von Inklusion und Exklusion in bezug auf die Systemtheorie betrachtet werden.
In der von Luhmann geprägten systemtheoretischen Schule wird der „sozialen Integration des Persönlichkeitssystems als struktureller Bedingung des Bestandes sozialer Systeme aus theoretischen und empirischen Gründen“ (Nassehi 1999:112f) eher weniger Gewicht beigemessen. Wenn wir aber dennoch nicht mehr ausschließlich die Systeme als Referenzpunkte für eine Gesellschaftsanalyse heranziehen, sondern auch Personen mit einbeziehen wollen, müssen wir uns mit der Teilhabe von Personen an den Funktionssystemen beschäftigen. Diese wird über Inklusion, bzw. Exklusion vollzogen. Inklusion und Exklusion bedeuten systemtheoretisch ausgedrückt also die (Nicht-)Anschlussfähigkeit von psychischen Systemen (Menschen) an Kommunikation. (vgl. Nassehi 1999:111f) Luhmann schlägt deshalb vor unter
„Inklusion denjenigen Mechanismus zu verstehen, nach dem im Kommunikationszusammenhang Menschen bezeichnet, also für relevant gehalten werden.“ (Luhmann 1994:20, zitiert nach Nassehi 1999:112)
Aus der Vielfältigkeit der verschiedenen Funktionssysteme ergeben sich unter dem Gesichtspunkt von Inklusion und Exklusion für uns an dieser Stelle zwei wichtige Folgen:
Erstens unterscheiden sich die Formen von Inklusion/Exklusion ebenso, wie die Funktionssysteme selbst[5], gemeinsam ist ihnen lediglich allen, dass sie sich nur auf jeweils ein spezielles Funktionssystem beziehen. Zweitens partizipiert jede Person an mehreren verschiedenen Teilsystemen gleichzeitig. Dieser Tatbestand wird mit dem Begriff Multiinklusion beschrieben. (Nassehi 1999:113f) Die Folgen dieser Multiinklusion werden im kommenden Abschnitt kurz angesprochen und werden uns, so viel sie hier schon einmal vorweg genommen, die ganze Arbeit hindurch begleiten.
Zur gesamtgesellschaftlichen Etablierung der verschiedenen Funktionssysteme ist zudem eine wachsende Inklusivität der Teilsysteme zwingende Voraussetzung. Im historischen Kontext hieß das in den meisten Fällen eine Loslösung der einzelnen Teilsysteme aus dem exklusiven Zugriff von (herrschenden) Eliten, so geschehen in der Politik (hier ist die Inklusion zumindest über die Möglichkeit von Wahlen formal gegeben[6] ) oder im Gesundheitswesen. Mit der wachsenden Inklusivität der Teilsysteme geht deshalb - zumindest theoretisch - dann auch eine Reduzierung von stratifikatorischen oder segmentären Gesellschaftsordnungen einher. (Mayntz 1988:22) Lediglich Teilsysteme, deren Ansatz von Beginn an generell inklusionistisch war, sind für ihre Etablierung nicht notwendigerweise auf eine wachsende Inklusivität angewiesen. Ein Beispiel dazu wären religiöse Teilsysteme (vgl. ebd.).
1.4 Die Folgen der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft: Exklusionsindividualität, Desintegration und strukturelle Fremdheit
Die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft hat auf die in ihr lebenden Personen Auswirkungen in vielfacher Hinsicht. Unter anderem diejenige, dass sie Inklusion nur noch in die jeweiligen Funktionssysteme erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen. Von der entgegengesetzten Seite aus betrachtet partizipieren die Funktionssysteme also auch immer nur Teile bzw. Rollen der Personen. Aus dem Individuum wird aus der Perspektive eines Teilsystems also quasi ein "Dividuum". (vgl. Nassehi 1999:116) Der übrige Teil der Person, also die für die Teilsysteme nicht relevanten Facetten, wird dem Zugriff der jeweiligen Funktionssysteme entzogen, bzw. hat für diese keinerlei Relevanz. Im Inklusionsbereich, und dieser existiert in unserer Lesart ja nur innerhalb der funktionalen Teilsysteme, können Individuen demnach also nicht aufgehen. Der unteilbare Bereich der Person ist demnach also nur im Exklusionsbereich zu finden. Individualität mutiert in ihrer spezifisch modernen Form somit also zur Exklusionsindividualität. (vgl. Nassehi 1999:116f)
Aus dem beschriebenen systemtheoretischem Blickwinkel ergeben sich implizit einige weitere, für den theoretischen Hintergrund dieser Arbeit maßgebende Feststellungen: Die Spezialisierung der jeweiligen Funktionssysteme und die daraus resultierende Vervielfältigung der Systeme verlangt von den sich in den Systemen bewegenden Personen die gleichzeitige Zugehörigkeit zu mehreren, sich in ihrer Funktion unterscheidenden, Teilsystemen. (vgl. Nassehi 1999:113) Anders ausgedrückt könnte man auch - um Parsons Terminologie zu bemühen - sagen, dass Personen in der modernen Gesellschaft mehrere Rollen parallel ausfüllen müssen (vgl. Henecka 1994:90ff). Dieser Umstand führt dazu, dass mehrere Teilsystemgrenzen in einer Person zusammenkommen. Oder anders ausgerückt: Systemgrenzen und Personengrenzen verlaufen nicht (mehr) parallel zueinander (Nassehi 1999:114f). Aus dieser Rollendifferenzierung als Folge der Mannigfaltigkeit der verschiedenen möglichen Rollenkombinationen und Funktionsträgerschaften ergibt sich einerseits Individualität und Individualisierung in ihrer spezifisch modernen Form (vgl. dazu auch Beck 1983: „Jenseits von Stand und Klasse“), andererseits sorgt gerade dieses Phänomen bei den Individuen für Rollendiffusion, Rollenkonflikte und Identitätsverunsicherungen. (vgl. Schimank/Volkmann 1999:8) Gab es in den vormodernen Gesellschaften noch Instanzen oder Systeme, die den Individuen eine komplette Inklusion ihrer Person zur Verfügung stellten (im Mittelalter wäre hier für Europa z.B. Religion als alles überwölbende sinn- und identitätsstiftende Inklusionsinstanz zu nennen), so wurden diese im Zuge der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft aufgelöst. Zwar gibt es, wie oben gezeigt, weiterhin Inklusionsmechanismen, aber diese zielen eben nur auf ihren spezifischen Bereich ab. Kein Funktionssystem integriert das gesamte Individuum und kein Funktionssystem kann eine gesamtgesellschaftlich integrative Funktion wahrnehmen. (vgl. Nassehi 1999:115ff) Luhmann beschreibt das Phänomen, bzw. je nach Interpretation auch Problem, wie folgt:
„Das Prinzip der Inklusion ersetzt jene Solidarität, die darauf beruhte, daß man einer und nur einer Gruppe angehörte.“ (Luhmann 1980:31, zitiert nach Nassehi 1999:114)
Die Folgen dieses Prozesses sind dann einerseits strukturelle Fremdheit (vgl. Hahn 1994:162), und andererseits der Zustand der aktuell als Desintegration bezeichnet wird.
Strukturelle Fremdheit ist für das Fortbestehen und Funktionieren einer funktional differenzierten Gesellschaftsform aber auch notwendig: Eine Kassiererin im Supermarkt kann ihre Kunden auch nur in ihrer spezifischen Funktion als eben solche wahrnehmen und umgekehrt. Würde sie genau und interessiert auf weitere Eigenschaften der Person eingehen, dann bräche das System zusammen und der Vorgang wäre auch kein reiner Einkauf mehr[7]. (vgl. ebd., Nassehi 1999:115)
Desintegration meint das Fehlen einer zentralen, die Person als Ganzes integrierende Instanz. Dieser Zustand sei aber - so Nassehi - in einer funktional differenzierten Gesellschaftsform als "Normalfall" zu werten, denn er sei lediglich die logische Konsequenz aus den beschriebenen Charakteristika der funktionalen Differenzierung. Es wir im folgendem zu diskutieren sein, wie Identitätsverunsicherungen umgegangen wird und wie versucht wird, das Problem der Desintegration zu lösen. (vgl. Nassehi 1999:115f)
2. Ethnizität und Nation
Im vorangegangenen Kapitel wurde bereits gezeigt, dass den einzelnen funktionalen Teilsystemen keine integrative Wirkung für die gesamte Gesellschaft zukommt. Keines der einzelnen Funktionssysteme ist in der Lage den Individuen eine Vollinklusion anzubieten. Die Frage, die in diesem Kapitel nun zu klären sein wird, ist die nach den Mechanismen oder Formen, die der strukturellen Desintegration entgegenwirken können, bzw. den Menschen das Gefühl[8] einer Vollinklusion vermitteln können.
Die Frage kann aber auch mit Bezug zu einer höheren Ebene diskutiert werden. Denn nicht nur den Individuen fehlt innerhalb der funktionalen Teilsysteme eine, den gesamtgesellschaftlichen Sinn oder die gesamtgesellschaftliche Integration schaffende Instanz. Das Problem lässt sich auf der Makroebene ebenfalls feststellen. Denn: was bedeutet eigentlich in dem hier untersuchten Zusammenhang Gesellschaft ? Ist sie nur die Summe ihrer Systeme oder gibt es noch mehr? Und wenn es mehr gibt, was ist es und wie hält es die Gesellschaft zusammen? Mit der Systemtheorie als Referenzpunkt wissen wir, dass es keines der funktionalen Teilsysteme sein kann. Weder Religion, noch Politik, noch Wirtschaft stiften einen alles andere überwölbenden und einbindenden Sinn.
Die Ebene der Teilsysteme soll uns in diesem Kapitel aber eher sekundär interessieren. Unsere Ausgangsfrage bleibt die nach der Generalinklusion und nach den, die gesellschaftliche Einheit generierenden Mechanismen. Diese und ähnliche Fragen transportieren jedoch implizit die Annahme, dass eine solche Einheit auch tatsächlich existiert. Denn, wie Nassehi so treffend formuliert:
„Der Gedanke einer trotz Differenzierung integrierten Gesellschaft hält letztlich an der regulativen Idee einer normativ kulturellen Einheit der Gesellschaft fest, die exakt das nicht sehen will, was differenzierten Einheiten eigen ist: Einheit lässt sich aus jeweiligen Positionen nur in Differenz zu anderen Positionen setzen. Sie ist dann zugleich Einheit und Differenz.“ (Nassehi 1999:111)
Es sei schon einmal vorweg genommen, dass die hier untersuchten Ansätze davon ausgehen, dass Nationen und Ethnizitäten zwar durchaus in der Lage sind diese wahrgenommene Einheit für Individuen zu generieren, aber dabei trotz allem lediglich kommunikative Konstrukte sind und bleiben, die mittels ihrer Ein- und Ausschlusssemantiken Grenzziehungsprozesse vornehmen die weltweit nicht nur zur wahrgenommenen Generalinklusion für Individuen und somit auch zur modernen Gesellschaftsstruktur, sondern auch zur Produktion von sozialen Ungleichheiten und humanitären Katastrophen geführt haben.
2.1 Ethnizität
Das ausgehende 20. Jahrhundert sah sich stets mit ethnischen Differenzen und nationalen Konflikten konfrontiert, und es hat den Anschein, als würde sich diese Tatsache auch im beginnenden 21. Jahrhundert nicht so schnell ändern. Zwar können wir sicherlich festhalten, dass die aktuellen Probleme nicht das Ausmaß haben, dass sie noch in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts besaßen (vgl. Nassehi 1999:153). Dennoch bleiben ethnisch-kulturell motivierte Konflikte, sowohl innerhalb von Staatsgrenzen, als auch über diese hinaus eine Aufgabe, der sich die Menschheit stellen muss. So zeigen etwa die E.T.A. in Spanien, die längst nicht überwundenen Konflikte im ehemaligen Jugoslawien, aber auch fremdenfeindlich motivierte Gewalttaten, die unselige Diskussion über die "deutsche Leitkultur" oder um eine Begrenzung der Zuwanderung in Deutschland, dass eine Auseinandersetzung mit den diesen Konflikten zu Grunde liegenden Konzepten auch weiterhin sinnvoll und notwendig ist.
2.1.1 Begriffsbestimmung und Bedeutung
Doch bevor wir uns etwas detaillierter mit dem Phänomen der Ethnizität auseinandersetzen, sollten wir auch diesen Terminus definieren. Heckmann beschreibt Ethnizität anhand von mehreren Definitionen zusammenfassend als ein Konzept, dass sich aus
„,[...] soziokulturellen Gemeinsamkeiten, Gemeinsamkeiten geschichtlicher und aktueller Erfahrungen, Vorstellung einer gemeinsamen Herkunft, eine auf Selbst-Bewusstsein und Fremdzuweisung beruhende kollektive Identität, die eine Vorstellung ethnischer Grenzen einschließt und ein(em) Solidarbewußtsein [...]“ (Heckmann 1991:56)
zusammensetzt. Dabei ist auch ihm die Betonung wichtig, dass diese Gemeinsamkeiten oftmals vorgestellt werden (vgl. Heckmann 1991:56f), sprich nicht notwendigerweise einer realen Basis bedürfen, was gleichzeitig aber nicht heißen soll, dass diese empfundenen Gemeinsamkeiten nicht auch auf tatsächlichen Gemeinsamkeiten beruhen können. Trotz dieser, von den Mitgliedern einer ethnischen Gruppe zumindest wahrgenommenen Gemeinsamkeiten muss eine solche Gruppe nicht zwangsläufig homogen sein, denn Konflikte innerhalb einer ethnischen Gruppe, oder Kontakte zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen stehen dem oben genannten Konzept nicht entgegen und lassen sich zu genüge beobachten. (vgl. Heckmann 1991:58)
Heckmanns Definition verweist zudem eindeutig auf den Konstruktcharakter von Ethnizität. So schreiben sich ethnische Gruppen selbst ein kollektives Schicksal zu, dass in vielen Fällen an historischen Tatsachen vorbeigeht, sich gerne auf Mythen und Geschichten bezieht (vgl. Heckmann 1991:57) oder gar kreative Kollektivgeschichtsschreibung betreibt. So wird Geschichte nachträglich umgedeutet und umgeschrieben, um die ethnische Position entsprechend als natürlich und urwüchsig darzustellen. Auf diese Weise lässt sich die Organisation von ethnisch motivierten klientelischen Gruppen durch einen Hinweis auf historische, ethnische Solidarität begründen und verstärken. (vgl. Elwert 1989:446) Elwert beobachtet sogar Gruppen, die Ethnologen für das Schreiben ihrer Geschichte bezahlen, um ihren Anspruch darauf eine Ethnie zu sein wissenschaftlich fundieren zu lassen (vgl. ebd.). Man kann wohl davon ausgehen, dass es in dem Falle wahrscheinlich auch ein gutes Stück Interpretation und Konstruktion bedeutet. Elwert bezeichnet gar „die Geschichten von Nationen und Ethnien in Form von historischen Berichten“ als generell „falsch, gefälscht, fehlerhaft“ (Elwert 1989: 442).
Auf die Genese von Ethnien und Nationen, die, und so viel sei bereits vorweggenommen, nicht unabhängig von einander betrachtet werden dürfen, kommen wir dann in Abs. 2.2 erneut zurück. Im Folgenden soll uns die Bedeutung von Ethnizität interessieren, insbesondere im Hinblick auf Mobilisierung, Grenzziehung und die Theorie funktionaler Differenzierung interessieren.
Die in diesem Kapitel einleitend genannten Beispiele weisen bereits darauf hin, dass besonders dann, wenn nationale und ethnische Grenzen, oder auch Sprach- und Kulturgrenzen aufeinanderprallen, sehr schnell kollektive Identitätsverständnisse bemüht werden, die ansonsten im alltäglichen Leben in den Hintergrund treten (vgl. Nassehi 1999:153). In diesem Zusammenhang treten zwei, meiner Meinung nach wesentliche, Aspekte von Ethnizität zu Tage.
Erstens ihre Bedeutung als Ressource zur Artikulation und Verfolgung politischer, rechtlicher, ideologischer oder sozialer Interessen (vgl. Esser 1988:235[9] ). Dieser Mobilisierungscharakter von Ethnizität findet sich ebenfalls in Situationen des Widerstandes gegen Diskriminierungen oder überhöhten Assimilationsdruck. Ethnisches Bewusstsein der sich bedrängt oder unterdrückt fühlenden Gruppen wird dann zu ethnischen Grenzziehungen benutzt, die nicht zuletzt ethnische Schließungen zur Folge haben können. Der Zusammenschluss solcher Gruppen kann dann gewissermaßen als Antwort auf die wahrgenommenen Repressionserfahrungen verstanden werden. (vgl. Heckmann 1991:53, Esser 1988:236f).
Dabei ergänzt Elwert, dass vertikale Organisationsformen tendenziell erfolgsversprechender seien, da sich in ihnen alle gesellschaftlichen Schichten wiederfänden. Somit würde sich auch das Mobilisierungspotential erhöhen (vgl. Elwert 1989:451f). Zudem lässt sich die These finden, dass über Ethnizität häufig auch ältere, traditionale Konflikte in die Moderne getragen werden, um nun endlich ausgefochten zu werden. Es würden also gewissermaßen unerledigte Repressionen aus der Vormoderne in die Moderne hinein projiziert (vgl. Heckmann 1991:54f, Esser 1988: 23f, Nassehi 1999:168[10] ).
Zweitens können wir feststellen, dass ethnisch kulturelle Konflikte besonders dann hervortreten, wenn durch Bildungen von Nationalstaaten Teile der Bevölkerungen zu ethnischen Minderheiten marginalisiert werden. Denn ethnische Gruppen werden erst dadurch relevant und können ihren Mobilisierungscharakter überhaupt abrufen, wenn sie sich als Gegenpol zu anderen Gruppen positionieren können. (vgl. Heckmann 1991:58) Anders ausgedrückt könnte man sagen, dass sich ohne Grenzziehungen keine ethnischen Gruppen, oder überhaupt Gruppen jeglicher Art bilden. Grenzziehungen sind konstitutiv für Gruppenbildungen: Wo kein Wir da kein Ihr. Wo also kein Staat seine Genese über ethnische Argumentation legitimiert, bzw. das Vorhandensein einer bestimmten Gruppe als den (gewünschten) Normalfall definiert, da können auch keine Gruppen als nicht zugehörig bezeichnet werden, respektive sich selbst als nicht zugehörig verstehen die dem ethnischen Verständnis nicht entsprechen (ebd.).
„Ethnizität beginnt in Europa ihre moderne Bedeutung anzunehmen, als [...] der Prozess der Nationalstaatsbildung einsetzt. Ethnische Gruppen sind nicht gewissermaßen "an sich" gesellschaftlich relevant, sondern gewinnen mit der Entstehung von Nationen ihre spezifische Bedeutung. Zugespitzt formuliert: Nationenbildung als umfassender Vereinheitlichungsprozeß und Nationalstaat schaffen eigentlich erst ethnische Gruppen in ihrer gegenwärtigen Bedeutung.“ (ebd.)
Allgemein ist aber noch zu sagen, dass die Bedeutung von Ethnizität durchaus variabel sind und immer von der aktuellen sozialen, rechtlichen, kulturellen oder auch gesamtgesellschaftlichen Gemengelage abhängen (vgl. auch Heckmann 1991:58).
„Ethnizität ist ihrerseits [...] ein ausgesprochen mannigfaltiges Phänomen, das je nach Situation, Bedürfnislage und historischem Erfahrungsraum in unterschiedlicher Weise konzipiert wird.“ (Giordano 200:383)
Neben den oben beschriebenen, mehr oder weniger empirisch zu beobachtenden Funktionen von Ethnizität wollen wir uns nun mit einer abstrakteren, eher theoretischeren Bedeutung von Ethnizität befassen: ihre semantischen Kompensationsfunktion in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft.
2.1.2 Ethnizität und die Theorie funktionaler Differenzierung
Wie in Kapitel 1 bereits gezeigt wurde, zeichnet sich die funktional differenzierte Gesellschaft unter anderem dadurch aus, dass den Individuen zwar einerseits durchaus Inklusion in die jeweiligen funktionalen Teilsysteme ermöglicht wird, andererseits aber von den Teilsystemen keine Generalinklusion geleistet werden kann. Wo Klasse, Dorfgemeinschaft oder Religion diese Leistung in den vormodernen Gesellschaftsformen vollbrachten klafft nun gewissermaßen eine Lücke. Diese Lücke wird, so der Ansatz von Nassehi, nun durch ethnische oder nationale Semantiken geschlossen. (vgl. Nassehi 1999:157f) Es werden also über Kommunikation Zusammengehörigkeitsgefühle kommuniziert und daraus Gemeinschaften konstruiert, die, wie bereits erwähnt, durchaus eine reale Grundlage vermissen lassen können.
Diese Semantiken stehen gewissermaßen quer zu den einzelnen Teilsystemen, bzw. transzendieren oder überwölben diese, ohne jedoch selbst ein Teilsystem zu sein (vgl. ebd.). Ethnische oder nationale Semantiken besitzen also eine Art Kompensationsfunktion. Wenn man diese Logik weiterführt ergibt sich daraus der Schluss, dass Nationen oder Ethnien als Formen kollektiver Identitäten als kausale Folge der funktionalen Differenzierung betrachtet werden können (vgl. Nassehi 1999:157). Ihre Kompensationsfunktion machte sie gerade in der Übergangszeit von stratifikatorischen, vormodernen Gesellschaftsformen hin zur funktional differenzierten Gesellschaft so überaus erfolgreich (Nassehi 1999:158). So fällt der Anfang der "Karriere" (Nassehi 1999:159) des Begriffs der Nation mit dem Beginn der funktionalen Differenzierung zusammen. Unter diesem Aspekt kann auch die Bezeichnung von Nation als "Ersatzreligion" begriffen werden (vgl. ebd.), denn was die Religion als Klassen, Gemeinschaften und Menschen überhöhende Sinninstanz bis in die Vormoderne hinein zu leisten vermochte, das kommt heute den nationalen, bzw. ethnischen Semantiken zu. Luhmann und Nassehi konstatieren für Generalinklusionsinstanzen wie einstmals Religion eine gewesen ist, eben diese Eigenschaft: einen gesamtgesellschaftlichen Sinn, verbunden mit dem Setzen von Norm- und Wertvorstellungen, zu stiften (vgl. ebd.). Auf Nation übertragen bedeutet dies also etwa, dass in nationalen Semantiken generelle Sinn- und Wertpostulate kommuniziert werden, die über die einzelnen Codes der Funktionssysteme hinausgehen, bzw. durch diese hindurchgehen. Genau diese Leistung lasse sich auch bei ethnischen, bzw. nationalen Semantiken entdecken (ebd.). Die innergesellschaftlichen Inklusionsgrenzen werden also transzendiert und in ethnische Grenzziehungen zusammengefasst (vgl. ebd.), was dann aber natürlich wieder zwangsläufig Exklusion für den Rest der Welt bedeutet.
“Ethnizität und Nationalität bilden also Brücken zur Integration trotz struktureller Desintegration. Genau genommen hat Ethnizität kaum eine gesellschaftliche Funktion im Sinne eines ausdifferenzierten Teilsystems wie etwa Wirtschaft, Recht, Familie oder Politik. Aus diesem Grunde ist die Nation auch kein gesellschaftliches Teilsystem, sondern nur ein askriptives, auf einen kollektiven Wertkonsens beruhendes Identitätsmerkmal, das in gewisser Hinsicht ein unerläßliches Verbindungsstück zwischen den immer komplexer werdenden gesellschaftlichen Prozessen und der notwendigen Sozialintegration von Personen schafft.“ (Nassehi 1999:163 [Hervorhebungen im Org.])
Allerdings hätte sich der Stellenwert von ethnischen Selbstidentifikationsfolien für die Individuen mittlerweile verändert, da sie nicht mehr die entscheidende Rolle wie noch in der frühen Moderne oder in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts spielten. Denn, - so Nassehi - waren sie früher noch obligatorische, also dann für alle notwendige und gültige Identifikationsmerkmale, werden Individuen heute durch (Multi-)Inklusion in vielen Teilsystemen Funktionsträger, in denen Ethnizität oder Nationalität irrelevant seien (vgl. Nassehi 1999:170f).
Das soll aber keinesfalls heißen, dass es mittel- bis langfristig zu einer vollständigen Erosion von ethnischen oder nationalen Identifikationsmustern kommt[11]. Denn so lange ethnische oder nationale Semantiken - sowohl latent als auch offensichtlich - aktiv bleiben, werden auch die darüber funktionierenden Inklusions- und Exklusionsmechanismen nicht verschwinden. Dass dies weiterhin der Fall ist, ist evident und braucht m.E. nach deshalb hier auch nicht belegt zu werden. Gerade - wie bereits erwähnt - dort, wo ethnische Minoritäten innerhalb staatlicher Grenzen mit den staatstragenden Majoritäten aufeinanderprallen zeigt sich die Aktualität mit aller größter Deutlichkeit (vgl. Nassehi 1999:168).
Mit Heckmann könnte man an dieser Stelle vielleicht den Terminus der "Wahlfreiheit" (Heckmann 1992:54) einführen, da Ethnizität und Nationalität lediglich noch zwei Identifikationsmerkmale unter vielen darstellen (vgl. Nassehi 1999:170f). Die Bindungskraft von diesen Konzepten lässt nach, und es kommt zu einer "Entdramatisierung" (Nassehi 1999:171). So gesehen kann, vorausgesetzt man folgt dieser These für Ethnizität, oder respektive Nationalismus durch die Brille der Theorie der funktionalen Differenzierung ein Funktions- oder auch Bedeutungswandel (vgl. ebd.) festgestellt werden.
Diese Lesart des Komplexes greift allerdings nur, wenn der gesamtgesellschaftliche Rahmen in der Art funktioniert, dass den oben bereits beschriebenen Mobilisierungspotentialen von Ethnizität, bzw. von ethnischen Semantiken kein Grund geliefert wird; sprich, wenn es der Gesellschaft gelingt soziale Ungleichheiten, politische und rechtliche Ungleichbehandlungen und Verteilungskonflikte aufzulösen (vgl. Nassehi 1999:173). So lange dies nicht der Fall ist, und moderne Gesellschaftsformen weiterhin Zugänge zu und Verteilungen von gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Ressourcen ungleich oder anhand von ethnisch-kulturellen Grenzziehungsprozessen durchführen, wird Ethnizität auch weiterhin seine Explosivität behalten, und nicht als das wahrgenommen werden, was sie nach der Theorie der funktionalen Differenzierung ist, nämlich nur ein mögliches Identifikationsmuster unter vielen. (vgl. Nassehi 1999:178)
2.2 Zur Genese des Nationalismus in Europa
Im Folgenden soll die Entwicklung des Nationalismus in Europa kurz skizziert werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei, auch im Sinne einer Anschlussfähigkeit an die kommunikationszentrierte Systemtheorie, auf der sprachlichen Vereinheitlichungsentwicklung. Der Hauptbezugspunkt der Ausführungen stellt Benedict Andersons Konzept von Nation als vorgestellter Gemeinschaft (im englischen Original "imagined communities") dar. Die politische Entwicklung, die ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Nationalismus leistete wird bewusst nur punktuell und kursorisch aufgegriffen, da sie zum einen unsere soziologische Analyse hier nur wenig voran bringt, und zum zweiten der Platz kaum ausreichen würde um die politischen Einflüsse adäquat wiederzugeben.
2.2.1 Vormoderne Verhältnisse
Benedict Andersons viel zitiertes Konzept von Nationen als "vorgestellte Gemeinschaften" sieht für Westeuropa das 18. Jahrhundert als Startschuss des Nationalismus (vgl. Anderson 1996:20). Dabei betont er, dass die Entwicklungsgeschichte des Nationalismus nicht getrennt von den großen kulturellen Systemen gesehen werden darf, die ihm vorausgingen. Innerhalb dieser großen kulturellen Systeme misst Anderson der Religion, der Sprache und den damaligen Herrschaftsformen, die ich in Anlehnung an Anderson hier ebenfalls mit dem Begriff Dynastien bezeichnen werde, die größte Bedeutung bei. Nationen seien aber nicht einfach aus religiösen Gemeinschaften und Dynastien heraus entstanden. Die Erosion der Dynastien verlief vielmehr parallel zu Veränderungen im Wahrnehmungssystem der Welt. Diese Veränderungen ermöglichten es erst den Begriff "Nation" zu denken. (vgl. Anderson 1996:30) Die wesentlichste Leistung dieser großen kulturellen Systeme für die vormoderne Gesellschaftsordnung bestand in der Legitimation des stratifikatorischen Charakters der mittelalterlichen Weltordnung. So waren die damaligen Herrscher durch Gottes Gnaden eingesetzt, die Leiden im Diesseits waren der Weg zur Erlösung[12] und jegliche Ordnung gestaltete sich ausgeprägt zentralistisch. Religion vermochte es also wichtigstes Vergesellschaftungsmoment und alles überwölbende, Sinn gebende Instanz zu sein. (vgl. Nassehi 1999:160f)
Wie bereits erwähnt sind Nationen für Anderson vorgestellte Gemeinschaften. Dieser Terminus transportiert bereits unmittelbar die zentrale Aussage unserer Überlegungen: Nationen sind Konstrukte. D.h. sie sind nicht primordial, sie sind nicht "natürlich" entstanden, oder waren gar immer schon da, sondern sind vielmehr kommunikative Systeme. Diese kommunikativen Systeme tragen sich über bestimmte Symboliken und Semantiken (vgl. Anderson 1996:30ff). Das Nationalbewusstsein speist seine Berechtigung aus dieser Semantik und Symbolik heraus und hält sich über diese selbst am Leben (vgl. ebd.).
Andersons These ist der systemtheoretischen Ansicht von Nation und Ethnizität als sich über Kommunikation generierende semantische Systeme also durchaus anschlussfähig (vgl. Nassehi 1999:157ff).
Die Ursprünge des Nationalbewusstseins lassen sich für Anderson folglich u.a. in der Entstehung von Sprachgemeinschaften finden (genaueres dazu siehe Abs.2.2.2). Aber noch im ausgehenden Mittelalter, also in einer Zeit, als das Christentum noch eine entscheidende Wirkung auf das Setzen von Normen und Werten hatte und somit noch eine gesamtgesellschaftlich integrative Funktion wahrnahm (vgl. ebd.), die Herrschaftsverhältnisse relativ häufig wechselten, hatten Begriffe wie Staat und Nation für ihre Bürger, wenn überhaupt, eine nur geringe Bedeutung. Staaten, respektive monarchische Reiche wurden weniger mit festen Grenzen und einem ganz bestimmten Territorium gleichgesetzt, sondern vielmehr mit einem Zentrum, von dem aus die jeweiligen Herrscher ihren Einfluss ausübten. (vgl. Anderson 1996:26f)
In den mittelalterlichen Staaten orientierten sich die politischen Bestrebungen demnach nicht an kulturellen oder ethnischen Gegebenheiten. Das primäre Ziel war Erhalt und Erweiterung politischer Macht, sowohl für geistliche, als auch für weltliche Eliten. So bezeichnet Heckmann die beginnende Staatenbildung im ausgehenden Mittelalter folglich auch politisches Mittel der großen dynastischen Herrschaftshäuser gegen Feudalherren und kosmopolitisches Christentum. (vgl. Heckmann 1991:60) Die Bevölkerungen dieser Staaten waren dem zu Folge keine ethnisch homogenen Gruppen, im Gegenteil; bis ins ausgehende Mittelalter hätte man schwerlich Menschen gefunden, die sich über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie, geschweige denn Nation definierten. Das dynastische Herrschaftssystem beruhte auf stratifikatorischer und religiöser Legitimation, kulturelle oder herkunftsorientierte Herrschaftsansprüche oder Interessen hätten der politischen Praxis entgegengestanden. (vgl. Heckmann 1991:59)
Gab es durch Kriege oder Heiratspolitik Expansionen oder Machtwechsel, so hatte das für die Untertanen für die alltägliche Wahrnehmung ihres Lebens, oder ihr Identitätsverständnis kaum eine Bedeutung. Ihr Leben konzentrierte sich auf einen kleinen familiären Raum, Wanderungen aus diesem Alltagsraum heraus waren nur Minderheiten oder Eliten vorbehalten. Es bestand also so gesehen keine Veranlassung, und wahrscheinlich auch keine Möglichkeit, für die "einfachen Massen" ein ethnisches Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wenn es denn kulturelle Grenzen gab, dann wurden sie diesen nicht gewahr. (vgl. Anderson 1996) Fremdes hatte also für das tägliche Leben kaum eine Relevanz, und fremde Reisende oder Händler kamen heute und gingen morgen.
2.2.2 Beginnende sprachliche Vereinheitlichungsprozesse
Um ein ethnisches Selbstbewusstsein zu entwickeln ist es wie in Abs.2.1.1 bereits erläutert nötig Unterschiede zu anderen festzulegen, oder gleichzeitig Gemeinsamkeiten zu definieren bzw. ggf. zu entwickeln und in einem großen, möglichst alle Individuen, die diese Gemeinsamkeiten zugerechnet werden erreichenden Kommunikationsprozess diese Grenzen zu vermitteln. Anderson sieht für diesen Prozess die Entwicklung des Buchdrucks in Zusammenarbeit mit den kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten des Marktes[13] als ausschlaggebend an. Er habe „das Angesicht der Welt verändert“ (Anderson 1996:44). Denn der Buchdruck bewirkte neben der Steigerung der technischen Reproduzierbarkeit von Wissen außerdem die Herausbildung von, auch im Laufe der Zeit als solche wahrgenommenen, Sprachgemeinschaften: Nachdem der Markt für lateinsprachige Buchdruckerzeugnisse gesättigt war, wurden der Logik des Kapitalismus folgend die Landessprachen für das Verlagswesen interessant. Unterstützt wurde dieser schlicht absatzorientierte, keiner politischen Ideologie folgende Prozess durch den Protestantismus (Anderson bezeichnet Luthers in "deutsch" erschienene Werke als „erste Massenliteratur“ (Anderson 1996:46)) und die Durchsetzung von Landessprachen als Verwaltungssprachen durch absolutistische Herrscher. (vgl. Anderson 1996:44ff) Dabei hatte aber weder der Protestantismus, noch der Absolutismus mit diesen Maßnahmen eine Ausweitung von frühnationalistischen Tendenzen oder Ideologien zum Ziel. Zwar kann den frühen protestantischen Druckerzeugnissen, nicht nachgesagt werden, ihre Intention wäre unpolitisch gewesen, doch ging diese politische Intention in eine andere Richtung, obwohl bereits hier deutlich wird, welche Mobilisierungsmöglichkeiten Kommunikationsmittel besitzen. (vgl. Anderson 1996:46f )
Dieser Prozess erhielt auch von nicht-ökonomischer Seite einen Anschub, welcher letztlich mehr bewegte, als tatsächlich dadurch beabsichtigt wurde: Die absolutistischen Herrscher erhoben die lange verpönten Landessprachen, nach ihrer Etablierung und stärkeren Verbreitung im Schriftlichen zu offiziellen Verwaltungssprachen. Die Einführung kann zwar im weitesten Sinn als politischer Akt gedeutet werden, allerdings war hier ein eher pragmatischer Aspekt Vater des Gedankens, und nicht eine eventuelle Marginalisierung der Menschen welchen eine fremde Landessprache vorgesetzt wurde - obwohl das natürlich einige Male zwangsläufig der Fall war (vgl. Anderson 1996:48) - denn dieses Vorgehen führte automatisch zur Bildung ethnischer, in diesem Falle also anderssprachiger Minderheiten (vgl. Nassehi 1999:163). Die absolutistischen Herrscher versprachen sich schlicht einen administrativen Vorteil von dieser Maßnahme (vgl. Anderson 1996:48).
So entstanden mit der Zeit neue Lese-, Sprach- und Kommunikationsgemeinschaften, die sich allmählich ihrer Existenz bewusst wurden. Der Buchdruck half dabei diese neuen Sprachen zu fixieren und zu vereinheitlichen, und ermöglichte ihre Reproduzierbarkeit. Dieser Prozess verlief zu Beginn zwar ungesteuert, ließ sich aber instrumentalisieren. Im Laufe der Zeit entstanden so Kommunikationssysteme, welche die Ursprünge von national vorgestellten Gemeinschaften bildeten. (vgl. Anderson 1996:51f) Diese Sichtweise der historischen Ereignisse mag je nach Lesart ein wenig monokausal[14] erscheinen, Anderson betont deshalb:
„Die Entstehung der neuen, nationalen Gemeinschaften ist auch ohne die Existenz eines, oder vielleicht sogar aller dieser Faktoren denkbar. Im positiven Sinn wurden diese neuen Gemeinschaften durch eine eher zufällige, doch explosive Interaktion möglich, die sich zwischen eine System von Produktion und Produktionsbeziehungen (dem Kapitalismus), einer Kommunikationstechnologie (dem Buchdruck) und dem unausweichlichen Faktum, daß Menschen verschiedene Sprachen haben.“ (Anderson 1996:49f)
Die oben nachgezeichnete Entwicklung bildete also eine Art Fundament auf dem der Nationalismus als Ideologie gedeihen konnte. Aber Sprache blieb auch in der Zeit, in der der Nationalismus zum primären politischen und gesellschaftlichen Ordnungsrahmen in Europa wurde (nach Anderson v.a. der Zeitraum zwischen 1820 und 1920 (vgl. Anderson 1996:72)) ein Motor dieser Entwicklung. Mit voranschreitender Alfabetisierung entwickelte sich eine breitere Mittelschicht heraus, deren berufliche Tätigkeiten häufig eng mit dem schriftlichen und mündlichen Gebrauch von Sprache verbunden waren (vgl. Anderson 1996:80). Diese "philologische Eliten" (Anderson) waren es, die Vereinheitlichung der Landessprachen weiter voran trieben und mit ihrer Arbeit auch dafür sorgten, dass Latein nach und nach seiner herausragenden Stellung als Sprache der geistigen Eliten beraubt wurde. Linguisten beförderten zudem im Laufe der Zeit die Landessprachen zu offiziellen Sprachen an den Universitäten. Landessprachen waren also nicht länger die Sprache der einfachen Massen, sondern plötzlich auch die der geistigen Eliten. (vgl. ebd.)
Gerade diese Eliten entdeckten nun einen durch eine Sprache verbundenen eigenen Kulturkreis, vielleicht auch weil - wie Anderson anmerkt - der Niedergang des Lateinischen das Bewusstsein hervorrief, dass Sprachen nicht Gott gegeben sind, sondern Besitzer haben. Im Zuge dieses neuen Selbstverständnisses entwickelte sich auch ein neues, an der empfundenen Einzigartigkeit des eigenen Kulturreises orientiertes Geschichtsbild, das sich später in Aussprüchen wie „Ein Volk, eine Sprache, eine Nation!“ ausdrückte. (vgl. Anderson 1996:72ff) Gerade "Geschichte" zeigt(e) sich dabei als praktikables Instrument um vorgestellte Einheiten im nachhinein als natürliche, traditionelle, urwüchsige Einheiten darzustellen: so wurden (und werden in der historischen Kontinuität immer noch) Legenden und Mythen umgedeutet, alte Texte neu übersetzt und interpretiert, historische Fakten in einen passenderen Kontext gesetzt, und im schlimmsten Fall werden Tatsachen und Fiktion untrennbar miteinander verwoben. (vgl. Heckmann 1991:64f, Elwert 1989:442ff)
Ein Blick in unsere Zeit scheint diese These sehr schnell zu bestätigen: Sprache scheint immer noch ein wesentliches, wenn nicht gar oft das wichtigste Merkmal zur Grenzziehung für ethnische Gruppen und deren Selbstverständnis zu sein. So verstehen sich z.B. Flamen, Wallonen und die deutschsprachige Minderheit in Belgien durchaus - nach unserer Definition - als ethnische Gruppen. Wenn wir an dieser Stelle wieder die Brücke zur Theorie der funktionalen Differenzierung schlagen, dann muss eine Ethnie auch eine gemeinsame Sprache sprechen, denn sonst könnte sich ein rein kommunikatives System ja gar nicht erst etablieren.
Die - wie Anderson sie nennt - "lexikographisch-philologische Revolution" (Anderson 1996:89) in Europa verbreitete so die Überzeugung Sprachen seien gewissermaßen persönlicher Besitz derjenigen Gruppen, die dieselben lesen und sprechen. Diese Anschauung lieferte eine entscheidende Grundlage für die Ansicht, diese (vorgestellten) Gemeinschaften besäßen ein Recht auf Selbstständigkeit in einer homogenen Gruppe von Gleichen. (vgl. Anderson 1996:89f) Somit war also die Basis für die folgenden ethnischen Vereinheitlichungsprozesse geschaffen, die im nächsten Abschnitt beschrieben werde sollen. Abschließend soll aber hier noch ein Zitat Andersons angeführt werden, welches die vorangegangen Ausführungen auf den Punkt bringt:
„Es ist immer ein Fehler, Sprachen als "Symbol" des "Nation-Seins" wie Flaggen, Trachten, Volkstänze und dergleichen zu behandeln. Die weitaus wichtigste Eigenschaft der Sprachen ist vielmehr ihre Fähigkeit, vorgestellte Gemeinschaften hervorzubringen, in dem sie besondere Solidaritäten herstellt und wirksam werden läßt.“ (Anderson 1996:133)
2.2.3 Politische und ethnische Vereinheitlichungsprozesse
Es dürfte aus den obigen Ausführungen hervor gegangen sein, dass in der vormodernen Gesellschaftsordnung seitens der herrschenden Eliten keinerlei Interesse an einer sprachlichen, kulturellen oder ethnischen Homogenisierung ihres Einflussbereichs bestand. Sie hätte der machtpolitischen Praxis (Internationalität, Heiratsexpansion, Zentralismus, etc.) sogar entgegengestanden und war schlicht zum Machterhalt nicht notwendig. (vgl. Heckmann 1991:59f) Die sprachlich-ethnischen Einheitsbestrebungen, oder anders formuliert: die nationalistischen Volksbewegungen (Anderson 1996:91) setzten die Herrschenden aber unter Druck. So versuchten diese ihre Legitimation nun auch nachträglich völkisch-nationalistisch zu begründen. Anderson beschreibt diese Bestrebungen als "offiziellen Nationalismus" (ebd.).
„Die Herrschenden, die ihre Marginalisierung oder ihren Ausschluß fürchteten, reagierten antizipatorisch.“ (ebd.)
Der offizielle Nationalismus stellte so seine Geschichtsschreibung auf Nation um, indoktriniert dieses Modell via Schulen, Verwaltung, usw. in die gemeine Bevölkerung. Mit fortwährender Dauer dieses Programms ergab es sich also, dass es selbstverständliche Normalität wurde, dass der Nachbar von gestern, mit dem man sich viel natürlich verbunden fühlte nun zum institutionalisierten, zu einem offiziellen Fremden, bzw. "Ausländer" wurde und auch als solcher gewertet werden sollte. Die Wirklichkeit wurde auf ein ganz bestimmtes, explizit kenntlich gemachtes Territorium beschränkt, und somit schuf man für die Einwohner dieses Territoriums ein einheitliches Erfahrungsuniversum. (vgl. Anderson 1996:120ff)
Trotz der großen Bedeutung der sprachlich-völkischen Bewegung (wichtige Vertreter in Deutschland waren ohne Zweifel Herder oder Fichte) für nationale Vereinheitlichungsprozesse, dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass aber auch machtpolitische Staatengründungen im ausgehenden Mittelalter bereits einen ersten Schritt in Richtung einer homogenen kulturellen gesellschaftlichen Schließung darstellen. Die Motivation war aber auch an dieser Stelle eindeutig machtpolitisch-pragmatischer Natur, denn ein zentralistisch operierendes Verwaltungssystem benötigt klar definierte Zuständigkeiten. Absolutistische Herrscher brauchen definierte Untertanen. Somit müssen zwangsläufig Grenzen eingerichtet werden, um diese Zuständigkeiten zu regeln und zu gewährleisten. (vgl. Heckmann 1991:60f)
Die Modernisierung und Technisierung der Gesellschaft fällt parallel zu den sich entwickelnden nationalistischen Bemühungen in die gleiche Zeit und unterstützte die politischen und ethnischen Vereinheitlichungsprozesse ihrerseits durch die Vereinheitlichung der ökonomischen und soziostrukturellen Gegebenheiten (Kommunikationswesen, Verkehrswesen, Arbeitsteilung, etc.). (vgl. Heckmann 1991:62) Wenn man so will, kann man also auch an dieser Stelle ein Zusammenspiel von funktionaler Differenzierung und der Herausbildung von Nationalstaaten feststellen.
Die Entwicklung in Deutschland zeigte sich in ihren Anfängen im 18. Jahrhundert als Bewegung von Intellektuellen, die dann im 19. Jahrhundert zur populistischen Massenbewegung mutierte. Fanden sich zu Beginn dieser Bewegung im Zuge der bürgerlichen Revolutionen in Europa und Amerika - deren Verschriftlichungen sie nach Anderson zu einer Art kopierbarer dinglicher Sache machten (Anderson 1996:120ff) - durchaus noch liberitäre Interessen und Forderungen, veränderte sich das Gedankengut des Nationalismus in Deutschland letztlich in das, was es heute immer noch ausmacht: Der Nationalismus in Deutschland wurde zu einer ethnozentristisch, völkisch-national orientierten Bewegung. (vgl. Heckmann 1991:63f)
2.3 Ethnischer Nationalismus und das Konzept der Staatsbürgerschaft
Im vorangegangenen Abschnitt haben wir bereits festgestellt, dass ein wesentliches Merkmal des Nationalismus seine Bemühungen um Homogenität ist. In Deutschland bedeutet Homogenität vor allem Homogenität im ethnisch-kulturellen Sinne. Die deutsche Spielart des Nationalismus wird deshalb auch allenthalben als Paradebeispiel für ethnischen Nationalismus angeführt (so u.a. Bielefeld 1991, Heckmann 1991, Giordano 2000, Eckert 1998, Nassehi 1997). Diese Form des Nationalismus ist freilich nicht die einzig vorkommende. Daneben gibt es nach Heckmann auch noch den politisch Nationalismus, den er noch in ein demotisch-unitaristisches Modell und ein ethnisch-pluralistisches Modell unterscheidet (Heckmann 1991:69). Die letztgenannten sollen uns hier aber vorerst nicht interessieren. In diesem Abschnitt werden stattdessen kurz die Wesensmerkmale des ethnischen Nationalismus - zumindest in seiner deutschen Erscheinungsform - und das darauf aufbauende Staatbürgerschaftskonzept als offizieller Ein-, respektive Ausschlussmechanismus erläutert.
2.3.1 Ethnischer Nationalismus
Wie bereits in Abs.2.2 beschrieben, war die Entwicklung des Nationalismus in Deutschland in ihrer ersten Phase eine hauptsächlich aus intellektuellen Eliten vorangetragene Bewegung. Als politische Ideologie strebte er nach einer ethnisch-kulturell homogen verfassten Nation, deren ethnische Grenzen mit den staatlichen Grenzen übereinstimmen sollten. Der ethnische Nationalismus begreift Nationen also als nach Herkunft, Kultur, Sprache und Geschichte homogene Personengruppen. (vgl. Heckmann 1991:63) Es sollte ein Deutschland gebildet werden, in dem alle als "deutsch" definierten - oder besser konstruierten - Personen ihr natürliches, ursprüngliches zu Hause finden würden. (vgl. Walzer 1983:224) Dabei war das deutsche Ethnizitätsverständnis von Anfang an untrennbar mit dem Begriff des "Volks" verbunden. Wurde dieser Begriff zur Zeit der Aufklärung noch abwertend verwendet, so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Bewertung des Begriffes mit dem Aufkommen des Nationalismus zwangsläufig eine Aufwertung erfuhr. Grund hierfür war eine Verklärung und Neudefinition des Begriffs, der "Volk" mit "Urvolk", und in dieser Folge mit Naturwüchsigkeit, Tugendhaftigkeit und kultureller Gemeinschaft assoziierte. In der Geschichtsschreibung mutierte "Volk" zum kollektiven Subjekt, dem bis in das mittlere 20. Jahrhundert ganz selbstverständlich "individuelle" Eigenschaften, ja gar bestimmte Persönlichkeitszüge und Charakteristika zugeschrieben wurden. (vgl. Heckmann 1991:67)
Dieser zwanghafte Wunsch nach ethnisch-kultureller Homogenität verursacht aber automatisch in dem Moment, in dem aus dem Wunsch eine politische Programmatik wird einige verhängnisvolle Implikationen. Denn zur vollständigen Erreichung, bzw. Einhaltung dieses Programms muss gewährleistet sein, dass alle Mitglieder des Volks, respektive der Nation innerhalb des Nationalstaats versammelt sind, dass niemand der nicht Mitglied des Volks ist, sich innerhalb des Staatsgebiets aufhält, also Fremde im Sinne Simmels lediglich als Wandernde willkommen sind (wobei sie dann im soziologischen Sinne natürlich keine Fremden mehr wären). (vgl. Heckmann 1991:63)
Dabei werden auch gerade im ethnischen Nationalismus in der Regel Gemeinschaften eher er - als ge funden:
„Die Forderungen des ethnischen Nationalismus beziehen sich dabei häufig auf Bevölkerungen, die historisch und gegenwärtig fiktive kulturelle Einheiten darstellen; Einheit und Gemeinsamkeit wird behauptet und in historischen Projektionen "hergestellt", wo sie nicht bewiesen werden kann. Geschichtslegenden über Herkunft und Entwicklung "des Volkes" werden erfunden, Sprachen wiederbelebt, Geschichte und Tradition neu gedeutet.“(ebd.) „So wurde im 19. Jahrhundert von berühmten Gelehrten mit hohem intellektuellem Aufwand eine quasi naturwüchsige und zwangsläufige Kontinuität der deutschen Geschichte von ihren Anfängen bis zur "Erfüllung" im zweiten deutschen Reich zurechtgestrickt. Der in Rom erzogene Cheruskerfürst Arminius, der religiöse Reformator Luther, Friedrich der Große, der französisch sprechende, deutsch nur radebrechende "König von Preußen", wurden zu Helden des Kampfes um den deutschen Nationalstaat umgedeutet.“(Oberndörfer 1987, zitiert nach Heckmann 1991:64)
Wir können also festhalten, dass der deutsche ethnische Nationalismus in seiner ideologischen Natur kulturelle Heterogenität nicht akzeptiert. Tritt dieser Zustand dennoch ein, dann muss er überwunden werden. In seiner, katastrophalerweise eingetretenen, radikalsten Form wird aus dieser Überwindung dann Vertreibung oder gar Vernichtung ganzer, als nicht dazu gehörig definierter (oder besser: konstruierter) ethnischer Gruppen und Minderheiten. (vgl. Heckmann 1991:64f) Dabei werden an dieser Stelle m.E. zwei Aspekte deutlich: Erstens, dass der Holocaust als solcher sicherlich das absolut negative Extrem der Ideologie des ethnischen Nationalismus repräsentiert, aber dennoch eine emergente Folge des Konzepts ist, da er den schrecklichen Höhepunkt der Entwicklung und Fortführung dieser Ideologie ist.
Zweitens zeigt sich, dass Ethnizitäten erst im Nationalismus die Bedeutung erhält, in der sie heute die Weltgesellschaft vor Konflikte stellt. Aus einer einfachen, in der vormodernen Praxis kaum wahrgenommenen Vergesellschaftungsform wird ein politisches und soziales Organisationsprinzip, welches in Abgrenzungsprozessen erst ethnische Minderheiten produziert, um dann mit diesen zu kollidieren. Wird in diesem Prozess ein Integrations- oder Assilimationsdruck von der Mehrheit auf die Minderheit(en) ausgeübt, dann können sich diese im Widerstand solidarisieren, bzw. vielleicht auch überhaupt erst entstehen. (vgl. Heckmann 1991:65)
Somit erleben wir die paradoxe Situation, dass Vereinheitlichungsprozesse je stärker sie vorangetrieben werden, mit umso stärkerem Widerstand zu rechen haben und sich in dieser Logik dann auch selbst hemmen. (vgl. ebd.)
2.3.2 Das Konzept der Staatsbürgerschaft
Das Konzept des ethnischen Nationalismus war maßgebend für die Entstehung und Entwicklung des deutschen Staates, und hat, egal in welcher historischen Erscheinungsform, sein Staatsbürgerschaftsrecht an diesem Prinzip orientiert. (vgl. Heckmann 1991:68, Giordano 2000:386) Doch bevor wir uns detaillierter mit dem deutschen Staatsbürgerschaftsrecht beschäftigen, und es kurz mit dem französischem kontrastieren, sollten wir uns vorab einige generelle Aussagen zum Konzept der Staatsbürgerschaft vergegenwärtigen.
Nationalstaaten sind nicht nur geographische, territoriale Einheiten, sondern vielmehr in ihrer politischen Verfasstheit Zusammenschlüsse von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern (Giordano 2000:385). Dabei wies schon Max Weber darauf hin, dass Nationalstaaten als verband nur begrenzt nach innen und außen offen sind (M. Weber 1956,Bd I: 26, zitiert nach ebd.). Giordano spricht von einem "institutionellen Siebungsmechanismus, der Zugehörigkeiten und gleichzeitig Ausschluss regelt" (ebd.), Nassehi und Schroer bezeichnen das Konzept der Staatsbürgerschaft als den "wirksamsten Grenzziehungsprozess der Moderne" (Nassehi/Schroer 1999:95).
Seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 besitzen alle Menschen ein unveräußerliches, nicht zu revidierendes Recht auf Staatsbürgerschaft. Es sind also demnach alle Individuen, die irgendwie im Bereich gesellschaftlicher, zwischenmenschlicher Kommunikation existieren unauslöschlich in der Dichotomie von nationalstaatlicher Inklusion und Exklusion wiederzufinden. Staatsbürgerinnen und -bürger sind universal in den Inklusionsbereich ihrer Nation eingebunden und gleichzeitig partikularistisch aus allen anderen Nationen exkludiert. (Nassehi/Schroer 1999:96) Das sieht jedenfalls der Normalfall der modernen Struktur der (Welt-)Gesellschaft so vor. Alle Menschen geraten somit von Beginn ihres Lebens an unweigerlich in die vielen verschiedenen nationalen Schließungssysteme (Nationalökonomie, nationale Bildungssysteme, nationale Politik und Kultur), die der simulierten gesellschaftlichen Einheit der Nation Vorschub leisten, und - einen unkritischen Konsum dieses Systems vorausgesetzt - bei den Adressaten wohl Loyalität und Solidarität gegenüber der gesellschaftlichen Einheit erzeugt werden. (vgl. Nassehi/Schroer 1999:96f)
Dem Konzept der Staatsbürgerschaft wohnt aber gerade aus diesem Grund stets eine gewisse Spannung inne: auf der einen Seite stehen wie gesagt universale Menschen- und Bürgerrechte, deren Ziel es sein soll, in einer, durch ihre Struktur Ungleichheiten schaffenden Gesellschaft Gleichheit zu gewährleisten, wenigstens aber zu formulieren. Auf der anderen Seite steht der begrenzte Geltungsbereich dieser eigentlich universalen Rechte. Und wie bereits dargelegt bedeutet eine Solidarisierung nach innen immer auch gleichzeitig eine Abgrenzung nach außen. Dabei gingen die modernen Nationalstaaten in ihrer Entwicklung lange Zeit davon aus, bzw. glauben dies noch immer, dass Nicht-Bürgeinnen und Nicht-Bürger auf ihrem, als homogene Einheit gedachten und kommunizierten Territorium Abweichungen sind, deren Vorhandensein marginalisiert werden könne. (vgl. Nassehi/Schroer 1999:99-104) Denn eine Einbindung von Fremden liefe dem Konzept der Vollinklusion durch die Nation für ihre Mitglieder zuwider. Da sich aber hinter dem Anspruch Vollinklusion zu leisten auch noch ein Aufforderungs- und Verpflichtungscharakter für diejenigen verbirgt, die sich dem Konzept unterordnen (Stichweh 1988:288), bringt natürlich eine Verwässerung der Exklusivität ihrer Mitgliedschaft, z.B. durch eine Übertragung der Mitgliedschaft auf alle Menschen die diese gerne besäßen, in so fern Probleme, als dass eventuelle Appelle ihre Wirkungskraft verlören. Wenn Fremden die gleichen Privilegien die eine Zugehörigkeit zu einer Nation, oder eine Staatsbürgerschaft formal mit sich bringen, erhalten, dann kann mit diesen Privilegien nicht mehr motiviert oder mobilisiert werden, dann lockern sich auf Staatsbürgerschaft beruhende Verpflichtungen[15] auf. (vgl. Stichweh 1988:288f)
Es wird deutlich, wie eng Legitimation und Loyalität in diesem Sinne mit der ethnischen und nationalen Verfasstheit von modernen Staaten verbunden sind (vgl. Nassehi/Schroer 1999:103). Und spätestens seit Thomas Hobbes (Hobbes 1970) wissen wir, dass der Staatsbürgerschaftsstatus dazu dient Vertragssicherheiten zu gewährleisten. Würden diese, in der jeweiligen Wahrnehmung der diesen Staatsvertrag konstituierenden Personen auch noch auf alle möglichen Fremden ausgeweitet, ergäben sich nach dieser Argumentation Loyalitäts- und Stabilitätsprobleme für die national verfasste Gesellschaft (vgl. Nassehi/Schroer 1999:98).
Zusammengefasst können wir also festhalten, dass die Funktion eines so angelegten Staatsbürgerschaftsrechts darin besteht, eine ethnisch, bzw. national einheitlich verfasste Nation als den Normalfall zu symbolisieren und Nicht-Bürgerinnen und Nicht-Bürger zum dezidierten Ausnahmefall zu machen (vgl. Nassehi/Schroer 1999:103).
"Alle Staatsgewalt geht von Volke aus!" Dieser schon sprichwörtliche, auf den ersten Blick stets als die demokratische Manifestation Deutschlands schlechthin geltende Grundsatz erweist sich auf den zweiten Blick und insbesondere in der in dieser Arbeit angewandter Lesart als ethnisch exklusionistisch (vgl. Heckmann 1991:69). Dass das politische Beteiligungsrecht in Deutschland auf seinen speziellen Volksbegriff zurückgeht, und damit explizit in Deutschland (wie lange auch immer) lebende ethnische Minderheiten ausschließt (vgl. Giordano 2000:289) ist die umgesetzte Konsequenz aus dem deutschen Staatsbürgerschaftsrecht.
Der deutschen Staatsbürgschaftspolitik und dem deutschen Staatsbürgerschaftsrecht liegt und lag, wie schon gesagt, eine ethnische Vorstellung des Nationalstaats zu Grunde (vgl. Heckmann 1991:68). Aus diesem Verständnis ergeben sich demnach einige folgenreiche Implikationen für den Erwerb, bzw. den Nicht-Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit: So liegt es außerhalb des Einflusses der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, ob sie sich zu den "Glücklichen" zählen dürfen, die das Privileg der deutschen Staatsangehörigkeit genießen dürfen, denn das Recht ist in seiner konsequenten Auslegung lediglich durch Geburt zu erlangen, und somit ausschließlich erblich. Umgekehrt bedeutet dies natürlich dann auch, dass ein Mensch ohne deutsche Vorfahren, trotz aller Assimilations- und Akkulturationserfahrungen keine Chance hat, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen. (vgl. Heckmann 1991:68) Nicht umsonst spricht man beim deutschen Staatsbürgerschaftsrecht auch vom jus sanguinis[16] (frei übersetzt etwa: Blutrecht) (vgl. Giordano 2000:387). Diese Auffassung bedeutet zu dem, dass auch ethnische Minderheiten außerhalb des deutschen Staatsgebiets auf Grund von deutschen Vorfahren in dem hier diskutierten Sinne noch als deutsch gelten, und ohne größere Probleme die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten könnten, vorausgesetzt, dass deutsche Vorfahren noch nachweisbar sind. Aus diesem Grunde verwundert es auch nicht, dass trotz einer quantitativ relevanten Einwanderung die Einbürgerungsquote bis zur Novellierung des Einbürgerungsrechts 1991 bei 0,03% lag. (vgl. Heckmann 1991:68)
Giordano verdeutlicht die oben genannten Implikationen an drei soziologischen, bzw. historischen Phänomenen, die hier nur kursorisch wiedergegeben werden sollen:
Erstens die deutsche Wiedervereinigung 1990: ohne die erläuterten Vorstellungen von Volk, Zusammengehörigkeit und Abstammung hätte die Wiedervereinigung nach gut fünfzig Jahren ohne wirklichen gegenseitigen Kontakt sicherlich nicht mit dem Tempo und auch nicht mit den verwendeten Einheitssemantiken vollzogen werden können, mit der sie dann tatsächlich vollzogen wurde (vgl. Giordano 2000:388).
Zweitens die Aussiedlerfrage: Aussiedler aus Mittel- und Osteuropa oder aus Zentralasien gelten immer noch als "Vollmitglieder des deutschen Volkes" und werden bei Einbürgerungsanträgen auch dementsprechend behandelt (vgl. ebd.).
Drittens die Migrantenfrage: Deutschland versteht sich nicht als Einwanderungsland[17], trotz vollständig assimilierter und akkulturierter Migranten in der zweiten oder dritten Generation werden diese von politischen und demokratischen Rechten exkludiert (vgl. Giordano 2000:289).
Dem deutschen Verständnis von Staatsbürgerschaft steht das französische Modell gegenüber. Dort wird Nation nicht als ethnische Gruppe, sondern als politische Vereinbarung von Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern untereinander aufgefasst. Demzufolge spricht man hier auch vom politischen Nationalismus, und beim Staatsbürgerschaftsrecht vom jus soli (etwa: Gemeinrecht) (vgl. Giordano 2000:386). Die Chance zur Übernahme der französischen Staatsbürgerschaft ist in diesem Modell also theoretisch und formal allen Menschen gegeben. In der Praxis dann allen, die eine vollzogene französische Assimilation nachweisen können.
Dieses Modell ist zwar von seiner Art her tendenziell offener und liberitärer als das deutsche, allerdings darf nicht übersehen werden, dass auch die in diesem Modell geforderte Assimilation kulturelle Homogenität zum Ziel hat (vgl. Giordano 2000:387), und dass der ethnische Diskurs in Frankreich auch sehr unerfreuliche Ergebnisse hervorbringt, wie der jüngste Beinahe-Erfolg des rechtspopulistischen Kandidaten Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen 2002 zeigt. Giordano spricht mit Blick auf den französischen Diskurs zur kulturellen Heterogenität als eine „unbequeme Realität, die nur mit Unbehagen akzeptiert wird“ (ebd.).
Als Fazit aus diesen beiden Staatsbürgerschaftsmodellen können wir also festhalten, dass beide auf kulturelle gesellschaftliche Homogenität abzielen, wobei die Praxis in Deutschland selbst freiwillig assimilierten Ausländern in ihrer Heimat[18] eine beachtliche Menge an politischen Rechten verwehrt, und diese somit zu "Bürgern zweiter Klasse" (Heckmann 1991:69) macht. Der moderne Nationalstaat ist konzeptionell also gegen Andersartigkeit ausgerichtet (vgl. Bauman 1991, Giordano 2000:389) und benutzt das Staatsbürgerschaftsrecht zur Durchsetzung und Erhaltung dieses Konzepts.
„Ethnokulturelle Minderheiten stehen demzufolge zwischen dem Hammer der Identitätsaufgabe und dem Amboss der Ausgrenzung.“ (Giordano 2000:389)
2.4 Nation als Form
Dirk Richters Analyse der Nation als Form versucht im wesentlichen Luhmanns Systemtheorie um diesen Begriff zu erweitern, da dieser von der Systemtheorie lange vernachlässigt wurde. (vgl. Richter 1997:60) Insgesamt gesehen lässt sich mit diesem Modell tatsächlich eine Menge von sozialen Phänomenen erklären.
2.4.1 Systemtheoretische Vorannahmen
Richter macht für seine Analyse der Nation zwei systemtheoretische Voraussetzungen geltend: erstens den "Form" Begriff Luhmannscher Prägung[19], welcher davon ausgeht, dass durch das Setzen einer Form eine Unterscheidung (vgl. Abs. 1.2) gemacht wird, die dann zwangsläufig eine Innen- und eine Außenseite schafft. (vgl. Richter 1997:62) Diese Formen werden via Medien vermittelt und kommuniziert (Nassehi/Richter 1998:153).
Die Form schließt also alles, was nicht in den eigenen Relevanzbereich gehören soll aus und garantiert somit, dass alles was sich außerhalb befindet dann auch nicht thematisiert werden muss. So lässt sich durch die zugehörige Semantik etwas als vertraut oder fremd, als gut oder schlecht behandeln, ohne dass diese Vertrautheit oder Fremdheit erst diskursiv in einem Kommunikationsprozess erzeugt werden müsste. Die Semantik orientiert sich an der Form und diese ist von vorneherein definitorisch. (vgl. Nassehi/Richter 1998:156)
Zweitens fasst er im Sinne Luhmanns die moderne (Welt-)Gesellschaft nicht als Summe von Handelnden, sondern als Gesamtheit aller möglichen Kommunikation auf. Jede Kommunikation findet folglich innerhalb der Weltgesellschaft statt und kann theoretisch globale Konsequenzen haben und global beobachtet werden. Dabei wird für die Weltgesellschaft ebenfalls die funktionale Differenziertheit als eine ihrer wesentlichsten Konstitutionskriterien aufgefasst. Denn in der funktional ausdifferenzierten, modernen Gesellschaft machen die Relevanzbereiche der einzelnen Funktionssysteme immer weniger Halt vor territorialen oder nationalen Grenzziehungen. Oder anders ausgedrückt: Wissenschaft (als ein Beispiel für ein Funktionssystem) mag zwar einerseits eine höhere Kommunikationsdichte innerhalb eines Staates haben, muss als eigenständiges Funktionssystem aber in der Gesamtheit seiner Kommunikation betrachtet werden. (vgl. ebd., Richter 1997:62)
Auf der Basis dieser Vorannahmen stellt Richter fest, dass die Nation als solche nicht hypostasiert werden dürfe, da Nationen gesellschaftsstrukturell nicht vorhanden sind. Im Bereich dieser Ebene gäbe es nur globale Funktionssysteme. Aus diesem Grund sei die Auffassung von Nation als eine definierte homogene Gruppe von Individuen, wie sie z.B. in der empirischen Sozialforschung anzutreffen sei, nicht haltbar. (vgl. Richter 1997:63) Diese streng systemtheoretische Analyse der Nation zeigt sich m.E. durchaus anschlussfähig an die in den vorangegangenen Abschnitten aufgestellten Thesen. Richter schlägt stattdessen vor, Nation als einen Beobachtungsmodus anzusehen.
„Die "Nation"[...] ist eine semantische Form [...], mit der die Welt aus einer distinkten Perspektive bestimmbar gemacht wird. Die Semantik der Nation findet Verwendung zu Klassifizierungs- und Einteilungszwecken. Es werden semantische Ein- und Ausschlußverhältnisse konstruiert, um die in der Weltgesellschaft beobachteten Phänomene handhabbar und praktikabel zu machen.“ (ebd.).
Demzufolge bedeutet Nation weder eine definierte Gemeinschaft von Personen, noch eine natürliche Gegebenheit, sondern ein auf Kommunikation beruhendes Konstrukt, das durch seine Form der Beobachtung der Welt gleichzeitig das hervorbringt, was es sieht, nämlich "Nation(en)". (vgl. Nassehi/Richter 1998:153)
Die Weltgesellschaft wird also nach diesem Ansatz durch das Setzen von Formen partikularisiert: Nation als angewandte Form verursacht für diejenigen Individuen, die sie anwenden eine Zweiteilung der Welt in Innen und Außen. Innen befindet sich die Nation und alles, was in ihrem Gefolge als dazugehörig kommuniziert wird. In der Praxis ergibt sich so das oben als spezifisch modern beschriebene Verständnis der Welt, da es für jede Nation[20] eine jeweils eigene Form gibt, und sich somit eine ungeheure Pluralität von Nationen als Beobachtungsformen entwickelt; und folglich die segmentäre Aufteilung der Welt auch im territorialen Sinne mitkonstituiert.
2.4.2 Politische Implikationen
Aber nicht nur aus diesem Grund ergibt sich auf dieser Ebene eine segmentäre Aufteilung der Weltgesellschaft. Denn wir sollten uns an dieser Stelle daran erinnern, dass Nation als Form im Wesentlichen von politischen Systemen kommuniziert und angewendet werden (vgl. Richter 1997:64). Und Staaten als politische Systeme sind auf diese segmentäre Differenzierung der Welt angewiesen. Denn die Legitimationssemantik der Politik ist das Gemeinwohl, und dessen Bezugspunkt könne eben nicht die ganze Welt sein (vgl. Richter 1997:63). Die politischen Systeme benötigen somit zu ihrem Machterhalt klar definierte Adressaten und Zuständigkeiten. Es muss sich also ein Kollektiv entwickeln, dessen Gemeinwohl als Legitimation eines politischen Systems herhalten kann. Aus diesem Grunde arbeiten Staaten mit der Form der Nation zur Unterscheidung in Eigenes (Nation) einerseits und Fremdes (Nicht-Nation) andererseits. Oder anders formuliert läuft die Bildung dieses Kollektivs, wie in den obigen Ausführungen schon mehrfach erläutert, über Ein-, respektive über Ausschlusssemantiken ab. (vgl. Richter 1997:63f) Nationen können unter diesem Blickwinkel also als künstliche Kommunikationseinheiten verstanden werden, die sich selbst in einer Art Feedback-Schleife stabilisieren. Die auf diese Art durch das Setzen von Kommunikationsgrenzen geschaffenen Einheiten lassen den Bereich gemeinsamer Kommunikation und vor allem den Bereich der Erreichbarkeit, überschaubarer werden. Auf dieser Basis fällt es dann wesentlich leichter Gemeinsamkeitsempfindungen, Solidarität und gleichzeitige Informationsvermittlung zu generieren. (vgl. Nassehi/Schroer 1999:103)
2.4.3 Nation als Personenäquivalent im Kommunikationsprozess
Den auf diese Weise entstandenen Einheiten kann nun Kommunikation zugerechnet werden. Diese Kollektive können so als ansprechbare Adressaten - ähnlich Individuen in alltäglichen Kommunikationsprozessen - innerhalb der Weltgesellschaft betrachtet werden, und Kausalitäten können somit auch den jeweiligen Kollektiven zugesprochen werden. Aus dieser Sichtweise heraus ist es also möglich Kollektive analog zu Personen im Kommunikationsprozess zu verstehen und auch dementsprechend zu konstruieren. (vgl. ebd.) Dabei muss allerdings kurz darauf hingewiesen werden, dass diese Kollektive nicht zwangsläufig politische Kollektive wie Nationen sein müssen, sondern dass zur Bildung von Kollektiven auch, wie bereits erwähnt z.B. auch ethnische, sprachliche oder soziale Grenzen herangezogen werden können (vgl. Richter 1997:64f).
Für Luhmann stellen Nationen sog. "Fixpunkte in der Kommunikation der Weltgesellschaft" dar. Sie ermöglicht es, Individuen Ereignisse die jenseits des eigenen Einfluss- und Erfahrungsbereiches liegen als Vertrautes, ja u.U. sogar als Eigenes erfahren zu lassen. (Nassehi/Richter 1998:157)
Die oben genannte These lässt sich anhand von Konstrukten wie "Volk", insbesondere wenn es als eine Art natürlich gewachsener Organismus personifiziert wird, veranschaulichen: Die Nation wird mit einem "Volk" gleichgesetzt und analog zu Personen hypostasiert. Nationen werden dann also äquivalent zu Personen gesehen und folglich im weltgesellschaftlichen Kommunikationsprozess auch dementsprechend behandelt. Den äußeren Kollektiven können nun auch Eigenschaften zugeordnet werden, und meist noch folgenreicher: sie können nun für soziale Kausalitäten verantwortlich gemacht werden.
2.4.4 Askriptionen, Konkurrenz und Nationalismus
Für die Bewertung des Inneren und des Äußeren lässt sich eine signifikante Schieflage in bezug auf die Bewertung aufzeigen: das Innere, also das Eigene, ist tendenziell positiv. Das Äußere, also das Fremde, wird tendenziell negativ gesehen und eine Gleichrangigkeit zu anderen Nationen oder konkurrierenden Kollektiven wird deshalb hier nur schwer aufrecht zu erhalten sein. (vgl. Richter 1997:66-69)
„Dass heißt, Nationales ist nicht ohne abwertende Differenz zu haben.“ (Richter 1997:65)
Gerade Zuschreibungen dieser Art haben sich im Laufe der Zeit manifestiert und dienen, wie es Stereotypen eben eigen ist, zur (besseren) Orientierung und zur Typisierung der Umwelt (vgl. Richter 1997:68f).
„Man weiß einfach, wie der "Türke", der "Russe" oder der "Asylant" ist.“ (Richter 1997:69)
Diese, in den Worten Richters, kommunikativen Stereotypen erhalten zusätzlich zu ihrem konstitutiven Merkmal, dass sie als Stereotypen als solche weniger auf Tatsachen, als auf Zuschreibungen beruhen, weitere Brisanz, wenn es um die Inklusion in Funktionssysteme geht. Vornehmlich dann, wenn ein Kollektiv sein Inklusionsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Kollektiven als nicht gleichwertig betrachtet. (vgl. Richter 1997:71f) In solchen Fällen werden Ungleichheiten mit anderen Kollektiven als Folge einer Konkurrenz mit diesen wahrgenommen. Ungleichverteilungen sind dann Ungerechtigkeiten und am Ende einer solchen Argumentationskette steht in aller Regel die Feststellung, dass die anderen, in den Augen des klagenden Kollektivs besser gestellten, Kollektive Schuld an der Lage des klagenden Kollektivs haben (müssen). (vgl. ebd.)
Diese Überlegung werden wir uns nun im Hinblick auf die Inklusion in die einzelnen Funktionssysteme ein wenig detaillierter anschauen. In der reinen Theorie der funktionalen Differenzierung sind Funktionssysteme so angelegt (vgl. Abs. 1.3), dass sie per se Individuen Inklusion offerieren sollten, um ihren funktionalen Imperativ einhalten zu können. In den Fällen, in denen Individuen keine Inklusion erhalten existiert eben für sie für dieses Funktionssystem Exklusion. (vgl. Nassehi/Richter 1998:160)
In der Alltagswelt aber werden diese Inklusionen zu den Funktionssystemen graduell und nicht binär wahrgenommen. Jemand fühlt sich mehr oder weniger gut repräsentiert, jemand hat mehr oder weniger gute Chancen auf gesellschaftlichen Aufstieg als irgendjemand anderes. Es werden also zur Ermittlung des eigenen sozialen Status ständig Vergleiche bemüht. (vgl. Richter 1997:71, Nassehi/Richter 1998:160) Diese Wahrnehmungen könnte man auch als Statuserwartungen bezeichnen. In dem Moment, in dem sich Statusunsicherheiten oder Erwartungen in einem (eigenen) Kollektiv ausdrücken, ermöglicht das Vorhandensein eines anderen Kollektivs, eine Konkurrenz um Inklusionsmöglichkeiten auf das andere Kollektiv zurückzuführen. In dem Maße, in dem das andere Kollektiv für die geminderten Inklusionschancen des eigenen Kollektivs verantwortlich gemacht wird - das andere Kollektiv also automatisch auch abgewertet wird, vielleicht sogar zum Feind deklariert wird - steigt die Identifikationswirkung des eigenen Kollektivs. Das eigene Kollektiv wird durch die entsprechenden, diesen Prozess begleitenden, Semantiken noch stärker als Einheit wahrgenommen und aufgewertet. (vgl. Nassehi/Richter 1998:160)
Die Selbstdefinition von Individuen läuft dann über das Kollektiv und dessen Mitglieder werden in dieser Situation selbst zur Projektionsfläche für die Form dieses Kollektivs. Sie werden zum Medium und transportieren und stabilisieren die Semantik der Form weiter. Die Form der Nation ermöglicht demnach also Individuen eine ganzheitliche Verortung trotz der Identitätsdiffusion in der funktional differenzierten Gesellschaft. Wenn die Einheit einer spezifischen Gruppe konstruiert wird, und die individuelle Zugehörigkeit zu dieser Gruppe gegeben ist, dann verspricht diese Zugehörigkeit zu der, allerdings ja nur vorgestellten, Gemeinschaft Schutz, Solidarität und Sicherheit. (vgl. ebd.)
Für das Ausgangsproblem, eine Konkurrenzsituation nämlich, bedeutet dies, dass per se eigentlich abstrakte, nur partiell in den einzelnen Funktionssystemen vorhandene und deshalb tendenziell nicht sichtbare Konkurrenz plötzlich durch die identitätsstiftende Form der Nation und die damit verbundene Grenzziehung als klare Konkurrenten am Horizont erscheinen. Die verunsicherten Beobachter ihrer eigenen sozialen Umwelt erkennen nun plötzlich die vermeintlich Verantwortlichen für die Knappheit die ihre persönlichen Chancen einschränkt. Die Anderen sind Schuld, und wir nicht. Wird, wie im Falle der Form der Nation, über Form auch noch eine kulturelle Einheit suggeriert, dann kann diese Kultur auf die gesamte Person, auf jedes Mitglied dieses Kollektivs übertragen werden. Kultur kann dann also als eine zusätzlich erzeugte Inklusionsmöglichkeit betrachtet werden. (vgl. Nassehi/Richter 1998:158ff)
Wenn der gerade beschriebene Fall für eine Nation zutrifft, in der sich das staatstragende Kollektiv bspw. durch die Inklusionen von ethnischen Minderheiten in spezifische Funktionssysteme benachteiligt fühlt, oder die Relation der Inklusionsmöglichkeiten der Minderheit, bspw. im Zuge von Statusunsicherheiten als nicht angemessen auffasst, dann werden die Grenzziehungen der beiden Kollektive in den politischen Diskurs eingebracht. Das politische System des klagenden Kollektivs A (der Staat A), das seinen Machtanspruch, wie bereits gesagt, durch das Verfolgen des Gemeinwohls für eben dieses Kollektiv A (der Nation A) begründet, ist dann gezwungen - will es seine Machtansprüche weiter behalten - die Ansprüche seines Kollektivs A (der Nation A) gegenüber denen des anderen Kollektivs B (der Minderheit B) zu schützen. (vgl. Richter 1997:71)
Das gleiche Szenario ist natürlich auch bei zwei Nationen gegeneinander denkbar. Allgemeiner formuliert lässt sich sagen, dass dem Staat die Rolle des Beschützers der Partikularinteressen seines Kollektivs in der Weltgesellschaft zukommt. Zusammengefasst können wir also auch hier festhalten, dass erst die Politisierung ethnischer Differenzen die Hauptvoraussetzung für ethnische und nationale Konflikte ist. (vgl. Richter 1997:72)
Es dürfte allerdings in den vorangegangenen Abschnitten deutlich geworden sein, dass sich die Wahrnehmung der Differenzen nicht an Tatsachen orientieren muss - und dies in aller Regel auch nicht tut - sondern, dass empfundene Bedrohungen durch fremde Kollektive ebenfalls von Zuschreibungen abhängen (vgl. Richter 1997:71), wobei diese Zuschreibungen in aller Regel ohne jegliche Trennschärfe daherkommen, bspw. "die Asylanten". Hauptsache es wird deutlich, dass die "Anderen", die Außenseite der Form also, gemeint ist (vgl. Nassehi/Richter 1998:158).
In einer Krisen- oder extremen Konkurrenzsituation kann sich diese Zuschreibung dann bis auf das Extrem verengen, dass alles außerhalb des eigenen Kollektivs nicht nur als fremd, sondern als feindlich wahrgenommen wird, denn das andere Kollektiv hat ja wie bereits mehrfach gezeigt "Schuld" an der schlechten Position des eigenen Kollektivs. In Fällen von Gefährdungen von sozialen Leistungen oder als existenziell notwendig wahrgenommenen Ressourcen treten nationale Semantiken als Beobachtungsprogramme auf den Plan und regeln die binäre Codierung in innen und außen, respektive in gut und böse. (vgl. Richter 1997:72)
Nationalismus in seiner negativen Konnotation bzw. seiner xenophoben Spielart entsteht also dann, wenn Ungleichheiten oder Verschiedenheiten zwischen Regionen oder Ethnien nach diesem Muster erklärbar und nachvollziehbar gemacht werden sollen. (vgl. Richter 1997:71f) Oftmals lässt sich auch beobachten, dass in einer ethnisch-national gefärbten Konflikt- oder Knappheitssituation, ähnlich den oben beschriebenen Situationen, ein Kollektiv dem anderen gegenüber einen Überlegenheitsanspruch geltend macht, insbesondere wenn es sich bei einer der beiden Gruppen um eine Minderheit handelt (vgl. Nassehi/Richter 1998:158).
Wenn sich eine solche Sicht einmal etabliert hat, dann liegt es nahe, dass sie nicht nur schwer rückgängig zu machen ist, sondern auch, dass das Eigene gegen alles Fremde zu verteidigen ist (vgl. Richter 1997:73). Am Ende dieser Entwicklung ist ein reziprokes, soziales Konfliktsystem entstanden, in dem sich alle Seiten gegenseitig am Leben erhalten (vgl. Richter 1997:73f). Welche Ausmaße ein solches Szenario annehmen kann, brauche ich m.E. an dieser Stelle nicht auszuführen, dazu reicht ein kurzer Blick auf die europäische Geschichte des letzten Jahrhunderts.
2.5 Fazit
Nation und Ethnizität sind askriptive Konstrukte, die den Einschluss in die kollektive Identität, die von ihnen symbolisiert wird, durch Ausschluss regeln. Das Verhältnis zu den Anderen, zur Nicht-Nation, zur Außenseite wird somit einerseits über Selbstidentifikationen, andererseits über Zuständigkeiten bestimmt (Bielefeld 1991:99). Überdies kommt den beiden Konzepten eine Kompensationsfunktion zur Überwindung von Identitätsverunsicherungen in der funktional differenzierten Gesellschaft zu.
Wir beobachten die Welt also, indem wir uns selbst bezeichnen (Selbstidentifikation) und durch das Setzen der Unterscheidung die Zuständigkeiten bestimmen. Auf diese Art entsteht ein relativ geschlossenes Weltbild, das automatisch alles Schlechte, Unheimliche, Kranke (vgl. Hahn 1994:151ff), etc auf die Außenseite, weil es nun einmal nicht in das Eigene, sondern ins Andere gehört. Ganz egal, ob es ursächlich wirklich von dort kommt oder nicht. Ein derart geschlossenes Weltbild verteidigt sich selbst indem es alle störenden, besser-wissenden oder unheimlichen Meinungen oder auch konkurrierenden Tatsächlichkeiten der Außenseite zuweist und sich somit wieder selbst bestätigt. (vgl. Nassehi Richter 1998:168)
Fremdenfeindlichkeit ist somit eine emergente Folge des konsequenten Anwendens der Form der Nation (vgl. Nassehi/Richter 1998:164).
3. Die Außenseite: Analysen zur Soziologie des Fremden
Fremdheit ist kein objektives Verhältnis, es ist eine askriptive Definition einer Beziehung und hängt als solche immer auch von dem verwendeten Fokus ab, mit dem diese Beziehung untersucht werden soll (vgl. Hahn 1994:140). Diese kurze Definition von Fremdheit dürfte in den oben gemachten Bestimmungen bereits deutlich geworden sein. Nur durch die Unterteilung der Welt in ein Wir und ein Ihr, nur durch die Bestimmung von Innen und Außen, nur durch Grenzziehungsprozesse also, kann Fremdes überhaupt erst festgelegt werden. Dadurch, dass Staaten sich über gerade diese Askriptionen konstituieren, bzw. über diese konstruiert und kommuniziert werden, lässt sich so etwas wie institutionalisierte Fremdheit (Hahn 1994:141) beobachten. Der Staat als Institution übernimmt gewissermaßen die Einteilung in fremd/vertraut für seine Bürgerinnen und Bürger. Auch Hahn versteht diese Prozesse als Differenzierungsfolgen:
„Die Gestalt des Fremden im modernen Sinne - also die des Ausländers, der im Inland besondere Funktionen wahrnimmt - hängt mit den eigentümlichen Problemen zusammen, die sich einer Gesellschaft stellen, die sich auf funktionale Differenzierung umstellt.“ (Hahn 1994:142)
Wie aber lassen sich die vielfältigen Probleme die sich aus diesem Verhältnis, und insbesondere aus der Tatsache ergeben, dass moderne Nationalstaaten tendenziell gegen alles Fremde wirken, ja auf Grund ihrer Struktur wirken müssen angehen? Fremdenfeindlichkeit und interethnische Konflikte sind immer noch Begleiterscheinungen der Moderne und besitzen m.E. immer ein Konfliktpotential, das in kürzester Zeit sozialen Katastrophen[21], und dies - je nach Fokus für den Begriff "soziale Katastrophe" - auch täglich tun.
Im Folgenden soll hier untersucht werden, was das Verhältnis von Fremdheit soziologisch bestimmt und gleichzeitig auch ein wenig nach Lösungsmöglichkeiten für die modernen Konflikte Ausschau gehalten werden.
3.1 Die Klassiker: Simmel und Schütz
3.1.1 Der Fremde als Prototyp der Moderne? Georg Simmels Bestimmung des Fremden
Georg Simmels kurzer Exkurs über den Fremden gilt gemeinhin als der Klassiker in der Soziologie des Fremden schlechthin. Kaum eine Analyse zu diesem Thema kommt ohne den Verweis auf Simmels Definition des Fremden als denjenigen, der „heute kommt und morgen bleibt“ (Simmel 1983:509) aus. Fremdheit wird für Simmel erst in dem Moment soziologisch relevant, in dem der vormals Wandernde im Raum der Autochthonen physisch präsent wird. Diese Präsenz ist Voraussetzung für eine Wechselwirkung zwischen dem Fremden und seiner Umwelt, und ohne Wechselwirkung erhält das Verhältnis keine soziologische Relevanz. Dabei wird diese spezielle Wechselwirkung von einer Ambivalenz aus physischer Nähe einerseits und sozialer Distanz andererseits bestimmt (ebd.). Diese Feststellung ist in meinen Augen sowohl auf vormoderne, traditionale, homogene Gesellschaften, als auch auf funktional differenzierte, heterogene, (post)moderne Gesellschaften anwendbar.
Denn diese Bestimmung leistet neben der Beschreibung für Einwanderer in stabile, geschlossene Gesellschaften (wie Simmel es am Beispiel des Händlers illustriert (Simmel 1983:510)) auch eine abstraktere Analyse über das Ausmaß von empfundener Nähe und Ferne, welches die Fremdheit ebenfalls mitkonstruiert. Wenn Fremdheit die Außenseite von Verbundenheit, empfundener Gemeinsamkeit und sozialer Nähe darstellt, dann wächst der Grad der empfundenen Fremdheit proportional zu dem Grad von nur allgemeinen Gemeinsamkeiten. Mit empfundener sozialer Nähe verhält es sich natürlich dementsprechend umgekehrt[22]. (vgl. Simmel 1983:511)
Schroer sieht in Simmels Analyse des Fremden sogar noch das Potential ein Chiffre für den Menschen in der Moderne an sich (Schroer 1997:22) entworfen zu haben. Denn der Fremde sei der Initiator der Anonymität in den modernen, auf Wirtschaftlichkeit aufbauende Gesellschaftsform. Die Ambivalenz von Innen und Außen charakterisiere auch die bereits beschriebene Inklusions-/Exklusionsproblematik in Bezug auf Identitätsbildung in einer funktional differenzierten Gesellschaft (vgl. Schroer 1997:21f). Nassehi empfindet Simmels Analyse hingegen als zu einseitig, da sie nur auf Eindringlinge in stabile Gemeinschaften abziele (vgl. Nassehi 1999:183). Es kann zwar festgehalten werden, dass der Ausgangspunkt von Simmels Beobachtungen sicherlich stabile, als mehr oder weniger homogen angesehene Gesellschaften sind, dass aber gerade seine abstraktere Bestimmung der Charakteristika von Fremdheit auch auf moderne, funktional differenzierte Gesellschaftsformen anzuwenden sind.
3.1.2 Wissenssoziologisch beobachtete Assimilation: Der Fremde bei Alfred Schütz
Alfred Schütz wissenssoziologische Betrachtung des Fremden - ebenfalls ein Klassiker - geht im Gegensatz dazu aber unzweifelhaft von stabilen In-Groups und deren "Denken-wie-üblich" (Schütz 1944:58) aus, das auch mit dem Begriff einer relative stabilen Weltanschauung bezeichnet wird (ebd.). Das Handeln der Mitglieder der In-Groups basiert auf dieser Weltanschauung, und läuft an Hand von Rezepten für Standardsituationen relativ routiniert ab. Schütz zeichnet nun den Verlauf der Ankunft eines Neuankömmlings in die fremde In-Group nach. Erfährt der Fremde, dass er das Denken-wie-üblich und die damit verbundenen Handlungsrezepte und Weltanschauungen auf Grund seiner individuellen, zu den Autochthonen differenten, Sozialisation nicht teilt, durchläuft er eine "persönliche Krisis" (Schütz 1944:59) und muss seine eigene Weltanschauung in Frage stellen. Dieser Zustand bewirkt einerseits die Objektivität[23] des Fremden (Schütz 1944:68), andererseits befindet er sich in einem Dilemma, da er seine enkulturierten Rezepte in der neuen Umgebung nicht mehr anwenden kann. Der Fremde ist hier eine ambivalent Handelnder mit zweifelhafter Loyalität (ebd.), der auf der Grenze von zwei verschiedenen Weltsystemen wandelt (vgl. Schütz 1944:62). Der Weg aus diesem Dilemma führt über die Aneignung der neuen Weltanschauung: er muss seine eigene in die fremde übersetzen (vgl. Schütz 1944:63f). Dieser Vorgang der Anpassung wird bei Schütz denotativ als Voraussetzung zum Erhalt von "Schutz und Obdach" (Schütz 1944:69) präsentiert, der das Problem[24] des Fremden, und somit den Fremden letztlich selbst aus der Welt schafft[25] (vgl. ebd.). Es wird in diesem Ansatz also nicht die soziostrukturelle Genese die zur Konstruktion des Fremden beiträgt, oder der Umgang mit ihm untersucht, sondern vielmehr beschrieben, wie „das Problem“ durch Assimilation beseitigt werden kann (vgl. Nassehi/Schroer 1999:104).
3.2 Das ewig Unentscheidbare als Feind der modernen Ordnung: der Fremde bei Zygmunt Baumann
Zygmunt Baumans Analyse des Fremden sieht ihn als eine generell unentscheidbare Kategorie, als permanente Ambivalenz die dem vertrauten Freund/Feind Antagonismus diametral entgegen läuft.
„Es gibt Freunde und Feinde. Und es gibt Fremde.“ [Hervorhebung im Original] (Bauman 1991:23)
Bauman geht also davon aus, dass das Ordnungsschema der modernen Welt von einer binären Unterscheidung in Freund und Feind, bzw. in Innen und Außen lebt[26]. Freunde bezeichnen in dieser Ordnung das Positive, während Feinde das Negative symbolisieren. Dieser antagonistische Grenzziehungsprozess ermöglicht den Individuen Kategorisierungen und ist somit Voraussetzung für ein bequemes, an Denken-wie-üblich und Rezepten (um Schütz Terminologie zu verwenden) orientiertes, sicheres Alltagsleben. Dieser sich so bildende Antagonismus ist seinerseits vertraut. Der Fremde rebelliert nun seinerseits (passiv) aber gegen diesen Antagonismus, da er wegen seiner Unentscheidbarkeit nicht in diesen, die moderne Gesellschaft konstituierenden, Ordnungsrahmen einzuordnen ist. Weil er also das gesamte System durch seine bloße Anwesenheit in Frage stellt, bedeutet seine Anwesenheit eine Gefahr für die Gesellschaft selbst. (vgl. Baumann 1991:25) Gerade wegen dieser Unentscheidbarkeit fordert der Fremde indirekt dazu auf, sich aktiv mit ihm zu befassen. Diese Auseinandersetzung führt dann zu der Erkenntnis, dass der Fremde sowohl Elemente des Freundes als auch des Feindes in sich vereinigt, was die Unentscheidbarkeit ja letztendlich bestätigt und bei den Beobachtern Unbehagen auslöst. (vgl. Bauman 1991:29) Zudem löst der Fremde (wie Simmel bereits zeigte) die Trennung zwischen physischer Nähe und sozialer Distanz auf, und hat als potentiell Wandernder (Simmel 1983:509) ein größeres Potential seine Umgebung zu verlassen, als die Autochthonen, was eine Bindung an ihn zusätzlich erschwert (vgl. Bauman 1992:30f).
Nationalstaaten treten als soziale und territoriale Ordnungsmacht folglich immer dann auf den Plan, wenn der Fremde in ihren Zuständigkeitsbereich eindringt. Ihre Aufgabe sei es laut Bauman, Freunde und Feinde in ein Ordnungsraster zu drücken und diesen Antagonismus als vertraut zu etablieren.
„Die vorrangige Aufgabe des Nationalstaats besteht darin, das Problem des Fremden, nicht das des Feindes, anzugehen.“ (Bauman 1991:33)
Denn Nationalismus sei aus dem Bedürfnis heraus entstanden, sozialen und politischen Arrangements Sinn zu verleihen, und die Häufigkeit von hermeneutischen Problemen, durch territoriale und funktionale Segmentierung zu reduzieren (vgl. ebd.).
Das Fremde trägt aber, wie schon gesagt, durch seine Anwesenheit im Nationalstaat nicht zu dieser Reduzierung bei, und stellt sich deshalb gegen die Ordnungsabsichten des Staates. Dieser wiederum braucht den Nationalismus zur eigenen Stärkung und umgekehrt. Denn die "Kollektivierung von Freundschaft" ist ein nicht zu vernachlässigender Kraftakt, der wiederum ohne Solidarität und Gemeinschaftsgefühle nicht zu schaffen sei. An diese Stelle treten die imaginierten Gemeinschaften (Anderson), sprich der Nationalismus. Als Gegenleistung manifestiert der Staat den Nationalismus mittels der Staatsbürgerrechte und garantiert somit implizit die vorherrschende Ordnung. Aufgrund dieser Koalition lässt sich dann beobachten, dass die Nationalstaaten ihre Mitglieder zu "Eingeborenen" erklären, und Tendenzen in Richtung kulturelle, sprachliche, ethnische, etc. Einheit fördern.
„Anders gesagt: Nationalstaaten fördern Uniformität.“ (Bauman 1991:34)
Nationalstaaten haben also dieser These nach, etwas gegen den Fremden einzuwenden. Das geht sogar soweit, dass sie nicht nur etwas ein- sondern auch etwas anzuwenden heben: Mechanismen die das Fremde verschwinden lassen sollen. Bauman unterscheidet zwei Mechanismen in Anlehnung an Lévi-Strauss als (anthropo)phagisch und (anthropo)emisch. Die phagische Strategie könnte auch mit Assimilation oder Integration übersetzt werden. Ihr Ziel ist es, den Fremden in ein Glied des eigenen Kollektivs umzuwandeln. Die emische Strategie hingegen zielt darauf ab, den Fremden aus dem eigenen Kollektiv auszuschließen, sei es durch Ausweisung, durch Wegsperren oder gar durch Eliminierung. Beide Mechanismen hätten, so Bauman, in der Moderne ihre Blütezeit erlebt, bzw. erleben diese immer noch (vgl. auch die verschiedenen Staatsbürgerschaftskonzepte in Abs. 2.3.2.) (vgl. Bauman 1999:37ff)
Im Kontext dieser Arbeit - auch im Anschluss an Schütz` Analyse des Fremden - ist vor allem Assimilation interessant. Bauman übersetzt Assimilation, auch in gewisser Weise etymologisch, als ein nicht selbstgesteuertes, gleichmachendes Umwandeln mit dem Ziel Uniformität zu erzeugen (vgl. Bauman 1991:36f). Assimilation sei der Krieg der Nationalstaaten gegen - die Ordnung zerstörende - Ambivalenz des Fremden. Aus Sicht der Staaten ist Assimilation demnach ein notwendiges Instrument um ihre Macht, sprich das Ordnungsmonopol in gut/böse, Ordnung/Chaos aufrecht zu erhalten. Das vom Staat präferierte Muster der Lebensweise, Kultur, etc. wird durch Assimilation verbreitet und konkurrierende Ansichten zu Lebensweisen, Werten und Normen sowie der Ordnung an sich werden auf diese Art eliminiert. (vgl. Bauman 1991:37f) Wenn wir diese Argumentation von der entgegengesetzten Seite aus verfolgen, dann bedeutet Differenz in unserem Kontext ein Zeichen dafür, das Ziel die gesellschaftliche Ordnung zu bestimmen und den Status Quo der Machthierarchie, nämlich die unterstellte Überlegenheit einer bestimmten Weltanschauung gegenüber einer anderen, nicht erreicht zu haben (vgl. Bauman 1991:38f).
Für die als different, bzw. von dieser Ordnung abweichenden, stigmatisierten Menschen bedeutet der aus diesen Gründen vorangetriebene Assimilationsdruck, die eigene Weltanschauung in Frage zu stellen. Die so behandelten Menschen durchlaufen dann eine "persönliche Krisis" im Sinne von Schütz (vgl. Abs. 3.1.2). Es entsteht in einer forcierten Sichtweise also eine Art Konkurrenzkampf der Weltanschauungen, der ohne den nationalstaatlichen Assimilationsdruck erst gar nicht entstanden wäre, und somit auch keine Konflikte hätte generieren können (vgl. Baumann 1991:39).
Ich werde an dieser Stelle vorerst darauf verzichten, die Thesen Baumans weiter auszuführen (und damit verzichte ich implizit letztendlich auch auf eine Diskussion seiner Diskussion des Projekts der Moderne), da seine Theorie des Fremden im Rahmen dieser Arbeit auch nur in ihren wesentliche Grundzügen erfasst werden soll. Es sei aber noch vermerkt, dass Bauman m.E. mit zwei Kategorien des Fremden arbeitet: die hier dargestellte könnte als politische oder kulturelle Kategorie verstanden werden. Daneben stellt Bauman noch eine zweite Kategorie an, die, in Anschluss an Simmel und Schroer, mit Generalisierung und Verschwinden der Fremdheit in der modernen (funktional differenzierten) Gesellschaft umrissen werden könnte. Demnach leben die modernen Formen der Vergesellschaftung (um Simmels Terminologie zu verwenden) von der strukturellen Fremdheit, die sie hervorbringen (vgl. Abs. 1.4). Bedingt durch diese strukturelle Fremdheit werden alle allen gegenüber zu Fremden, und wenn es alle sind, ist es keine mehr (vgl. Bauman 1999:35-66; Schroer 1997:29ff). (Näheres zu der Generalisierungsthese siehe 3.4.2)
3.3 Der Fremde als Vertrauter (Feind) bei Armin Nassehi
Nassehis Ansatz zur Untersuchung der Soziologie des Fremden wirft den Klassikern (Schütz, Simmel, Park) vor, dass ihre Analysen der Fremdheit von stabilen In-Groups ausgehen, und deshalb die Annahme, Gesellschaften seien tatsächliche, homogene, integrierte Gemeinschaften stützen. Diese Annahme steht aber im Gegensatz zur Theorie der funktionalen Differenzierung, die, wie bereits erläutert, das genaue Gegenteil postuliert. Die Frage nach der strukturellen Genese von Fremdheit fände ebenfalls nicht statt[27] (vgl. Nassehi 1995:446f).
In einem kurzen Exkurs zur soziokulturellen Evolution der Fremdheit stärkt Nassehi z.T. Baumans Ansatz[28], indem er darauf hinweist, dass in einfachen Sozialformen der Fremde tatsächlich nicht in den vertrauten Fremd/Feind Antagonismus eingeordnet wurde, sondern als generell Unvertrautes und Unentscheidbares galt. Allerdings entwickelte sich aus dieser Herangehensweise graduell eine Ethik des Gastrechts, deren Ziel mittel- bis langfristig die Einordnung des Fremden in den vertrauten Antagonismus ist. Dies geschieht mit Hilfe von ritualisierten Techniken, durch die dann geprüft werden soll, ob der Fremde den nun als Freund oder als Feind zu werten sei. (Nassehi 1995:449f)
Mit der gesellschaftlichen Entwicklung weg von segmentären Formen, hin zu stratifikatorischen Strukturen erhielt der Fremde dann auch politische Relevanz: wesentlich für seine Bewertung war nun die Frage, in wie weit er das politische System stützt oder ihm schadet. Im Ergebnis führte dies zu einer politischen Funktionalisierung des Fremden, die dann letztlich auch eine größere Formenvielfalt des Fremden bedingt:
„Im Vergleich zu einfachen Gesellschaften vermochte es das stratifizierte System der europäischen Neuzeit, eine größere Formenvielfalt des Fremden aufzubauen und damit auch eine Diversität von Populationen und gewisse Toleranzwerte zu entwickeln. Erfunden wurde hier zweierlei: zum einen der politische Fremde, zum anderen - damit zusammenhängend - eine komplexere Form des Umgangs mit dem Fremden [...].“ (Nassehi 1995:450) [Hervorhebungen im Original]
Der Umgang mit den Fremden wurde also zweckgerichteter, von politischen und wirtschaftlichen Interessen geleiteter auf der einen Seite, und reflexiver auf der anderen Seite, da der Fremde zwar weiterhin das tendenziell Unentscheidbare bleibt, der Umgang mit diesem Unentscheidbaren aber im Laufe der Zeit routinierter, sprich vertrauter wurde. Der Fremde - so Nassehi - befindet sich zwar immer noch auf der äußeren Seite des Freund/Feind Antagonismus, aber dieser Antagonismus ist mittlerweile selbst vertraut. (vgl. ebd.)
Dadurch kann der Fremde ebenfalls zum Faktor politischer Planung werden, was aber eine Reziprozität des Verhältnisses nicht ausschließen muss. (vgl. ebd.)
Der moderne Nationalstaat entwickelte dann folglich auch Mechanismen, um den Fremden innerhalb seiner politischen Möglichkeiten in sein Kalkül einbeziehen zu können. Als wesentlichster ist hier natürlich das Konzept der Staatsbürgerschaft zu nennen, auf das ich ja bereits in Abs. 2.3.2 detaillierter eingegangen bin. Zusätzlich fungieren, wie ebenfalls bereits dargelegt, nationale Ein -, bzw. Ausschlusssemantiken als Identifikationsfolien (vgl. 2.4). Ergänzend sei hier noch hinzugefügt, dass gerade der Fremde sich, so Nassehi, sehr gut als "negative Identifikationsfolie", also als "identitätsstiftender Außenhorizont" eigne (vgl. hierzu den Formbegriff von Richter, Abs. 2.4). (vgl. Nassehi 1995:450-454)
Die zweite wichtige Frage, die Nassehi untersucht. ist wann oder wie der Fremde denn nun zum Feind wird. Denn, und dies ist das auf den ersten Blick Paradoxe an Nassehis Ansatz, um zum Feind zu werden muss er zuerst einmal in den vertrauten Antagonismus verortet werden können. Der Fremde kann also eigentlich nur zum Feind werden, wenn er ein Vertrauter geworden ist. (vgl. Nassehi 1995:455)
Um schließlich zum Feind zu werden, müssen für den Fremden zwei Faktoren erfüllt sein: Erstens muss er als solcher sichtbar und identifizierbar sein, was impliziert, dass er zumindest zu Beginn seiner gesellschaftlichen Relevanz noch jenseits des vertrauten Antagonismus zu entdecken und zu kategorisieren war. Zweitens muss er im Laufe der Zeit mit den Autochthonen um knappe Ressourcen konkurrieren, bzw. ihm (es können natürlich auch Kollektive sein) muss diese Konkurrenz wenigstens zugeschrieben werden können. In diesem Fall greifen dann die bereits in Abs. 2.4.4 beschriebenen Mechanismen, die bei Konkurrenz oder Statusängsten die "Schuldigen" immer wieder gerne auf der Außenseite des eigenen Kollektivs wahrnehmen. (vgl. Nassehi 1995:455ff) Die Thesen lassen sich also wie folgt zusammenfassen:
„Der Fremde [...] wird tatsächlich dann zum Feind, wenn er in den vertrauten Antagonismus innergesellschaftlicher Zuschreibungen und Gruppenkonstruktionen eingeordnet werden kann. Diese Einordnung mutiert in der Regel dann zur Feindschaft, wenn sich Fremde aufgrund ihrer Sichtbarkeit als Zurechnungsfokus für Konflikte um knappe Ressourcen anbieten. Dadurch wird die Position des Fremden paradox: der Fremde als Feind erscheint als ein Vertrauter.“ (Nassehi 1995:457f) [Hervorhebung im Org.][29]
3.4 Lösungsansätze: "Mulit-Kulti", Generalisierung und Vergegnung
Die zuvor vorgestellten Ansätze aus der Soziologie des Fremden enthalten keine expliziten Vorschläge, wie das Problem, welches die moderne Gesellschaft mit den Fremden hat, bzw. deutlicher formuliert, das Problem mit Nicht-Staatsbürgern und -bürgerinnen, zu lösen sei. (Auf eventuelle implizite Hinweise wird in der Schlussdiskussion noch eingegangen werden.) Schütz Hinweis darauf, dass der Fremde bei Assimilation verschwindet ist m.E. aber an dieser Stelle nicht zu diskutieren, da erstens die Moderne Fremdheit braucht und somit generiert, und zweitens Bauman zeigt, welche Probleme durch Assimilation(sdruck) erst erzeugt werden.[30]
Im Folgenden sollen exemplarisch zwei Lösungsvorschläge aufgegriffen und kurz diskutiert werden, die Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung liefern wollen. Dabei handelt es sich bei der Multikulturalismus Debatte um eine in der Gesellschaft tatsächlich anzutreffende Diskussion, während der Ansatz zur Generalisierung der Fremdheit wohl eher als soziologieinterner Diskurs zu werten sein dürfte.
3.4.1 Zur Multikulturalismus Debatte
Seit den späten 80er, vor allem aber seit den 90er Jahren hält der Ausdruck der "multikulturellen Gesellschaft" verstärkt Einzug in Politik, Medien, Kultur, soziale Verbände und auch Wissenschaft in Deutschland. Der Grund für die, wie viele Theoretiker mit Verweis auf andere Staaten meinen, verspätete (vgl. Radtke 1991:80ff) Diskussion muss wohl hauptsächlich als beharrliche Weigerung der bundesrepublikanischen Gesellschaft betrachtet werden, den realen gesellschaftsstrukturellen Realitäten ins Auge zu sehen. Die faktische kulturelle Heterogenität wurde einfach lange nicht thematisiert[31]. Nun galt es also "neue Spielregeln" zu finden, die das Zusammenleben verschiedener ethnisch-kultureller Gruppen neu ordnet (vgl. Radtke 1991:81).
Dabei war und ist interessanterweise zu beobachten, dass sowohl im linken als auch im rechten politischen Spektrum der Tatbestand dieser Heterogenität, oder der diese beschreibende Terminus, nicht angezweifelt wird. Es scheint beinahe einen gesamtgesellschaftlichen Konsens darüber zu geben, dass der Multikulturalismus in Deutschland zu einer Art neuen Realität geworden ist (vgl. Nassehi 1997). Die resultierenden Forderungen, bzw. Vorschläge für den Umgang mit diesem "Phänomen" sind freilich höchst unterschiedlich[32].
Es soll uns an dieser Stelle aber nicht die Beschreibung sozialer Verhältnisse interessieren, sondern vielmehr der in der Multikulturalismus Debatte zu findende Lösungsansatz zum Umgang mit dem Fremden. Nach Radtke könnte man hier auch von einer "pädagogischen Programmatik" sprechen, die von der Gesellschaft fordert, ethnisch-kulturellen Differenzen mit gegenseitigem Respekt und Toleranz zu begegnen, und die Unterschiede vielmehr als kulturell spannende Bereicherung zu erleben, anstatt sie als Auslöser für Diskriminierung zu benutzen (vgl. Radtke 1991:82).
„Der Diskurs des Multikulturalismus versteht sich als eine Aufforderung an die Gesellschaft, mit Hilfe einer Neuinterpretation der entstandenen Situation das Verhältnis zu den Fremden moralischer, das heißt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der "Menschenwürde", die sonst in der Gesellschaft gültig sind, zu bewältigen.“ (Radtke 1991:90).
Auf einer rein moralischen, humanistischen oder auch xenophilen Ebene kann diesem Konzept sicherlich nichts Negatives nachgesagt werden. In seiner semantischen, diskursiven Praxis entstehen allerdings einige wesentliche Folgen, oder "Nebenwirkungen" (Radtke 1991:91), die dem, was eigentlich durch die Debatte, bzw. die Programmatik erreicht werden soll entgegenarbeiten (vgl. Radtke 1991:90f, Nassehi 1997:183). Denn, durch die Thematisierung, bzw. übermäßig starke Betonung der Vielfalt und Pluralität von Ethnizitäten und Kulturen in einer dann multikulturellen Gesellschaft werden die Differenzen und die darauf beruhenden Grenzziehungen weiter aufrecht erhalten, wenn nicht sogar verstärkt. Der Diskurs als solcher dient also eher dem, was er überwinden will, als dem, was er erreichen möchte. (vgl. Nassehi 1997:183, Radtke 1991:91f)
Mit Bezug auf Nassehis in Abs. 3.3 dargelegten Ansatz könnte man auch sagen, dass der Diskurs einerseits die nationalen Einheitssemantiken weitertransportiert, andererseits, und dies scheint mir der wesentlichere Aspekt zu sein, dafür sorgt, dass Fremdes eindeutig sichtbar wird. Vielleicht lässt sich diese These an Hand der Feststellung belegen, dass auch die diversen "Das Boot ist voll!" - Argumentationen, deren einzige Grundlage ja naturgemäß Grenzziehungskonstruktionen ethnischer, bzw. kultureller Art sind, sich ohne ihre Argumentationsstruktur ändern zu müssen in die Debatte einbringen können.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass der "pädagogische" (Radtke) Gedanke hinter der Multikulturalismus Debatte sicherlich sehr viele gute bzw. gut-gemeinte Ansätze besitzt und ausgesprochen positive moralische Ziele verfolgt. Auf der anderen Seite manifestiert die Diskussion aber weiter die bestehenden Konstruktionen von Fremdheit und Vertrautheit, von Nation und Kultur, welche der eigentliche Auslöser für das Entstehen der Debatte ist und war.
In bezug auf unsere Eingangsfrage nach Lösungsansätzen muss hier also festgehalten werden, dass der Multikulturalismusdiskurs in der Form, wie er bisher geführt wurde keine zufriedenstellende, langfristig wirkende Lösung darstellt.
3.4.2 Generalisierung der Fremdheit
Wie in Kapitel 1 bereits beschrieben, zeichnet sich die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft in ihrem öffentlichen Leben unter anderem durch eine Reduktion von Individuen, respektive Akteuren auf ihre jeweiligen situationsspezifischen Funktionsrollen aus. So werden im alltäglichen intersubjektiven Arbeits- oder Kommunikationsprozess reine Funktionsträgerschaften und Anonymität zur Basis für das Funktionieren der modernen Gesellschaftsform. Oder anders ausgedrückt: Fremdheit wird zur - in diesem Fall sogar strukturell unvermeidbaren - Basis für das Funktionieren funktionaler Teilsysteme (vgl. Hahn 1994:162). Funktionale Differenzierung lebt demnach also nicht nur von Fremdheit, sondern erzeugt sie vielmehr auch. Fremdheit wird in der Moderne somit generalisiert, und letztendlich (zumindest in dieser Logik) durch diese Generalisierung auch eliminiert. Denn, „wenn jeder ein Fremder ist,“ so Zygmunt Bauman, „dann ist es keiner.“ ((Bauman 1992:126) zitiert nach Schroer 1997:29)
Der dezidierte Ort, an dem sich diese These am besten beobachten ließe ist bereits bei Georg Simmel (vgl. 1995), spätestens bei Richard Sennett (vgl. 1983) oder auch etwas aktueller bei Zygmunt Bauman (vgl. Bauman 1999) die Stadt. Das moderne Leben in seiner Reinform sei das urbane Leben, so der Tenor der aufgeführten Autoren. In der Stadt begegne man ausschließlich Fremden, dort sei jeder fremd (vgl. ebd.).
Diese Universalität der Fremdheit als konstitutiv für die Moderne anzunehmen bedeutet implizit dann auch, dass sich in diesem Ansatz zwar einerseits ein Lösungsansatz verbirgt, dieser dann aber auf der anderen Seite an empirischen Tatsachen vorbeigeht, denn in den vorangegangenen Abschnitten wurden die beschriebenen Konflikte und Problempotentiale allesamt auf die gesellschaftliche Ordnung der Moderne bezogen.
Bauman schlägt dennoch vor, dem Problem, welches sich in der Begegnung, also im konkreten Umgang, mit dem Fremden verbirgt durch eine Ver gegnung aufzuheben. Die Vergegnung zeichne sich dadurch aus, dass sie Personen von einer moralischen Befassung mit dem Fremden befreit. (vgl. Schroer 1997:31) In die Systemtheorie übersetzt bedeutet das also in etwa, dass der öffentliche Bereich auf reine Funktionsrollenübernahme reduziert werden soll.
Radtke weist darauf hin, dass hier eine Art von Individuum gefordert wird, das der Fragmentierung seiner Identität, bzw. der strukturellen Desintegration der Gesellschaft gleichgültig bis wohlwollend gegenübersteht (Radtke 1991:94). Unabhängig davon, dass solche Personen wohl nur schwer zu finden sind, - wenngleich es sie sicherlich geben wird - sprechen die empirischen Beobachtungen, und nicht zuletzt die darauf beruhenden, in dieser Arbeit vorgestellten, Analysen der Moderne eine andere Sprache. Dieser Ansatz bringt - zumindest in der momentanen gesellschaftsstrukturellen Situation - ebenfalls keinen Fortschritt.
Literaturliste:
- Anderson, Benedict 1996: Die Erfindung der Nationen. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt/M. / New York
- Bauman, Zygmunt 1991: Moderne und Ambivalenz, in:. Bielefeld, Uli (Hg.): Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der alten Welt?, Hamburg
- Bauman, Zygmunt 1992: Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit, Frankfurt/M
- Bauman, Zygmunt 1999: Unbehagen in der Postmoderne, Hamburg
- Beck, Ulrich 1983: Jenseits von Stand und Klasse? in: Kreckel (Hg.): Soziale Ungleichheit. Soziale Welt Sonderband 2, Göttingen, S. 35-74
- Bielefeld, Uli 1991: Das Konzept des Fremden in der Wirklichkeit des Imaginären, in: ders: (Hg.): Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der alten Welt?, Hamburg
- Eckert, Julia 1998: Ethnizität, ethnische Konflikte und politische Lösung - Theorien und Befunde im Überblick, in: Eckert, R. (Hg.): Wiederkehr des "Volksgeistes"? Ethnizität, Konflikte und politische Bewältigung, Opladen, S. 271-312
- Elwert, Georg 1989: Nationalismus und Ethnizität, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 41, S. 440-464
- Esser, Hartmut 1980: Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse, Darmstadt/ Neuwied
- Esser, Hartmut 1988: Ethnische Differenzierung und moderne Gesellschaft, in: Zeitschrift für Soziologie 17, S. 235-248.
- Esser, Hartmut 2000: Soziologie. Spezielle Grundlagen Bd. 6, Frankfurt/M
- Giordano, Christian 2000: Zur Regionalisierung der Identitäten und der Konflikte, in: Hettlage, Robert: Identitäten in der modernen Welt, S. 282-407
- Hahn, Alois 1994: Die soziale Konstruktion des Fremden, in: Sprondel, Walter M. (Hg.): Die Objektivität der Ordnung und ihre kommunikative Konstruktion, Frankfurt/M, S. 140-163
- Hahn, Alois 2000: Konstruktion des Selbst, der Welt und der Geschichte, Frankfurt/M.
- Heckmann, Friedrich 1991: Ethnos, Demos und Nation, oder: Woher stammt die Intoleranz des Nationalstaates gegenüber ethnischen Minderheiten?, in: Bielefeld, Uli (Hg.): Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der alten Welt?, Hamburg
- Henecka, Hans Peter 1994: Grundkurs Soziologie, Opladen, 5. Auflage
- Hobbes, Thomas 1970: Leviathan, Stuttgart (Org. 1651)
- Luhmann, Niklas 1994: Inklusion und Exklusion. in: Helmut Berding (Hg.): Nationales Bewußtsein und kollektive Identität. Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins der Neuzeit 2, Frankfurt/M., S. 15-45
- Mayntz, Renate 1988: Funktionale Teilsysteme in der Theorie funktionaler Differenzierung, in: Mayntz, Renate et al: Differenzierung und Verselbstständigung, Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme, Frankfurt/M. / New York
- Nassehi, Armin 1995: Der Fremde als Vertrauter. Soziologische Beobachtungen zur Konstruktion von Identitäten und Differenzen, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 47 (1995), S. 443-463
- Nassehi, Armin 1997: Das stahlhart Gehäuse der Zugehörigkeit, in: ders. (Hg.): Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität ethnischer Konflikte, Köln/Weimar/Wien, S.177-208
- Nassehi, Armin 1999: Differenzierungsfolgen, Beiträge zur Soziologie der Moderne, Opladen/Wiesbaden
- Nassehi, Armin/Richter, Dirk 1996: Die Form der Nation und der Einschluß durch Ausschluß. Überlegungen zur Fremdenfeindlichkeit in Deutschland, in: Sociologica Internationalis 34, S. 151-176
- Nassehi, Armin/Schroer, Markus 1999: Integration durch Staatsbürgerschaft. Einige gesellschaftstheoretische Zweifel, in: Leviathan H.1
- Radtke, Frank-Olaf 1991: Lob der Gleich-Gültigkeit. Die Konstruktion des Fremden im Diskurs des Multikulturalismus, in: Bielefeld, Uli (Hg.) , Das Eigene und das Fremde. Neuer Rassismus in der alten Welt?, Hamburg
- Richter, Dirk 1997: Die zwei Seiten der Nation. Theoretische Betrachtungen und empirische Beispiele, in: Nassehi, Armin (Hg.): Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität ethnischer Konflikte, Köln/Weimar/Wien, S. 59-83
- Rousseau, Jean-Jacques 1984: Diskurs über Ungleichheit. Paderborn/München/Wien/Zürich, S. 173
- Schimank, Uwe 1995: Theorien der gesellschaftlichen Differenzierung, Opladen
- Schimank, Uwe/Volkmann, Ute 1999: Gesellschaftliche Differenzierung, Bielefeld
- Schroer, Markus 1997: Fremde, wenn wir uns begegnen. Von der Universalisierung der Fremdheit und der Sehnsucht nach Gemeinschaft, in: Nassehi, Armin (Hg.): Nation, Ethnie, Minderheit. Beiträge zur Aktualität ethnischer Konflikte, Köln/Weimar/Wien, S. 15-39
- Schütz, Alfred 1972: Der Fremde. Ein sozialpsychologischer Versuch, in: ders, Gesammelte Aufsätze, Bd. 2: Studien zur soziologischen Theorie, Den Haag, 1972, S. 53-69.
- Sennett, Richard 1983: Verfall und Ende des öffentliche Lebens. Die Tyrannei der Intimität, Frankfurt/M
- Simmel, Georg 1983: Exkurs über den Fremden, in: ders. Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, Gesamtausgabe Bd. 2, Berlin, 6. Auflage, S. 509-512
- Simmel, Georg 1995: Die Großstädte und das Geistesleben, in: ders.: Aufsätze und Anhandlungen 1901-1908, Bd. 1, Frankfurt/M.
- Sieprath, Norbert 2001: Konstruktivistische Medientheorie. Zum Verhältnis von Systemtheorie und Cultural Studies, Aachen
- Stichweh, Rudolf 1988: Inklusion in Funktionssysteme der modernen Gesellschaft, in: : Mayntz, Renate et al: Differenzierung und Verselbstständigung, Zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilsysteme, Frankfurt/M. / New York
- Weber, Max 1956: Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 1, Tübingen, 4. Aufl.
[...]
[1] Ich verwende die Begriffe "Funktionale Teilsysteme", "Funktionssysteme", "Teilsysteme" und "Soziale Systeme" (im Sinne Luhmanns) in dieser Arbeit - auch um zu eintönige sprachliche Wiederholungen zu vermeiden - synonym.
[2] Es wird an späterer Stelle noch zu klären sein, was denn diese gesamte Gesellschaft ausmacht, bzw. was sie zusammenhält.
[3] Den Autopoiesisbegriff werde ich an dieser Stelle aus Platzgründen nicht weiter ausführen.
[4] Dies lässt sich vielleicht an einem Beispiel erläutern: Esser publizierte die These, dass die Theorie der funktionalen Differenzierung impliziere, dass mit fortschreitender Differenzierung kollektive Identitäten wie Ethnizität ihre Bedeutung verlieren. Nassehi kritisierte diesen Ansatz und Heckmann griff den Diskurs in seinem Essay auf damit ich an dieser Stelle eine theoretische Grundlage für meine Arbeit habe. Wissenschaft als System lebt von Kommunikation und verhält sich in diesem Kommunikationsprozess analog zu ihrem funktionalen Imperativ.
[5] Stichweh unterteilt die Inklusion in funktional differenzierten Gesellschaften an Hand ihrer jeweiligen Bezugsprobleme in der gesellschaftlichen Kommunikation in vier Formen: Erstens Inklusion als professionelle Betreuung (Rechtswesen, Gesundheitssystem), zweitens Inklusion über Exit-Voice-Optionen (Politik, Wirtschaft), drittens Inklusion in wechselnden Leistungs- und Publikumsrollen (Familie, intime Beziehungen), sowie viertens indirekte Inklusion am Sonderfall der Wissenschaft als System (vgl. Stichweh 1988:268-278).
[6] Allerdings bezieht sich die hier beschriebene Art der Inklusion auf eine exklusive Gruppe von Personen; auf wahlberechtigte StaatsbürgerInnen. Auf diese Problematik werde ich in Abs. 2.3.2 meiner Arbeit noch intensiver eingehen.
[7] Das Verhältnis ist aber keineswegs so einseitig, wie es im ersten Moment vielleicht erscheinen mag. Denn nicht nur die Funktionssysteme verzichten auf das Individuum als Ganzes. Auch die Personen müssen sich nur so weit in das Funktionssystem einbringen, wie es ihre Rolle in dem System erfordert. (vgl. Nassehi 1999:115)
[8] Ich wähle den Ausdruck "Gefühl" bewusst. Nach Anderson hätte ich auch sicherlich den Begriff "Vorstellung" verwenden können.
[9] So wird in der aktuellen Gesellschaftsform ein Aufruf zum Klassenkampf weniger Aussicht auf Gefolgschaft haben, als Aufrufe von Gruppen, deren Argumentation ethnisch-kulturell angelegt ist, bspw eine unterrepräsentierte Sprachgemeinschaft
[10] Ich werde in dieser Arbeit darauf verzichten, die Debatte zwischen Hartmut Esser und Armin Nassehi bzgl. des Vorwurfs Essers an die Systemtheorie, sie erkläre ethnische Konflikte nicht, sondern prognostiziere ihr Verschwinden (Esser 1988: "Ethnische Differenzierung und moderne Gesellschaft"); und Nassehis Antwort, Esser betreibe eine zu einseitige Lesart der Theorie, mit einer prompten Einbindung des Konzepts in dieselbe
[11] Mit einer derartigen Behauptung gäbe Nassehi ja Essers Ansatz im nachhinein doch recht.
[12] Gerade dieser Begriff verdeutlicht wie kaum ein anderer, dass die Erduldung des Leidens gewissermaßen die Voraussetzung des ewigen Lebens bedeutete.
[13] Andersons Argumentation zeigt sich insgesamt stark von marxistischen Denkweisen beeinflusst.
[14] Die politischen Vorgänge, so interessant und wichtig sie auch sind, werden wir hier aber noch nicht genauer betrachten. Wobei hier nicht der Eindruck entstehen soll, Sprachen und ihre Entwicklung seien die einzigen wirklich treibenden Kräfte bei der Herausbildung von Nation und Ethnizität gewesen. Eine solche Interpretation wäre zu kurzsichtig und würde auch schlichtweg historische Fakten verkennen, denn Sprache stand und steht in einem reziproken, interdisziplinären Verhältnis mit politischen, psychologischen, ökonomischen, etc Parametern. Vielmehr sollte hier die Anschlussfähigkeit von Nassehis Ansatz gezeigt werden.
[15] Bsp. für solche Verpflichtungen wären etwa Kriegsdienst, Steuern, etc.
[16] Die Einführung eines, sich auf dieses Prinzip beziehenden Staatsbürgerschaftsrechts erfolgte im übrigen 1913.
[17] Die Debatte wird zwar geführt, aber alleine die Art und Weise der Argumentation verdeutlicht und belegt unsere Thesen.
[18] "Heimat" meint in diesem Kontext den tatsächlichen Lebensmittelpunkt.
[19] Der Ansatz geht zurück auf Spencer-Brown.
[20] Vielleicht ist unter gewissen Voraussetzungen auch der Begriff der Ethnizität ebenso passend wie der der Nation. Richter jedenfalls benutzt ihn in diesem Kontext nicht. M.E. nach dürfte das Konzept aber auch problemlos auf den Begriff Ethnie, bzw. Ethnizität übertragen werden. Zumal die beiden Konzepte, besonders im ethnischen Nationalismus, ohnehin nicht immer völlig trennscharf sind.
[21] Unter "sozialen Katastrophen" verstehe ich hier Erscheinungen wie Kriege, Rassismus, Fremdenhass, ethnisch motivierte Gewalttaten, etc. .
[22] Wenn wir uns das an einem Beispiel illustrieren, dann würde man sich zu der Kommilitonin im Seminar nicht besonders verbunden fühlen, da ihre Anwesenheit im Seminar ein normaler Zustand ist. Die empfundene Gemeinsamkeit wäre allgemein. Treffen sich die gleichen Personen auf einem großen Konzert in einer anderen Stadt dann wäre in diesem Moment die Gemeinsamkeit der beiden (das gemeinsame Studium) wesentlich weniger allgemein, die empfundene Nähe deshalb größer. Treffen sich die beiden dann in Australien wäre die auf Grund des gemeinsamen Studiums empfundene Nähe noch größer. Diese Analyse ist deshalb m.E. auch auf moderne Gesellschaften anwendbar, weil sie nicht auf einer bestimmten gesellschaftsstrukturellen Annahme beruht, sondern das abstrakte Verhältnis von sozialer Nähe und Distanz beschreibt.
[23] Schütz vertritt hier ein ähnliches Verständnis von Objektivität wie Simmel
[24] Wenn "Problem" nicht wissenssoziologisch gemeint ist, dann ist es m.E. gesamtgesellschaftlich konnotativ.
[25] Interessant an Schütz` Ansatz scheint mir die Art und Weise zu sein, in der er den Assimilationsprozess als "Muss" darstellt: "[...]Prozeß der sozialen Anpassung, dem sich der Neuankömmling unterwerfen muß[...]"(Schütz 1944:69). Mir leuchtet es zwar ein, dass eine Assimilation das alte gegen das neue Denken-wie-üblich austauschen wird und damit die soziale Integration des Fremden und sein psychisches Wohlbefinden fördern kann, aber die Möglichkeit des Behaltens der alten Weltanschauung wird nicht berücksichtigt, Das mag einerseits an der sozialpsychologischen Perspektive der Analyse liegen, unterstellt aber gleichzeitig auch eine kulturelle Homogenität, ja sogar eine tendenzielle Gleichheit der Erfahrungen der In-Group. Je nach Lesart könnte m.E. nach diese Argumentation als eine Art Verpflichtung des Fremden sich anzupassen gedeutet werden.
[26] Baumans Ansatz ist nicht systemtheoretisch eingefärbt. Dennoch lässt sich seine These in diesem Punkt m.E. mit dem Modell der Nation als Form vergleichen, bzw. daran anschließen. Im Ergebnis jedenfalls laufen beide Argumentationen auf das gleiche hinaus.
[27] wobei ich bereits zu zeigen versuchte, dass dieser Vorwurf zwar bei Schütz und Park zutreffen mag, bei Simmel allerdings nur bedingt, da ein Teil seiner Analyse auch auf eine abstraktere Ebene, als auf die des bloßen Eindringlings in eine Gesellschaft von Autochthonen abzielt. Denkt man Nassehis These weiter, dann könnte man sogar den Vorwurf formulieren, sie betrieben eine Identifikationspolitik im Interesse der Nationalstaaten.
[28] Nassehi begrüßt hier allerdings nur Baumans Vorschlag den Fremden außerhalb des Freund/Feind Antagonismus zu verorten, Die These, dass die sich Moderne generell nach dieser ordne teilt Nassehi jedoch nicht.
[29] Als Beleg für seine These führt Nassehi eine Studie von Hartmut Esser zur Arbeitsmigration an, die ich hier aber nur kursorisch wiedergeben möchte: Demnach führt die Einwanderung von ArbeitsmigrantInnen anfänglich zu einer ethnischen Schichtung, da sie nur Nischen besetzen, die die Autochthonen nicht besetzen wollen, vielleicht auch nicht besetzen können. Diesem neuen interethnischen Schichtgefüge wohnt sogar trotz der horizontalen Schließung eine gewisse Stabilität inne, da es die (ungleiche) Verteilung von (knappen) Ressourcen legitimiert und eindeutige Zuschreibungen von Positionen ermöglicht. Eine Integration erfolgt nur in dem Maße, in dem es die einzelnen Teilsysteme (respektive der Arbeitsmarkt) erfordern. Diese zwischenzeitliche Stabilität des Gefüges fällt aber dann in sich zusammen, wenn die zweite Generation - also die in der "Fremde" Aufgewachsenen - stärker in das gesamtgesellschaftliche Gefüge eindringt und dementsprechend auch formalrechtliche und tatsächliche Gleichstellung und Gleichbehandlung einfordert, und versucht, diese auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Wenn dieser formalen Gleichstellung dann auch eine wirkliche Gleichbehandlung folgt, dann wird der Fremde, der zuvor lediglich seine Arbeitskraft für Bereiche angeboten hat, die die Autochthonen nicht nachgefragt haben, seinerseits plötzlich zum Nachfrager auch der Bereiche, die von den Autochthonen sehr wohl nachgefragt werden. Es kommt zu einer unmittelbaren, sichtbaren Konkurrenz zwischen den Fremden und den Autochthonen (vgl. Esser 1980, zitiert nach Nassehi 1995:455f).
[30] Es sei allerdings angemerkt, dass Schütz an keiner Stelle von durch Nationalstaaten erzwungener Assimilation spricht. Vielmehr soll Assimilation in seinen Augen dazu dienen, dem Neuankömmling wieder ein soziales Umfeld zu schaffen
[31] Auch die aktuelle Zuwanderungsdebatte zeigt, wie schwer sich Deutschland damit tut, den Status Quo als ethnisch verfasster Staat anzukratzen. Dass Deutschland faktisch ein Einwanderungsland ist, wird kaum angezweifelt (höchstens aus dem bürgerlichen bis rechten Lager bedauert). Dass Deutschland nun aber auch ein offizielles Einwanderungsland werden könnte (was die Verhältnisse höchstens unwesentlich verändern würde) will so gut wie niemand. Diese paradoxe Situation zeigt in meine Augen, wie sehr sich die BRD immer noch als ethnisch homogener Staat verstehen will.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes?
Der Text widmet sich dem Thema kollektiver Identitäten und der Soziologie des Fremden, hauptsächlich aus einer systemtheoretischen Perspektive, die sich an der Theorie der funktionalen Differenzierung orientiert. Der Fokus liegt auf den Arbeiten von Armin Nassehi und darauf, wie die moderne Welt und der Erfolg kollektiver Identitäten wie Ethnizität und Nation als Folge des Differenzierungsprozesses verstanden werden können.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis erwähnt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Themen: Vorwort, Einführung in Begriffe der Systemtheorie und der Theorie der funktionalen Differenzierung (funktionale Teilsysteme, Kommunikation, Inklusion/Exklusion, Folgen der funktionalen Differenzierung), Ethnizität und Nation (Begriffsbestimmung, Genese des Nationalismus, ethnischer Nationalismus, Staatsbürgerschaft), Die Außenseite: Analysen zur Soziologie des Fremden (Simmel, Schütz, Bauman, Nassehi, Multikulturalismus, Generalisierung der Fremdheit), und eine Literaturliste.
Was sind funktionale Teilsysteme laut dem Text?
Funktionale Teilsysteme sind gesamtgesellschaftlich relevante, institutionalisierte und funktionsspezifische Handlungszusammenhänge, deren wesentliches Merkmal ein spezieller Sinn (funktionaler Imperativ) ist. Sie erbringen spezifische Leistungen für andere Teilsysteme, wobei ihr Hauptzweck die Funktion für die gesamte Gesellschaft ist.
Wie werden Ethnizität und Nation definiert?
Ethnizität wird als ein Konzept beschrieben, das sich aus soziokulturellen Gemeinsamkeiten, historischen Erfahrungen, einer Vorstellung gemeinsamer Herkunft, kollektiver Identität (basierend auf Selbst- und Fremdzuschreibung), ethnischer Grenzen und einem Solidarbewusstsein zusammensetzt. Nationen werden als "vorgestellte Gemeinschaften" betrachtet, die durch Kommunikation, Symbole und Semantiken konstruiert werden.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Genese des Nationalismus?
Die sprachliche Vereinheitlichung, insbesondere durch den Buchdruck und die Verwendung von Landessprachen in Verwaltung und Bildung, trug wesentlich zur Entstehung von Nationalbewusstsein bei. Sprachgemeinschaften wurden sich ihrer Existenz bewusst, und es entstanden neue Kommunikationssysteme, die den Ursprung national vorgestellter Gemeinschaften bildeten.
Was ist ethnischer Nationalismus?
Ethnischer Nationalismus strebt nach einer ethnisch-kulturell homogen verfassten Nation, deren ethnische Grenzen mit den staatlichen Grenzen übereinstimmen sollen. Er begreift Nationen als homogene Personengruppen nach Herkunft, Kultur, Sprache und Geschichte.
Welche Konzepte zur Soziologie des Fremden werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Konzepte von Simmel (der Fremde als jemand, der "heute kommt und morgen bleibt"), Schütz (Assimilation des Fremden durch Aneignung der neuen Weltanschauung), Bauman (der Fremde als ewig Unentscheidbarer) und Nassehi (der Fremde als Vertrauter (Feind)).
Was sind die Lösungsansätze zur Problematik des Fremden, die im Text diskutiert werden?
Der Text diskutiert die Multikulturalismus-Debatte und den Ansatz der Generalisierung der Fremdheit. Die Multikulturalismus-Debatte betont Respekt und Toleranz gegenüber kulturellen Unterschieden, wird aber kritisiert, weil sie Differenzen und Grenzziehungen verstärken kann. Die Generalisierung der Fremdheit argumentiert, dass Fremdheit in der modernen Gesellschaft universalisiert wird und somit ihre Bedeutung verliert, was jedoch empirisch nicht immer zutrifft.
Was bedeutet "Nation als Form" nach Dirk Richter?
Dirk Richter analysiert die Nation als einen Beobachtungsmodus, eine semantische Form, mit der die Welt aus einer distinkten Perspektive bestimmbar gemacht wird. Die Nation ist demnach ein Konstrukt, das durch seine Form der Beobachtung der Welt gleichzeitig das hervorbringt, was es sieht, nämlich "Nation(en)".
Wie wird Fremdenfeindlichkeit im Text erklärt?
Fremdenfeindlichkeit wird als eine emergente Folge des konsequenten Anwendens der Form der Nation betrachtet. Durch das Setzen von Grenzen (Innen/Außen) und Zuschreibungen entstehen Stereotypen, die bei Konkurrenz um Ressourcen zur Abwertung des Fremden führen können.
- Quote paper
- Daniel Houben (Author), 2002, Nation, Ethnizität und ihre Außenseite. Eine Analyse aus dem Blickwinkel der Theorie funktionaler Differenzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107567