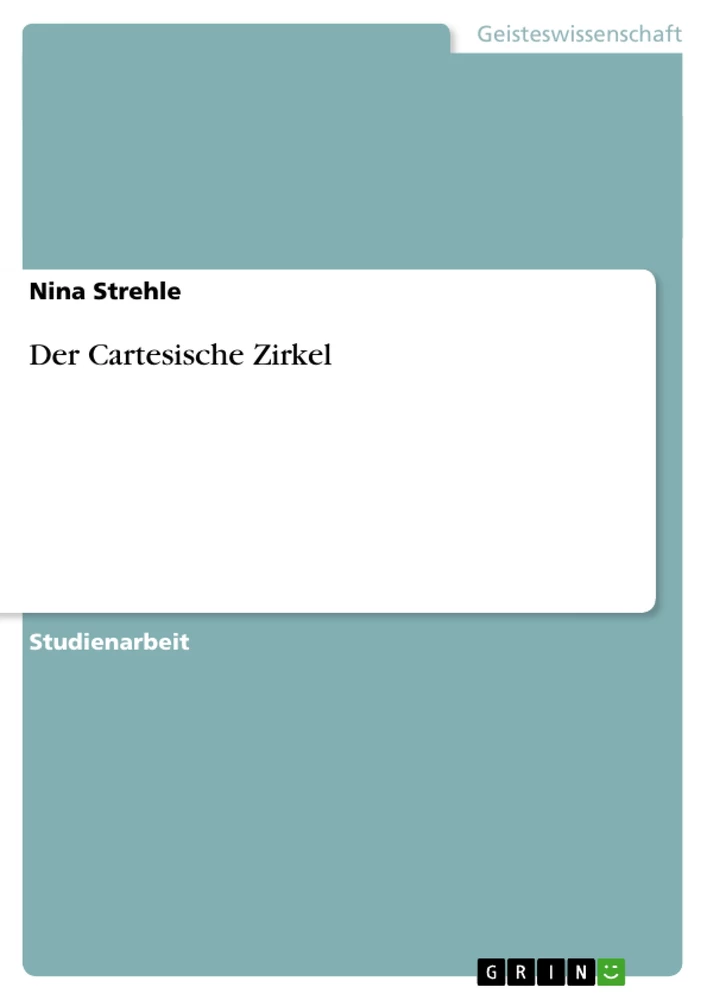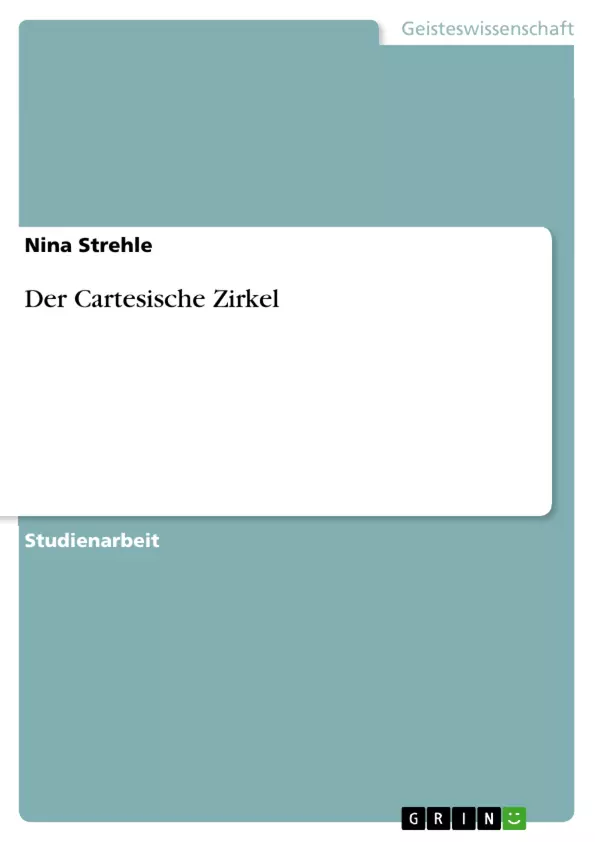Meine Hausarbeit beschäftigt sich mit der Dritten Meditation aus Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, in der RENÉ DESCARTES versucht, die Existenz eines nicht-täuschenden Gottes zu beweisen. Dieser ist notwendig, um die Wahrheit von klaren und deutlichen Wahrnehmungen zu garantieren, denn ein betrügerischer Gott könnte mich in allem täuschen, was sich mir selbst am offensichtlichsten darstellt.
Im ersten Abschnitt meines Textes werde ich das sogenannte Wahrheitskriterium erläutern, aus dem DESCARTES folgert, dass unsere Ideen von den Dingen fraglos existieren müssen, auch wenn die Anwesenheit unserer Umwelt noch unsicher ist.
Daher ist es im zweiten Abschnitt notwendig, die Natur der Ideen und ihrer Ursachen zu untersuchen, um schließlich ein Ergebnis über die Idee Gottes, die wir in uns haben, und ihren Ursprung zu erhalten. Nach Ansicht des Verfassers gibt es Grade an Realität, d.h. manchen Ideen/Dingen kommt eine höhere Wirklichkeit zu als anderen. Er nennt die Wirklichkeit von Ideen objektive Realität, die von Objekten formale Realität. Da sich Ursache und Wirkung in ihrer Wirklichkeit entsprechen müssen, kann nur der Schöpfer die einzige Ursache unserer Idee von ihm sein, da Gott als Ursprung die höchste formale Realität und die Idee von ihm die höchste objektive Realität enthält. Dieser Allmächtige kann kein Betrüger sein, andernfalls würde ihm ein Mangel zukommen. Ausgehend von diesem Ergebnis kann schließlich das Wahrheitskriterium bestätigt werden.
Gegen DESCARTES′ Argumentation ist der Vorwurf gemacht worden, sie sei zirkulär, da man nicht gleichzeitig das Wahrheitskriterium und die Existenz Gottes wissen könne. Das eine setze das andere voraus. Im dritten Abschnitt werde ich deshalb die wichtigsten Interpretationsversuche aus der Sekundärliteratur (ausgehend von GEORGE DICKER) darstellen, die sich bemühen, DESCARTES′ Beweisführung als nicht-zirkulär auszuweisen.
Zuerst werde ich die vindication-not-needed strategy erläutern, die davon ausgeht, dass der Gottesbeweis nicht gebraucht werde, um momentane klare und deutliche Wahrnehmungen, sondern um die Zuverlässigkeit der Erinnerung an vergangene Überlegungen zu gewährleisten [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- DESCARTES' Wahrheitskriterium
- Von der Idee Gottes zu Gott
- Die Natur der Ideen
- Objektive und formale Realität
- DESCARTES' Argumentation
- Der Cartesische Zirkel
- Die vindication-not-needed strategy und die memory defense
- Die criterion-not-needed strategy und die general rule defense
- DESCARTES' validation of reason und abschließende Bermerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Descartes' Gottesbeweis in dessen "Meditationen über die Grundlagen der Philosophie", insbesondere die Frage der Zirkularität seines Arguments. Die Arbeit untersucht Descartes' Wahrheitskriterium und dessen Rolle im Gottesbeweis, die Natur der Ideen und den Zusammenhang zwischen objektiver und formaler Realität. Sie befasst sich auch mit verschiedenen Lösungsansätzen aus der Sekundärliteratur, die versuchen, den Vorwurf der Zirkularität zu entkräften.
- Descartes' Wahrheitskriterium ("Was immer ich klar und deutlich wahrnehme, ist wahr")
- Der Gottesbeweis und die Überwindung des radikalen Zweifels
- Die Natur der Ideen und der Unterschied zwischen objektiver und formaler Realität
- Der Vorwurf der Zirkularität in Descartes' Argumentation
- Interpretationen und Lösungsansätze zur Vermeidung des Zirkelschlusses
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert das Thema der Arbeit: die Analyse von Descartes' Gottesbeweis in der dritten Meditation und die Auseinandersetzung mit dem Vorwurf der Zirkularität. Sie gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit und die behandelten Aspekte, wie das Wahrheitskriterium, die Natur der Ideen und die verschiedenen Interpretationsansätze zur Vermeidung des Zirkelschlusses. Die Einleitung stellt klar, dass der Gottesbeweis für Descartes essentiell ist, um die Zuverlässigkeit klarer und deutlicher Wahrnehmungen zu gewährleisten, da ein betrügerischer Gott diese in Frage stellen könnte. Der Fokus liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit Descartes' Argumentation und den verschiedenen Lösungsvorschlägen aus der Sekundärliteratur.
DESCARTES' Wahrheitskriterium: Dieses Kapitel erläutert Descartes' Wahrheitskriterium: "Was immer ich klar und deutlich wahrnehme, ist wahr." Es wird Descartes' Ausgangspunkt, das sichere Selbstbewusstsein ("Cogito, ergo sum"), und die daraus abgeleitete Gewissheit des Kriteriums dargestellt. Der Text verdeutlicht, dass dieses Kriterium zentral für Descartes' Philosophie ist, da es die Grundlage für die Überwindung des radikalen Zweifels bildet und die Möglichkeit objektiver Erkenntnis ermöglicht. Die klare und deutliche Wahrnehmung wird als intellektuelles Erkennen definiert, im Gegensatz zur bloß sinnlichen Wahrnehmung, und an Beispielen wie mathematischen Aussagen veranschaulicht. Die Bedeutung dieses Kriteriums im Kontext des Gottesbeweises wird hier vorbereitet.
Von der Idee Gottes zu Gott: Dieses Kapitel befasst sich mit der Natur der Ideen und Descartes' Argumentation für die Existenz Gottes. Es wird der Unterschied zwischen objektiver und formaler Realität eingeführt: Objektive Realität bezieht sich auf den Realitätsgehalt einer Idee, formale Realität auf die Realität des Objekts selbst. Descartes argumentiert, dass die Ursache einer Idee mindestens so viel Realität enthalten muss, wie die Idee selbst. Da die Idee Gottes die höchste objektive Realität besitzt, muss ihre Ursache – Gott – die höchste formale Realität besitzen. Dieser Gottesbeweis dient dazu, die Möglichkeit eines betrügerischen Gottes auszuschließen und damit die Gültigkeit des Wahrheitskriteriums zu sichern. Das Kapitel analysiert Descartes' Argumentationsschritte im Detail und bereitet den Boden für die Diskussion des Vorwurfs der Zirkularität.
Der Cartesische Zirkel: Dieses Kapitel thematisiert den Vorwurf der Zirkularität in Descartes' Gottesbeweis. Es präsentiert verschiedene Interpretationsversuche aus der Sekundärliteratur, wie die "vindication-not-needed strategy" und die "criterion-not-needed strategy", die versuchen, den Zirkelschlusses zu widerlegen. Die Analyse dieser Strategien zeigt deren Schwächen und Unzulänglichkeiten auf. Es wird gezeigt, dass diese Ansätze nicht erfolgreich die Kritik an der Zirkularität des Gottesbeweises entkräften können, und somit die Problematik der Argumentation von Descartes verdeutlicht. Das Kapitel bereitet den Weg für die Betrachtung einer alternativen Perspektive im folgenden Kapitel.
Schlüsselwörter
René Descartes, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Gottesbeweis, Wahrheitskriterium, klarer und deutlicher Wahrnehmung, objektive Realität, formale Realität, Cartesischer Zirkel, Zirkularität, Cogito, ergo sum, Gott, radikaler Zweifel, Sekundärliteratur, George Dicker, Gewirth, Frankfurt.
Häufig gestellte Fragen zu: Descartes' Gottesbeweis und der Cartesische Zirkel
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert René Descartes' Gottesbeweis in dessen "Meditationen über die Grundlagen der Philosophie" und untersucht insbesondere den Vorwurf der Zirkularität in seiner Argumentation. Die Arbeit beleuchtet Descartes' Wahrheitskriterium, die Natur der Ideen, den Unterschied zwischen objektiver und formaler Realität sowie verschiedene Lösungsansätze aus der Sekundärliteratur, die versuchen, den Zirkelschlusses zu entkräften.
Was ist Descartes' Wahrheitskriterium und welche Rolle spielt es im Gottesbeweis?
Descartes' Wahrheitskriterium lautet: "Was immer ich klar und deutlich wahrnehme, ist wahr". Es ist der Ausgangspunkt seiner Philosophie zur Überwindung des radikalen Zweifels und bildet die Grundlage für objektive Erkenntnis. Im Gottesbeweis dient es als Voraussetzung, um die Zuverlässigkeit von klaren und deutlichen Wahrnehmungen zu gewährleisten und die Möglichkeit eines betrügerischen Gottes auszuschließen.
Wie argumentiert Descartes für die Existenz Gottes?
Descartes argumentiert, dass die Ursache einer Idee mindestens so viel Realität enthalten muss, wie die Idee selbst. Da die Idee Gottes die höchste objektive Realität besitzt, muss seine Ursache – Gott – die höchste formale Realität besitzen. Dieser Gottesbeweis soll die Gültigkeit seines Wahrheitskriteriums sichern, indem er einen betrügerischen Gott ausschließt.
Was ist der "Cartesische Zirkel" und wie wird er in der Arbeit behandelt?
Der "Cartesische Zirkel" bezeichnet den Vorwurf der Zirkularität in Descartes' Gottesbeweis. Die Arbeit präsentiert und analysiert verschiedene Lösungsansätze aus der Sekundärliteratur (z.B. "vindication-not-needed strategy", "criterion-not-needed strategy"), die versuchen, diesen Vorwurf zu entkräften. Die Analyse zeigt jedoch die Schwächen dieser Strategien und verdeutlicht die Problematik von Descartes' Argumentation.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Einleitung (mit Themenüberblick und Problemformulierung), Descartes' Wahrheitskriterium (Erläuterung und Bedeutung), Von der Idee Gottes zu Gott (Descartes' Gottesbeweis und die Unterscheidung zwischen objektiver und formaler Realität), Der Cartesische Zirkel (Analyse des Zirkularitätsvorwurfs und Lösungsansätze) und abschließende Bemerkungen. Jedes Kapitel analysiert einen spezifischen Aspekt von Descartes' Argumentation und diskutiert relevante Sekundärliteratur.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: René Descartes, Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, Gottesbeweis, Wahrheitskriterium, klare und deutliche Wahrnehmung, objektive Realität, formale Realität, Cartesischer Zirkel, Zirkularität, Cogito, ergo sum, Gott, radikaler Zweifel, Sekundärliteratur.
Welche Sekundärliteratur wird in dieser Arbeit berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Autoren der Sekundärliteratur, die sich mit Descartes' Gottesbeweis und dem Vorwurf der Zirkularität auseinandergesetzt haben. Genannt werden unter anderem George Dicker, Gewirth und Frankfurt, wobei die spezifischen Werke im Text selbst detaillierter aufgeführt sind.
- Quote paper
- Nina Strehle (Author), 1999, Der Cartesische Zirkel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10763