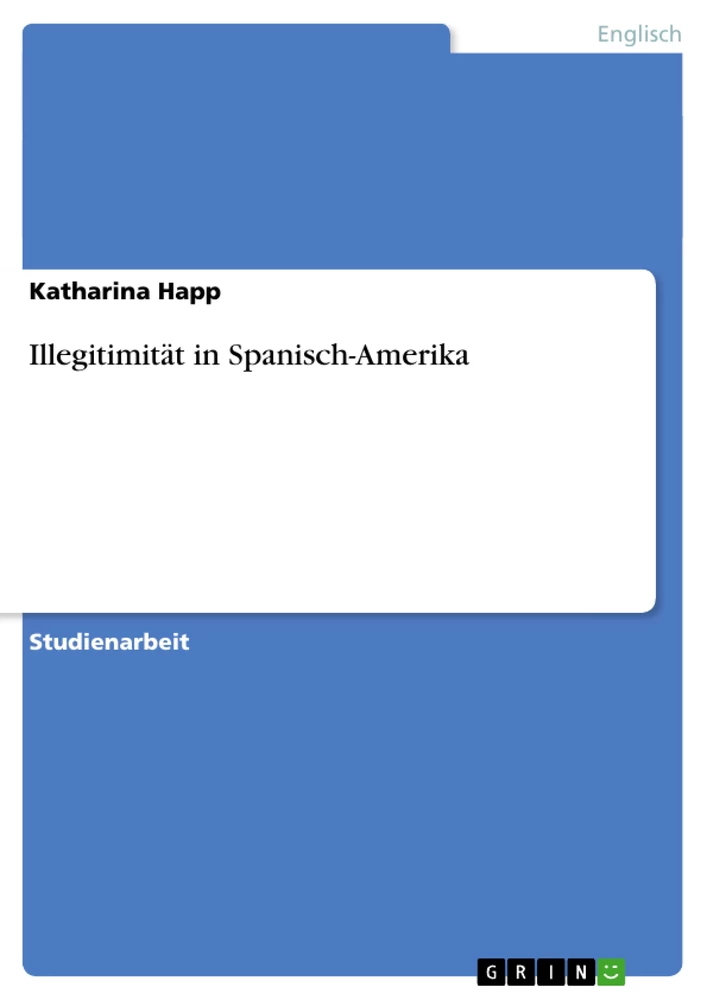Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Zur Definition von Illegitimität
1. Rechtliche Grundlagen
1.1. Ehe
1.2. Barragania und Konkubinat
1.3. Kinder aus illegitimen Beziehungen
2. Einfluss der Kirche
3. Populäre Vorstellungen
3.1. Spanische Traditionen
3.2. Indigene und afrikanische Traditionen
4. Auswirkungen von Illegitimität
4.1. Der Prozess der “Mestizaje”
4.2. Strategien im Umgang mit Illegitimität
4.3. Legitimation
Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Einleitung: Zur Definition von Illegitimität
Die Familie stellte den Kern und die Basis der hispano-amerikanischen Gesellschaft dar. Ihr kam die Aufgabe der Wahrung und Vererbung bestimmter kultureller Bräuche und sozialer Strukturen zu. Dabei spielte Elternschaft eine wichtige Rolle bei der Vermittlung eines bestimmten gesellschaftlichen Status an die Nachkommen.[1] Der Geburtsstatus eines Kindes bezeichnet bestimmte Rechte und Pflichten, die durch eine Geburt unter gewissen Umständen erlangt werden: “All the relationships, property rights, etc. which a child acquires at birth by virtue of his legitimacy, whether through the father or through the mother.“ [2] Die Vorstellungen über die Bedingungen, die einen legitimen, also rechtmäßigen Geburtsstatus ausmachen, sind kulturbedingt. Das Vorhandensein oder Fehlen von Legitimität hat daher wichtige Auswirkungen auf den Status und die soziale Platzierung einer Person innerhalb der Gesellschaft.
In der hispano-amerikanischen Gesellschaft galt allein eine christliche, d.h. in facie ecclesia geschlossene Ehe als legitimer Ausgangspunkt einer Familiengründung. Legitimität betraf damit nicht allein den Status der Kinder, sondern auch den ihrer Eltern und letztendlich der gesamten Familie, die um den Erhalt ihres „rechtmäßigen“ Status in der Gesellschaft besorgt sein musste.
Während Legitimität auf diese Weise gesetzlich und moralisch eindeutig definiert war, stellte „Illegitimität“ ein weitaus komplexeres Phänomen dar: Potenziell galt zwar jeder andere Geburtsumstand und jede andere Form der Elternschaft (bzw. der sexuellen Beziehung, auch wenn keine Kinder geboren wurden) als „illegitim“.[3] Illegitimität bezeichnet also ein unrechtmäßiges Verhalten der Eltern ebenso wie den Status der unter diesen Umständen geborenen Nachkommen. Diese Unrechtmäßigkeit wurde aber innerhalb der gesellschaftlichen Gruppen (Staat, Kirche, Bevölkerung) auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet und nach unterschiedlichen Maßstäben beurteilt. Außerdem fand eine Abstufung der Unrechtmäßigkeit und der damit verbundenen moralischen Verwerflichkeit statt, die es möglich machte, dass bestimmte Formen von Illegitimität als weniger „schlimm“ beurteilt wurden als andere. Die Definitionen und Vorstellungen darüber, was nicht legitim und bis zu welchem Grad moralisch verwerflich war, sollen daher im Folgenden auf drei Ebenen dargestellt werden: Die spanische Familiengesetzgebung, in der sich die Definition von Illegitimität der Krone widerspiegelte, die moralischen und rechtlichen (kanonischen) Vorstellungen der Kirche, sowie die moralischen Einstellungen, die in der Bevölkerung vorherrschten und die vor allem durch spanische und indigene Traditionen beeinflusst waren.
Weiterhin soll darauf eingegangen werden, welche Bedeutung und Auswirkungen Illegitimität für die hispano-amerikanische Gesellschaft hatte und welche Strategien der Umgang mit dem Makel der Illegitimität mit sich brachte.
1. Rechtliche Grundlagen
Die Grundlagen für die neu zu erlassenden Gesetze in den eroberten Kolonien, mit dem Ziel ein eigenes Derecho Indiano zu schaffen, boten in erster Linie spanische, d.h. kastilische Rechtstraditionen.[4] Das Herzstück der spanischen Zivilgesetzgebung und damit des Familienrechts bildeten (formal als nachrangiges Gesetzeswerk) die Siete Partidas, die seit 1348 geltendes Recht waren[5], sowie seit 1505 die Leyes de Toro, die Reformen vor allem auf dem Gebiet des Erbrechts beinhalteten[6]. Die eigens für die besonderen Situationen in den Kolonien geschaffenen Gesetze des Derecho Indiano sollten in Amerika vorrangig gelten und das kastilische Recht als ergänzend herangezogen werden. Aufgrund der erheblichen Lücken des Derecho Indiano galt in weiten Teilen jedoch kastilisches Recht und damit die Siete Partidas. 1680 trat mit der Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias das erste eigens für die Kolonien geschaffene Gesetzeswerk in Kraft. Sie enthielt jedoch vorwiegend Staats- und Verwaltungsrecht und kaum neue zivilrechtliche Regelungen. Somit bestimmten die Siete Partidas als Kernstück des kastilischen Privatrechts das Familienrecht Lateinamerikas bis zum Ende der Kolonialzeit und der Unabhängigkeit der neuen Republiken.[7]
1.1. Ehe
Die Heirat wurde in der vierten Partida (Titel 2) als einzig legitime Form der Familiengründung[8] definiert, die als Sakrament einen universalen Wert darstellte. Sie war das Ideal einer Partnerschaft, die gegenseitiges Einvernehmen, Treue und Respekt voraussetzte und unauflösbar war.
“(Ley 1) Matrimonio es ayuntamiento de marido, e de muger, fecho con tal entencion de beuir ſiempre en vno, e de non ſe departir guardando lealtad cada vno dellos al otro, e no ſe ayuntando el varon, a otra muger, nin ella o otro varo[n] biuiendo ambos a dos. [...].
(Ley 3) Pro muy grande, e muchos bienes naſcen del casamiento, ſegud es dicho enel prologo deſta quarta partida. E avn ſin aquellos, ſeñaladamente ſe leuantan ende tres coſas, fe, e linaje, e ſacramento. [...] E el otro bien del linaje es, de fazer fijos para creſcer derechamente el linaje delos omes, e con tal entencion, deuen todos caſar, tanbien los que non pueden auer fijos, como los que los han. E el otro bien del ſacramento es, que nunca se deuen partir en su vida. [...].
(Ley 5) Conſentimiento ſolo, con voluntad de caſar, faze matrimonio, entre el varon, e la muger. [...].”[9]
Die Verlobung, deren Modalitäten in dem vorangehenden Titel (2) beschrieben werden, war keine notwendige Voraussetzung für die Schließung einer Ehe. Wenn sie aber vollzogen wurde, so galt sie als offizielles und rechtlich bindendes Eheversprechen[10].
Die Vorstellungen darüber, was einer legitimen Partnerschaft zuwiderlief, spiegeln sich in den Hinderungsgründen für eine Eheschließung wider. Als Umstände, die eine Ehe unrechtmäßig machten oder ausschlossen, galten (unheilbare) Demenz eines Partners (Ley 4), Zwang (15), ein entscheidender Irrtum bezüglich der Identität des zukünftigen Partners (10), die Unterschreitung des Mindestalters von 12 Jahren für die Frau und 14 Jahren für den Mann (6), nahe Verwandtschaft bzw. Inzest (12)[11], “unsinnige” Bedingungen (condiciones “torpes”), an die eine Ehe geknüpft wurde, die Ablegung des Keuschheitsgelübdes seitens eines Partners bzw. der Eintritt in ein Kloster (11), vorher begangener Gattenmord (14), unterschiedliche Religion (15), Impotenz (17), Ehebruch mit dem Versprechen einer zukünftigen Heirat (19), sowie Vergewaltigung oder Entführung (14).[12] Das erste Gesetz (s. Zitat S. 3) verbot implizit die Polygamie.
In der entstehenden hispano-amerikanischen Gesellschaft betraf die rechtliche Frage von illegitimen Eheschließungen vor allem drei Bereiche, in denen Antworten auf die spezifische Situation in den Kolonien gesucht wurden: (a) Polygamie seitens der indigenen Bevölkerung und Bigamie seitens der Spanier, (b) das Problem der Eheschließung bei unterschiedlichen Religions- und ethnischen Zugehörigkeiten[13], sowie (c) die freie Partnerwahl für Beamte, Abhängige, Sklaven oder Angehörige unterschiedlicher sozialer Schichten.
(a) Die Polygamie, die bei den Eliten der großen indigenen Gesellschaften (sowohl bei den Azteken in Mexiko als auch bei den Inka in Peru) in vorkolumbischer Zeit üblich war, stellte für die spanische Krone ein Problem dar. Während sie zu Beginn der Evangelisationsbestrebungen noch eine tolerante Übergangshaltung einnahm[14], schlossen sich die zivilen Autoritäten bald dem vehementen Kampf der kirchlichen Institutionen gegen die Polygamie an.[15] Verbote und Bestrafungen für ein (eheliches oder nicht-eheliches) Zusammenleben mit mehreren Frauen durch Ordenanzas der Audiencia Real galten für Getaufte und Ungetaufte gleichermaßen, anders als z.B. Bestimmungen über den Besuch der Messe oder den Empfang der Sakramente. Die rechtmäßige Ehefrau von polygamen Partnerschaften konnte nach kanonischem Recht nur die erste geheiratete Frau sein. In der Praxis wurde diese Regel auf dem ersten Konzil von Lima allerdings erweitert, so dass der Ehemann mit der Frau seiner Wahl zusammen bleiben konnte.[16] Aufgrund großer Unsicherheiten, Missverständnisse und „Erinnerungslücken” kam es allerdings zu zahlreichen Eheauflösungen und Neuverheiratungen durch kirchliche Autoritäten in der indigenen Bevölkerung.[17] Ein weiteres Problem stellte die Notwendigkeit dar, die abgelehnten Ehefrauen weiterhin zu versorgen, so dass während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zahlreiche Haushalte registriert wurden, in denen getaufte Indianer mit zwei oder mehr Ehefrauen zusammenlebten. Die fast ausschließlich monogamen „heidnischen“ Ehen der einfachen indigenen Bevölkerung wurden dagegen ohne Probleme nach dem „Naturrecht“ anerkannt.[18]
Die Vorfälle von Bigamie unter den Konquistadoren, die ihre Ehefrauen in Spanien hinterlassen hatten und in Amerika eine neue – meist politisch vorteilhaftere – Ehe schlossen, stellte die spanische Krone in der frühen Kolonialzeit ebenfalls vor ein neues Problem. Die Überprüfung des Familienstandes der in Amerika lebenden Spanier war Gegenstand mehrerer Cédulas zwischen 1538 und 1559.[19] Demnach sollten verheiratete Männer nur noch gemeinsam mit ihren Ehefrauen nach Amerika kommen und diejenigen, die ihre Ehefrauen in Spanien zurückgelassen hatten, bekamen 3 Jahre Zeit, um sie nachzuholen.[20] Auch einige Änderungen des Konzils von Trient (1545-1563) im Hochzeitszeremoniell, die 1564 in spanisches Recht eingingen, dienten u.a. diesem Ziel, indem genaue Nachforschungen über evtl. bereits bestehende Bindungen oder Ehen der Heiratswilligen und die vorherige öffentliche Ankündigung einer geplanten Hochzeit vorgeschrieben wurden.[21]
(b) Bereits in den Siete Partidas war die Heirat von Angehörigen verschiedener Religionen (also mit Juden, Moslems oder Häretikern) verboten, solange der „ungläubige“ Partner nicht zum Christentum konvertierte,[22] und gleiches galt in Bezug auf die indigene Bevölkerung Amerikas[23] sowie später auch für die afrikanischen Sklaven. Zu gemischt-religiösen Ehen kam es dennoch, wenn ein indigener Ehepartner konvertierte. Diese Ehen sollten nicht automatisch ungültig sein: Ein friedliches Zusammenleben konnte solange existieren, wie der heidnische Partner nicht den Christen von seinem Glauben abzubringen suchte oder eine Todsünde beging. Wenn das passierte, sollte der christliche Partner dreimal Besserung und Reue verlangen und wenn das keinen Erfolg hatte, konnte er seinen heidnischen Partner verstoßen und die Ehe auflösen.[24]
Interethnische Eheschließungen wurden von der spanischen Krone nicht verboten, allerdings wurden Unterschiede nach der ethnischen Zugehörigkeit gemacht. Heiraten zwischen Spaniern und der indigenen Bevölkerung wurden von der Krone zu Beginn der Kolonialzeit begrüßt, zum einen, um die häufigen nicht-ehelichen Beziehungen zwischen Spaniern und Indianerinnen zu unterbinden und zum anderen, um Verbindungen mit der indigenen Elite zu fördern. Bereits 1514 wurden „gemischte“ Ehen ausdrücklich erlaubt[25] und eine Real Cédula von 1525 bestätigte diese Haltung[26]. Eheschließungen mit der afrikanischen Bevölkerung wurden dagegen weniger gern gesehen, besonders zwischen Indianern und Schwarzen, und nach einer R.C. von 1541 sollten sich Schwarze ausdrücklich mit Schwarzen verheiraten.[27] Aber eine Bitte des Vizekönigs Martín Enríquez an Philipp II., diese Ehen zu verbieten, blieb erfolglos.[28]
(c) Das Prinzip der Freiwilligkeit der Ehe und damit die freie Partnerwahl wurde von Krone und Kirche zunächst gleichermaßen hochgehalten und in den Beschlüssen des Konzils von Trient ausdrücklich als ausschlaggebend für eine Eheschließung festgelegt. So blieb Sklaven oder Indianern einer Encomienda gegen den Widerstand ihrer Besitzer und Encomenderos die Eheschließung mit einem Partner aus einer anderen Encomienda oder eines anderen Sklavenbesitzers rein rechtlich ausdrücklich erlaubt.[29] Die gängige indigene Praxis, Töchter durch ihre Väter auch gegen deren Willen zu verheiraten, wurde in einer Real Cédula von 1623 verboten.[30] Umgekehrt war das Einverständnis der Eltern für eine Heirat ihrer (heiratsmündigen, s.o.) Kinder zunächst keine zwingende juristische Voraussetzung für die Gültigkeit einer Ehe – wenn auch meist ein starker sozialer Druck innerhalb der höheren sozialen Schichten bestand. Mit der Pragmática Sanción von 1776 und ihrer spezifischen Anwendung für die amerikanischen Kolonien 1778, wurde dagegen die Zustimmung der Eltern für die Heirat von Unmündigen (d.h. Frauen unter 28 und Männer unter 25 Jahren) notwendig[31]. Dadurch sollten vor allem heimliche und zwischen Angehörigen ungleicher sozialer Schichten geschlossene Ehen verhindert[32] und indirekt auch bestimmte interethnische Heiraten erschwert werden: So galt beispielsweise die Angehörigkeit zu den castas oder Schwarzen als „rationaler“ Verweigerungsgrund für die elterliche Zustimmung.[33] Die Auslegung der Pragmática spiegelte zugleich die Verflechtung von ethnischen Vorurteilen und Klassenbewusstsein der hispano-amerikanischen (meist kreolischen) Elite wider: So waren “mulatos, negros, coyetes e individuos de castas y razas semejantes” [34] von dieser Regelung ausgenommen; jene von ihnen, die ein hohes Ansehen genossen oder im Dienste der Krone standen[35] sowie die indigene Bevölkerung insgesamt fielen wiederum unter diese Regelungen und wurden insofern der spanisch-kreolischen Bevölkerung gleichgestellt.
Ehebeschränkungen gab es weiterhin für hohe Beamte der Kolonialverwaltung, denen es untersagt war, eine Frau aus ihrem Verwaltungsdistrikt zu heiraten.[36] Diese Regelung war in der Sorge um eine unabhängige Verwaltung und Justiz begründet und konnte von der Krone durch eine Heiratslizenz aufgehoben werden. Ehen, die trotz des Verbots geschlossen wurden, waren zwar nicht ungültig, wurden aber mit Amtsenthebung bestraft.[37]
1.2. Barraganía und Konkubinat
Während es auch am Ideal der Ehe unrechtmäßige Aspekte gab, so galt doch vor allem jede Art von sexueller Beziehung, die nicht innerhalb einer Ehe stattfand,[38] in der spanischen Tradition als illegitim und moralisch verwerflich. Trotzdem kannte die römisch-spanische Rechtstradition[39] mit der barraganía eine Form der nicht-ehelichen Partnerschaft, die zwar als moralisch zweifelhaft galt, aber trotzdem mit den (weltlichen) Gesetzen konform ging.[40] Ihr Status wurde ebenfalls in der vierten Partida (Titel 14) geregelt:
“Barraganas defiende ſanta egleſia, que no tenga ningu[n] chriſtiano, por que biue co[n] ellas en pecado mortal. Pero los ſabios antiguos que fizieron las leyes coſentieronles que algunos las pudieſſen auer ſin pena temporal, porque touieron que era menos mal, de auer vna que muchas. E porque los fijos que naſcieron dellas, fueſſen mas ciertos. [...]”
Die Voraussetzungen für eine barraganía waren ähnlich denen für eine Ehe: die Partner mussten frei, gesund und unverheiratet bzw. nicht durch ein religiöses Gelübde gebunden sein und die Partnerschaft in freiem Willen eingehen. Es galten z.T. ähnliche Rechte und Pflichten wie in einer Ehe, so z.B. Treue und sogar einige Vermögens- bzw. Erbansprüche.[41] Damit sollte die barraganía eine stabile, monogame Partnerschaft sein, die sich vor allem dadurch von der Ehe unterschied, dass sie nicht den Anspruch auf Unauflösbarkeit besaß.[42] Gerade dieser temporäre Charakter konnte ein Grund sein, eine barraganía einer Ehe vorzuziehen. Weitere Motive waren z.B. die juristische Unmöglichkeit[43] einer Eheschließung, oder große soziale Unterschiede zwischen den Partnern, bei denen eine Ehe auf starke gesellschaftliche Ablehnung gestoßen wäre oder (vermögens-)rechtliche Nachteile gebracht hätte.
Der relativ toleranten Haltung der spanischen Gesetzgebung gegenüber der barragnía als eine Partnerschaft zwischen Ledigen, die im Prinzip auch eine Ehe schließen könnten, standen andere Formen des Konkubinats gegenüber, die als eindeutig illegitim galten. Hierzu gehörten ehebrecherische Verbindungen und Beziehungen zu Geistlichen.
Verbindungen, in denen ein oder beide Partner verheiratet waren galten als illegitim und besonders moralisch verwerflich, da sie auf einem Ehebruch begründet waren. Ehebruch konnte nach den Siete Partidas [44] zwar von beiden Partnern angeklagt werden, soweit er erwiesen war. Der Ehebruch seitens der Frau war in der spanischen Tradition allerdings verwerflicher und konnte – anders als der umgekehrte Fall – ein Grund sein, die Ehe aufzulösen.[45]
Das Konkubinat mit einem Geistlichen, das im spanischen Mittelalter noch weit verbreitet und in unterschiedlichen lokalen fueros zum Teil sogar erlaubt war, wurde spätestens seit dem Konzil von Trient aufs Schärfste bekämpft und galt als Sakrileg[46]. Die Bestrafung dieser als “dañado y punible ayuntamiento” bezeichneten Beziehungen unterlag aber den kirchlichen Autoritäten.
Die zahlreichen Konkubinate mit indianischen Frauen seitens der Spanier während der Konquista und der Entstehung der hispano-amerikanischen Gesellschaft entsprachen ebenfalls meist nicht dem Charakter der barraganía, die auf eine möglichst stabile und eheähnliche Beziehung aus war. Besonders die auf Zwang basierenden Verhältnisse zu indianischen Frauen stellten sowohl für die Kirche als auch für die Krone vor allem ein moralisches Problem dar, das wegen der schlechten Vorbildfunktion bekämpft werden sollte. Eine R.C. von 1541 stellte fest:
“[...] A nos se ha hecho relación que en esa provincia hay muchos españoles que tienen en sus casas cantidad de indias a efectuar con ellas sus malos deseos, y que para lo remediar convernía mandásemos que ningún español tuviese en su casa india sospechosa, ni parida ni preñada salvo las que fuesen menester tasadamente para su cocina y servicio común [...].”[47]
Diese Beziehungen galten als verwerflich, weil es sich oft um kurzlebige, zur Promiskuität neigende und (seitens der Frau) oft unfreiwillige Verhältnisse handelte.[48] Ethnisch gemischte Konkubinate wurden von der Krone weitaus stärker bekämpft, als solche Ehen – auch hier wiederum vor allem afro-indianische Verbindungen, die mit teilweise brutalen Strafen geahndet wurden.[49]
Insgesamt lässt sich festhalten, dass es eine relativ größere Toleranz der Rechtssprechung gegenüber länger andauernden, stabilen und damit eheähnlichen Beziehungen gab, nicht nur in Bezug auf die legale barraganía, sondern sogar bei ehebrecherischen oder sakrilegischen Konkubinaten.
1.3. Kinder aus illegitimen Beziehungen
Der Status der Kinder, die in solchen illegitimen Beziehungen geboren wurden, war ebenfalls gesetzlich geregelt. Die Klassifizierung entsprach dabei der Art der Beziehung, die ihre Eltern eingegangen waren. Als legitim galten alle in einer Ehe (d.h. frühestens sechs Monate nach Eheschließung oder spätestens zehn Monate nach dem Tode des Ehemannes) geborenen Kinder. Lagen Ehehindernisse vor, die Eltern hatten aber in gutem Glauben geheiratet, so galt das Kind ebenfalls als legitim.[50] Alle anderen Kinder galten als illegitim aber ihr Status war unterschiedlich und wurde entsprechend der nicht legitimen Beziehung der Eltern bewertet:
- Als hijos naturales galten somit Kinder einer nicht-ehelichen Verbindung von Unverheirateten, deren Eheschließung keine gesetzlichen Hürden entgegenstanden.[51]
- Als hijos espurios galten alle übrigen Kinder und wurden je nach Umständen ihrer Geburt unterschieden in: adulterios (oder adulterinos), wenn sie das Produkt eines Ehebruchs waren, bastardos , wenn sie aus einer barraganía stammten, incestuosos , wenn sie in einer inzestuösen Beziehung gezeugt wurden[52], sacrílegos , wenn sie aus einer Verbindung mit einem Geistlichen hervorgingen und manceros , wenn sie von einer Prostituierten geboren wurden.
Illegitimität verhinderte die Vermittlung des vollen gesellschaftlichen Status an die Nachkommen und hatte somit Konsequenzen für die gesamte Familie und Verwandtschaft – umso mehr, je höher der zivile Status von Eltern und Familie war:
“Honrra con muy grand pro, viene alos fijos en ſer legitimos. Ca han pore[n]de los honrras de ſus padres. E otroſi pueden recebir dignidad, e orde[n] ſagrada de la egleſia, e las honrras ſeglares, e a vn heredan a ſus padres e a ſus abuelos, e a los otros ſus parie[n]tes, aſsi como dize en el titulo delas here[n]cias, lo que no pueden fazer los otros que non ſon legitimos.”[53]
Aber auch illegitim Geborene besaßen stark eingeschränkte Erbansprüche, die in den Leyes de Toro 1505 neu geregelt wurden.[54] Außerdem kannte das spanische wie das römische Recht auch Möglichkeiten zur Legitimation von nicht-ehelichen Kindern (s. dazu unter 4.). Illegitimität konnte somit vom Gesetzgeber auch als rein juristisches Phänomen betrachtet werden, das unter bestimmten Bedingungen durch einen rechtlichen Akt aufgehoben werden konnte.
2. Einfluss der Kirche
Die spanische Familiengesetzgebung war im Allgemeinen vom Moralkodex der katholischen Kirche beeinflusst und richtete sich zu großen Teilen nach ihrer Lehre und ihren Beschlüssen. So gingen die Ergebnisse des Konzils von Trient 1564 in spanisches Recht ein, die der Kirche das „Monopol” zur Eheschließung sicherte: Heimliche Ehen wurden verboten und damit nur noch vor Geistlichen geschlossene Ehen anerkannt. Weiterhin wurde durch das Konzil die bereits erwähnte Pflicht zur öffentlichen Ankündigung des Ehewunsches eingeführt, einige Änderungen in der Abstufung der Verwandtschaftsgrade, die ein Ehehindernis darstellten, sowie deren Zählweise.[55]
Trotzdem entwickelte die Kirche in einigen Punkten abweichende, meist dogmatischere Positionen im Gegensatz zur oft pragmatischeren Haltung der Krone. Hierzu gehörte die strenge Verurteilung der barraganía , die nach weltlichem Recht erlaubt blieb. Die Proklamation der Pragmática Sanción lief dagegen dem kirchlichen Prinzip der Freiwilligkeit der Ehe zuwider und führte zu einem teilweisen Verlust der kirchlichen Autonomie der Eheschließung, da nun auf staatliche Weisung die Zustimmung der Eltern verlangt wurde.[56]
Die Haltung zur Illegitimität war in der Kirche noch grundsätzlicher als in den staatlichen Institutionen und wurde vor allem moralisch begründet. Im Zuge der Gegenreformation entstand im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts eine zunehmend repressive Haltung gegenüber Sexualität an sich. Enthaltsamkeit, Jungfräulichkeit und Keuschheit waren die grundlegenden Werte des christlichen Moralkodex, und die Ehe, mit dem Zweck der Familiengründung, bildete das einzig legitime Gegenstück zu einem geistlichen Leben.[57] Legitimität war ebenso die unabdingbare Voraussetzung für einen vollen Status innerhalb der kirchlichen Hierarchie und die Möglichkeit, eine geistliche Laufbahn einzuschlagen. Allerdings kannte auch die Kirche Formen der Legitimation, die, solange sie nicht auch vom König bestätigt wurden, allein für kirchliche Institutionen galten. Somit war auch aus kirchlicher Sicht Legitimität eine Rechtsfigur, die losgelöst von den tatsächlichen Geburtsumständen und moralischen Bewertungen behandelt werden konnte.
Eine zentrale praktische Rolle in Bezug auf Illegitimität spielte die Kirche in ihrer Funktion, die Geburts- bzw. Taufbücher zu führen und damit den Geburtsstatus der Neugeborenen zu dokumentieren. Für illegitime Kinder gab es verschiedene Möglichkeiten der Registrierung, die in unterschiedlicher Weise den Ruf der Eltern zu schützen suchten und gleichzeitig die Möglichkeiten einer späteren Legitimation beeinflussten. So wurden die meisten illegitimen Kinder nicht als hijo/a natural, sondern als Waisen ( huérfanos, hijos de iglesia) oder von unbekannten Eltern ( padres desconocidos) deklariert. Aber auch die Angabe von nur einem Elternteil zum Schutz des anderen war möglich (padre/madre desconocido/a).[58]
3. Populäre Vorstellungen
In der Praxis wich das Verhalten der Bevölkerung trotz der restriktiven Haltung von Kirche und Staat oft von diesen offiziellen Moralvorstellungen ab. Illegitimität war besonders in Spanisch-Amerika weit verbreitet und stellte in einigen Regionen sogar eher die Norm als die Ausnahme dar. Die Moralvorstellungen innerhalb der Gesellschaft waren außerordentlich komplex und wichen oft von dieser offiziellen Sicht ab. Einige dieser Tendenzen, die sich aus den unterschiedlichen Traditionen der Bevölkerungen (vor allem spanische und indigene Bräuche) sowie den besonderen Umständen der hispano-amerikanischen Kolonialgesellschaft ergaben, sollen im Folgenden dargestellt werden.
3.1. Spanische Traditionen
In der spanischen Tradition fanden sich zum einen Tendenzen, die der Einhaltung dieser offiziellen Moralvorstellungen entgegenkamen. Hierzu gehörte das Konzept der Ehre als „ein Komplex von Werten und Verhaltensweisen“[59], der die Hierarchisierung der spanischen Gesellschaft in einige wenige, die sie besaßen und alle anderen ermöglichte.
“Honor was profoundly important because it rationalized hierarchy, the division of Hispanic society between a privileged few and a deprived majority. It established a distinctive agenda of discrimination, because those who possessed it were privileged with special access to political, economic, and social power, and they maintained their superior rank by discrimination against everyone else. Those with honor recognized it in others and accorded those peers an attention and respect they denied the rest of society.”[60]
Ehre definierte sich über Abstammung, Geburtsstatus (und damit Legitimität) und das Konzept der limpieza de sangre[61], das ursprünglich die Abwesenheit von Juden, conversos, Mauren oder Häretikern unter den Vorfahren darstellte und sich in der Kolonialgesellschaft zu einer rein spanischen (d.h. „weißen“) Abstammung veränderte, sowie bestimmte Verhaltensweisen in Bezug auf Ehe und Sexualität. Sie erforderte eine restriktive Kontrolle der Sexualität vor allem von Frauen, um die Sicherheit über die notwendigen Geburtsumstände und die Weitergabe der Ehre innerhalb der Familie zu gewährleisten. Somit betraf die Einhaltung der strengen „offiziellen“ Moralvorstellungen vor allem die (weiblichen) Mitglieder der Elite, die den Verlust der Ehre durch eine illegitime Geburt verhindern mussten.
Andererseits nahm die spanische Tradition der barraganía Einfluss auf die moralischen Vorstellungen, und vermutlich begünstigte sie die weite Verbreitung von Konkubinaten und anderen Formen von illegitimen Beziehungen während der Konquista und der frühen Kolonialzeit.[62] So hatten einige lokale mittelalterliche fueros in Spanien neben öffentlichen barraganías zwischen Ledigen auch barraganías desconocidas erlaubt, in denen einem verheirateten Mann und sogar Geistlichen eine heimliche Geliebte gestattet wurde.[63] Mit der zunehmenden Konsolidierung der hispano-amerikanischen Gesellschaft und der sich ändernden öffentlichen Moral galt die barraganía aber, trotz ihrer Legalität, nicht mehr als eine allgemein anerkannte Institution und wurde besonders in den oberen Bevölkerungsschichten als unmoralische Randerscheinung verurteilt.[64]
In Bevölkerungsteilen, die weit weniger um den Erhalt ihrer Ehre besorgt sein mussten[65], kamen aber auch andere Vorstellungen über Moral und darüber, was legitim sei und was nicht, zum Tragen. In einigen spanischen Inquisitionsfällen des 16. Jahrhunderts über „sexuelle Entgleisung“ spiegeln die Argumente der Angeklagten Moralvorstellungen wider, die von der kirchlichen Lehre deutlich abwichen und illegitime sexuelle Beziehungen nicht als Todsünde betrachteten[66]. So rechtfertigten sich einige mit dem biblischen Gebot zur Fortpflanzung[67] ; andere führten vermeintlich rechtliche Gründe an, nach denen eine sexuelle Beziehung erlaubt war, wenn man verheiratet war[68], wenn ein oder beide Partner ledig waren[69] oder wenn der Ehepartner abwesend war[70]. Weiterhin wurde käufliche Liebe als von Kirche und Staat offiziell erlaubt angesehen[71], oder sexueller Kontakt dadurch gerechtfertigt, dass er bezahlt wurde[72], gerade nicht bezahlt wurde[73] oder der Befriedigung von natürlichen körperlichen Bedürfnissen diente.[74] Auch ethnische Vorurteile wurden angeführt, wie die Tatsache, dass die manceba eine Mulattin[75], eine schöne und als lasziv geltende morisca [76] oder gar eine Sklavin[77] war. Diese Beispiele machen die sehr unterschiedlichen Moralvorstellungen der spanischen Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts deutlich und es ist anzunehmen, dass diese Ansichten auch in der hispano-amerikanischen Kolonialgesellschaft zu finden waren. Allerdings setzte im Laufe des 17. Jahrhunderts, unter dem zunehmenden Einfluss von Kirche und Inquisition im Zuge der Gegenreformation, in Spanien und Amerika gleichermaßen ein „Moralisierungsprozess“ ein, der vielleicht nicht unbedingt das Verhalten vollständig änderte, aber doch zumindest solche Positionen nicht mehr öffentlich vertretbar machte.[78]
3.2. Indigene und afrikanische Traditionen
Angesichts der Vielzahl von Völkern, die den amerikanischen Kontinent vor Ankunft der Spanier besiedelten, waren natürlich auch die Bräuche und Moralvorstellungen außerordentlich vielfältig und komplex. Aber zumindest bei den größten Gesellschaften in den Kerngebieten des spanischen Kolonialreiches, den Azteken und Inka, hatte in vorkolumbischen Zeiten für alle Bevölkerungsschichten ein strenger Moralkodex gegolten, der in einigen Punkten Ähnlichkeiten mit dem römischen Katholizismus aufwies, indem er Jungfräulichkeit betonte und Ehebruch mit dem Tode bestrafte.[79] Einer aztekischen Frau beispielsweise wurden vor ihrer Hochzeit folgende Werte mitgegeben:
“[...] Cuando fuere dios servido de que tomes marido, estando ya en su poder, mira que no te altivezcas; mira que no te ensubervezcas; mira que no le menosprecies; mira que no des licencia a tu coarçón para que se icline a otra parte; mira que no te atrevas a tu marido; mira que en ningún tiempo ni en ningun lugar le hagas traición, que se llama adulterio; mira que no des tu cuerpo a otro, porque esto, hija mía muy querida y muy amada es una caída en una sima sin suelo, que no tiene remedio ni jamás se puede sanar, según el estilo del mundo. Si fuere sabido y si fueres vista en este delicto, matarte han, echarte han en una calle para exemplo de toda la gente donde será por justicia machucada la cabeça y arrastrada.” [80]
Ehe und Legitimität spielten auch in diesen hierarchisch gegliederten Gesellschaften eine zentrale Rolle – wobei der Begriff der Legitimität teilweise anders definiert wurde, besonders in Bezug auf die polygamen Ehen der Eliten[81], sowie die Freiwilligkeit der Eheschließung, die hier meist keine Rolle spielte. Der von den Spaniern vielbeklagte „Verfall der Sitten“ in der frühen Kolonialzeit durch die drastische Zunahme illegitimer, nicht-ehelicher Beziehungen betraf daher nicht allein die spanischen Moralvorstellungen.[82]
Andererseits beeinflussten vermutlich gerade solche Institutionen wie die Polygamie die illegitimen Konkubinate zwischen Spaniern und Indianerinnen während der Konquista: Viele dieser Verbindungen, besonders wenn sie mit Töchtern von Kaziken eingegangen wurden, funktionierten in ähnlicher Weise wie früher die Polygamie als Mittel zur Allianzbildung zwischen indigenen Familien und den neuen Herrschern sowie auch als Weg der sozialen Mobilität für Frauen – selbst wenn es sich nicht um legitime Heiraten handelte. Garcilaso de la Vega beschreibt diesen Prozess der Verschwägerung, bei dem anscheinend die (illegitime) Abstammung stärker wog, als die moralische Verurteilung einer solchen Beziehung:
“[...] viendo los indios alguna india parida de español, toda la parentela se juntaba a respetar y servir al español como a su ídolo, porque había emparentado con ellos. Y así fueron estos tales de mucho socorro en la conquista de las Indias.”[83]
Ein Einfluss afrikanischer Familienwerte und Traditionen ist aufgrund der durch die Sklaverei beschränkten Entwicklungsmöglichkeiten dieser Bevölkerungsgruppe eher gering einzuschätzen. In Regionen wie der Karibik, in denen Schwarze oft die Mehrheit der Bevölkerung stellten, sind solche Einflüsse jedoch vermutlich stärker gewesen. So wird neben einer hohen Illegitimitätsrate auch die Verbreitung von Mutter-Kind-Einheiten (Matrifokalität) als Erbe der Sklaverei, aber auch polygamer, afrikanischer Strukturen angesehen.[84]
4. Auswirkungen von Illegitimität
Die Illegitimitätsrate blieb während der gesamten Kolonialzeit ein spezifisches Charakteristikum Spanisch-Amerikas und unterschied sich in ihrer Entwicklung sowohl von Europa (v.a. Spanien) als auch dem angelsächsischen Amerika: Während sie in diesen Ländern im Laufe des 18. Jahrhunderts deutlich zunahm, gab es in Spanisch-Amerika von Anfang an eine durchschnittlich um ein Vielfaches höhere, stark fluktuierende Illegitimitätsrate, die aber zur Mitte des 18. Jahrhunderts – als Ausdruck einer gesellschaftlichen Konsolidierung – eher den Trend zur Stabilisierung aufwies oder sogar abnahm. In Mexiko lag sie beispielsweise im 17. Jahrhundert zwischen 7% und fast 50% und im 18. Jahrhundert zwischen 7% und 35%.[85]
Eine weitere Besonderheit von Illegitimität in Spanisch-Amerika war ihr enger Zusammenhang mit sozialer und ethnischer Zugehörigkeit. Während die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen (und besonders die spanisch-kreolische Oberschicht) in ihrem Heiratsverhalten zur Endogamie neigten, wurde Illegitimität geradezu ein Merkmal von gemischt-ethnischen Beziehungen und ihren als castas bezeichneten Nachkommen.[86]
“Natives, Spaniards, and Africans all maintained their group distinctiveness yet also intermingled, forming complex racial and social combinations. Sexual encounters that spanned racial boundaries – whether they reflected unequal liaisons between conquerors and conquered, masters and slaves, or white elites and everyone else, or whether products of the more socially equal relationships between the various racial categories or castes – typically occurred outside of matrimony. At least in the first colonial centuries, to be racially mixed in colonial Spanish America was virtually synonymous with being illegitimate.”[87]
Illegitimität hatte somit – anders als in den angelsächsischen Kolonien in Amerika – entscheidende Auswirkungen auf die Demographie Spanisch-Amerikas, die sich besonders durch den Mestizisierungsprozess auszeichnete.[88]
Aber auch innerhalb der „weißen”, spanisch-kreolischen Bevölkerung gab es einen Anteil an illegitimen Geburten, der eine besondere Bedrohung für die Ehre der Elite-Familien darstellte und so bestimmte Strategien im Umgang mit diesem Makel hervorbrachte.
4.1. Der Prozess der “Mestizaje”
Vor allem zu Beginn der Kolonialzeit hatten auch Spanier einen größeren Anteil an der Entwicklung der Illegitimitätsrate: Die Entstehung der ersten Generationen von „Mestizen“ basierte zum größten Teil auf illegitimen Beziehungen zwischen spanischen Männern und indianischen Frauen. Obwohl gemischt-ethnische Heiraten von der Krone zunächst gefördert wurden, um die Nachkommen aus diesen Verbindungen zu legitimieren, blieben Ehen – solange sie nicht unter Druck geschlossen wurden[89] oder es sich um eine politisch vorteilhafte Verbindung handelte – die Ausnahme.[90] Der Prozess der Mestizaje war somit von Anfang an ein Phänomen der Illegitimität – und im Laufe der Zeit wurden diese beiden Begriffe zu Synonymen.[91] Die zunehmende Diskriminierung der mestizischen Bevölkerung basierte damit zu einem großen Teil auf diesem ursprünglichen Makel der Illegitimität. Während den Indianern die limpieza de sangre zugestanden wurde (solange sie sich der Evangelisierung nicht widersetzten), wurden die Mestizen von dieser Doktrin ausgeschlossen[92] und – nachdem sie anfangs noch leichter zu ihren spanischen Vätern assimiliert wurden – mit ihrer zahlenmäßigen Zunahme auch bestimmter sozialer Rechte enthoben.[93] Diese Vermischung von ethnischen Vorurteilen und Illegitimität galt auch für die übrigen Angehörigen der castas, wie Mulatten oder zambos, deren afrikanische Abstammung allerdings noch größere Ablehnung und Diskriminierung hervorrief.[94]
4.2 Strategien im Umgang mit Illegitimität
Illegitimität kam aber in allen sozialen Schichten der hispano-amerikanischen Gesellschaft vor. Besonders für Frauen (weniger für Männer[95] ) aus Familien der Elite waren uneheliche Beziehungen und vor allem eine daraus resultierende Schwangerschaft problematisch, da die Folgen nicht nur sie persönlich, sondern die Ehre der gesamten Familie bedrohte. Dennoch bot das Konzept der Ehre unter gewissen Umständen Flexibilität im Umgang mit solchen gesellschaftlichen Normüberschreitungen seitens der Frauen und ermöglichte einen intermediären Status zwischen den beiden idealtypischen Vorstellungen einer ledigen Jungfrau oder treuen Ehefrau, die innerhalb der (gesellschaftlichen) Kontrolle stand und einer „gefallenen“, promiskuitiven Sünderin, die vollständig aus dieser Kontrolle herausfiel.[96] Die Diskrepanz zwischen Theorie des Ehrkonzepts und seiner Praxis, die auf einer Unterscheidung zwischen dem öffentlichen Ruf einer Person und der privaten Realität basierte, ermöglichte verschiedene Strategien im Umgang mit unehelichen Schwangerschaften und Geburten seitens der ledigen Frau, die in unterschiedlicher Weise ihren Ruf und damit ihre Ehre beeinträchtigten.[97]
(a) Die einfachste Variante, den Verlust der Ehre durch eine ungewollte voreheliche Schwangerschaft zu vermeiden, war eine unmittelbare Heirat beider Partner, soweit diese ledig waren. Nach der römisch-spanischen Rechtstradition hatte das die automatische Legitimation des unehelichen Kindes zur Folge.[98] Daraus erklärt sich auch der bessere Status der hijos naturales, deren Geburtsumstand theoretisch diese einfachste und am wenigsten skandalträchtige Legitimation erlaubte.
(b) War eine nachträgliche Heirat nicht möglich, so konnte durch eine „private Schwangerschaft“ („Private pregnancy“), in welcher der Zustand der Frau versteckt und damit offiziell als nicht existent suggeriert wurde – oftmals wider besseren Wissens seitens Nachbarn oder Bekannten – der offizielle Ruf als ledige Jungfrau gewahrt werden. Sogar die Kirche kam einer solchen Lösung in gewisser Weise entgegen, indem sie den Namen der Mutter in den Taufbüchern nicht erwähnte (s. unter 2.). Allerdings war unter diesen Umständen eine Anerkennung und die Annahme des Kindes durch die Mutter ausgeschlossen.[99]
(c) Eine weitere Möglichkeit bot eine „öffentliche Schwangerschaft und eine verlängerte Verlobung“ (“Public Pregnancy and Extended Engagement“) dar. Sie basierte auf dem bindenden Charakter der Verlobung als „Eheversprechen für die Zukunft“[100]. Die ledige Schwangere rechtfertigte ihre Schwangerschaft damit, die sexuelle Beziehung erst mit dem palabra de casamiento eingegangen zu sein und sie mit einer zukünftigen Heirat jederzeit legitimieren zu können. Auf diese Weise konnten ledige Mütter eine beträchtliche Zeitspanne verbringen – oft sogar ihr gesamtes Leben, wenn die Aussicht auf eine Heirat aufgrund von familiären Umständen, dem Tod des Partners, der Verweigerung des Mannes oder gar dessen Heirat mit einer anderen Frau schwand. Der Umstand des Eheversprechens konnte die spätere Legitimierung des Kindes erleichtern und den öffentlichen Ehrverlust mildern – mit Hinweis auf das unehrenhafte Verhalten des Mannes, der sein Eheversprechen nicht einlöste. Allerdings gab es auch hier gewisse Grenzen und die Kinder dieser Frauen waren von den sozialen Barrieren der Illegitimität nicht ausgenommen.[101]
(d) Eine öffentliche Schwangerschaft und ein Konkubinat (“Public Pregnancy and Concubinage“), in dem kein Eheversprechen ausgetauscht worden war oder der beteiligte Mann verheiratet oder ein Geistlicher war, galt als eindeutig inakzeptables Verhalten der ledigen Mutter. Die Reaktionen der Gesellschaft mögen in solchen Fällen unterschiedlich ausgefallen sein. Aber die Tatsache, dass ein beträchtlicher Anteil von Nachkommen aus solchen Beziehungen legitimiert werden konnte[102] zeigt, dass selbst in diesen Fällen ein vollständiger Verlust der Ehre (zumindest der Familie insgesamt) verhindert werden konnte.
Diese Strategien weisen auf eine gewisse Toleranz der Öffentlichkeit in Hinblick auf ein illegitimes Sexualverhalten von Frauen hin, die auf der Ambivalenz des Ehrenkodex basierte.
“As in the case of race, where Latin society consciously distinguished a complex range of colors, so too in sexual relationships society recognized varying degrees of illicit activity. Just as colonists perceived mulattoes as neither white nor black, women who engaged in premarital or extramarital sex were neither virgins nor whores. Instead, just as society acknowledged indeterminate areas where racial mobility might occur, some sexual relationships permitted the preservation or recovery of honor.”[103]
Je weiter sich die „Entgleisung“ der Frau dabei vom Ideal der Ehe und damit dem Ehrenkodex entfernte, umso schwieriger wurde eine vollständige Wiederherstellung der Ehre.
4.3. Legitimation
Die reale Situation von illegitim Geborenen konnte recht unterschiedlich sein und hing unter anderem von den Geburtsumständen (bzw. der Art der illegitimen Beziehung ihrer Eltern), sowie vom Ansehen und gesellschaftlichen Status der Herkunftsfamilie und deren Haltung zu ihnen (z.B. Anerkennung oder Annahme durch den leiblichen Vater) ab. Für einen formal vollständigen sozialen Status (und damit uneingeschränktes Erbrecht)[104], die Annahme bestimmter ehrenvoller Positionen[105] oder kirchlicher und staatlicher Ämter[106] war jedoch eine formelle juristische Legitimation notwendig. Die römisch-spanische Rechtstradition kannte verschiedene Formen der Legitimation[107]: durch nachfolgende Heirat der Eltern, durch einen königlichen Erlass oder kirchliche Anerkennung, sowie durch ein entsprechendes Anerkenntnis des Vaters im Testament[108]. Neben der Heirat bot die Anerkennung durch den König die umfassendste Legitimation, während sich eine Anerkennung durch die Kirche auf ihren Einflussbereich (eine geistliche Laufbahn) beschränkte. Grundsätzlich waren die Nachkommen aus jeder Art von illegitimer Beziehung legitimierbar durch einen Erlass des Königs, wobei die Erfolgschancen mit zunehmender Schwere des Verstoßes gegen die Norm (Inzest, sakrilegische Beziehungen) sanken, aber mit zunehmendem Rang, Ansehen oder Vermögen der leiblichen Eltern (besonders des Vaters) stiegen.
Die Legitimation durch den König hatte eine lange Tradition in Spanien.[109] Sie bezog sich bis ins 16. Jahrhundert überwiegend auf die Legitimation von hijos espurios oder hijos sacrilegios und diente somit vor allem der Wiederherstellung von schweren „Entgleisungen“ und der Erlangung des vollen Erbrechts. Bei den Anträgen auf gracias al sacar des 18. Jahrhunderts in Spanisch-Amerika wird dagegen eine Veränderung deutlich, indem die Legitimation hier vor allem hijos naturales gewährt wurde und sich daher eher mit Fragen des sozialen Status beschäftigte.[110] Die sprunghafte Zunahme der Anträge auf gracias al sacar in den 1780er Jahren[111] weist somit einerseits, ähnlich wie die Proklamation der Pragmatica Sanción zu dieser Zeit, auf die zunehmende Sorge um Fragen des sozialen Status und das Abschottungsverhalten der Eliten der hispano-amerikanischen Gesellschaft hin und ist andererseits ein Indikator für eine gewisse soziale Mobilität, die in Einzelfällen trotz eines makelhaften Geburtsstatus weiterhin möglich war.
Eine juristische Legitimation war besonders für Angehörige der Eliten wichtig, wo Statusfragen eine zentrale Rolle spielten: “The large majority of applicants were the white offspring of local elites, blood kin deprived of equal status only because or their birth.“ [112] Sie kam somit vor allem für Personen in Frage, die trotz ihrer Illegitimität bereits ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft genossen und denen die offizielle Legitimierung nun deren uneingeschränkte Wertschätzung oder den Zugang zu staatlichen Ämtern ermöglichte – wie beispielsweise im Fall von Gabriel Muñoz aus Medellín, Kolumbien:
“Gabriel had to grow up and achieve sufficient success so that he was at the edge of acceptance by the Medellín elite – neither so fully established that an official legitimation proved unnecessary, nor so totally ostracized that it would have been ineffective had he received it.”[113]
Die Tatsache, dass nur ein sehr kleiner Anteil der großen Zahl an illegitim Geborenen einen Antrag auf Legitimation stellte, macht aber auch deutlich, dass dieser für die meisten, besonders für Angehörige der unteren sozialen Schichten, weder Aussicht auf Erfolg gehabt noch einen entscheidenden Unterschied in ihrem Leben gemacht hätte. Für sie war Illegitimität bzw. die Beschäftigung mit Statusfragen nicht die zentrale Kategorie, die ihre Lebensumstände bestimmte.
Schlussbemerkung
Illegitimität spielte eine wichtige Rolle in Spanisch-Amerika, sowohl in Hinblick auf die spezifische demographische Entwicklung der hispano-amerikanischen Gesellschaft allgemein, als auch in Bezug auf die sozialen Umstände und Entwicklungsmöglichkeiten einzelner Personen oder Familien, für die Illegitimität Einschränkungen im gesellschaftlichen Status bedeuten konnte. Gleichzeitig wird deutlich, dass – trotz der eindeutigen christlich-moralischen Verurteilung – eine Dichotomie von legitim und illegitim weder in der gelebten Realität der Gesellschaft bestand, noch in den rechtlichen Bestimmungen der Krone angelegt war, sondern Zwischenpositionen in der Beurteilung von Illegitimität durchaus möglich waren und auch eingenommen wurden.
Die enge Verknüpfung von Illegitimität und (Verlust von) gesellschaftlichem Status erklärt die besondere Bedeutung, die dieser Makel für Angehörige der höheren sozialen Schichten der hispano-amerikanischen Gesellschaft und dem von ihnen praktizierten Konzept Ehre hatte. Die Ambivalenz dieses Ehrkonzepts erlaubte aber gleichzeitig gewisse Strategien, die auch den Umgang mit Illegitimität erleichterten: Ein besonderes Merkmal von Ehre in Spanisch-Amerika war die Unterscheidung zwischen dem öffentlichen Status und der privaten Realität einer Person, die eine Konzeptualisierung von Geburtsstatus – und damit von Illegitimität – ebenso wie ethnische Zugehörigkeit als variable Kategorien ermöglichte, die unter bestimmten Bedingungen erworben, verloren oder wiedererworben werden konnten.
“Unlike English America, where a person’s race and birth tended to be sharply defined and permanently fixed, in Hispanic America both variables had in-between categories, and an individual might have more than one racial or birth status at the same time. [...] The recognition of intermediary positions between the extremes of black and white, or legitimate and bastard, not only revealed the presence of but also created the potential for significant racial and social flexibility.”[114]
Literaturverzeichnis
GACTO FERNANDEZ, Enrique
1969 La filiación no legítima en el Derecho histórico español. Sevilla.
1971 “La filiación ilegitima en la historia del derecho español”, in: Anuario de Historia del derecho español Bd. 41, Madrid, S. 899-944.
GONZALBO AIZPURU, Pilar
1997 „Nuevo mundo, nuevas formas familiares“, in: Dies. (Hg.), Genero, familia y mentalidades en América Latina. México, S. 13-38.
GOODY, Esther N.
1982 Parenthood and Social Reproduction. Fostering and Occupational Roles in West-Africa. Cambridge u.a.
HALICZER, Stephen H.
1999 “Sexuality and Repression in Counter-Reformation Spain“, in: Saint-Saëns, Alain (Hg.), Sex and Love in Golden Age Spain. New Orleans, S. 81-93.
KONETZKE, Richard (Hg.)
1953 Colección de documentos para la Historia de la Formación Social de Hispanoamérica 1493-1810. Bd. 1-3, Madrid.
KUZNESOF, Elizabeth Anne
1991 “Raza, clase y matrimonio en la Nueva España: Estado actual del debate” in: Gonzalbo Aizpuru, Pilar (Hg.) Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX. México, S. 373-399.
LAVRIN, Asunción
1994 “Lo femenino: Women in Colonial Historical Sources”, in: Cevallos-Candau, Francisco J. (Hg.), Coded Encounters. Writing, Gender, and Ethnicity in Colonial Latin America. Amherst, S. 153-176.
1989 “Introduction: The Scenario, the Actors, and the Issues”, in: Dies. (Hg.), Sexuality and Marriage in Colonial Latin America. Lincoln und London, S. 1-43.
LEYES DE TORO
1978 [1505] Según el original que se conserva en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.
MARGADANT, Guillermo F.
1991 “La familia en el derecho novohispano” in: Gonzalbo Aizpuru, Pilar (Hg.) Familias novohispanas. Siglos XVI al XIX. México, S. 27-56.
Mörner, Magnus
1969 La mezcla de razas en la historia de América Latina. Buenos Aires.
NASH, June
1993 “Mujeres aztecas: La transición de status a clase en el imperio y la colonia”, in: Stolcke, Verena (Hg.), Mujeres invadidas: La sangre de la conquista de America. Madrid, S. 11-27.
POTTHAST, Barbara
1997 „Sklavenfamilien: ein Forschungsüberblick“, in: COMPARATIV. Heft 1, S. 18-31.
RÍPODAS ARDANAZ, Daisy
1977 El matrimonio en Indias. Realidad social y regulación jurídica. Buenos Aires.
SAINT-SAËNS, Alain
1999 “’It is not a sin!’ Making Love according to the Spaniards in Early Modern Spain”, in: Ders. (Hg.), Sex and Love in Golden Age Spain. New Orleans, S. 11-26.
Sahagún, Bernadino de
1990 Historia general de las cosas de Nueva España. Edición de Juan Carlos Temprano, Bd. A, Madrid.
SCHEPPACH, Maria
1991 Las Siete Partidas. Entstehungs- und Wirkungsgeschichte. Pfaffenweiler.
LAS SIETE PARTIDAS
1974 [1555] Partidas del sabio rey don Alonso, nueuamente Glosadas por el Licenciado Gregorio Lopez del Consejo Real de Indias de su Majestad. Salamanca.
SOCOLOW, Susan Migden
2000 The Women of Colonial Latin America. Cambridge.
STOLCKE, Verena
1993 “Mujeres invadidas: La sangre de la conquista de America”, in: dies. (Hg.), Mujeres invadidas: La sangre de la conquista de America. Madrid, S. 29-46.
TWINAM, Ann
1989 “Honor, Sexuality and Illegitimacy in Colonial Spanish America”, in: Lavrin, Asunción (Hg.), Sexuality and Marriage in Colonial Latin America. Lincoln und London, S. 118-155.
1999 Public Lives, Private Secrets. Gender, Honor , Sexuality and Illegitimacy in Colonial Spanish America. Stanford.
WINTERER, Hermann
1981 Die rechtliche Stellung der Bastarde in Spanien im Mittelalter. München.
[...]
[1] Vgl. die Aufgaben von Elternschaft nach Goody (1982, S. 8-10) zu denen weiterhin Zeugung und Geburt, sowie verschiedene erzieherische Aufgaben gehören.
[2] Goody 1982, S. 8.
[3] Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff „illegitim“ bereits eine Wertung als „unrechtmäßig“ enthält, die nach Standpunkt der jeweiligen Gesellschaften oder Individuen unterschiedlich ausfällt. Gerade die Subjektivität dieser Wertung und die Unterschiedlichkeit der Urteile darüber was „legitim“ ist und was nicht, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Ich benutze den Begriff Illegitimität daher im Folgenden ohne Anführungszeichen.
[4] Die Recopilación de Leyes de Indias von 1680 machte durchaus auch Konzessionen an indigene Gewohnheitsrechte, soweit diese den Interessen von Staat und Kirche nicht entgegenstanden. Vgl. Margadant 1991, S. 27, Fußnote 1.
[5] Die rechtliche Situation im mittelalterlichen Spanien war aufgrund von zahlreichen nebeneinander existierenden lokalen Fueros sehr uneinheitlich. Als Alfons XI. 1348 die Durchsetzung der Siete Partidas gelang, stellten sie formal das an dritter Stelle anzuwendende Rechtsmittel dar. Aufgrund der Lückenhaftigkeit der vorangehenden Gesetze stellten sie aber faktisch das geltende Recht im Königreich Kastilien. Vgl. Scheppach 1991, S. 200-206.
[6] S. unter 3. und Leyes de Toro, 1974. Die Siete Partidas rutschten mit Einführung der Leyes de Toro an vierte Stelle der Rechtsrangfolge. Vgl. Scheppach 1991, S. 206-207.
[7] Vgl. hierzu Scheppach 1991, S.214-224.
[8] Das galt auch für sexuelle Beziehungen insgesamt: Als einer der Gründe weshalb die Ehe geschaffen wurde, wird in der vierten Partida (Titel 2) angegeben: “[…] para guardar ſe los omes de pecado de fornicio [...]“ (Ley 5).
[9] Las Siete Partidas, vierte Partida, Titel 2, Leyes 1-5.
[10] Vgl. Margadant 1991, S. 28-29 und Vierte Partida, Titel 1.
[11] Verwandtschaft und Verschwägerung bis zum vierten Grad sowie spirituelle Verwandtschaft. Die Zählung der Verwandtschaftsgrade wurde seit dem Konzil von Trient (1563) geändert, s. Margadant 1991, S. 32.
[12] Vgl. Margadant 1991, S. 30.
[13] Der Begriff der ethnischen Zugehörigkeit soll hier nicht allein kulturelle Merkmale bezeichnen, sondern gerade Abstammung und biologische Merkmale wie Hautfarbe miteinbeziehen. Obwohl dieser Be-griff gewisse Grenzen für die Beschreibung der spezifischen sozialen Umstände der hispano-amerikanischen Gesellschaft aufweist, möchte ich den in der spanisch- und englischsprachigen Literatur gebräuchlichen Be-griff der rassischen Zugehörigkeit nicht übernehmen, der vor allem die biologischen Merkmale wie Hautfarbe bezeichnet und der spanischen Einteilung nach vermeintlichen physiognomischen Merkmalen nahe kommen soll. Denn auch in der spanischen Vorstellung handelte es sich m. E. nicht um eine rein biologistische Einteilung, sondern das Konzept des „reinen Blutes“ und der raza im Sinne von Abstammung umfasste auch bestimmte kulturelle und soziale Merkmale, die einer bestimmten „Rasse“ bzw. ihrer Vermischung zugeschrieben wurden (z.B. das Fehlen von Ehre oder bestimmter Fähigkeiten). Für diese Kombination von biologischen und soziokulturellen Merkmalen halte ich den Begriff der Rasse für äußerst problematisch.
[14] „[...] por ser gente nuevamente convertida y ser cosa que se usaba entre ellos, tener muchas mujeres.“ Alonso de Zorita zitiert nach Gonzalbo 1997, S. 28.
[15] „[...] ningún cacique, aunque sea infiel, se case con más de una mujer y las otras no les tengan encerradas, ni les impidan casar con quien quisiesen [...].” R.C. 1551, nach Konetzke 1953, I, Dok. 202.
[16] Bulle Altitudo von Papst Paul III. von 1537 Vgl. Rípodas Ardanaz 1977, S. 123. Pius V. ordnete 1571 in der Romani Pontificis an, dass diejenige, die sich mit dem Ehemann gemeinsam taufen lässt, die rechtmäßige Ehefrau bleibe. Ibid. S. 130.
[17] “Se han hecho y deshecho, con mucha facilidad, por los religiosos... diversos y casi infinitos matrimonios entre estos naturales, muy confusamente...” Carta al Rey de los obispos de Nueva España, sobre las cosas que es preciso proveer parael buen gobierno de sus iglesias, zitiert nach Gonzalbo 1997, S. 28.
[18] Nach dem Dekret Gaudemus de divortiis erkannte die Kirche Heiraten zwischen Ungläubigen an, die nach ihren eigenen Gesetzen geschlossen wurden. S. Gonzalbo 1997, S. 26, Fußnote 32.
[19] Vgl. Gonzalbo 1997, S. 34 und 39-40 und Margadant 1991, S. 44-45 und Rípodas Ardanaz 1977, S. 159-162. Auch in späteren Gesetzgebungen spielte dieser Aspekt noch eine Rolle (z.B. Konetzke 1953, II, Dok. 138 von 1618) und mit Einführung der Inquisition in den Kolonien (1570-1610) fallen diese Vorfälle in die Zuständigkeiten des Santo Oficio.
[20] Vgl. Konetzke 1953, I, Dok. 54, 112, 118. Diese Vorschriften richteten sich natürlich nicht nur gegen bigamistische Ehen, sondern in erster Linie gegen jede Art von illegitimen Beziehungen und den allgemeinen moralischen „Verfall“ der Spanier, die ein schlechtes Beispiel für die Indianer darstellten und das Projekt einer dauerhaften Besiedlung gefährdeten, ‘[...] porque no atendían a ‘edificar ni plantar, ni criar, ni sembrar’”. Gonzalbo 1997, S. 35.
[21] Vgl. Socolow 2000, S. 11.
[22] “[...] Ca ningu[n] chriſtiano deue caſar con judia, ni co[n] mora, nin co[n] hereja, nin co[n] otra mujer q non touieſſe la ley de los Christianos: e ſi caſaſſe no valdria el caſamiento. Pero el Christiano deſpoſar ſe puede con muger q non sea de ſu ley, ſobre tal pleyto q ſe torne ella Chriſtiana, ante que ſe cupla el caſamiento [...].” Vierte Partida, Titel 2, Ley 15. Die Konversion eines christlichen Partners zum Judentum oder Islam war ein Grund, die Ehe aufzulösen.
[23] Allerdings nahmen Kirche und Krone hier eine etwas moderatere Haltung ein, mit der Begründung, dass es sich bei den Indianern um Heiden handelte, die mit der christlichen Religion noch nicht in Berührung gekommen waren – im Gegensatz zu den „starrsinnigen” und „konversionsunwilligen“ Muslimen und Juden der iberischen Halbinsel – und die Christianisierung in den neuerworbenen Kolonien daher gewaltfrei und durch Überzeugung durchgeführt werden sollte; jedenfalls solange dieser „Überzeugungskraft“ kein aktiver Widerstand entgegenbracht wurde.
[24] Privilegio Paulino. Vgl. Rípodas Ardanaz 1977, S 199-203.
[25] Vgl. Konetzke 1953, I, Dok. 28 u. 29.
[26] “[...] Por endo yo vos mando y encargo mucho que cada y cuando algunos de los dichos españoles quisieren casarse ellos o sus hijos e hijas con los dichos indios y los dichos indios con los dichos españoles, les ayudéis y favorezcáis en todo lo que les tocare y hubiere lugar en las cosas de la tierra, para que hayan efecto los tales casamientos y sea ejemplo para convocar que otros lo hagan, que en ello recibiré placer y servicio.” Konetzke 1953, I, Dok. 37.
[27] Vgl. Konetzke 1953, I, Dok. 136.
[28] Vgl. Margadant 1991, S. 36. Ehen zwischen Schwarzen, v.a. den Sklaven, sollten ebenfalls gefördert werden. Allerdings war bereits in den Siete Partidas festgelegt, dass selbst die Heirat mit einem Freien dem Sklaven nicht die Freiheit bringt. Vierte Partida, Titel 5 u. Konetzke 1953, I, Dok. 50 u. 109.
[29] In der Praxis war dieses Recht allerdings kaum durchzusetzen. Auch bei Heiraten innerhalb einer Encomienda sollte darauf geachtet werden, dass die Ehe nicht nur durch den Willen des Encomendero gestiftet wurde. Vgl. Margadant 1991, S. 38.
[30] Vgl. Margadant 1991, S. 38.
[31] Allerdings musste die Verweigerung der Zustimmung bestimmte „rationale“ Gründe haben.
[32] Sie betraf aber nicht nur die Elite, sondern „[...] desde las más altas clases del Estado sin exepción alguna hasta las más comunes del pueblo [...]“. Konetzke 1953, III, Dok. 235.
[33] S. hierzu Rípodas Ardanaz 1977, S. 266-269.
[34] R.C. declarando la forma en que se ha de gurardar y cumplir en Las Indias la Pragmática Sanción de 23 de Marzo de 1776 sobre contraer matrimonios, nach Konetzke 1953, III, Dok. 247.
[35] “[...] exeptuando a los que de ellos me sirvan de oficiales en las Milicias o se distingan de los demás por su reputación, buenas operaciones y servicios, porque éstos deberán así comprenderse en ella [...]” Konetzke 1953, III, Dok. 247.
[36] Diese Regel galt für Vizekönige, Präsidenten von Audiencias, Oidores, Staatsanwälte von Audiencias, Gobernadores, Corregidores, Staatsanwälte, Alcaldes mayores und Alcaldes del crimen. Vgl. Margadant 1991, S. 36.
[37] Nach einer anfänglich etwas toleranteren Haltung wurden seit Ende des 16. Jahrhunderts sogar hohe Beamte wegen eines bloßen Eheversprechens ihres Amtes enthoben. Vgl. Margadant 1991, S. 37.
[38] Das galt natürlich – mit unterschiedlichen Graden von Verwerflichkeit – für heterosexuelle, homosexuelle, oder gar sodomitische Beziehungen gleichermaßen.
[39] Zum römischen Ursprung und der weiteren juristischen Entwicklung der barraganía s. Gacto Fernandez 1969, S. 3-33. Ihre spanische Version geht aber vor allem auf die Reconquista zurück. S. Winterer 1981, S. 75.
[40] Als legitim würde ich sie dennoch nicht bezeichnen, da die in dieser Beziehung geborenen Kinder zwar einen geregelten, aber nicht den gleichen Status wie eheliche Kinder besaßen.
[41] Die Formulierungen in Bezug auf die barraganía enthalten allerdings nicht in gleicher Weise die Reziprozität wie bei einer Ehe, sondern behandeln vor allem das notwendige Verhalten der barragana. Vgl. Gacto Fernandez 1969, S. 46-51.
[42] Ebenso wie die barraganía ohne besonderes Zeremoniell durch gegenseitiges Einverständnis geschlossen wurde, konnte sie durch die Rücknahme des Einverständnisses eines Partners beendet werden. Diese Bedingungen wurden aber auch oft mit einem documento matrimonial (obwohl es sich ausdrücklich nicht um eine eheliche Verbindung handelte) vertraglich geregelt. Vgl. Gacto Fernandez 1969, S. 51-55 und Winterer 1981, S. 74-78.
[43] Gacto Fernandez (1969, S. 8) nennt als Beispiel für diesen Fall Geistliche, denen eine Eheschließung verboten war. Während das in der Praxis vermutlich oft der Fall war, so war diese Art von Beziehung aber gerade nicht die stabile Partnerschaft, die nach weltlichen Gesetzen legitimiert werden sollte, sondern in der vierten Partida ausdrücklich ausgenommen: “Comunalmente segund las leyes seglares mandan, todo ome que non fueſſe embargado de orden o de casamiento: puede auer barragana [...]” (Titel 14, Ley 2)
[44] Vierte Partida, Titel 2, Ley 19.
[45] Vierte Partida, Titel 10, Ley 2. In der mittelalterlichen spanischen Rechtsanschauung wurde männlicher Ehebruch nicht als Delikt gewertet. Winterer 1981, S. 77.
[46] Vgl. Gacto Fernandez 1971, S. 901.
[47] “R.C. sobre las indias sospechosas que tienen los españoles en sus casas” vom 26.10.1541, nach Konetzke 1953, I, p. 209. Eine R.C. von 1535 verfügte bereits eine Geldstrafe von 20 000 maravedís für Spanier, die eine freie indianische Frau als manceba gegen ihren Willen hielten und nicht binnen 3 Tagen diese Beziehung beendeten. ibid. Dok. 92.
[48] Vierte Partida, Titel 14, Ley 2 verbietet ausdrücklich mehrere barraganas gleichzeitig.
[49] Obwohl von der Krone verboten, wurden in einigen Teilen Perus die afrikanischen Männer in solchen Beziehungen kastriert. Vgl. Kuznesof 1991, S. 379.
[50] Vierte Partida, Titel 13, Ley 1. Kinder aus Ehen mit bekannten Ehehindernissen wurden demnach vermutlich entsprechend den Bestimmungen für nicht-ehelich geborene Kinder behandelt. Über den Sonderfall von Kindern aus indianischen polygamen Ehen habe ich allerdings keine Hinweise gefunden.
[51] “[...] ordenamos e mandamos que entonces se digan ser los hijos naturales, quando al tiempo que nascieren o fueren concebidos, sus padres podian casar con sus madres iustamente sin dispensacion [...]” Leyes de Toro, Ley 11.
[52] Margadant (1991, S. 48) unterscheidet zudem nefarios, aus einem Inzest in direkter Linie und incestuoso aus einem Inzest in der transversalen Linie.
[53] Vierte Partida, Titel 13, Ley 11.
[54] Bei Fehlen legitimer Kinder konnten sie rechtmäßige Erben werden. Ansonsten gab es nur die Möglichkeit einer testamentarischen Verfügung, die stark begrenzt war (für Mütter bis zu 1/5 ihres Vermögens). „Sakrilegische“ Kinder waren von jeder Erbschaft ausgenommen. Vgl. Leyes de Toro, leyes 9-13.
[55] Vgl. Margadant 1991, S. 32.
[56] Pragmática Sanción Artikel 18 in Konetzke 1953, III, Dok. 235.
[57] Vgl. Socolow 2000, S. 7-8 und Haliczer 1999. Die Betonung dieser Werte führte sogar teilweise zu ehefeindlichen Tendenzen in der spanischen Kirche, s. Haliczer 1999, S. 87-88.
[58] Vgl. Lavrin 1994, S. 158.
[59] “a complex of values and behavior“, Elizabeth S. Cohen zitiert nach Twinam 1999, S. 32.
[60] Twinam 1999, S. 32.
[61] Näheres hierzu s. Twinam 1999, S. 41-50. Limpieza de sangre war z.B. Voraussetzung für die Bekleidung eines öffentlichen Amtes oder den Eintritt in ein Kloster.
[62] Zu den besonderen Umständen nicht-ehelicher Beziehungen während dieser Phase und ihre Bedeutung für die Entstehung der hispano-amerikanischen Gesellschaft s. unter 2.
[63] Vgl. Winterer 1981, S. 77.
[64] In Spanien war die Institution der barraganía aus ähnlichen Gründen zurückgegangen: “No fue pues, una reacción jurídica contraria la que desterró el concubinato de la sociedad hasta dejarlo reducido a comportamientos individuales aislados, sino un proceso de evolución en la mentalidad social. El concubinato no fue condenado por la legislación civil, sino abandonado epontáneamente por la comunidad que fue dejando de ver en él una unión deseable cuando la moralidad pública experimentó un cierto progreso.” Gacto Fernandez 1969, S. 7.
[65] “Even though colonial Spanish Americans from all castes and classes might have their own versions of honor […] it cannot be overstated that only colonial elites reserved it exclusively to themselves.” Twinam 1999, S. 33.
[66] “Córdoba. Mariana... ella dijo que no era pecado mortal tener cuenta con hombre y diciéndole que no sólo obrarlo, pero pasarlo por el pensamiento era pecado, dijo anda que no iré al infierno por eso.” Saint-Saëns 1999, S. 14, Fußnote 28; s. auch ibid., S. 15, Fußnote 32.
[67] “Úbeda. Viuda...reprendiéndola sobre unos hijos que tenía con un hombre casado, dijo que Dios mandaba multiplicar el mundo y tener hijos y que no era pecado.” Saint-Saëns 1999, S. 15, Fußnote 33.
[68] “De Cordoba: Maria Cabrera...que dijo que el tener a un hombre siendo casado no era pecado.” Ibid., Fußnote 37.
[69] “Villacarrillo. Juan Leal, pastor, echarse un hombre con una mujer, siendo solteros no era pecado.” Ibid., Fußnote 40, s. auch Fußnote 39.
[70] “Córdoba. Barbola Pérez, mesonera, dijo que si su marido estuviera presente fuera pecado mortal hacelle traición, pero que estando ausente y siendo soltero cierto hombre, no era pecado mortal echarse con él.” Ibid., S. 17, Fußnote 42, s. auch 44.
[71] “Lucena. Martín de la Torre, sastre, porque dijo que no es pecado echarse con una mujer de la mancebía, pues la Iglesia y justicia lo consentía.” Ibid., S. 18, Fußnote 47, s. auch 48-50 u. 53
[72] “Quesada. Alonso Hernández de Membrilla labrador tratando de las mujeres públicas dijo que no era pecado tener parte con ellas pagándoselo.” Ibid., S. 19, Fußnote 56, s. auch 57.
[73] “[...] joder hombre sin dinero no es pecado.“ Ibid., S. 21, Fußnote 64.
[74] „Cazorla. Pedro Sánchez, gañan, porque dijo y afirmó que no era pecado echarse un hombre con una mujer, antes era pecado no dárselo al cuerpo cuando lo pedía.” Ibid., S. 20, Fußnote 61
[75] “Aguilar. Gil Gómez del Lagar, alcalde de Aguilar, porque dijo que no era pecado estar amandebado con una mujer mulata.“ Ibid., S. 23, Fußnote 76.
[76] “Villanueva del Arzobispo. Diego Rodríguez, pintor, tratando de una morisca dijo que por ser hermosa y morisca no era pecado echarse con ella.” Ibid., S. 23, Fußnote 78.
[77] “Montilla. Juan García de Priego, labrador, tratando de mujeres...dijo que con su poco saber tenía que tener un hombre parte con una mujer como no fuese doncella o casada que no era pecado que con una esclava bien se le entendía.” Ibid., S. 24, Fußnote 81.
[78] “’Men an women would learn in the 17th century that it was no longer possible to say that fornication was not a sin without getting in trouble with the Inquisition’ and an apparently greater sense of guilt would surface through the inquisitorial documents.” Saint-Saëns 1999, S. 25.
[79] Vgl. Gonzalbo 1997, S. 15-22 und zum Leben aztekischer Frauen vgl. Nash 1993, S. 14-16.
[80] Sahagún, Bd. A, S. 422.
[81] Hier spielen beispielsweise die Unterschiede zwischen „Haupt“- und „Nebenfrauen“ eine Rolle für den entsprechenden Status der Kinder.
[82] Vgl. auch Kuznesof 1991, S. 377-378.
[83] Zitiert nach Mörner 1969, S. 34-35. S. auch Gonzalbo 1997, S. 20.
[84] Vgl. Potthast 1997, S. 18-22.
[85] Vgl. Twinam 1999, S. 11.
[86] “En el siglo XVI, la relación de la ilegitimidad con la mezcla de razas fue tan grande que una de las normas que definían las castas era, precisamente, la de la ilegitimidad.” Kuznesof 1991, S. 373
[87] Twinam 1999, S. 10.
[88] In den englischen Kolonien blieben die Illegitimitätsraten selbst in Grenzgebieten unter 5% und dementsprechend niedrig blieb auch der Anteil an ethnisch gemischter Bevölkerung. Twinam 1999, S.11.
[89] Der gobernador von Santo Domingo beispielsweise befahl den Kolonnisten, ihre indianischen Konkubinen zu heiraten oder sie zu verlassen. Vgl. Mörner 1969, S. 36.
[90] In Lima waren z.B. nach dem Zensus von 1613 von 630 indigenen Frauen 32 mit nicht-indigenen Männern verheiratet und von diesen nur drei mit Spaniern.
[91] Aber auch die Vermutung, dass der Begriff Mestize überhaupt nur für uneheliche gemischt-ethnische Nachkommen benutzt wurde, während die anderen als Spanier, criollos oder americanos klassifiziert wurden, wäre plausibel. Mörner nach Kuznesof 1991, S. 379.
[92] Vgl. Stolcke 1993, S. 29-36.
[93] Zwischen 1549 und 1643 verloren Mestizen (neben Mulatten und illegitim Geborenen) das Recht, eine Encomienda zu erhalten, Kaziken oder Notare zu werden und in das Heer einzutreten. Vgl. Konetzke 1953, I, Dok. 167; II, Dok. 43, 231.
[94] Die Vermischung von ethnischen Vorurteilen und illegitimem Geburtsstatus wird auch in der Gesetzgebung deutlich, die diese Elemente als Grund für eine Diskriminierung gleichsetzt: „RC. Que ningun mulato, ni mestizo, ni hombre que no fuere legitimo, pueda tener indios, ni oficio real ni publico.“ Konetzke 1953, I, Dok. 167.
[95] “Since men could never physically demonstrate proof of virginity at the time of first sexual intercourse, male sexual abstinence could never be an issue of honor. Men could not become pregnant, and so they never risked physical alterations that signals that they had been sexually active, which might pose a risk to their honor.” Twinam 1999, S. 91.
[96] Nach Twinam war ihr Zustand weder “in control”, noch „out of control“, sondern “somewhere in between”. Twinam 1989, S. 148.
[97] Twinam (1989) untersuchte die Geburtsumstände von 187 Antragstellern auf Legitimation zwischen 1630 und 1820 („gracias al sacar“ - s. dazu unter 4.3.). Für Schwangerschaften aus außerehelichen Beziehungen – also Ehebruch seitens der Frau – waren diese Strategien nicht zu verwenden. Allerdings ist in diesem Zusammenhang auf die Regelung hinzuweisen, die alle in einer Ehe geborenen Kinder als ehelich erklärt – zunächst einmal unabhängig vom tatsächlichen leiblichen Vater, solange kein Verdacht auf Ehebruch besteht.
[98] Vgl. z.B. in den Siete Partidas: Vierte Partida, Titel 13, Ley 1.
[99] Bei den untersuchten Fällen handelte es sich daher um ein spätes Geständnis, um die Legitimierung zu ermöglichen. Vgl. Twinam 1989, S. 125-134. 35,8% der von Twinam Untersuchten hatten eine heimliche Schwangerschaft gewählt.
[100] Zur Bedeutung der Verlobung in der spanischen Tradition s. Las Siete Partidas, vierte Part., Titel 1.
[101] Vgl. Twinam 1989, S. 134-142. Diese Variante wurde von 23.5% der Frauen gewählt.
[102] 70 von 80 Fällen, in denen der Vater ledig war, 9 von 13, in denen er verheiratet war und 11 von 14 Fällen, bei denen der Vater Priester war, hatten Erfolg bei ihrem Legitimationsgesuch. Twinam 1989, S. 144.
[103] Twinam 1989, S. 148-149.
[104] Vgl. Las Siete Partidas (Vierte Partida, Titel 16, Ley 9) und Leyes de Toro.
[105] Vgl. Twinam 1999, S. 3-6 über den Rechtsstreit von Gabriel Muñoz, der trotz illegitimer Geburt auf den Titel des „Don“ bestand, der ihm von anderen verweigert wurde.
[106] Vierte Partida, Titel 16, Ley 9.
[107] Vgl. Las Siete Partidas, Vierte Partida, Titel 13, Leyes 1, 4, 5, und Titel 14, Leyes 6,7.
[108] Allerdings handelte es sich hierbei vielmehr um die Bestätigung der Legitimität des Nachwuchses und nicht den Akt der Legitimation selbst.
[109] Vgl. ihre Regelung bereits in den Siete Partidas. Allein für den Zeitraum 1475-1543 sind über 2300 Legitimationen im Archiv des Schlosses von Simancas erhalten. Twinam 1999, S. 50-51.
[110] Aus der frühen Kolonialzeit sind nur wenige Legitimationsfälle aus dem 17. Jahrhundert erhalten, obwohl anzunehmen ist, dass es zu Legitimationen vor allem von mestizischen Nachkommen der Konquistadoren kam (s. z.B. Konetzke 1953, II, Dok. 16), für die den Vizekönigen zeitweise vom Indienrat die Kompetenzen übertragen worden waren. Erst die Etablierung eines festen Mechanismus für die Legitimierung im Rahmen der bourbonischen Reformen lässt Rückschlüsse auf die zahlenmäßige Entwicklung der Anträge auf gracias al sacar seit 1720 zu.
[111] Von 2-14 Fällen pro Dekade zwischen 1720-1780 auf 59-71 in den 1780er und 90er Jahren und 27 bzw. 28 Fälle von 1800-1810. S. Twinam 1989, S. 121.
[112] Twinam 1999, S. 14.
[113] Twinam 1999, S. 14.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Dokuments?
Das Dokument behandelt das Thema der Illegitimität in der hispano-amerikanischen Gesellschaft während der Kolonialzeit. Es untersucht rechtliche Grundlagen, den Einfluss der Kirche, populäre Vorstellungen und die Auswirkungen von Illegitimität.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Das Dokument behandelt die spanische Familiengesetzgebung (insbesondere die Siete Partidas und die Leyes de Toro) als Grundlage für die Definition von Ehe, barraganía und Konkubinat sowie den Status von Kindern aus illegitimen Beziehungen. Es geht auch auf die Anpassungen dieser Gesetze an die spezifischen Gegebenheiten der Kolonien ein, insbesondere in Bezug auf Polygamie, interreligiöse Ehen und die freie Partnerwahl.
Welchen Einfluss hatte die Kirche auf die Vorstellungen von Legitimität und Illegitimität?
Die katholische Kirche spielte eine zentrale Rolle bei der Definition und moralischen Bewertung von Legitimität und Illegitimität. Sie verurteilte die barraganía, bestand auf der Freiwilligkeit der Ehe (im Gegensatz zur staatlichen Pragmática Sanción) und dokumentierte den Geburtsstatus durch die Führung von Taufbüchern. Die Kirche vertrat eine strengere Haltung gegenüber Sexualität außerhalb der Ehe als die staatlichen Institutionen.
Welche populären Vorstellungen prägten den Umgang mit Illegitimität in der hispano-amerikanischen Gesellschaft?
Die Moralvorstellungen innerhalb der Bevölkerung waren komplex und wichen oft von den offiziellen Vorgaben ab. Das Konzept der Ehre spielte eine wichtige Rolle, insbesondere für die Elite, die ihren Geburtsstatus und die Reinheit des Blutes wahren wollte. Spanische Traditionen (z.B. die barraganía) sowie indigene und afrikanische Bräuche beeinflussten die Vorstellungen darüber, was legitim war und was nicht. Es gab eine gewisse Toleranz gegenüber länger andauernden, eheähnlichen Beziehungen, auch wenn sie nicht innerhalb einer Ehe stattfanden.
Welche Auswirkungen hatte Illegitimität auf die hispano-amerikanische Gesellschaft?
Illegitimität war in Spanisch-Amerika weit verbreitet und beeinflusste die demografische Entwicklung, insbesondere durch den Prozess der "Mestizaje", die Vermischung von Ethnien. Sie war eng mit sozialer und ethnischer Zugehörigkeit verbunden und führte zu Diskriminierung von gemischt-ethnischen Bevölkerungsgruppen. Illegitimität stellte eine Bedrohung für die Ehre der Elite-Familien dar und führte zu bestimmten Strategien im Umgang mit diesem Makel.
Welche Strategien wurden angewandt, um mit Illegitimität umzugehen?
Es gab verschiedene Strategien, um den Verlust der Ehre durch illegitime Schwangerschaften und Geburten zu vermeiden oder zu mildern: eine sofortige Heirat, eine „private Schwangerschaft“ (Verheimlichung), eine „öffentliche Schwangerschaft mit verlängerter Verlobung“ oder ein öffentliches Konkubinat. Diese Strategien ermöglichten unter Umständen eine gewisse soziale Akzeptanz und Wiederherstellung der Ehre.
Welche Möglichkeiten der Legitimation gab es?
Die römisch-spanische Rechtstradition kannte verschiedene Formen der Legitimation: durch nachfolgende Heirat der Eltern, durch einen königlichen Erlass oder kirchliche Anerkennung, sowie durch ein entsprechendes Anerkenntnis des Vaters im Testament. Die Legitimation durch den König bot die umfassendste Möglichkeit, den sozialen Status uneingeschränkt wiederherzustellen. Sie war besonders für Angehörige der Eliten wichtig, für die Statusfragen eine zentrale Rolle spielten.
- Citar trabajo
- Katharina Happ (Autor), 2000, Illegitimität in Spanisch-Amerika, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/107726