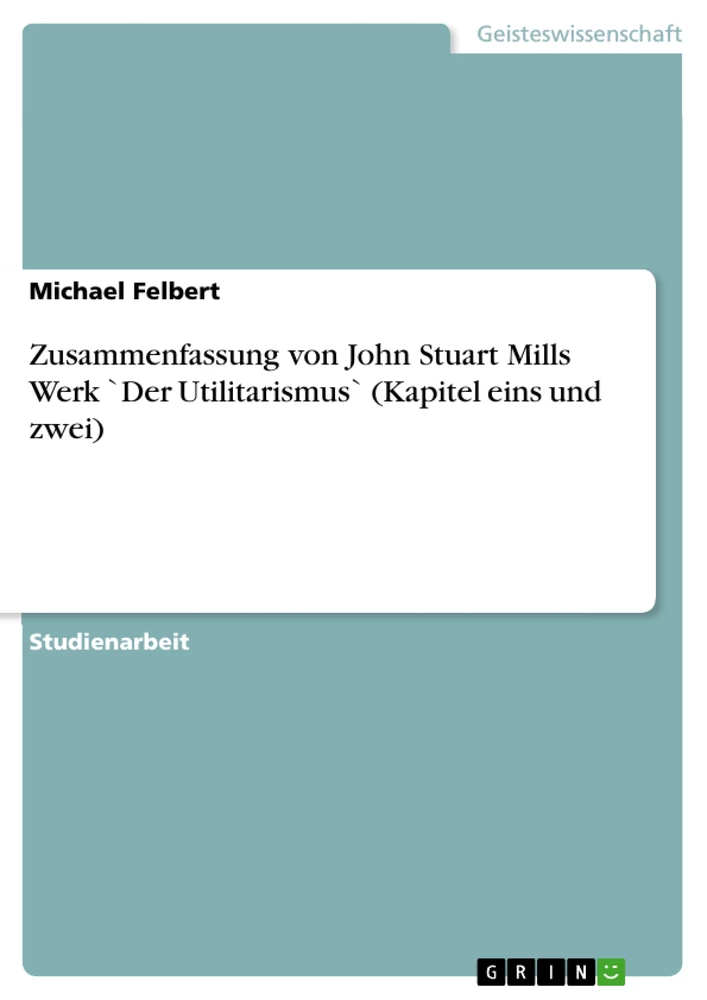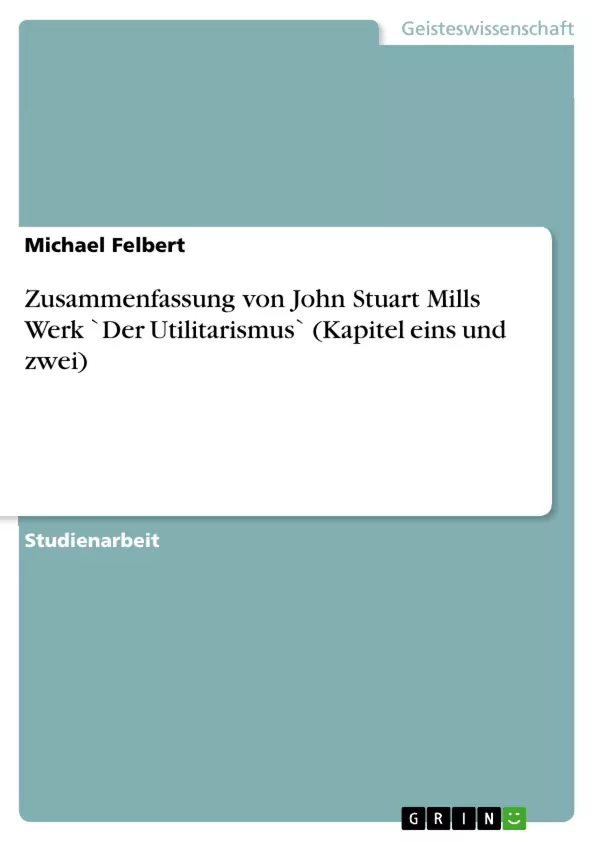"Jeremy Bentham (1748-1832), Rechtstheoretiker, Philosoph und Sozialreformer entwickelt nach Vorarbeiten von Hobbes, Cumberland, Hume und Priestley die Ethik des Utilitarismus (lat. Utilis:
nützlich) und erklärt sie zur moralischen Grundlage für eine wissenschaftliche (empirisch-rationale) Normenbegründung und eine ebenso wissenschaftliche Gesellschaftskritik. Ihr Leitprinzip ist das `größte Glück der größten Zahl` (...)" (Höffe, 2001, S. 232).
"John Stuart Mill (1806-1873), Philosoph, Nationalökonom und Sozialreformer, ist der einflußreichste britische Denker des 19. Jahrhunderts und zugleich einer der intellektuellen Wortführer dieser Zeit (gewesen)" (Höffe, 2001, S. 232). In seiner Wissenschaftstheorie, dem System der deduktiven und induktiven Logik (1843), vertrete er einen radikalen Empirismus, der gegen eine dogmatische Metaphysik stehe, aber Gefahr laufe, "(...) selbst zu einer Dogmatik zu erstarren" (Höffe, 2001, S. 233). Mill vertrat den sozialen Liberalismus. Er fordere in seinen Grundsätzen der politischen Ökonomie (1848) die staatliche Nichteinmischung ("laisser-faire"), "(...) weil die einzelnen ihre Interessen selber am besten beurteilen können (...)" (Höffe, 2001, S.233). Dies bringe eine doppelte Orientierung an effizientester Staatstätigkeit als auch den stärksten Anreiz zur Entwicklung des einzelnen zustande (Höffe, 2001, S. 233).
"Durch eine Reihe neuer Aufgaben wächst das Gemeinwesen jedoch über den frühliberalen `Nachtwächterstaat` hinaus: Es soll zwar nicht selber Schulen gründen, aber die Eltern zwingen, ihre Kinder in eine Schule zu schicken. Es soll, um Ausbeutung und Gesundheitsschäden zu verhindern, die Arbeitszeit
seiner Bürger überwachen. Mit der Förderung von Auswanderung soll es der Übervölkerung entgegensteuern, da sie den sozialen Frieden gefährdet. Es soll gegen Tierquälerei einschreiten und karitative Treuhandschaften überwachen. (...) (Zudem) setzt sich Mill für die politische Gleichberechtigung der Arbeiterschaft, ihre Vereinigungsfreiheit und ihre Beteiligung an den Betrieben ein sowie für eine Brechung der wirtschaftlichen und politischen Vormacht des grundbesitzenden Adels" (Höffe, 2001, S. 233).
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkungen: Gründer des Utilitarismus und politisch-historische Einbettung des Utilitarismus
- Kapitel 1: Allgemeine Bemerkungen - Nützlichkeit als oberstes Prinzip
- Kapitel 2: Was heißt Utilitarismus? - Definition und Beschreibung des Utilitarismus, Abgrenzung und Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit fasst die ersten beiden Kapitel von John Stuart Mills Werk "Der Utilitarismus" zusammen. Ziel ist es, Mills Argumentation für den Utilitarismus nachzuvollziehen und die zentralen Aspekte seiner Theorie darzulegen. Die Zusammenfassung konzentriert sich auf die historischen Wurzeln des Utilitarismus, die Definition des Prinzips der Nützlichkeit und seine Abgrenzung von anderen ethischen Positionen.
- Historische Entwicklung des Utilitarismus
- Definition und Prinzip der Nützlichkeit
- Abgrenzung und Kritik des Utilitarismus
- Die Rolle des größten Glücks der größten Zahl
- Das oberste Prinzip in der Moral und Wissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Vorbemerkungen: Gründer des Utilitarismus und politisch-historische Einbettung des Utilitarismus: Dieser Abschnitt stellt Jeremy Bentham und John Stuart Mill als die wichtigsten Vertreter des Utilitarismus vor. Er beschreibt Benthams Beitrag zur Entwicklung einer empirisch-rationalen Normenbegründung und Gesellschaftskritik, basierend auf dem Prinzip des "größten Glücks der größten Zahl". Der Abschnitt betont Mills Einfluss als britischer Denker des 19. Jahrhunderts und seine Verbindung von radikalem Empirismus mit sozialliberalen Positionen. Mills Plädoyer für eine begrenzte, aber dennoch soziale Rolle des Staates wird beleuchtet, inklusive seiner Forderungen nach Schulpflicht, Arbeitszeitregulierung und der Förderung der Arbeiterrechte, im Gegensatz zum frühliberalen "Nacht-wächterstaat". Die Einbettung der Gedanken in den historischen Kontext des 19. Jahrhunderts wird als essentiell für das Verständnis der utilitaristischen Philosophie dargestellt.
Kapitel 1: Allgemeine Bemerkungen - Nützlichkeit als oberstes Prinzip: Mill untersucht die Herausforderungen bei der Bestimmung eines obersten Prinzips für Recht und Unrecht, indem er die Analogie zu wissenschaftlichen Erklärungen zieht. Er argumentiert, dass auch wissenschaftliche Theorien auf induktiven Verallgemeinerungen beruhen, die sich durch empirische Belege stützen. In der Moral, so Mill, sollte ein allgemeines Prinzip vorrangig vor speziellen Handlungsregeln stehen. Jedes Handeln habe einen Zweck, und ein "Maßstab für Recht und Unrecht" sei als Hilfsmittel zur Bestimmung dieses Zwecks notwendig. Die Frage nach dem Ursprung dieser Erkenntnis über ein erstes Prinzip wird angeschnitten, wobei die Existenz eines moralischen Instinkts im Sinne einer direkten Wahrnehmung verneint wird. Das Kapitel legt den Grundstein für Mills utilitaristische Argumentation, indem es die Notwendigkeit eines obersten Prinzips für die Moral betont und die Frage nach seiner Herkunft aufwirft.
Kapitel 2: Was heißt Utilitarismus? - Definition und Beschreibung des Utilitarismus, Abgrenzung und Kritik: (Diese Zusammenfassung muss aufgrund der fehlenden Textinformationen zu Kapitel 2 ergänzt werden. Der Text der Aufgabenstellung enthält keine Informationen zu Kapitel 2.) Dieses Kapitel würde voraussichtlich eine detaillierte Definition des Utilitarismus liefern, seine Prinzipien erläutern und ihn von anderen ethischen Theorien abgrenzen. Es ist zu erwarten, dass Mill auf Kritikpunkte eingeht und diese beantwortet, seine Position weiter verfeinert und die praktischen Implikationen seiner Theorie darlegt. Hier würde eine Auseinandersetzung mit der Frage nach dem "größten Glück der größten Zahl" im Detail stattfinden und die Abwägung verschiedener Güter und deren Konsequenzen beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Utilitarismus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Nützlichkeit, größtes Glück der größten Zahl, empirisch-rationale Normenbegründung, sozialer Liberalismus, Moralphilosophie, wissenschaftliche Erklärungen, oberstes Prinzip.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Der Utilitarismus" (Kapitel 1 & 2 Zusammenfassung)
Was ist der Inhalt dieser Zusammenfassung?
Diese Zusammenfassung fasst die ersten beiden Kapitel von John Stuart Mills Werk "Der Utilitarismus" zusammen. Sie beinhaltet Vorbemerkungen zu den Gründern des Utilitarismus (Bentham und Mill), eine Zusammenfassung von Kapitel 1 ("Allgemeine Bemerkungen - Nützlichkeit als oberstes Prinzip") und eine vorausschauende Zusammenfassung von Kapitel 2 ("Was heißt Utilitarismus? - Definition und Beschreibung des Utilitarismus, Abgrenzung und Kritik"). Die Zusammenfassung enthält außerdem eine Zielsetzung, Themenschwerpunkte und Schlüsselwörter.
Wer sind die wichtigsten Vertreter des Utilitarismus, die in der Zusammenfassung erwähnt werden?
Die wichtigsten Vertreter des Utilitarismus, die in den Vorbemerkungen behandelt werden, sind Jeremy Bentham und John Stuart Mill. Bentham wird als Entwickler einer empirisch-rationalen Normenbegründung und Gesellschaftskritik beschrieben, während Mill als britischer Denker des 19. Jahrhunderts mit sozialliberalen Positionen dargestellt wird.
Was ist das zentrale Thema von Kapitel 1 ("Allgemeine Bemerkungen - Nützlichkeit als oberstes Prinzip")?
Kapitel 1 befasst sich mit der Suche nach einem obersten Prinzip für Recht und Unrecht. Mill zieht eine Analogie zu wissenschaftlichen Erklärungen und argumentiert, dass auch in der Moral ein allgemeines Prinzip vor speziellen Handlungsregeln stehen sollte. Er betont die Notwendigkeit eines "Maßstabs für Recht und Unrecht" zur Bestimmung des Zwecks menschlichen Handelns und wirft die Frage nach dem Ursprung dieser Erkenntnis auf, wobei er die Existenz eines moralischen Instinkts verneint.
Was wird voraussichtlich in Kapitel 2 ("Was heißt Utilitarismus?") behandelt?
Kapitel 2 wird voraussichtlich eine detaillierte Definition des Utilitarismus liefern, seine Prinzipien erläutern und ihn von anderen ethischen Theorien abgrenzen. Es ist zu erwarten, dass Mill auf Kritikpunkte eingeht, seine Position verfeinert und die praktischen Implikationen seiner Theorie darlegt. Die Abwägung verschiedener Güter und deren Konsequenzen im Kontext des "größten Glücks der größten Zahl" wird im Detail behandelt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Zusammenfassung am besten?
Schlüsselwörter, die den Inhalt der Zusammenfassung gut beschreiben, sind: Utilitarismus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Nützlichkeit, größtes Glück der größten Zahl, empirisch-rationale Normenbegründung, sozialer Liberalismus, Moralphilosophie, wissenschaftliche Erklärungen, oberstes Prinzip.
Welche historische Einbettung wird im Text vorgenommen?
Der Text betont die historische Einbettung des Utilitarismus im 19. Jahrhundert. Mills sozialliberale Positionen, seine Forderungen nach Schulpflicht, Arbeitszeitregulierung und Förderung der Arbeiterrechte im Gegensatz zum frühliberalen "Nacht-wächterstaat" werden hervorgehoben. Diese Einbettung wird als essentiell für das Verständnis der utilitaristischen Philosophie dargestellt.
Welche Zielsetzung verfolgt die Zusammenfassung?
Die Zielsetzung der Zusammenfassung ist es, Mills Argumentation für den Utilitarismus nachzuvollziehen und die zentralen Aspekte seiner Theorie darzulegen, insbesondere die historischen Wurzeln, die Definition des Prinzips der Nützlichkeit und seine Abgrenzung von anderen ethischen Positionen.
- Citation du texte
- Michael Felbert (Auteur), 2002, Zusammenfassung von John Stuart Mills Werk `Der Utilitarismus` (Kapitel eins und zwei), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10796