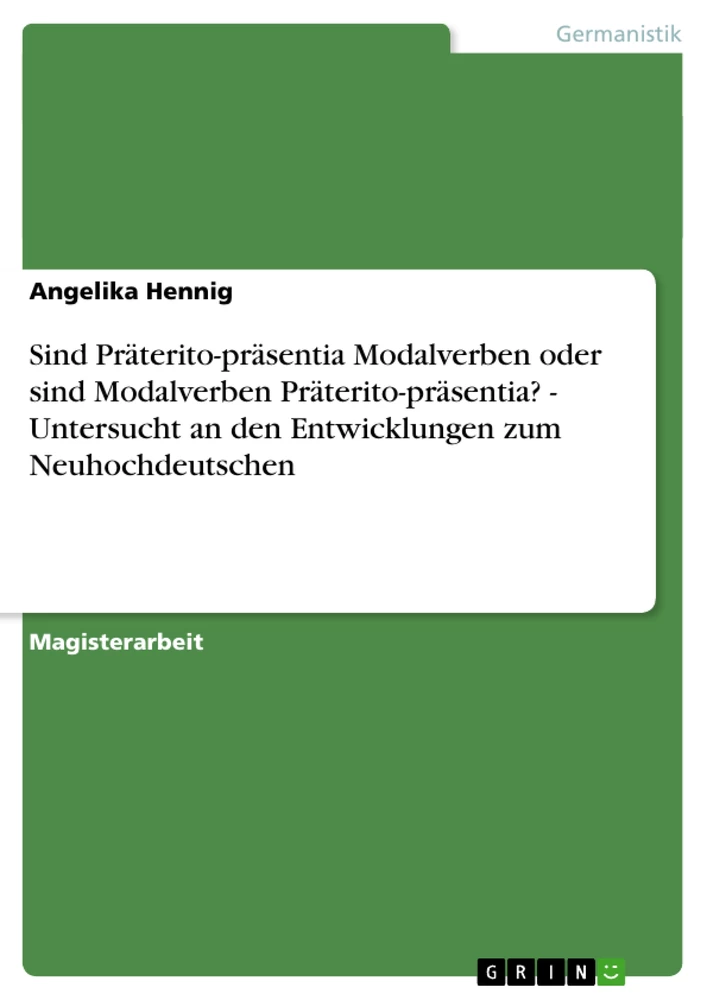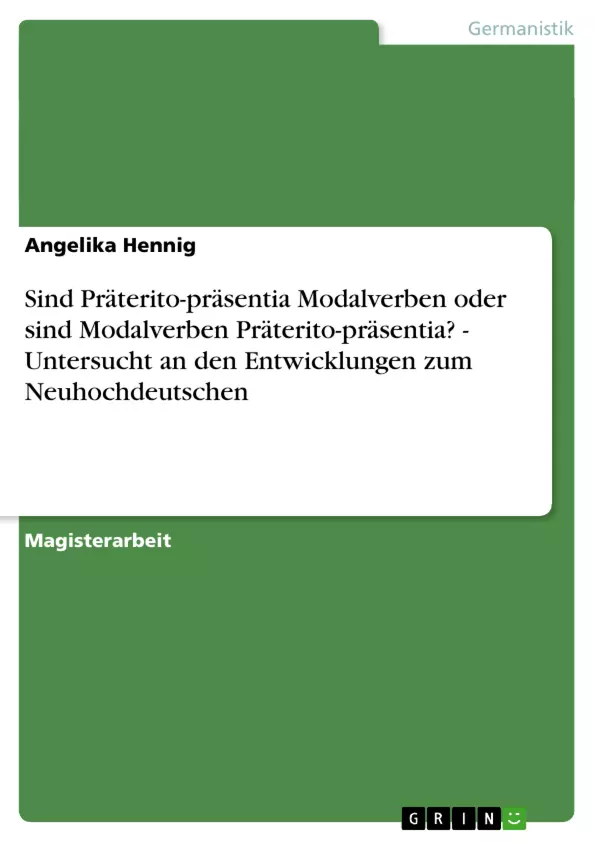In der deutschen Gegenwartssprache besteht eine verbale Sonderklasse, der lediglich sechs Verben angehören: Die Präterito-Präsentia. Mit Ausnahme von dem Vollverb nhdt. wissen, handelt es sich bei den übrigen Präterito-Präsentia um Modalverben, nämlich nhdt. dürfen, können, mögen, müssen und sollen. Umgekehrt besteht die Gruppe der Modalverben aus den genannten Präterito-Präsentia außer wissen und dem Modalverb nhdt. wollen. Letzteres weist in seiner Formenbildung Analogien zu dem Flexionsmuster der Präterito-Präsentia auf. Es stellt sich die Frage: "Sind Präterito-Präsentia Modalverben oder sind Modalverben Präterito-Präsentia?"
Es scheinen zwei gleichwertige Antworten nebeneinander zu stehen. Jedoch besteht eine solche Bindung von Flexionsklassenzugehörigkeit und verbaler Funktion im synchron neuhochdeutschen Gesamtverbsystem sonst nicht, und ein Blick in die Sprachdiachronie zeigt, daß sich hinter dem nhdt. Befund ein Grammatikalisierungsprozeß verbirgt: Das ist die Funktionalisierung eines in morphologischer Hinsicht vereinheitlichten Flexionsmusters durch die Knüpfung an eine sich parallel dazu formierende Gruppe von Modalverben zum Neuhochdeutschen. Dieser Grammatikalisierungsprozeß wird mit der vorliegenden Arbeit untersucht und dargestellt. Exemplarisch erfolgt dies anhand der sprachhistorischen Entwicklungen zum Neuhochdeutschen.
Neu ist dieses Phänomen innerhalb der Sprachwissenschaft nicht. Jedoch besteht kaum Literatur, die sich mit der Darstellung in Form eines möglichst vereinfachten Überblicks über diesen Prozeß befaßt. Im anderen Fall entzieht sich dies meiner Kenntnis. Deshalb stützt sich diese Arbeit hauptsächlich auf Birkmann (1987) , der diesen Prozeß anhand eines komplexen Modells und anhand eines detaillierten und umfangreichen Quellenmaterials darstellt; zu komplex, zu detailliert und zu umfangreich für einen einfachen Überblick. Die vorliegende Arbeit steht damit als Versuch, den ohnehin schon komplexen Sachverhalt ohne theoretischen Hintergrund möglichst einfach darzulegen.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- 1 EINLEITUNG
- 2 FORSCHUNGSEINBLICK
- 2.1 BIRKMANN (1987): „PRÄTERITO-PRÄSENTIA“
- 2.2 JONGEBOER (1985): „IM IRRGARTEN DER MODALITÄT“
- 2.3 VATER (1975): „WERDEN ALS MODALVERB“
- 3 ZUM BEGRIFF DES PRÄTERITO-PRÄSENS
- 3.1 DIE DIACHRONIE: ORIGINÄRE PRÄTERITO-PRÄSENTIA
- 3.2 DIE SYNCHRONIE: PRÄTERITO-PRÄSENTISCHES LEXEM/ FLEXIONSMUSTER
- 4 ZUM BEGRIFF DES MODALVERBS
- 5 PRÄTERITO-PRÄSENTIA, IHR FLEXIONSMUSTER UND MODALVERBEN
- 6 VOM ORIGINÄREN PRÄTERITO-PRÄSENS ZUM PRÄTERITO- PRÄSENTISCHEN FLEXIONSMUSTER/ LEXEM
- 6.1 GOTISCH
- 6.1.1 GOTISCH WILJAN
- 6.2 ALTHOCHDEUTSCH
- 6.2.1 ALTHOCHDEUTSCH WELLEN
- 6.3 MITTELHOCHDEUTSCH
- 6.3.1 MHDT. WELLEN/ WOLLEN
- 6.4 FRÜHNEUHOCHDEUTSCH
- 6.4.1 FRÜHNEUHOCHDEUTSCH WELLEN/ WOLLEN (Ö/Ü)
- 6.5 NEUHOCHDEUTSCH
- 6.5.1 NEUHOCHDEUTSCH WOLLEN
- 6.6 ZUSAMMENFASSUNG
- 7 VOM ORIGINÄREN PRÄTERITO-PRÄSENS ZUM MODALVERB
- 7.1 GOTISCH
- 7.2 ALTHOCHDEUTSCH
- 7.3 MITTELHOCHDEUTSCH
- 7.4 FRÜHNEUHOCHDEUTSCH
- 7.5 NEUHOCHDEUTSCH
- 7.6 ZUSAMMENFASSUNG
- 8 FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit der sprachhistorischen Entwicklung der Präterito-Präsentia, genauer gesagt mit der Herausbildung eines präterito-präsentischen Flexionsmusters und dessen Verbindung zu den Modalverben. Die Arbeit untersucht, wie sich die Lexeme im Laufe der Zeit hinsichtlich ihrer Form und Bedeutung entwickelt haben, und wie sich dieses Muster im Deutschen manifestiert.
- Die sprachhistorische Entwicklung der Präterito-Präsentia
- Die Herausbildung eines präterito-präsentischen Flexionsmusters
- Die Verbindung des präterito-präsentischen Flexionsmusters zu den Modalverben
- Die morphologischen und semantischen Veränderungen im Zusammenhang mit den Präterito-Präsentia
- Die Rolle von Ablautreihen in der Entwicklung der Präterito-Präsentia
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Thematik der Präterito-Präsentia und ihre Bedeutung für die Sprachwissenschaft einführt. Kapitel 2 beleuchtet den Forschungsstand zum Thema und präsentiert wichtige Studien von Birkmann, Jongeboer und Vater. Kapitel 3 erörtert den Begriff des Präterito-Präsens und seine diacronen und synchronen Aspekte.
Kapitel 4 befasst sich mit der Definition des Modalverbs und erläutert dessen Funktion in der Syntax und Semantik. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen den Präterito-Präsentia, ihrem Flexionsmuster und den Modalverben.
Kapitel 6 widmet sich der sprachhistorischen Entwicklung der Präterito-Präsentia von der gotischen bis zur neuhochdeutschen Periode. Es werden die Veränderungen im Flexionsmuster und in der Bedeutung der Lexeme anhand von konkreten Beispielen dargestellt. Kapitel 7 untersucht die Entwicklung der Präterito-Präsentia im Hinblick auf ihre Modalverbfunktion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die folgenden Schlüsselwörter und Themengebiete: Präterito-Präsentia, Modalverben, Sprachgeschichte, Flexionsmuster, Lexem, Grammatikalisierung, Vokaldifferenz, Null-Allomorph, Ablautreihen, Germanistik, Sprachwissenschaft, Morphologie, Semantik, Syntax, Neuhochdeutsch.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Präterito-Präsentia?
Es handelt sich um eine kleine Gruppe von Verben, deren ursprüngliche Präteritalformen (Vergangenheit) eine präsentische Bedeutung (Gegenwart) angenommen haben. Im Neuhochdeutschen gehören dazu wissen, dürfen, können, mögen, müssen und sollen.
Sind alle Modalverben auch Präterito-Präsentia?
Fast alle. Die Gruppe der Modalverben besteht aus den Präterito-Präsentia (außer 'wissen') und dem Verb 'wollen', das sich diesen morphologisch angeglichen hat.
Wie hat sich das Verb 'wollen' entwickelt?
Obwohl 'wollen' ursprünglich kein Präterito-Präsens war, hat es im Laufe der Sprachgeschichte (Gotisch bis Neuhochdeutsch) Analogien zum Flexionsmuster der Präterito-Präsentia entwickelt.
Was ist ein Grammatikalisierungsprozess in diesem Zusammenhang?
Es ist die Funktionalisierung eines vereinheitlichten Flexionsmusters durch die Bindung an die sich formierende Gruppe der Modalverben im Übergang zum Neuhochdeutschen.
Welche Rolle spielen Ablautreihen bei diesen Verben?
Ablautreihen und Vokaldifferenzen sind zentrale morphologische Merkmale, die die historische Entwicklung und die heutige Sonderstellung dieser Verben erklären.
- Citation du texte
- Angelika Hennig (Auteur), 2003, Sind Präterito-präsentia Modalverben oder sind Modalverben Präterito-präsentia? - Untersucht an den Entwicklungen zum Neuhochdeutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10805