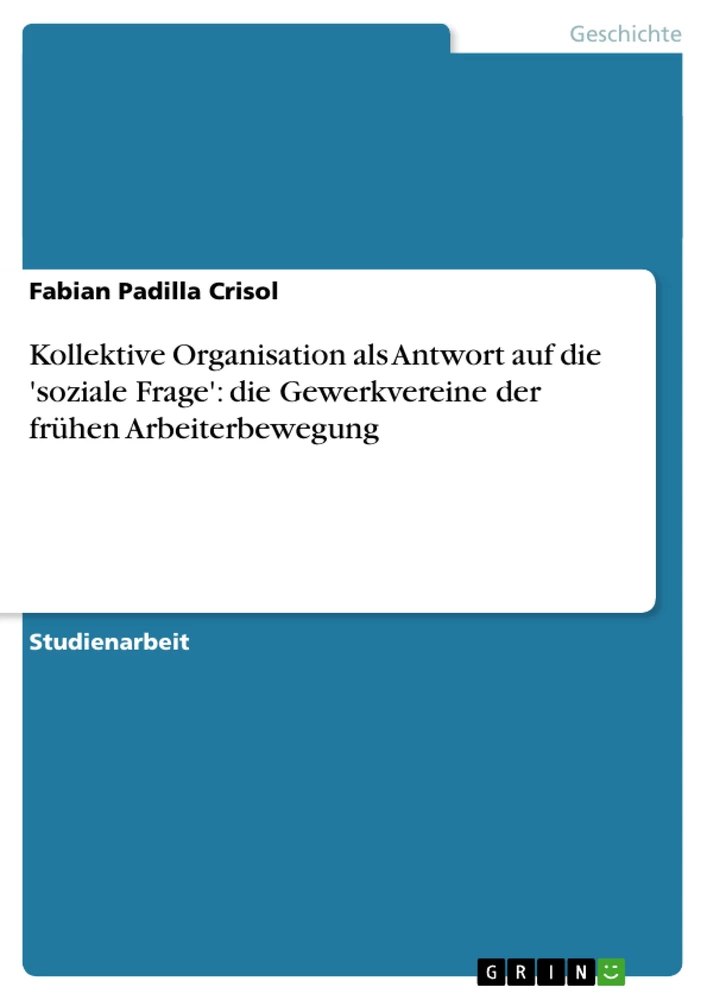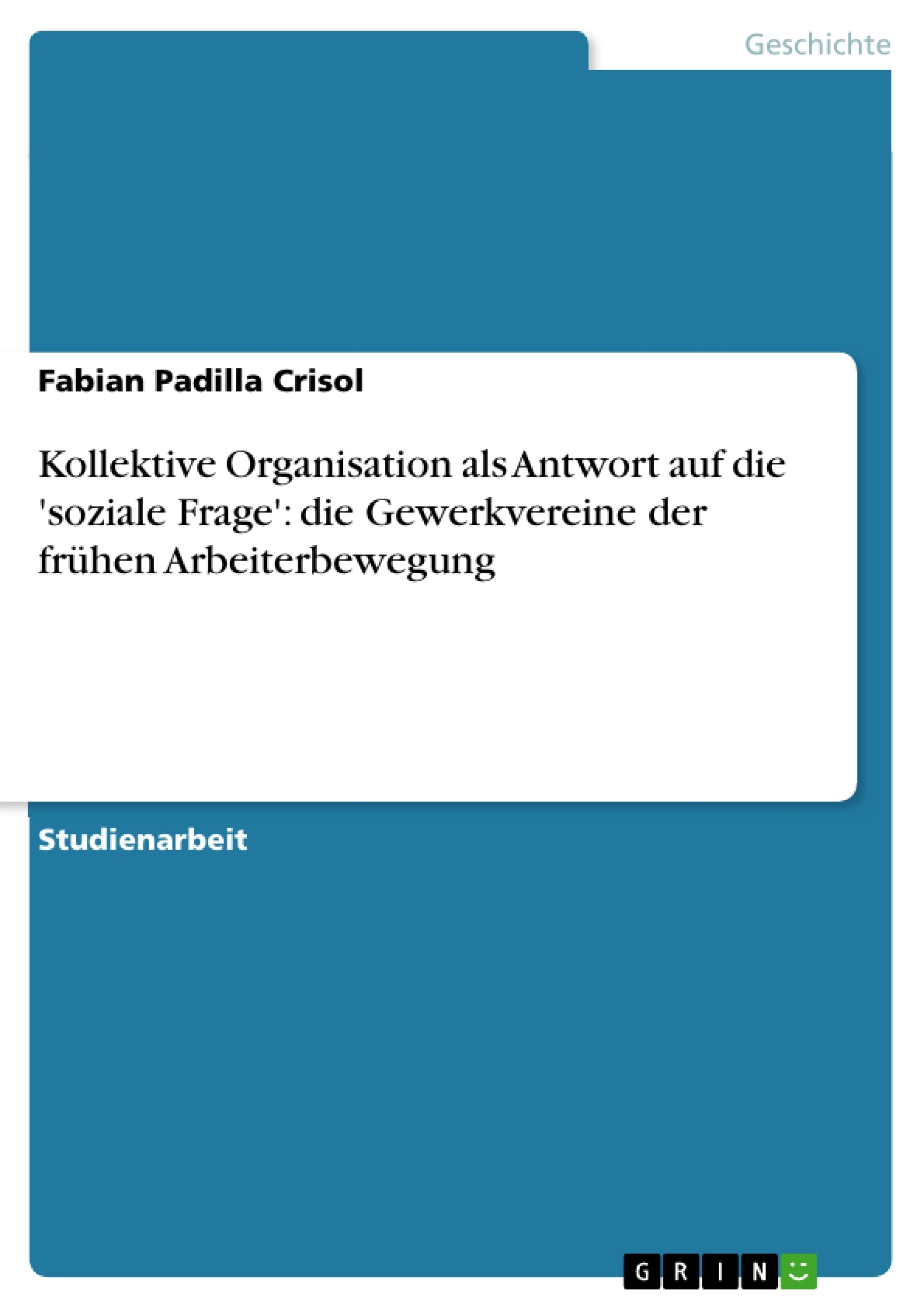Kollektive Organisation als Antwort auf die 'soziale
Frage': die Gewerkvereine der frühen Arbeiterbewegung
0 Einleitung
„Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet.“(1)
Auch wenn das „Kommunistische Manifest“ in späteren Jahren eine große politische Bedeutung erlangen sollte, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts spielte es für die politische und soziale Situation in Deutschland keine entscheidende Rolle. Das Proletariat war noch keine Masse, und noch existierte keine proletarische Massenorganisation.
Genauso wenig existierte das Klassenbewusstsein, welches sich später noch entwickeln sollte.(2) Diese Arbeit bezieht sich auf den Zeitraum von 1810 bis 1850 und beschreibt die Entwicklung einer durch den Industrialisierungsprozess neu zusammengestellten Unterschicht und deren ökonomische Probleme, die von bürgerlicher Seite ab 1840
auch als „soziale Frage“ bezeichnet wurden. Betrachtet werden hier deren Zusammenschlüsse und deren Vereinsbildungen. Es soll geklärt werden, ob kollektive Organisation zu einer Verbesserung ihrer Lage beitrug. Desweiteren wird zu beleuchten sein, ob es sich bei den Zusammenschlüssen der Unterschicht um selbstmotivierte Phänomene
handelt, oder aus dem Interesse des Bürgertums entstanden sind. Es sollen die verschiedenen Zielsetzungen und Formen der Zusammenschlüsse abgegrenzt werden, sowie die Wege die diese einschlugen um eine Besserung des Wohles der Unterschicht zu erlangen.
Außerdem soll geklärt werden warum es zwischen 1830 und 1848 kaum Vereinsbildungen gab. Es sollen die Anfänge einer sozialen Bewegung beleuchtet werden, die entstanden war um ihre ökonomische und soziale Lage zu verbessern und zu einer Massenbewegung zu werden, die auch in der Lage war ihre Interessen durchzusetzen. Die Rede ist vom kurzen aufflackern der Gewerkvereine. Mit ihnen hatte die Unterschicht
zum ersten Mal, obwohl für sehr kurze Zeit, in der Industrieellen Revolution ein Druckmittel um der Ausbeutung durch die Kapitaleigener etwas entgegenzusetzen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftliche Entwicklung im 19. Jh. und die Entstehung der „Sozialen Frage"
- Rahmenbedingungen der Industriellen Revolution
- Änderung der Lebensbedingungen
- Das Aufkommen der „Sozialen Frage"
- Auf dem Weg zur Gründung der ersten
- Arbeiterbildungsvereine
- Genossenschaftsvereine
- Auslandsvereine
- Die Bildung der ersten Gewerkvereine in Deutschland
- Gutenberg-Bund
- Assoziation der Zigarren-Arbeiter Deutschlands
- Schlussfolgerung
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Entstehung der ersten Gewerkvereine in der frühen Arbeiterbewegung Deutschlands im Zeitraum von 1810 bis 1850. Sie untersucht, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert, insbesondere die Industrialisierung, auf die Lebensbedingungen der Unterschicht auswirkte und zur Entstehung der „Sozialen Frage" führte. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Formen der Zusammenschlüsse der Unterschicht, wie Arbeiterbildungsvereine, Genossenschaftsvereine und Auslandsvereine, und untersucht deren Zielsetzungen und Auswirkungen auf die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiter. Darüber hinaus wird beleuchtet, ob die Entstehung dieser Zusammenschlüsse aus der Selbstmotivation der Arbeiter oder aus dem Interesse des Bürgertums resultierte.
- Die Auswirkungen der Industriellen Revolution auf die Lebensbedingungen der Unterschicht
- Die Entstehung der „Sozialen Frage" als Ausdruck der ökonomischen und sozialen Probleme der Arbeiter
- Die verschiedenen Formen der Zusammenschlüsse der Unterschicht und deren Zielsetzungen
- Die Rolle des Bürgertums und des Staates bei der Entstehung der Arbeiterorganisationen
- Die Herausforderungen und Erfolge der frühen Gewerkvereine in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Arbeit dar und führt in die Thematik der Entstehung der „Sozialen Frage" im 19. Jahrhundert ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Industrialisierung und die Herausforderungen, denen sich die neu entstandene Unterschicht gegenüber sah.
Das erste Kapitel analysiert die wirtschaftliche Entwicklung im 19. Jahrhundert und die Entstehung der „Sozialen Frage". Es werden die Rahmenbedingungen der Industriellen Revolution, die Veränderungen in den Lebensbedingungen der Arbeiter und die Entstehung einer grossen Unterschicht beschrieben.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Anfängen der Arbeiterorganisationen. Es werden die verschiedenen Formen der Zusammenschlüsse der Unterschicht, wie Arbeiterbildungsvereine, Genossenschaftsvereine und Auslandsvereine, vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Entstehung dieser Vereine und deren Zielsetzungen sowie die Herausforderungen, denen sie sich aufgrund der politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen gegenüber sahen.
Das dritte Kapitel fokussiert auf die Bildung der ersten Gewerkvereine in Deutschland. Es werden die Entstehung des Gutenberg-Bundes, der ersten nationalen Organisation von Buchdruckern, und der Assoziation der Zigarren-Arbeiter Deutschlands im Kontext der Revolution von 1848/49 dargestellt. Die Arbeit zeigt die Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Entstehung dieser Organisationen und deren Ziele und Aktivitäten auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die „Soziale Frage", die Industrialisierung, die Arbeiterbewegung, die Gewerkvereine, die Arbeiterbildungsvereine, die Genossenschaftsvereine, der Gutenberg-Bund, die Assoziation der Zigarren-Arbeiter Deutschlands, die Revolution von 1848/49, die politische und rechtliche Rahmenbedingungen, die Selbstmotivation der Arbeiter und das Interesse des Bürgertums.
- Arbeit zitieren
- Fabian Padilla Crisol (Autor:in), 2003, Kollektive Organisation als Antwort auf die 'soziale Frage': die Gewerkvereine der frühen Arbeiterbewegung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108081