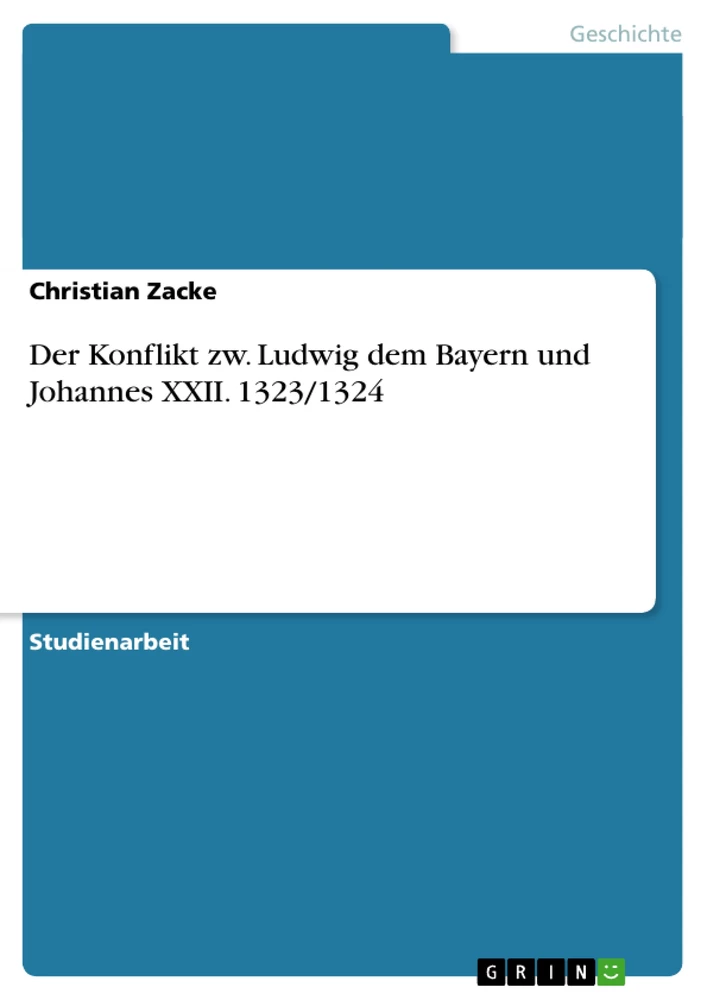In einer Epoche tiefgreifender Umwälzungen, in der das Papsttum und das Heilige Römische Reich um die Vorherrschaft rangen, entfaltet sich die fesselnde Geschichte Ludwigs des Bayern und seines unerbittlichen Kampfes gegen Papst Johannes XXII. Eine Machtprobe, die das mittelalterliche Europa in seinen Grundfesten erschütterte. Dieser Konflikt, der sich über die Jahre 1323/24 zuspitzte, beleuchtet die brisante Frage der päpstlichen Approbation eines gewählten Königs und die daraus resultierenden Konsequenzen für die politische und religiöse Landschaft. Tauchen Sie ein in eine Zeit, in der Intrigen, Exkommunikation und kaiserliche Machtansprüche die Bühne bereiteten für einen dramatischen Zusammenstoß zweier unnachgiebiger Protagonisten. Verfolgen Sie die Eskalation des Konflikts von den ersten juristischen Auseinandersetzungen bis hin zur Exkommunikation Ludwigs und der Verweigerung seiner königlichen Rechte. Entdecken Sie die komplexen Motive und Strategien beider Seiten, während sie um die Kontrolle über das Reich und die spirituelle Autorität kämpfen. Die Analyse der Nürnberger und Frankfurter Appellationen enthüllt die raffinierten Schachzüge Ludwigs, während er versucht, sich gegen die päpstliche Autorität zu verteidigen und seine Macht zu festigen. Die Sachsenhäuser Appellation markiert einen Wendepunkt, in dem Ludwig die Rechtmäßigkeit des Papsttums offen in Frage stellt und ein allgemeines Konzil anruft. Erforschen Sie die Auswirkungen der Exkommunikation auf das Reich und die Versuche des Papstes, Ludwigs Unterstützung zu untergraben. Die dramatischen Ereignisse gipfeln im vierten Prozess, in dem Ludwig aller Rechte beraubt wird, doch der Konflikt ist damit noch lange nicht beendet. Die Untersuchung der historischen Hintergründe, der politischen Allianzen und der religiösen Überzeugungen dieser Zeit ermöglicht ein tieferes Verständnis der komplexen Dynamik zwischen Kirche und Staat. Dieses Buch bietet eine fesselnde Analyse der Ereignisse von 1323/24 und zeichnet ein lebendiges Bild einer Epoche, in der Glaube, Macht und Politik untrennbar miteinander verbunden waren. Es enthüllt die langfristigen Folgen dieses Konflikts für das Heilige Römische Reich und die Rolle des Papsttums in den folgenden Jahrhunderten. Eine spannende Lektüre für alle, die sich für mittelalterliche Geschichte, Kirchengeschichte und die politischen Intrigen dieser turbulenten Zeit interessieren. Entdecken Sie die Wahrheit hinter den Appellationen, Prozessen und Exkommunikationen, die das Schicksal eines Kaisers und das Gesicht Europas veränderten.
1. Inhaltsverzeichnis
2. Einleitung
3. Der historische Hintergrund
4. Der Auslöser des Konflikts
5. Der Konflikt in den Jahren 1323/24
5.1 Der erste Prozeß gegen Ludwig
5.2 Die Nürnberger Appellation
5.3 Die Frankfurter Appellation und der zweite Prozeß
5.4 Der dritte Prozeß- die Exkommunikation
5.5 Die Sachsenhäuser Appellation
5.6 Der vierte Prozeß
6. Ausblick und Schlußbetrachtungen
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
7.1 Quellen
7.2 Literatur
2. Einleitung
Die letzte große Auseinandersetzung zwischen dem Papsttum und den deutschen Herr- schern des Mittelalters zog sich durch die gesamte Regierungszeit Ludwigs IV., ge- nannt der Bayer (1314 – 1347), und hatte eine klare machtpolitische Frage zum Gegen- stand: die Notwendigkeit der Approbation des gewählten römischen Königs durch den Papst. Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der erste Höhepunkt dieser Auseinander- setzung in den Jahren 1323/24, der mit dem ersten Prozeß Johannes‘ XXII. gegen Lud- wig den Bayern beginnt und schließlich mit dessen Exkommunikation und Abspre- chung aller der durch die Königswahl erwachsenen Rechte endet. Zu diesem Zweck werde ich die beiden Kontrahenten zunächst in den historischen Kontext einordnen und mich dann dem Auslöser des Konflikts widmen. Anschließend wende ich mich mit den vier Prozessen Johannes‘ XXII. und den drei Appellationen Ludwigs des Bayern dem eigentlichen Thema dieser Arbeit zu und schließe mit einem Ausblick auf die folgenden Jahrzehnte. Auf den durch die Doppelwahl des Jahres 1314 verursachten Thronkampf und die damit verbundenen politischen Verwicklungen innerhalb des Reiches werde ich nur soweit eingehen, wie es zum Verständnis der Auseinandersetzung zwischen Papst und König notwendig ist. Ziel ist es, die rechtlichen Schritte der beiden Parteien und die sich dahinter verbergenden Motive sowie die damit verbundenen, direkten Auswir- kungen nachzuzeichnen.
Die Ereignisse der Jahre 1323/24 können aus den entscheidenden Quellen, die teils im Original, teils in Abschriften erhalten sind, in ausreichendem Maße erschlossen werden; ihre Interpretation ist in der Forschung allerdings umstritten. Besonders auf die Ein- schätzung der Appellationen Ludwigs werde ich an gegebener Stelle genauer eingehen und die konträren Einschätzungen der Historiker Miethke, Kaufhold und Schütz be- leuchten, soweit es im Rahmen dieser Arbeit möglich ist.
3. Der historische Hintergrund
Als Kaiser Heinrich VII. aus dem Hause Luxemburg am 24. August 1313 nach nur fünf Regierungsjahren starb, erschien die Thronbesteigung seines Sohns Johann, der bereits die Herrschaft über Böhmen ausübte, naheliegend. Einige Kurfürsten favorisierten je- doch Friedrich von Habsburg, und im Mai 1314 war infolge verschiedener Wahlverträ- ge und -versprechen absehbar, daß keine Einigung erzielt werden konnte und eine mit Thronkämpfen verbundene Doppelwahl drohte. Da das Haus Habsburg erst im Jahre 1307 die Herrschaft über Böhmen verloren und die diesbezüglichen Machtansprüche in den vergangenen acht Jahren keineswegs vergessen hatte, erschien es den Luxembur- gern unklug, eine Auseinandersetzung um die Herrschaft im Reich zu riskieren, deren Ausgang keineswegs vorhersehbar war. So begaben sie sich auf die Suche nach einem Kompromißkandidaten, der einerseits für die zu Friedrich neigenden Kurfürsten akzep- tabel sein sollte, andererseits aber den Habsburgern nicht zu nahe stand. Sie entschieden sich für den jungen Fürsten Ludwig von Bayern, der einige militärische Erfolge in ver- gangenen Auseinandersetzungen mit den Habsburgern vorweisen konnte.[1]
Im Herbst des Jahres zeigte sich, daß es den Luxemburgern nicht gelungen war, eine Doppelwahl zu verhindern. Die Parteigänger Friedrichs versammelten sich am 19. Ok- tober 1314 in Sachsenhausen und stimmten für Friedrich von Habsburg; am Tag darauf wählten die verbliebenen Kurfürsten auf der anderen Seite des Mains vor den Toren Frankfurts den Wittelsbacher Ludwig. Zwar hatte Ludwig mehr Stimmen als Friedrich vorzuweisen, doch galt damals noch kein Mehrheitswahlrecht und zwei der Stimmen waren gespalten und somit strittig.[2]
Den Papst gemäß der Tradition als Schiedsrichter anzurufen, war im Jahr 1314 nicht möglich. Clemens V., der sich aufgrund politischer Unruhen in Italien in Lyon krönen ließ und in Avignon residierte (und so das ungefähr siebzig Jahre währende „Exil von Avignon“ einläutete), war am 20. April des Jahres gestorben; eine Meinungsverschie- denheit der Kardinäle über den zukünftigen Amtssitz des Papstes verhinderte die Wahl eines Nachfolgers und führte zu einer mehrjährigen Sedisvakanz.[3] In dieser Situation wurden die Wahldekrete der beiden gewählten Könige an einen zukünftigen Papst ge- schickt, wobei bereits hier ein Keim des späteren Konflikts zwischen der Kurie und Ludwig enthalten war: in der Wahlanzeige Friedrichs wird zunächst um Approbation gebeten, während Ludwigs Anhänger den Heiligen Stuhl direkt um die Kaiserkrönung ersuchen. Schließlich kam es am 25. November in Ermangelung eines Schiedsspruchs dazu, daß sowohl der Habsburger als auch der Wittelsbacher zum König gekrönt und eine militärischer Konflikt unausweichlich wurde.[4]
Am 7. August 1316 wurde Jaques Duèse, zum Bischof von Avignon avancierter Ab- kömmling einer bürgerlichen Familie aus Cahors, auf Druck des französischen und nea- politanischen Königs zum Papst gewählt und gab sich den Namen Johannes XXII. Er war juristisch gebildet, verfügte als Erzieher und zeitweiliger Kanzler Roberts von Nea- pel über politische Erfahrung und galt als unbestechlich und unnachgiebig bis zum Äußersten. Sein hohes Alter von 72 Jahren läßt die Vermutung zu, daß er von den Kar- dinälen als eine Art Notlösung betrachtet worden ist; niemand konnte zu diesem Zeit- punkt ahnen, daß er das höchste kirchliche Amt achtzehn Jahre bekleiden würde.[5]
4. Der Auslöser des Konflikts
Johannes XXII. begann unmittelbar nach seiner Wahl, die Durchsetzung päpstlicher In- teressen in Oberitalien voranzutreiben. Dies war schon allein aufgrund der räumlichen Entfernung schwierig; zusätzlich hatten die dortigen Städte das mittlerweile eingetrete- ne Schwinden der kaiserlichen Macht jenseits der Alpen genutzt, um ihre Eigenständig- keit auszubauen. Vor diesem Hintergrund ist die Zurückhaltung Johannes‘ im Thron- streit zwischen Ludwig und Friedrich zu sehen, der, statt nach seiner Erhebung eine kla- re Stellung zu beziehen, die beiden Kontrahenten in seinem ersten für sie bestimmten Schreiben lediglich als in regem Romanorum electi bezeichnete und die Vermittlung des Heiligen Stuhls anbot. Der Zwist konnte für Johannes nur von Vorteil sein, da er nicht die Einmischung eines von reichsinternen Auseinandersetzungen unbelasteten Königs in seine Italienpolitik befürchten mußte. So betrachtete er das Reich als vakant und erhob deshalb Ende März 1317 in der Bulle Si fratrum Anspruch auf das Reichsvikariat in Ita- lien, durch das seit den späten Staufern die dortige Reichspolitik vertreten wurde. Wer sich im Rahmen des Vikariats bereits eine Machtstellung angeeignet hatte, wurde unter Androhung der Exkommunikation aufgefordert, von dieser Abstand zurückzutreten.[6]
Um diesen Vorgehen Nachdruck zu verleihen, ernannte der Papst Ende Juli 1319 seinen Neffen Bertrand de Poujet zum Kardinallegaten für Ober- und Mittelitalien. Dieser er- öffnete im Juni 1320 einen Inquisitionsprozeß gegen Heinrichs VII. Reichsvikar Matteo Visconti. Johannes selbst verurteilte Matteo schließlich am 14. März 1322 als Ketzer und ließ im Dezember des Jahres in ganz Europa den Kreuzzug gegen die Visconti pre- digen.[7] In seiner Bedrängnis wandte sich der Sohn des inzwischen verstorbenen Matteo, Galeazzo Visconti, an Ludwig und bat um Unterstützung. Ludwig war es im September 1322 in Allianz mit Johann von Böhmen gelungen, die Habsburger in der Schlacht von Mühldorf zu besiegen und Friedrich gefangenzunehmen. Damit war die Gefahr durch das Haus Habsburg zwar keineswegs vollständig gebannt, doch erhielt der Bayer star- ken Auftrieb und war in der Lage, sein Augenmerk auf die Geschehnisse in Italien zu richten.[8] Er versprach, Gesandte an den Kardinallegaten zu schicken und verlieh am 2. März 1323 seinem Vertrauten Graf Berthold von Neuffen das Generalvikariat über Ita- lien. Bereits im April trafen der Kardinallegat und der frischernannte Genervikar zusam- men, und Berthold von Neuffen forderte den päpstlichen Gesandten auf, künftige An- griffe auf die Visconti zu unterlassen, da sie Reichsuntertanen seien. Der Affront gegen die Kurie in Avignon gewinnt noch an Schärfe, als Berthold am 5. Mai im Bischofspa-last zu Mantua ein königliches Schreiben verliest, in dem den Anwesenden befohlen wird, die Visconti gegen das Bertrand de Poujet unterstehende Heer zu unterstützen. Für die Unterstützung verurteilter Ketzer konnte es aber nach dem Kirchenrecht nur eine Strafe geben: die Exkommunikation![9]
5. Der Konflikt in den Jahren 1323/24
5.1 Der erste Prozeß gegen Ludwig
Am 8. Oktober 1323 holt Johannes XXII. zum Schlag gegen den Wittelsbacher aus, der seine Pläne in Oberitalien durchkreuzt hatte: Schon längst freilich haben [ ... ] die geist- lichen und weltlichen Fürsten [ ... ] mit uneinheitlich verteilten Stimmen zwei Personen in zwiespältiger Wahl erhoben [ ... ]. Von uns, dem die Prüfung, Bestätigung und Zulas- sung oder auch die Zurückweisung und Verwerfung einer derartig zwiespältigen Wahl [ ... ] zusteht, wurde die genannte Wahl in keiner Weise genehmigt und die Person nicht bestätigt. [ ... ] Er [ Ludwig] hat vielmehr auf anderem Wege [ ... ] die Würde des be- sagten römischen Königtums und den Königstitel an sich gerissen, obwohl keiner der beiden Gewählten die bezeichnete Würde und den Titel annehmen durfte, bevor eine der beiden Personen vom Apostolischen Stuhl bestätigt oder abgelehnt worden wäre; denn vorerst sind sie nicht römische Könige, sondern zu Königen Erwählte [ ... ].[10]
Wenn Ludwig gehofft haben sollte, nach seinem Sieg von Mühldorf vom Papst als alleiniger und rechtmäßiger König anerkannt zu werden, wurde er enttäuscht. Johannes beschränkte sich in seiner Prozeßeröffnung jedoch nicht nur auf die aus der Doppelwahl resultierenden Unregelmäßigkeiten, er benennt auch den Tatbestand, der als wahres Mo- tiv seines Handelns betrachtet werden darf: Auch hat sich Ludwig, mit dem angemaßten Titel noch nicht zufrieden, bis jetzt in frecher und ungeziemender Weise herausgenom- men [ ... ], sich auf die Verwaltung der Königs- und Kaiserrechte zu stürzen und sich in sie einzumischen [ ... ] zum offenkundigen Unrecht seiner römischen Mutter Kirche, der bekanntlich die Regierung bei Vakanz des Reiches, wie eben gegenwärtig, zusteht [ ... ]. Er tat dies, indem er unter dem königlichen Titel in Deutschland und in einigen Teilen Italiens selbst und durch andere Treueide forderte und entgegennahm [ ... ].[11]
Als Konsequenz setzte ihm Johannes XXII. ein klares Ultimatum: In Anwesenheit einer großen Menge Getreuer ermahnen wir besagten Ludwig kraft dieses Schreibens- und zwar unter Verpflichtung des heiligen Gehorsams und unter der Strafe der Exkommuni- kation, die ihn mit unserem Willen aufgrund der Tat selbst trifft, sofern er dieser un- serer Mahnung nicht mit Erfolg gehorchen sollte- daß er innerhalb von drei Monaten [ ... ] von besagter Amtsausübung, Begünstigung und Schutzherrschaft ganz und gar Ab- stand nehme und davon ablasse; er soll die Amtsführung auch weiterhin weder selbst noch durch einen oder mehrere andere aufnehmen, außer, wenn und sofern seine eigen- artige Wahl [ ... ] und seine Person vom Apostolischen Stuhl bestätigt und genehmigt sein sollten. Und er soll innerhalb der gesetzten Frist, soweit irgend die Möglichkeit da- zu besteht, die Handlungen offen widerrufen, die er unter dem angemaßten Titel vorge- nommen hat [ ... ].[12]
Die Prozeßurkunde wird Ludwig nicht persönlich zugestellt, sondern zunächst an die Türen der Kathedrale von Avignon geheftet, ein Verfahren, daß von Bonifaz VIII. (1294 – 1303) angewendet und formaljuristisch abgesichert worden war. Dennoch ist es in diesem Fall mindestens potentiell anfechtbar, da Johannes‘ Vorgänger Clemens V. die Regelung dahingehend einschränkte, daß ihre Anwendung nur dann statthaft sei, wenn die Übergabe der Nachricht mit Gefahren für den Boten durch den Empfänger verbunden ist. Die Wortwahl am Ende der Zitation weist darauf hin, daß sich der Papst dessen bewußt war und versuchte, einen Formfehler zu vermeiden. Darüber hinaus war es politisch geboten, die Urkunde zumindest unter den deutschen Klerikern bekannt zu
machen. Allerdings wurde mit Ausnahme der Bischöfe von Passau und Augsburg vor allem jenen Bischöfen das Dokument zugestellt, deren Diözesen sich ohnehin in Gebie- ten befanden, die Ludwig im Rahmen des Thronstreites ablehnend gegenüberstanden.[13]
Teile des Kardinalkollegs sahen das Vorgehen Johannes‘ im übrigen durchaus kritisch. Nach einem aragonesischen Gesandtenbericht soll vor allem bemängelt worden sein, daß Johannes XXII. dem Thronkampf bis zum Zeitpunkt des ersten Prozesses gegen Ludwig mehr oder minder tatenlos zugesehen habe, ohne die Parteien auf die Unrecht- mäßigkeit ihrer Herrschaftsansprüche hinzuweisen. Ferner widerspräche die Forderung nach einer päpstlichen Approbation den Gepflogenheiten des Reiches.[14]
5.2 Die Nürnberger Appellation
Ludwig der Bayer reagierte zunächst, indem er am 12. November 1323 drei Prokurato- ren ernannte, die sich in Avignon nach dem Wahrheitsgehalt der Gerüchte um einen Prozeß gegen ihn erkundigen, und, so sie den Tatsachen entsprächen, um eine Fristver- längerung bitten sollten. Hierbei wird es sich wohl um ein Verzögerungsmanöver ge- handelt haben; da die Zitation wie bereits erwähnt auch in einigen bayrischen Diözesen veröffentlicht worden war, dürfte Ludwig recht genau über den Prozeß informiert gewe- sen sein.[15] Dafür spricht auch, daß der Wittelsbacher am 18. Dezember des Jahres eine Appellation verlesen und urkundlich aufsetzen ließ. In dieser sogenannten Nürnberger Appellation sagte Ludwig dem Papst zu, der Kirche stets im rechten Glauben dienen und gehorsam sein zu wollen. Es sei jedoch allgemein bekannt, daß die Verwaltung des Reiches bereits durch die Wahl der Kurfürsten und die Krönung am rechten Ort in vol- lem Umfang verliehen werde. Ferner sei der Vorwurf, ein Freund und Verteidiger von Ketzern zu sein, haltlos, da ihn der Papst niemals über die Verurteilung der Visconti informiert habe. Anschließend ging der Bayer in die Offensive: der Papst selbst sei ein Unterstützer von Häretikern, da er den Bruch des Beichtsiegels durch die Minoriten decke.[16]
Ob Johannes XXII. die Nürnberger Appellation erhalten hat, ist allerdings durch die Quellen nicht schlüssig zu belegen und daher in der Forschung stark umstritten.[17] Im folgenden sollen deshalb einige Positionen diskutiert werden.
Miethke geht davon aus, daß die Appellation niemals bei der Kurie angekommen ist. Sie ist seiner Meinung nach als Notariatsinstrument konzipiert, das nicht fristgerecht eingebracht werden sollte, sondern lediglich der Schaffung einer fiktiven Öffentlichkeit (ähnlich dem Anheften der Zitation an das Portal der Kathedrale von Avignon) zur Rechtsverwahrung und prozeßtechnischen Einrede dienen sollte.[18]
Auch Kaufhold glaubt aufgrund der fehlenden Quellenbelege nicht an die Übersendung des Dokuments nach Avignon. Für ihn ist die Art der Ausgestaltung ein deutlicher Hin- weis darauf, wie sehr die Kanzlei Ludwigs von den Vorwürfen des Papstes überrascht und im Grunde überhaupt nicht auf eine große Auseinandersetzung mit der Kurie einge- stellt gewesen sei. Konkret argumentiert er diesbezüglich, es wirke in seinem Bemühen um eine korrekte Form und in seinen wenig eleganten Erwiderungen auf die Vorwürfe ungelenk; der Vorwurf gegen den Papst macht auf ihn einen unmotivierten Eindruck und verstärkt den Verdacht, es handle sich um ein auf die Schnelle zusammengestelltes Schriftstück. Das habe man wohl in der Kanzlei nachträglich erkannt und es deshalb nicht abgeschickt.[19]
Schütz interpretiert die Nürnberger Appellation völlig anders. Nach seiner Einschätzung ist sie der Beleg für einen durchdachten und unmittelbaren Versuch, einer Verurteilung als Ketzer vorzubeugen. Schütz sieht eine Doppelstrategie: zum einen sagt die Appella- tion aus, Ludwig wolle seinen Standpunkt nicht pertinaci animositate verteidigen, wenn die iura res et honores des Reiches gewahrt blieben. Hierbei mache sich die Kanzlei zu- nutze, daß nach dem damals gültigen Kirchenrecht niemand als Häretiker verurteilt werden durfte, wenn er die Eintscheidung über die Rechtmäßigkeit seiner Lehren der Kirche überließ (wobei Ludwig ja nicht irgendwelche dogmatischen Lehrsätze zum Vorwurf gemacht wurden, sondern die Unterstützung der Visconti, wie Schütz selbst zugibt). Zum anderen sei die Attacke gegen Johannes ein geschickter Schachzug, der auf die Verfahrensvorschriften in einem Inquisitionsprozeß- und um einen solchen han- delte es sich- abziele. In Inquisitionsprozessen fungierte der Richter gleichzeitig als An- kläger. Die Rolle des Anklägers durften aber grundsätzlich nur Unbescholtene beklei- den. Gab es daran Zweifel, entschied eine höhere Instanz nicht nur über den Ankläger, sondern auch über alle mit den Zweifeln im Zusammenhang stehenden Aspekte des Prozesses. Die Anrufung einer höheren Instanz ist im Falle des Papstes aus offensicht- lichen Gründen ausgeschlossen. Gleichzeitig darf er sich aber im Rahmen der gegen ihn vorgebrachten Vorwürfe nicht zum Richter in eigener Sache machen. Den einzigen Ausweg bietet die Bildung eines Schiedsgerichts, das in unserem konkreten Fall nicht nur über Johannes‘ Rolle als Ankläger, sondern auch über die Nürnberger Appellation als „Träger“ der Vorwürfe zu entscheiden gehabt hätte. Im Rahmen dieser Taktik wäre es dann aus Sicht des Königs auch unerheblich gewesen, ob das Schiedsgericht den Be- schuldigungen gegen den Ankläger stattgegeben hätte. Ludwig hoffte wohl, so Schütz, daß ihm ein Schiedsgericht besser gesonnen sei als der Papst. Da Johannes diese Ein- schätzung geteilt habe, sei er gezwungen gewesen, die Belege für den Eingang der Ap- pellation „verschwinden“ zu lassen, wodurch Schütz das Fehlen entsprechender Quellen erklärt.[20]
5.3 Die Frankfurter Appellation und der zweite Prozeß
Am 5. Januar 1324, also kurz vor Ablauf der päpstlichen Frist, wird in Frankfurt ein als Frankfurter Appellation bekanntes Schriftstück aufgesetzt. Dieses Dokument deckt sich im Wortlaut im großen und ganzen mit der Nürnberger Appellation; einziger, jedoch nicht unbedeutender Unterschied ist das Fehlen der Anklage gegen den Papst als Unter- stützer von Häretikern.[21]
Kaufhold betrachtet die Frankfurter Appellation im Prinzip als korrigierte Fassung der Nürnberger Appellation, mit der Ludwig einer Verurteilung zuvorkommen will.[22] Schütz glaubt dagegen, erneut einen ausgeklügelten Plan seitens des Wittelbachers zu erkennen: das erste Schriftstück habe zum Ziel gehabt, Johannes XXII. die Jurisdiktion über die Nürnberger Appellation zu entziehen; das zweite Schriftstück sei dagegen an- gelegt, um Gleiches für die päpstliche Jurisdiktion über die Person Ludwigs zu er- reichen. Dies wäre nach Schütz durch den Vorwurf der Feindseligkeit des Richters ge- genüber dem Angeklagten möglich gewesen. Im konkreten Fall werde versucht, den entsprechenden Beleg über die peremptorische Zitation und Beraubung der aus der Kö- nigswahl erwachsenen Rechte für eine nicht strafbare Handlung zu führen. Hier würde das gleiche Prinzip wie zuvor greifen. Johannes kann sich nicht zum Richter in eigener Sache machen, und in Ermangelung einer höheren Instanz hätte der Fall einem Schieds- gericht übertragen werden müssen. Ein erneuter Hinweis auf die Minoriten wäre in die- sem Zusammenhang überflüssig gewesen Das der Plan keinen Erfolg gebracht habe, lä- ge daran, daß dem einem Verbrechen wie der Ketzerbegünstigung Angeklagten ein solches Rechtsmittel nicht zur Verfügung stand und Johannes deshalb berechtigt gewe- sen sei, die Frankfurter Appellation zurückzuweisen.[23]
Auf den Fortgang des Konflikts hatten die bisherigen Appellationen jedenfalls keine nachweisbare Auswirkung. Nachdem Johannes XXII. am 4. Januar die Prokuratoren an- gehört hatte, wiederholte er am 7. Januar seinen Approbationsanspruch sowie den Vor- wurf der Ketzerbegünstigung und der widerrechtlichen Aneignung der Königswürde Ludwigs. Damit verbunden war ein lediglich zwei Monate währender Aufschub der im ersten Prozeß gesetzten Frist. Um dieses neuerliche Ultimatum im ganzen Reich be- kannt zu machen, veröffentlichte es der Papst in Form eines zweiten Prozesses. Die Empfänger der entsprechenden Dokumente decken sich im wesentlichen mit den Emp- fängern der ersten Prozeßurkunde.[24]
5.4 Der dritte Prozeß- die Exkommunikation
Die zweite Frist endete für Ludwig den Bayern am 7. März 1324. Johannes der XXII. zögerte noch einmal für kurze Zeit und verhängte schließlich am 23. März in einem dritten Prozeß die angekündigte Strafe der Exkommunikation. Allen kirchlichen Wür- denträgern befahl Johannes unter Androhung von Ämter- und Pfründensuspension sein Urteil zu unterstützen; die weltlichen Anhänger des Wittelsbachers mußten damit rechnen, ebenfalls exkommuniziert zu werden.[25] Für ihre Herrschaftsgebiete bedeutete das gleichzeitig das Interdikt, also gemäß einer Regelung Bonifaz‘ VIII. die Ein- schränkung der Gottesdienste auf die vier Hochfeste und eine erhebliche Einschänkung der zu spendenden Sakramente für die gesamte Bevölkerung.[26] Diejenigen, die durch ei- nen Eid an Ludwig gebunden waren, entband der Papst von ihren Pflichten, damit sich keiner auf solche berufen konnte, und er stellte Ludwig erneut ein Ultimatum: binnen dreier Monate sollte er bis zu seiner Approbation durch den Heiligen Stuhl von seiner Königsherrschaft zurücktreten oder alle mit der Wahl von 1314 verbundenen Rechte un- wiederbringlich verlieren. Beendete Ludwig im gleichen Zeitraum nicht auch die Unter- stützung der Visconti, drohte ihm zusätzlich eine Verurteilung als Begünstiger von Ketzern.[27]
Die Exkommunikation Ludwigs konnte ihre volle Wirkung selbstverständlich nur dann entfalten, wenn sie im ganzen Reich verkündet wurde. In den Gebieten, die dem Bayern ablehnend gegenüberstanden, war das natürlich problemlos möglich. In Gebieten von Fürsten, deren Interessen mit seiner Herrschaft verbunden waren oder denen er gefähr- lich werden konnte, sah es anders aus. So mußte beispielsweise der Erzbischof von Mainz, der sich in der Publikation der vorhergegangenen zwei Prozesse sehr zögerlich verhalten hatte, von Johannes energisch aufgefordert werden, seinen diesbezüglichen Pflichten nachzukommen. Der Bischof von Lüttich unterstützte zwar die Position der Kurie, doch mußte Johannes hier intervenieren, weil sich die Bürger der Stadt gegen das Urteil sträubten.[28]
5.5 Die Sachsenhäuser Appellation
Am 22. Mai 1324 reagierte Ludwig auf seine Exkommunikation mit einer dritten, der sogenannten Sachsenhäuser Appellation. Sie ist deutlich schärfer und umfangreicher ge- halten als die bisherigen Prozeßschriften aus der Kanzlei des Wittelsbachers. So wird Johannes die Rechtmäßigkeit seines Pontifikats abgesprochen, indem er mit Johannes qui se dicit papam angesprochen wird und das Dokument an ein allgemeines Konzil und den zukünftigen, legitimen Papst gerichtet ist. Mit zahlreichen Vorwürfen soll belegt werden, daß Johannes XXII. in erster Linie durch seinen Haß auf das Reich zu den un- zulässigen Prozessen gegen den gesetzmäßigen König motiviert worden ist. Die Recht- mäßigkeit der Herrschaft durch die Wahl der Kurfürsten wird erneut unterstrichen, der päpstliche Anspruch auf das Reichsvikariat als Usurpation bezeichnet, da die Führung der Reichsrechte im Falle einer Vakanz des Reiches dem Pfalzgrafen bei Rhein zustün- de.[29]
Die Sachsenhäuser Appellation ist in zwei Versionen erhalten, einer forma minor ge- nannten kürzen und einer forma major genannten längeren Version. Der Hauptunter- schied zwischen diesen beiden Versionen besteht in der Aufnahme des Armutsexkurses in der forma major.[30] Dabei wird auf einen seit langem schwelenden Konflikt innerhalb der Kirche Bezug genommen, der die Frage zum Gegenstand hat, ob Christus und seine Jünger Eigentum besessen hatten, und wenn ja, ob gemeinsam oder einzeln. Das war von größerer Relevanz, als es im ersten Moment erscheinen mag, da der Klerus dazu aufgerufen war, dem Beispiel Christi in allen Lebensbereichen nachzufolgen. 1322, also unmittelbar vor Ausbruch der Auseinandersetzung zwischen Ludwig und Johannes, spitzte sich der Armutsstreit zu, als ein Generalkapitel der Franziskaner verkündete, es sei katholische Lehre, daß Christus und seine Jünger weder einzeln noch gemeinsam Ei- gentum besessen hatten. Johannes trat den Franziskanern entgegen und verurteilte diese Lehre im November 1323 als häretisch, worauf eine Minderheit des Ordens im Gegen- zug den Papst zum Häretiker erklärte. Dieser Vorwurf gegen Johannes wird in der for- ma major aufgegriffen.[31]
Wie bei den beiden bereits dargestellten Appellationen gibt es auch hier deutliche Dif- ferenzen in der Interpretation der Existenz zweier Versionen zwischen Kaufhold und Schütz. Schütz argumentiert, daß Ludwig nach seiner Exkommunikation nur noch die Möglichkeit geblieben sei, die Jurisdiktion Johannes‘ grundsätzlich anzufechten und dadurch das Urteil vom 23. März annullieren zu lassen. Zu diesem Zweck werde der Papst in der forma major mit Hinweis auf den Armutsstreit der Häresie bezichtigt.[32] Da aber der Standpunkt der Franziskaner noch nicht von der ganzen Kirche gebilligt wor- den war, sondern die entsprechende Entscheidung eines Generalkonzils noch ausstand, wäre Ludwigs politische Zukunft untrennbar mit einem Urteil zugunsten des Bettelor- dens verbunden gewesen. Der Ausweg, so Schütz, habe sich in der Arbeitsweise großer Kanzleien gefunden, in denen der formelle Siegelinhaber seine Zustimmung zum Inhalt einer Urkunde nicht mehr durch eigenhändiges Anbringen des Siegels gab, sondern die- se Aufgabe einem Beamten überlies. Dies geschah natürlich unter der Voraussetzung, daß der Beamte die Kanzleigeschäfte in Übereinstimmung mit der Intention seines Herrn führte. Wurde bewußt eine Urkunde ausgestellt, die im Gegensatz zu den Absich- ten des Herrn stand, sprach man von einer Kanzleifälschung. Hätte ein Generalkonzil dem minoritischen Standpunkt stattgegeben, wäre Ludwigs Exkommunikation durch Jo- hannes hinfällig gewesen. Anderenfalls hätte sich Ludwig auf die forma minor berufen und die forma major als Kanzleifälschung für ungültig erklären können. Ob Ludwig, der am 22. Mai vor Zeugen erklärt hatte, sich nicht in den Armutsstreit einmischen zu wol- len, zu diesem Zeitpunkt Kenntnisse über den erweiterten Inhalt der forma major besaß, läßt sich nicht nachweisen.[33] Das auch hier wie bei der Nürnberger Appellation der Eingang des Dokuments in Avignon nicht eindeutig durch Quellen belegt werden kann, erklärt Schütz durch den erneuten Zwang des Papstes, die Umgehung des Rechtsweges zu vertuschen. Auch Ludwig hätte, folgt man dieser Argumentation, die forma major nicht publizistisch verwerten können, da er von ihr vor der Entscheidung des General- konzils keine Kenntnis hätte haben dürfen.[34]
Nach Kaufholds Auffassung geht der Armutsexkurs in der forma major auf die Tätig- keit von Franziskanern an Ludwigs Hof zurück. Als tatsächliche Prozeßschrift sei keine der beiden Versionen gedacht gewesen, sondern als propagandistisches Mittel, daß den Anhängern Ludwigs Argumente im Streit mit seinen Gegnern liefern sollte. Die forma minor stimme zwar mit Ausnahme des besagten Exkurses sinngemäß mit der längeren Fassung überein, doch sei sie durch eine andere Akzentuierung stärker auf die Interes- sen der Reichsfürsten abgestimmt. Ludwigs Eintreten für deren Rechte würde hervorge- hoben, der Eindruck einer päpstlichen Usurpation dieser Rechte noch verstärkt. Weitere Überlegungen müßten aufgrund der Quellenlage unterbleiben. Der forma minor kommt also nach dieser Einschätzung die weitaus größere Bedeutung zu.[35]
Johannes war sich offensichtlich bewußt, wie nachteilig die Auswirkung seiner unerbitt- lichen Forderung nach einer päpstlichen Approbation auf die Fürsten des Reiches sein konnte. Am 26. Mai 1324 wies er in einem Brief die gegen ihn geäußerten Verdächti- gungen, er wolle die Rechte der Kurfürsten beschneiden, wütend zurück und versicher-te, dies sei niemals seine Absicht gewesen.[36]
5.6 Der vierte Prozeß
Der Wittelsbacher hatte in der Sachsenhäuser Appellation mehr als deutlich gemacht, daß er nicht gewillt war, dem Papst klein beizugeben. So ließ er dann auch die am 23. Juni auslaufende erneute Frist verstreichen. Wie im dritten Prozeß schritt Johannes je- doch nicht sofort zur Tat, sondern wartete weitere drei Wochen, bis er schließlich zum vorerst letzten Schlag ansetzte. Ludwig wurden im vierten Prozeß alle Rechte abge- sprochen, die aus seiner Wahl erwachsen waren. Klerikern und Laien aller Stände wur- de es unter Wiederholung der bereits am 23. März ausgesprochenen Strafandrohungen verboten, ihn zu unterstützen oder als König des Reiches anzuerkennen. Außerdem kün- digte Johannes an, ihm alle Rechte zu entziehen, die die Kirche seinen Vorgängern ge- währt hatte. Abschließend griff er die Behauptung Ludwigs auf, er wolle die Kurfürsten in ihren Rechten einschränken, und erklärte, er sei durch das Verhalten seines Kon- trahenten zu diesem Vorgehen gezwungen, habe aber keinesfalls die Absicht, kurfürst- liche Privilegien anzutasten. Diejenigen, die als Anhänger Ludwigs bereits exkommuni- ziert seien, hätten die Möglichkeit zur Absolution durch ihren Erzbischof, falls sie sich bis zum 1. Oktober von ihm abwenden würden. Von der im dritten Prozeß angedeuteten Verurteilung als Ketzerbegünstiger sah Johannes ab; da er sich weitere Maßnahmen ge- gen Ludwig ausdrücklich vorbehielt, wollte er sich wohl nicht die Möglichkeit nehmen, den Konflikt im Bedarfsfall weiter zu verschärfen.[37]
Alles hing nun davon ab, wie sich die vom Papst Angesprochenen verhalten würden. Ludwig versuchte auf verschiedene Arten, den Ausgang dieses Entscheidungsprozesses in seinem Sinne günstig zu beeinflussen. Neben dem bereits dargestellten argumentati- ven Vorgehen in den Appellationen, die im Einflußbereich des Königs weite Verbrei- tung fanden, gibt es Hinweise auf gefälschte, im Namen der Kurie ausgestellte Briefe, die zu Propagandazwecken verbreitet wurden.[38] Am effektivsten war es aber naturge- mäß die Publikation des vierten Prozesses von vorne herein zu verhindern- wenn nötig, gewaltsam. So stellten sich dem Boten, der das Schriftstück im Auftrag des Salzburger Bischofs nach Regensburg bringen sollte, Bewaffnete entgegen und verhielten sich so feindselig, daß er die Botschaft auf seiner Flucht in den nächsten Fluß warf. In Freising, das sich fest in der Hand Ludwigs befand, traute sich der Überbringer des Dokuments nicht, dieses dem Domkapitel persönlich zu übergeben. Er wartete statt dessen eine günstige Gelegenheit ab, hinterlegte es auf dem Domaltar und verschwand aus der Stadt.[39] So zeichnete sich ein von großer Unruhe und teilweise sogar Angst geprägter Herbst ab, in dem auch die innenpolitischen Konflikte im Reich erneut an Brisanz ge- wannen, als Leopold von Habsburg am 27. Juli dem französischen König versprach, sich mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, daß dieser auch römischer König werde (eine Abmachung, die im übrigen weitgehend folgenlos blieb).[40] Wie eifersüchtig die Kur- fürsten über die Wahrung ihrer Rechte im Rahmen des Konflikts wachten, zeigte sich indes, als Ludwig für die Ausnutzung seiner Privilegien zur Erhebung von Zöllen erneut exkommuniziert wurde. So weigerten sich die rheinischen Erzbischöfe, daß ent- sprechende Urteil in ihren Diözesen bekannt zu machen, um keinen Präzedenzfall zu schaffen, der ihre eigene Zollpolitik hätte gefährden können.[41]
6. Ausblick und Schlußbetrachtungen
Bei aller Unnachgiebigkeit, mit der die Auseinandersetzung geführt wurde, gelang es keiner der beiden Seiten, eine Lösung in ihrem Sinne herbeizuführen. Ludwig bemühte sich 1325 um eine Aussöhnung mit dem Hause Habsburg. Im Münchner Vertrag vom 5. September wurde Friedrich als Mitregent anerkannt, alle im Rahmen des Thronkampfes gemachten Erwerbungen bekam er zugesichert. Am 7. Januar 1326 erklärte sich Ludwig im sogenannten Ulmer Vertrag sogar zum Verzicht auf die Krone bereit, falls die Kurie im Gegenzug den Habsburger als rechtmäßigen Herrscher anerkennen würde. Johannes, der ja nach wie vor vor allem an der Durchsetzung seiner Italienpolitik interessiert war, ging jedoch auf das Angebot nicht ein. Ludwig ließ sich dann schließlich am 17. Januar 1328 in Rom von vier Vertretern der Stadt zum Kaiser krönen (was einer erneuten, kla- ren Absage an das Mitspracherecht des Heiligen Stuhls gleichkam) und erklärte Johan- nes XXII. am 18. April des Jahres für abgesetzt. Peter von Corbara, am 12. Mai zum Gegenpapst Nikolaus V. erhoben, wiederholte die Krönungszeremonie. Auch nach dem Tode Johannes‘ 1334 gelang es dem Wittelsbacher nicht, einen Ausgleich mit der Kirche zu finden. Benedikt XII. (1334 – 1342) war zwar ernsthaft um ein Entgegen- kommen bemüht, mußte aber seinen 1335 begonnen Absolutionsprozeß zwei Jahre später auf Druck des französischen Königs abbrechen. Insofern war die Proklamation des Rhenser Kurvereins, in der die Kurfürsten am 16. Juli 1338 erklärten, auch ein in zwiespältiger Wahl bestimmter König bedürfe keiner päpstlichen Approbation, zwar verfassungsgeschichtlich sehr bedeutsam, realiter nützte sie aber Ludwig in Bezug auf seine päpstliche Verurteilung wenig.[42]
Am 11. Juli 1346 sank der Stern des Wittelsbachers, als die im Zuge des Ausbaus von Ludwigs Hausmacht in ihrer eigenen Territorialpolitik eingeschränkten Kurfürsten, von Papst Clemens VI. (1342 – 1352) ermutigt, Karl IV. zum Gegenkönig wählen. Noch be- vor es zu einer Auseinandersetzung kommen konnte, starb Ludwig der Bayer am 11. Oktober auf der Bärenjagd an einem Schlaganfall.[43] So endete ein Kampf, der sich über beinahe 23 Jahre hinzog, die Pontifikate dreier Päpste einschloß und zu Lebzeiten des Protagonisten nicht mehr geklärt werden konnte. Sein Wirken trug jedoch mit dazu bei, daß der Papst in der „Goldenen Bulle“ Karls IV. erfolgreich aus der deutschen Reichs- verfassung gedrängt werden konnte.
Im Rückblick stellt sich die Frage, warum Ludwig nicht zu einem Zeitpunkt, an dem seine Approbation als gewählter König noch möglich gewesen wäre, nachgab und statt- dessen einen jahrelangen (und letzten Endes jahrzehntelangen) Konflikt mit der Kurie riskierte. Ihm mußte Ende des Jahres 1323 bewußt gewesen sein, daß den Habsburgern eine solche Situation nur zu gut in ihre eigenen Pläne paßte. Außerdem wurde ihm ja von Johannes XXII. die Exkommunikation angedroht- eine Strafe, deren Wirkung Lud- wig als Vertreter des von Religiosität geprägten Mittelalters kaum auf die leichte Schul- ter genommen haben dürfte. Seine Motivation ist in der Wahrung der Selbständigkeit des Reiches und, genau wie bei Johannes, des Machtanspruches auf die oberitalieni- schen Reichsgebiete zu finden. Ein Zugeständnis an die Kurie in diesen Fragen wäre ein Schritt in die Richtung eines völlig vom Apostolischen Stuhl abhängigen König- und Kaisertums gewesen; Ludwig konnte und wollte ihn nicht gehen.
Ein letzter Gedanke sei Schütz‘ Interpretation der Appellationen des Wittelsbachers ge- widmet: es klingt plausibel, daß der Bayer versuchte, alle ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel unter Zuhilfenahme der kirchenrechtlich bedingten Verfahrensfeinheiten zu nutzen. Man müßte jedoch erwarten, daß für die tatsächliche Eingabe in Avignon vorgesehene Dokumente so eindeutig formuliert sind, daß ihr wahrer Zweck aus ihnen hervorgeht. Zweifelhaft ist auch, ob es dem Papst gelungen sein kann, alle Belege für den ihm unterstellten Rechtsbruch zu beseitigen, zumal Ludwig mindestens die Mißach- tung der Nürnberger Appellation ohne weiteres zu weiteren Vorwürfen an die Adresse seines Gegners hätte verwenden können. Doch auch hier sind keine eindeutigen Quel- lenbelege auffindbar.
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
7.1 Quellen
VI 1; in: J. Miethke, A. Bühler (Hrsg.): Kaiser und Papst im Konflikt. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter; Düsseldorf 1988, S. 132-136.
7.2 Literatur
Grohe, J. in: Lexikon des Mittelalters, Band V, München 1991, Sp. 545.
Kaufhold, M.: Öffentlichkeit im politischen Konflikt. Die Publikation der kurialen Pro- zesse gegen Ludwig den Bayern in Salzburg; in: Zeitschrift für historische Forschung, 22. Band (1995), Heft 4, S. 435-454.
Kaufhold, M.: Gladius spiritualis. Das päpstliche Interdikt über Deutschland in der Re- gierungszeit Ludwigs des Bayern (1324 – 1347); Heidelberg 1994.
Miethke, J.; Bühler, A.: Kaiser und Papst im Konflikt. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter; Düsseldorf 1988.
Pauler, R.: Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahrhundert. Von Heinrich VII. bis Karl IV.; Darmstadt 1997.
Rall, H., Rall, M.: Die Wittelsbacher. Von Otto I. bis Elisabeth I.; Graz u.a. 1986.
Reiter, E.: Das Papsttum in Avignon; in: Buckl, W. (Hrsg.): Das 14. Jahrhundert. Kri senzeit; Regensburg 1995, S. 19-31.
Schmid, A., in: Lexikon des Mittelalters, Band V, München 1991, Sp. 2178.
Schütz, A.: Die Appellationen Ludwigs des Bayern aus den Jahren 1323/24; in: Mittei- lungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 80. Band (1972), S. 71-112.
[...]
[1] Vgl. Kaufhold, M.: Gladius spiritualis. Das päpstliche Interdikt über Deutschland in der Regierungszeit Ludwigs des Bayern (1324 – 1347); Heidelberg 1994, S. 28-30.
[2] Vgl. Pauler, R.: Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahrhundert. Von Heinrich VII. bis Karl IV.; Darm- stadt 1997, S. 117.
[3] Vgl. Reiter, E.: Das Papsttum in Avignon; in: Buckl, W. (Hrsg.): Das 14. Jahrhundert. Krisenzeit; Regensburg 1995, S. 20-21.
[4] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 32-33.
[5] Vgl. Pauler: Könige, S. 122.
[6] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 50-53.
[7] Vgl. Pauler: Könige, S. 132-133.
[8] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 292.
[9] Vgl. Pauler: Könige, S. 137-138.
[10] VI 1, S. 134-135. In: J. Miethke, A. Bühler (Hrsg.): Kaiser und Papst im Konflikt. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter; Düsseldorf 1988, S. 132-136.
[11] Ebd., S. 135.
[12] A.a.O.
[13] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 56-58.
[14] Vgl. Pauler: Könige, S. 123-124.
[15] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 59.
[16] Vgl. ebd., S. 61.
[17] Vgl. ebd., S. 60.
[18] Vgl. Miethke, J., Bühler, A.: Kaiser und Papst im Konflikt. Zum Verhältnis von Staat und Kirche im späten Mittelalter; Düsseldorf 1988, S. 40.
[19] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 60-61.
[20] Vgl. Schütz, A.: Die Appellationen Ludwigs des Bayern aus den Jahren 1323/24; in: Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, 80. Band (1972), S. 76-79.
[21] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 61-62.
[22] Vgl. ebd., S. 62.
[23] Vgl. Schütz: Appellationen, S. 88-89.
[24] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 62.
[25] Vgl. ebd., S. 64.
[26] Vgl. Kaufhold, M.: Öffentlichkeit im politischen Konflikt. Die Publikation der kurialen Prozesse gegen Lud- wig den Bayern in Salzburg; in: Zeitschrift für historische Forschung, 22. Band (1995), Heft 4, S. 440.
[27] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 64-65.
[28] Vgl. ebd., S. 65.
[29] Vgl. ebd., S. 66-67.
[30] Vgl. ebd., S. 69.
[31] Vgl. Grohe, J. in: Lexikon des Mittelalters, Band V, München 1991, Sp. 545.
[32] Vgl. Schütz: Appellationen, S. 91-92.
[33] Vgl. ebd., S. 95-98.
[34] Vgl. ebd., S. 105.
[35] Vgl. Kaufhold: Gladius, S. 68-70.
[36] Vgl. ebd., S. 71.
[37] Vgl. ebd., S. 74-75.
[38] Vgl. ebd., S. 77.
[39] Vgl. ebd., S. 76.
[40] Vgl. ebd., S. 77.
[41] Vgl. ebd., S. 79.
[42] Schmid, A.: Lexikon des Mittelalters, Band V, München 1991, Sp. 2178.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem ersten Höhepunkt der Auseinandersetzung zwischen dem Papsttum und Ludwig dem Bayern in den Jahren 1323/24. Im Zentrum steht der erste Prozess Johannes‘ XXII. gegen Ludwig den Bayern, der schließlich mit dessen Exkommunikation und Aberkennung aller Rechte aus der Königswahl endet.
Wer waren die Hauptakteure in diesem Konflikt?
Die Hauptakteure waren Ludwig IV., genannt der Bayer (deutscher König), und Papst Johannes XXII.
Was war der Auslöser des Konflikts?
Der Konflikt wurde durch die päpstliche Forderung nach Approbation des gewählten römischen Königs durch den Papst ausgelöst, sowie durch Ludwigs Einmischung in Oberitalien, wo Johannes XXII. seine Interessen durchzusetzen versuchte.
Welche Ereignisse kennzeichneten den Konflikt in den Jahren 1323/24?
Die Ereignisse umfassen vier Prozesse Johannes‘ XXII. gegen Ludwig den Bayern und drei Appellationen (Rechtsmittel) Ludwigs des Bayern: die Nürnberger, Frankfurter und Sachsenhäuser Appellationen.
Was war die Nürnberger Appellation und wie wurde sie interpretiert?
Die Nürnberger Appellation war ein Schriftstück Ludwigs des Bayern, in dem er dem Papst Gehorsam zusicherte, aber auch Vorwürfe gegen den Papst erhob. Die Forschung ist sich uneins, ob die Appellation die Kurie erreichte. Einige Historiker sehen sie als Mittel zur Schaffung einer fiktiven Öffentlichkeit, während andere sie als strategischen Versuch interpretieren, einer Verurteilung als Ketzer zuvorzukommen.
Worin unterschied sich die Frankfurter Appellation von der Nürnberger?
Die Frankfurter Appellation ähnelte der Nürnberger, jedoch fehlte in ihr die Anklage gegen den Papst als Unterstützer von Häretikern.
Was war die Sachsenhäuser Appellation und welche Versionen davon existieren?
Die Sachsenhäuser Appellation war Ludwigs Reaktion auf seine Exkommunikation. Es existieren zwei Versionen: eine kürzere (forma minor) und eine längere (forma major), wobei der Hauptunterschied in der Aufnahme des Armutsexkurses in der forma major besteht.
Welche Auswirkungen hatte die Exkommunikation Ludwigs des Bayern?
Die Exkommunikation Ludwigs hatte zur Folge, dass seine Anhänger ebenfalls mit Exkommunikation bedroht wurden und über deren Herrschaftsgebiete das Interdikt verhängt wurde (Einschränkung der Gottesdienste). Die dem Wittelsbacher geleisteten Eide wurden für ungültig erklärt.
Wie endete der Konflikt zwischen Ludwig dem Bayern und dem Papsttum?
Obwohl der Konflikt über Jahre andauerte und keine der Seiten eine vollständige Lösung im eigenen Sinne erreichte, trug Ludwigs Wirken dazu bei, dass der Papst in der „Goldenen Bulle“ Karls IV. aus der deutschen Reichsverfassung gedrängt werden konnte.
Was war Ludwigs Motivation für seinen Widerstand gegen den Papst?
Ludwigs Motivation lag in der Wahrung der Selbständigkeit des Reiches und dem Machtanspruch auf die oberitalienischen Reichsgebiete. Ein Zugeständnis an die Kurie in diesen Fragen wäre ein Schritt in Richtung eines vom Apostolischen Stuhl abhängigen König- und Kaisertums gewesen.
- Citar trabajo
- Christian Zacke (Autor), 2003, Der Konflikt zw. Ludwig dem Bayern und Johannes XXII. 1323/1324, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108110