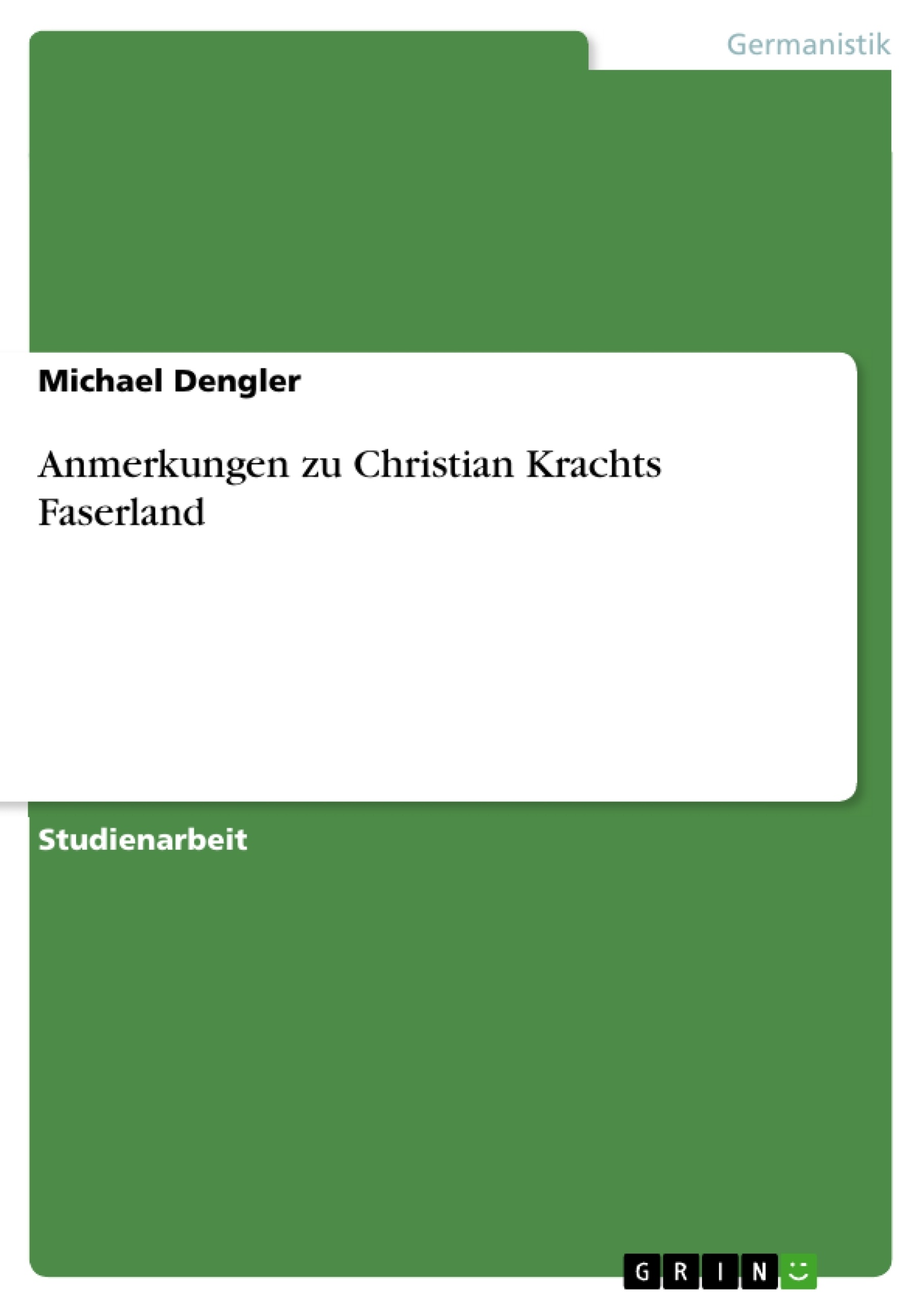Stellen Sie sich vor, Sie reisen durch Deutschland, ein zerrissenes Land, auf der Suche nach etwas Unbestimmtem, vielleicht nach sich selbst. Christian Krachts Kultroman "Faserland" nimmt Sie mit auf genau diese Reise, eine Odyssee von Sylt nach Zürich, begleitet von Champagner, Zigaretten und einer tiefen Melancholie. Der namenlose Ich-Erzähler, ein Spross der deutschen Nachkriegszeit, driftet durch eine Welt des Konsums und der Oberflächlichkeit, geplagt von diffusen Erinnerungen und einer eigentümlichen Distanz zu seiner eigenen Vergangenheit. Ist es die Last der deutschen Geschichte, die ihn so unruhig macht, oder ist es die Sinnlosigkeit des modernen Lebens? "Faserland" ist mehr als nur eine Road Novel; es ist eine intelligente und provokante Auseinandersetzung mit Identität, Moral und der Frage, was es bedeutet, deutsch zu sein. Krachts präziser und schonungsloser Stil fängt das Lebensgefühl einer ganzen Generation ein, die zwischen Hedonismus und Nihilismus, zwischen Party und Panik gefangen ist. Begleiten Sie den Protagonisten auf seiner ziellosen Reise durch das "Faserland" Deutschland, einer Reise voller absurder Begegnungen, exzessiver Partys und existenzieller Fragen. "Faserland" ist ein Roman, der unter die Haut geht, der verstört und fasziniert, und der noch lange nach dem Zuklappen des Buches nachhallt. Eine Reise durch Nachtclubs, Landschaften und die dunklen Ecken der deutschen Seele, Krachts Meisterwerk analysiert auf unvergessliche Weise die innere Zerrissenheit einer ganzen Generation im Spannungsfeld von Vergangenheit und Gegenwart. "Faserland" ist ein Muss für alle, die sich für zeitgenössische Literatur, Gesellschaftskritik und die Frage nach der deutschen Identität interessieren. Der Roman behandelt Themen wie Entfremdung, Identitätskrise, deutsche Geschichte, Konsumgesellschaft, Oberflächlichkeit, Reisen, Alkoholismus, Drogen, Partys, Melancholie, Sinnsuche, Generationenkonflikt, Moral, soziale Isolation, und die Suche nach Authentizität, was ihn zu einem relevanten Werk für Leser macht, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen wollen. Tauchen Sie ein in die verstörende Welt von "Faserland" und entdecken Sie die dunkle Seite des deutschen Pop.
Inhalt
1 Einleitende Bemerkung
2 „Faserland“ – Zum Titel des Romans
3 Zur Erzählstrategie von Kracht
4 (Flucht-)Reise durchs Party-Land
5 Drei Schlussfolgerungen
6 Literatur
1 Einleitende Bemerkung
Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit gilt im weitesten Sinn der Frage, wie sich der Debütroman Faserland des Schriftstellers und Journalisten Christian Kracht mit Moral auseinandersetzt. Es soll dabei exemplarisch und punktuell gezeigt werden, dass die Komposition bzw. die Struktur des Textes als auch die in ihm dargestellte Lebenssituation zum (moralischen) Nachdenken anregt. Einige der nachfolgenden Gedanken greifen auf die Faserland-Sitzung des Hauptseminars Ethik des Erzählens zurück. Ausgangspunkt meiner Betrachtung ist die Analyse des Titels. Daran anknüpfend werde ich auf die Erzählstrategie eingehen. Der dritte Teil der Untersuchung beschäftigt sich mit dem Aspekt der „Flucht“.
2 „Faserland“ – Zum Titel des Romans
„Faserland“[1] ist kein Titel, der eindeutig ist. Er verschließt sich dem Leser zunächst. Im Gegensatz zu solchen Titeln, die offensichtlich bzw. unvermittelt zeigen, worum es geht, wie etwa Harry Potter and the Order of the Phoenix – hier weiß man sofort, was sich dahinter verbirgt: Harry Potter wird nämlich (das ist gewiss) entweder mit oder gegen diesen Orden zu kämpfen haben, fordert „Faserland“ zu einer Interpretation auf.
Die Rezeption hat es bisher bedauerlicherweise versäumt, sich mit dem „sperrigen“ Titel näher zu beschäftigen. Allein Baßler (2000, 113) und Frank (2000, 83) stellen heraus, was dem literaturwissenschaftlichen Leser an und für sich klar zu sein scheint und daher keiner Erwähnung oder Überlegung bedarf: „Faserland“ steht für Fatherland, also Vaterland. Dass diese Identifizierung nicht von ungefähr kommt und Sinn macht, zeigt die Story: „Einmal durch die Republik, von Nord nach Süd: Christian Krachts namenloser Ich-Erzähler berichtet von seiner Deutschlandreise“[2]. – Die Reise, so der Schluss, geht durchs Vaterland.
Diese Überlegung hat im Seminar zu der Frage geführt, ob der Text zu dem Genre der so genannten „Vaterbücher“ zu zählen ist: Handelt es sich bei Krachts „Vaterland“ möglicherweise um eines jener Bücher, wie man sie mit Beginn der 70er Jahre lesen konnte, aus dem schwierigen Verhältnis heraus geschrieben zu den eigenen, mit dem Nationalsozialismus verstrickten Eltern? Ist Faserland ein solches Dokument, das – freilich sehr verspätet – die problematische Eltern-Kind-Konstellation der ersten Nachkriegsgeneration weiter literarisiert (als Reise durch das Vaterland) und dem Genre ein weiteres Werk hinzugibt? – Fest steht, dass Kracht und eben auch sein Erzähler-Ich als Vertreter der zweiten Nachkriegsgeneration, aufgewachsen in Wohlstand und Konsum, nur noch vermittelt über das erfahren können und, das ist ja die Frage, berichten, worunter die AutorInnen der Vaterbücher persönlich zu leiden hatten. Vielleicht lässt sich die Frage so angehen: beantwortet man sie mit ja, dann wird das Genre Vaterbuch um eine neue Generation bereichert und man müsste sich gut überlegen, ob es für Faserland eine bessere Bezeichnung geben könnte, als „Großvaterroman“. Erklärt man sich damit einverstanden, dann würde dies bedeuten, dass der Zustand der Gesellschaft der BRD der 90er Jahre und infolgedessen der Zustand des Protagonisten, den der Roman dem Leser vor Augen führt, kausal zurückgeführt wird auf die Generation der Großeltern. Das Fazit müsste heißen: Das „Fatherland“ ist zugleich und noch immer auch ein „Groß-Fatherland“. So gewitzt dieser Gedanke auch klingt, es dürfte schwierig sein zu beweisen, dass er völlig ohne Bedeutung ist. Außerdem ist es nicht per se so, dass die 90er Jahre Vaterbücher unmöglich machen würden, der gerade mal zwei Jahre vor Faserland erschienene Text Der Vater (1993) von Niklas Frank ist ein Beispiel dafür. Auch zeigt etwa die Walser-Buber-Kontroverse aus dem Jahr 1998 deutlich, dass der Nazismus und der Umgang mit diesem in Deutschland immer noch ein notwendiges, ja unabweisbares (literarisches) Thema ist. Aber vor allem Krachts Roman selbst nährt den Eindruck, dass es in Faserland, um den Ausdruck von Blasberg zu benützen, unter anderem um „Erörterungen einer schwierigen Vaterbeziehung“[3] gehen könnte, oder, etwas vorsichtiger ausgedrückt, wenigstens um die Andeutung dieses Diskurses[4]. Was der Titel in dieser Hinsicht ausstrahlt, greift der Text auf seltsame (anachronistisch wirkende) Weise unüberlesbar auf. Damit sind solche Momente von Faserland gemeint, in denen der Ich-Erzähler die Präsenz, die Spuren der eigenen und der deutschen Vergangenheit in der Gegenwart sieht, eigentätig herstellt bzw. hervor phantasiert, oder davon überwältigt wird. Dass der Vater dabei konkret eine Rolle spielt, zeigt sich zum Beispiel daran, dass Sylt, wo die Odysee des Ich-Erzählers durch Deutschland beginnt, die Urlaubsinsel seiner Kindheit ist, und Zürich, wo sie ihr abruptes (lesbares) Ende findet, der Ort, an dem er sich erinnert, was er als kleiner Junge im Auto seines Vaters sitzend, auf der Fahrt nach Genf, angestellt hat.
Meine einzige Erinnerung an die Schweiz ist eine Autofahrt mit meinem Vater. Ich war vielleicht sechs oder sieben, und wir fuhren am Genfer See entlang, nach Genf.[5]
Und auch sonst, ob in Hamburg (zweites und drittes Kapitel), Frankfurt (viertes Kapitel), Heidelberg (Kapitel fünf), München oder Meersburg (Kapitel sechs bzw. sieben), wird der Protagonist von Erinnerungen begleitet, denen er sich nicht entziehen kann, weil das Land, das er bereist bzw. welchem er ausgesetzt ist, ihn unaufhörlich dazu anregt, es im Schein der Vergangenheit zu sehen. Zwei Beispiele.
Nigel scheint seinen Pulli gefunden zu haben, so einen Fair-Isle-Pullover in beiger Wolle mit Kabelmuster, und er zieht ihn sich über den Kopf, über sein Hanuta-T-Shirt, dabei fällt mir ein, daß ich gerade erst neulich gemerkt habe, warum Hanuta Hanuta heißt. Das ist nämlich so: In Deutschland gibt es eine Art Abkürzungswahn, der von den Nazis erfunden worden ist. Gestapo und Schupo und Kripo, das ist ja klar, was das heißt. Aber es gab auch zum Beispiel die Hafabra, und das wissen, glaube ich, nur wenige, das heißt Hamburg-Frankfurt-Basel, und das war die Hitler-Autobahn. Ja, und Hanuta heißt natürlich, das glaubt man gar nicht: Haselnußtafel.[6]
Das ist nun Heidelberg, und es ist wirklich schön dort im Frühling. Dann sind die Bäume schon grün, während überall sonst in Deutschland noch alles hässlich und grau ist, und die Menschen sitzen in der Sonne an den Neckarauen. Das heißt tatsächlich so, das muß man sich erst mal vorstellen, nein, besser noch, man sagt das ganz laut: Neckarauen. Neckarauen. Das macht einen ganz kirre im Kopf, das Wort. So könnte Deutschland sein, wenn es keinen Krieg gegeben hätte und wenn die Juden nicht vergast worden wären.[7]
Ich möchte es damit an dieser Stelle bei dieser Ausführung belassen, zumal der eine oder andere hier angesprochene Aspekt, insbesondere die eigentümliche Verfasstheit des Ich-Erzählers, etwa sein Bezug zum Nazitum, in den nachfolgenden Abschnitten noch einmal aufgegriffen wird, und zu einer zweiten Deutung des Titels übergehen, die, wie ich zeigen werde, in Zusammenhang mit der ersten gesehen werden kann. Wichtig ist mir im Moment festzuhalten, dass der Titel Widerstand leistet und insofern dazu appelliert, seine kommunikative Funktion mithilfe des Textes zu ergründen. Die bisherigen Ausführungen dieses Abschnittes geben ein kurzes Beispiel dafür. Auch zeigt sich jetzt schon, dass Krachts Text, allein schon von seinem Titel her, einer rein oberflächlichen Lesart widerstrebt.
Ein zweiter Kontext des Titels tut sich auf, wenn man sich seine Komposition etwas näher anschaut, die Zusammensetzung der beiden Substantive „Faser“ und „Land“ zu dem Kompositum „Faserland“. Der zweite Bestandteil der Zusammensetzung ist nicht weiter klärungsbedürftig, der erste hingegen schon: was bedeutet bzw. könnte „ Faserland“ bedeuten, wenn man weiß, dass mit dem Wort „Faser“ eine „Garnsträhne“[8] gemeint ist? Steht „Faserland“ etwa für „zerfasertes Land“? Gleicht der Text einer einzelnen Strähne eines Gewebes und wenn ja, um was für ein Gewebe kann es sich dann handeln? Kann man daraus ableiten, dass uns Kracht nur einen einzigen Bestandteil von Deutschland zeigt, eine einzige Faser nur? Kann es sein, dass das Wort von seiner Aussprache her an „faseln“ erinnern soll, was soviel heißen würde, dass der Text Zeugnis einer „wirren Rede“ ist oder einfach nur „dummes Zeugs“ sein will, das sich höheren ästhetischen wie moralischen Ansprüchen verweigert? Oder ist es vielleicht sogar so, dass der Bestandteil „Faser“ auf die Bedeutung „Faserung“ anspielt, was zur Folge hätte, dass das so bezeichnete Land, das Faserland, nur profilmäßig, rein oberflächlich daher kommt und das darunter Befindliche, die tieferen Schichten nur als Andeutung? Oder, auch denkbar, heißt die Gleichung: Faserland ist ein Land der Oberfläche, ist ein oberflächliches Land? Wäre der Titel demnach die Ankündigung einer moralischen Abrechnung oder zumindest die Andeutung einer negativen Bilanzierung? Man merkt: auch eine semantische Analyse führt zu keiner wirklichen Klärung des Titels. Klar hingegen wird, dass, wie bei der ersten Deutung auch, hierfür der Text in den Blickpunkt genommen werden muss. Eine Überlegung möchte ich als Anregung noch anstellen bzw. aufgreifen (siehe oben): Was ergibt sich, wenn man Identifizierung eins, „Faserland“ = Vaterland, mit zwei der eben aufgeworfenen Fragen zueinander in Beziehung setzt, nämlich mit den Annahmen: (a) „Faser“ = Garnsträhne und (b) „Faser“ = faseln è wirre Rede (Abb. 1)?
Abb. 1: schematische Darstellung des Gedankengangs[9]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Es könnte sich Folgendes ergeben:
Erstens: Das „Vaterland“ determiniert die über die „wirre Rede“ nachvollziehbare Verfasstheit des Ich-Erzählers. Der Ich-Erzähler hat ein Problem und das Problem heißt: Leben in Deutschland. Für diese Annahme spricht zum Beispiel:
Ich denke daran, daß die Schweiz so ein großes Nivellierland ist, ein Teil Deutschlands, in dem alles nicht so schlimm ist. Vielleicht sollte ich hier wohnen, denke ich [...] Alles erscheint mir hier ehrlicher und klarer und vor allem offensichtlicher. Vielleicht ist die Schweiz ja eine Lösung für alles.[10]
Zweitens: Die „Garnsträhne“ erweist sich als derjenige Teil des Vaterlandes, der dem Bezug des Ich-Erzählers zur nationalsozialistischen Vergangenheit der gegenwärtigen Gesellschaft „Stoff gibt“. Die Garnsträhne ist nur eine, wenngleich eine sehr bedeutende Strähne des historischen Gewebes, das Deutschland konstituiert bzw. umgibt.
3 Zur Erzählstrategie von Kracht
Es muss insbesondere die Sprache bzw. Schreibweise von Faserland gewesen sein, die Politycki dazu brachte, über den Autor Kracht zu behaupten, er verkörpere den Inbegriff einer Riege junger Autoren, „die sich, begnadet durch eine noch spätere Geburt, um überhaupt nichts mehr scheren, am allerwenigsten um die Frage, was ein vollgeschwalltes Stück Papier von einem literarischen Text unterscheide“[11]. Politycki mag dabei solche Passagen im Auge gehabt haben, wie etwa diese:
Jetzt erzählt sie von Gaultier und daß der nichts mehr auf die Reihe kriegt, designmäßig, und daß sie Christian Lacroix viel besser findet, weil der so unglaubliche Farben verwendet oder so ähnlich.[12]
Politycki steht allerdings mit seinem Urteil (so gut wie) alleine da. Sicher: Stil und Duktus vermitteln den Eindruck, Kracht habe sich nicht die Mühe gemacht, beim Schreiben seines Buches irgend welche ästhetisch gewohnte und darüber hinaus geschätzte, ja mehr noch, geforderte Ansprüche, die man an Literatur so stellt, einzulösen. Und sicher kann der Leser deshalb auch zu der Meinung kommen, dass solche Literatur gar keine Literatur ist, – und falls doch, dann macht jeder, der schreibt, Literatur. Aber dieser Eindruck täuscht und kann auch nur dann so unumwunden Ausdruck finden wie bei Politycki, wenn man sich auf den Text nicht weiter einlässt. Wenn man vom „Oberflächlichen“, „Dilettantischen“, „Faselhaften“ abgestoßen wird und das Ausgeklügelte, Spannungsreiche des Textes, der Schreibweise nicht entdeckt. (Aber vielleicht hat das auch etwas mit persönlichen Präferenzen zu tun.)
Dieses unverdichtete, überwiegend in einem „Parlando-Ton“[13] gehaltene Erzählen Krachts hat nach meinem Empfinden nämlich einen verstörend machenden Zug: Einerseits bieten die umgangs- bzw. alltagssprachlichen Partikel wie zum Beispiel „eigentlich“, irgendwie“, „na ja“ und die immer wieder eingefügten Redewendungen („aber ich sag das jetzt mal trotzdem“) dem Sprecher zwar Gelegenheit, Selbstrelativierungen einzuräumen bzw. sprachlich zu sich selber in Distanz zu treten[14].
Während ich mich zurechtmache, erzählt Nigel schon wieder von dieser blöden Party, und ich denke daran, daß mir Partys eigentlich nicht so wichtig sind, obwohl sie für Nigel das wichtigste der Welt sind, glaube ich. Das ist mir nicht ganz verständlich, denn, na ja, vielleicht sollte man das nicht so ausdrücken, wenn man ihn beschreibt, aber ich sage das jetzt mal trotzdem: Vielleicht mag der Nigel Partys so gerne, weil er im Grunde ein asozialer Mensch ist, Gott das würde ich ihm nie sagen, aber irgendwie ist er nicht kommunikationsfähig, ich meine, vielleicht mag er Partys, weil das so rechtsfreie Räume sind, wo er funktionieren kann, ohne kommunizieren zu müssen.[15]
Andererseits jedoch legt der Erzähler hin und wieder einen hemmungslosen, unkontrolliert-aggresiven Ausdruck an den Tag, der ihn zweifelsohne angreifbar macht. Er beschimpft[16] und bezeichnet ohne Anzeichen von moralischem Bedenken, ja fast schon mit einem gewissen Genuss, einem Automatismus oder, wie Baßler es nennt, einer „Besessenheit“ (2002, 114) gleich, insbesondere Taxi-Fahrer, aber auch andere Personen, etwa den „Betriebsratvorsitzenden“, der ihn anscheinend „ganz kritisch“ (53) anguckt, mit solchen geschichtsträchtigen Wörtern wie „Faschist“, „Nazischwein“, „SPD-Schwein“, „SPD-Nazi“, „Nazi“. Und der Ich-Erzähler lässt unvermittelt solche Sätze vom Stapel, die seine „vorbehaltliche“ und „unbehaftbare“ Sprechweise bis aufs Äußerste strapazieren:
Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich sage das trotzdem mal: Ab einem bestimmten Alter sehen alle Deutschen aus wie komplette Nazis. Der Fahrer auch. Da muß man nur in bestimmte Orte fahren, wo sehr viele Rentner sind, dann kann man das sehen.[17]
An solchen Stellen knistert es in Faserland. Es stellt sich nämlich die Frage, was Kracht, auch und insbesondere im Hinblick auf Moral, da macht, wenn nicht ein „Stück vollgeschwalltes Papier“. Diese Frage kann unterschiedlich beantwortet werden:
(1) Mit Döring (1996, 232). Kracht schreibt so, wie auf Parties gesprochen wird. Seiner Literatur gelingt durch die „Simulation einer generationsspezifischen Oralität die adäquate Beschreibungsleistung eines Ausschnitts von zeitgenössischer Wirklichkeit“. Demzufolge kann von Moral nicht die Rede sein: Kracht zeichnet nur nach und macht sichtbar, dass das „Aufarbeitungsthema Nationalsozialismus“ im Rahmen einer Party-Sprache fast ohne Tiefgang, Diagnose und Verständnis, Empathie und Verantwortung gegenüber der Geschichte auskommen muss.
(2) Mit Baßler (2000, 118). Kracht macht Rollenprosa. „Das Erzähl-Ich hat dabei für seine Sprache selbst kein Bewusstsein, man könnte sagen, daß an jedem seiner Sätze noch ein anderer (sagen wir vereinfacht: der Autor) mitspricht“. Das Ergebnis einer solchen Prozedur wäre nach Bachtin „das Bild von einer fremden Sprache und Weltanschauung, die abgebildet wird und gleichzeitig abbildet“[18]. Dadurch, dass der Erzähler in Abhängigkeit eines dem Leser mehr oder weniger unbekannten Dritten steht, der ihn als Vermittler seiner Sprache und Weltanschauung heranzieht, muss es offen bleiben, ob der Sprecher mit seiner eigenen Sprache, die nicht zu Gehör kommt, und Weltanschauung, die der Leser nicht sieht, vorausgesetzt beides ist vorhanden, sich anders darstellen würde, auch moralisch. Dieser „Mangel“ zwingt den Leser zu fragen, welche Gewalt das Erzähl-Ich beherrscht und was sie zu bedeuten hat.
4 (Flucht)Reise durchs Party-Land
Frank (2000) hat aufgezeigt, dass das Schema des vorbehaltlichen und unbehaftbaren Sprechens, Döring nennt das „Party-Talk“, mit der „Haltung des flüchtenden Milieubeobachters“[19] übereinstimmt. Am Text ist dieser Zusammenhang zwischen Sprache und Handeln des Ich-Erzählers gut ablesbar. Erstes Kapitel: Auf Sylt kaum etwas mehr als einen Tag und der Ich-Erzähler sitzt schon im Zug nach Hamburg. Planmäßig irgendwie, aber mit einem komischen Beigeschmack. Als Karin, eine Bekanntschaft aus gemeinsamen Internatszeiten von Salem, ihn küsst und ihm ein Date für den nächsten Abend anbietet, reagiert er nur in Gedanken, was nicht nur Karin als Rückzieher erlebt haben dürfte:
Dann sieh sie mich an und sagt allen Ernstes, wir sollten uns morgen abend treffen, im Odin. Das sagt sie wirklich. Dabei habe ich ihr doch erklärt, daß ich morgen abfahre. Na ja, vielleicht hat sie das schon wieder vergessen.[20]
Enttäuscht, fast hilflos über die misslungene Situation, trennen sich die beiden wortlos. Karin braust davon, der Ich-Erzähler ist mit dem Champagner, mit dem die Beiden sich in Stimmung brachten, allein. Bezeichnenderweise perlt er nicht mehr und schmeckt „schal und flach und abgestanden“[21]. Im übertragenen Sinn soll das wohl heißen: was man aufmacht, muss man auch trinken. Spontaneität, Mut, Entschlossenheit und Offenheit für die auftretende Situation wäre hier angebracht gewesen, aber der Ich-Erzähler wirkt in dieser Hinsicht defizitär. Der Plan und die mitgebrachte Haltung ist im Zweifelsfall wichtiger als die (irritierende oder peinliche) Situation. Zweites und drittes Kapitel: Der Ich-Erzähler ist zu Besuch bei Nigel, bei dem er „ein paar Tage“ (29) wohnen kann. Dieser überredet ihn kurzerhand, mit auf eine Party zu gehen. Der Ich-Erzähler findet Parties zwar nicht so wichtig, geht aber mit – und erlebt in den nächsten Stunden Dinge, auf die er in keiner Weise eingestellt war: auf den Ecstasy-Trip, den ihm sein Hamburger Freund ermöglichte, um nicht zu sagen, aufschwatzte, folgt die Einladung zum Gruppensex – „Hey baby, why don’t you come over and join us, huh?“ (49). Zitternd und heulend flieht der Ich-Erzähler und begibt sich nach Frankfurt, um „den Alexander zu besuchen“ (66), mit dem er in „Salem auf einem Zimmer“ (62) war. Aber daraus wird auch nichts. Am Telefon, „aus Versehen Alexanders Nummer“ (74) gewählt, kommt ihm kein Wort über die Lippen, weil er so nervös ist und fast in Ohnmacht fällt.
Ich ziehe an meiner Zigarette, und Alexander sagt: Hallo, wer ist da, und auf einmal wird alles schummrig in meinem Gehirn. Ich habe das Gefühl, als ob ich nach hinten kippe. Ich sehe so schwarze und gelbe Dinge, und ich weiß nicht, was es für Dinge sind. Hallo, kommt noch einmal aus dem Hörer, aber von ganz weit weg über mir oder von hinten. Dann macht es klick in der Leitung, und Alexander hat aufgelegt.[22]
Und später, im Cafe Eckstein, als die Tür aufgeht und Alexander hereinkommt, behält das-nicht-darauf-Gefasstsein („weil ich da ja überhaupt nicht drauf vorbereitet bin, ihn zu treffen, meine ich“[23] ) über die vorhandene Freude des Wiedersehens mit Leichtigkeit die Oberhand: der Ich-Erzähler ist „verdutzt“, bleibt regungslos und beobachtet, legt sich dabei eine kleine Erklärung zurecht, die jedoch nicht ihn, sondern Alexander entschuldigen soll: „Vielleicht habe ich mich so verändert, daß er mich nicht erkennt, vielleicht liegt es daran“ (80/81). Was bleibt, ist die Flucht nach vorne, auf in den Zug und ab in die nächste Stadt. Eigentlich Karlsruhe, aber davon hält ihn der Trendforscher Matthias Horx ab, der eben gerade auf dem Weg dorthin ist. Also Heidelberg. Wieder Party, wieder Alkohol, ein paar Gedanken über Alexander und Sylt und wieder ein unmoralisches Angebot, aber diesmal bleibt der Erzähler standhaft. Eugens Koks ist nichts für ihn, auch nicht seine Anmache. Das Gefühl, „sehr bedroht“ (104) zu sein, führt ihn nach unten bis in den Keller des Hauses (ganz nach der Devise, möglichst viel Abstand zu Eugen), wo, für den Leser überraschend, Nigel liegt.
Er hat den rechten Arm mit einem Ledergürtel abgebunden, und aus einer kleinen Wunde in seiner Armbeuge rinnt einer dünner Streifen Blut.
Das glaube ich einfach nicht. Ich habe das Gefühl, als würde ich innerlich völlig ausrasten, als ob ich völlig den Halt verliere. So, als ob es gar kein Zentrum mehr gäbe. Nigel, rufe ich. Scheiße. Nigel. Er antwortet nicht. Ich frage ihn, ob er mich denn verdammt nochmal nicht kennt. Und er sagt, das sagt er wirklich: Sollten wir uns kennen?[24]
Das ist für den Erzähler nicht zu verkraften, und es geschieht das, was vorher im Hotelzimmer mit dem Hörer in der Hand sich angedeutet hatte: sein Körper verweigert sich ganz, er besucht den kleinen „Schlafes Bruder“. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, befindet er sich auf einer Party in München und neben ihm sitzt sein „alter Freund“ Rollo, den er natürlich in Salem kennen lernte. München bleibt übrigens die einzige Stadt, der einzige Ort auf der Reise durch die alten Bundesländer, die der Erzähler nicht mit schlechten Erfahrungen, respektive Ohnmacht, hinter sich lassen muss.
Kapitel Sieben erzählt – wer hätte es gedacht – von einer Party, die Rollo im üppigen Haus seiner Eltern in Meersburg gibt, das direkt am Bodensee liegt und in nicht allzu weiter Ferne von Salem. Der Ankunft in die Landschaft seiner Jugend entsprechend stellen sich beim Erzähler-Ich Erinnerungen an diese Zeit ein. Über keine andere Person, den Erzähler und Alexander ausgenommen, erfährt der Leser so viel, wie über Rollo. Aber es stellt sich heraus, und dies ist insbesondere im Hinblick auf die nationalsozialistischen Referenzen des Erzählers von Bedeutung, dass die Geschichte Rollos zu Teilen herbeifabuliert ist („Das sind natürlich alles eher billige Bilder, die ich mir über Rollos Leben ausdenke,...“[25] ) und es überhaupt nicht klar wird, welche Teile der biografischen Wirklichkeit Rollos entsprechen und welche nicht[26]. Diese Stelle deutet darauf hin, dass des Erzählers „Reisebericht“ eine Verquickung aus öffentlichem Gedächtnis[27], privater Erinnerung und selbst erzeugten Phantasien ist, die sich ebenso schwer entwirren lässt, wie ein Stoffknäuel. Dass Kracht mit diesem Bekenntnis erst relativ spät herausrückt, lange nachdem der Leser so etwas wie ein Gefühl für diesen „verklemmten“ Erzähler entwickelt hat, führt dazu, dass der Leser sein Verständnis von Erzähler und Erzählung überprüfen muss. Man könnte ja plötzlich der Meinung sein, auch angesichts des unmäßigen Alkoholkonsums des Erzählers, dass die alten Schulfreunde Karin, Nigel, Alexander und Rollo nicht wirklich auftreten, sondern nur die Reise in die eigene Vergangenheit begleitende Projektionen oder gar Halluzinationen wären.
Über diesen Effekt hinaus führt die Einsicht in das triadisch konzipierte Erzählen zu einer wenn-dann-Aussage: Wenn der Ich-Erzähler die öffentliche und die private Vergangenheit nur in einem Verhältnis der Phantasie halten kann, dann (vermutlich) deshalb, weil einerseits sein öffentliches Gedächtnis „Lücken“ hat und andererseits sein Verhältnis zur privaten Vergangenheit „Mängel“ aufweist. Lücke und Mangel sind insofern – frei nach Wagner-Engelhaaf – „ das Einfallstor der Imagination“[28]. Im Klartext: „Wirklichkeit“ und „Moral“ wird woanders gründlicher verhandelt.
Kapitel sieben zeigt überdies noch etwas: es führt nach drei Tagen Hetze, Rastlosigkeit und Flucht zum ersten Mal ein Moment der Stille und Ruhe ein. Vor der abendlichen Idylle des Bodensees setzt sich der Erzähler neben Rollo auf einen Stuhl. Es ist Folgendes zu lesen:
Das Geräusch des Windes, der durch die Büsche weht, und auch dieses leise Klicken der Eiswürfel in unseren Gläsern machen mich ganz ruhig, fast sogar ein bißchen schläfrig. Ich denke daran, daß ich früher auch oft am See gesessen habe und daß ich diese Stunde, in der das Licht nachlässt und man aufnahmefähiger für ganz komische Dinge, wunderbar finde. Wenn man so sitzt und nachdenkt und ein bißchen trinkt, dann wird man empfänglich für Schatten oder für Vögel, die am Himmel über den See kreisen. In sich sind diese Sachen ja gar nicht merkwürdig, aber wenn das alles so zusammen passiert, dann bekomme ich immer so eine halbwache Vorahnung von na, ja, etwas Kommendem, etwas Dunklem. Nicht, daß das mir Angst machen würde, dieses Nahende, aber es ist auch nicht angenehm. Auf jeden Fall ist es gut versteckt. Ich habe das noch niemandem erzählt, deswegen kann ich es auch nicht besser erklären. Es liegt hinter den Dingen, hinter den Schatten, hinter den großen Bäumen, deren Zweige fast den See berühren, und es fliegt hinter den dunklen Vögeln am Himmel her. Daran habe ich immer schon gedacht, auch so mit fünf. Ich habe das noch niemandem erzählt, weil es ja nichts Konkretes ist, nur so ein Gefühl, so eine Vorahnung eben. Über so etwas kann ich nicht viel sagen.[29]
Schatten, Himmel, Bäume, See, Büsche, Wind, Vögel und das abendliche Licht – das naturästhetische Erlebnis fern ab der Stadt bricht das besinnungslos machende wie sinnentziehende Treiben der Stadtlandschaften, durch die der Erzähler hetzt. Für einen kurzen Augenblick kommt er, eher spontan als geplant, eher der Situation folgend als aus dem bewussten Wissen heraus, dass eine kleine Ruhepause bei der Verarbeitung persönlicher Problemlagen hilfreich sein kann, in den Zustand der Kontemplation. Ansatzweiße sickert ihm ins Bewusstsein, was „hinter den Dingen liegt“, es stellt sich eine „Vorahnung“ ein, mehr allerdings auch nicht, was daran liegt, dass er für dieses „Gefühl“ keinen sprachlichen Ausdruck bereit stellen kann, eben deshalb, weil er es nie für angebracht hielt, sich darüber mit jemandem auszutauschen. Für solcherlei Gespräche ist wie es scheint, weder er noch der Andere, sei es Rollo, Alexander, Karin, Nigel oder sonst jemand bereit, wahrscheinlich sogar nicht einmal in der Lage: es fehlt die dafür wichtige Aufnahmefähigkeit, Ehrlichkeit, Energie und natürlich die Zeit, die man sich dafür zu nehmen hätte, was in einer vorwärtsorientierten Party-, Konsum- und Spaßgesellschaft jedoch nur schwer denkbar ist. Für einige der alten Freunde und Teilnehmer dieser Gesellschaft scheint dies kein Problem zu sein. Den Habitus des Oberflächlichen, den auf den Augenblick konzentrierte Spaß und den vereinenden oder auch trennenden Konsum von Musik, Alkohol und Drogen im Hochgeschwindigkeitstempo stellen „diese Kinder ihrer Zeit“ nicht in Frage, zumindest nicht verbal. Bei dem Ich-Erzähler stellt es sich allerdings etwas anders da: ihn bedrängt nun das sich entlang der „Flucht“ aufgebaute Gefühl, dass etwas nicht in Ordnung ist. Käme er zu einer bewussten Einsicht, dann müsste er sich wohl eingestehen: – Er macht zwar (so ziemlich alles) mit, aber mehr aus einer gewissen Gewohnheit bzw. einem Zwang heraus als aus aufrichtiger Überzeugung. – Er hat die Art eines Mitläufers, der mit dem Gefühl der Leere, Angst oder Unsicherheit mitmacht, um nicht als Spaßbremse oder, schlimmer noch, als Außenseiter zu gelten, zu dem er in Wirklichkeit, ohne es recht zu merken, geworden ist in den Jahren zwischen der gemeinsamen Zeit mit seinen Freunden in Salem und der momentanen Gegenwart. Sein Körper weiß darum und bringt es in klarster Weise zum Ausdruck, man denke daran, wie er sich ein ums andere Mal querstellt: er steht der Wirklichkeit ohnmächtig gegenüber. Der Weg ins Bewusstsein dauert allerdings länger, allein eine diffuse Vorahnung hat es geschafft, sich dort bemerkbar zu machen.
An diesem Zustand ändert sich zunächst wenig, um nicht zu sagen gar nichts, obgleich bemerkenswerter Weise der Autor ein paar Seiten später, wir befinden uns nebenbei bemerkt immer noch auf der Party, diesem Moment der Bestandsaufnahme einen zweiten hinzufügt, in dem das Motiv der Stille und Ruhe aufgegriffen wird. Der Erzähler baut seine gefühlsmäßigen Gedanken weiter aus, er denkt nun:
Alexander hat natürlich recht gehabt damit, daß es dort interessant sei. Nur erkenne ich das erst jetzt, Jahre später, in diesem Augenblick, auf der Party am Bodensee, neben Rollo stehend. Es hat etwas mit diesem Dampfer zu tun, mit dem Stillstehen, während der Dampfer selbst weiterfährt, und hinter einem liegen nackte alte Männer und starren einem auf den Arsch.
Das ist natürlich etwas schwierig zu erklären, aber es ist ein bißchen so, als finde man seinen Platz in der Welt. Es ist kein Sog mehr, kein Ohnmächtigwerden angesichts des Lebens, das neben einem so abläuft, sondern ein Stillsein. Ja, genau das ist es: Ein Stillsein. Die Stille.[30]
Der Abschluss des siebten Kapitels hingegen zeigt, dass die ansatzweiße sich einstellende Einsicht auf das Handeln keinen Einfluss nimmt. Der Erzähler lässt Rollo in seinem durch Valium und Alkohol aufgebauschten Schmerz allein und entlarvt sich damit ein weiteres Mal als Flüchtender, der sich weigert, der Situation gegenüber zu treten. Hier offenbart sich in aller Deutlichkeit, was den Erzähler am meisten davon abhält, zu einem handlungsfähigen, selbstbewussten, verantwortungsvollen und moralischen Menschen zu werden: die Antriebslosigkeit in Verbindung mit der fehlenden Perspektive. Deutlicher konnte Kracht nicht werden: Rollo ertrinkt, der (vorerst) letzte Freund aus Salem tritt aus dem Leben des Erzählers.
Das Schlusskapitel suggeriert den Eindruck, an der Konstitution des Erzählers könnte sich etwas ändern. Auf die geografische Zäsur, die mit der Fahrt nach Zürich markiert ist, folgen einige kleine Details, an denen Aufbruch, Wandel, womöglich sogar ein „Ankommen“ des Erzählers festgemacht werden könnte. Er trinkt zum ersten Mal in seinem Leben Kaffee, denkt daran, sich das Rauchen abzugewöhnen, kann (vielleicht aus diesem Grund) jetzt plötzlich Rauchringe machen und kauft sich eine Tageszeitung, obwohl er überhaupt nie Zeitungen liest. Alles Kleinigkeiten natürlich, die für sich genommen nur zeigen, dass der Erzähler von seinen reichlich gepflegten Gewohnheiten (und Möglichkeiten?) abkommt. Im Gesamtkontext der Erzählung kann dies aber durchaus als Ausdruck dafür gedeutet werden, dass mit der Ausreise aus Deutschland und der Einreise in die Schweiz, „eine Lösung für alles“ (151) erreicht werden möchte. Deutschland jedoch, dieses „ganze riesengroße Land“, diese „Maschine jenseits der Grenze“ (149) kann nicht einfach per Ausreise abgeschüttelt werden. Der Tod Rollos, der über die Zeitung den Erzähler einholt, verhindert den zurechtgelegten Abschied von Deutschland und den damit verbundenen Neuanfang, den er sich mit einiger Phantasie ausmalt: mit Isabella Rossellini und den Kindern zusammen auf einer kleinen Hütte am Rande eines kalten Bergsees wohnen, durch die dunklen Wälder streifen und dabei Deutschland hinter sich lassen, sich vergessen und neu erfinden und frei sein.
Aber es bleibt bei der Phantasie, denn der Erzähler irrt weiter durch Zürich, mit der Zigarette im Mund, wer weiß, wie die dahin gekommen ist, und begibt sich auf den Friedhof, oben, auf einen Hügel über dem See, um das Grab von Thomas Mann aufzusuchen. Man fragt sich zwar, was diese Reminiszenz zu bedeuten hat, aber die Tatsache, dass der Erzähler wegen der eintretenden Dunkelheit das Grab nicht findet, macht dieses kleine Rätsel unwichtig. Es reicht zu wissen, dass es dem Erzähler einmal mehr nicht gelingt, da anzukommen, wo er hin will in der Meinung, das könnte der rechte Ort sein.
5 Drei Schlussfolgerungen
Aus der vorliegenden Arbeit ist unter anderem zu entnehmen:
(1) Sprache und Handlung der Erzählung korrespondieren auffallend mit der Fragwürdigkeit des Titels. Der Roman als Ganzes vermag sich einer eindeutigen Lesart zu entziehen. Insbesondere die im Gewand einer Party-Sprache gehaltene Disposition des Erzählers zur deutschen Vergangenheit lässt den Leser verwirrt zurück: welche Absicht verfolgt der Autor damit, dass er seinen Erzähler permanent dazu anhält, auf diese Art und Weise „zurückzublicken“? Auf diese Frage gibt der Text selbst keine Antwort, aber die Existenz dieser Anlage kann im Grunde nur heißen: die (geistigen) Mechanismen, die aus dem Nationalsozialismus herrühren, sind in der postindustriellen Party- und Konsumgesellschaft der 90er Jahre unter, aber auch auf der Oberfläche des Alltags immer noch wirksam oder wenigstens manifest.
(2) Obgleich es die „Leistung“ des Erzählers ist, den Zusammenhang zwischen Vergangenheit und gegenwärtigem Leben aufzuzeigen, gelingt es dem Leser nur bedingt, daraus eine moralische Quintessenz zu ziehen. Über weite Strecken steht der Erzähler dieser Verbindung unreflektiert gegenüber, er registriert nur. Möglicherweise präsentiert Kracht nur eine Rolle, deren Funktion es ist zu zeigen, dass der Bezug der heutigen Jugend zur Vergangenheit des eigenen Landes im Vergleich zur Elterngeneration dem aktuellen Zeitgeist entsprechend abgenommen hat. Aber: ist das schlecht oder gut? Die Haltung des Erzählers spricht vermutlich dafür, dass man dieser Entwicklung auch gleichgültig gegenüber stehen kann.
(3) Andererseits wird einem schnell klar, dass dieser Erzähler ein Problem hat und dass dieses Problem in irgendeiner Weise mit Deutschland zu tun hat. Der Text assoziiert die kausale Verstrickung, der Erzähler konstituiere sich als Teil einer Maschine („die fremde Macht“), die fesselt und saugt und im Zweifelsfall als Erklärung für die eigene Unzulänglichkeit, die fehlende Perspektive und unmöglich erscheinende Entwicklungsfähigkeit herhalten muss. Moralisches Handeln wird so zur „Glückssache“.
6 Literatur
Primärtext
Christian Kracht: Faserland. 2. Aufl. April 2003. München: dtv.
Sekundärliteratur
Baßler, Moritz (2002): Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München: C.H. Beck, 110 – 118.
Blasberg, Cornelia (1998): Hitlers ‚willige Vollstrecker’ und ihre unwilligen Biographien. Vaterbücher der 70er Jahre. In: Markus Heilmann & Thomas Wägenbaur (Hrsg.), Im Bann der Zeichen. Die Angst vor Verantwortung in Literatur und Literaturwissenschaft. Würzburg, 15 – 34.
Döring, Jörg (1996): ‚Redesprache, trotzdem Schrift’. Sekundäre Oralität bei Peter Kurzeck und Christian Kracht. In: Jörg Döring, Christian Jäger & Thomas Wegmann (Hrsg.), Verkehrsformen und Schreibverhältnisse. Opladen: Westdeutscher Verlag, 226 – 233.
Frank, Dirk (2000): ‚ Talking about my generation’. Generationskonstrukte in der zeitgenössischen Pop-Literatur. In: Der Deutschunterricht 52, Heft 5, 69 – 85.
Hielscher, Martin (2000): Generation und Mentalität. Aspekte eines Wandels. In: NDL 48, Heft 4, 174 – 182.
Kluge, Friedrich (1989): Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 22. Auflage unter Mithilfe von Max Bürgisser und Bernd Gregor völlig neu bearbeitet von Elmar Seebold. Berlin; New York: de Gruyter, 204ff.
[...]
[1] In diesem Abschnitt gilt: „Faserland“ = Titel des Romans.
[2] Ausschnitt aus dem Einbandtext von Faserland, Ausgabe April 2003, Deutscher Taschenbuch Verlag.
[3] BLASBERG 1998, 15.
[4] Natürlich kann von einer Entsprechung zum Vaterroman im engeren Sinn nicht die Rede sein. Überlegenswert ist jedoch, ob Krachts Titel nicht ein poetologisches Spiel treibt, das als Replik auf dieses literarische Genre gelesen werden kann.
[5] Christian Kracht, Faserland, 151.
[6] Ebd., 35.
[7] Ebd., 85.
[8] KLUGE 1989, 204.
[9] Zur Zeichenverwendung: { } morphologische Einheit; [ ] semantische Einheit; ↕ Interdependenz.
[10] Christian Kracht, Faserland, 151.
[11] Zitiert nach BAßLER 2000, 111.
[12] Christian Kracht, Faserland, 14
[13] HIELSCHER 2000, 179.
[14] DÖRING (1996,231) spricht daher vom „Prinzip des vorbehaltlichen und dadurch letztlich unbehaftbaren Sprechens“. Vgl. auch mit FRANK 2000, 83.
[15] Christian Kracht, Faserland, 36/37.
[16] Vgl. Christian Kracht, Faserland, 57.
[17] Christian Kracht, Faserland, 93.
[18] Zitiert nach BAßLER 2000, 118.
[19] Frank 2000, 83.
[20] Christian Kracht, Faserland, 23.
[21] Ebenda. Im folgenden werden die kurzen Zitate im Fließtext nur mit der Seitenzahl ausgewiesen.
[22] Christian Kracht, Faserland, 74/75.
[23] Ebenda, 80.
[24] Ebenda, 105.
[25] Ebenda, 124.
[26] Vgl. mit Seite vier dieser Arbeit sowie mit Christian Kracht, Faserland, 128.
[27] Ist in Anlehnung an BAßLER (2000, 48) definierbar als „niemals endgültiges Ergebnis demokratischer Verhandlungen“ über die öffentliche Vergangenheit. Walser hat in Bezug auf die deutsche Geschichte hierfür den Begriff „Dauerrepräsentation unserer Schande“ gefunden und ausgesprochen im Rahmen einer Preisverleihung 1998 in der Frankfurter Paulskirche. Dies war der Anstoß für die Kontroverse zwischen ihm und dem damaligen Zentralrat der Juden, Ignaz Bubis.
[28] WAGNER-ENGELHAAF, Martina (2000): Autobiographie. Metzler: Stuttgart/Weimar, S. 45.
[29] Christian Kracht, Faserland, 126/127.
Häufig gestellte Fragen zu "Faserland"
Worum geht es in der vorliegenden Arbeit zu Christian Krachts Roman "Faserland"?
Die Arbeit untersucht, wie sich Christian Krachts Debütroman "Faserland" mit Moral auseinandersetzt. Es wird analysiert, wie die Struktur des Textes und die dargestellte Lebenssituation zum moralischen Nachdenken anregen.
Was bedeutet der Titel "Faserland"?
Der Titel ist vieldeutig und verschließt sich zunächst einer eindeutigen Interpretation. Er kann als Anspielung auf "Fatherland" (Vaterland) interpretiert werden, was durch die Reise des Ich-Erzählers durch Deutschland nahegelegt wird. Eine andere Deutung sieht in "Faserland" ein "zerfasertes Land" oder ein Land der Oberfläche. Es wird auch spekuliert, ob der Titel auf "faseln" anspielt, was eine "wirre Rede" andeuten könnte.
Ist "Faserland" ein "Vaterbuch"?
Es wird die Frage aufgeworfen, ob "Faserland" zum Genre der "Vaterbücher" gezählt werden kann, die sich mit dem schwierigen Verhältnis zur Elterngeneration auseinandersetzen, insbesondere im Kontext des Nationalsozialismus. Es wird diskutiert, ob "Faserland" als "Großvaterroman" betrachtet werden könnte, der den Zustand der BRD der 90er Jahre auf die Generation der Großeltern zurückführt.
Wie ist die Erzählstrategie in "Faserland"?
Die Sprache und Schreibweise von "Faserland" wirken auf den ersten Blick oberflächlich und dilettantisch. Kracht verwendet eine umgangssprachliche und alltagsnahe Sprache, die jedoch einen verstörend machenden Zug hat. Der Ich-Erzähler verwendet Selbstrelativierungen und Redewendungen, legt aber auch einen hemmungslosen und aggressiven Ausdruck an den Tag. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Kracht nur eine "Party-Sprache" simuliert oder ob mehr dahinter steckt.
Was bedeutet die "Flucht" des Ich-Erzählers durch Deutschland?
Die Reise des Ich-Erzählers wird als "Flucht" interpretiert, die mit der "Haltung des flüchtenden Milieubeobachters" einhergeht. Der Ich-Erzähler flieht vor Situationen, die ihn überfordern, und vor zwischenmenschlichen Beziehungen. Er ist unfähig, sich auf andere Menschen einzulassen und die Gegenwart zu gestalten. Stattdessen entzieht er sich verantwortungsvollen Situationen und flüchtet sich in Parties und oberflächliche Erlebnisse.
Welche Rolle spielt die Vergangenheit in "Faserland"?
Der Ich-Erzähler wird auf seiner Reise von Erinnerungen an die Vergangenheit begleitet, insbesondere an seine Kindheit und Jugend in Salem. Er sieht die Spuren der deutschen Vergangenheit in der Gegenwart und phantasiert über den Nationalsozialismus. Die Verquickung von öffentlichem Gedächtnis, privater Erinnerung und selbst erzeugten Phantasien macht es schwer, die Realität von den Projektionen des Erzählers zu trennen. Er scheitert aber dennoch daran, sich bewusst mit den Themen auseinanderzusetzen.
Gibt es eine Veränderung am Ende des Romans?
Das Schlusskapitel suggeriert eine mögliche Veränderung im Leben des Erzählers. Die Ausreise in die Schweiz und der Tod Rollos, seines Freundes aus Salem, stoßen weitere Reflektionen an. Er versäumt die Grabstätte Thomas Manns zu besuchen. Am Ende ist unklar ob er zu sich selbst gefunden hat.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu folgenden Schlussfolgerungen: (1) Sprache und Handlung der Erzählung korrespondieren mit der Fragwürdigkeit des Titels. (2) Der Leser kann nur bedingt eine moralische Quintessenz ziehen. (3) Der Erzähler hat ein Problem, das in irgendeiner Weise mit Deutschland zu tun hat. Es ist ein Glücksfall, ob es einen moralischen Ausgang findet.
- Quote paper
- Michael Dengler (Author), 2003, Anmerkungen zu Christian Krachts Faserland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108325