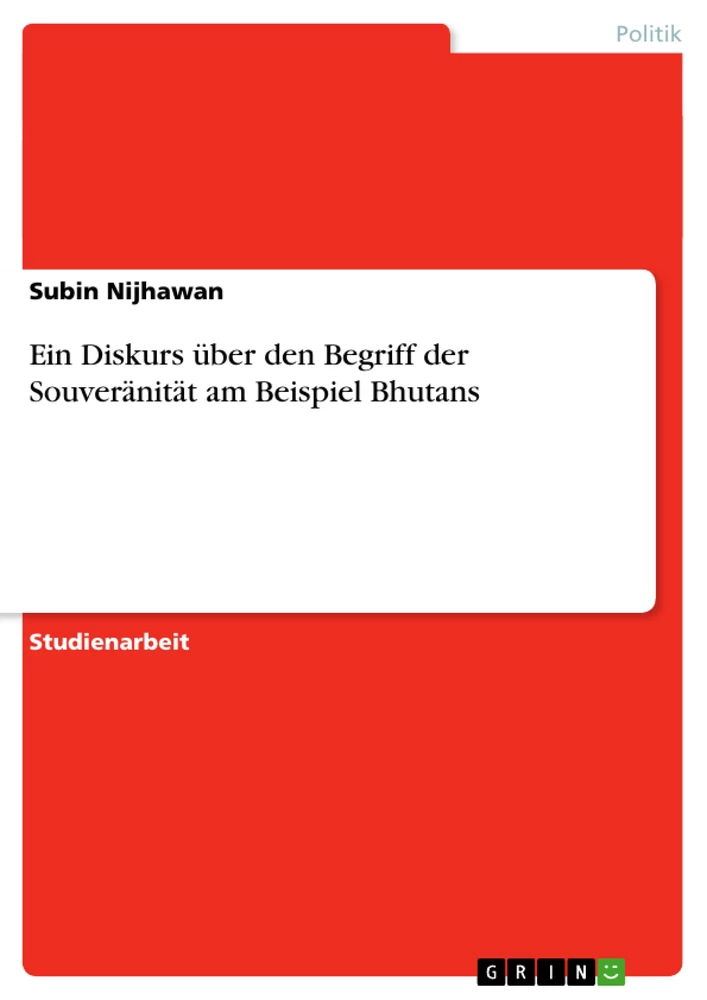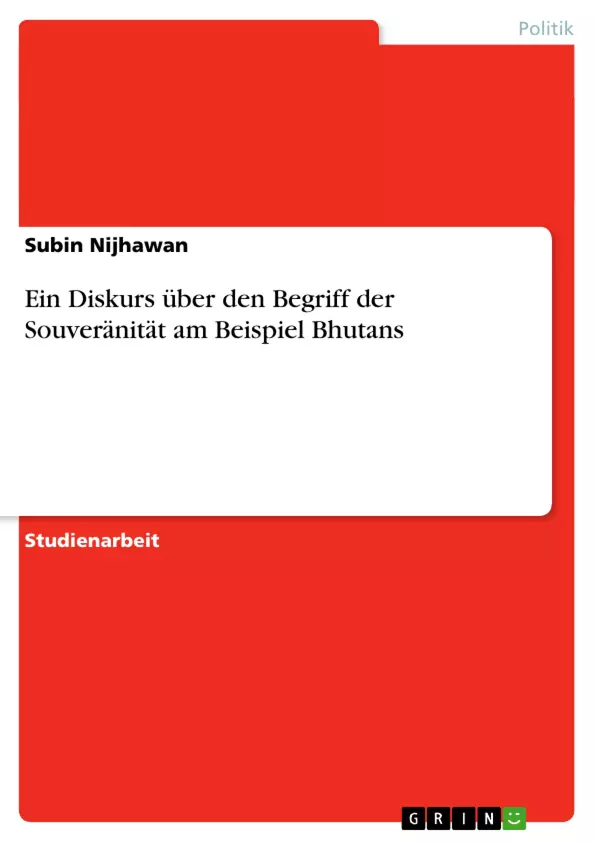Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung in die Problematik
II. Begriffe des Staates und der Souveränität
1. Der Begriff des Staates
a.) Staatsgebiet
b.) Staatsvolk
c.) Staatsgewalt
2. Der Begriff der Souveränität
a.) Kurzer geschichtlicher Überblick
b.) Begriff der Souveränität im modernen Völkerrecht
c.) Das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten
d.) Die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland
e.) Der moderne Begriff der Souveränität
III. Bhutan und die internationalen Beziehungen
1. Das Königreich Bhutan
2. Bhutans äußere Beziehungen
a.) Bhutan und Indien
b.) Bhutan und China
c.) Bhutan in der globalen Politik
IV. Ist Bhutan ein souveräner Staat per definition?
V. Schlussbetrachtung
Anhang: The Indian-Bhutamese Accord (IBA)
Literatur
I. Einleitung in die Problematik
Bekanntlich gibt es ein Spannungsfeld zwischen Politik und Recht, welches in der Wissenschaft ausgiebig diskutiert wird. Einerseits ist die Politik auf die Rechtswissenschaft angewiesen, weil sie der Politik die Normen gibt, innerhalb derer sich der Handlungsspielraum der Politik bewegt. Andererseits hat sich die Rechtswissenschaft in vielen Bereichen bereits verselbständigt. Das heißt, die Normen und Begriffe, die sie der Politikwissenschaft vermittelt, sind innerhalb ihrer oft nicht mehr anwendbar.
Diese Behauptung soll konkret am Begriff der Souveränität der Staaten im Völkerrecht geprüft werden. Es gibt zwar eine Menge juristische Begriffsdefinitionen, fraglich ist jedoch, ob diese Begriffsdefinitionen „in der Realität“ überhaupt angewandt werden können und Tatsachen so beschreiben, wie sie wirklich vorzufinden sind. Deshalb wird in dieser Arbeit der Begriff der Souveränität der Staaten hergeleitet und überprüft, ob er auf ein problematisches Beispiel – nämlich das Land Bhutan – anwendbar ist. Es wird wie folgt vorgegangen:
Anfangs werden begriffliche Klarstellungen der Begriffe Staat und Souveränität erfolgen, welche mit juristischen Lehrbüchern und Kommentaren hergeleitet werden. Im Anschluss werden die Begriffe auf den Fall von Bhutan angewandt, und letztendlich in der Schlussbetrachtung politikwissenschaftlich diskutiert, ob das Ergebnis auch de facto so zutrifft.
Die Idee, ein solches Thema auf diesem Weg anzugehen, entstand im Rahmen eines politikwissenschaftlichen Seminars, bei dem auf eine Behauptung des Autors bezüglich des rechtlichen Status von Bhutan darauf hingewiesen wurde, dass der juristische Begriffe der Souveränität „in der Realität“ oft nicht anwendbar sei. Deshalb wird jetzt der juristische Begriff der Souveränität einer politikwissenschaftlichen Prüfung unterzogen. An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass es der Anspruch ist, diese Untersuchung so kurz zu halten wie nur möglich, weshalb die Analyse an einigen Stellen vielleicht nicht tief genug ist, aber andererseits dafür in einer überschaubaren Länge versucht wird, dieses Problem zu lösen.
Während es zu den Themen Souveränität und Staat eine unüberschaubare Literaturmenge gibt und deshalb nur eine geringe Auswahl von Werken zugezogen wurde, war die Literatursuche zum Thema Bhutan problematisch. Bhutan – dieser kleine Staat zwischen Indien und China – ist in der globalen Politik weitesgehend unbedeutend. Selbst unter dreißig Studierenden des Faches Politikwissenschaften, die vor Anfertigung der Arbeit befragt wurden, ob sie den Namen Bhutan schon einmal gehört hatten, antworteten 18 (!) mit nein.[1] Selbst der OPAC der Freien Universität Berlin gibt bei Eingabe des Begriffes Bhutan nur 34 Treffer aus – eine lächerliche Zahl in Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um eines von fast 200 Ländern der Erde handelt – , wobei die meisten von reiner geographischer Natur waren. Folglich wurde bei der Einschätzung, ob Bhutan denn nun ein souveräner Staat sei oder nicht weniger auf Sekundärliteratur zurückgegriffen als versucht, den Sachverhalt unter den hergeleiteten Tatbestand der Begriffe Staat und Souveränität zu subsumieren.
Damit im nächsten Kapitel mit den Begriffsdefinitionen begonnen werden kann, soll hier erst noch eine Klarstellung bezüglich des Begriffs des Völkerrechts erfolgen. Das Völkerrecht ist die
„Summe aller Normen, die die Verhaltensweisen festlegen, die zu einem geordnetem Zusammenleben der Menschen dieser Erde notwendig und nicht im innerstaatlichen Recht der einzelnen souveränen Staaten geregelt sind.“[2] [Hervorhebung S.N.]
Es regelt vorwiegend das Verhalten der geborenen und gekorenen Völkerrechtssubjekte (souveräne Staaten, Internationale und Supranationale Organisationen). Die wichtigsten Völkerrechtsubjekte sind die souveränen Staaten. Und diese Begriffe werden jetzt erläutert.
II. Begriffe des Staates und der Souveränität
Damit festgestellt werden kann, ob Bhutan ein souveräner Staat ist oder nicht, bedarf es der begrifflichen Klarstellung von „Staat“ und „Souveränität“. Diese Begriffe werden im folgenden juristisch definiert.
1. Der Begriff des Staates
Allgemein anerkannt für die Definition eines Staates ist Georg Jellineks Dreielementenlehre von 1914. Demnach handelt es sich bei einem „politisch und rechtlich organisierten Personenverband“[3] um einen Staat, wenn eine Staatsgewalt ein Staatsvolk in einem abgegrenzten Staatsgebiet zugeordnet ist.[4]
a.) Staatsgebiet
Es handelt sich bei einem Gebiet um ein Staatsgebiet, wenn Grenzen diesen Raum als gemeinsamen Rechtsraum definieren. Somit sind Grenzen zugleich die Trennung zwischen verschiedenen Rechtsordnungen. Es bedarf nicht zwingend einer exakten Grenzlinie, entscheidend ist, dass ein unbestrittenes Kerngebiet existiert.[5]
b.) Staatsvolk
„Ein Staatsvolk ist ein auf Dauer angelegter Verbund von Menschen, über den der Staat die Hoheitsgewalt im Sinne der Gebietshoheit und bei Aufenthalt außerhalb des Hoheitsgebietes die Personalhoheit innehat.“[6]
Mit dem „auf Dauer angelegten Verbund“ ist die Zusammenfassung der Menschen unter eine Staatsbürgerschaft gemeint. Es zählen nicht Eigenschaften wie gemeinsame Sprache, Kultur, Religion, Rasse etc.[7] Wenn nach solche Gesichtspunkten vorgegangen würde, dann wäre z.B. Indien kein Staat (19 offizielle Amtssprachen, keine Staatsreligion, sondern religiöser Pluralismus und sekuläre Verfassung). Entscheidend alleine ist der Tatbestand der Staatsangehörigkeit.[8]
c.) Staatsgewalt
„Die Staatsgewalt erstreckt sich auf das Staatsgebiet und das Staatsvolk“[9]. Sie implementiert eine Ordnung für das Staatsvolk, welches auf dem Staatsgebiet lebt. So entsteht letztendlich der Staat. Die Staatsgewalt hat im Innern das Souverän, verpflichtende Gesetze zu erlassen und ist die Institution, welche für die internationalen Beziehungen mit anderen Staaten zuständig ist.[10]
2. Der Begriff der Souveränität
„[Es] ermangelt dem Begriff der Souveränität an eindeutigen, allgemeinen anerkannten Konturen. Man beklagt seine fehlende Präzision, konstatiert Unklarheiten, ja spricht vom berüchtigten Begriff der Souveränität“.[11]
Albrecht Randelzhofer, Professor für Internationales Recht an der Freien Universität Berlin, stellt heraus, dass die Anwendung des Souveränitätsbegriffes problematisch ist, weil es keinen Konsens über diesen Begriff gibt. In Anbetracht der Tatsache, dass dessen Anwendung in der heutigen Zeit[12] stets bedeutender wird, ist es verwunderlich, dass über diesen Begriff so viele unterschiedliche Auffassungen existieren. Erklärt werden kann dies dadurch, dass sich der Begriff der Souveränität in der Geschichte laufend gewandelt hat und eigentlich nie ein wirklicher Konsens bestand. Um die Dimension dieses Begriffes zu verstehen, soll erst ein kurzer geschichtlicher Überblick erfolgen.
a.) Kurzer geschichtlicher Überblick
Entscheidend ist die Entstehung des modernen Staates. Nach überwiegender Meinung geschah dies spätestens um die Wende vom 13. bis 14. Jahrhundert. Andere Auffassungen: 10. bis 11. Jahrhundert bzw. 16. Jahrhundert (zu der Zeit des konfessionellen Bürgerkrieges in Frankreich). Im Zuge dieser Entwicklung entstand auch erste Begriffe der Souveränität.[13] Jean Bodin[14] behauptet, in seinem Werk „Les six livres de la République“ (1576) als erster den Begriff der Souveränität definiert zu haben: „Il est icy besoin de former la définition de souveraineté, par ce qu’il n’y a ny iurisconsulte, ny philosophe politique, qui l’ayt définie.“[15] Bodin definiert Souveränität als „puissance absolue et perpétuelle d’une République“[16]. Weiter fügt er hinzu, dass sie ein wesentliches Merkmal des Staates sei: „République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages et de ce qui leur et commun avec puissance souveraine“[17]. Bodins Souveränitätsbegriff ist in erster Linie auf den König, den Träger der Staatsgewalt, bezogen. Neben dem König kann es keine weiteren Träger von Souveränität geben.
In Laufe der Zeit hat sich der Begriff der Souveränität weiter gewandelt. Es entstand der Begriff der Volkssouveränität. Der Begriff der Volkssouveränität steht in unmittelbarem Gegensatz zu Bodins Souveränitätsbegriff, weil hier neben dem König – in Bodins Kontext war der König der Staat[18] – weitere Träger von Souveränität möglich sind. Die ersten Vertreter dieser Lehre sind Marsilius von Padua (14. Jh.) und Lupold von Bebenburg (Beginn 16. Jh.). Eine wichtige Weiterentwicklung erfuhr die Volkssouveränität bei Johann Althusius (1614). Er vereinigte die Souveränität des Staates bei den Fürsten, bekannt als Fürstensouveränität. Weiter wurde der Souveränitätsbegriff bei Jean Jacques Russeau im Rahmen seiner Theorie des Gesellschaftsvertrages verwendet. Bei Hegel wird der Staat eine Person im Rechtssinne und damit Willensobjekt. Diese Lehre ist seitdem bekannt als „Lehre der Staatssouveränität“. Unter Carl Friedrich von Gerber (1880) wird die Lehre von der Staatssouveränität letztendlich zur herrschenden Lehre und als Konsequenz die Lehre von der Volks- und Fürstensouveränität vollständig verworfen. Souveränität ist nun die alleinige Eigenschaft der Staatsgewalten.
b.) Begriff der Souveränität im modernen Völkerrecht
Entscheidende Modifikation erlebte der Souveränitätsbegriff nach Ende des ersten Weltkrieges und die dadurch resultierende neue Weltordnung. Es entstand mit dieser neuen Weltordnung auch das sogenannte „moderne“ Völkerrecht. Drei Kernelemente begründen den Begriff der Souveränität im Rahmen dieses modernen Völkerrechts, welche das Vorhandensein der Souveränität der Staaten gewährleisten[19]:
- die prima facie Rechtshoheit über ein Territorium und die darauf lebenden Bevölkerung,
- die Pflicht zur Nichtintervention in ein Gebiet unter exklusiver Rechtshoheit eines anderen Staates,
- die Abhängigkeit von Auflagen, die z.B. aus dem Handelsrecht erwachsen, sowie Verträgen unter Zustimmung der sich bindenden Parteien.
Besonders einschneidend für den heutigen Souveränitätsbegriff ist die Verabschiedung der UNCH[20] 1945. Seit diesem Zeitpunkt gibt es das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten.[21]
c.) Das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten
Wort-wörtlich sagt Art. 2.1 UNCH: „The Organization [die UNO] is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.”
An dieser Stelle soll auf die Wichtigkeit dieses Artikels hingewiesen werden, denn er ist der Grundsatz aller internationaler Beziehungen. Um es in ein paar Worten zu fassen: weder die Größe des Staatsgebietes und des Staatsvolkes noch die Art der Staatsgewalt in den haben irgendeinen Einfluss auf die Rangstufe eines Staates innerhalb der internationalen Beziehungen. Jeder auch so kleine Staat hat dieselben Rechte und Pflichten wie die Weltmächte. Im Rahmen der UN bedeutet das:
- alle Staaten besitzen denselben rechtlichen Status,
- alle Staaten werden gleichbehandelt und dürfen aufgrund ihrer Merkmale nicht diskriminiert werden,
- in der UN-Generalvollversammlung gilt das „one state – one vote“ Verfahren, (womit jeder Staat bei den Abstimmungen den gleichen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis hat).[22]
Aus dem Art. 2.1 UNCH können zwei weitere wichtige Prinzipien hergeleitet werden: das Prinzip der äußeren Souveränität und das Prinzip der inneren Souveränität.
(1) Das Prinzip der äußeren Souveränität
„Nur der souveräne Staat, d.h. der von Weisungen jedes anderen Staates unabhängige und wegen der im Innern höchsten Gewalt nach außen als Wirkungseinheit auftretende Staat ist geborenes Völkerrechtssubjekt. [...] Staaten verlieren ihre Souveränität daher grundsätzlich auch nicht durch die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, da die damit verbundene Verpflichtungen durch freiwillig abgeschlossene Verträge übernommen sind“[23]
Dieses Zitat erklärt den grundsätzlichen Gedanken der internationalen Organisationen. Es entsteht der Eindruck, dass durch die zunehmende Politikverflechtung in den internationalen Beziehungen – d.h. den anwachsenden Status der internationalen Organisationen sowie die Übertragung von staatlicher Kompetenz an sie – die Staaten zunehmend ihre Souveränität aufgeben. Dies ist aber nicht der Fall, beachtet man, dass bilaterale und multilaterale Verträge zwischen den Staaten freiwillig abgeschlossen werden. Kein Staat kann gezwungen werden, einer internationalen Organisation beizutreten bzw. einen bilateralen Vertrag mit einem anderen Staat abzuschließen. Und „kein souveräner Staat kann gegen seinen Willen an neues Völkerrecht gebunden werden“[24]. So lange die Möglichkeit besteht, von internationalen Verträgen zurückzutreten und die abgetretenen Hoheitsrechte zurückzuerlangen, behalten die Staaten ihre äußere Souveränität.[25] Darüber hinaus gibt es einen wichtigen wichtigen Grundsatz für Beschlüsse im Rahmen von internationalen Organisationen: „Soweit nichts anderes vereinbart ist, [gilt] zwischen den Staaten das Prinzip der Einstimmigkeit“[26]. Damit wird die Souveränität der Staaten innerhalb der internationalen Organisationen gewahrt.
Die UNCH verbietet den Mitgliedsstaaten auch, in die inneren Angelegenheiten der Staaten einzugreifen.[27] Dies ist das zweite wichtige Prinzip des Art. 2.1 UNCH.
(2) Das Prinzip der inneren Souveränität
Das Prinzip der inneren Souveränität hängt sehr nah mit der äußeren Souveränität zusammen und setzt sich aus „Einzigkeit und Einseitigkeit der Staatsgewalt“ zusammen.
„Einzigkeit bedeutet, dass es neben der souveränen Staatsgewalt eine gleiche andere Gewalt im Staat nicht geben kann, da die souveräne Staatsgewalt sonst nicht die höchste wäre. Sie ist allen anderen Gewalten im Staate rechtlich übergeordnet. Nicht dagegen bedeutet Einzigkeit, dass es im Staat neben der souveränen Staatsgewalt überhaupt keine anderen Gewalten gibt oder geben darf. „[...] Einseitigkeit der Staatsgewalt bedeutet, dass die Staatsgewalt zur Ausübung ihrer Zuständigkeit nicht der Zustimmung oder Mitwirkung der Betroffenen bedarf.“[28]
Direkte Anwendung findet der innere Souveränitätsbegriff u.a. auch im Gewaltanwendungsverbot[29] und im Selbstbestimmungsrecht der Völker[30]. Damit wird die territoriale Integrität der Staaten sichergestellt. Im Innern ist alleine die regierende Staatsgewalt für die Angelegenheiten verantwortlich. Fraglich ist, ob ein Staat an Souveränität verliert, wenn er im Zuge der Internationalisierung das Völkerrecht als Teil seiner Rechtsordnung akzeptiert:
„Diese [innere] Souveränität des Staates wird problematisch, wenn das Völkerrecht als eine den Staat verpflichtende und berechtigte Rechtsordnung mit in Betracht gezogen wird“[31], weil „die Staaten Ihre Angelegenheiten im innern alleine regeln [dürfen]“![32] [Hervorhebung S.N.]
Ist ein Staat trotzdem souverän, obwohl die völkerrechtlichen Normen unmittelbaren Einfluss auf seine Ordnung hat? Laut des obigen Begriffs wohl nicht. Aber wie bereits gezeigt wurde, ist der Begriff der Souveränität dynamisch und passt sich den politischen Gegebenheiten an. Am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland soll ermittelt werden, ob ein Staat mit einer Verfassung, die das Völkerrecht als Bestandteil seines Bundesrechts akzeptiert, doch als souverän klassifiziert werden kann.
d.) Die Souveränität der Bundesrepublik Deutschland
Für die Bundesrepublik ist der Art. 25 GG bezüglich des Ranges des Völkerrechts einschlägig:
Art. 25: Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.
Nach Art. 25 GG sind die allgemeinen Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts und gehen den Gesetzen vor. Zuallererst muss folgendes klargestellt werden. In der BRD gilt (vereinfacht!) folgende Hierarchie:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das heißt, die Landesgesetzgebung muss im Einklang mit der Bundesgesetzgebung stehen und die Bundesgesetzgebung im Einklang mit der Verfassung. Das Völkerrecht i.S.d. Art. 25 geht den Gesetzen vor, d.h. der Rang ist unmittelbar unter der Verfassung anzusiedeln.
Mit allgemeinen Regeln i.S.d. Art. 25 GG ist das
„universell geltende Völkergewohnheitsrecht [gemeint]. [...] Entscheidend ist nicht eine besondere inhaltliche Qualität der Norm, sondern die Allgemeinverbindlichkeit“ [...].Allgemeine Regeln des Völkergewohnheitsrechts sind solche, die von der überwiegenden Mehrheit der Staaten als verbindlich anerkannt werden“.[...] „Empfehlungen (Beschlüsse, Resolutionen [und Verträge S.N.]) internationaler Organisationen sind keine allgemeinen Regeln des Völkerrechts“[33]
Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind unmittelbarer Bestandteil des Bundesrechts. Wenn man jetzt streng nach den o.g. Definitionen der inneren Souveränität vorgeht, dann ist die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat aufgrund ihrer nicht vorhandenen inneren Souveränität, zumal das Völkerrecht, welches nicht vom Bundesgesetzgeber erlassen wird, Bestandteil des Bundesrechts ist und damit die Einzigkeit der Staatsgewalt in Frage gestellt wird. Aber wie bereits gezeigt wurde, ist der Begriff der Souveränität dynamisch und passt sich den politischen Gegebenheiten an. Im folgenden wird klargestellt, dass die Bundesrepublik nichtsdestoweniger ein souveräner Staat ist.
e.) Der moderne Begriff der Souveränität
Wie gezeigt wurde, haben die allgemeinen Regeln unmittelbaren Einfluss auf die innere Ordnung der BRD. Damit fehlt es der Bundesrepublik Deutschland eigentlich an innerer Souveränität. Trotz der Existenz der internationalen Staatengemeinschaft ist die Souveränität der Staaten nicht aufgegeben, weil der Grundsatz der Verfassungshoheit nicht berührt ist. Austritte aus Verträgen sind möglich, aber nicht der Verlust der Souveränität der Mitgliedstaaten, gerade weil fortwährend die Option besteht, von völkerrechtlichen Verträgen zurückzutreten.[34]
Werden alle angesprochenen Begriffe und Probleme zusammengefasst, soll folgender Begriff für die Souveränität gelten:
„Wenn die ein Staatsgebiet und ein Staatsvolk beherrschende Staatsgewalt ihrerseits keinen Höheren über sich hat, sondern nur mehr dem Völkerrecht untersteht, bezeichnet man einen solchen Staat und eine solche Regierung als souverän. Der souveräne Staat ist der Prototyp der völkerrechtlichen Rechtsperson, ähnlich wie der Einzelmensch der Normalfall der Rechtsperson im innerstaatlichen Recht ist“[35] [Hervorhebung S.N.]
Damit ist das moderne Völkerrecht in den Souveränitätsbegriff integriert. Die Bundesrepublik ist ein souveräner Staat, obwohl das Völkerrecht Bestandteil der Rechtsordnung in der BRD ist. An dieser „de-facto-Souveränität“ besteht nicht der geringste Zweifel.
III. Bhutan und die internationalen Beziehungen
Bisher wurde der moderne Begriff der Souveränität hergeleitet und gezeigt, dass ein Staat souverän seien kann, auch wenn er sich „dem Völkerrecht unterwirft“. Mit den gewonnen Erkenntnissen soll geprüft werden, ob Bhutan ein souveräner Staat ist. Dafür wird folgende These formuliert:
Gerade aufgrund des modernen Souveränitätsbegriffes könnte auch Bhutan ein souveräner Staat sein.
Nach einem kurzer Überblick über Bhutan[36] wird im Anschluss versucht zu prüfen, ob der Tatbestand des souveränen Staates für Bhutan erfüllt ist.
1. Das Königreich Bhutan
Bhutan ist ein Binnenstaat auf dem indischen Subkontinent mit einer Fläche von 47.000 m² , was in etwa der Fläche von der Schweiz entspricht. Die Bevölkerungszahl liegt bei 810.000.[37] Interessant ist die Lage von Bhutan. Da das Königreich inmitten den asiatischen Supermächten Indien und Chinas autonomer Region Tibet eingebettet ist, ist der Staat als strategisch sehr wichtig anzusehen, beachtet man die schwierigen Beziehungen zwischen Indien und China. Diese strategische Bedeutung Bhutans wirkt sich auch unmittelbar auf dessen Stellung innerhalb der internationalen Beziehungen aus.
1910 unterzeichneten Großbritannien – zur der Zeit Kolonialmacht in Indien – und Bhutan einen Vertrag, der den Briten jegliche Einmischung in die inneren Angelegenheiten verbot, allerdings ihnen das Recht zuwies, die auswärtigen Beziehungen Bhutans zu bestimmen. Nachdem sich Großbritannien 1947 aus Südasien zurückzog und Indien ein unabhängiger Staat wurde, übernahm Indien als Rechtsnachfolger von British-Indien mehr oder weniger die Rolle Großbritanniens in dem Königreich. Seit 1949 existiert der IBA[38], der die Beziehungen zwischen Indien und Bhutan regelt.
2. Bhutans äußere Beziehungen
Bhutan unterhält nicht mit vielen Ländern äußere Beziehungen. Im Mittelpunkt – gerade aufgrund der prekären Lage – sind die Beziehungen zu Indien und China.
a.) Bhutan und Indien
Kennzeichnend für die Beziehungen zwischen Indien und Bhutan ist der Art.2 IBA, welcher Indien untersagt, sich in die internen Angelegenheiten Bhutans einzumischen, allerdings an derselben Stelle die Indien Kompetenz zuweist, in der Außenpolitik Bhutans beratend mitwirken.[39] Weiter soll Art. 6 IBA erwähnt werden. Schließend aus diesem Artikel kann Indiens Verantwortung für Bhutans Verteidigungspolitik und Sicherheit hergeleitet werden, weil die Aufrüstung Bhutans nur mit Indiens Einverständnis erfolgen kann.[40] Indien ist also eine Art Patron für Bhutan, beachtet man folgenden Ausschnitt aus Nehrus Rede vor dem indischen Unterhaus 1959:
“The Government of India is responsible for the protection of the borders of Sikkim and Bhutan and of the territorial integrity of these two states and any aggression against Bhutan and Sikkim will be considered as aggression against India.“[41]
Allerdings bestritt der Premierminister Jigmie Dorji von Bhutan Status diesen Status des Protektorates vehement.[42]
Aufgrund Bhutans wichtiger geographischer Lage hat gerade auch Indien ein großes Interesse an dieser guten Beziehung zu Bhutan.
„[...], the foreign policy-makers of India’s South Block (the headquarters of the Ministry of External Affairs) seem to be more careful and cautious to see that nothing is done – even unwittingly – to hurt the ruling elite […] in any thinkable manner on any front”.[43]
Bhutan ist zu einem Pufferstaat zwischen Indien und seinem Erzrivalen China geworden,[44] weshalb es auch für Indien so wichtig ist, gute Beziehungen zu unterhalten. Indien selbst wird als Bhutans „true friend in need“[45] beschrieben.[46] Dies lässt sich unter anderem auch mit den Daten über den auswärtigen Handel von Bhutan belegen. In den 90er Jahren wurden 92 % der Handelsgüter nach Indien exportiert, 71 % der Waren wurden aus Indien importiert.[47] Dies zeigt die Abhängigkeit Bhutans von seinem Nachbarn Indien. Bezeichnend ist, dass Bhutan mit seinem anderen großen Nachbarn China keine nennenswert guten Beziehungen pflegt.[48]
b.) Bhutan und China
Mit seiner nördlichen Grenze grenzt Bhutan an Chinas autonome Provinz Tibet. In den 50er Jahren hatte China vor allem dafür zu sorgen, die Provinz Tibet nicht zu verlieren. Deshalb war es für China in erster Linie nicht so bedeutend, dass Bhutan so nahe Beziehungen zu Indien pflegte, obgleich China diese Beziehung sehr genau beobachtete und seinerseits versuchte, positiven Einfluss auf Bhutan auszuüben. In erster Linie ist hier wichtig, dass China – wenn auch mit leichtem Vorbehalt – Bhutans Rang als unabhängiger Staat akzeptierte und Bhutan nicht zum Schlachtfeld zwischen Indien und China wurde.
Bhutan selbst entgegnete China durchweg skeptisch, vermutlich aus dem Grund, weil es die Gefahr sah, China könne Bhutan einmal für sich beanspruchen, gerade im Kontext des Krieges in Tibet. Als Beweis für diese Behauptung ist eine Landkarte, abgedruckt im der China Pitorical Zeitschrift von 1958 anzusehen, welche sowohl Bhutan als auch einige Teile Indiens als chinesisches Territorium definiert.[49] Bhutan konnte die Weltmacht China aber auch nicht umgehen, weshalb eine komplizierte Situation entstand. Der König Jigme Dorji Wangchuck von Bhutan drückte 1961 während eines Besuches in Indien diese Position deutlich aus: „We do not want to be either friends or enemies of China.“[50]
China erkannte während des Indisch-Chinesischen Krieges 1962 die Chance, Einfluss auf Bhutan auszuüben. Es bot Bhutan an, den vollständigen souveränen Status zu verschaffen. Dieses Angebot wurde jedoch von Bhutan nicht angenommen.
Vor 1960 hatte Bhutan Handelsbeziehungen zu Tibet, die aber seit der chinesischen Invasion eingestellt wurden. Als die chinesische Besatzung begann, wurde der Handel zwar eingestellt, jedoch konnte Bhutan sich auf lange Dauer eine Ignorierung Chinas seinerseits nicht erlauben. Besonders seit der Annexion Sikkims durch Indien 1974 verbesserten sich die Beziehungen zwischen Bhutan und China – vielleicht aus der Angst, ähnliches könnte Bhutan selbst wiederfahren . Allerdings erlebten diese Beziehungen niemals einen großen Durchbruch.
c.) Bhutan in der globalen Politik
Bis zum Jahre 1960 unterhielt Bhutan keine offiziellen Beziehungen zu anderen Staaten außer Indien, es verfolgte selbst eine „policy of isolation“[51]. Im Laufe der Zeit bemühte sich Bhutan, ein Mitglied der internationalen Staatengemeinschaft zu werden. Die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi gab 1966 grünes Licht für Bhutans Ambitionen, Mitglied der UNO und weiterer internationaler Organisationen zu werden und diplomatische Beziehungen zu anderen Staaten aufzubauen.[52]
Letztendlich ist Bhutan 1971 der UNO als Vollmitglied beigetreten.[53] Es wird behauptet, Bhutan sei seitdem global als souveräner Staat akzeptiert worden sei.[54] Von nun an trat es zahlreichen anderen internationalen Organisationen bei und unterhält diplomatische Beziehungen mit einigen Staaten auf der Welt.[55] Botschaften hat Bhutan in Indien, Bangladesh und in New York bei der UNO, zusätzlich unterhält es ein Generalkonsulat in Kuwait und Honorarkonsulate in Hong Kong und Singapur. Es zeichnet sich ein Ausbau der diplomatischen Beziehungen von Bhutan mit anderen Ländern ab.
Trotz dieses Trends ist es ersichtlich, dass der Staat innerhalb des Systems der internationalen Beziehungen keine wichtige Rolle spielt und faktisch unbedeutend ist. Dadurch, dass Bhutan aber mit immer mehr Staaten diplomatische Beziehungen aufnimmt, kann eigentlich geschlossen werden, dass Bhutan ein souveräner Staat ist. Ob dies wirklich der Fall ist, wird im nächsten Kapitel erörtert, indem die im Laufe dieser Arbeit ermittelten Begriffe auf Bhutan angewandt werden.
IV. Ist Bhutan ein souveräner Staat per definition?
Ermittelt werden soll, ob Bhutan ein souveräner Staat ist. Begonnen werden soll mit dem Begriff des Staates im Sinne der Dreielementenlehre von Jellinek. Wenn diese Drei Elemente zutreffen, existiert automatisch ein Staat, er braucht nicht durch die Staatengemeinschaft anerkannt zu werden.[56]
1. Staatsgebiet: Die Karte von Kapitel III 1. zeigt das Bhutan umfassende Gebiet. Es besteht kein Zweifel, dass Bhutan ein Staatsgebiet hat.
2. Staatsvolk: Auch wenn die Einwohnerzahlen von Bhutan stark divergieren, hat Bhutan möglicherweise ein Staatsvolk. Bhutan selbst hat zwar keine geschriebene Verfassung, jedoch regelt Bhutan Citizenship Act von 1985[57] die Frage der Staatsangehörigkeit positiv.[58] Damit hat Bhutan auch ein Staatsvolk.
3. Staatsgewalt: Bhutan besitzt mit seinem König als Staatsoberhaupt auch eine Staatsgewalt.
Der Tatbestand der Dreielementenlehre ist damit erfüllt. Bhutan ist ein Staat. Fraglich ist allerdings, ob er souverän ist. Dazu müsste er sowohl innere als auch äußere Souveränität besitzen.
1. Innere Souveränität: Bhutan hat eventuell innere Souveränität. Dazu dürfte kein Staat auf die inneren Angelegenheiten Bhutans Einfluss nehmen. Fraglich ist, ob durch Art. 2 IBA Bhutans innere Souveränität durch Indien beeinträchtigt wird. Vom Wortlaut des Art. 2 IBA kann aber entnommen werden, dass sich Indien nicht in die inneren Angelegenheiten Bhutans einmischt. Und auch ein eventueller Einfluss des Völkerrechts auf Bhutans innere Ordnung ist als unproblematisch einzuordnen, wie bereits am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland gezeigt. Deshalb besitzt Bhutan an innerer Souveränität.
2. Äußere Souveränität: Bhutan hat äußere Souveränität, wenn kein anderer Staat Bhutan in der Ausübung seiner Außenpolitik beeinflusst. Möglicherweise beeinträchtigt Art. 2 IBA die äußere Souveränität Bhutans. Art. 2 IBA weist Indien die Kompetenz zu, Bhutans Außenpolitik zu bestimmen. Damit hat Indien unmittelbaren Einfluss auf außenpolitische Entscheidungen von Bhutan. Dies beeinträchtigt die äußere Souveränität Bhutans. Allerdings ist der IBA ein freiwillig abgeschlossener Vertrag zwischen Bhutan und Indien, bei dem Bhutan einwilligt, einen Teil seiner Hoheitsrechte abzutreten. Nach Art. 10 IBA besteht die Möglichkeit, diesen Vertrag zu verändern bzw. aufzulösen. Wenn die Möglichkeit besteht, einmal übertragenen Hoheitsrechte wieder zurückzuerlangen, d.h. von dem Vertrag zurücktreten, dann verlieren Staaten nicht die äußere Souveränität.[59] Damit hat Bhutan durch den IBA nicht seine äußere Souveränität verloren. Bhutan besitzt damit weiterhin äußere Souveränität.
Bhutan besitzt sowohl innere als auch äußere Souveränität. Damit ist Bhutan trotz des IBA ein souveräner Staat.
V. Schlussbetrachtung
Per Definition ist Bhutan also ein souveräner Staat. Zumindest, wenn man den juristischen Begriff der Souveränität anwendet. Dahingestellt bleibt aber, ob Bhutan de facto wirklich Souveränität besitzt. Das Problem im Fall von Bhutan ist, dass Bhutan sich in einer Abhängigkeit von Indien befindet, die es fragwürdig erscheinen lässt, ob Bhutan im politikwissenschaftlichen Sinne ein souveräner Staat ist und so der juristische Begriff der Souveränität hier vorbehaltlos angewandt werden kann.
Angenommen, es wäre der Fall, Bhutan würde sich von dem IBA zurückziehen. Dies kann große wirtschaftliche Probleme zur Folge haben. In Kapitel III. 1. a) wurde auf das wirtschaftliche Zusammenspiel von Bhutan und Indien hingewiesen. Darüber hinaus erhält Bhutan jährlich Zahlungen von 500.000 Rupien (entspricht ca. 11.000 €) im Rahmen des IBA.[60] Ungewiss bleibt, ob die Volkswirtschaft Bhutans bestehen kann, wenn Indien aus Konsequenz der Absetzung des IBA die wirtschaftliche Zusammenarbeit einstellt und auch auf den vertraglich vereinbarten „Jahresbetrag“ verzichten muss.[61]
Gravierender wären allerdings die Folgen, was Bhutans weitere Existenz als Staat angeht. Sollte Bhutan den IBA kündigen, würde Indien dies gewiss nicht einfach so hinnehmen, weil es für Indien diese außergewöhnliche geostrategische Bedeutung hat. China hat Indiens Annexion von Sikkim 1974 noch nicht anerkannt. Darüber hinaus erhebt es Anspruch auf Indiens nordöstlichste Provinz Arunachal Pradesh. Wenn Bhutan – eingebettet zwischen diesen beiden indischen Provinzen – den IBA lösen sollte, könnte China versuchen, durch Bhutan stärkeren Druck auf Indien auszuüben, eventuell so weit gehend, um seine Ansprüche durchzusetzen. Ob Indien also einen Rücktritt Bhutans vom IBA hinnehmen würde, ist stark anzuzweifeln. Dadurch, dass Indien aufgrund Art. 2 IBA schon die Außenpolitik Bhutans regelt, wäre es durchaus denkbar, dass bei einer einseitigen Kündigung des IBA durch Bhutan Indien in Erwägung ziehen würde, Bhutan zu annektieren[62], um China in seinen Grenzen zu halten. Darüber hinaus sieht der Art. 9 IBA ein sehr unfaires Schiedsverfahren im Falle von Streitigkeiten um die Auslegung des Vertrages zugunsten Indiens vor. Das Tribunal setzt sich aus einem Vertreter der indischen Regierung, einem Vertreter der bhutanesischen Regierung und einem von Bhutan ernannten Richter eines indischen Gerichtes. Indien behält also innerhalb dieses Tribunals die Oberhand.
Es muss an dieser Stelle auch auf die Asymmetrie des IBA hingewiesen werden. Er ist zwar nach Art. 10 IBA kündbar oder veränderbar, jedoch bedarf es dazu der Zustimmung beider Vertragsparteien. Anzunehmen ist, dass Indien nie einer derartigen Kündigung zustimmen würde, woraus folgt, dass Bhutan aufgrund Art. 9 und 10 IBA anscheinend bis in alle Ewigkeit von Indien abhängig ist.[63] Da der Vertrag, wie bereits gezeigt, Bhutans äußere Souveränität erheblich beeinflusst und Bhutan ohne Indiens Einwilligung den Vertrag nicht kündigen kann, ist Bhutan de facto kein souveräner Staat. Der hier so viel zitierte Autor Parmanand stützt diese These. „Be that as it may, Articles 2 and 9 are construed by many [...] as a device to dilute Bhutan’s sovereignty”[64]. Bhutan ist also nicht der kleine Bruderstaat Indiens, sondern dessen unmündiger Sohn.
Dieses Problem kann man auch empirisch untersuchen. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, das Abstimmungsverhalten Bhutans in der UN-Generalvollversammlung mit dem Abstimmungsverhalten Indiens zu vergleichen und zu überprüfen, ob dieses Abstimmungsverhalten jemals divergiert hat[65]. Dies ist sicherlich eine interessante Frage, die Anreiz geben soll, Bhutans Souveränität einmal mit der quantitativen Methode zu untersuchen und zu verifizieren, ob das Ergebnis dieser Arbeit so vertretbar ist.
Anhang: The Indian-Bhutamese Accord (IBA)
TREATY OF PERPETUAL PEACE AND FRIENDSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF BHUTAN
Darjeeling , 8 August 1949
The Government of India on the one part, and His Highness The Druk Gyalpo's Government on the other part, equally animated by the desire to regulate in a friendly manner and upon a solid and durable basis the state of affairs caused by the termination of the British Government's authority in India, and to promote and foster the relations of friendship and neighbourliness so necessary for the well-being of their peoples, have resolved to conclude the following treaty, and have, for this purpose named their representatives, that is to say Sri Harishwar Dayal representing the Government of India, who has full powers to agree to the said treaty on behalf of the Government of India, and Deb Zimpon Sonam, Tobgye Dorji, Yang-Lop Sonam, Chho-Zim Thondup, Rin-Zim Tandin and Ha Drung Jigmie Palden Dorji, representing the Government of His Highness the Druk Gyalpo, Maharaja of Bhutan, who have full powers to agree to the same on behalf of the Government of Bhutan.
Article I
There shall be perpetual peace and friendship between the Government of India and the Government of Bhutan.
Article II
The Government of India undertakes to exercise no interference in the internal administration of Bhutan. On its part the Government of Bhutan agrees to be guided by the advice of the Government of India in regard to its external relations.
Article III
In place of the compensation granted to the Government of Bhutan under Article 4 of the Treaty of Sinchula and enhanced by the treaty of the eighth day of January 1910 and the temporary subsidy of Rupees one lakh per annum granted in 1942, the Government of India agrees to make an annual payment of Rupees five lakhs to the Government of Bhutan. And it is further hereby agreed that the said annual payment shall be made on the tenth day of January every year, the first payment being made on the tenth day of January 1950. This payment shall continue so long as this treaty remains in force and its terms are duly observed.
Article IV
Further to mark the friendship existing and continuing between the said Governments, the Government of India shall, within one year from the date of signature of this treaty, return to the Government of Bhutan about thirty-two square miles of territory in the area known as Dewangiri. The Government of India shall appoint a competent officer or officers to mark out the area so returned to the Government of Bhutan.
Article V
There shall, as heretofore, be free trade and commerce between the territories of the Government of India and of the Government of Bhutan; and the Government of India agrees to grant the Government of Bhutan every facility for the carriage, by land and water, of its produce throughout the territory of the Government of India, including the right to use such forest roads as may be specified by mutual agreement from time to time.
Article VI
The Government of India agrees that the Government of Bhutan shall be free to import with the assistance and approval of the Government of India, from or through India into Bhutan, whatever arms, ammunition, machinery, warlike material or stores may be required or desired for the strength and welfare of Bhutan, and that this arrangement shall hold good for all time as long as the Government of India is satisfied that the intentions of the Government of Bhutan are friendly and that there is no danger to India from such importations. The Government of Bhutan, on the other hand, agrees that there shall be no export of such arms, ammunition, etc., across the frontier of Bhutan either by the Government of Bhutan or by private individuals.
Article VII
The Government of India and the Government of Bhutan agree that Bhutanese subjects residing in Indian territories shall have equal justice with Indian subjects, and that Indian subjects residing in Bhutan shall have equal justice with the subjects of the Government of Bhutan.
Article VIII
(1) The Government of India shall, on demand being duly made in writing by the Government of Bhutan, take proceedings in accordance with the provisions of the Indian Extradition Act, 1903 (of which a copy shall be furnished to the Government of Bhutan), for the surrender of all Bhutanese subjects accused of any of the crimes specified in the first schedule of the said Act who may take refuge in Indian territory.
(2) The Government of Bhutan shall, on requisition being duly made by the Government of India, or by any officer authorised by the Government of India in this behalf, surrender any Indian subjects, or subjects of a foreign power, whose extradition may be required in pursuance of any agreement or arrangements made by.the Government of India with the said power, accused of any of the crimes, specified in the first schedule of Act XV of 1903, who may take refuge in the territory under the jurisdiction of the Government of Bhutan, and also any Bhutanese subjects who, after committing any of the crimes referred to in Indian territory, shall flee into Bhutan, on such evidence of their guilt being produced as shall satisfy the local court of the district in which the offence may have been committed.
Article IX
Any differences and disputes arising in the application or interpretation of this treaty shall in the first instance be settled by negotiation. If within three months of the start of negotiations no settlement is arrived at, then the matter shall be referred to the Arbitration of three arbitrators, who shall be nationals of either India or Bhutan, chosen in the following manner:
(1) One person nominated by the Government of India;
(2) One person nominated by the Government of Bhutan;
(3) A Judge of the Federal Court, or of a High Court in India, to be chosen by the Government of Bhutan, who shall be Chairman. The judgernent of this Tribunal shall be final and executed without delay by either party.
Article X
This treaty shall continue in force in perpetuity unless terminated or modified by mutual consent.
DONE in duplicate at Darjeeling this eighth day of August, one thousand nine hundred and forty-nine, corresponding with the Bhutanese date the fifteenth day of the sixth month of the Earth-Bull year.
HARISHWAR DAYAE Political Officer in Sikkim.
DEB ZIMPON SONAM TOBGYE DORJI YANG-LOP SONAM CHHO-ZIM THONDUP RIN-ZIM TANDIN HA DRUNG JIGMIE PALDEN DORJI
(wortwörtlich übernommen von der Internetseite des Indischen Außenministeriums: http://www.meadev.nic.in/economy/ibta/volume1/chap26.htm [16.12.2002])
Literatur
CIA (2002). The CIA World Factbook 2002, CIA. 2002.
Grimm, Jens (1995). Intervention, Souveränität und "Neues Völkerrecht": Die Irak-Resolution SR-Res. 688 (1991) und ihre Folgen. Berlin, Diplomarbeit (Freie Universität Berlin) D.A. 4550.
Ipsen, Knut (1999). Völkerrecht. München, C.H. Beck.
Kohli, Manorama (1993). From Dependency to Interdependence: A Study of Indo-Bhutan Relations. Delhi, Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
Krüger, Herbert and Georg Erler (1957). Zum Problem der Souveränität. Karlsruhe, C.F. Müller.
Library of Congress (1991). Bhutan. A Country Study, Library of Congress. 2002.
Parmanand (1992). The Politics of Bhutan. New Delhi, Pragati Publications.
Randelzhofer, Albrecht (1987). Staatsgewalt und Souveränität. Handbuch des Staatsrechts. J. Isensee and P. Kirchhoff. Heidelberg, C.F. Müller Verlag. I: 691-708.
Rojahn, Ondolf (1995). Art. 25 GG. Grundgesetzkommentar. I. v. Münch and P. Kunig. München, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 2: 195-221.
Seidl-Hohenveldern, Ignaz and Thorsten Stein (2000). Völkerrecht. Köln, Bonn, Berlin, München, Carl Heymanns Verlag KG.
Simma, Bruno, Ed. (1994). The Charter of The United Nations. A Commentary. München, C.H. Beck.
Sprung, Christoph (2002). Bhutan: Bevölkerung, Kultur und Gesellschaft, Südasien-Informationsnetz. 2002. http://www.suedasien.net/laender/bhutan/bevoelkerung.htm [16.12.2002]
Royal Government of Bhutan (2001). Country Presentation for Bhutan. Third United Nations Conference on the Least Developed Countries. Brüssel.
Töpfer, Eric (2002). Auf dem Weg zur konstitutionellen Monarchie:
Verfassungsentwurf für Bhutan soll vor Jahresende vorgelegt werden, Südasien-Informationsnetz. 2002. http://www.suedasien.net/news/2002/oktober/bhutan_constitution.htm [16.12.2002]
Fischer Taschenbuch Verlag (1999). Der Fischer Weltalmanach 1999. Frankfurt, Fischer Taschenbuch Verlag.
[...]
[1] Genauer gesagt: Butan gas war bekannt, aber nicht der Staat Bhutan.
[2] Seidl-Hohenveldern und Stein (2000), § 1, Rn. 1f.
[3] Ipsen (1999), § 5, Rn. 2.
[4] Vgl. Ipsen (1999), § 5, Rn. 2.
[5] Nach Ipsen (1999), § 5, Rn. 4.
[6] Ipsen (1999), § 5, Rn. 5.
[7] Vgl. Ipsen (1999), § 5, Rn. 5.
[8] Für die Bundesrepublik Deutschland wird im Art. 116 GG definiert, wer Deutscher Staatsangehöriger ist.
[9] Ipsen (1999), § 5, Rn. 6.
[10] Im Laufe der Arbeit wird noch ausführlicher auf die „innere“ und „äußere“ Souveränität eingegangen.
[11] Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 1.
[12] Das momentane Zusammenwachsen der Staaten hat in praxi die Übertragung von Hoheitsrechten z.B. an internationale Organisationen zur Folge, womit Teile der Souveränität eingebüßt werden.
[13] Vgl. Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 13.ff. Vgl. auch Krüger und Erler (1957), S. 1.
[14] Jean Bodin (1530-1596): Französischer Jurist (und Philosoph).
[15] Zitiert in Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 16.
[16] Zitiert in Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 16.
[17] Zitiert in Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 16.
[18] Erinnert sei an Ludwig XIV Ausspruch: „L’état, c’est moi“.
[19] Grimm (1995), S. 12. Der Autor bezieht sich auf Delbrück, Jost (1992): “A Fresh Look at Human Right Intervention under the Authority of the United Nations.“ Indiana Law Journal, 67, S. 889. Das erste Grundprinzip ist in Art. 2.1 United Nations Charter (UNCH) niedergeschrieben. Der zweite Punkt – die Pflicht zur Nichtintervention – steht in Art. 2.4 UNCH. Das letzte Prinzip bezieht sich wohl auf den Grundsatz „Pacta sunt servanda“ des Art. 26 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge. Wenn die Staaten sich nicht verpflichten würden, die von ihnen abgeschlossenen Verträge einzuhalten, dann würde das internationale Vertragsrecht nicht effektiv sein.
[20] United Nations Charter.
[21] Art. 2.1 UNCH
[22] Das one state – one vote der UN-Generalvollversammlung Verfahren ist zwar in der Tat eine Revolution in den Internationalen Beziehungen. Allerdings ist zu beachten, dass die Generalvollversammlung nicht das wichtigste Organ ist, denn die wichtigsten Beschlüsse werden vom Weltsicherheitsrat verfasst. Und der Weltsicherheitsrat ist nicht von der Gleichheit der Staaten geprägt. Einerseits ist er regional nicht angemessen repräsentiert, und andererseits haben die Staaten USA, Russische Föderation, Großbritannien, Frankreich und China mit ihrer permanenten Mitgliedschaft und dem Recht, Beschlüsse durch ein Veto zu blockieren, wesentlich mehr Kompetenzen als alle anderen UN-Mitgliedstaaten. Deshalb ist die Berufung auf das one state – one vote Verfahren, wenn man über Gleichheit im Rahmen der UN redet, eigentlich nicht angemessen.
[23] Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 25
[24] Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 27
[25] Vgl. hierzu auch Ipsen (1999), § 5, Rn. 7. Anhand dieser Prinzipien ist zu erkennen, wie sehr alle Staaten in den internationalen Beziehungen auf gegenseitige Kooperation angewiesen sind. Das gilt auch für den Fall, dass ein Streit zwischen Staaten vor internationalen Schiedsgerichten entschieden werden soll. Die Staaten müssen beide einverstanden sein, einen Rechtsstreit zu führen bzw. „sich verklagen zu lassen“. Darüber hinaus gibt es das Prinzip der Staatenimmunität: Kein Staat kann vor dem Gericht eines anderen Staates verklagt werden (par in parem non habet inducium). Anhand dieser beiden Beispiele kann man erkennen, dass sich die Staaten eigentlich in einem de-facto rechtsfreiem Raum befinden und es an ihrem Einverständnis liegt, ob internationales Recht bei Streitfällen angewandt werden soll.
[26] Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 28. Dieses Prinzip der Einstimmigkeit trägt einerseits dazu bei, dass man um Konsensfindung bemüht ist, andererseits aber auch zu Handlungsunfähigkeit von internationalen Organisationen.
[27] Art. 2.7 UNCH.
[28] Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 35 ff.
[29] Art. 2.4 UNCH.
[30] A/Res/2625 XXV (Resolution der UN-Vollversammlung) und Art. 1.2 sowie Art. 55 UNCH.
[31] Seidl-Hohenveldern und Stein (2000), § 46, Rn. 631 ff.
[32] Simma (1994).
[33] Rojahn (1995), Rn. 6ff.
[34] Vgl. Randelzhofer (1987), § 15, Rn. 33f.
[35] Seidl-Hohenveldern und Stein (2000), § 46, Rn. 631f.
[36] Als Quellen für Daten wurden benutzt: CIA (2002), und Sprung (2002).
[37] Allerdings besagen andere Schätzungen, dass sie bei über 2 Millionen liegt, was offensichtlich auf eine Manipulation der Regierung von Bhutan zurückzuführen ist. Vgl. Sprung (2002).
[38] Indian-Bhutamese Accord. Der Vertrag ist abgedruckt in: Parmanand (1992), S. 222ff. und auch im Anhang zu finden. Sein vollständiger Name ist Treaty of Perpetual Peace and Friendship between The Government of India and The Government of Bhutan.
[39] Dies ist nur eine kurze Schilderung des Sachverhaltes. Es wird im Laufe der Arbeit geprüft, ob Souveränität vorliegt oder nicht.
[40] Es wird zwar bestritten, dass Indien für die Sicherheit Bhutans zuständig sei (vgl. Parmanand (1992), S. 190), aber gerade aufgrund der teleologischen Auslegung des Art. 6 IBA scheint dies doch der Fall zu sein. Indiens ehemaliger Premierminister Nehru erwähnte auch im Zuge der Anspannung der Chinesisch-Tibetanischen und der Chinesisch-Indischen Beziehungen, dass ein Angriff gegen Bhutan als ein Angriff gegen Indien angesehen wird. Vgl. Parmanand (1992), S. 165.
[41] Zitiert nach: Parmanand (1992), S. 165.
[42] Parmanand (1992), S. 166.
[43] Parmanand (1992), S. 177.
[44] Indiens Streben nach Sicherheit ist in der Tat das wichtigste Indiz. Vgl. auch Kohli (1993), S. 47.
[45] Parmanand (1992), S. 114.
[46] Vgl. auch ein Interview von Parmanand mit dem König von Bhutan vom 21. Oktober 1991. Abgedruckt in: Parmanand (1992), S. 236 ff.
[47] Vgl. The Royal Government of Bhutan (2001), S. 17f.
[48] Was nicht heißen soll, dass Bhutan und China überhaupt keine oder eine schlechte Beziehung haben
[49] Vgl. Parmanand (1992), S. 165. Von China wurde unter anderem die indischen Regionen Arunachal Pradesh und Ladakh als chinesisches Territorium betrachtet.
[50] Zitiert nach: Parmanand (1992), S. 166.
[51] Parmanand (1992), S. 151.
[52] Vgl. Kohli (1993), S. 116. Bhutan ist seit 1974 auch teilnehmender Staat an dem UN Development Program.
[53] Bezeichnend ist, dass der IBA trotz des Beitritt Bhutans zur UNO nie modifiziert wurde, obwohl dies eigentlich nötig gewesen wäre. Vgl. auch Parmanand (1992), S. 190. Bhutan drängte in der Tat mehrmals auf eine Veränderung des Art. 2 IBA, allerdings ohne Erfolg, womit man sich später auch zufrieden gab. Vgl. Parmanand (1992), S. 187 und Kohli (1993), S. 49.
[54] Vgl. Kohli (1993), S. 117. Auch Handbücher und Zeittafeln stellen heraus, dass Bhutan seit diesem Jahr souverän sei. Vgl. u.a. Fischer Taschenbuch Verlag (1999), S. 102 und eine Zeittafel von Areion Online: Königreich Bhutan / Drug Yul - Chronik, www.areion.org/areiononline/bhutanc.html [15.12.2002],
[55] 1992 waren es 23 Staaten, unter ihnen viele EU-Staaten, die Schweiz und Japan. Vgl. Parmanand (1992), S. 153.
[56] Ein Staat braucht nicht anerkannt zu werden, um ein Staat zu sein, nur eine Regierung kann die Anerkennung verweigert werden. Dies wird oft durcheinandergebracht.
[57] Bhutan hatte natürlich auch vor diesem letzten Citizenship Act eine Regelung bezüglich der Staatsangehörigkeit, das zitierte Gesetz von 1985 ist jedoch die neueste Version.
[58] Abgedruckt in: Parmanand (1992), S. 233ff. Ende dieses Jahres wird übrigens ein erster Verfassungsentwurf vorgelegt, welcher als ein Schritt in Richtung Demokratie interpretiert werden kann. Siehe auch Töpfer (2002).
[59] Vgl. Ipsen (1999), § 5, Rn. 7. Dies wurde auch in Kapitel II. 2. c) (1) diskutiert.
[60] Art. 3 IBA. Darüber hinaus beteiligt sich Indien an Bhutans Fünfjahresplänen. Die Fünfjahrespläne Bhutans sind Programme für die Weiterentwicklung Bhutans. Im Rahmen des dritten Fünfjahresplans (1971/72 – 1975/76) zahlte Indien ca. 10 Millionen € an Bhutan. „India’s role and contribution towards the economic development continued to be tremendous and Bhutan’s economic dependence upon India overwhelming.“ (Kohli (1993), S. 129). An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Zahlen zwar sehr niedrig klingen, allerdings gemessen an der Größe des Landes doch bedeutende Größen sind.
[61] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese Zahlen zwar sehr niedrig klingen, allerdings gemessen an der Größe des Landes doch bedeutende Größen sind.
[62] Dieses Szenario besorgte Bhutan in der Tat. Vgl. auch Parmanand (1992), S. 191.
[63] Diese Behauptung wird auch in der Literatur gestützt. Vgl. Kohli (1993), S. 41. Im Gegensatz dazu steht eine Behauptung des Außenministers von Bhutan im Jahr 1974, der behauptet, dass es egal sei, ob Bhutan sich an die indischen Richtlinien für die Außenpolitik halte oder nicht. Vgl. hierzu Library of Congress (1991). Das mag stimmen, solange die Entscheidung für Indien keine große Bedeutung hat. Wenn es sich jedoch um eine für Indien wichtige Entscheidung handelt, würde sich Indien durch eine Maßnahme Bhutans zuungunsten Indiens sicher nicht zurückhaltend verhalten.
[64] Parmanand (1992), S. 187.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieser Arbeit über Bhutan und Souveränität?
Diese Arbeit untersucht die Souveränität von Staaten im Völkerrecht, insbesondere anhand des Beispiels von Bhutan. Sie analysiert, ob die juristischen Definitionen von Staat und Souveränität in der Realität anwendbar sind und wie sie sich auf die internationale Position Bhutans auswirken.
Welche Definitionen von Staat und Souveränität werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Georg Jellineks Dreielementenlehre zur Definition des Staates (Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt) und untersucht den Begriff der Souveränität im historischen und modernen Kontext des Völkerrechts, einschließlich der Bedeutung der Charta der Vereinten Nationen und des Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten.
Welche Bedeutung hat der Indian-Bhutanese Accord (IBA) für Bhutans Souveränität?
Der IBA von 1949 zwischen Indien und Bhutan wird eingehend analysiert, insbesondere Artikel 2, der Indien eine beratende Rolle in Bhutans Außenpolitik zuweist. Die Arbeit untersucht, ob dieser Artikel Bhutans äußere Souveränität beeinträchtigt und ob Bhutan trotz des IBA als souveräner Staat gelten kann.
Wie werden Bhutans Beziehungen zu Indien und China bewertet?
Die Arbeit beleuchtet die strategische Bedeutung Bhutans zwischen Indien und China und analysiert, wie diese Beziehungen Bhutans Position in der internationalen Politik beeinflussen. Sie untersucht auch die wirtschaftliche Abhängigkeit Bhutans von Indien.
Was ist das Fazit der Arbeit bezüglich Bhutans Souveränität?
Obwohl Bhutan per Definition (gemäß den juristischen Kriterien) als souveräner Staat angesehen werden kann, kommt die Arbeit zu dem Schluss, dass Bhutan de facto aufgrund seiner Abhängigkeit von Indien und den Beschränkungen durch den IBA möglicherweise nicht vollständig souverän ist. Sie schlägt vor, dass eine quantitative Analyse des Abstimmungsverhaltens Bhutans in der UN-Generalversammlung diese These untermauern könnte.
Was sind die Hauptpunkte des Indian-Bhutanese Accord (IBA), der im Anhang aufgeführt ist?
Der IBA, der im Anhang enthalten ist, ist ein Vertrag über ewigen Frieden und Freundschaft zwischen Indien und Bhutan. Er legt fest, dass Indien sich nicht in die inneren Angelegenheiten Bhutans einmischt, Bhutan sich aber in seinen auswärtigen Beziehungen von Indien beraten lässt. Der Vertrag regelt auch Fragen des Handels, der Sicherheit und der Rechtsprechung.
Welche Art von Literatur wird zitiert?
Die Arbeit zitiert unter anderem Standardwerke des Völkerrechts und der Staatslehre, Länderstudien, Abhandlungen über die Beziehungen zwischen Indien und Bhutan sowie Internetquellen.
- Arbeit zitieren
- Subin Nijhawan (Autor:in), 2003, Ein Diskurs über den Begriff der Souveränität am Beispiel Bhutans, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108385