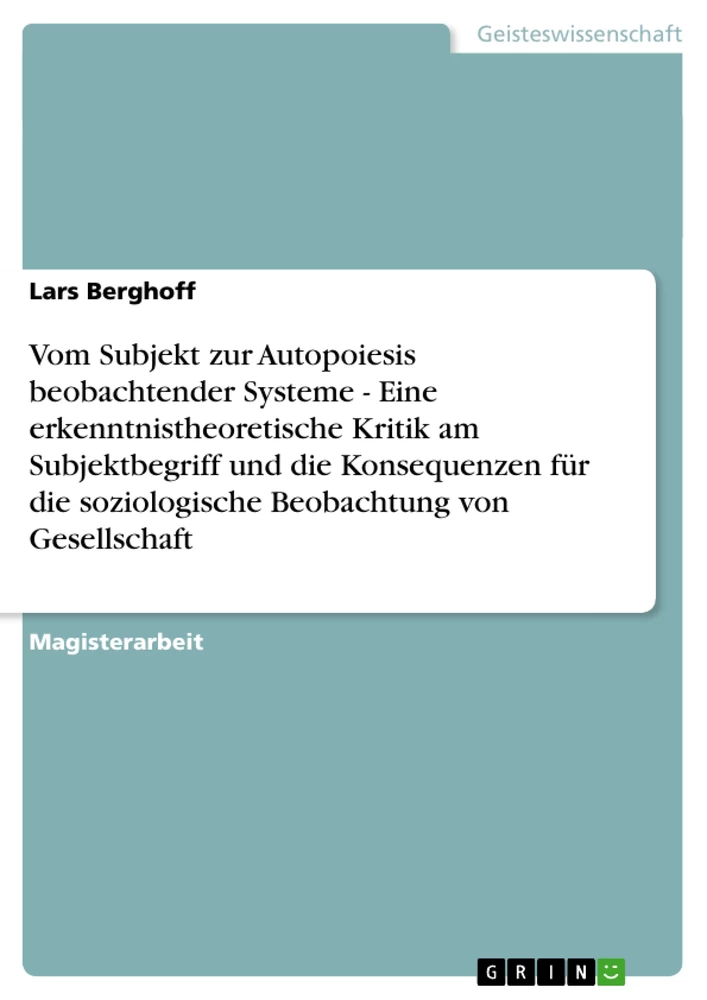Was, wenn das Subjekt, die viel gepriesene Bastion des modernen Denkens, in Wahrheit eine Illusion ist? Diese provokante Frage steht im Zentrum dieser tiefgreifenden Untersuchung, die den traditionellen Begriff des Subjekts kritisch hinterfragt und seine Dekonstruktion als kognitive und soziale Konstruktion nachzeichnet. Beginnend mit einer Analyse des Verhältnisses von Subjekt und Objekt in der Erkenntnistheorie, werden die Grenzen des Realismus, des objektiven und subjektiven Idealismus ausgelotet, um die fundamentalen Probleme der Begründung subjektübergreifender Erkenntnis aufzuzeigen. Der Fokus verschiebt sich dann auf die Kognitionswissenschaften, wo das Subjekt als Gegenstand der Forschung ins Visier gerät. Die Analyse des Kognitivismus und Konnektionismus offenbart die Schwierigkeiten repräsentationalistischer Ansätze und ebnet den Weg für eine radikal konstruktivistische Perspektive. Hier wird die Theorie autopoietischer Systeme vorgestellt, die Erkenntnis ohne Repräsentation postuliert und das Subjekt durch den Begriff des Beobachters ersetzt. Dieser Perspektivenwechsel revolutioniert das Verständnis von Ich-Bewusstsein, Handlungskompetenz und Entscheidungsfindung, indem er diese als Effekte von Beobachtungsoperationen entlarvt. Anschließend wird die Theorie beobachtender Systeme in der Soziologie untersucht, die aufzeigt, wie Selbstbewusstsein als Effekt von Beobachtungsoperationen entsteht und wie Bewusstsein und Kommunikation in einem komplexen Zusammenspiel interagieren. Die Arbeit kulminiert in einer soziologischen Beobachtung der Gesellschaft, die Kontingenz und richtungslose Evolution gesellschaftlicher Operationen in den Blick nimmt und die Frage aufwirft, ob die Soziologie Bewusstsein oder Kommunikation beobachten sollte. Durchdrungen von Schlüsselbegriffen wie Erkenntnistheorie, Kognitionswissenschaft, Radikaler Konstruktivismus, Systemtheorie, Autopoiesis und Beobachtung, bietet dieses Werk eine bahnbrechende Neubetrachtung des Subjekts und seiner Rolle in der Erkenntnis und der Gesellschaft, die das Potenzial hat, unser Verständnis von Wissen, Handeln und sozialer Realität grundlegend zu verändern. Dieses Buch ist unverzichtbar für alle, die sich mit Philosophie, Soziologie, Kognitionswissenschaft und den drängenden Fragen der menschlichen Existenz auseinandersetzen wollen und bietet neue Perspektiven auf die Konstruktion von Realität, die Natur des Bewusstseins und die Funktionsweise sozialer Systeme. Es ist ein fesselndes Plädoyer für eine differenzierte Betrachtung der Welt, die die Grenzen des traditionellen Denkens sprengt und inspirierende Einblicke in die komplexen Zusammenhänge von Geist, Gesellschaft und Erkenntnis bietet, indem sie das fundamentale Konzept des Beobachters in den Mittelpunkt stellt und die transformative Kraft der Kommunikation betont. Die Arbeit liefert wertvolle Beiträge zur Systemtheorie, zur Soziologie des Wissens und zur Philosophie des Geistes und ist somit eine essenzielle Lektüre für Forschende und Studierende, die sich mit den zentralen Fragen der menschlichen Existenz und der sozialen Ordnung auseinandersetzen.
INHALT
1. Einleitung
2. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Erkenntnistheorie
2.1. Das Begründungsproblem subjektübergreifender Erkenntnis
2.2. Realismus: Erkenntnis als Repräsentation einer objektiven Realität
2.3. Objektiver Idealismus: Erkenntnis als Repräsentation objektiver Ideen
2.4. Subjektiver Idealismus: Das apriorische Erkenntnisvermögen des Subjekts
2.5. Zusammenfassung
3. Das Subjekt als Gegenstand der Kognitionswissenschaften
3.1. Kognitionswissenschaft als Wissenschaft vom Intentionalen
3.2. Kognitivismus: Kognition als Symbolverarbeitung und Repräsentation
3.3. Konnektionismus: Kognition als Selbstorganisation und Repräsentation
3.4. Zur Kritik an repräsentationalistischen Ansätzen der Kognition
3.5. Zusammenfassung
4. Das Subjekt aus der Perspektive des Radikalen Konstruktivismus
4.1. Die Theorie autopoietischer Systeme: Erkenntnis ohne Repräsentation
4.2. Ich-Bewusstsein, Handlungskompetenz und Entscheidungsfindung
4.3. Gedächtnis, Erinnerungen, Erzählgeschichten
4.4. Zusammenfassung
5. Die Theorie beobachtender Systeme in der Soziologie
5.1. Der Beobachter als selbstreferentielles System
5.2. Selbstbewusstsein als Effekt von Beobachtungsoperationen
5.3. Zum Verhältnis von Bewusstsein und Kommunikation
5.4. Die Eigenständigkeit kommunikativer Operationen
5.5. Zum theoretischen Verständnis der Emergenz
5.6. Zusammenfassung
6. Soziologische Beobachtung von Gesellschaft
6.1. Kontingenz und richtungslose Evolution gesellschaftlicher Operationen
6.2. Beobachten: Bewusstsein oder Kommunikation?
7. Schlussbetrachtung
8. Verwendete Literatur
1. Einleitung
Im Verlauf der Menschheitsgeschichte musste der Mensch mehr und mehr seine Sonder-stellung im Kosmos aufgeben. Zuerst vertrieb ihn Kopernikus aus dem Mittelpunkt der Welt, dann erklärte die Evolutionstheorie Charles Darwins die menschliche Schöpfung als Produkt biologischer Variation und Selektion. Die Einsicht in die Bedeutungslosigkeit des Menschen wurde jedoch zu Beginn des modernen Denkens mit einer Selbstüberhöhung gekontert: der Mensch war immerhin Subjekt. Mit dem Subjektbegriff korrespondierte die Vorstellung, der Mensch sei ein vernunftorientiertes Wesen und imstande, das Wahre und Gute zu entdecken, um daraufhin die politischen und sozialen Verhältnisse auf der Erde bestimmen zu können und eine gerechte Gesellschaftsordnung auf Dauer zu errichten. Begriffe wie Entscheidungsfreiheit, Handlungskompetenz, Selbstbestimmung oder willentliche Autonomie machten die Runde und wurden bestimmend für das Selbstverständnis der modernen westlichen Gesellschaft. Als Erkenntnissubjekt sollte der Mensch die Welt in ihren Strukturen und Gesetzmäßigkeiten ent-decken können, denn diese galten als objektiv gegeben und brauchten der Erkenntnis nur noch zugeführt werden. Entsprechend dieser Vorstellung sollten dann alle Menschen die Welt auf die gleiche Weise sehen und zu denselben Einsichten gelangen – vorausgesetzt, es wurden Beobachtungsfehler vermieden, die ihre Ursache entweder in einer verzerrten (ideologischen, unkritischen, naiven) Sicht auf die Dinge oder in einem unzureichenden Erkenntnisvermögen haben sollten. Dieser Auffassung lag die Annahme zugrunde, die Menschen würden in einer gemeinsamen Welt leben, an der sie bloß in unterschiedlicher (»subjektiver«) Weise anknüpf-en. Meinungsverschiedenheiten waren dann ein Resultat verschiedener Sichtweisen auf ein und denselben Gegenstand, und wissenschaftliche Methoden sollten offenbaren, wie die Welt »wirklich« ist, und nicht wie sie einem Beobachter subjektiv erscheint.[1] Des weiteren ging man davon aus, dass der Mensch die Welt nur zu einem Teil erleide: als willentlich handelndes Subjekt sei der Mensch in der Lage, sein eigenes Tun zu verantworten, denn immerhin habe er die Möglichkeit, anders zu denken, anders zu entscheiden, also auch: anders (und hoffentlich vernünftig) zu handeln. Diese Auffassung geht von dem Glauben aus, die Welt werde von ein-heitlichen Vernunftprinzipien regiert, und da der Mensch Teil der Welt sei, würde die Vernunft bis in das menschliche Bewusstsein vordringen und sich dort schließlich entfalten können. Die Menschen würden dann mit ihrem Denken, ihren Ideen und Visionen auf den Verlauf der Geschichte gestaltend Einfluss nehmen und in der Zukunft eine gerechte Gesellschaft einlösen, insofern alle Menschen nur vernünftig geworden sind. Inzwischen wird dieses Welt- und Menschenbild erneut angegriffen, wenn postmoderne Theoretiker den »Tod des Subjekts« ver-künden und das autonome Erkenntnis-, Sprach- und Handlungssubjekt als Produkt gesell-schaftlicher Diskurse erklären – und nicht als deren Schöpfer.
Diese Arbeit hat zum Ziel, den Subjektbegriff kritisch zu hinterfragen und die Konsequenzen aufzuzeigen, wenn der Subjektbegriff fallengelassen und das Subjekt stattdessen als kognitive und soziale Konstruktion behandelt werden muss. In diesem Zusammenhang sind dann zwei Aspekte zu berücksichtigen, die nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können: der Mensch als erkennendes und als handelndes Subjekt. Dem Handlungsbegriff liegt die An-nahme zugrunde, dass Handlungen ein Handlungssubjekt (und somit: ein Erkenntnissubjekt) voraussetzen. Die Handlungsfähigkeit des Menschen ist an kognitive Fähigkeiten gebunden, so dass Handlungen nicht losgelöst von Wahrnehmung, Denken und Erkennen gesehen werden können. Aus diesem Grund werde ich zu Beginn dieser Arbeit auf das Subjekt als erkennendes Subjekt eingehen, um dann im weiteren Verlauf zunehmend auch handlungs- und gesell-schaftstheoretische Aspekte in den Blick zu nehmen. Am Ende der Arbeit soll das Verhältnis von erkennendem und handelndem Subjekt präzisiert und schließlich das Subjekt durch den Begriff des Beobachters ersetzt werden. Die Überlegung ist dabei folgende: wenn das Subjekt als Erkenntnissubjekt wegfällt, dann fällt es auch als Handlungssubjekt weg und somit schließ-lich: als Gegenstand der Soziologie. Gegenwärtig versteht sich die Soziologie überwiegend als subjektzentrierte bzw. handlungstheoretisch orientierte Soziologie, was heißen soll, dass sie die gesellschaftliche Realität und das Handeln von Menschen auf ein intentionales Bewusstsein zurückführt. Die Grundannahme dabei ist, dass subjektiver Sinn (Gedanken, Überzeugungen, Absichten, Wünsche,) das individuelle und soziale Verhalten bestimmen. Methodischer An-satzpunkt seien deshalb handelnde Subjekte. Nahezu alle gesellschaftlichen Verhältnisse und Prozesse werden damit in anthropozentrischen oder bewusstseinsphilosophischen Begriffen zu fassen versucht:
Üblicherweise wurde und wird das soziale Geschehen mit einer subjektphilosophischen Begrifflichkeit beschrieben. Der Mensch bildet demnach die kleinste Einheit des Sozialen. Die Gesellschaft als das umfassendste Sozialsystem besteht somit aus Menschen und ihren sozialen Beziehungen. In der gleichen Weise werden auch Kommunikationen in bezug auf kommunizierende Menschen bzw. Subjekte gedacht. Der Mensch kommuniziert, bzw. mehrere Menschen kommu-nizieren miteinander.[2]
Entsprechend dieser Vorstellung wird die Gesellschaft von Handlungssubjekten konstituiert und von handelnden Subjekten sinnhaft gestaltet. Wie auch immer die Theorieansätze im ein-zelnen aussehen, sie stehen in der subjektphilosophischen Tradition, die im Bewusstsein des Menschen ein subjektives Schwerpunktzentrum voraussetzt, das mit Sinn angereichert ist und als Grundlage für Denken, Handeln und Entscheiden herhalten soll: vom Bewusstsein ausge-hend werden Handlungs- oder Kommunikationsabläufe strukturiert und organisiert, letztlich also Gesellschaft vollzogen. Diese Vorstellung ist in der Soziologie so selbstverständlich, dass kaum die Möglichkeit gesehen wird, dass das Subjekt lediglich eine soziale Konstruktion ist, und keine anthropologische Konstante. Das Subjekt wird in der Soziologie immer vorausge-setzt, taucht aber als Grundbegriff nur selten auf. Und wie ein Vergleich zwischen Philosophie und Soziologie erkennen lässt, scheint das Subjektproblem »in der Soziologie weniger wichtig zu sein als in der Philosophie, und es scheint in der französischen Soziologie wichtiger zu sein als in der deutschen« (Zima 2000, S. 43).
Inzwischen werden aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtungen Zweifel angemeldet, wenn es um den Menschen als Erkenntnis-, Erfahrungs-, und Sinnzentrum geht. Philosophie, Psychologie, Linguistik, Neurowissenschaft, Anthropologie und systemtheoretische Soziologie kommen heute zu dem Ergebnis, dass das erkennende und willentlich handelnde Subjekt eine gesellschaftliche Konstruktion ist, die sich vornehmlich einer kognitiven Illusion verdankt.[3] Erkennen und Handeln haben ihren Ursprung nicht im menschlichen Bewusstsein, denn das Bewusstsein selbst ist zwischen anderen Systemprozessen angesiedelt und wird von diesen an-dauernd bearbeitet. Sowohl Psychologie als auch Neurobiologie machen den Einfluss unbe-wusst ablaufender Prozesse geltend und erklären das Bewusstsein als emergentes Resultat multipler Beobachtungsprozesse. Die Linguistik löst das Bewusstsein aus seinem Zentrum her-aus, indem sie die Vorstellung dekonstruiert, sprachliche Ausdrücke seien Entäußerungen einer innerpsychischen, sich selbst zugrundeliegenden Subjektivität. Will man diese Befunde auf einen gemeinsamen Nenner bringen, dann lässt sich sagen, dass der Mensch als Erkenntnis- und Handlungssubjekt zunehmend aufgelöst, dezentriert und als Produkt historischer Narrative dargestellt wird. Die Soziologie hätte daraus die Konsequenz zu ziehen, dass sie das Subjekt nicht als konstituierendes Element der Gesellschaft betrachtet, sondern als ihr Produkt. Daran schließt sich die Frage an, was die Soziologie zu leisten vermag, wenn sie sinnverstehend bei handelnden Individuen ansetzt und gesellschaftliche Strukturen und Prozesse reduktionistisch auf ein Subjektbewusstsein zurückführt. Eine andere Möglichkeit wäre, mithilfe einer system-theoretischen Begrifflichkeit die Gesellschaft von der Gesellschaft her zu erklären, was be-deuten würde: Kommunikation statt Bewusstsein zu beobachten. Die Systemtheorie macht es heute möglich, mit einer einheitlichen Begriffssprache unterschiedliche – physikalische, bio-logische, soziologische – Phänomene in den Blick zu nehmen und sie auf ihre Prozesse hin zu untersuchen.[4] Das systemtheoretische Paradigma katapultiert damit den Menschen ein weiteres Mal aus dem Mittelpunkt, in diesem Fall: aus seiner anthropozentrischen Perspektive. Wie man heute weiß, sind kognitive und intentionale Fähigkeiten nicht nur dem Menschen vorbe-halten, sondern auch in anderen Beobachtersystemen anzutreffen. Die Welt besitzt viele ver-schiedene Möglichkeiten, sich zu beobachten, und das menschliche Bewusstsein ist nur eine Realisierungsform davon.[5] Wenn die Systemtheorie von Beobachtersystemen spricht, dann ist dies nicht hegelianisch gemeint: die Systemtheorie arbeitet differenztheoretisch, sie bestreitet also die Existenz eines universellen Geistes oder einer Weltseele. Stattdessen werden ver-schiedene Formen des Beobachtens angenommen, und der Begriff des Subjekts wird ersetzt durch den Begriff des Beobachters. Für die Soziologie bringt diese Umstellung der Begrifflich-keit insofern einen Erkenntnisgewinn, als sie gesellschaftliche Kommunikation als ein eigenes System auffassen kann, das zu Selbstorganisation fähig ist, ohne dass man diese Fähigkeit auf ein zugrundeliegendes Bewusstsein zurückführen muss. Diese veränderte Sicht zwingt dazu, die Beobachtungsweise in der Soziologie umzustellen, indem nicht mehr Bewusstsein, sondern Kommunikation beobachtet und einer soziologischen Untersuchung zugänglich gemacht wird. Ich werde in dieser Arbeit immer wieder zu zeigen versuchen, dass mit dem Subjektbegriff so-wohl das menschliche Erkennen als auch die Evolution der gesellschaftlichen Prozesse nicht hinreichend erklärt werden kann. Die Kritik am Subjektbegriff vollzieht sich interdisziplinär, um zu zeigen, wie heute Forschungen aus ganz unterschiedlichen Wissenschaften dahingehend konvergieren, dass der Status des menschlichen Bewusstseins neu bewertet werden muss. Im Anschluss sollen dann die Konsequenzen für die überwiegend handlungstheoretisch orientierte Soziologie aufgezeigt werden.
In einem ersten Schritt werde ich auf das Subjekt als Erkenntnissubjekt eingehen und zeigen, von welchen Grundannahmen die klassische Erkenntnistheorie ausgeht und welche Probleme mit dem Subjekt-Objekt-Schema verbunden sind. Dabei geht es um die Frage, was genau die Quelle der Erkenntnis ist und wie im allgemeinen die Möglichkeit objektiver Erkenntnis be-gründet wird.[6] In einem zweiten Schritt werde ich das Erkenntnissubjekt aus der Sicht der Kognitionswissenschaften beleuchten und zeigen, welche Schwierigkeiten mit dem derzeit vorherrschenden Repräsentationsparadigma verbunden sind und welche Tendenzen sich gegenwärtig abzeichnen. Im vierten Kapitel behandele ich dann die Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus, in der der Repräsentationsgedanke endgültig aufgegeben und durch das Konzept autopoietischer, lebend verkörperter Kognitionssysteme ersetzt wird. Dem konstruktivistischen Wahrnehmungsparadigma liegt dabei die Annahme zugrunde, dass jedes kognitive System ein operational geschlossenes, selbstreferentielles, autopoietisches System ist. Jede Erkenntnis und jede Wirklichkeitsvorstellung ist dann das Konstrukt eines kognitiven Systems und hat als solche keinerlei Entsprechung in der Umwelt (»order from noise«). Die Sprache referiert dann nicht mehr auf eine außersprachlich liegende Realität, wie es etwa die Korrespondenztheorie behauptet, sondern nur wieder auf sich selbst, nämlich auf sprachlich erzeugte Konstrukte. Das Subjekt-Objekt-Schema wird also durch das Konzept autopoietischer Systeme ersetzt, und anstelle der Unterscheidung von Sein und Erkennen des Seins tritt die Unterscheidung in erkennendes (konstruierendes) System und erkannter (konstruierter) Um-welt. Da sowohl eine objektive Realität als auch objektive (transzendentale) Erkenntnisbeding-ungen wegfallen, versteht sich diese Erkenntnistheorie letztlich subjektivistisch. Ankerpunkt allen Erkennens ist also das einzelne Subjekt, das für seine Wirklichkeitskonstruktionen dann die Verantwortung übernehmen soll. Die Schwäche des Radikalen Konstruktivismus liegt darin, dass er auf der Ebene der Konstruktionssubjekte verbleibt und den Einfluss der Sozial-dimension (kommunikativer Operationen) an der Wirklichkeitskonstruktion vernachlässigt. Ich werde versuchen, die Schwächen dieses Ansatzes herauszuarbeiten, indem ich auf das Subjekt als Sprach- und Handlungssubjekt eingehen und zeigen werde, dass eine radikalkonstruktivist-ische Erkenntnistheorie nicht haltbar ist, da Bewusstsein und Gedächtnisleistungen immer schon eine soziale Komponente besitzen. Kognitive Systeme konstruieren Wirklichkeit, sie handeln und treffen Entscheidungen, doch diese Prozesse verdanken sich keiner intrinsischen Subjektivität.[7] Anhand von Beispielen aus der Psychologie und klinischen Befunden aus der Neurophysiologie werde ich zeigen, dass die Einheit des Ich-Bewusstseins eine Illusion ist, und dass die Sprachsubjekte ihre Sprechakte (unwissentlich) aus sozialen Zwängen heraus vollziehen. Jede sprachliche Rationalisierung einer Handlung ist eine Pseudorationalisierung insofern, als das sprachlich beschreibende System keinen Zugang zu den tatsächlich ablaufen-den Prozessen hat, sich aber das Handlungsgeschehen dennoch zuschreibt und sich für den Autor des Geschehens hält.
Im fünften Kapitel werde ich dann auf die Systemtheorie als Theorie beobachtender Systeme eingehen, die auf die Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus aufbaut und dessen Prämissen insofern übernimmt, als das Subjekt-Objekt-Schema durch das Beobachterkonzept ersetzt wird. Die Welt wird dann nicht mehr als Gegenstand, sondern als Möglichkeitshorizont vorausgesetzt, so dass je nach gewählter Systemreferenz unterschiedliche Beobachtungen bzw. Erkenntnisinhalte aktualisiert werden. Im Gegensatz zum Radikalen Konstruktivismus bleibt das Beobachterkonzept der Systemtheorie jedoch nicht nur auf lebende Systeme beschränkt, sondern wird auf alle Systeme übertragen, die sich durch einen selbstreferentiellen Prozess von Beobachtungsoperationen auszeichnen. Während die biologisch begründete Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus auf der Ebene des Nervensystems verbleibt und beobachtende Prozesse von der Struktur des Nervensystems her denkt, wird das Beobachterkonzept in der Systemtheorie so formal gehalten, dass auch nichtlebende Systeme Beobachtungsoperationen vollziehen können. Beobachtende Systeme sind dann alle autopoietischen Prozesse, die auf die Operation des Unterscheidens und Bezeichnens zurückgreifen, und lebende Systeme sind dann nur eine Form dieser autopoietischen Organisation. Der Begriff des Beobachtens impliziert nicht, dass der Beobachter ein menschliches Subjekt sein muss, sondern auch Kommunikation kann sich anhand der Unterscheidung von Information und Mitteilung beobachten. Diese Unterscheidung verdankt sich jedoch keinem zugrundeliegenden Bewusstsein, das über diese Unterscheidung a priori verfügt, sondern ist ein emergentes Resultat beim Aufeinandertreffen selbstreferentiell operierender Systeme. Kommunikation lässt sich dann nicht mehr auf die an Kommunikation beteiligten Bewusstseinssysteme zurückführen, sie kann von einem Bewusst-sein weder initiiert, berechnet noch kausal gesteuert werden. Kommunikation orientiert sich vielmehr, wie andere selbstreferentielle Beobachter auch, an ihrer eigenen Vergangenheit. Sie nimmt dabei eigene Selektionen vor und etabliert Erwartungsstrukturen für die an Kommuni-kation beteiligten Bewusstseinssysteme, ist also ein eigenständiges Prozesssystem, das nicht mit Kausalannahmen, nicht »von unten«, nicht von einem zugrundeliegenden Bewusstsein her erklärt werden kann.
Wie auch im Radikalen Konstruktivismus verzichtet die Theorie beobachtender Systeme auf ontologische Prämissen und behandelt Wirklichkeitsvorstellungen als unterscheidungsbasierte Konstruktion. Doch wird diese Konstruktionsleistung dann von einem Subjektbewusstsein auf die Sozialdimension verlagert, und geht deshalb die soziologische Systemtheorie von einem Primat der Kommunikation aus. Es liegt nicht in der Macht einzelner Subjekte, die Evolution der gesellschaftlichen Kommunikation in eine bestimmte Richtung zu lenken (wie dies noch die Hoffnung der Subjektphilosophie ist), sondern vielmehr orientiert sich die gesellschaftliche Kommunikation an sich selbst, ähnlich wie in der Biologie im Schema von Variation und Selektion. Sie greift auf aktuelle Themen und Schemata zurück, orientiert sich an der eigenen Systemgeschichte und ist dabei offen für Neues. Gesellschaft als autopoietischer Kommuni-kationszusammenhang produziert und reproduziert sich dann in Abhängigkeit ihrer eigenen Geschichtlichkeit und nach funktionalen Erfordernissen.[8] Das Einzelbewusstsein, dessen Wirklichkeitsvorstellungen stets kontingent gedacht werden müssen, wird mit vorgefertigten Wissenskonstruktionen aus der Gesellschaft versorgt, und ist es in diesem Sinne dann Produkt, nicht Produzent der Gesellschaft. Es hat dabei kaum einen Einfluss auf die Richtung der ge-sellschaftlichen Evolution, da sich autopoietische Prozess von ihrer eigenen Vergangenheit ab-hängig machen.
Wie lässt sich dann noch Gesellschaft beobachten, wenn die Gesellschaft nicht von Subjekten gemacht oder organisiert wird, weil das Subjekt selbst eine soziale Konstruktion, eine Erfin-dung des modernen Denkens ist? Nachdem ich den systemtheoretischen Gesellschaftsbegriff vorgestellt habe, werde ich im Anschluss zeigen, wie sich das Verhältnis der Soziologie zu ihrem Gegenstand verändern muss: Gesellschaft ist nicht das Resultat des sinnhaften Handelns von Akteuren, denn diese sind nicht die zugrundeliegende Einheit, sind nicht mehr Subjekte (Autoren, Urheber, Gestalter) der Gesellschaft. Eine systemtheoretisch informierte Soziologie begreift Kommunikation subjektlos, nämlich als selbstreferentiellen Prozess mit der Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und eigene Selektionen vorzunehmen. Aus dieser Perspektive wäre es dann falsch (zumindest unzureichend), methodologisch auf das Bewusstsein abzustellen. Vielmehr gilt es, den Blick auf die gesellschaftlichen Diskurse zu richten, die den Menschen kommunikativ zu dem machen, was sie sind: zu guten, böswilligen, vernünftigen oder patho-logischen Subjekten. Denn eine Wissenschaft, die ohne Ontologie auskommt, kann sich nicht mehr darauf berufen, dass ihre Beobachtungen lediglich eine vorfindliche Realität aufdecken, um diese dann in Sprache zu überführen und anderen Beobachtern zur Verfügung zu stellen. Jede Beobachtung basiert auf Unterscheidungen und lässt sich deshalb immer auch anders unterscheiden, also auch: anders beobachten. Dies gilt auch für soziologische Kommunikation, die die Eigenschaften ihrer Untersuchungsobjekte immer erst konstruiert.[9] Das Soziale als Sinnzusammenhang von Kommunikationen kann durch die Soziologie weder theoretisch über-schaut noch repräsentiert werden, denn jeder Versuch, die Gesellschaft zu repräsentieren, ist selbst eine gesellschaftliche Operation, die sich ihrerseits wieder einer Beobachtung und Kritik aussetzt. Der Soziologe erfasst nicht die soziale Realität, indem er sie auf Sprache abbildet, sondern er erzeugt und konstruiert Realität mit seinen eigenen Beobachtungsinstrumenten (Begriffen, Unterscheidungen, Theorien, Methoden). Die Rationalität einer systemtheoretisch informierten Soziologie kann sich nur noch darin erschöpfen, ihre eigenen Beobachtungen zu verantworten und die Effekte zu berücksichtigen, die sie in anderen Systemen (Recht, Politik, Wirtschaft, Gesundheit) auslöst, kurz: wenn ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft in Rech-ung gestellt werden. Die methodologischen Konsequenzen für die Soziologie können im Rahmen dieser Arbeit nur angedeutet werden. Es zeigt sich aber, dass die Soziologie ihre Beobachtungsmethode in zweierlei Hinsicht umstellen muss: Zum einen hat sie Kommuni-kation statt Bewusstsein zu beobachten, zum anderen wird sie von einer Beobachtung erster Ordnung (»Was ist der Fall?«) zu einer Beobachtung zweiter Ordnung übergehen müssen, die in den Blick nimmt, wie die gesellschaftliche Kommunikation Identitäten (Objekte, Tatsachen, Sachverhalte) konstruiert, wie sie also mit Kontingenz umgeht und wie diese an verschiedenen Kommunikationsstellen unterschiedlich bearbeitet wird. Das Augenmerk der Soziologie wäre dann auf den sinn produzierenden Aspekt der Kommunikation gerichtet, und nicht wie bisher: auf die Rekonstruktion eines essentiellen Sinns in Texten.
2. Das Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Erkenntnistheorie
2.1. Das Begründungsproblem subjektübergreifender Erkenntnis
Seit Beginn des philosophischen Denkens ist man über die Existenz und Erkennbarkeit der Welt verschiedener Meinung. Bereits in der Antike hatte man sich Gedanken darüber ge-macht, wie das Verhältnis von Sein und Erkennen des Seins, also die Relation von erkanntem Objekt und erkennendem Subjekt, zu bestimmen ist. So hatte Platon die Frage aufgeworfen, ob es ein wirkliches Wissen (episteme) von den Dingen gibt, das sich von subjektiven Einschätz-ungen oder bloßen Meinungen (doxa) unterscheidet. Die Frage, ob eine Erkenntnis nur für den Einzelnen oder auch für die Gesamtheit bindend ist, wurde in der Geschichte der Philosophie unterschiedlich beantwortet, und es stehen sich dabei erkenntnisoptimistische und erkenntnis-pessimistische Positionen gegenüber: die einen halten allgemeingültiges Wissen grundsätzlich für möglich, und man streitet darüber, worauf sich eine solche Möglichkeit gründet. Die andere Position bezweifelt die Möglichkeit objektiver Aussagen, denn nach ihrer Auffassung ist das einzelne Individuum Maßstab der Erkenntnis. Die Geltung menschlichen Wissens sei dann eine Machtfrage und beruhe auf dem politischen Durchsetzungsvermögen innerhalb einer Sprachgemeinschaft.
Die meisten Wissenschaftler verstehen sich als Erkenntnisoptimisten. Sie nehmen an, mit ihren Methoden könnten sie ein Wissen hervorbringen, das einen objektiven Gehalt hat, weil es un-abhängig vom Forschenden einen Weltsachverhalt widerspiegelt. Wissenschaftliche Methoden würden sich also gegenüber subjektiven Meinungen und Einschätzungen dadurch auszeichnen, dass sie auf eine Objektivierung von Informationen abzielen (vgl. Wenturis 1992, S. 68 f.). Dies lässt sich dann in etwa so beschreiben:
Unsere Ansichten werden oft durch Vorurteile oder Interessen beeinflusst, und das hindert uns daran zu sehen, wie sich die Sache tatsächlich verhält. Wollen wir das erkennen, so müssen wir uns um Objektivität, um Unvoreingenommenheit in unseren Urteilen bemühen, wir müssen bestrebt sein, über unsere rein persönliche, individuelle Perspektive hinaus-zukommen.[10]
Im Gegensatz zu religiösen Glaubensvorstellungen oder subjektiven Überzeugungen soll die Wissenschaft ein objektives Wissen zu ermitteln suchen und dieses intersubjektiv verfügbar machen. Mit Hilfe besonderer Erkenntnisverfahren soll dann herausgefunden werden, wie die Welt tatsächlich ist, und nicht wie sie einem Beobachter subjektiv erscheint. Als Kennzeichen wissenschaftlicher Objektivität gilt die Unabhängigkeit des Erkannten von den Vorstellungen, Wünschen, Meinungen oder Wertüberzeugungen des Forschers sowie die Forderung, dass wissenschaftliche Sätze jederzeit einer intersubjektiven Überprüfung standhalten müssen (wes-halb die Protokollierung und Offenlegung des Erkenntnisverfahrens einen wichtigen Teil wiss-enschaftlichen Arbeitens ausmacht). Kurzum: Wissenschaft soll die Welt systematisch erfassen und die subjektiven Befindlichkeiten des Forschers mit Hilfe methodischer Kontrollverfahren weitestgehend ausschalten. Das auf diese Weise hervorgebrachte Wissen soll dann allgemeine Gültigkeit beanspruchen dürfen.[11]
Wer an die Möglichkeit allgemeingültiger Aussagen glaubt, geht dabei von einer wichtigen Grundannahme aus: dass die Welt, zumindest im Prinzip, allen Beobachtern gleichermaßen zugänglich ist. Die Welt wird sich dann vorgestellt als etwas, das der Erkenntnis nur noch zu-geführt werden braucht, und bestehende Differenzen im Hinblick auf die »richtige« Sicht der Dinge werden auf Unzulänglichkeiten im Beobachtungsprozess zurückgeführt: auf das Unver-mögen eines Beobachters, sich der Welt, wie sie tatsächlich ist, erkennend zu nähern.[12] Die Überlegung ist also folgende: Wenn die Meinungen über einen Weltsachverhalt auseinander-gehen, dann kann dies nicht an dem Sachverhalt selbst liegen, sondern nur an der Art und Weise, wie beobachtet wird. Zwar gehen die meisten Wissenschaftler heute nicht mehr davon aus, dass sie ein für alle Zeit gesichertes Wissen verfügbar machen können, aber es wird zu-mindest an der Idee festgehalten, dass ihre Erkenntnisse etwas Objektives widerspiegeln.[13] Es entsteht damit dann allerdings das Problem, wie sich die intersubjektive Geltung von Wissen rechtfertigen lässt, und der Streit entzündet sich an der Frage, auf welchem Fundament sich wissenschaftliche Objektivität gründen kann. Nachfolgend sollen drei klassische Antwortver-suche vorgestellt werden: auf der einen Seite steht die erkenntnistheoretische Position, die vom Erkenntnis objekt ausgeht und sich dann entweder auf eine objektiv gegebene Realität oder auf objektive Ideen bezieht. Auf der anderen Seite steht die erkenntnistheoretische Position, die die Möglichkeit allgemeingültiger Erkenntnis im Erkenntnis subjekt begründet sieht und hierfür dann apriorische Erkenntnisbedingungen in Anspruch nimmt. Ausgangspunkt ist die Überleg-ung, dass jedes Erkennen auf einen Gegenstand (das Erkenntnisobjekt) gerichtet ist. Zu klären wäre dann allerdings, wie die Gegenstände der Erkenntnis beschaffen sind, ob es sich dabei um die Gegenstände der Außenwelt oder um die Vorstellungsinhalte eines Bewusstseins handelt. Historisch hat diese Unterscheidung in die beiden Gegenpositionen Realismus und Idealismus geführt. Im Realismus wird angenommen, dass die Erkenntnis es mit einer von Sprache und Bewusstsein unabhängigen Realität zu tun hat, wenngleich nur unvollkommen und in den Grenzen menschlicher Wahrnehmungsmöglichkeiten. Die Erkenntnis bezieht ihre Objektivität daher, weil Faktisches auf das Erkenntnissubjekt abgebildet wird. Der Idealismus hingegen betont, dass Aussagen über die Wirklichkeit nicht losgelöst vom einem erkennenden Subjekt gedacht werden können. Die Wirklichkeit wäre dann etwas, an dem das erkennende Subjekt konstitutiv beteiligt ist.
2.2. Realismus: Erkenntnis als Repräsentation einer objektiven Realität
Der Begriff Realismus steht für jene Positionen, die von der Existenz einer objektiven Realität ausgehen und behaupten, dass diese zum Gegenstand menschlicher Erfahrung ge-macht werden kann. Dabei ist zwischen ontologischen und erkenntnistheoretischen Positionen zu unterscheiden.[14] Der erkenntnistheoretische Realismus hat den ontologischen Realismus notwendig zur Voraussetzung, denn man kann nicht die Erkennbarkeit der Realität behaupten und zugleich ihre Existenz bezweifeln. Die These des ontologischen Realismus ist folgende: Es gibt eine Realität, die in ihrer Existenz und Beschaffenheit unabhängig davon ist, ob und wie sie von einem menschlichen Bewusstsein erfahren wird. Bestimmte Sachverhalte werden als objektiv gegeben vorausgesetzt und den subjektiven Sachverhalten des Meinens, Glaubens, Wollens oder Fühlens gegenübergestellt. Die Kurzformel für den ontologischen Realismus lautet also: Es gibt objektive Tatsachen. Die Argumentation sieht dann folgendermaßen aus: Wenn das Papier tatsächlich weiß ist, so auch dann, wenn es von niemandem beobachtet wird oder es jemanden versehentlich als gelb erscheint.[15] Ein erkenntnistheoretischer Realismus nimmt zusätzlich an, dass die Realität zumindest teilweise so erfahren wird, wie sie tatsächlich ist, die These hierfür ist: Es gibt eine Erkenntnis von objektiven Sachverhalten (vgl. Kutschera 1982, S. 179 ff.). Während alle naiven Realisten glauben, dass die Dinge so beschaffen sind, wie sie sich in unserer Wahrnehmung zeigen, sind sich alle kritischen Realisten darin einig, dass einiges in unserer Wahrnehmung objektiv gegeben, anderes hingegen subjektives Bei-werk ist – über das Mischungsverhältnis ist man jedoch unterschiedlicher Meinung.[16] Wenn es also eine objektive Erkenntnis geben soll, dann muss sie in den Wahrnehmungserlebnissen enthalten sein, und die Frage lautet deshalb: Wie können wir bei unseren Wahrnehmungs-erlebnissen verlässlich entscheiden, was von der Realität stammt, und was von uns – unserem Erkenntnisapparat – subjektiv beigesteuert wird? (vgl. Roth 1998, S. 341 f.).
Im Realismus wird also die Auffassung vertreten, dass sich alles Wissen aus der Realität ein-speist: alles Erkennen entspringt der erfahrbaren Realität, nimmt dort ihren Ausgang. Diese Gedanken finden sich erstmals bei Aristoteles, der auf die Erfahrung als Quelle der Erkenntnis hinweist. Für Aristoteles ist die Tätigkeit des Verstandes sekundär, denn sie beschränkt sich lediglich auf die begriffliche Zuordnung der Erfahrungsinhalte: »Alle Begriffe, mit denen wir die Welt beschreiben, sind nach dieser Auffassung der Erfahrung entnommen, und alle Aus-sagen über die Welt sind aus Erfahrungen gewonnen« (Kutschera 1982, S. 438). Sprachliche Beschreibungen haben für einen Realisten nur dann einen Sinn, wenn sie stellvertretend für einen realen Sachverhalt stehen, wenn sie also einen Weltsachverhalt repräsentieren. Insofern gilt, dass jede Behauptung über die Welt entweder eine wahre oder falsche Behauptung sein muss.[17] Da als Rechtfertigungsgrund der Erkenntnis die Erfahrung in Anspruch genommen wird, bezeichnet man diesen Standpunkt auch als Empirismus. Wissen gewinnt der Mensch dadurch, indem er die Erfahrungsinhalte auf Begriffe abbildet.[18] Sprachliche Ausdrücke werden als Repräsentanten der Realität gesehen, von der angenommen wird, dass sie unabhängig von den sprachlichen Beschreibungen existiert. Entsprechend dieser Auffassung versteht sich die Wissenschaft als erkennende und informierende Tätigkeit, die sich der Welt begrifflich zu nähern versucht, und es wird angenommen, dass »unsere Erkenntnis den objektiven Zustand der Realität durchaus erfassen kann« (Wenturis 1992, S. 234).
2.3. Objektiver Idealismus: Erkenntnis als Repräsentation objektiver Ideen
Die zum Realismus entgegengesetzte Position ist der Idealismus, auch hier muss wieder zwischen einer ontologischen und einer erkenntnistheoretischen Fassung unterschieden werden. Der erkenntnistheoretische Idealismus geht davon aus, dass die Erkenntnis nicht die Realobjekte der Außenwelt, sondern die Vorstellungsinhalte des Erkenntnissubjekts zu ihrem Gegenstand hat.[19] Damit wird nicht die Existenz, wohl aber die Erkennbarkeit einer Realität bestritten, die unabhängig vom Erkenntnissubjekt existieren soll. Eine Zuspitzung erfährt der Idealismus in seiner ontologischen Variante: wenn sich die Erkenntnis nur auf Ideen oder auf Vorstellungen von den Dingen richtet, dann ist anzunehmen, dass die »Außenwelt« ebenfalls wieder eine solche Vorstellung ist. Im ontologischen Idealismus wird dann einzig und allein eine geistige Wirklichkeit akzeptiert: alles in der Welt besteht aus Ideen oder ist bloße Vorstell-ung. Materielle Erscheinungen werden dann entweder geleugnet oder als sekundär angesehen, als Entfaltung eines geistigen Gehalts (vgl. Kutschera 1982, 213 ff.).
Als Begründer des Idealismus gilt Platon, für den die Wirklichkeit nicht die materielle Realität darstellt, sondern die unveränderlichen, ewig währenden Urbilder oder Ideen. Diese machen das eigentliche Wesen der Dinge aus und ermöglichen deren Existenz in der realen Welt. Nach Platon sind diese Ideen raumzeitlichen Veränderungen enthoben: sie sind transzendent und existieren unabhängig davon, ob sie in der Welt eine Manifestation erfahren oder nicht. Dem-nach seien alle Gegenstände der erfahrbaren Welt bloß Erscheinungen, denen je eine be-stimmte Idee zugrunde liegt.[20] Die Erscheinungswelt kann dann zwar vom Menschen sinnlich wahrgenommen werden, ist aber nicht das eigentliche Objekt der Erkenntnis. Vielmehr habe der Mensch kraft seines Verstandes die allen Erscheinungen zugrundeliegenden Ideen zu ent-decken, er muss sich von diesen lediglich einen Begriff machen.[21] Platon unterscheidet aus diesem Grund mehrere Erkenntnisstufen: sofern die Erkenntnis auf die sinnlich erfahrbare Welt gerichtet ist, hat sie es nicht mit den Ideen zu tun und bleibt deshalb subjektive Meinung (doxa), aus der sich kein objektives Wissen gewinnen lässt. Die höchste Form des Erkennens ist nach Platon die philosophische Wissenschaft (episteme), denn sie hat es mit den Ideen – als dem wahrhaft Seienden hinter den materiellen Erscheinungen – zu tun. Wissenschaftliches Erkennen heißt dann für Platon, dass der Mensch eine begriffliche Vorstellung von den Ideen erlangt, indem er sich von diesen eine gedankliche Repräsentation anfertigt. Die höchste Wahr-heit bestehe deshalb in der Identität von Denken und Sein, in der Einsicht in das Wesen der Dinge. Dies könne jedoch nicht allein mit Hilfe des Verstandes gelingen, sondern es bedarf darüber hinaus der Intuition, in der Denken und Sein miteinander verschmelzen. Die Intuition erkennt in diesem Moment das eigentliche Wesen der Dinge. Während also in der sinnlichen Wahrnehmung die Differenz von Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt erhalten bleibt, wird diese in der Intuition aufgehoben: das erkennende Subjekt dringt bis zu der Idee vor. Wissen-schaftliches Erkennen müsse deshalb losgelöst von der sinnlichen Wahrnehmung betrieben werden. Sie ist dann hauptsächlich reine Verstandestätigkeit, weshalb nur wenige Menschen imstande seien, sich dem wahren Ziel aller Erkenntnis zu nähern (vgl. Wenturis 1992, S. 14 ff).
2.4. Subjektiver Idealismus: Das apriorische Erkenntnisvermögen des Subjekts
In Platons Erkenntnistheorie paart sich ein erkenntnistheoretischer Idealismus mit einem ontologischen Idealismus. Das ist aber nicht allgemein der Fall: Man kann auch ein erkenntnis-theoretischer Idealist sein und dabei die Existenz einer objektiven Realität voraussetzen. Der bekannteste Vertreter dieser Kombination ist Kant, der versucht, die Einseitigkeiten des Empirismus zu überwinden und den metaphysischen Spekulationen des Rationalismus eine Absage zu erteilen.[22] An der traditionellen Erkenntnistheorie kritisiert Kant, dass diese das Subjekt-Objekt-Verhältnis stets einseitig gedacht hatte. Entweder wurde das Erkennen aus-schließlich vom Objekt her gedacht, indem die Gegenstände der Außenwelt auf das Subjekt einwirken und in diesem dann Vorstellungen von der Welt (begriffliche Repräsentationen) er-zeugen. Oder aber es wurde das Erkennen ausschließlich vom Bewusstsein her gedacht, näm-lich als gedankliches Produkt eines sich die Welt vorstellenden Subjekts. Der Clou bei Kant ist nun, Empirismus (Erfahrungswissen) und Rationalismus (Vernunftwissen) so miteinander zu verbinden, dass dabei das Subjekt weder zu einer Projektionsfläche der außenweltlichen Realität noch zu einem Empfänger transzendenter oder göttlicher Ideen gemacht wird. Die Verbindung von Empirismus und Rationalismus kommt dann bei Kant darin zum Ausdruck, dass für ihn die Erkenntnis zwar an die Erfahrung gebunden ist, ihre Gültigkeit jedoch nur aus den apriorischen Erkenntnisbedingungen bezieht, letztlich also ihre Fundierung wieder im Subjekt hat.[23]
Entgegen der Tradition behauptet Kant, dass der Erkenntnisprozess eine Synthese aus beidem sei, aus Erfahrung und Verstandestätigkeit. Kant wendet sich damit gegen die rationalistische Auffassung, es könne eine von aller Erfahrung losgelöste Erkenntnis geben, wie dies etwa Platon für möglich gehalten hatte. Nach Kant ist neben der reinen Verstandestätigkeit immer auch die Erfahrung als Quelle der Erkenntnis beteiligt.[24] Die Kritik Kants richtet sich aber auch gegen den naiven Empirismus, der glaubt, es in der Erkenntnis mit den Dingen »an sich« zu tun zu haben. Nach Kant bekommt das Subjekt die Dinge niemals zu Gesicht, wie sie an sich sind, sondern hat es stattdessen mit Vorstellungen von den Dingen zu tun. Die Vorstellungs-inhalte des Subjekts kommen jedoch nicht schon allein dadurch zustande, dass die Objekte der Außenwelt auf die Sinne einwirken und dann – gewissermaßen passiv abbildend – eine interne Repräsentation erzeugen, sondern sie entstehen nach Kant dadurch, dass der Verstand mit Hilfe einer apriorisch gegebenen Begrifflichkeit Ordnung in die Mannigfaltigkeit der Sinnes-eindrücke bringt. Erst in dieser Synthese sei schließlich Erkenntnis möglich: die Sinnesein-drücke werden durch den Verstand kategorial geordnet, strukturiert und somit zu Erfahrungen eines sich selbst bewussten Subjekts.
Obwohl die Erkenntnistheorie Kants einen ontologischen Realismus zur Voraussetzung hat, ist sie doch keine Abbild- oder Repräsentationstheorie.[25] Die Gegenstände der Außenwelt wirken zwar auf den Menschen ein und lösen in ihm bestimmte Vorstellungen aus, aber dabei handelt es sich nicht um gedankliche Zuordnungen: die Erkenntnis liefert kein Abbild der Realität im menschlichen Bewusstsein. Aufgabe des Verstandes ist es nicht, die Realität widerzuspiegeln, sondern dieser erzeugt lediglich die Regelmäßigkeit und Strukturiertheit unserer Erfahrungen. Kant wendet sich damit gegen die Vorstellung, dass von den Denkgesetzmäßigkeiten eines Be-wusstseins auf analoge Gesetzmäßigkeiten in der Welt geschlossen werden kann. Die mentale Zeichenwelt des Erkenntnissubjekts dürfe nicht als gedankliche Zuordnung zu externen Sach-verhalten missverstanden werden. Um nämlich von Zuordnungen zu sprechen, müsste das Subjekt ja zunächst einmal einen direkten Zugang zur Realität haben, um dann eine Relation zwischen Realobjekt und Erkenntnisobjekt feststellen zu können. Nach der idealistischen Auf-fassung ist dies aber unmöglich, da das Subjekt nur im Besitz mentaler Vorstellungen ist und allenfalls über das Funktionieren seiner Vorstellungen etwas aussagen kann, nicht aber über die Realität an sich (vgl. Kutschera 1982, S. 189 ff.).
Nach Kant bleibt also die Realität dem erkennenden Subjekt verschlossen: die Erkenntnis hat es mit Vorstellungen von den Dingen, niemals aber mit den Dingen an sich zu tun. Durch den Rückgang auf das Subjekt, auf das Ich-Bewusstsein als sicherer Ausgangspunkt der Erkenntnis entsteht aber das Problem, wie sich subjektübergreifendes Wissen rechtfertigen lässt. Wie kann ich sicher sein, dass meine Vorstellungen nicht nur Einbildung sind, sondern auch für andere Menschen Gültigkeit besitzen? Wie kann ich wissen, dass bestimmte Erfahrungen meinerseits in der gleichen Weise auch von anderen Menschen gemacht werden, etwa die Erfahrung, dass alle Ereignisse in der Welt eine raumzeitliche Dimension haben? Wenn das Subjekt lediglich im Besitz gedanklicher Vorstellungen ist, muss man dann nicht annehmen, dass die außenwelt-liche Realität nur eine Illusion, eine reine Vorstellung des Denkens ist?[26]
Da Kant keine Abbildtheorie vertritt, braucht er auch nichts über die Gesetzmäßigkeiten in der Realität aussagen. Sein Interesse gilt vielmehr den Gesetzmäßigkeiten, die dem menschlichen Erkennen innewohnen – diese können nach Kant durch reflexives Nachdenken aufgespürt und einer näheren Untersuchung zugänglich gemacht werden. Das Wissen um die Bedingungen und Grenzen menschlichen Erkennens könne dann einwandfrei die Frage beantworten, wann eine Erkenntnis im strengen Sinne als wissenschaftlich anzusehen ist.[27] Die Besonderheit der Transzendentalphilosophie besteht darin, dass Erkenntnis nicht mehr mit der Relation von Subjekt und Objekt erklärt wird, sondern mit der Strukturgleichheit des menschlichen Erkennt-nisvermögens: alle Erfahrung unterliegt den Bedingungen einer transzendentalen Struktur, die sich den Sinneseindrücken aufprägt, somit Ordnung in das Denken bringt und letztlich die Ein-heit des Erkennens sicherstellen soll.[28] Kants Theorie zufolge müssten sich alle Erfahrungen in einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang einordnen lassen, da dieser von der transzendentalen Hintergrundstruktur notwendig bereitgestellt wird. Da alles Erkennen an diese Formen gebun-den ist, sei empirisches Wissen nicht etwas subjektives, sondern könne apriorische Gültigkeit beanspruchen. Kant glaubt damit an eine dem Menschen fest vorgegebene und seinem gestalt-enden Einfluss entzogene Begrifflichkeit, aus der heraus allgemeingültiges Erfahrungswissen möglich sein soll (vgl. Stachowiak 1989, S. 64).
Kant verlagert also die Möglichkeit objektiver Erkenntnis von einer unerkannt bleibenden Realität in die transzendentalen Bedingungen der Erfahrbarkeit. Die Gültigkeit wissenschaft-licher Aussagen hat ihre Verankerung dann nicht mehr in der Realität, sondern in den allen Menschen gleichen Erkenntnisformen: diese sollen sicherstellen, dass wissenschaftliche Aus-sagen zwar erfahrungsbezogen, aber dennoch notwendig richtig sind. Wichtig ist, dass nach Kant die Hintergrundstruktur des Denkens nicht der Erfahrung entstammt, sondern dieser vor-geordnet ist. Die Zuverlässigkeit des Wissens sei damit durch die unbedingte Gültigkeit der Kategorien gewährleistet, nicht aber durch den Bezug auf eine erfahrbare Realität (vgl. Roth 1998, S. 340 f.).
2.5. Zusammenfassung
Seit ihren Anfängen hat die westliche Philosophie das Problem, dass sie nach einem festen Fundament der Erkenntnis sucht und dieses dann entweder in der Realität selbst oder im erkennenden Subjekt zu finden glaubt. Die Erkenntnistheorie hat dann zu klären, wie aufgrund der Differenz von Erkenntnisobjekt und Erkenntnissubjekt allgemeingültiges Wissen möglich ist, wie also ein Wissen begründet werden kann, das bewusstseinsunabhängige Gegebenheiten zum Ausdruck bringt. Der Realismus glaubt an die Möglichkeit objektiven Wissens, weil dem Erkennen eine objektive Realität zugrunde liegen soll, von der angenommen wird, dass man sie auf Sprache abbilden kann, so dass schließlich die Sätze in unserer Sprache Sachverhalte aus der Realität widerspiegeln: die Welt soll möglichst passiv erfahren und dann in sprachliche Beschreibungen (Beobachtungssätze) überführt werden. Theoretische Vorannahmen sollen dann nach Möglichkeit nicht in die wissenschaftliche Beobachtung einfließen, da diese den Blick auf die Realität verstellen und in eine bestimmte Richtung lenken würden, so dass sich also kein objektives Wissen gewinnen lässt. Das Bewusstsein soll sich einzig und allein aus der erfahrbaren Realität einspeisen, es hat dann keinen von der Realität unabhängigen Erkenntnis-inhalt, sondern ist letztlich immer Widerspiegelung der objektiven Realität. Als Wahrheits- und Bestätigungskriterium der Erkenntnis gilt deshalb nur wieder die Konfrontation mit der er-fahrbaren Realität.[29]
Der Idealismus glaubt an die Möglichkeit objektiver Erkenntnis, weil alles Wirkliche dieser Welt auf objektive Ideen zurückgeführt wird. Die Existenz einer gegenständlichen Welt wird durchaus zugestanden, jedoch nur als Realisierungsform der objektiven Ideen. Die Welt, so wird angenommen, könne dann durch klares und vernünftiges Denken in ihren Grundzügen erfasst werden, da sie eine intelligible Struktur aufweist, die sich dem Verstand offenbart und in sprachliche Beschreibungen überführt werden kann. Eine spezifische Form des Idealismus findet sich schließlich bei Kant, der nicht an einen objektiven Ideenhimmel glaubt, sondern stattdessen die Existenz einer Realität voraussetzt, die für ihn aber unerkannt bleibt. Damit ent-steht dann folgendes Problem: wenn die Erkennbarkeit der Realität bezweifelt wird, dann kann unter Umständen nicht einmal deren Existenz behauptet werden. Die Konsequenz wäre also ein Solipsismus, nach dem die Vorstellung einer von der Erkenntnis unabhängig existierenden Realität nur wieder eine weitere Vorstellung ist. Man verliert dann jede äußere Grundlage, jedes Fundament, auf dem sich objektiv gültiges Wissen gründen lässt. Um dies zu vermeiden, baut Kant in seine Theorie apriorische Erkenntnisbedingungen ein, um auf diese Weise eine nichtkontingente Grundlage für unsere Welterkenntnis benennen zu können (vgl. Valera/ Thompson 1992, S. 192). Obwohl Kant also die Erkennbarkeit der Realität bezweifelt, hält er dennoch an der Möglichkeit objektiver Erkenntnis fest. Auf die Frage, warum die Wirklichkeit in bestimmter Hinsicht allen Subjekten gleich erscheint – und in diesem Sinne eine objektive Struktur aufweist –, antwortet Kant mit einem transzendentalen Argument: die im Subjekt an-gelegten Erkenntnisbedingungen sind zugleich die Möglichkeit ihrer objektiven Geltung. Nach Kant sind diese Bedingungen aller Erfahrung vorgeordnet und damit sozialen und historischen Einflüssen enthoben. Das transzendentale Argument ist somit eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis von Freiheit und Autonomie vernünftig handelnder Subjekte, das für das moralische und rechtliche Selbstverständnis der modernen Gesellschaft grundlegend geworden ist. Denn da nach Kant die Grundsätze moralischen und rechtlichen Handelns weder von Gott vorgegeben sind noch empirisch ermittelt werden können, bedürfen sie einer transzendentalen Grundlegung, die jedoch nur durch reflexives Nachdenken erreicht werden könne (vgl. Mohr/ Willaschek 1998). Die Erkenntnistheorie Kants hat also ethische Implikationen, denn »wenn das transzendentale Universalsubjekt allen empirischen Subjekten zugrunde liegt, müsste deren Denken einem und demselben Muster folgen« (Zima 2000, S. 330).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Das Subjekt-Objekt-Verhältnis und die Frage, wie sich subjektübergreifende Erkenntnis rechtfertigen lässt. Der Realismus begreift Erkenntnis als Repräsentation einer realen Außenwelt. Das Wissen speist sich aus der erfahrbaren Realität ein und kann auch nur wieder an dieser überprüft (und gegebenenfalls: korrigiert) werden. Im Idealismus wird die Gültigkeit unserer Vorstellungen mit Gott oder einer universellen Vernunft begründet. Eine Ausnahme bildet Kant, der zwar eine objektive Realität voraussetzt, deren Erkennbarkeit aber bezweifelt. Die Begründung für allgemeingültiges Wissen wird dann verlagert von einer Ontologie hin zu den transzendentalen Bedingungen des Erkennens.
Allen hier genannten Positionen ist gemeinsam, dass sie objektives Wissen grundsätzlich für möglich halten, es unterscheidet sich lediglich die Form der Begründung. Im Realismus ist es die objektive Realität, die sich der Erkenntnis mitteilt, im Idealismus Platons sind es die von der Welt abgekoppelten, objektiven Ideen, die der menschlichen Vernunft zugänglich sind. Im subjektiven Idealismus Kants ist es die apriorisch gegebene (transzendentale) Struktur des menschlichen Erkenntnisvermögens, die als Bedingung der Möglichkeit subjektübergreifender Erkenntnis in Anspruch genommen wird. Die Erkenntnis wird dann nicht durch ein objektives Weltsein, sondern stattdessen durch objektive Erkenntnisbedingungen fundiert:
Bei Kant entfällt damit eine Komponente des platonischen Erkenntnisideals, dass Erkenntnis immer Erkenntnis einer Wirklichkeit an sich ist, während er die andere Komponente dieses Ideals beibehält: die Notwendigkeit des Erkannten. Er hält im Sinne der idealistischen Tradition am subjektiven Faktor des platonischen Ideals fest, dem Modus der Sicher-heit, der Unfehlbarkeit, und streicht den objektiven Faktor: die Wirklichkeitserkenntnis.[30]
Obwohl also Kant die Erkennbarkeit der Realität aufgibt, hält er an der Möglichkeit objektiv gültiger Urteile fest. Das ganze Gebäude seiner Theorie stützt sich dann auf das Argument, das Subjekt verfüge über apriorische oder ursprünglich gegebene Kategorien. Anderenfalls, so die Befürchtung, gäbe es nur noch einen Relativismus an Meinungen und führe dann letztlich alles in Beliebigkeit: »Diese Angst entspricht einem Dilemma: Entweder unsere Erkenntnis hat eine feste, stabile Grundlage und einen ruhenden Ausgangspunkt, oder wir geraten in Dunkelheit, Chaos und Verwirrung. Kurz, sofern es keine absolute Basis gibt, bricht alles auseinander« (Valera/Thompson 1992, S. 197). Der Gegenspieler ist dann die skeptische Position, die im Erkennen weder eine Annäherung von Denken und Sein sieht noch an apriorisch gegebene Kategorien im Erkenntnissubjekt glaubt. Keine Erkenntnis, so der Skeptiker, könne sich auf der sicheren Grundlage der Sinneswahrnehmung oder auf das rein begriffliche Denken oder auf transzendentale Begründungsaprioris stützen. Was also ist die Alternative? Ist also alles Er-kennen subjektiv? Gibt es keine objektiv gültigen Maßstäbe mehr, an denen sich die Menschen orientieren und danach ihr Handeln ausrichten können? Die nachfolgenden Kapitel werden sich weiterhin mit diesen Fragen beschäftigen.
3. Das Subjekt als Gegenstand der Kognitionswissenschaften
3.1. Kognitionswissenschaft als Wissenschaft vom Intentionalen
Die Kognitionswissenschaft ist keine eigenständige Forschungsdisziplin, sondern setzt sich aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen wie Neurobiologie, Psychologie, Philosophie, Linguistik, Informatik, Anthropologie, Mathematik, Physik, Kybernetik und Systemtheorie zusammen:
Gemeinsames Ziel der Kognitionswissenschaften ist die Beschreibung und Erklärung kognitiver Prozesse in natürlichen und künstlichen Systemen. Forschungsleitend ist dabei die Perspektive, dass es sich bei kognitiven Prozessen um solche der Informationsverarbeitung handelt.[31]
Es gibt innerhalb der Kognitionswissenschaften keine verbindliche oder allgemein akzeptierte Definition von dem, was unter Kognition zu verstehen ist. Der Begriff wird jedoch häufig im Sinne von »kategorialer Wahrnehmung«, »Denken«, »Repräsentation« und »Intentionalität« gebraucht. Emotionale oder soziale Aspekte von Kognition bleiben meist unberücksichtigt, was daran liegt, dass Kognition im Sinne der oben genannten Definition hauptsächlich als »Informationsverarbeitung« aufgefasst wird und bewusst auf »informationsverarbeitende« Systeme beschränkt bleibt (vgl. Roth 1998, S. 26). Die Kognitionswissenschaft konzentriert sich dann vor allem auf solche Zusammenhänge, die mit intelligentem Verhalten zu tun haben. Man nimmt an, dass kognitive Systeme einen intentionalen Gehalt haben: sie repräsentieren und beabsichtigen etwas und verhalten sich zielgerichtet.[32] Und schließlich erhofft man sich durch die Ergebnisse der Kognitionswissenschaften auch neue Einsichten in die Denk- und Verhaltensweise des Menschen.[33]
Im derzeit vorherrschenden Paradigma wird angenommen, dass kognitive Systeme die Realität in bestimmten Merkmalen erfolgreich repräsentieren müssen, wenn sie überleben, handeln und sich kommunikativ mitteilen wollen. Dies hat man sich dann in etwa folgendermaßen vorzu-stellen: die Realität wirkt auf das System ein und ruft aufgrund sensorischer Umwandlungs- und interner Verarbeitungsprozesse symbolische Repräsentationen im System hervor. Diese wiederum generieren das Verhalten des Systems, und Verhaltenskoordination mehrerer solcher Systeme macht schließlich Gesellschaft aus – kurz: ohne Realität keine Repräsentation, ohne Repräsentation kein Verhalten, ohne Verhalten keine Gesellschaft. Dieses Verständnis der Kognition geht von einer Input-Output-Beziehung von Welt und erkennendem Subjekt aus. Es wird angenommen, dass die im System erzeugten Repräsentationen – die man in neuronalen Konfigurationen vermutet – auf die außenweltliche Realität verweisen, also eine ontologische Entsprechung außerhalb des Bewusstseins haben. Wahrnehmung wäre dann eine Relation von externen Objekten und deren internen Repräsentationen.
3.2. Kognitivismus: Kognition als Symbolverarbeitung und Repräsentation
Das Entstehen der Kognitionswissenschaften in den vierziger und fünfziger Jahren war zum einen stark durch die Ineffizienz des behavioristischen Ansatzes motiviert, zum anderen durch das Aufkommen kybernetischer und informationstheoretischer Ansätze, die eine neue Klasse von Modellen und eine neue Metaphorik für die Behandlung kognitiver Prozesse be-reitstellten. In Abkehr von der unterkomplexen Methodologie und mangelnden Erklärungskraft des Behaviorismus wurden für die Beschreibung und Erklärung kognitiver Prozesse nunmehr auch die internen Zustände eines Systems berücksichtigt, denn diese wurden zunehmend von Bedeutung für die Modellierung kognitiver Prozesse (vgl. Engel/König 1998, S. 157f.). In der Folge kam es zu einem Aufschwung des Kognitivismus, bei dem man versuchte, das Modell der Informationsverarbeitung im computertechnischen Sinne auch auf den Menschen zu über-tragen (vgl. Roth 1998, S. 26 ff.). Im kognitivistischen Ansatz wird dem menschlichen Gehirn dann eine eigene Verarbeitungs- und Transformationskapazität zugestanden, dennoch bleibt es bei der Vorstellung, dass es sich beim menschlichen Denken um Prozesse der Informationsver-arbeitung handelt (vgl. Baumgartner/Payr 1997, S. 90 ff.).
Die Grundüberlegung im Kognitivismus ist folgende: die Sinnesorgane wandeln die Ereignisse der Außenwelt in Systemereignisse um, und das »Nervensystem verarbeitet diese Information-en durch Aktivitäten, von denen wir annehmen, dass es ein formales Modell für sie gibt und dass man sie deshalb in einem bestimmten Sinn als Rechenoperationen beschreiben kann« (Metzinger 1998, S. 336). Man nimmt an, dass Wahrnehmung nach expliziten und formalisier-baren Regeln abläuft und wie bei einem Computer auf einer sequentiellen Durchführung von Berechnungen basiert. Demnach ist ausgeschlossen, dass Erwartungen, Gedächtnis, Vorwissen und Erfahrung an der Konstitution von Wahrnehmung beteiligt sind. Wahrnehmung heißt, dass mentale Inhalte aus aktuell gegebenen sensorischen Informationen berechnet werden, wobei die Nervenzellen die binären Schaltelemente zur Ausführung logischer Operationen sein sollen (vgl. Engel/König 1998).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Objekterkennung und Repräsentation durch Einzelzellen. Das kognitivistische Paradigma geht davon aus, dass ein gegebenes Objekt durch Sensoren auf bestimmte Merkmale – Form, Farbe, Helligkeit, Kontrast oder Bewegung – abgetastet wird (links), diese Informationen dann auf immer höheren Verarbeitungsstufen zu einem komplexen Muster verbunden werden (Mitte), bis schließlich das Objekt durch eine entsprechende »semantische« Zelle detektiert und auf diese Weise symbolisch repräsentiert wird (Quelle: Engel/König 1998, S. 162, von mir verändert).
Aus der Tatsache, dass die Nervenzellen in den Sinnesorganen eine spezifische innere Struktur aufweisen, hatte man den Schluss gezogen, dass einige Neuronen möglicherweise als Merk-malsrezeptoren – für Form, Farbe oder Bewegung – in Frage kommen, und dass auf diese Weise die Objekte der Außenwelt im Gehirn eine neuronale Repräsentation erhalten. Es wurde dann davon ausgegangen, dass die sensorischen Informationen aufwärtsgerichtet verarbeitet werden und auf immer höheren Verarbeitungsebenen schließlich zu einer umfassenden Objekt-erkennung führen. Die Umwelt, so wird im Kognitivismus angenommen, würde zunächst in ihren Einzelheiten sensorisch abgetastet und dann im System eine symbolische Repräsentation erhalten:
Nach dieser Hypothese sollten nicht nur elementare Merkmale wie Farbe, Orientierung oder Objektbewegung durch die Aktivität einzelner Neurone kodiert werden, sondern auch komplexe Objekte, wie etwa die Buche im Vorgarten, der neue Sportwagen des Nachbarn oder die eigene Großmutter.[34]
Das Modell einer aufwärts gerichteten Merkmalsverarbeitung (»bottom-up-Modell«) mit an-schließender Objektrepräsentation hat weitreichende Implikationen, denn es setzt im Gehirn vorab existierende Regelstrukturen und Verarbeitungsmechanismen voraus. Demnach wird ein Gegenstand dadurch erkannt, dass zunächst bestimmte Einzelmerkmale (Form, Farbe oder Be-wegung) mit einem Gestaltrepertoire im Gedächtnis verglichen und diesen dann eine neuronale Repräsentation zugewiesen wird, was bedeuten würde, dass das Gehirn über ein angeborenes Kategoriensystem verfügen muss. Diese Vorstellung eines modularen Aufbaus des Gehirns hat vor allem in der Linguistik und in anderen nichtneurobiologischen Kognitionswissenschaften einen großen Einfluss ausgeübt und tut dies auch immer noch (vgl. Roth 1998, S. 192 f.).
3.3. Konnektionismus: Kognition als Selbstorganisation und Repräsentation
Der Kognitivismus hatte eine ganz bestimmte Schwierigkeit: in kognitiven Systemen wurde eine vorab implementierte Regel- und Symbolstruktur vorausgesetzt, weshalb es diesem Ansatz vor allem an biologischer Plausibilität mangelte. Erst allmählich wurde klar, dass das Konzept der computertechnischen Symbolverarbeitung nicht ohne weiteres auf den Menschen übertragbar war. In der Folgezeit setzte sich der konnektionistische Ansatz durch, bei dem Informationsverarbeitungsprozesse nicht mehr nach expliziten Regeln ablaufen, sondern viel-mehr auf Prozessen der Selbstorganisation beruhen:
Über Jahrzehnte waren die Kognitionswissenschaften dominiert von der Annahme, dass kognitive Prozesse als algorith-mische Rechenoperationen verstanden werden könnten, die formalisierbaren Regeln folgen und mit propositional organisiertem Wissen über die Welt arbeiten. In jüngster Zeit ist jedoch eine Abkehr von diesem Dogma zu verzeich-nen. Zunehmend setzt sich die Ansicht durch, dass kognitive Funktionen wie Wahrnehmung, Gedächtnis, Denken oder Sprache auf komplexen Interaktionen in neuronalen Netzen mit einer hochgradig distribuierten und parallelen Architek-tur beruhen, die – im Gegensatz zu herkömmlichen informationsverarbeitenden Systemen – durch Lernvorgänge und aktivitätsabhängige Plastizität geprägt ist. Charakteristisch für solche Netze ist ferner, dass die Informationsverarbeitung nicht auf expliziten Regeln, sondern auf Selbstorganisationsprozessen in neuronalen Aktivitätsmustern beruht.[35]
Die theoretische Umorientierung im Konnektionismus findet vor allem dahingehend statt, dass neuronale Verarbeitungsprozesse nicht mehr länger als sequentielle Rechenschritte, sondern als hochgradig interaktive Operationen aufgefasst werden, die in funktionaler Hinsicht parallel und in zeitlicher Hinsicht simultan ablaufen. Informationen werden dann nicht mehr einfach in bestimmten Nervenzellen gespeichert, sondern sind über das gesamte neuronale Netzwerk hin-weg durch Aktivitätsverteilungen codiert.[36] Für die Repräsentation von Objektmerkmalen sind vor allem zeitkritische Aspekte (Synchronizität aktiver Neuronen) ausschlaggebend, weshalb einzelne Neuronen an Bedeutung verlieren und raumzeitliche Aktivitäten in den Vordergrund treten. Zudem wird auf die klassische Unterscheidung von Inhalt und Operation verzichtet und durch eine Architektur ersetzt, in der laufende Operationen als Merkmale der Daten gespeich-ert sind. Damit wird explizit anerkannt, dass Inhalte nicht von ihren Operation zu trennen sind. Denn hatte man im Kognitivismus noch angenommen, dass Informationsverarbeitung dadurch zustande kommt, dass bestimmte formale Operationen (Algorithmen) auf gegebene Inhalte (Daten) angewendet werden – und zwar derart, dass der Zusammenhang zwischen Daten und Algorithmen im Prinzip beliebig ist –, so wird diese Auffassung heute durch Befunde infrage gestellt, die die Inhaltsspezifität kognitiver Operationen belegen und somit Funktionsarchi-tekturen nahe legen, in denen Inhalte und operative Prozesse nicht mehr voneinander getrennt sind (vgl. Prinz/Strube 1997, S. 147 ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Vergleich zwischen Kognitivismus und Konnektionismus.
Insgesamt gibt es also eine Reihe konzeptueller Veränderungen, die sich wie folgt zusammen-fassen lassen: Objektmerkmale wie Form, Farbe oder Bewegung werden im Konnektionismus funktional getrennt bearbeitet durch spezialisierte Areale, die untereinander reziprok in Ver-bindung stehen; die Folge ist dann eine komplexe Netzwerkarchitektur mit einer hochgradigen Arbeitsteilung. Sowohl die Struktur des neuronalen Netzwerkes als auch dessen topologische Veränderungen im ausgereiften Zustand werden nicht mehr als genetisch fixiert angesehen, sondern sind Resultat der Selbstorganisation dieser Netzwerke.[37] Objektmerkmale erhalten dann keine lokale Repräsentation in einzelnen Nervenzellen, sondern sind zeitlich durch einen Verbund synchron aktiver Neuronen (»assemblies«) codiert. Kognition basiert also nicht auf regelgeleiteten Operation, sondern auf Prozessen der Selbstorganisation, in deren Verlauf raumzeitliche Muster etabliert werden, die eine dynamische Repräsentation des Verrechnungs-ergebnisses darstellen.[38] Die Struktur dieser Muster wird bestimmt durch die Topologie dieser Netzwerke sowie durch die Systemgeschichte, in deren Verlauf durch Lernvorgänge adaptive strukturelle Veränderungen herbeigeführt wurden (vgl. Engel/König 1998, S. 163ff.). Mit dem konnektionistischen Ansatz wird zudem besser verständlich, warum viele Menschen über ein implizites Wissen verfügen, über das sie nicht bewusst sprechen können. Darüber hinaus hat der Konnektionismus zu einer Erweiterung des Intelligenzbegriffs geführt,[39] und inzwischen ist es auch möglich geworden, eine Analogie zwischen neuronalen Netzen und kommunikativen Netzwerken (sozialen Systemen) herzustellen, wenngleich diese Analogie noch nicht mit der nötigen begrifflichen Präzisierung ausgearbeitet und empirisch verankert worden ist (vgl. Metzinger 1998, S. 342 ff.).
3.4. Zur Kritik an repräsentationalistischen Ansätzen der Kognition
Obwohl sich die genannten Ansätze im Detail erheblich unterscheiden, teilen sie doch gemeinsame Grundannahmen. Beide Ansätze implizieren eine realistische Ontologie und beide werden zentral von dem Gedanken der Repräsentation beherrscht. Sowohl im Kognitivismus als auch im neueren Konnektionismus wird angenommen, der Mensch verfüge über interne Repräsentationen (Zeichen, Modelle, Kategorien, Bilder, Vorstellungen), die außerhalb des Bewusstseins eine ontologische Entsprechung haben. Dieser Vorstellung liegt die klassische Subjekt-Objekt-Unterscheidung zugrunde, dergemäß das Erkennen die Beziehung von erkenn-endem Subjekt (Repräsentation) und erkanntem Objekt (Original) darstellt. Das Kognitions-system nimmt die Welt lediglich zur Kenntnis, und sein Verhalten wird aus dieser Sicht zur bloßen Adaption an eine vorfindliche Umwelt:
Aufgabe der Wahrnehmung ist es dann, diese vorgegebenen Strukturen der Welt zu rekonstruieren. Es wird ange-nommen, dass durch die Berechnung von Objektrepräsentationen eine ›Kopie‹, ein inneres Modell der Welt entsteht, das dann als Datenbasis für die Verhaltenserzeugung zur Verfügung steht.[40]
Das Repräsentationsparadigma geht also von der Annahme aus, dass die Welt aus isolierbaren, beobachterunabhängigen, kontextinvarianten Objekten besteht. Wahrnehmung wird deshalb weitestgehend auf Objekterkennung und Objektrepräsentation reduziert und das »richtige« Klassifizieren und die »richtige« Rekonstruktion zum Kriterium für erfolgreiche Kognition ge-macht (vgl. Engel/König, 1998, S. 177). Wissen wäre dann nichts anderes als das Ergebnis eines adäquaten Informationsverarbeitungsprozesses: Man »geht davon aus, dass das Problem objektiv gegeben ist, repräsentiert werden kann und bloß noch einer Lösung harrt« (Baum-gartner/Payr 1997, S. 92).
In jüngster Zeit finden jedoch theoretische Neuorientierungen statt, die am besten unter dem Begriff der dynamisch-systemtheoretischen Kognitionswissenschaft zusammengefasst werden können. Dieser Ansatz stellt eine Alternative zum klassischen Repräsentationsparadigma dar, und unter Einbeziehung der Theorie nichtlinearer Systeme (»Chaostheorie«) ist inzwischen auch eine mathematische Modellierung kognitiver Prozesse möglich geworden.[41] Innerhalb des systemtheoretischen Ansatzes wandelt sich der Repräsentationsbegriff in seiner Bedeutung so stark, dass er außer dem gemeinsamen Wortlaut kaum noch etwas mit dem klassischen Be-griff der Repräsentation gemeinsam hat. Anstelle der Extern-Intern-Relation zwischen Welt und erkennendem Subjekt wird auf Selbstreferenz abgestellt, und Repräsentation meint dann: das System arbeitet mit selbsterzeugten Invarianten, anhand derer es seine Umwelt entwirft (»inszeniert«), um in dieser dann erfolgreich operieren zu können. Es handelt sich dabei also um »Repräsentationen ohne Repräsentation«, denn die Invarianten haben keine ontologische Entsprechung, sie spiegeln keine objektive Realität wider. Die Repräsentationen haben dann nicht die Eigenschaften von mengentheoretischen Kategorien, bei denen die Zugehörigkeit durch notwendige und hinreichende Bedingungen definiert wird: »Kategorien sind vielmehr dynamische Ganzheiten, die diffus und instabil in einer Weise sind, die unter den gegebenen Bedingungen der sozialen und kulturellen Umgebung angemessen sind« (Haken/Haken-Krell 1997, S. 235). Repräsentation und semantischer Gehalt sind dann auch nichts statisches mehr: »Die Entstehung des intentionalen Gehalts mentaler Repräsentationen ist nämlich im Rahmen der Systemtheorie ein sehr kurzer, vorübergehender Vorgang, bei dem Systemdynamik und Weltdynamik interagieren« (Metzinger 1998, S. 348).
Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Ergebnisse der Kognitionswissenschaften eine fundamentale Bedeutung haben für das Selbstverständnis des Menschen im allgemeinen sowie für die Entscheidungstheorie und die Theorie der Rationalität im besonderen. Wenn nämlich der Repräsentationsgedanke aufgegeben werden muss, weil es kein apriorisches Kategorien-system und »keinen Bereich der kognitiven Sphäre gibt, der nach dem Muster des logischen Schließens modelliert werden kann, dann entsteht eine neue Variante des Sollen-Können-Problems: Es wird schwer, die Logik noch als normative Theorie der Rationalität aufzufassen« (Metzinger 1998, S. 346). Es müssten dann völlig neue Überlegungen angestellt werden, was genau eigentlich damit gemeint gewesen ist, wenn bislang immer von Rationalität die Rede war. Denn wenn das Gehirn über keine angeboren Kategorien verfügt und sich deshalb auch keine diskreten Repräsentationen finden lassen, dann kann mit Rationalität jedenfalls nicht die Kohärenz zwischen Gedanken und Überzeugungen gemeint gewesen sein (vgl. Metzinger 1998, S. 346).
3.5. Zusammenfassung
Wie diese kurze Einführung zeigt, ist das Subjekt-Objekt-Schema aus der Philosophie auch in die Kognitionswissenschaft transportiert worden und spielt der Repräsentationsbegriff seitdem eine unübersehbar große Rolle. Dem Repräsentationsgedanken liegt die Annahme zu-grunde, dass erkennende Systeme einer vorfindlichen Welt gegenüberstehen und Kognition sich darin erschöpft, den außenweltlichen Objekten eine innere Repräsentation zuzuweisen. Umgekehrt, so die Überlegung, könne von den Repräsentationen dann wieder auf die Realität geschlossen werden. Das Repräsentationsparadigma findet sich sowohl im Kognitivismus als auch im Konnektionismus, der Unterschied zwischen beiden Ansätzen besteht lediglich in der Art und Weise, wie sich das Repräsentieren im einzelnen vorgestellt wird. Im Kognitivismus wird hierfür eine explizite Symbolstruktur – vergleichbar mit der eines Computers – vorausge-setzt, und man nimmt an, dass die Realobjekte im Inneren auf spezifische Neuronen projiziert werden. Diese Überlegungen sind auf die Impulse der Informationstheorie zurückzuführen: man hatte die Funktionsweise eines Computers verstanden und glaubte auf diese Weise auch den Menschen verstehen zu können. Es war also nur eine logische Folge, dass die Begriffe und Konzepte aus der Informationstheorie auf den Menschen übertragen wurden. Auf diese Weise entstand dann das Bild vom Menschen als symbolverarbeitende Maschine, deren symbolisches Universum nicht die Kultur, sondern das Nervensystem und dessen syntaktische Operationen sein sollte (vgl. Metzinger 1998, S. 340 f.).
Im Konnektionismus sind es plastizitätsabhängige und globale Prozesse der Selbstorganisation, die eine über das gesamte System verteilte Repräsentation möglich machen sollen. Im Zuge dieser Entwicklung entfernt man sich jedoch mehr und mehr vom klassischen Repräsentations-begriff, bei dem noch von einer festen Zuordnung von Realobjekt und Erkenntnisobjekt ausge-gangen wurde. Man sieht nämlich heute, dass kognitive Systeme einer ontogenetischen Ent-wicklung ausgesetzt sind über keine vorgefertigten (apriorischen) Kategorien verfügen, anhand derer sie ein Objekt einordnen, klassifizieren und repräsentieren können.[42] Doch obwohl sich der konnektionistische Ansatz erheblich von seinem Vorgänger unterscheidet, stimmt er mit diesem in wichtigen Punkten überein:
In beiden Paradigmen wird angenommen, dass Wahrnehmung darin besteht, innere Abbilder von Objekten zu erzeugen und auf diese Weise die – als beobachterunabhängig betrachteten – Strukturen der Außenwelt in einem inneren ›Mo-dell‹ zu replizieren und zu speichern. Darüber hinaus ist nicht nur dem klassischen, sondern auch noch dem konnektion-istischen Paradigma eine atomistisch gefärbte Grundhaltung zu eigen, die sich einerseits in bestimmten ontologischen Annahmen äußert, andererseits aber auch zu einem methodologischem Atomismus führt. Und schließlich teilen die Ver-treter des alten und des neuen Paradigmas mehrheitlich eine strikt reduktionistische Grundauffassung, die davon aus-geht, dass die Erklärung von Wahrnehmungsvorgängen letzten Endes ausschließlich auf der neuronalen Ebene zu erfol-gen habe und dass die Neurobiologie somit über einen privilegierten Zugang zu kognitiven Prozessen verfüge.[43]
Im systemtheoretischen Ansatz wird der Repräsentationsgedanke schließlich aufgegeben und durch einen handlungsbezogenen Wahrnehmungsbegriff ersetzt. Wahrnehmung bedeutet dann nicht Abbildung oder Wiederentdeckung einer vorfindlichen Realität, sondern »Festlegung relevanter Unterscheidungen in einem ›offenen‹, nicht präfigurierten Wahrnehmungsfeld« (Engel/König 1998, S. 186). Der Mensch ist dann keine informationsverarbeitende Maschine, sondern ein »Vehikel der Welterzeugung«. Wahrnehmung ist nicht auf ontologische Entitäten gerichtet, sondern vollzieht sich in Bedeutungskontexten und Verweisungszusammenhängen, die durch das vorherige Operieren des Systems immer schon vorstrukturiert sind (»situierte Kognition«). Die Untrennbarkeit von System und Welt wird mit dem Begriff der »Situations-ontologie« zum Ausdruck gebracht: Objekte sind keine kontextinvarianten Entitäten, sondern immer nur relativ zu einer Situation individuierbar, mit der Konsequenz, dass es niemals nur eine Möglichkeit gibt, ein Objekt oder einen Sachverhalt richtig zu bezeichnen. Erfolgreiche Kognition bedeutet nicht die »korrekte« Wiedergabe ontologischer Gegebenheiten, sondern das kontextabhängige Konstruieren unter den Bedingungen selektiver Aufmerksamkeit – eine Konsequenz, die weitreichende methodische Implikationen hat.[44]
Es lässt sich also die Tendenz beobachten, dass der klassische Repräsentationsbegriff zunehm-end an Bedeutung verliert und die Kognitionswissenschaft aus dem Subjekt-Objekt-Schema auszubrechen versucht, indem sie die Dingontologie durch eine kontextabhängige Situations-ontologie ersetzt. Ein solches Verständnis von Kognition liegt auch der Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus zugrunde, der sich als Alternative zum Repräsentationskonzept versteht. Die Kernthese des Radikalen Konstruktivismus ist, dass ein kognitives System im Verlauf seiner Interaktionsgeschichte Invarianten erzeugt, die es als »Umwelt« bezeichnet. Kognitive Systeme entwerfen sich dann verschiedene Wirklichkeiten, die als systemabhängige Konstruktionen keine ontologische Entsprechung in der Umwelt des Systems haben. Aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus wird deshalb bezweifelt, dass es ein objektives Wissen geben kann, da das Erkennen nicht auf etwas objektiv Vorhandenes gerichtet ist und kognitive Systeme auch nicht über ein angeborenes Kategoriensystem verfügen. Die Frage wäre dann, wie innerhalb dieses Paradigmas Intersubjektivität gedacht werden muss. Was also sind die Gründe, dass trotz der Konstruktivität des Gehirns bestimmte Sachverhalte als objektiv er-scheinen? Wie ist es möglich, dass kognitive Systeme vergleichbare Wirklichkeitskonstruk-tionen ausbilden?
4. Das Subjekt aus der Perspektive des Radikalen Konstruktivismus
4.1. Die Theorie autopoietischer Systeme: Erkenntnis ohne Repräsentation
Die Theorie autopoietischer Systeme (Maturana 1982) ist der Versuch einer biologisch begründeten Erkenntnistheorie und stellt eine Alternative zu den klassischen Repräsentations-theorien dar, ohne auf transzendentale Begründungsfiguren zurückgreifen zu müssen. Nach Maturana sind lebende Systeme autopoietische (sich selbst herstellende und reproduzierende) Systeme, die in einem Netzwerk von zellulären Prozessen Elemente (Zellen) produzieren, die dann wiederum für die Erhaltung und Reproduktion desselben Netzwerkes in Anspruch ge-nommen werden. Diese Prozesshaftigkeit autopoietischer Systeme beschreibt Maturana wie folgt:
Die Organisation des Lebendigen ist eine zirkuläre Organisation, die die Erzeugung oder Aufrechterhaltung der Be-standteile sicherstellt, die diese zirkuläre Organisation herstellen, und zwar so, dass das Ergebnis des Funktionierens der Bestandteile eben die Organisation ist, die wiederum diese Bestandteile erzeugt.[45]
Die Besonderheit autopoietischer Systeme besteht in der Autonomie dieser Netzwerke, denn die Aktivitäten eines Netzwerkes führen nur wieder zu weiteren Aktivitäten desselben Netz-werkes: das System operiert also geschlossen. Die autopoietische Organisation ist dann darauf abgestellt, sich fortlaufend selbst (autopoietisch) am Leben zu erhalten, indem sich das Netz-werk in einem zirkulären Prozess selbst reproduziert. Zustandveränderungen im Organismus bewirken Zustandsveränderungen im Organismus, und jede Operation führt nur wieder zur Fortsetzung weiterer Operationen. Autopoiesis schließt somit Selbstreferentialität notwendig mit ein:
Die Operationen bilden einen geschlossenen Kreis, und dadurch liegen die Produkte auf derselben Ebene wie die Pro-duktionsvorgänge. Innerhalb dieser Organisation verlieren damit die gewöhnlichen Unterscheidungen zwischen Produ-zent und Produkt, zwischen Anfang und Ende oder zwischen input und output ihren Sinn.[46]
Die Autopoiesis lebender Systeme kann sich in unzähligen Strukturen verkörpern. Insofern sind autopoietische Systeme struktur veränderbare, jedoch organisations invariante Systeme. Vergleicht man also verschiedene Lebensformen, so wird man hinsichtlich des Operierens dieser Systeme keinen Unterschied feststellen können. Der Unterschied besteht lediglich im Hinblick auf die Strukturen, die je nach Lebensform ausgebildet und aktualisiert werden. Die Operationen autopoietischer Systeme und ihre Beziehungen untereinander verfolgen dabei kein bestimmtes Ziel, wie etwa bei allopoietischen Systemen, sondern dienen lediglich der Er-haltung des Systems (vgl. Köck 1993, S. 168).
Unter Aufrechterhaltung ihrer operativen Autonomie erfahren autopoietische Systeme dann strukturelle Veränderungen (Deformationen), die mit den strukturellen Veränderungen ihres Milieus übereinstimmen. Diese Strukturkopplung von Organismus und Milieu bezeichnet Maturana auch als »structural drift«. Eine Veränderung der Struktur des Milieus führt gleich-zeitig zu Veränderungen der Struktur des Organismus und umgekehrt, was bedeutet, dass die Strukturveränderungen eines Organismus mit den Strukturveränderungen seines Milieus über-einstimmen:
Wenn wir vor dem Hintergrund der Strukturkopplung zwischen Organismus und Milieu, die wir als operational unab-hängige Systeme ansehen, unser Augenmerk auf das Fortbestehen der Organismen als dynamische Systeme im Milieu richten, dann erscheint uns die Grundlage dieses Fortbestehens die strukturelle Verträglichkeit des Organismus mit dem Milieu zu sein, also das, was wir Anpassung nennen. Beobachten wir andererseits eine destruktive Interaktion zwischen einem Lebewesen und seinem Milieu, die zur Auflösung des ersteren als autopoietisch Einheit führt, dann sagen wir, es habe seine Anpassung verloren. Die Anpassung einer Einheit an ihr Milieu ist deshalb eine notwendige Folge der strukturellen Kopplung dieser Einheit mit ihrem Milieu. Mit anderen Worten: Jede Ontogenese als die individuelle Geschichte strukturellen Wandels ist ein Driften von Strukturveränderung unter Konstanthaltung der Organisation und daher unter Erhaltung der Anpassung.[47]
Lebewesen sind also angepasst, solange ihre strukturelle Dynamik aufrechterhalten bleibt. Dabei spielt es keine Rolle, wie dies geschieht, wichtig ist nur, dass es geschieht. Der Begriff der Strukturkopplung meint also nicht, dass sich ein Lebewesen an eine objektiv vorfindliche Realität anpasst. Die Theorie Maturanas geht vielmehr davon aus, dass sich Organismus und Umwelt in einem zirkulären Abhängigkeitsverhältnis befinden, bei dem die Strukturveränder-ungen von Organismus und Milieu reziprok aufeinander einwirken:
So hat zum Beispiel die Tatsache, dass die Zellen während der ersten Million Jahre nach dem Ursprung des Lebens gerade Sauerstoff und nicht irgendein anderes mögliches Gas verbreitet haben, substantielle Veränderungen in der Erd-atmosphäre bewirkt, so dass dieses Gas als Ergebnis der Geschichte heute einen wichtigen Prozentsatz der Atmosphäre ausmacht. Anderseits hat das Vorkommen von Sauerstoff in der Atmosphäre seinerseits strukturelle Variationen in vielen Stämmen von Lebewesen »selektiert« und dabei im Verlauf der Phylogenese zum Aufbau von Formen geführt, die als sauerstoffatmende Wesen leben. Die Strukturkopplung ist immer gegenseitig; beide – Organismus und Milieu – erfahren Veränderungen.[48]
Das hier beschriebene Passungsverhältnis von Organismus und Umwelt hat weitreichende Konsequenzen für das Verständnis von Evolution. Für gewöhnlich wird davon ausgegangen, dass nur solche Organismen überleben können, die mit ihrem Wahrnehmungsapparat die Realität zumindest in ihren Grundzügen korrekt wiedergeben und sich auf diese Weise an ihre Umwelt anpassen. Evolution bedeutet dann einen einseitigen Vorgang der Anpassung von Organismen an ihre Umwelt. Dies ist der Standpunkt der Evolutionären Erkenntnistheorie, die der Umwelt eine determinierende Rolle im Anpassungsprozess zuschreibt.[49] In der Theorie autopoietischer Systeme verschiebt sich dann die Kompetenz des Systems im Umgang mit der Umwelt von einer darwinistischen Anpassung zugunsten der Eigenbedingungen des Systems:
Solange es lebt, produziert bzw. reproduziert es seine eigenen Bestandteile, es organisiert sich selber und unterwirft seinen gesamten Aktions- und Interaktionsbereich notwendig dieser eigenen Organisation, es bestimmt den Raum seiner Existenz. Dieser Raum ist dann aber nicht ein ihm äußerliches Umfeld, in das es hineinagiert bei einem sonst gleich-gültigen Nebeneinander, sondern beider Existenz ist historisch und reziprok in struktureller Kopplung verflochten. Beides sind dynamische und interagierende Systeme, deren Strukturen und Komponenten sich bereits von ihren Eigen-bedingungen her in ständigem Wandel befinden.[50]
Dieses Passungsverhältnis kann mit dem Begriff der Viabilität umschrieben werden. Ein in Operation befindliches Netzwerk erzeugt solange viable Strukturveränderungen, wie es zur autopoietischen Reproduktion des Netzwerkes beiträgt. Der Begriff der Viabilität zielt dann zwar ebenfalls auf Evolution und Anpassung ab, meint aber im Gegensatz zur darwinistischen Anpassung keine positive Selektion (im Sinne einer Auswahl der bestangepassten Organis-men), sondern einen negativen Prozess der Auslese nichtviabler Strukturveränderungen:
Diese Fassung von Selektion als eines ausschließlich negativen Prozesses bedeutet eine wichtige Präzisierung der Evolutionstheorie, ohne die das Problem des Fortbestehens verschiedener morphologischer Charakteristika lebender Systeme trotz radikaler Veränderungen der Umwelt (im objektivistischen Sinne) nicht erklärt werden kann.[51]
Die Strukturkopplung von Organismus und Umwelt hat auf natürliche Art zur Folge, dass im Organismus sensomotorische Korrelationen etabliert werden, von denen einige im Verlauf der Interaktionsgeschichte invariant gehalten werden.[52] Während die sensomotorische Schleife bei einem Einzeller unmittelbar erfolgt (und als solche auch beobachtet werden kann), verfügen komplexe Lebewesen über ein zwischengeschaltes Neuronennetzwerk, das die Sensorik und die Motorik auf komplizierte Art und Weise miteinander verbindet. Der Unterschied zwischen einem Pantoffeltierchen und dem Menschen beruht dann hauptsächlich auf der Komplexität und Plastizität des Nervensystems.[53] Mit dem Zwischenschalten einer komplexen Netzwerk-architektur wird das Feld der möglichen sensomotorischen Korrelationen eines Organismus (und damit: der Verhaltensbereich) stark ausgeweitet, die Verhaltenskomplexität steigt.[54] Ge-meinsam ist also allen Lebewesen ihre autopoietische Organisation, während die Unterschiede in den Strukturen zu finden sind, die diese Systeme aktualisieren können. Und diese Strukturen sind wiederum abhängig von der Komplexität und der spezifischen Konfiguration des Nerven-systems, also von der Art und Weise, wie sensorische und motorische Neuronen miteinander verknüpft werden.[55]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Unterschied zwischen einfachen und komplexen lebenden Systemen. Das Protozoon besitzt die einfachste senso-motorische Schleife (links), da bei diesem sensorische und motorische Flächen identisch sind. Ihre Koppelung erfolgt also un-mittelbar: eine sensorische Erregung hat eine sofortige (reflexhafte) motorische Bewegung zur Folge. Die sensomotorischen Schleifen nehmen an Komplexität zu, wenn zwischen Sensorik und Motorik ein interneuronales Netzwerk (Nervensystem) zwischengeschaltet wird (rechts). Das Nervensystem ermöglicht es dem Organismus, sensorische Erregungen je nach aktueller Befindlichkeit mit unterschiedlichem Verhalten zu beantworten.
Wenn man die operationale Geschlossenheit zellulärer Netzwerke ernst nimmt, dann kann das Gehirn keinen direkten Umweltkontakt haben kann, denn Veränderungen neuronaler Aktivität haben nur wieder Veränderungen neuronaler Aktivität zu Folge. Aus der Neurobiologie ist be-kannt, dass das Gehirn für die Ereignisse in der Umwelt grundsätzlich unempfindlich ist, denn die Nervenzellen werden nur durch spezifische elektrische Signale und bestimmte chemische Moleküle erregt und in ihrer Aktivität gehemmt. Die Umweltereignisse müssen deshalb durch die Sinnesrezeptoren in die Sprache des Gehirns umgewandelt werden, und diese verfahren dabei nach dem Prinzip der Frequenzmodulation: je intensiver ein Reiz auf eine Sinneszelle einwirkt, desto höher ist die Frequenz ihrer Entladung und umgekehrt.[56] Die Tatsache, dass Reizeinwirkungen aus der Umwelt in einheitliche elektrische Impulse umgewandelt werden, bereitet an sich keine gedanklichen Schwierigkeiten. Problematisch wird es erst dann, wenn er-klärt werden soll, wie unsere bunte Wahrnehmungswelt denn nun eigentlich zustande kommt. Im Gehirn existieren ja keine Farben, Formen, Klänge, Gerüche oder ähnliches, sondern in diesem gibt es nur die relative Gleichförmigkeit der Nervenerregungen. Diese enthalten dann aber keine bedeutungshaften oder verlässlichen Informationen über die Umwelt, denn das Gehirn kann die Herkunft der Nervenimpulse nicht modalspezifisch unterscheiden: Nerven-impulse sind nämlich in bezug auf einen vorausgegangenen Reiz vollkommen unspezifisch. Das Gehirn muss die modalspezifische Bedeutung einer Nervenerregung vielmehr erschließen, dabei greift auf seine eigene Topologie zurück: Modalität und Qualität eines Reizes werden durch den Ort des Auftretens einer Erregung bestimmt. Im Fall des Sehsystems bedeutet dies, dass eine neuronale Erregung im visuellen Cortex als Sehen interpretiert wird, und zwar gleichgültig, ob diese Erregung ihren Ursprung tatsächlich im Auge hatte. Das Gehirn geht bei der Differenzierung der Wahrnehmungsinhalte ausschließlich nach internen Kriterien vor, die es teils phylogenetisch, teils ontogenetisch ausgebildet hat. Wahrnehmung ist deshalb hoch-gradig erfahrungsabhängig (vgl. Roth 1996, Roth 1998). Die auf den Sinnesrezeptoren ausge-lösten Erregungen sind also zunächst bedeutungsfrei, bis ihnen im Kontext der gerade vorherr-schenden neuronalen Aktivität eine Bedeutung zugewiesen wird, wobei das Gehirn auf eigene Erfahrungswerte zurückgreift:
Diese unbezweifelbare und eigentlich triviale Tatsache, dass nämlich die Umweltereignisse nicht ihre Wirkungen auf das Gehirn selbst festlegen, sondern dass diese Wirkungen ausschließlich durch den neuronalen Kontext festgelegt werden, bestimmt den Begriff der informationalen oder semantischen Geschlossenheit.[57]
Das Prinzip der erfahrungsabhängigen (selbstreferentiellen) Bedeutungserzeugung möchte ich kurz anhand der Unterscheidung in triviale und nichttriviale Maschinen darstellen.[58] Triviale Maschinen haben die Eigenschaft, dass sie auf einen bestimmten Input x stets eindeutig mit einem dazugehörigen Output y reagieren. Triviale Maschinen sind also alle erdenkbaren Vor-gänge oder Prozesse, bei denen auf ein bestimmtes Ereignis eine festgelegte, vorhersagbare Wirkung eintritt. Im Gegensatz dazu wird bei einer nichttrivialen Maschine das Ergebnis nicht nur vom Input, sondern darüber hinaus auch vom internen Zustand z der Maschine bestimmt. Jedes mal, wenn durch ein Ereignis x eine Wirkung y hervorgerufen wird, verändert sich der Zustand z der Maschine in den Zustand z’ – mit der Folge, dass sich mit jeder Operation des Systems die innere Struktur wieder verändert. Nichttriviale Maschinen sind deshalb analytisch unbestimmbar, vergangenheitsabhängig und nicht vorhersagbar (vgl. Foerster 2000, S. 60 ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Unterschied zwischen einer trivialen und einer nichttrivialen Maschine. Bei einer trivialen Maschine (links) führt das Ereignis x zu einem definierten Verhalten y, zwischen Input und Output besteht ein eindeutiger Zusammenhang, und die Wirkung dieser Maschine ist vorhersagbar. Bei einer nichttrivialen Maschine (rechts) erzeugt die Ursache x ein bestimmtes Ver-halten y, das jedoch analytisch unbestimmt bleibt. Gleichzeitig wird der Zustand z der Maschine in den Zustand z’ überführt, die Operationsweise dieser Maschine verändert sich also in Abhängigkeit von den vorangegangenen Operationen.
Wird bei einer nichttrivialen Maschine die Kette von Ursache und Wirkung zu einem Kreis ge-schlossen – der Output dieser Maschine wieder an den Input rückgekoppelt –, so entsteht eine zirkuläre Organisation, die Maschine arbeitet rekursiv. Jede Wirkung wird zu einer Ursache, die eine Wirkung hervorbringt, die wiederum zu einer Ursache wird, usw. Es gibt kein Anfang und kein Ende mehr, das System erzeugt seine Zustände aufgrund seiner eigenen früheren Zustände und operiert ausschließlich mit systeminternen Elementen. Das System steht dann zwar in einer energetischen Austauschbeziehung mit seiner Umwelt – ist also strukturell an ihr gekoppelt –, aber es besitzt keinen informationellen Input oder Output. Das Gehirn hat keinen direkten Zugang zur Realität, es beobachtet nicht die Welt »da draußen«, sondern nur wieder seine eigene neuronale Erregung. Es muss deshalb im Laufe seiner Entwicklung (Ontogenese, Selbstorganisation) selbst die Bedeutungen hervorbringen, mit denen es seine neuronale Aktivität bewertet. Kurz: das Gehirn ist ein informationell geschlossenes, selbstexplikatives System (vgl. Roth 1996).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Informationserzeugung statt Informationsaufnahme. Kognitive Systeme treten zwar in Wechselwirkung mit ihrer Umwelt und sind diesbezüglich offene Systeme, aber sie besitzen keinen informationellen Input oder Output. Neuronale Netz-werke – die Gesamtheit aus Sensorik, Motorik und Nervensystem – sind operational geschlossen und erzeugen ihre Zustände aufgrund ihrer eigenen früheren Zustände. Kognitive Systeme erzeugen also selbst die Informationen, die sie im Laufe ihrer Systemgeschichte verarbeiten.
Die idealistische Erkenntnistheorie hatte das Problem, herauszufinden, wie Erkenntnis möglich ist, obwohl sie keinen unmittelbaren Zugang zur außenweltlichen Realität hat.[59] Der Radikale Konstruktivismus dreht das Verhältnis um und behauptet: »Erkenntnis ist nur möglich, weil sie keinen Zugang zur Realität außer ihr hat« (Luhmann 2001, S. 219). Die Erkenntnis braucht dann auch nicht mehr über gültige Repräsentationen verfügen: kognitive Inhalte spiegeln keine objektive Realität wider. Die Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus impliziert also ein anderes Realitätsverständnis: als »Realität« bezeichnet ein erkennendes (beobachtendes, beschreibendes) System die selbst erzeugten Invarianten, die es im Verlauf seiner Systemge-schichte durch rekursives Operieren ausgebildet hat. »Realität« ist dann das, was ein System an sprachlichen oder nichtsprachlichen Beschreibungen anfertigt. In diesem Sinne ist dann jede Ontologisierung, jede Definition von Realität möglich, solange es dem System gelingt, mit seinen Beschreibungen zu überleben und die autopoietische Organisation aufrechtzuerhalten. Die Realitätskonstrukte sind jedoch keine Repräsentation einer objektiv gegebenen Realität, sondern die systeminterne Konstruktionen einer systemexternen Umwelt, die als solche zwar ontologisierend behandelt wird, aber an sich keine Entsprechung in der Umwelt des Systems hat:
Operational geschlossene Systeme sind dadurch charakterisiert, dass die Ergebnisse ihrer Prozesse diese Prozesse selbst sind. Daher ist das Konzept der operationalen Geschlossenheit eine Möglichkeit, Prozesse zu bestimmen, die auf sich selbst zurückwirken und damit autonome Netzwerke bilden [...] Entscheidend ist, dass derartige Netzwerke nichts repräsentieren: Statt eine unabhängige Außenwelt zu repräsentieren, inszenieren sie eine Welt; diese ist als Feld von Unterscheidungen untrennbar mit der im Kognitionssystem verkörperten Struktur verbunden.[60]
Aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus ist die außenweltliche Realität eine in Form von Beschreibungen konstruierte Realität.[61] Dem klassischen, fremdreferentiellen Verständnis der Kognition liegt aber die Annahme zugrunde, dass ein äußerlich gegebenes Objekt im Subjekt eine innere Repräsentation erhält.[62] Es wird dann eine wie auch immer geartete Korrespondenz zwischen einem Realobjekt (Original) und dessen phänomenaler Erscheinung (Repräsentation) unterstellt, oder anders ausgedrückt: es wird eine Abbildungsrelation zwischen zwei getrennten Phänomenbereichen herzustellen versucht. Ein Beobachter benutzt dann eines dieser Phäno-mene als Zeichen (Repräsentation) und das andere als Objekt (Original), und versucht dann mit Hilfe des Zeichens deskriptive Schlussfolgerungen über das Objekt zu bekommen:
Um jedoch dies zu tun, muss der Beobachter (oder das System, das die Repräsentation anfertigt) operational sowohl außerhalb des Objekts als auch außerhalb des Zeichens sein, und er muss durch ihre Unterscheidung zwar isomorphe, aber strukturell verschiedene Phänomenbereiche definieren, die eine vollständige wechselweise Abbildung gestatten. Dies kann das Nervensystem nicht leisten.[63]
Für ein Nervensystem ist es vollkommen unmöglich, aus seinem Operieren herauszutreten, es hat stets nur mit einem der beiden Phänomene, nämlich ausschließlich mit sich selbst, zu tun. Der Begriff der Repräsentation bekommt deshalb eine vollkommen andere Bedeutung: anstelle einer Innen-Außen-Relation meint Repräsentation dann nur noch eine Innen-Innen-Relation (eine Beschreibungs-Beschreibungs-Relation). Maturana spricht deshalb auch nicht von einer Kausalbeziehung von System und Umwelt, sondern von struktureller Kopplung. Die Umwelt erzeugt zwar Ereignisse auf den Rezeptorflächen eines kognitiven Systems, doch ob diese dann Wirkungen im kognitiven System haben, hängt nicht nur vom Reiz selbst, sondern auch vom aktuellen Zustand des Systems ab (»top-down-Modell«). Beobachtbar sind dann nur noch interne Korrelationen, nicht aber ein Kausalzusammenhang zwischen Umweltereignissen und Systemereignissen. Eine Kausalbeziehung zwischen Umwelt und kognitivem System würde nämlich nur dann vorliegen, wenn im System die Spezifität der Umweltereignisse gewahrt bleibt, wenn also eine eindeutige Korrelation zwischen bestimmten Umweltreizen und be-stimmten Nervenerregungen vorliegt, wie verschieden diese ihrer Natur nach auch sein mögen. Roth und Maturana kommen zu dem Ergebnis, dass eine solche Korrelation nicht vorliegt: »Es gibt keine eindeutige Beziehung zwischen Umweltreizen und gehirninternen Prozessen« (Roth 1998, S. 100). Empirisch wird dieser Sachverhalt mit Untersuchungen am visuellen System belegt: zwischen der physikalischen Lichtwellenlänge (Objektbereich) und entsprechenden Farbempfindungen (Repräsentationsbereich) konnten weder Zuordnungen noch Korrelationen festgestellt werden. Dieselben Farbempfindungen können nämlich auch bei unterschiedlichen Erregungsmustern auf der Ebene der Farbrezeptoren ausgelöst werden.[64] Das Gehirn passt sich vielmehr den wechselnden spektralen Lichtverhältnissen dynamisch an und hält somit eine konstante Farbwahrnehmung aufrecht. Wäre dem nicht so, sähe morgens, mittags und abends die Welt dramatisch anders aus (vgl. Roth 1998, S. 120 f.).
Es konnten zwar keine Korrelationen zwischen der physikalischen Lichtwellenlänge (extern) und den entsprechenden Farbempfindungen (intern), wohl aber zwischen Farbempfindungen (intern) und deren sprachlichen Bezeichnungen (intern) festgestellt werden, also ausschließlich Korrelationen zwischen systeminternen Elementen. Der Begriff der Repräsentation – wenn er denn überhaupt noch verwendet werden soll – kann also nur selbstreferentiell gemeint sein: das System unterscheidet Farbenwahrnehmungen nicht in Bezug zu einer außerhalb des Systems liegenden Referenz (hier: der physikalischen Lichtwellenlänge), sondern nur wieder relativ zu anderen Unterscheidungen (hier: den sprachlichen Zuordnungen). Die Umstellung von fremd-referentieller Informationsaufnahme auf selbstreferentielle Informationserzeugung hat dann weitreichende erkenntnistheoretische Konsequenzen. Für einen Beobachter ist »Realität« nicht etwas vorfindliches, sondern ein Bereich sprachlicher und nichtsprachlicher Beschreibungen:
Was aus der Aktivität von Gehirn und Nervensystem entsteht, ist keine Erkenntnis, jedenfalls keine objektive und zwei-felsfreie. Als sprach-, bewusstseins- und gedankenproduzierende Wesen – auf der Ebene des Nervensystems formuliert, als Wesen, die mit ihren eigenen neuronalen Zuständen in unendlicher Weise zu interagieren imstande sind – sind wir Menschen konstitutiv Beobachter. Aus unserem Status treten wir niemals heraus, die Möglichkeit und Grenzen unseres stets an Sprache gebundenen Tuns bleiben im Bereich der Beschreibungen.[65]
Roth kommt zu der Schlussfolgerung, dass Aussagen immer nur die systemintern konstruierte Wirklichkeit betreffen, nicht aber eine wie auch immer geartete Realität. Diese wird zwar weiterhin vorausgesetzt, doch finden ontologische Überlegungen stets im Bereich sprachlicher Beschreibungen statt und dürfen sie deshalb keine objektive Gültigkeit beanspruchen (vgl. Roth 1998, S. 358 ff.). Die Wirklichkeit ist ein Bereich von Beschreibungen, und es ist unmög-lich, mit Hilfe sprachlicher Äußerungen diesen Beschreibungen wieder entkommen zu wollen:
Mit Sprache interagieren wir in einem Bereich von Beschreibungen, in dem wir notwendigerweise auch dann verbleib-en, wenn wir über die Welt oder über unser Wissen darüber Behauptungen aufstellen. Dieser Bereich ist begrenzt und unendlich zugleich; begrenzt, weil alles, was wir sagen, eine Beschreibung ist, und unendlich, weil jede Beschreibung in uns selbst die Basis für neue Orientierungsinteraktionen und folglich neue Beschreibungen konstituiert.[66]
Jeder Beobachter bleibt unaufhebbar im Rahmen der Sprache gefangen: »Solange er spricht, fertigt er Beschreibungen an und darf die Logik seiner Beschreibungen nicht mit der des Be-schriebenen verwechseln« (Hoffmann 1998, S. 212). »Realität« meint also keinen Bereich ontologisch vorfindlicher Objekte, sondern ein Bereich sprachlicher Beschreibungen. Realität ist dann jeweils das, was von einem Beobachter so beschrieben und dargestellt wird:
Daraus folgt, dass eine Realität als eine Welt unabhängiger Gegenstände, über die wir reden können, notwendigerweise eine Fiktion des rein deskriptiven Bereiches ist, und dass wir den Begriff der Realität gerade auf den Bereich der Be-schreibungen anwenden sollten, in dem wir, die beschreibenden Systeme, mit unseren Beschreibungen so interagieren, als ob diese unabhängige Gegenstände wären. Diese veränderte Auffassung des Begriffs der Realität muss richtig ver-standen werden. Wir sind es gewöhnt, über die Realität so zu reden, dass wir einander durch sprachliche Interaktionen auf das hin orientieren, was wir für sensorische Erfahrungen konkreter Gegenstände halten, was jedoch, wie im Falle von Gedanken und Beschreibungen, in Zuständen relativer Aktivität zwischen Neuronen besteht, die wiederum neue Beschreibungen erzeugen.[67]
Ein Beobachter verfügt nicht, wie es Kant noch angenommen hatte, über ein apriorisches Kategoriensystem, mit dessen Hilfe er seine Beschreibungen anfertigt, vielmehr muss dieses vom Beobachter im Laufe seiner selbstreferentiellen Organisation eigenständig erlernt werden, wie dies an Fallbeschreibungen über sehend gewordene Blinde deutlich wird: Die betroffenen Personen können nach einem operativen Eingriff visuelle Erfahrungen überhaupt nicht oder nur äußerst schwer in die einmal entwickelten kognitiven Strukturen einpassen, und die visuellen Eindrücke werden dann häufig in eine andere, bekannte Sinnesmodalität eingeordnet (vgl. Roth 1998, S. 320). So auch im Fall eines vierzehnjährigen Jungen, der nach lebenslanger Blindheit vom grauen Star befreit wurde:
Der Junge hatte kein Gefühl für Formen und konnte Entfernungen nicht abschätzen, sondern glaubte, alles sei sehr dicht vor seinen Augen. Er verwendete stets den Tastsinn zur Überprüfung dessen, was er sah – er hatte z.B. Probleme, den Unterschied zwischen einer Katze und einem Hund zu beschreiben, bis er eines Tages eine Katze aufhob und streich-elte. Nur durch die Verbindung von Sehen und Tastsinn konnte er die Tiere unterscheiden.[68]
Diese Beobachtungen scheinen die sensomotorische Korrelationsthese zu bestätigen, wonach Kognition ein rekursiver Lernprozess ist, in dessen Verlauf kognitive Invarianten erzeugt und aufrechterhalten werden. Das konstruktivistische Wahrnehmungsparadigma stimmt also mit der Position Kants darin überein, dass wir nicht die Realität an sich wahrnehmen, sondern nur so, wie sie uns aufgrund unseres Erkenntnisvermögens in Erscheinung tritt. Allerdings wird die Position Kants dahingehend radikalisiert – und das ist der entscheidende Unterschied zu einer transzendentaltheoretischen Begründung –, dass das Erkenntnisvermögen des Menschen nicht apriorisch vorbestimmt ist, sondern sich stattdessen einer erfahrungsabhängigen Organisation verdankt, weshalb auf den Objektivitätsanspruch des Erkennens verzichtet werden muss. Zwar sind die Erkenntnisinhalte immer auch auf eine bestimmte Art und Weise kategorial geordnet, doch ist dieses Kategoriensystem nicht einfach apriorisch vorgegeben, sondern wird selbst-referentiell und erfahrungsabhängig erlernt, wobei sprachliche Unterscheidungen eine große Rolle spielen dürften.
Während Kant behauptet, dass uns die kognitiven Inhalte aufgrund einer apriorisch gegebenen Begrifflichkeit notwendig so gegeben sind und deshalb für alle Subjekte Gültigkeit besitzen, werden im Radikalen Konstruktivismus die »objektiven« Bedingungen des Erkennens end-gültig aufgegeben. Nicht die Erfahrbarkeit leitet sich aus transzendentalen Bedingungen ab, sondern – legt man die sensomotorische Korrelationsthese zugrunde – die Erkenntnis leitet sich aus dem operativen Aufbau von Formen ab, und zwar in Abhängigkeit davon, wie ein System interne Korrelationen herzustellen imstande ist.[69] Da dies nahezu in unendlicher Weise geschehen kann, gibt es dann keinen ausgezeichneten Standpunkt mehr, von dem aus eine be-stimmte Wirklichkeitsauffassung gegenüber anderen bevorzugt werden kann. Systeminterne Korrelationen – sprachliche wie nichtsprachliche – können nämlich bei entsprechender Einüb-ung beliebig hergestellt werden, und lassen sich dann verschiedene »Realitäten« konstruieren. So kann man etwa aus der Konstanzleistung von Objekteigenschaften nicht auf deren objektive (beobachtungsinvariante) Natur schließen:
Konstanzleistungen wie Farb-, Form und Dingkonstanz sind hochkomplexe Leistungen unseres Gehirns, sie sind Kon-struktionen, allerdings solche, die nicht unserem Willen unterliegen. Ebenso können wir nicht aus der Tatsache, dass alle Menschen und sogar viele Tiere offenbar Dinge in derselben Weise sehen (zum Beispiel einige Dinge für größer halten als andere oder Dreiecke von Kreisen unterscheiden), eine Objektivität dieser Dinge unterstellen, sondern wir können nur auf dieselbe oder eine ähnliche Funktionsweise von kognitiven Systemen schließen.[70]
Objektivität bedeutet dann, dass verschiedene Beobachter die gleichen Erfahrungen machen, ist also ein Indikator für gleiche Beobachtungsleistungen. Die Gültigkeit der Repräsentationen ist jedoch weder durch Rekurs auf Ontologie noch durch ein apriorisches Konstruktionsdesign gegeben: »Die Welt in repräsentierbare Einheiten aufzuteilen ist hier gerade nicht möglich und wird es auch nicht durch noch so weitgehende Formalisierung und Regelaufstellung« (Hoff-mann 1998, S. 220).
4.2. Ich-Bewusstsein, Handlungskompetenz und Entscheidungsfindung
Wenn man danach fragt, wem eine Kompetenz zum Handeln zugestanden werden soll, dann wird meist auf das Handlungssubjekt verwiesen: das Subjekt ist das bewusst denkende und willentlich handelnde Ich, das Wünsche und Gefühle hat, Pläne ausheckt, Absichten ver-folgt und Ziele verwirklicht. Doch wer oder was genau ist eigentlich dieses Ich? Niemand hat es bisher gesehen, und es scheint sich dem Zugriff des Forschers auf geheimnisvolle Weise zu entziehen. Bislang sind alle Bemühungen, »das Ich im Gehirn zu lokalisieren, völlig fehlge-schlagen« (Roth 1996, S. 249). Wenn sich im konstruktivistischen Wahrnehmungsparadigma die Realität einer beschreibenden Konstruktion verdankt, dann muss intentionales Verhalten ebenfalls eine solche Beschreibung sein. Wird dadurch das willentlich handelnde Subjekt außer Kraft gesetzt? Das kann aber eigentlich nicht sein, denn die eigene Erfahrung sagt uns, dass hinter allem, was erkannt, gedacht, erfahren, gedeutet, gewollt und entschieden wird, ein Ich steckt, dass diese Operationen ausführt. Schließlich bin ich es, der entscheidet, und ich bin es auch, der sich gekränkt fühlt, wenn man mich ärgert. Es zeichnet sich ab, dass aus der Sicht des Radikalen Konstruktivismus der intentionale Standpunkt anders bewertet werden muss als in der subjektphilosophischen Tradition.[71] Wenn sich herausstellen sollte, dass das intentionale Ich nur eine kognitive Illusion ist, dann kann es nicht das sein, wofür es immer gehalten wurde. Wenn Maturana sagt, dass operative Prozesse von einem Beobachter semantisch aufgeladen und in intentionalen Begriffen beschrieben werden, dann deutet sich an, dass diese Prozesse jedenfalls von keinem ausführenden Agens oder Subjekt regiert werden.
In der Subjektphilosophie wird intentionales Verhalten damit begründet, dass einem Tun eine bestimmte Absicht, also ein subjektiver Willensakt, zugrunde liegt.[72] Der Willensakt ist dann das verursachende Moment, welches ein Subjekt veranlasst, Handlungen auszuführen oder Entscheidungen zu treffen. Es geht hierbei also »um das Gefühl, dass die Entscheidung letztlich aus mir selbst kommt und nicht von außen aufgezwungen wurde. Die Frage ist nun: Spiegelt dieses Gefühl eine tatsächliche Entscheidungsfreiheit wider, oder ist sie eine Illusion?« (Roth 1998, S. 304). Wenn man nach dem Verursacher von Handlungen fragt, dann kommt man um das Geist-Materie-Problem (auch: Geist-Gehirn-Problem) nicht herum. Dabei geht es um die Frage, in welchem ontologischen und kausalen Verhältnis Geist und materielles Gehirn zueinander stehen. Im Dualismus wird eine wesensmäßige Verschiedenheit von Geist und Gehirn angenommen: entweder gibt es eine nebenherlaufende Parallelität ohne kausale Beeinflussung, oder aber eine Interaktion mit wechselseitiger Einflussnahme. In der Identitäts-theorie des Geistes wird davon ausgegangen, dass geistige Phänomene mit neurobiologischen Zuständen im Gehirn identisch sind, sie sind dann ihrem Wesen nach nichts anderes als die Aktivität von Nervenzellen. Der emergenztheoretische Materialismus behauptet, dass geistige Phänomene zwar als Systemeigenschaften aus neuronalen Prozessen hervorgehen, dass diese aber nicht reduktionistisch auf die Eigenschaften von Nervenzellen zurückgeführt werden können, wenngleich sie ohne diese nicht existieren würden.[73] Oder aber der Geist wird als ein Epiphänomen aufgefasst: es wird dann ein Zusammenhang zwischen neuronalen Prozessen und subjektiv erlebten Bewusstseinszuständen anerkannt, aber der Geist hat keinen Einfluss auf die Aktivität des Gehirns, kausal wirksam wären hierbei einzig und allein die neuronalen Prozesse.[74]
Legt man allen Handlungs- und Entscheidungsprozessen ein willentliches Subjekt zugrunde, dann muss der Willensakt den Gehirnprozessen entweder zeitlich vorausgehen oder gemein-sam mit ihnen auftreten, so dass sich folgende Kausalkette aufstellen lässt: zuerst subjektiver Wille (Geist), dann neuronale Aktivität (Gehirn), dann motorische Reaktion (Muskeln). Den Einfluss des Geistes auf das Gehirn (genauer: die Exekutivgewalt des Geistes über das Gehirn) wollte der amerikanische Neurobiologe Benjamin Libet experimentell nachweisen. Zu diesem Zweck wurden Versuchspersonen gebeten, innerhalb einer vorgegebenen Zeit den willent-lichen Entschluss zu fassen, einen Finger der rechten Hand zu heben und sich genau in diesem Moment die Position eines rotierenden Zeigers zu merken. Parallel dazu wurde die Gehirn-aktivität der Versuchsperson gemessen. Wie zu erwarten war, ging der Willensentschluss der motorischen Reaktion um einige Zeit (durchschnittlich 200 ms) voraus. Überraschenderweise ging aber dem Willensakt noch etwas anderes voraus (im Durchschnitt 350-550 ms), nämlich das sogenannte Bereitschaftspotential:
In keinem Fall fiel das Bereitschaftspotential mit dem »Willensentschluss« zeitlich zusammen oder folgte diesem gar. Dieser Befund wird von manchen Neurobiologen und Philosophen dahingehend interpretiert, dass der Willensent-schluss nicht die Ursache der Bewegung ist, sondern ein Begleitgefühl für die Handlung selber.[75]
So war der Experimentator paradoxerweise in der Lage, auf der Grundlage des gemessenen Bereitschaftspotentials »vorauszusagen, wann diese Handlung stattfinden würde, und zwar eine halbe Sekunde bevor die betreffende Person selbst ihrer Absicht gewahr wurde« (Claxton 1997, S. 297). Das Experiment gibt Anlass zu der Vermutung, dass Entscheidungsprozesse keine Operation des Bewusstseins sind. Einer bewusst gewollten Handlung gehen neuronale Prozesse voraus, die dem Bewusstsein kognitiv unzugänglich bleiben und die es auch nicht steuern oder kausal beeinflussen kann:
Der Willensakt geht also den neuronalen Prozessen nicht voraus, sondern ergibt sich aus ihnen. In entsprechender Weise folgt das Gefühl, eine Handlung intendiert zu haben – also der »Willensakt« – den für eine Willkürhandlung notwendig-en corticalen und subcorticalen Prozessen und tritt zusammen mit den nachfolgenden Handlungen auf. Einige Philoso-phen haben dagegen eingewandt, es könne ja sein, dass der Willensakt selbst zusammen mit den Hirnprozessen gestartet werde, aber Zeit brauche, um bewusst zu werden. Diese Annahme, es gebe einen unbewussten Willensakt, erscheint aber als ein Widerspruch in sich selbst, wenn man die traditionelle Sicht des Willensaktes zugrunde legt.[76]
In den Entscheidungsprozess fließen zwar auch Komponenten der bewussten Handlungs-planung ein, doch stehen diese letztlich wieder unter Kontrolle des unbewusst operierenden Bewertungsgedächtnis: »Dies bedeutet, dass die aktuelle Entscheidung, etwas zu tun, unbe-wusst erfolgt« (Roth 1998, S. 307). Was jemand letztlich »will«, wird dezentral und in parallel-verteilten Prozessen entschieden, und stützen diese Befunde die These Maturanas, wonach intentionales Verhalten lediglich eine beschreibende Konstruktion für an sich nichtintendierte Operationen ist. Im Gehirn existiert kein zentraler Auftraggeber, der unabhängig von den dort stattfindenden Prozessen einen freien Willen artikuliert und daraufhin Handlungen einleitet. Wenn das Verhalten trotzdem in intentionalen, psychologischen und mentalistischen Begriffen beschrieben wird, dann nur deshalb, weil die Sprache hinter diesen Prozessen einen »Macher« identifiziert, und weil nicht sorgfältig zwischen operierendem System und beschreibenden Beobachter unterschieden wird:
Wir sagen: »Ich habe das Filetsteak gewählt«, wenn wir ein Essen in einem Restaurant beschreiben, oder: »Ich be-schloss, zur Abwechslung erst einmal den Hund Gassi zu führen und dann den Abwasch zu machen«. Dabei vermittelt die Syntax uns das Gefühl, dass wir nicht einfach beschreiben, was geschehen ist, sondern uns irgendwie zugute halten können, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Was wirklich geschah, war, dass ein Steak bestellt oder ein Hund ausgeführt wurde. Doch suggeriert die Verwendung der Wörter »gewählt« oder »beschloss« mehr als nur das: dass nämlich das Bestellen und Gassigehen nur die äußeren Produkte eines vorangegangenen inneren Prozesses waren, von dem das »Ich« nicht nur gewusst hat, sondern an dem es aktiv beteiligt war.[77]
Einen Hinweis darauf, dass dem Ich-Bewusstsein keine zentrale Exekutivgewalt zukommt, liefern auch die Experimente zur Erforschung des Unbewussten. Zwar wird oft behauptet, das Unbewusste sei weder existent noch könne man etwas darüber erfahren (weil man ja nicht wissen kann, was einem nicht bewusst ist), dennoch gibt es offensichtlich etwas, das Verhalten zu erzeugen in der Lage ist, ohne dass sich dies mit dem Vorhandensein von Bewusstsein er-klären ließe. So etwa beim Autofahren, wenn wir nach einiger Zeit des Träumens plötzlich auf-wachen und bemerken, dass wir einen komplizierten Handlungsablauf bewältigt und alle möglichen Umwelthinweise registriert und berück-sichtig haben, ohne uns dessen bewusst zu sein oder auch nur eine Erinnerung an das zu haben, was wir getan haben [...] Im allgemeinen neigen wir dazu, die ungeheure Vielfalt von Hinweisen darauf, dass die »Kommandozentrale Bewusst-sein« eben nicht das Kommando hat und oft genug nicht einmal weiß, was vor sich geht, zu ignorieren, beiseite zu wischen oder umzudeuten.[78]
Die Existenz unbewusst ablaufender Beobachtungsprozesse ist inzwischen durch zahlreiche Experimente und klinische Befunde bestätigt worden. Ein aus der Neurobiologie bekanntes Phänomen ist das Blindsehen, bei dem die Patienten an einer funktionalen Gehirnstörung leiden, so dass sie in einem Teil ihres Gesichtsfeldes völlig erblindet sind. Die Personen haben kein visuelles Seherlebnis, sie nehmen weder Farben noch Formen wahr. Und trotzdem: wenn die Personen aufgefordert werden, können sie nach Objekten greifen oder den genauen Ort einer Lichtquelle angeben, behaupten aber gleichzeitig, keine bewusste Erfahrung des Sehens zu haben. Stattdessen haben sie das Gefühl, sie würden ins Leere greifen oder die Position der Lichtquelle nur zufällig erraten (was jedoch nicht der Fall ist, da die Trefferquote weit über die erwartbaren Zufallstreffer liegt). Blindsichtige Patienten verstehen oft die Anweisungen nicht, die man ihnen gibt, denn sie sollen nach etwas greifen, das sie nicht sehen können. Sie geben durch verbales Leugnen zu verstehen, dass sie sich einer visuellen Erfahrung in keiner Weise bewusst sind (im Gegensatz zu »hysterisch blinden« Personen, die lediglich behaupten, blind zu sein). Und trotzdem können sie, ohne eigentlich zu wissen warum, den Aufforderungen des Experimentators nachkommen.[79]
Das Phänomen des Blindsehens zeigt, dass Wahrnehmungen möglich sind, ohne dass diese notwendigerweise auch bewusst werden müssen. Die Personen haben nachweislich eine Wahr-nehmung des Sehens und können sich nach energischer Aufforderung entsprechend verhalten, aber sie haben keine bewusste Erfahrung des Sehens. Wenn es also eine Wahrnehmung auf einer nicht bewussten (und deshalb: nicht mitteilbaren) Ebene gibt, dann liegt es nahe, dass Menschen auf dieser Ebene auch lernfähig sind: in einem psychologischem Experiment wurde den Versuchspersonen ein Gitternetz von Zahlen gezeigt, und diese sollten dann so schnell wie möglich antworten, ob das Gitter eine bestimmte Zahl (»Zielnummer«) enthielt, die auch an jeder anderen Position im Zahlennetz hätte stehen können:
Die Versuchsperson wusste nicht, dass die ihr vorgestellten Schaubilder einige subtile Korrelationen zwischen der Posi-tion der Zielnummer und den Zahlen enthielt, mit denen man den Rest des Gitters ausgefüllt hatte. Standen beispiels-weise eine 4 und eine 7 nebeneinander, dann konnte man die Zielnummer in der Mitte der obersten Reihe finden. War einen solche Korrelation gegeben, dann vermochten die Versuchspersonen das Ziel nach und nach schneller zu entdeck-en, obwohl sie bei späterer Befragung absolut kein bewusstes Wissen von dem Muster hatten, das sie als Hilfestellung benutzt hatten. Selbst wenn die Versuchspersonen mit Tricks von Psychologen vertraut sind (wenn sie beispielsweise Kollegen an der Fakultät für Psychologie sind) und selbst wenn sie ausdrücklich aufgefordert werden, das Hintergrund-muster zu entdecken, sind sie nicht dazu in der Lage. Ja, sie leugnen sogar mit Nachdruck, dass es ein solches Muster überhaupt gibt – weil sie es nicht bewusst erfassen können.[80]
Das Experiment zeigt, dass auch auf einer nichtbewussten Ebene wahrgenommen und gelernt werden kann. Wenn die Versuchspersonen ihre Beobachtungen nicht verbalisieren können, ist das kein Beweis dafür, dass diese Prozesse nicht existieren. Auch die Fallbeschreibungen von »splitbrain«-Patienten zeigen, dass die Einheit der Wahrnehmung eine Illusion ist und man stattdessen besser von einer Überlagerung mehrerer Beobachtungszustände sprechen sollte. Bei »splitbrain«-Patienten ist aufgrund eines operativen Eingriffs im Gehirn die Verbindung zwischen der linken und rechten Hemisphäre getrennt, so dass zwei unabhängige Bereiche ent-stehen und die linke Hemisphäre bewusstseinsmäßig nicht weiß, was die rechte tut. Mit Hilfe eines ausgeklügelten Verfahrens ist es dann möglich, mit beiden Hemisphären unabhängig in Kontakt zu treten. Wie man weiß, werden Objekte, die dem linken Gesichtsfeld gezeigt werden, auf die rechte Hemisphäre, und Objekte, die dem rechten Gesichtsfeld gezeigt werden, auf die linke Hemisphäre projiziert. Das Sprachvermögen ist jedoch bei den meisten (rechts-händigen) Personen nur in der linken Hemisphäre angesiedelt. Zwar besitzt auch die rechte Hemisphäre ein rudimentäres Wortverständnis, aber diese kann Instruktionen nur lesen, jedoch nicht benennen oder sprachlich über sie berichten (vgl. Roth 1998, S. 218). Fordert man nun einen Patienten auf, einen Punkt in der Mitte eines Bildschirms zu fixieren und lässt dabei ein zusammengesetztes Bild nur so kurz aufleuchten, dass die Augen sich nicht bewegen und das Bild abtasten können, dann wird die linke Hälfte des Bildes nur von der rechten und die rechte Hälfte des Bildes nur von der linken Hemisphäre wahrgenommen:
Zeigt also die linke Hälfte des Bildes einen schneebedeckten Vorgarten, und die rechte Hälfte eine Vogelkralle, dann nimmt die »linguistische« Gehirnhemisphäre nur den Vogel zur Kenntnis und die »nicht-linguistische« nur den Schnee. Fordert man die Versuchsperson nun auf, aus einer Reihe von Bildern die auszuwählen, die zu dem zuvor vorgeführten Bild passen, dann greift die linke Hand (die von der rechten Hemisphäre kontrolliert wird) nach dem Bild einer Schau-fel, während die rechte Hand (die von der linken Hemisphäre kontrolliert wird) das Bild eines Huhns auswählt. Die linke, sprachliche Hemisphäre sieht also die Vogelkralle, und sie sieht auch, wie die beiden Hände verschiedene Bilder auswählen. Aber sie weiß nichts von der Schnee-Szene, die zur Auswahl der Schaufel durch die linke Hand geführt hat. Fordert man die Versuchsperson nun auf, ihre Auswahl der Bilder zu erklären, dann wird sie etwas in diesem Sinne sagen: »Oh, das ist einfach. Sehen Sie, die Hühnerkralle passt zu dem Huhn, und man braucht eine Schaufel, um den Hühnerstall auszumisten «. Der Geschichtenerzähler in der linken Hemisphäre macht sich an die Arbeit und braut zuver-sichtlich eine Geschichte zusammen, die eine plausible Erklärung dessen liefert, was geschehen ist. Sie basiert auf den Informationen, zu denen er Zugang hatte, ist aber keine zutreffende Erklärung, eben deswegen, weil der Erzähler keinen Zugang zu allen relevanten Fakten hat und nicht in Betracht zieht, dass er nicht alle Informationen haben könnte. Was in ihrem Bewusstsein ankommt, so nimmt die linke Gehirnhälfte an, muss auch schon alles sein, was es gibt, und so hält sie die von ihr aus dem Stegreif zusammenfabulierte Geschichte für die buchstäbliche Wahrheit. Dieses Verhalten des gespaltenen Gehirns macht sichtbar und dramatisiert, was auch im intakten Gehirn ständig geschieht. Es handelt sich dabei nicht nur um eine klinische Kuriosität, sondern um eine Parabel, welche das Verhältnis zwischen der bewussten Spitze und der unbewussten Masse des zerebralen Eisbergs offenbart.[81]
In allen mit »splitbrain«-Patienten durchgeführten Experimenten zeigt sich, dass die rechte Hemisphäre zu kognitiven und emotionalen Erfahrungen fähig ist, dass aber in der Regel nur die linke Hemisphäre sprachliche Beschreibungen anfertigen kann. Da diese jedoch nichts von den Wahrnehmungen in der rechten Hemisphäre weiß, werden Antworten erfunden, mit denen die linke Hemisphäre ihre eigenen Beobachtungen plausibilisiert. Fordert man also die rechte Hemisphäre auf, zu lachen, so erfindet die linke (linguistische) Hemisphäre auf die Frage, warum die Versuchsperson denn lache, eine dazu passende Antwort: »Weil sie so komische Typen sind«. Die Ergebnisse dieser Experimente weisen auf etwas Grundlegendes hin: in sprachlichen Bereichen gibt es keine Inkohärenz. Der sprachfähige Beobachter (hier: die linke Hemisphäre) erfindet stets eine plausible und kohärente Geschichte, die jedoch nicht dem tat-sächlichen Geschehen entspricht (denn von der Aufforderung zum Lachen weiß die linke Hemisphäre nichts). Es werden dann Pseudorationalisierungen vorgenommen – meist in Form von Kausalerklärungen –, denn scheinbar müssen die Geschehnisse in irgendeinem Zusamm-enhang stehen, also auch erklärbar sein (vgl. Maturana/Valera 1987, S. 248 f.).
Bei manchen »splitbrain«-Patienten ist sowohl die linke als auch die rechte Hemisphäre zu sprachlichen Beschreibungen fähig, so dass dadurch zwei getrennte Persönlichkeiten entstehen können. Die Trennung beider Gehirnhemisphären führt zu einer operationalen Überschneidung dreier verschiedener Personen, die zu bestimmten Zeiten unabhängige, selbstbewusste Wesen sein können und die jeweils unabhängig vom Forscher befragt werden können. Auf ein und dieselbe Frage, was die Versuchsperson später einmal werden will, werden dann unterschied-liche Antworten gegeben, was als Beleg dafür gewertet wird, dass es ein Selbstbewusstsein nur im Bereich der Sprache geben kann:
Das zeigt uns auf dramatische Weise, dass es die Sprache ist, in der ein Selbst, ein Ich, entsteht – und zwar als jene soziale Singularität, die durch die operationale Überschneidung der rekursiven sprachlichen Unterscheidungen, in denen das Ich unterschieden wird, im menschlichen Körper entsteht. Daraus ersehen wir, dass wir in dem Netzwerk der sprachlichen Interaktionen, in dem wir uns bewegen, eine andauernde deskriptive Rekursion aufrechterhalten, die wir unser »Ich« nennen. Sie erlaubt uns, unsere sprachliche operationale Kohärenz zu bewahren sowie unsere Anpassung im Reich der Sprache.[82]
Dass das Ich-Bewusstsein mehr eine beschreibende denn eine ausführende Instanz ist, zeigen auch die Fälle von schizophrenen Menschen. Schizophrenie geht oft mit Wahnvorstellungen und Halluzinationen einher, und die Patienten sind unfähig, eigene von fremden Aktivitäten zu unterscheiden. Schizophrene haben oft ungewöhnliche Gefühle, zeigen chaotisches Verhalten, sind inkonsistent in ihrem Denken und haben Kommunikationsschwierigkeiten. Sie sehen ihr eigenes Sprechen als »fremde Stimmen« an, und ihre Gedanken und Handlungen werden als »von außen« aufgezwungen empfunden. Manche Patienten können sich als mehrere Personen oder Ichs empfinden und mehrere Identitäten annehmen: »In manchen Fällen unterscheiden sich die anderen Persönlichkeiten nicht nur im ›Charakter‹, sondern auch in körperlichen Eigenschaften wie Haltung, Stimme, Handschrift und sogar Gehirnströmen, Pulsfrequenz und Blutdruck« (Cohen 1997, S. 75).
Schizophrenie wird auf verschiedene Weise erklärt, angefangen als vorwiegend biochemische Störung im Gehirn bis hin zu einer im Grunde gesunden, jedoch verzweifelten Reaktion auf Zustände in der Familie oder in der Gesellschaft, die den »Patienten« buchstäblich verrückt machen (vgl. Claxton 1997, S. 165). Schizophrenie wird zwar häufig mit einer Störung der Dopamin-Produktion im Gehirn erklärt, doch muss diese nicht der eigentliche Grund, sondern kann auch eine Begleit- oder Folgeerscheinung sein (vgl. Roth 1998, S. 205). So weiß man heute, dass Schizophrenie auch durch Stress ausgelöst werden kann. Das führt dann zu einer (vorrübergehenden) Störung der Dopamin-Produktion, die sich jedoch rekursiv verstärkt, so dass die betroffenen Personen auch nach wiederhergestellter Gehirntätigkeit dauerhaft soziale Schwierigkeiten haben. Eine erhöhte Dopamin-Produktion im Gehirn, ausgelöst durch Stress, führt dazu, dass eine Person ihren ersten psychotischen Schub erlebt. Da die ungewöhnlichen neuronalen Vorgänge im Gehirn aber auch ungewöhnliche Gefühle und Handlungen zur Folge haben, wird das erzählende Ich in die Verlegenheit gebracht, Erklärungen aufzutischen, warum sich in seiner Welt alles so sehr verändert hat:
Der Erzähler hat keinen freien Zugang zum Gehirn und kann daher keine auf dem tatsächlichen Geschehen beruhende Erklärung finden. Deshalb kann er nur annehmen, irgendetwas habe sich in der sozialen Welt selbst verändert. »Ich fühle mich verwirrt und verletzbar, weil die Menschen, die ich bisher für meine Freunde gehalten habe, auf einmal ihr wahres Ich gezeigt haben. Sie mögen mich nicht wirklich, und man kann ihnen nicht trauen. Bisher haben sie mich täuschen können, aber damit ist es jetzt vorbei. Ich werde künftig auf der Hut sein«. Der Erzähler erfindet für mich eine unheimliche und gefährliche Sicht der »Realität«, die eine »Erklärung« für den radikalen Wandel in meinen Reaktionen liefert, allerdings um den Preis einer radikalen Verschiebung meiner Beziehungen zur Welt. Die ursprüngliche Panne bei der Dopamin-Produktion mag nur eine vorübergehende Unterbrechung im reibungslosen Funktionieren des Gehirns gewesen sein, so wie ein Staubpartikel im Vergaser, der einen kurzfristigen Leistungsabfall im Motor meines Autos ver-ursacht. Hat sich der Geschichtenerzähler jedoch erst einmal an die Arbeit gemacht, dann erhält die betreffende Person eine neue Perspektive der Welt, die zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden kann.[83]
Die sprachliche Beschreibung des eigenen Verhaltens kann also reale Auswirkungen auf das tatsächliche Verhalten einer Person haben. Aus diesem Grund fordern manche Psychologen, von der Verwendung bestimmter Sprachfiguren (»krank«, »verrückt«) Abstand zu nehmen, da diese den Zustand der betreffenden Personen zusätzlich verschlimmern und sogar dauerhaft werden lassen können. Der amerikanische Psychologe Ronald D. Laing hat die Kausalitäts-annahme sogar in ihr Gegenteil verkehrt, indem er die Logik der schizophrenen Wirklichkeit als Verlängerung der sozialen Ordnung auffasst: die Patienten haben kein stabiles Ich, keine einheitliche Vorstellung von einem »Selbst« und Schwierigkeiten, den Anforderungen der Gesellschaft gerecht zu werden (sie tun deshalb meist das, wovon sie glauben, dass es von ihnen erwartet wird). Das Ich ist durch die Konkurrenz gesellschaftlicher Normen hin- und hergerissen, und führt dieser Konflikt dann zu einer sozial bedingten Spaltung, die allerdings psychisch zugerechnet wird. Das Ich kann keine dauerhafte Identität entwickeln, es oszilliert zwischen gesellschaftlichen Zuschreibungen, was zu Inkohärenz im Verhalten führt und einem außenstehenden Beobachter als »schizophren« erscheint.[84]
Was bei schizophrenen Personen dramatisch zum Vorschein kommt, ist auch beim gesunden Menschen der Fall. Im Gehirn existieren mehrere Beobachter, die sich gegenseitig überlagern und dabei um Aufmerksamkeit und Ressourcen kämpfen. Der Gedanke, dass es kein Subjekt, kein einheitliches Ich, keinen zentralen Geist im philosophischen Sinne gibt, ist jedoch in der heutigen Zeit unpopulär, da durch diese Vorstellung das moderne Welt- und Menschenbild in seinen Grundfesten erschüttert wird:
Für ein »Ich«, das soweit gekommen ist, sich selbst als Chef des Ganzen zu sehen und von dieser Sicht abhängig zu sein, kann die Idee, dass es nicht Chef ist (und vielleicht nie gewesen ist), nur ein Schock und eine Bedrohung sein. Der Gedanke, dieses Gefühl von Kontrolle könne eine Illusion, eine Form von Selbsttäuschung sein, »rechnet sich« einfach nicht. Schließlich habe ich viele Jahre lang meine Erfahrung in den Begriffen dieses Modells erklärt, nach dem das Be-wusstsein auf dem Fahrersitz sitzt. Das ist keine Vorstellung, das ist Wahrheit. Und weil solche Meinungen meine Er-fahrungen durchdringen, scheint jeder weitere Augenblick weitere Beweise dafür zu bringen – wenn noch mehr benötigt würden –, dass die Kontrolle durch mich ein unverrückbares Faktum ist. Und sollte ich mich überreden lassen, diese andere Idee einmal ernst zu nehmen, dann kann ich mir, von meinem Standpunkt hinter den Gittern aus, nur vorstellen, dass es sich um einen tatsächlichen Verlust von etwas handelt, was ich bis jetzt tatsächlich besessen habe. Dieser Vor-schlag ist daher entweder absurd oder furchterregend. Wenn »Ich« nicht dieses Auto lenke, was zum Teufel tue »Ich« dann?[85]
Es bliebe also zu klären, welchen Status bzw. welche Funktion das Bewusstsein hat, wenn es schon nicht als Exekutivgewalt auftritt. Roth (1998, S. 209 ff.) vertritt die Auffassung, dass das Bewusstsein vor allem bei der Herstellung und Neuverknüpfung neuronaler Netzwerke in Erscheinung tritt. Das Gehirn verfügt über relativ feste und dauerhafte Verschaltungen, auch prozedurales oder implizites Gedächtnis genannt. Dieses prozedurale Gedächtnis ist zwar sehr effektiv, schnell und zuverlässig, doch es versagt immer dann, wenn neue Probleme auftreten, für deren Lösung noch kein fertiges Netzwerk vorliegt. Im Falle des Versagens routinemäßiger Aufgaben ist das Bewusstsein dann flexibel genug, um eine Neuorganisation der neuronalen Verschaltung vorzunehmen und ein neues Nervennetz auszubilden, welches diese Aufgabe dann später übernimmt:
Dieses neue Nervennetz wird nun beim Vorliegen gleicher oder vergleichbarer Situationen überprüft, verändert und schließlich in einer Form verfestigt, die sich bei der Überprüfung bewährt hat. Entsprechend benötigen wir immer weniger Zeit, um ein bestimmtes Problem zu bewältigen, und wir tun Dinge mit immer weniger Aufwand (bzw. immer »eleganter«). Im selben Maße zieht sich das Bewusstsein zurück, bis schließlich von uns die anstehenden Aufgaben mehr oder weniger automatisiert erledigt werden können.[86]
Das subjektive Empfinden von Bewusstheit ist dann eine Kennzeichnung, eine Bezeichnung oder Beschreibung des Gehirns für sich selbst, »eine Hervorhebung von momentan korrelier-ten neuronalen Ereignissen aus einem allgemeinen Aktivitätszustand« (vgl. Roth 1998, S. 270). Dass sich das Bewusstsein nicht als einen beschreibenden Beobachter, sondern für den Autor des Geschehens hält, kann damit erklärt werden, dass es seine Fähigkeit vorherzusagen, was das System als Ganzes im nächsten Moment tun wird, mit der Fähigkeit verwechselt, zu bestimmen oder zu kontrollieren, was gleich geschehen wird (vgl. Claxton 1997, S. 217). Das Bewusstsein weiß um seine neuronalen Grundlagen nicht bescheid und kann deshalb seine Ahnung »nicht als Vorhersagen interpretieren und muss sie deshalb als Kontrolle verstehen, als die tatsächliche Quelle der Absicht, die dann das Handeln bestimmt, und nicht als provisor-ische Hypothese über das, was irgendwann in der Zukunft geschehen könnte« (Claxton 1997, S. 275). Oder wie Dennett formuliert: das Bewusstsein ist ein »Erwartungserzeuger« (Dennett 1999, S. 74). Doch verleiten die Modalverben der Sprache dazu, möglichst überzeugend »auf einen Erfahrenden hinter der Erfahrung, einen Täter hinter der Tat, einen Wählenden hinter der Wahl hinzuweisen« (Claxton 1997, S. 162). Das Bewusstsein ist jedenfalls kaum in der Lage, diese Illusion zu durchschauen, denn es kann sein Selbstmodell nicht als Selbstmodell, nicht als Beschreibung von sich selbst, erkennen:
De facto sind wir selbst also Systeme, die sich selbst ständig mit dem von ihnen selbst erzeugten subsymbolischen Selbstmodell ›verwechseln‹. Indem wir dies tun, generieren wir eine stabile und kohärente ›Ich-Illusion‹, die wir auf der Ebene des bewussten Erlebens nicht transzendieren können [...] Der Kern der Subjektivität des Mentalen liegt also in diesem Akt der ›Selbstverwechslung‹: Ein Mangel an Information, ein Mangel an epistemischer Transparenz führt zur Entstehung eines phänomenalen Selbst. Dies ist vielleicht die wichtigste Einsicht über den menschlichen Geist, die man mit den Mitteln der Kognitionswissenschaft und mit Blick auf die philosophische Anthropologie formulieren kann.[87]
Diese Einsicht ist nur dann schockierend, wenn man das Ich-Bewusstsein für ein Subjekt hält, das allem Geschehen zugrunde liegen und dafür die Verantwortung übernehmen soll.[88] Man braucht deshalb aber nicht beunruhigt sein, das Gegenteil ist der Fall: der gesamte Komplex von Operationen, der letztlich Verhalten erzeugt, baut auf einem gewaltigen Vorrat an Erfahr-ungen auf, die das System im Verlauf seiner Interaktionsgeschichte gemacht, bewertet und schließlich ins prozedurale Gedächtnis überführt hat. Man darf die Selbstbeschreibung des Systems (»Ich«) nur nicht mit einem Subjekt, mit einer verantwortlichen Kommandozentrale, verwechseln, die als »Macher« des Geschehens auftritt. Wenn das Ich-Bewusstsein nur in der Sprache existiert, indem es das laufende Geschehen beobachtet und mit Kommentaren ver-sieht, indem es sich vor anderen rechtfertigen und sein Tun begründen muss, dann liefert es sozial erwartbare Sprachfiguren und bestimmen die sozialen Spielregeln, wie das Ich über sich zu denken hat. Dies hat dann Auswirkungen auf die Erinnerungen und Erzählgeschichten, die von einem Ich-Bewusstsein produziert werden.
4.3. Gedächtnis, Erinnerungen, Erzählgeschichten
Wenn vom Gedächtnis die Rede ist, dann werden nicht selten Formulierungen verwen-det, die wieder an die Computermetapher erinnern: das Gedächtnis als »Aufbewahrungsort«, wo Erinnerungen »gespeichert« und »abgerufen« werden. Dieser Sprachgebrauch stammt aus der Zeit des kognitivistischen Paradigmas, er ist aber nicht nur irreführend, sondern trivialisiert den Menschen zu einer Input-Output-Maschine, bei der Informationen über die Sinnesorgane in das Gehirn gelangen, dort verarbeitet und im Gedächtnis für weitere Zwecke bereitgestellt werden.[89] Da man im Kognitivismus von einer aufwärtsgerichteten Informationsverarbeitung (»bottom-up-Modell«) ausging, spielte das Gedächtnis letztlich nur eine protokollierende und aufzeichnende Rolle, keinesfalls sollte es eine strukturierende oder interpretierende Funktion ausüben. Im konnektionistischen Paradigma sieht die Sache dann schon ein wenig anders aus: Wahrnehmung ist kein einseitiger Vorgang, der von Peripherie in Richtung Zentrum verläuft, sondern umgekehrt hat das kognitive System einen erheblichen Einfluss darauf, was von der Peripherie überhaupt weitergeleitet wird und was nicht (»top-down-Modell«). Der Wahrnehm-ungsprozess verschiebt sich somit von einem dominierenden Einfluss äußerer Reize hin zu einer gedächtnisbasierten Aufmerksamkeitssteuerung:
Das Gedächtnis repräsentiert in seiner neuronalen Architektur und den dadurch ermöglichten Funktionsabläufen sozu-sagen den jeweiligen Stand der Wahrnehmungsgeschichte eines kognitiven Systems und steuert die Bedeutungszuweis-ungen an aktuelle Wahrnehmungen durch Schemata bzw. Attraktoren, wobei Sprache eine wichtige Rolle spielen dürfte. Damit erfüllt es eine zentrale Funktion bei der Wahrnehmungs- und Verhaltenssynthese und bildet die Grundlage der selbstorganisierenden Autonomie des kognitiven Systems, das völlig überfordert wäre, müsste es in jedem Wahr-nehmungsvorgang gleichsam als tabula rasa immer wieder von neuem beginnen.[90]
Das Gedächtnis ist der Wahrnehmung nicht einfach kausal nachgeschaltet, sondern integraler Bestandteil der Wahrnehmung. Es steuert die Aufmerksamkeit und strukturiert die Wahrnehm-ung, deren Inhalte wiederum vom Systemgedächtnis beobachtet, bewertet und in die Gesamt-konfiguration des Systems eingearbeitet werden. Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Bewertung hängen untrennbar zusammen, und dem Gedächtnis kommt im Wahrnehmungsprozess die Hauptrolle zu. Es ist »unser wichtigstes Sinnesorgan«, aber zugleich nur »ein Glied im Kreis-prozess von Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Erkennen, Handeln und Bewerten« (Roth 1998, S. 263).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 7: Zirkuläre Organisation von Verhalten, Wahrnehmung, Bewertung, Gedächtnis und Aufmerksamkeit (Quelle: Roth 1998, S. 241, von mir leicht verändert).
Will man auf die Bibliotheksmetapher verzichten, dann stellt sich die Frage, wie ein System zu Gedächtnisleistungen fähig ist, wenn es seine Erinnerungen nicht irgendwo »abgespeichert« hat. Es geht also um die Frage, wie kognitive Inhalte von einem System zu einem späteren Zeitpunkt reproduziert werden können. Eine Antwort darauf liefert die Attraktorentheorie: Das Gehirn ist ein chaotisches und hochdynamisches System, in dem vorrübergehend stabile makroskopische Zustände (Attraktoren) ausgebildet werden. Attraktoren entwickeln sich im »freien Spiel der Kräfte« und müssen einem Prozess nicht erst aufgezwungen werden. Sie sind ein Ergebnis der Selbstorganisation komplexer Systeme, die ihre Ordnungszustände spontan, also aus der inneren Dynamik der Prozesse heraus, entstehen lassen. Dies gilt dann nicht nur für Gestaltwahrnehmungen, sondern auch für semantische Prozesse: so konnte an Versuchs-personen nachgewiesen werden, dass in Abhängigkeit vom lebensweltlichen Kontext der Person eine einmal erzählte Geschichte in ihrer weiteren Reproduktion zunehmend kürzer und einfacher wird und im Vergleich zur Mehrdeutigkeit ihrer Ausgangsversion an Eindeutigkeit und Kohärenz gewinnt (vgl. Stadler/Kruse 1992).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 8: Darstellung einer Kuh (Quelle: Roth 1998, S. 262).
An einem Beispiel demonstriert Roth, wie Wahrnehmung und Gedächtnis zusammenspielen, und wie Attraktoren auf den Vorgang des Erinnerns wirken. Abbildung 8 zeigt die Darstellung einer Kuh, die gelegentlich einer kleineren oder größeren Anzahl von Personen gezeigt wurde, wobei niemand in der Lage war, das Bild auf Anhieb zu erkennen (selbst in einer ausge-wählten Gruppe von Studenten, die als »hochbegabt« gelten, gelang dies nur einer Person nach 10 Minuten, alle anderen konnten das Bild auch nach 20 Minuten nicht erkennen). Wenn nun Details dieser Figur gezeigt wurden, dann vollzog sich der Erkenntnisprozess ganz langsam, das heißt innerhalb von wenigen Minuten: »Was ich dabei tat, war nichts anderes, als bekannte ›Versatzstücke‹ im visuellen Gedächtnis der Zuschauer zu aktivieren und das Gehirn dazu zu bringen, sie ›richtig‹ zusammenzusetzen« (Roth 1998, S. 261). So verhalf bei einigen Personen eine scheinbar nur lose mit der Darstellung verbundene Äußerung (»Franziska von Almsick«) dem Gedächtnis zum Wiedererkennen der vorgelegten Darstellung:
Die Erinnerung an das gemeinsame Auftreten einer jungen Sportlerin und eines bestimmten Lebewesens in einem Fern-sehwerbespot genügte, um dem heftig arbeitenden Bindungs-System einen wertvollen Tipp zu geben. Ist der Prozess des Zusammenbindens zunächst scheinbar völlig unzusammenhängender Details zu einem stabilen, sinnvollen Ganzen erst einmal vollbracht, so wird dieses Resultat neu im Gedächtnis verankert. Wenn das Bild wieder auftaucht, so voll-zieht sich die Identifikation spürbar schneller [...] Eine Darstellung, die uns anfangs trotz größter Anstrengung völlig un-gestaltet erschien, wird durch Erfahrung zu einer stabilen und bedeutungsvollen Wahrnehmung. Es ist nach längerem Umgang mit der Darstellung völlig unmöglich, in dem Bild etwas anderes zu erkennen als eine Kuh. Unser kognitives System »rastet« auf diese eine Deutung ein; systemtheoretisch ausgedrückt hat sich ein Attraktorzustand der Wahr-nehmung herausgebildet, auf den unter den gegebenen Anfangs- und Randbedingungen unser Wahrnehmungssystem zuläuft und in ihm (vorübergehend) verharrt.[91]
Die Attraktorentheorie kann auch erklären, wie es immer wieder zu kognitiven Fehlleistungen kommt: spezifische innere Konfigurationen (»Versatzstücke«) reichen aus, um eine Attraktor-wirkung auszulösen und daraufhin ein geschlossenes Bild entstehen zu lassen. Das Gehirn erzeugt dann aus nur wenigen Eckdaten eine dazu passende Wirklichkeit. Denn um von einer Situation ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen dem Gehirn keineswegs alle Details dieser Situation vorliegen, sondern es genügt das Vorliegen einer kritischen Menge an Daten. Je ein-deutiger von vornherein bestimmte Merkmale zusammenpassen, desto schneller wird das komplette Bild produziert und desto weniger Eckdaten benötigt das Gehirn, um aus diesen ein Bild zu erzeugen, das zu diesen Eckdaten passt:
Es genügen zum Teil nur Bruchstücke von aktuellen Sinnesdaten, um in uns ein vollständiges Wahrnehmungsbild zu er-zeugen, das dann gar nicht von den Sinnesorganen, sondern aus dem Gedächtnis stammt [...] Das subjektiv empfundene vollständige Bild entsteht also dadurch, dass die wenigen Eckdaten durch Gedächtnisinhalte komplettiert werden.[92]
Wahrnehmung verläuft also im wesentlichen gedächtnisbasiert. Die genannten Fehlleistungen kommen zustande, wenn das Gehirn eine Situation nach Abtasten der Eckdaten fälschlich als »vertraut« oder »bekannt« einstuft und dadurch neue Details im Wahrnehmungsprozess völlig ignoriert werden:
Dies erleben wir, wenn wir uns in einer vertrauten Umgebung bewegen, in der kleine, aber wichtige Einzelheiten ver-ändert wurden. Diese werden dann gar nicht bewusst wahrgenommen, denn sie kommen in dem vom Gedächtnis pro-duzierten Komplettbild natürlich nicht vor.[93]
Das Gedächtnis, wie es hier dargestellt wird, kann dann nicht sinnvoll als Informationsspeicher bezeichnet werden. Vielmehr ist es eine neurophysiologische Funktion, um Wahrnehmungen zu erzeugen und diese später in Form von Erinnerungen wieder bewusst werden zu lassen. Der Vorgang des Erinnerns ist dann eine kognitive Operation, in der Wahrnehmungsinhalte erzeugt werden, die wir als Erinnerungen bezeichnen. Das Erinnern ist dann das Erzeugen, nicht das Abrufen von Wahrnehmungsketten mit Hilfe des Gedächtnisses (vgl. Schmidt 1992, S. 32 ff.). Die Konsequenz daraus ist:
Eine Konzeption von Erinnern als aktuelle Produktion von Wahrnehmungsketten, die bei früheren Erfahrungen ausge-bildet worden sind und sich dabei als hinreichend erfolgreich erwiesen haben, koppelt Erinnern vom Wahrheitspostulat ab: Erinnern ist aktuelle Sinnproduktion im Zusammenhang jetzt wahrgenommener oder empfundener Handlungsnot-wendigkeiten.[94]
Dies hat weitreichende Implikationen für die Biographieforschung, die zu einem Teil immer noch davon ausgeht, mit Hilfe des Gedächtnisses vergangene Ereignisse erinnern und sprach-lich mitteilbar machen zu können. Angesichts der semantischen Konstruktivität des Gehirns und den sozial motivierten Zensierungs- und Selektionsprozessen, mit denen Erinnerungen erzeugt und geformt werden, muss diese Vorstellungen als überholt angesehen werden. Denn abhängig vom aktuellen Zustand eines kognitiven Systems (seinen Stimmungen, Gefühlslagen, Ängsten, Interessen, Bedürfnissen und Wünschen) werden bestimmte Strukturen eher als andere aktiviert, und muss damit die Tauglichkeit des Gedächtnisses für die Erforschung der Vergangenheit in hohem Maße bezweifelt werden (vgl. Rusch 1997, S. 160 f.). Durch die Konzeption des Erinnerns als aktiver Konstruktionsvorgang kehrt sich also das gewöhnlich an-genommene Verhältnis zwischen Vergangenheit und Erinnerung um: nicht die Erinnerungen stammen aus der Vergangenheit, sondern die Vergangenheit resultiert aus den Erinnerungen und gewinnt durch sie erst an Identität. Erinnerungen haben nämlich, um sinnvoll zu sein, keine Referenz auf die tatsächlich erlebte Vergangenheit nötig (vgl. Rusch 1987, S. 392).
Aus dieser Überlegung aber ergibt sich dann weiterhin, dass die Geschichten, die wir aus der Erinnerung über unser eigenes Leben erzählen, zwar Geschichten zu einem unverwechselbar individuellen Leben, nicht aber die Lebens-geschichten sein können, für die sie gehalten werden.[95]
So kommt es mitunter vor (und ist eigentlich sogar sehr häufig der Fall), dass die Vergangen-heit in der Erinnerung umgeschrieben wird, ohne dass dies vom Erzähler beabsichtig ist. Denn der Erzähler hat eine bestimmte Vorstellung von sich selbst, die er jedoch immer in Bezug zu seiner Vergangenheit bringen muss. Die Erinnerung enthält dann möglicherweise ein anderes Selbstbild, ohne dass die Person bemerkt, dass es so ist.[96] Dabei fällt die Erinnerung nicht will-kürlich aus, sondern entspricht einer sozial erwartbaren Logik: es wird sich so erinnert, dass die Erinnerungen zur gegenwärtigen Situation passen, sie geben dann aber keinen Aufschluss darüber, was tatsächlich geschehen ist. Erzählgeschichten sind dann Rationalisierungen, deren Inhalte sich aus dem Zwang ergeben, sich vor anderen rechtfertigen zu müssen.
Der Erzähler ist wie jeder andere Autor gewissen Zwängen unterworfen. Er muss eine »gute« Story erzählen. Sie muss irgendwie Sinn machen, zusammenhängend sein, so dass, selbst wenn die Ursachen kompliziert, verworren oder unbe-kannt sind, immer eine plausible Geschichte zusammengebastelt werden muss.[97]
Schon allein der Gebrauch von Sprache zwingt den Erzähler zu einer kohärenten Darstellung des Geschehens, und wie die experimentelle Psychologie inzwischen herausgefunden hat: auch dann, wenn überhaupt kein objektiver Zusammenhang besteht.[98] Das Sprachsubjekt muss fort-laufend Verrenkungen machen, um seine eigene konstruierte Identität zu bewahren. Denn eine der wichtigsten Annahmen des Ichs ist, dass es eine dauerhafte Identität besitzt. Zutreffend ist jedoch eher der umgekehrte Fall: nicht das Ich erinnert und erzählt die Geschichte, sondern die Geschichte konstruiert, entwirft, inszeniert und vertextet das erzählende Ich, das durch die Geschichte erst zu einem solchen gemacht wird. Denn ein einmal gewähltes Erzählschema verleitet den Erzähler ganz von selbst zu einem sinnvollen Entwurf der Geschichte, in deren Verlauf sich dann die Konstruktionen gegenseitig stabilisieren:
In diesem Sinne erzwingt das Erzähl-Schema den konsistenten Entwurf einer Geschichte, der jedoch in dem Maße, wie ihm Konsistenz und Schlüssigkeit, Wahrscheinlichkeit und Anschaulichkeit und schließlich Interesse und Zustimmung anderer zukommt, seinen Entwurfscharakter immer mehr verliert, weil es immer schwieriger wird, gegen die Überzeug-ungskraft eines komplexen konsistenten Systems zu denken [...] Damit wird das kognitive System gewissermaßen ein Opfer seiner eigenen Verführungskünste; es kann die Kohärenz, die es erzeugt, nicht leugnen, und erliegt dadurch selbst der Überzeugungskraft, auf die hin seine Konstruktionen angelegt sind.[99]
Das Ich-Bewusstsein ist dann erzählend, rechtfertigend und begründend am Werk und bemerkt nicht einmal, wie es eine Konstruktion aufrechterhält, die ihm vielmehr aufgezwungen wird als ihm frei zur Disposition steht. Der Sprecher ist dann nicht Subjekt, sondern Produkt seiner Erzählung. Obwohl also Erzählungen nachträglich etwas zu rationalisieren versuchen, sagen sie im allgemeinen nichts darüber aus, was tatsächlich geschehen ist (auch deswegen nicht, weil zum Zeitpunkt der Rechtfertigung andere Erfüllungs- oder Wahrheitsbedingungen zu-treffen als zum Zeitpunkt der erlebten Vergangenheit). Eine Rechtfertigung gibt dann nicht so sehr Aufschluss darüber, was in einem Bewusstsein vor sich gegangen ist, sondern welches die Spielregeln des sozialen Verhaltens sind (vgl. Münch 1998, S. 36 f.).
Erinnerungen werden so konstruiert, dass sie Konsistenz hinsichtlich der gerade vorliegenden Situation aufweisen, dass sie also Sinn machen und anschlussfähig sind. Da das kognitive Ich im Bereich sprachlicher Beschreibungen existiert, wird es sich beim Sprechen so präsentieren, wie es glaubt, seiner eigenen Konstruktion entsprechen zu müssen. Dabei formen dann soziale Zwänge den Prozess des Erinnerns, lenken diesen in eine bestimmte Richtung, und die Erzähl-ung dient weniger der Rekonstruktion der Vergangenheit als vielmehr der Aufrechterhaltung und Anpassung der Identität. Erzählgeschichten verdanken sich also keiner zugrundeliegenden Subjektivität, denn diese ist selbst ein Effekt der Erzählung:
Ebenso wie Spinnen nicht bewusst und absichtsvoll darüber nachdenken müssen, wie sie ihr Netz spinnen sollen, und ebenso wie Biber, anders als menschliche Ingenieure, nicht bewusst und überlegt die Strukturen planen, die sie bauen, so überlegen auch wir uns (anders als professionelle menschliche Geschichtenerzähler) nicht bewusst und absichtsvoll, welche Geschichten wir erzählen sollen und wie wir sie erzählen sollen. Unsere Geschichten werden gesponnen, doch größtenteils sind nicht wir diejenigen, die sie spinnen; sie spinnen uns. Unser menschliches Bewusstsein und unsere er-zählerische Ichheit sind ihr Produkt, nicht ihre Quelle.[100]
Der Gedanke, es gebe ein intentionales Zentrum, von dem heraus Sprechakte erzeugt werden, nennt Dennett (1994a, S. 299) auch die Illusion vom »zentralen Bedeutungserzeuger«. Dennett zeigt auf anschauliche Weise, dass es im Gehirn keinen zentralen »Begriffsbildner« gibt, der etwas denkt, meint und dies dann auch noch sprachlich mitteilt. Das Bewusstsein operiert mit mehreren Stimmen (Sprechern), die dann einander diskursiv überlagern. Wenn zum Beispiel eine Person etwas Mehrdeutiges sagt und daraufhin befragt wird, was sie eigentlich gemeint habe – ein zentraler Bedeutungserzeuger muss schließlich etwas meinen! –, dann weiß es die Person manchmal selbst nicht so genau und wählt einfach eine Bedeutungsvariante, die aber ebenso gut auch hätte anders ausfallen können.[101] Das Gehirn produziert zur gleichen Zeit stets mehrere Sprechakte, von denen dann letztlich nur einer nach außen hin artikuliert wird (außer in pathologischen Fällen, wo dies nicht gelingt: aus dem Mund der Person sprudelt dann ein unzusammenhängender Wortsalat hervor). Mit dem Verschwinden des zentralen Bedeutungs-erzeugers verschwindet dann aber auch der zentral Wollende.[102]
4.4. Zusammenfassung
Das Problem der traditionellen Erkenntnistheorie war die Annahme einer Ontologie, und resultierte daraus das Problem, wie ein erkennendes Subjekt auf diese Bezug nehmen kann. Will man dieses Problem vermeiden, bietet sich zunächst eine naturalistische Erkenntnistheorie an, wie sie von Maturana und Valera im Kontext der autopoietischen Organisation lebender Systeme entwickelt worden ist. Die Erkenntnis repräsentiert dann nicht mehr irgendwelche ontologischen Entitäten, sondern ist Konstruktion einer systemexternen Umwelt, die als solche aber keine ontologische Entsprechung außerhalb des konstruierenden Systems hat. Der Objekt-bereich ist dann das Produkt der Beschreibung eines geschlossen operierenden Systems, so dass Fremdreferenz auf Objekte als Selbstreferenz auf die eigenen Beschreibungen gedacht werden muss. Diese Konzeption von Erkennen hat weitreichende Konsequenzen, denn es wird damit die Möglichkeit einer objektiven Beschreibung der Realität aufgegeben. Jeder Objekt-bereich ist beobachterabhängig und damit relativ zu anderen Objektbereichen:
Wenn wir uns in einem bestimmten Bereich operationeller Zusammenhänge befinden, dann halten wir diesen Bereich für die Wirklichkeit. Falls wir uns daran festklammern, verfallen wir in die Vorstellung einer absoluten Objektivität. Erkennen wir aber, dass dieser Bereich nur einer von den vielen möglichen Bereichen operationeller Zusammenhänge ist und dass es noch andere gibt, dann befinden wir uns nicht mehr im Bereich der absoluten Objektivität, sondern in dem Bereich der relativen »Objektivität«.[103]
Die Stärke des konstruktivistischen Wahrnehmungsparadigmas liegt darin, dass das Erkennen radikal deontologisiert wird. Eine bewusstseinsexterne Welt wird zwar nicht geleugnet, ist aber für ein erkennendes System nicht greifbar. Alle Aussagen verbleiben im Bereich sprachlicher Beschreibungen und haben keinen Bezug zu einer außerhalb der Sprache liegenden Realität. Dies gilt dann auch für das Ich-Bewusstsein, das diese Beschreibungen nicht hervorbringen kann: »Die Wirklichkeit ist nicht ein Konstrukt meines Ich, denn ich bin selbst ein Konstrukt« (Roth 1998, S. 330).
Mit dem Verschwinden des Erkenntnissubjekts muss dann aber auch die Vorstellung des Bewusstseins als Handlungssubjekt aufgegeben werden. Wie ich zu zeigen versucht habe, geht der Wille einer Handlung nicht fundierend voraus, sondern ist eine neurokognitive Konstruk-tion, die eine Handlung nachträglich mit einem Urheber versieht und damit individuell und sozial zurechenbar macht. Das Ich-Bewusstsein ist nicht das Subjekt der Handlung, denn ihm sind andere, nicht bewusste Prozesse vorgeschaltet. Der Status des Bewusstseins ändert sich damit von einem Autor oder Urheber des Geschehens zu einem Zuschauer oder beschreiben-den Kommentator. Die Einheit der Ich-Erfahrung ist dann ein Effekt der Selbstbeschreibung des Systems, gewissermaßen eine Vereinfachung für einen komplexen und erfahrungsmäßig nicht zugänglichen Prozess, der dezentralisiert, parallelverteilt, hochdynamisch und nahe an Instabilitätspunkten verläuft. Was dann in pathologischen Fällen augenscheinlich hervortritt, gilt auch für das normale Ich-Bewusstsein, das sich der Illusion hingibt, eine einheitliche und stabile Identität zu besitzen.[104] Dass das Ich möglicherweise nur eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl kognitiver Prozesse ist, haben schon andere Philosophen erkannt (insofern ist diese Erkenntnis nicht neu, sie wird nunmehr aber auch empirisch belegt). Bereits Kant hatte darauf hingewiesen, dass es innerhalb des Erlebnisstromes nichts gibt, das einem einheitlichen, konstanten Ich entspricht. Diese Einheit hatte Kant dann mit einem transzendentalen Subjekt erklärt, nämlich mit einem ursprünglichen und unwandelbaren Bewusstsein, das unpersönlich und ordnend den Lenker der Erfahrung für das empirische Bewusstseins spielt (vgl. Valera/ Thompson 1992, S. 104 f.) Auch für Hume war das Ich keine konstante Größe, sondern eine kognitive Idee für ein komplexes zusammengesetztes Phänomen, das aus Wahrnehmungen, Vorstellungen und Empfindungen besteht. Für ihn war das Ich nichts weiter als »Theater« (vgl. Roth 1998, S. 329).
Die Dekonstruktion des Subjekts als Erkenntnis- und Handlungszentrum führt zu der Einsicht, dass das Ich-Bewusstsein ein von Grund auf dissonantes, geteiltes, gespaltenes, oszillierendes und interferierendes Ich ist, jedenfalls nicht ein zugrundeliegendes Subjekt. Ein komplexes System kann durch rekursives Operieren Schemata erzeugen, die es dem System ermöglichen, Beschreibungen anzufertigen, inklusive einer Beschreibung von sich selbst, die dann als »Ich« empfunden wird. Die Konkurrenz von Beobachtungsoperationen kann dann dazu führen, dass eine Diskrepanz zwischen körperlichen (unbewussten) und bewussten Beobachtungsprozessen entsteht: Während etwa der Körper eine Bedrohung längst wahrgenommen hat, kann sich das Bewusstsein noch Gedanken darüber machen, wie es diese Bedrohung leugnet oder dafür anderweitig eine Erklärung finden. Die Folgen solcher Pseudorationalisierungen sind dann häufig »psychosomatische« Störungen, wenn nämlich die unbewusste Registrierung einer Be-drohung (z.B. Einsamkeit) vom Bewusstsein zensiert wird, wenn also das anhaltende Krisen-management zwischen unbewussten und bewussten Beobachtungsprozessen unwillkürlich zur Gewohnheit wird und dann zu chronischen Schmerzen, Muskelanspannungen und dergleichen führt. Das Ich-Bewusstsein als Kommentator des Geschehens wird dann angeheuert, eine für den bewussten oder öffentlichen Gebrauch bestimmte Geschichte zu ersinnen, die ein den Erwartungen entsprechendes Bild seiner selbst verstärkt, wobei aber die Realität der unbewusst ablaufenden Prozesse geleugnet oder entstellt wird (vgl. Claxton 1997, S. 223 ff.).
Diese Diskrepanz von unbewussten und bewussten Beobachtungsprozessen bringt auch der französische Psychoanalytiker Jacques Lacan zum Ausdruck, der die Theorie der Ich-Werdung als Prozess der Entfremdung versteht. Für Lacan gibt es keine präexistente Subjektivität, da ein Subjekt immer erst durch Eingliederung in eine symbolische Ordnung zu existieren beginnt. Es kommt dann zu einer Spaltung oder Verdoppelung des Subjekts auf der sprachlichen Ebene, denn es entsteht eine Sprache (eine symbolische Ordnung) des Unbewussten, die mit der Sprache des Bewusstseins konkurriert:
Das Subjekt verdoppelt sich auf sprachlicher Ebene: Es teilt sich in eine bewusste und eine unbewusste Instanz, die ein-ander diskursiv überlagern, ineinandergreifen und in der Alltagssprache kaum zu unterscheiden sind [...] Das zwischen Bewusstem und Unbewusstem gespaltene Subjekt erscheint dezentriert, weil es unablässig zwischen Bewusstem und Unbewusstem oszilliert und folglich nicht weiß, von wo aus es spricht: als Bewusstsein oder als Unbewusstes.[105]
Auch bei Lacan wird also die Vorstellung aufgegeben, das Subjekt sei eine über Sprache verfügende Autorität, welcher frei zur Disposition stehen würde, wie sie zu denken hat und diese Gedanken sprachlich miteilen will.[106] Wenn aber das erzählerische Ich nicht Subjekt ist, weil es nur im Bereich sprachlicher Beschreibungen existiert, dann muss das Verhältnis um-gedreht werden: nicht das Ich erzählt die Geschichte, sondern die Erzählung ruft verschiedene »Subjekte« auf den Plan, die je nach sozialen Umständen und Bedingungen unterschiedlich in Anspruch genommen werden. Oder in anderen Worten ausgedrückt: »Das (Pseudo-)Subjekt spricht und handelt im Rahmen von narrativen Programmen, die es nicht selbst entworfen hat« (Zima 2000, S. 229).
Ich habe bisher versucht, den Menschen als Erkenntnis-, Sprach und Handlungssubjekt zu dekonstruieren und mich dabei auf die Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus ge-stützt. Meine Kritik am Radikalen Konstruktivismus richtet sich gegen die zu starke Betonung des Gehirns, das als Referenz für Erkennen und Handeln in Anspruch genommen wird. Man gelangt dann schnell zu dem Schluss, dass jedes Erkennen (weil von individuellen Gehirnen konstruiert) primär subjektabhängig ist. Es stellt sich nämlich die Frage, ob der »Blick in das Gehirn« zum Verständnis kognitiver Prozesse ausreicht: »Aus einer Reihe von Gründen scheint es zweifelhaft, dass die Neurobiologie allein eine angemessene Wahrnehmungstheorie liefern könnte und dass sich in neurobiologischen Beschreibungen alles Relevante über Wahr-nehmung sagen ließe« (Engel/König 1998, S. 184). Der Versuch, Kognition individualistisch zu erklären, wird dann von den Autoren auch treffend als »Neuro-Chauvinismus« bezeichnet. Dennoch dürfen die Ergebnisse des Radikalen Konstruktivismus nicht unterbewertet werden. Der Blick in das Gehirn ist nur ein erster Schritt für ein Verständnis von Kognition. Je mehr man jedoch über das Gehirn herausfindet, desto deutlich wird, dass die Bezugsgröße Mensch zwar eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für eine Theorie des Erkennens ist. Obwohl also eine naturalistische Erkenntnistheorie zunächst beim Gehirn ansetzt, bedeutet das nicht, dass man deshalb auch auf dieser Ebene verbleiben muss. Maturana deutet die Richtung an, wenn er das erkennende Subjekt im Bereich der Sprache ansiedelt und zu dem Schluss kommt: »In diesem Sinn ist Kognition also sozialer Art. Sie findet nicht im Gehirn statt, son-dern in der sozialen Dynamik« (Maturana in Riegas/Vetter 1993, S. 75).
5. Die Theorie beobachtender Systeme in der Soziologie
5.1. Der Beobachter als selbstreferentielles System
Es sieht so aus, als würde sich die Soziologie eine Reihe von Problemen einhandeln, die sich daraus ergeben, dass sie ein zu enges Verständnis von Kognition nahe legt. Als Referenz des Erkennens wird nämlich der Mensch, namentlich das Subjekt, genannt.[107] Es gibt jedoch keinen theoretischen Grund, das Erkennen von vornherein auf den Menschen zu beschränken, und die Theorie beobachtender Systeme macht diese Engführung auch nicht mit. Maturana hat die Fähigkeit zu Kognition auf alle Lebensformen ausgeweitet, die über ein mehr oder weniger komplexes Nervensystem verfügen und interne Beschreibungen herzustellen imstande sind. Die Systemtheorie radikalisiert diese Annahme und überträgt das Beobachterkonzept auf alle Systeme, die zu Differenzwahrnehmung fähig sind. Ausgangspunkt einer systemtheoretischen Konzeption des Erkennens ist dann ein extrem formaler Beobachtungsbegriff: Beobachtung wird definiert als Operation des Unterscheidens und Bezeichnens.[108] Dabei muss unterschieden werden zwischen einer Operation und einer beobachtenden Operation. Eine Operation ist noch keine Beobachtung, aber jede Beobachtung ist notwendig an eine Operation gebunden. Eine Operation findet faktisch statt, sie orientiert sich an der Differenz von vorher/nachher und markiert einen Zeitunterschied.[109] Eine Beobachtung (eine beobachtende Operation) liegt dann vor, wenn durch eine Operation etwas unterschieden und die eine Seite der Unterscheidung dann bezeichnet und für weitere Operationen zur Verfügung gestellt wird. Der reale Vollzug dieser Beobachtungsoperationen erzeugt schließlich eine Form: »Bei rekursiver Fortsetzung des Operierens entwickelt sich daraus eine Systemgrenze, die einschränkt, was in diesem System beobachtet wird. Es entsteht das, was wir dann ›der Beobachter‹ nennen können« (Luhmann 1992, S. 82). Mit Beobachter ist also ein System gemeint, das fortlaufend Unter-scheidungen und Bezeichnungen prozessiert: »Unterscheidung und Bezeichnung ist dabei als Operation eines Beobachters begriffen. Dieser Beobachter operiert mit Bezug auf eigene andere Operationen, operiert also als System« (Luhmann 1993, S. 29).
Der Begriff des Beobachtens impliziert nicht, dass ein Subjekt diese Operationen ausführt. Das Beobachten benötigt keine privilegierte Instanz, die als Träger der Beobachtungsoperationen fungiert: der Beobachter wird stattdessen als Kondensat von Beobachtungsoperationen erklärt (vgl. Luhmann 1992, S. 113).
In der Ausbuchstabierung des Beobachters als Prozess-System liegt dann auch die entscheiden-de theoretische Neuerung der Systemtheorie. Das Beobachterkonzept Luhmanns knüpft zwar an das Autopoiesis-Konzept von Maturana an, generalisiert dieses jedoch und überträgt es auf alle Systeme, die sich durch die rekursive Ermöglichung eigener Operationen durch die Resultate eigener Operationen auszeichnen (vgl. Luhmann 1999, S. 94 f.). Die Beschränkung des Autopoiesis-Konzept auf lebend beobachtende Systeme macht Luhmann also nicht mit. Der Autopoiesis-Begriff bezieht sich bei Luhmann stattdessen auf die Selbstreferenz von Operationen, die zur Fortsetzung von Operationen desselben Typs führen.[110] Der Beobachter ist dann erst mit dem Vollzug seiner eigenen Operationen gegeben, und die Art der Operationen entscheidet darüber, um welches Beobachtersystem es sich dabei handelt:
Damit ist keineswegs nur an Bewusstseinsprozesse, also nicht nur an psychische Systeme zu denken. Der Begriff wird hochabstrakt und unabhängig von dem materiellen Substart, der Infrastruktur oder der spezifischen Operationsweise be-nutzt, die das Durchführen von Beobachtungen ermöglicht.[111]
Damit wird offengelassen, auf welcher Realitätsbasis das Beobachten erfolgt. Im Unterschied zu Maturana, der ausschließlich die Erkenntnisfähigkeit lebender Systeme im Blick hat, ist bei Luhmann der Begriff des Beobachtens indifferent gegen die Form der Autopoiesis, »also in-different dagegen, ob als Operationsform Leben oder Bewusstsein oder Kommunikation be-nutzt wird. Er ist auch indifferent gegen die Form der Aufzeichnung (Gedächtnis)« (Luhmann 2001, S. 222). Vielmehr entscheidet die Art der Elemente, die miteinander operativ verknüpft werden, über die Art der Autopoiesis des Systems, und damit auch, zu welcher Beobachtung das System fähig ist. Für Luhmann ist Selbstreferenz keine Sonderleistung eines denkenden Bewusstseins, sondern ein sehr allgemeines Systembildungsprinzip, und gibt es dann viele ver-schiedene Möglichkeiten, die Welt zu beobachten, je nach dem, welche Systemreferenz dabei zugrunde gelegt wird (vgl. Luhmann 2001a, S. 95).
Nicht jeder Beobachter ist immer schon gleich auf Erkenntnis spezialisiert, denn die Begriffe Beobachten und Erkennen sind nicht gleichbedeutend. Das Beobachten verweist lediglich auf das System und seine Operationen: »Das Beobachten ist der operative Vollzug einer Unter-scheidung durch Bezeichnung der einen (und nicht der anderen) Seite« (Luhmann 1992, S. 84). Zu Erkenntnis kommt es erst dann, wenn ein beobachtendes System beginnt, komplexe Beobachtungen in Form von Beschreibungen anzufertigen: »Erkenntnis wird demnach durch Operationen des Beobachtens und des Aufzeichnens von Beobachtungen (Beschreiben) ange-fertigt. Das schließt Beobachten von Beobachtungen und Beschreiben von Beschreibungen ein« (Luhmann 2001, S. 222). Ein erkenntnisfähiges System muss also seine Beobachtungen auf Dauer stellen, es muss sich ein Gedächtnis anlegen. Zu diesem Zweck muss das System Redundanzen aufbauende und Redundanzen störende Operationen benutzen, so dass dann bestimmte Beobachtungen wahrscheinlicher, andere wiederum unwahrscheinlicher werden (vgl. Luhmann 1993, S. 40).
Hatte man in der ontologischen Denktradition die Welt als Seinszustand vorausgesetzt, die man nur noch richtig erkennen und bezeichnen brauchte (Paradigma der Annäherung an eine unabhängig vom Beobachter existierende Wirklichkeit), so besagt die Theorie beobachtender Systeme, dass im Vollzug von Beobachtungsoperationen Realität konstruiert wird. In der traditionellen Erkenntnistheorie galt die Identität eines Objekts dadurch gesichert, dass es allen Subjekten, die ihren Verstand richtig gebrauchen, als dasselbe erscheint. Wird das Subjekt aber durch den Beobachter ersetzt, dann entfällt jede Objektgarantie. Jeder Objektbereich ist eine systemabhängige Konstruktion, die davon abhängt, mit welchen Unterscheidungen ein System beobachtet: »Wenn wir das Subjekt durch den Beobachter ersetzen und Beobachter definieren als Systeme, die sich selbst durch die sequentielle Praxis ihres Unterscheidens erzeugen, ent-fällt jede Formgarantie für Objekte« (Luhmann 1999a, S. 878). Für die Wissenschaft gilt des-halb, dass sie »an einer Weltkonstruktion arbeitet, die durch ihre Unterscheidungen, aber nicht durch die Welt an sich, gedeckt ist« (Luhmann 1992, S. 102). Die Erkenntnis hat dann keine ontologische Entsprechung außerhalb des erkennenden Systems mehr: »Die Erkenntnis bleibt einzigartig als unterscheidungsbasierte Konstruktion. Als solche kennt sie nichts, was außer-halb ihrer ihr selbst entsprechen würde« (Luhmann 2001, S. 233). Das bedeutet nicht, dass es keine Realität außerhalb eines Beobachters gibt, sondern nur, dass die Unterscheidung von Sein und Nichtsein aufgegeben werden muss:
Das heißt nicht, dass die Realität geleugnet würde, denn sonst gäbe es nichts, was operieren, nichts, was beobachten, und nichts was man mit Unterscheidungen greifen könnte. Bestritten wird nur die erkenntnistheoretische Relevanz einer ontologischen Darstellung der Realität.[112]
Die primäre Realität liegt deshalb für Luhmann nicht in der Welt »da draußen«, sondern im Vollzug von Beobachtungsoperationen, wodurch dann das entsteht, was ein Beobachter als »Realität« bezeichnet. Als systeminterne Konstruktion einer systemexternen Umwelt ist diese Realität aber nicht Abbild einer ontologisch vorfindlichen Realität, sondern ein Indikator für erfolgreiche Konsistenzprüfungen im System (vgl. Luhmann 1996, S. 17 ff.). Außerhalb eines beobachtenden Systems existiert also durchaus noch etwas, doch bleibt dieser Bereich für das System kognitiv unzugänglich, da ein Beobachter nicht aus seinen eigenen operativen Bereich heraustreten kann.
Die These des operativen Konstruktivismus führt also nicht zu einem »Weltverlust«, sie bestreitet nicht, dass es Realität gibt. Aber sie setzt Welt nicht als Gegenstand, sondern im Sinne der Phänomenologie als Horizont voraus. Also als un-erreichbar. Und deshalb bleibt keine andere Möglichkeit als: Realität zu konstruieren und eventuell: Beobachter zu be-obachten, wie sie die Realität konstruieren.[113]
Werden Beobachter beobachtet, wie sie Realität konstruieren, dann handelt es sich um eine Beobachtung zweiter Ordnung. Diese beobachtet, wie eine andere Beobachtung beobachtet, das heißt: welche Unterscheidungen einer anderen Beobachtung zugrunde liegen.[114] Eine Beob-achtung zweiter Ordnung liegt dann (und nur dann) vor, wenn unterschieden wird, welche Unterscheidungen ein Beobachter, der man selbst oder ein anderer sein kann, benutzt. Mit der Beobachtung zweiter Ordnung wird es dann möglich, Beobachter zu beobachten und zu sehen, was diese selbst nicht sehen können, man beobachtet in diesem Fall den Beobachter als Beobachter.[115] Auf der Ebene der Beobachtung zweiter Ordnung wird dann die beobachtungs-leitende Unterscheidung umgestellt, aber man bezieht deshalb keine hierarchisch höherwertige Position: man beobachtet nicht besser, sondern lediglich anders (vgl. Luhmann 1992, S. 86 f.).
5.2. Selbstbewusstsein als Effekt von Beobachtungsoperationen
Die klassische Erkenntnistheorie nahm an, dass es ein Subjekt gibt, das der Welt erkenn-end gegenübersteht. Die Sonderbehandlung des Menschen als Subjekt wurde dann mit dem Besitz von subjektiver Wahrnehmung und Selbstbewusstsein begründet. Das erlebende Ich ist sich seiner selbst bewusst, und sollte dies zugleich die Voraussetzung dafür sein, dass das Ich denken, handeln und sich sprachlich mitteilen kann. Wie man jedoch heute weiß, sind auch einfachste Lebewesen und sogar künstliche Systeme zu Differenzwahrnehmung fähig und ver-fügen deshalb zumindest über eine Subjektivität der Erfahrung:
Der Besitz subjektiver Wahrnehmung ist nicht unbedingt an den Besitz eines Nervensystems gekoppelt, wie auch um-gekehrt die Abwesenheit eines Nervensystems nicht Abwesenheit der Subjektivität der Erfahrung bedeutet, sondern nur ihre Auflösung in einen allgemeinen, undifferenzierteren Wahrnehmungsstrom, der vielleicht vage unserer Empfindung von Lust und Schmerz ähnelt. Die Fähigkeit zu Wahrnehmungen dieser Art ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein uni-verselles Merkmal aller in der Natur vorkommenden Systeme.[116]
Die Systemtheorie erklärt alle Systeme zu Beobachtern, wenn diese auf die Operation des Unterscheidens und Bezeichnens zurückgreifen. Damit wird offengelassen, inwieweit man »auch labile Großmoleküle oder Amöben, Immunsysteme oder Gehirne, Zellen oder tierische oder menschliche Organismen als Beobachter bezeichnen kann« (Luhmann 1992, S. 82). Wie Maturana gezeigt hat, wird der Wahrnehmungsbereich durch ein komplexes Nervensystem erheblich ausgeweitert (da eine Vielzahl von Unterscheidungen ausgebildet werden können), doch ist Wahrnehmung nicht notwendigerweise an das Vorhandensein eines Nervensystems gebunden. Der systemtheoretische Beobachterbegriff geht nun davon aus, dass jedes differenz-wahrnehmende System ein beobachtendes System ist.[117] Die Systemtheorie unterscheidet dann operierende Systeme, beobachtend operierende Systeme und erkennend beobachtende Systeme. Letztere können ihre eigenen Beobachtungen ordnen und interne Beschreibungen an-fertigen, sie sind dann gedächtnisbasierte beobachtende Systeme. Es besitzen damit alle beob-achtenden Systeme über eine rudimentäre Form von Bewusstsein, doch nur die wenigsten von ihnen verfügen über ein Selbstbewusstsein. Bevor ich das Entstehen von Selbstbewusstsein mit Hilfe der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz erklären werde, möchte ich noch einmal auf den Begriff der Intentionalität eingehen. Dies deshalb, weil das Konzept der Intentionalität vorschnell an Selbstbewusstsein und Sprache gekoppelt wird, dabei aber andere Spielarten von Intentionalität und Bewusstsein ausgeblendet werden.
Die Kognitionswissenschaften überwinden allmählich die Idee, dass für das Vorhandensein von Intentionalität eine intelligible Struktur oder eine denkende Rationalität vorausgesetzt werden muss. Es setzt sich zunehmend die Einsicht durch, dass intentionales Verhalten mit Begriffen und Konzepten aus der second-order-Kybernetik ausreichend beschrieben werden kann. Derartige Erklärungsansätze implizieren dann keinen Mentalismus mehr, »denn was tatsächlich abläuft, lässt sich mit Hilfe des Konzepts der negativen Rückkopplung beschreib-en« (Münch 1998, S. 21). Gewöhnlich wird die Fähigkeit, sich intentional zu verhalten, also handeln zu können, nur solchen Wesen zugesprochen, die sich intelligent, absichtsvoll und zielorientiert bewegen, mit anderen Worten: wenn sie mit ihrem Tun einen subjektiven Sinn verbinden und deshalb Gründe dafür angeben können. Da die Begründung des eigenen Tuns aber die Kompetenz zum Sprechen voraussetzt, ist das Konzept der Intentionalität von vorn-herein an Sprache gekoppelt. Mit der Beschränkung auf denk- und sprachfähige Systeme wird also bereits im Vorfeld darüber entschieden, was als kognitives System zugelassen werden soll und was nicht.[118]
Diese Engführung wird jedoch nicht von allen Kognitionsforschern geteilt. Die Kritik richtet sich dann gegen die Vorstellung, dass es so etwas wie eine ursprüngliche oder intrinsische Intentionalität gibt. Der Kognitionsforscher Daniel Dennett zeigt an zahlreichen Beispielen, wie problematisch es ist, intentionales Verhalten an das Vorhandensein von Sprache binden zu wollen.[119] Dennett erklärt auf anschauliche Weise, wie aus einfachen Kohlenwasserstoffverbin-dungen sich selbstverdoppelnde Makromoleküle entstehen können, »die so komplex sind, dass sie Handlungen ausführen können, statt nur herumzuliegen und Wirkungen zu haben. Ihre Handlungsfähigkeit ist nicht so umfassend ausgebildet wie unsere. Sie wissen nicht, was sie tun« (Dennett 1999, S. 33). Aus diesen Bausteinen des Lebens haben sich im weiteren Verlauf durch Systembildungsprozesse immer komplexere Bausteine entwickelt, die jedoch alle auf dieser rudimentären Handlungsfähigkeit aufbauen oder sich von dieser ableiten:
Die Handlungsfähigkeit der Makromoleküle sieht anders aus; für das, was sie tun, gibt es zwar Gründe, aber dieser Gründe sind sich die Makromoleküle nicht bewusst. Dennoch ist ihre Art der Handlungsfähigkeit der einzig mögliche Nährboden, auf dem der Same unserer eigenen Handlungsfähigkeit wachsen kann.[120]
Für Dennett sind alle differenzwahrnehmenden Entitäten intentionale Systeme, und der Blick-winkel, von dem aus ihre Handlungsfähigkeit beobachtet wird, ist der intentionale Standpunkt. Intentionalität ist dann wie bei Maturana eine Beobachterkategorie, ist also eine beobachtete Intentionalität. Diese wird jedoch von einem Beobachter oft als intrinsische Intentionalität, als ureigene Absicht, wahrgenommen, und der Beobachter wird deshalb annehmen, dass sich alle menschlichen Produkte dieser ursprünglichen Intentionalität verdanken. Externalisierungen (Sprache, Architektur, Kunst, Kultur) werden deshalb von ihm auf ein subjektives Bewusstsein zurückgeführt, was den Beobachter dann zu folgender Beschreibung veranlassen wird:
Äußere Repräsentationen erhalten also ihre Bedeutung – ihre Intensionen und Extensionen – durch die Bedeutung der inneren, geistigen Zustände und Handlungen der Menschen, die sie hervorbringen und benutzen. Diese geistigen Zu-stände und Handlungen besitzen ursprüngliche Intentionalität.[121]
Auf die Frage, wie Intentionalität »aus sich selbst heraus« überhaupt möglich sein kann, hatte die subjektphilosophische Tradition damit geantwortet, dass alle geistigen Zustände von sich aus eine innere Bedeutung haben, weil sie »erstaunlicherweise in einer Art Sprache formuliert sind – in der Sprache des Denkens. In Mentalesisch« (Dennett 1999, S. 69). Dies ist selbstver-ständlich ironisch gemeint, denn der Autor selbst bezweifelt ja die Existenz einer ursprüng-lichen subjektiven Sinnquelle. Seine These ist, dass jede Form von Intentionalität immer schon aus anderen Formen abgeleitet ist. Oder anders ausgedrückt: jede denkende Rationalität ver-dankt sich immer schon einem Komplex nichtdenkender Operationen, weshalb es weder eine ursprüngliche Intelligenz noch eine organisierende Subjektivität gibt, die als Gravitations-zentrum herhalten kann.
Vergleicht man den intentionalen Standpunkt Dennetts mit dem Beobachterbegriff Luhmanns, dann wird man Gemeinsamkeiten feststellen können. Wo Dennett von intentionalen Systemen spricht, ist es bei Luhmann der Beobachter, und beide gehen davon aus, dass beobachtenden Prozessen kein subjektiver Träger zugrunde liegt. Sowohl Dennett als auch Luhmann unter-scheiden zwischen einfachen Beobachtersystemen ohne Selbstbewusstsein und komplex auf-gebauten Beobachtersystemen mit Selbstbewusstsein. Beide stimmen darin überein, dass man zwischen Wahrnehmung und Wahrnehmung der Wahrnehmung, zwischen Beobachtung und Beobachtung der Beobachtung, zwischen Bewusstsein und Bewusstsein des Bewusstseins unterscheiden muss. Für beide ist Selbstbewusstsein ein Effekt von Beobachtungsoperationen, im Gegensatz zu Kant, der darin eine transzendentale Voraussetzung gesehen hat, damit das Subjekt sich in jedem Akt seines Erlebens als einheitliches Ich wahrnehmen kann. Nach Kant beruht das Selbstbewusstsein nicht auf empirischen Operationen, sondern wird durch die trans-zendentale Struktur als Vermögen bereitgestellt: »Dieses Bewusstsein meiner selbst als des identischen Subjekts meines mentalen Lebens ist, wie Kant betont hat, nicht durch Erfahrung vermittelt, sondern Voraussetzung für Erfahrungen« (Kutschera 1993, S. 231). Da die System-theorie keine transzendentale Voraussetzung nötig hat, erklärt sie das Selbstbewusstsein als Produkt empirischer Beobachtungsoperationen. Denn ein Beobachter kann bei rekursiver An-wendung dazu übergehen, seine eigenen Operationen zu beobachten:
Jede einzelne Beobachtung macht einen Unterschied, indem sie eine Unterscheidung wählt. Eben deshalb ist es mög-lich, dass eine Operation eine andere beobachtet und die durch diese erzeugte Differenz thematisiert, was die beobacht-ete Beobachtung nicht kann. Das kann (muss aber nicht) in ein und demselben System geschehen. Auf diese Weise ist in einem System das möglich, was wir Selbstbeobachtung nennen werden.[122]
Zu Selbstbeobachtung kommt es, wenn ein System hinreichend komplex geworden ist und es neben zahlreichen anderen Unterscheidungen die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz einführt: es benutzt diese Unterscheidung dann, um sich selbst als System zu bezeichnen. Es kann dann seine eigenen Systemoperationen beobachten, kann es sich selbst als ein beobachtendes System wahrnehmen. Die Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremd-referenz spezialisiert also das System darauf, sich selbst von seiner Umwelt zu unterscheiden und sich diesen Unterschied bewusst zu machen:
Ein System kann, wenn hinreichend komplex, vom Beobachten seiner Operationen zum Beobachten seines Beobacht-ens und schließlich zur Beobachtung des Systems selbst übergehen. In diesem Fall muss es die Unterscheidung »System und Umwelt« zu Grunde legen, also Selbstreferenz und Fremdreferenz unterschieden können. Aber auch dies geschieht, anders wäre es keine Selbst beobachtung, durch Operationen des Systems im System.[123]
Die Subjektivität des Bewusstseins ist somit ein Effekt der Verdopplung des Systems, wenn nämlich mit dieser Unterscheidung die Differenz von System und Umwelt plötzlich zweimal vorkommt: »als durch das System produzierter Unterschied und als im System beobachteter Unterschied« (Luhmann 1999, S. 45). Man kann nun meinen, dass jeder Beobachter, dessen Nervensystem hinreichend komplex ist, diese Unterscheidung ausbildet und deshalb über ein Selbstbewusstsein verfügt. Dies ist aber offensichtlich nicht der Fall. Obwohl sich das Gehirn des Menschen nicht wesentlich von anderen Lebewesen unterscheidet, besitzt einzig und allein der Mensch ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Ich stelle nun folgende Behauptung auf: das Vorhandensein eines Nervensystems ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung, um ein reflektierendes Selbstbewusstsein ausbilden zu können.[124] Entweder geht man wie Kant davon aus, dass die Fähigkeit zur Selbstreflexion noch vor aller Kommunikation gegeben ist, oder man geht den umgekehrten Weg und behauptet, dass Selbstreflexion ein Effekt der Teil-nahme an gesellschaftlicher Kommunikation ist. In diesem Fall wäre dann aber zu klären, wie Kommunikation – wenn nicht von Subjekten konstituiert – möglich ist, und müssen dann die Konsequenzen dieser Konzeption besprochen werden.
5.3. Zum Verhältnis von Bewusstsein und Kommunikation
In den Sozialwissenschaften wird Kommunikation meist als Handlung begriffen und das Zustandekommen der gesellschaftlichen Wirklichkeit dann auf Handlungssubjekte, auf deren subjektives Bewusstsein, zurückgeführt: es sind Subjekte, die denken, entscheiden, handeln und kommunizieren. Für die soziologische Systemtheorie ist es jedoch einzig und allein die Kommunikation, die als Letztelement des Sozialen infrage kommt (was nicht bedeutet, dass das Bewusstsein keine Rolle mehr spielt, nur ist es nicht der letzte Bezugspunkt des Sozialen). Man muss dann allerdings sehen lernen, was genau der Unterschied zwischen Handlung und Kommunikation ist, denn häufig wird Kommunikation mit Handlung gleichgesetzt: sie meint dann lediglich eine spezifische Form des menschlichen Handelns.
Die Handlungstheorie in der Tradition von Max Weber versteht unter einem sozialen Ereignis ein Verhalten, wenn damit ein subjektiver Sinn verbunden ist, der sich auf eine andere Person richtet.[125] Demnach würde ein soziales Ereignis bereits schon dann vorliegen, wenn jemand etwas zu kommunizieren beabsichtigt, dieser Versuch aber unbeobachtet bleibt.[126] Da das Soziale daran nicht so recht erkennbar ist, dreht Luhmann das Verhältnis einfach um und be-stimmt Kommunikation nicht vom Sprecher (Alter), sondern vom Hörer (Ego) ausgehend. Ein soziales Ereignis liegt dann vor, wenn jemand versteht, dass jemand anderes eine Mitteilung macht. Kommunikation beginnt also mit der Fähigkeit, Information und Mitteilung vonein-ander zu unterscheiden:
Im Unterschied zu bloßer Wahrnehmung von informativen Ereignissen kommt Kommunikation nur dadurch zustande, dass Ego zwei Selektionen unterscheiden und diese Differenz seinerseits handhaben kann. Der Einbau dieser Differenz macht Kommunikation erst zur Kommunikation, zu einem Sonderfall von Informationsverarbeitung schlechthin.[127]
So ist etwa das Stimmengewirr in einer Straßenbahn für einen Beobachter lediglich eine Ab-folge informativer Ereignisse – man hört, was sich andere zu erzählen haben. Kommunikation kommt aus der Sicht des Beobachters erst dann zustande, wenn er eine Information als Mitteil-ung einer Information versteht: »Kommunikation kommt nur zustande, wenn ein Beobachter imstande ist, in seinem Wahrnehmungsbereich zwischen Mitteilung und Information zu unter-scheiden, also Mitteilung als Mitteilung einer Information (statt einfaches Verhalten) zu ver-stehen« (Luhmann 1993, S. 56). Anders ausgedrückt: Kommunikation kommt zustande, wenn eine Information mitgeteilt wird und jemand anderer dabei irgendetwas versteht.[128]
Es gibt zwei Verstehensformen in einer Kommunikation: das operative und das strukturelle Verstehen. Operatives Verstehen meint: es wird verstanden, dass kommuniziert wird, dass es sich also um eine Mitteilung und nicht um einfaches Verhalten handelt (vgl. Luhmann 1999, S. 96 ff.). Für das operative Verstehen der Kommunikation spielt es keine Rolle, was dabei die Bewusstseinssysteme psychisch verstehen. Ein Kommunikationssystem hält seine Autopoiesis solange aufrecht, wie das operative Verstehen funktioniert. Für erfolgreiches Kommunizieren muss also nicht unbedingt der gemeinte Sinn eines anderen Bewusstseins verstanden werden, entscheidend ist, dass die Mitteilungen so prozessieren, dass weitere Mitteilungen anschließen können. Bewusstseinssysteme erarbeiten sich dann selbst ihren Sinn, den sie einer Mitteilung abgewinnen, denn eine Mitteilung ist zunächst »nichts weiter als ein Selektionsvorschlag, eine Anregung. Erst dadurch, dass diese Anregung aufgegriffen, dass die Erregung prozessiert wird, kommt Kommunikation zustande« (Luhmann 1984, S. 194). Der Sprecher hat also kaum Ein-fluss darauf, wie das Gesagte beim Hörer ankommt:
Dem Autor einer Mitteilung ist dadurch die Kontrolle über ihre psychischen und kommunikativen Sinneffekte entzogen. Was als gemeinsamer Knotenpunkt bleibt, von dem aus die verschiedenen Sinneffekte ihren Ausgang nehmen, ist das zitierfähige Mitteilungsereignis. Variabel und zukunftsoffen sind demgegenüber die Informationsgehalte, die dieser Mitteilung im Verstehen abgewonnen werden können. Der verstandene Sinn kristallisiert sich zwar an der Mitteilung und ist an das Mitteilungsereignis gebunden. Das Verstehen ist jedoch produktiv.[129]
Das strukturelle Verstehen bezieht sich dann auf die inhaltliche Seite der Kommunikation und kommt zweigeteilt vor: als psychisches Verstehen im Bewusstsein und als soziales Verstehen in der Kommunikation. Das soziale Verstehen meint, dass die nachfolgende Kommunikation bestimmt, wie sie die vorangegangene Kommunikation versteht (beobachtet, wahrnimmt, interpretiert). Jede Anschlusskommunikation weist einer vorangegangenen Kommunikation einen Sinn zu und bestimmt, was diese gemeint hat: »Erst die Reaktion schließt die Kommuni-kation ab, und erst an ihr kann man ablesen, was Einheit zustande gekommen ist« (Luhmann 1984, S. 212). Eine Kommunikation bleibt deshalb solange sozial unbestimmt, bis eine andere Kommunikation anschließt und festlegt, wie sie die vorangegangene Kommunikation versteht:
Die mitgeteilte Information kann auf sehr unterschiedliche Weise verstanden werden. In welcher Weise dies geschieht, entscheidet allein die Kommunikation. Dass die Kommunikation selbst festlegt, was als Verstehen erreicht wird, besagt nichts anderes, als dass allein aus der Anschlusskommunikation hervorgeht, was und in welcher Weise verstanden wurde. In diesem Sinne ist Verstehen eine Komponente des Kommunikationsgeschehens und kein Bewusstseinsereig-nis.[130]
Das soziale Verstehen der Kommunikation bewirkt, dass Anschlussmöglichkeiten eröffnet und reduziert werden. Jede Kommunikation verweist dann in zwei Richtungen: »Nach rückwärts gerichtet trifft sie eine Auswahl aus den Anschlussmöglichkeiten, die von vorausgegangenen Mitteilungen eröffnet wurden. Nach vorne gerichtet eröffnet sie neue Möglichkeiten des Weitermachens« (Schneider 1994, S. 169). Damit wird zum Ausdruck gebracht, was Luhmann unter Sinn versteht. Sinn bedeutet »Selektion aus anderen Möglichkeiten und damit zugleich Verweisung auf andere Möglichkeiten« (Luhmann 1991, S. 116). Anders als gewöhnlich wird Sinn hier nicht als eine inhaltliche Qualität verstanden, sondern als Operation, nämlich als selektiver Übergang von einem kommunikativen Ereignis zum nächsten:
Sinn gibt es ausschließlich als Sinn der ihn benutzenden Operationen, also auch nur in dem Moment, in dem er durch Operationen bestimmt wird, und weder vorher noch nachher. Sinn ist demnach ein Produkt der Operationen, die Sinn benutzen, und nicht etwa eine Weltqualität, die sich einer Schöpfung, einer Stiftung, einem Ursprung verdankt.[131]
Der operative Sinnbegriff weist darauf hin, dass Sinn keine essentielle Größe oder Substanz ist, die von einem Forscher ausgegraben oder tiefenstrukturell erforscht werden kann. Denn jede Bestimmung des Sinns einer Kommunikation (oder eines Textes) ist selbst eine beobachtende Operationen, die im Moment ihres Vollzugs wiederum Sinn produziert – wohlbemerkt: nicht als Substanz, sondern als Verweisungshorizont. Ein Soziologe kann einer Kommunikation zwar immer einen gemeinten Sinn unterstellen, aber in dem Moment, wo seine Beobachtung kommuniziert wird, ist sie selbst eine soziale Operation, die sich ihrerseits einer Beobachtung (und damit: Sinnfestlegung) aussetzt.[132] Kommunikation ist also keine Übertragung von Sinn in ein anderes Bewusstsein, sondern Produktion und Veränderung von Beobachtungen. Der Beobachter ist dann aber nicht mehr ein anderes Subjekt, sondern das nächste Mitteilungs-ereignis, das dem vorausgegangenen folgt (vgl. Schneider 1994, S. 168).
Da ein Bewusstsein nur beobachten kann, was ihm mitgeteilt wird, und nicht, was ein anderes Bewusstsein denkt, kann es sich im weiteren Verlauf der Kommunikation auch nur wieder an den Mitteilungssequenzen orientieren, andere Abstützpunkte stehen ihm nicht zur Verfügung. Es ist vollkommen unmöglich, die psychischen Selektionen eines anderen Bewusstseins zu beobachten, denn wie sich leicht einsehen lässt: »Jede Äußerung (auch die Äußerung eines Gedanken) ist offensichtlich selbst: kein Gedanke. Man kann niemanden fragen, was er denkt, ohne eine Antwort zu erhalten, die kein Gedanke ist« (Fuchs 1993, S. 19). Beobachtbar sind also nur die sozialen Selektionen, also das, was kommunikativ verstanden wird:
Zwar kann kommuniziert werden, dass wir in der Kommunikation unsere Gedanken austauschen und uns über unsere jeweiligen Vorstellungen verständigen, aber auch das ist nur eine kommunikative Behauptung, also eine Operation des Kommunikationssystems – und kein Gedankenaustausch. Ebenso kann ich denken, dass ich die Gedanken meines Ge-sprächspartners in der Kommunikation vollständig erfasst und verstanden habe, aber auch das ist einzig mein Gedanke, also eine Operation meines Bewusstseinssystems – und keine Kommunikation.[133]
Von den Mitteilungsereignissen einer Kommunikation kann man nicht auf das schließen, was sich die beteiligten Bewusstseinssysteme dabei denken. Psychisches Sinnverstehen ist »nicht beobachtbar und vor allem dadurch ausgeschlossen, dass Systeme nur ein Selbstverständnis, nie aber ein Fremdverständnis entwickeln können, ganz gleich wie sie sich bemühen« (Faßler 1997, S. 37). Kommunikation und Bewusstsein markieren somit eine Differenz: der in einer Kommunikation verstandene Sinn muss nicht mit dem übereinstimmen, was ein Bewusstsein psychisch versteht: »Was als Verstehen in der Kommunikation erreicht wird, entzieht sich der Steuerung jedes einzelnen Beteiligten. Es ist ein emergentes Resultat ihres Zusammenwirkens und daher nicht als Handlung zurechenbar auf Sender oder Empfänger« (Schneider 1994, S. 164). Psychische und soziale Verstehensoperationen können also inkongruent ausfallen: man denkt etwas, meint etwas – und sagt dann doch etwas ganz anderes.[134] Auf der sozialen Ebene der Kommunikation finden andere Selektions- und Verstehensoperationen statt als auf der psychischen Ebene des Bewusstseins. Ich denke zum Beispiel, dass mich mein Gegenüber ziemlich nervt, aber kommuniziert wird etwas anderes: »Tut mir leid, aber ich habe gerade keine Zeit für Dich«. Mein Gesprächspartner denkt ebenfalls, dass er mich besser schon vor einer halben Stunde hätte im Regen stehen lassen sollen, aber die Kommunikation gibt zu ver-stehen: »Schade eigentlich. War wirklich schön, dass wir uns mal wiedergetroffen haben«. Die Kommunikation kann also etwas bestimmtes kommunizieren, während im Bewusstsein etwas ganz anderes vor sich geht: »Nie lässt sich in der Kommunikation feststellen, ob Bewusstseins-systeme ›authentisch‹ dabei sind oder nur das zum Fortgang notwendige beitragen« (Luhmann 1999a, S. 874). Die soziologische Systemtheorie geht deshalb von einer scharfen Trennung aus: Bewusstsein und Kommunikation sind beides eigenständige Systeme mit eigenen Operat-ionen. Das Bewusstsein ist der Operationsmodus psychischer Systeme und die Kommunika-tion der Operationsmodus sozialer Systeme, nämlich der ständige Prozess des Reduzierens und Öffnens von Anschlussmöglichkeiten (vgl. Luhmann 2001c).
5.4. Die Eigenständigkeit kommunikativer Operationen
Die Grundlagendiskussion der Soziologie wird gegenwärtig durch den Gegensatz von Handlungstheorie und Systemtheorie bestimmt. Dabei geht es um die Frage, ob die Dynamik kommunikativer Prozesse auf eine darunterliegende Ebene (auf Individuen) zurückgeführt werden soll, oder ob Kommunikation ein emergentes System darstellt, das sich einer eigenen operativen Realität verdankt. Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, welche Funktion man der Kommunikation zuschreiben will. Man kann nämlich der Kommunikation eine eigene bedeutungs erzeugende Systemleistung zugestehen, oder aber handlungstheoretisch auf einen an sich bedeutungs losen Informationsaustausch abstellen (vgl. Faßler 1997, S. 25). Will man der Kommunikation eine sinnproduktive Rolle nicht zugestehen, dann bedeutet dies, dass man als einzige Sinnquelle auf das menschliche Bewusstsein verweist: zuerst waren die Gedanken, und diese werden dann kommunikativ mitgeteilt. Kommunikation meint dann ein Mittel, um Gedanken auszutauschen, keinesfalls aber soll Kommunikation imstande sein, eigenständig Bedeutungen, eigenständig eine Semantik, zu erzeugen. Als Soziologe habe man deshalb vor allem auf das Bewusstsein und dessen Sinngehalte zu schauen, die in einer Kommunikation zum Ausdruck kommen. Die Systemtheorie hingegen behandelt Kommunikation als eigen-ständig ablaufenden Prozess, der eigensinnig operiert. Es ist dann aber unklar, wie man sich Kommunikation vorzustellen hat, wenn nicht durch ein Subjekt, das kommuniziert.
Um zu verstehen, dass Kommunikation keine Kommunikation zwischen Subjekten, keine Be-deutungs- oder Gedankenübertragung zwischen Bewusstseinssystemen ist, sondern diese sich einer eigenen evolvierenden Selektivität verdankt, ist es zunächst hilfreich, auf die sprach-wissenschaftlichen Untersuchungen Saussures einzugehen. Nach Saussure ist das menschliche Bewusstsein zeichenhaft organisiert, womit gemeint ist, dass jedes sprachliche Zeichen aus einer psychischen Einheit besteht: einem gedanklichen Inhalt (Signifikat) und einem dazuge-hörigem lautlichen Ausdruck (Signifikant). Die Zeicheninhalte oder Signifikate stehen dabei für das in der Vorstellung des Zeichenbenutzers mental Gedachte, also für Vorstellungen, Begriffe, Ideen, Konzepte usw., die Zeichenausdrücke oder Signifikanten hingegen für deren Lautbilder oder Repräsentanten.[135] Nach Saussure existieren keine gedanklichen Vorstellungen ohne dazugehörige Lautbilder und umgekehrt, für sich allein genommen sind beide Bestand-teile sinnlos. Niemals existiert nur die eine Seite des Zeichens, also entweder die inhaltliche Seite der Signifikate oder die lautliche Seite der Signifikanten. Zwischen einem bezeichnetem Inhalt (Signifikat) und einem bezeichnendem Ausdruck (Signifikant) besteht allerdings kein natürlicher Zusammenhang, vielmehr ist diese Zuordnung arbiträr, sie beruht auf einer sozialen Konvention.[136] Die wohl wichtigste Einsicht Saussures ist die Überlegung, dass ein Zeichen nur aufgrund seiner Differenz zu anderen Zeichen eine Bedeutung erlangen kann. Zeichen erhalten also nur in Relation zu anderen Zeichen eine je spezifische Bedeutung. Die Bedeutung eines Zeichens realisiert sich dann nicht vertikal über die Beziehung von Signifikat und Signifikant, sondern nur über selbstreferentielle Verweise auf der horizontalen Ebene, als Differenz der Zeichen untereinander. Die Individualität eines Zeichens gelingt nur über die Einbettung des Zeichens in ein ihn umgebendes System (vgl. Saussure 1967, S. 146). Damit verabschiedet sich Saussure von der realistischen Vorstellung, dergemäß Zeichen eine Referenz auf die Außen-welt haben. Für Saussure sind Zeichen nur Zeichen qua Opposition zu anderen Zeichen und haben keine Verankerung in einer außersprachlichen Realität. Die Vorstellung einer Nomen-klatur, nach der die Zeichen stellvertretend für Realobjekte stehen, wird von ihm also gründ-lich verworfen.
Nach Saussure haben Zeichen die Funktion, eine Einteilung des Denkens vor sich zu nehmen und sich in sprachlicher Kommunikation zu veräußern. Kommunikation bedeutet für Saussure dann ein Austausch von Gedanken mit Hilfe der Zeichen, wobei sich dieser Vorgang in einen aktiven und in einen passiven Teil aufspaltet.[137] Nach Saussure ist das Denken ein aktiver Vor-gang, bei dem Lautbilder ausgelöst werden, die dann beim Sprechen oder Schreiben äußerlich gemacht werden. Das Hören sei hingegen ein passiver Vorgang, bei dem die Schallwellen beim Empfänger ein innerpsychisches Lautbild auslösen, und diesem wird dann wiederum im »Assoziationszentrum« eine dazugehörige Vorstellung zugewiesen. Das Subjekt beherrscht also die sprachlichen Zeichen: es denkt aktiv und produziert simultan eine Lautfolge, die es dem Empfänger kommunikativ miteilt. In der Kommunikation wird dann eine repräsentative Funktion psychischer Prozesse gesehen: »Die Sprache ist ein System von Zeichen, die Ideen ausdrücken« (Saussure 1967, S. 19). Saussure steht damit in der aristotelischen Tradition, in der die Seele als Sinnzentrum fungiert und die Sprache diesen Sinn lediglich auszudrücken ver-sucht.[138]
Nach Saussure besitzen alle Individuen einer Sprachgemeinschaft annähernd dieselben sprach-lichen Zeichen, dieselben sprachlichen Codes: diese sind bei »allen Individuen aufgespeichert« (Saussure 1967, S. 165). Kommunikation meint dann einen Austausch von Gedanken, eine Übertragung sprachlicher Codes. Das Signifikat wird dadurch überbewertet: in allen Sprach-subjekten wird eine gemeinsam geteilte Symbolwelt, ein transzendentales Signifikat, oder wenn man so will: eine »Sprache des Geistes« vorausgesetzt. Denn die Unterscheidung in Signifikat und Signifikant, in gedanklichen Inhalt und lautlichen Ausdruck, lässt die Möglich-keit offen, ein Signifikat zu denken, das » in sich selbst Signifikat ist, und zwar aufgrund seiner einfachen gedanklichen Präsenz und seiner Unabhängigkeit gegenüber der Sprache, das heißt gegenüber einem Signifikantensystem« (Derrida 1986, S. 56). Das würde bedeuteten, dass es so etwas wie ein »reines« Denken gibt und die Signifikanten nur deswegen existieren, damit sich das Sprachsubjekt nach außen hin artikulieren kann. Es wird damit suggeriert, dass der Vorgang des Denkens das zugrundeliegende, verursachende Moment ist , alles andere hingegen bloße Wirkung. Die Gedanken wären dann zwar untrennbar an ihre Ausdrücke gebunden, aber eben nicht: auf diese angewiesen.[139]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 9: Kommunikation als Gedankenaustausch zwischen Subjekten. Mit Hilfe des sprachlichen Zeichens externalisiert der Sender seine Gedanken, überträgt diese dem Empfänger, um dann dort wiederum dasselbe Zeichen auszulösen. Das Modell impliziert, dass es ein von den Signifikanten unabhängiges Sinnzentrum (transzendentales Signifikat) gibt, das in jedem Moment sich selbst präsent ist und deshalb über die Zeicheninhalte frei verfügt. Das Signifikat existiert in diesem Sinne also losgelöst von den Signifikanten und braucht diese nur in Anspruch zu nehmen, wenn es sich einem anderen Subjekt mitteilen will. Anders ausgedrückt: die Sprache wird von einer transzendentalen Struktur beherrscht, die allen sprachkompetenten Subjekten zugrunde liegt.
Vergleicht man die Zeichentheorie Saussures mit der operativen Erkenntnistheorie Luhmanns, dann wird bei beiden die Referenz der Sprache auf eine Außenwelt aufgegeben. Der entscheid-ende Unterschied besteht dann im Systembegriff. Für Saussure ist die Sprache ein System von Zeichen, aus dem ein Subjekt sprachliche Elemente denkend herausgreift und diese einem anderem Subjekt mitteilt. Der Zeichenbegriff meint dann ein operativ benutztes Element dieses Systems, nicht aber eine Operation (vgl. Luhmann 2001, S. 236). Luhmann bemerkt hierzu, dass das Zeichen zwar stets als Einheit erscheint, in Wirklichkeit aber als operatives Dual von Unterscheiden und Bezeichnen, also als Operation des Beobachtens, behandelt werden muss. Die Theorie des operativen Aufbaus von Formen habe deshalb vor dem Zeichenbegriff anzu-setzen.[140] Für Luhmann ist die Sprache also kein System, denn nur beobachtende Operationen, die fortlaufend aneinander anschließen, bilden ein System:
Man kann also Sprache einerseits nicht ignorieren, und darf ihre Tragweite auf keinen Fall unterschätzen. Sie ist aber anderseits auch nicht das System, das die Konstruktion der Erkenntnis als Realoperation ermöglicht. Sie ist überhaupt kein System. Sie leistet vielmehr die strukturelle Kopplung von Bewusstsein und Kommunikation.[141]
Ein System ist immer ein reales, ein in Operation befindliches System. Kommunikation meint dann Sprache-in-Betrieb, aber die Sprache selbst ist kein System: »Sprache hat keine eigene Operationsweise, sie muss entweder als Denken oder als Kommunizieren vollzogen werden; und folglich bildet Sprache auch kein eigenes System« (Luhmann 1999, S. 112).
Wenn Kommunikation ein eigenständig operierendes System sein soll, dann stellt sich die Frage, wie einzelne Kommunikationsereignisse sich überhaupt zu Prozessen mit geordneter, ausdifferenzierter Selektivität formieren können (vgl. Luhmann 1984, S. 224). Die Antwort darauf lautet: es sind Themenzusammenhänge, die das weitere Kommunikationsgeschehen mitbestimmen, so dass nicht jede beliebige Kommunikation anschließen kann. Bewusstsein wird dann in besonderer Hinsicht in Anspruch genommen: nicht alles, was ein Bewusstsein denkt, kann in die Kommunikation einfließen.[142] Es wurde weiter oben gesagt, dass Kommuni-kation sich anhand der Unterscheidung von Selbstreferenz (Mitteilung) und Fremdreferenz (Thema) beobachtet, also sowohl das operative als auch das strukturelle Verstehen beherrscht. Die Selbstreferenz der Kommunikation stellt dann sicher, dass Mitteilungen an Mitteilungen anschließen, die Fremdreferenz ermöglicht der Kommunikation, dass über verschiedene Themen kommuniziert werden kann. Die laufenden Operationen schränken dann aber ein, wie an vorangegangenen Selektionen angeschlossen wird, es kommt zum Aufbau von Strukturen, das System weist eine spezifische innere Ordnung auf. Die Kommunikation beobachtet sich anhand ihrer eigenen Struktur und richtet danach ihre Folgeereignisse aus. Die Reproduktion der Kommunikation läuft damit über die Reproduktion von Themen, die ihre Beiträge selbst organisieren (vgl. Luhmann 1984, S. 224).
Kommunikation als Verkettung von Mitteilungssequenzen ist also in starkem Maße von ihren eigenen Operationen, von ihrem eigenen kommunikativen Gedächtnis abhängig: »Das System kann seiner eigenen Geschichtlichkeit nicht entrinnen, es muss immer von dem Zustand aus-gehen, in den es sich selbst gebracht hat« (Luhmann 1999a, S. 883). In jeder länger anhalten-den Kommunikation werden evolutionär Strukturen ausgebildet, die den weiteren Verlauf der Kommunikation bestimmen, ohne dass dieser Prozess auf die beteiligten Bewusstseinsysteme zurückgerechnet werden kann. Alles, was geschieht, ist immer schon mitbestimmt durch die vorausgegangenen Operationen. Themen führen Limitierungen mit sich und ermöglichen auf diese Weise die Selbstbeobachtung der Kommunikation. Die rekursiv aufeinander bezogenen Kommunikationen lassen dann eine eigene Realität entstehen: das System schränkt sich selbst ein, es steuert sich über seine eigene Struktur bzw. Systemvergangenheit. Obwohl psychische Systeme am Verlauf der Kommunikation beteiligt sind und sich daran orientieren, sind ihre Selektionen dem Bewusstsein, und die sozialen Selektionen dem Kommunikationssystem zu-gehörig:
Keine Operation dieses Typs kann das System, das sie ermöglicht, verlassen, keine Operation dieses Typs kann daher ihr System mit der Umwelt verbinden. In systemtheoretischer Sicht sind lebende Systeme, Bewusstseinssysteme und Kommunikationssysteme deshalb verschiedenartige, getrennt operierende selbstreferentielle Systeme. Jedes dieser Systeme reproduziert sich selbst autopoietisch nach Maßgabe der eigenen Struktur.[143]
Da nicht alle Gedanken in die Kommunikation einfließen, sind soziale Systeme stets weniger komplex als die an ihr beteiligten Bewusstseinssysteme. Diese Reduktionsleistung kann und wird aber nicht von den Bewusstseinssystemen, sondern nur durch die Kommunikation selbst vorgenommen. Das Komplexitätsgefälle lässt eine innere Ordnung entstehen, an dem sich das weitere Geschehen ausrichtet, so dass nicht mehr alles beliebige kommuniziert werden kann. Durch diese selbstreferentielle Einschränkung von Anschlussmöglichkeiten entsteht dann eine emergente Ordnung, die zwar » bedingt ist durch die Komplexität der sie ermöglichenden Systeme, die aber nicht davon abhängt, dass diese Komplexität auch berechnet, auch kontrolliert werden kann. Wir nennen diese emergente Ordnung soziales System« (Luhmann 1984, S. 157). Ein soziale System ist dann die Abfolge von Kommunikationen, es entsteht, wenn Mitteilungen an Mitteilungen anschließen:
Ein soziales System kommt zustande, wenn immer ein autopoietischer Kommunikationszusammenhang entsteht und sich durch Einschränkung der geeigneten Kommunikation gegen eine Umwelt abgrenzt. Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen, auch nicht aus Handlungen, sondern aus Kommunikationen.[144]
Bewusstseinssysteme bilden kein soziales System, sondern sind lediglich an einem solchen beteiligt: »Kommunikationen bilden, wenn autopoietisch durch Rekursionen produziert, eine emergente Realität sui generis. Nicht der Mensch kann kommunizieren, nur die Kommuni-kation kann kommunizieren« (Luhmann 1999, S. 105). Die Behauptung, dass es Menschen sind, die kommunizieren, ist dann lediglich ein soziales Konstrukt, eine vereinfachende Selbst-beschreibung der Kommunikation. Menschen denken, sprechen und produzieren Laute, aber sie kommunizieren nicht:
Alle Begriffe, mit denen Kommunikation beschrieben wird, müssen daher aus jeder psychischen Systemreferenz her-ausgelöst und lediglich auf den selbstreferentiellen Prozess der Erzeugung von Kommunikation durch Kommunikation bezogen werden.[145]
Die Differenz von Kommunikation und Bewusstsein darf jedoch nicht so verstanden werden, dass es Bewusstsein ohne Kommunikation und Kommunikation ohne Bewusstsein gibt. Sie besagt nur, dass ein System außerhalb seiner Grenzen keine Operationen durchführen und deshalb kein System das andere instruieren kann. Weder können Bewusstseinssysteme den Verlauf der Kommunikation kausal bestimmen, noch kann die Kommunikation festgelegen, was ein Bewusstsein zu denken hat. Beide Systeme sind füreinander Umwelt, mit einer Ein-schränkung: Bewusstsein und Kommunikation setzen ein Mindestmaß an Aufmerksamkeit voraus. Obwohl also beide Systeme operational geschlossen sind, besteht zwischen ihnen ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis, das Luhmann mit dem Begriff der strukturellen Kopplung beschreibt.[146] Das Bewusstsein bestimmt nicht den Verlauf der Kommunikation, denn es wird immer auch von der Eigendynamik der Kommunikation mitgetragen:
Das Bewusstsein ist weder Ursache noch Urheber, weder Substanz noch Subjekt der Kommunikation. Kommunikation wird nicht so zustande gebracht, dass erst das Subjekt den Entschluss fasst, zu kommunizieren, dann diesen Entschluss ausführt und schließlich, als weiterer Effekt dieser Kausalkette, jemand hört oder liest, was gesagt oder geschrieben worden ist. Eine solche Darstellung [...] unterschlägt die Rekursivität des Vorgriffs und des Rückgriffs in allen auto-poietischen Operationen. Sie unterschlägt, mit anderen Worten, das Gedächtnis.[147]
Wenn die Soziologie Kommunikation als Abfolge von Handlungen erklärt, dann ist das eine nicht ganz falsche, aber dennoch unzureichende Beobachtung. Wird das Soziale auf bewusste Handlungen zurückgeführt, auf darunterliegende Einheiten (Subjekte, Individuen), dann bleibt die Frage, wie sozial ausgerichtetes, strukturell vorbestimmtes Handeln überhaupt möglich sein kann. Alle handlungstheoretischen Ansätze haben dann zum Problem, dass sie gezwungen sind, den Akteuren entweder eine gemeinsam geteilte Kultur, ein gemeinsames Symbolsystem oder durch Sozialisation übertragene Verhaltenserwartungen zu unterstellen: »Unbefriedigend an diesen Lösungen ist, dass etwas vorausgesetzt wird, was eigentlich erst erklärt werden müsste« (Staubmann 1997, S. 222).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 10: Kommunikation zwischen Subjekten (vereinfachte Darstellung von Abbildung 9). Die handlungstheoretische Fundierung von Kommunikation setzt voraus, dass die Bedingung der Möglichkeit von Kommunikation im Subjekt angelegt ist, und zwar noch vor aller Kommunikation. Intersubjektivität ist dann Voraussetzung, nicht Ergebnis von Kommunikation. Die Selbstreferenz des Bewusstseins wäre formal wie folgt zu schreiben: B = f(B), für Kommunikation muss dann gelten: K = f(B).
Die soziologische Systemtheorie dreht das Verhältnis um: nicht das selbstbewusste Subjekt er-möglicht Kommunikation, sondern erst durch die Teilnahme an Kommunikation nimmt ein Beobachter sich als kommunizierendes Subjekt wahr. Denn wie sollte ein Bewusstsein, das in die Welt hineingeboren wird und seitdem permanent mit sich selbst beschäftigt ist (also in seinem Bewusstsein stets eigenes Bewusstsein, aber kein Fremdbewusstsein vorfindet) auf die Idee kommen, dass es selbstbewusste Beobachter auch in seiner Umwelt gibt? (vgl. Luhmann 2001c, S. 127). Erst wenn ein Bewusstsein mit der Unterscheidung von Mitteilung und Infor-mation zu operieren beginnt, wenn es also Wahrnehmung von Kommunikation unterscheiden kann, erst dann wird es auf die Idee kommen, dass es irgendwo da draußen noch anderes Be-wusstsein gibt. Luhmann hält es deshalb für einen falsch gewählten Anthropozentrismus, wenn dem Selbstbewusstsein eine ontologische Vorrangstellung vor der sozialen zukommen soll:
Im Ergebnis unterscheiden psychische und soziale Systeme sich danach, ob Bewusstsein oder Kommunikation als Ope-rationsform gewählt wird. Diese Wahl ist nicht für das Einzelereignis möglich, denn am Einzelereignis schließen Be-wusstsein und Kommunikation sich nicht aus, fallen vielmehr häufig mehr oder weniger zusammen. Die Wahl liegt in der Betätigung sinnhafter Selbstreferenz, das heißt darin, über welchen Sinn sich aktualer Sinn auf sich selbst bezieht.[148]
Die Fähigkeit, eigenes und fremdes Bewusstsein voneinander zu unterscheiden, hatte Kant damit erklärt, dass das Selbstbewusstsein als apriorisches Vermögen vom transzendentalen Subjekt notwendig bereitgestellt wird. Das empirische Subjekt werde dann in jedem Moment seines Operierens von dieser transzendentalen Hintergrundstruktur begleitet, die dafür sorgt, dass es sich selbst nicht mit anderem verwechselt. Luhmann verzichtet auf ein transzendentales Argument und damit auch: auf eine subjektzentrierte Fundierung von Kommunikation. Erst der Umweg über die Kommunikation, erst die Teilnahme an einem ganz andersartig operieren-dem System, ließe ein Beobachter sich als »Subjekt« erfahren. Anstelle der Intersubjektivität als Bedingung der Möglichkeit von Kommunikation tritt damit dann die Selbstreferenz der Kommunikation (vgl. Luhmann 2001c, S. 128 f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 11: Kommunikation als eigenständig operierendes System. Die Systemtheorie führt Kommunikation nicht auf ein zugrundeliegendes Subjekt zurück und kann sie deshalb Kommunikation nicht sinnvoll als Handlung begreifen. Beide Systeme operieren überschneidungsfrei: Im Bewusstsein schließen Gedanken an Gedanken an (es handelt sich dabei dann um psychische Selektionen), und in sozialen Systemen schließen Kommunikationen an Kommunikationen an (es handelt sich dabei dann um soziale Selektionen). Die formale Beschreibung für die Selbstreferenz des Bewusstseins wäre dann wieder: B = f(B), für die Selbstreferenz der Kommunikation ist diesmal aber zu schreiben: K = f(K).
Ein systemtheoretischer Kommunikationsbegriff hat weitreichende gesellschaftstheoretische Implikationen. Das Subjektbewusstsein muss nämlich seine Vorrangstellung aufgeben, denn es wird erst durch die Teilnahme an Kommunikation ermöglicht und dabei mit gesellschaftlich angereicherten Unterscheidungen versorgt. Das Denken steht einem Bewusstsein nicht frei zur Disposition, was ja implizieren würde, dass man eigenverantwortlich auch hätte anders denken und handeln können. In der subjektphilosophischen Tradition ist man stets davon ausgegangen, dass es eine Sprache des Geistes gibt, die sich im Bewusstsein realisiert und von dort aus die Kommunikation organisiert. Dem sich selbst bewussten (und hoffentlich vernünftigen) Subjekt würden seine Gedanken frei zur Disposition stehen, und es könne sich folglich aussuchen, an welchem Kommunikationsgeschehen, an welchen Diskursen, es sich beteiligen will. Diese Subjektzentrierung wird in der Systemtheorie aufgegeben: der Sprecher ist nicht Subjekt, sondern Produkt der gesellschaftlichen Kommunikation. Das Subjekt wird dann nicht mehr einfach bloß »vorausgesetzt, sondern ist Ergebnis der diskursiven Praktiken, die die Regeln des Diskurses bereitstellen« (Auer 1999, S. 235).
Mitunter wird versucht, die Differenz von Bewusstsein und Kommunikation wieder aufzu-heben und den systemtheoretischen Kommunikationsbegriff dann paradoxerweise handlungs-theoretisch begründen zu wollen.[149] Eine subjektfundierte Gesellschaftstheorie hat jedoch das Problem, zu erklären, wie gesellschaftliche Wirklichkeit überhaupt entstehen konnte. Wird ein gemeinsames Symbolsystem oder eine gemeinsame Kultur zur Voraussetzung gemacht, dann kann man wiederum fragen: Wie ist dies möglich? Das transzendentale Argument lässt dann jedenfalls nur die Möglichkeit zu, dass Menschen mit Menschen kommunizieren können.[150] Wenn aber zur Selbstreferenz des Bewusstsein die Selbstreferenz der Kommunikation hinzu-kommt, dann wird Kommunikation nicht mehr von Subjekten konstituiert. Das bedeutet nicht, dass das Vorhandensein von Subjektivität bestritten wird. Es wird aber die These von der Sub-jektivität des Bewusstseins revidiert, nach der das Subjektbewusstsein aller Kommunikation zugrunde liegt:
Mit Hilfe einer Begrifflichkeit aus der Theorie selbstreferentieller Systeme, nämlich mit Hilfe der Vorstellung, dass Systeme mit ihren eigenen Operationen eine Beschreibung von sich selbst anfertigen und sich selbst beobachten können, lässt sich der Zusammenhang von Kommunikation, Handlung und Reflexion aus der Subjekttheorie (der Theorie von der Subjektivität des Bewusstseins) herauslösen. Natürlich behaupten wir nicht, dass es ohne vorliegendes Bewusstsein soziale Systeme geben könnte. Aber die Subjektivität, das Vorliegen des Bewusstseins, das Zugrunde-liegen des Bewusstseins wird als Umwelt sozialer Systeme und nicht als deren Selbstreferenz aufgefasst.[151]
Bewusstsein ist zwar notwendig am Zustandekommen von Kommunikation beteiligt, aber es ist nicht Urheber, nicht Subjekt der Kommunikation. Wenn Kommunikation dennoch in den meisten Fällen als Handlung gedacht wird, dann deshalb, weil sich Kommunikation aus der Sicht eines Bewusstseins nicht vollständig beobachten lässt. Entsprechend kommuniziert die Kommunikation über sich selbst als Handlungssystem und steuert damit zugleich den Fortgang ihrer Autopoiesis: »Und in dieser verkürzten, vereinfachten, dadurch leichter fasslichen Selbst-beschreibung dient Handlung, nicht Kommunikation, als Letztelement« (Luhmann 1984, S. 228). Handlung ist dann ein Effekt von Kommunikation, wenn nämlich beobachtet wird, wie eine Mitteilungshandlung die andere ablöst: »Handlungen sind einfacher zu erkennen und zu behandeln als Kommunikationen« (Luhmann 1984, S. 232).
5.5 Zum theoretischen Verständnis der Emergenz
Für die subjektzentrierte Soziologie gelten makroskopische Phänomene wie Herrschaft oder soziale Ungleichheit nur dann als befriedigend erklärt, wenn man diese Phänomene auf das Handeln von Individuen (auf deren subjektives Bewusstsein) zurückführen kann. Für die handlungstheoretische Soziologie sind es also nicht »die sozialen Strukturen oder die sozialen Systeme, die die sozialen Prozesse erzeugen und vorantreiben, sondern das an Situationen orientierte, sinnhafte, problemlösende Handeln der Menschen« (Esser 1999, S. 4). Dabei wird von folgender Überlegung ausgegangen: um die Phänomene auf der makroskopischen oder kollektiven Ebene analysieren zu können, muss zunächst einmal auf einer mikroskopischen Ebene der subjektiv gemeinte Sinn der Handlungssubjekte erfragt und verstanden werden. Das handlungstheoretische Primat der Art der Erklärung liegt deshalb auf der mikroskopisch-individuellen Ebene der Situationsdeutung. Der Soziologe muss sich deshalb in die Situation einer handelnden Person hineinversetzen und herausfinden, wie diese vom ihm wahrgenomm-en wird, welche Absichten und Überzeugungen sein Tun leiten, warum er sich für diese und nicht für jene Alternative entschieden hat. Im Anschluss an der verstehenden Rekonstruktion muss der Soziologe dann eine gedankliche Abstraktion vornehmen und klären, warum andere Subjekte in bestimmten Situationen ähnlich handeln (vgl. Esser 1999, S. 4 f.). Gesellschaft wird dann gewissermaßen von unten, vom Bewusstsein her, erklärt, denn die Grundüberzeug-ung der Handlungstheorie ist: »Für alle sozialen Mikro- und Makrophänomene gibt es eine individuelle Erklärung und eine begriffliche Reduktion« (Wenturis 1992, S. 179).
Die Handlungstheorie geht also in ihrer Analyse von Subjekten und Einzelhandlungen aus, kann damit aber das Soziale nicht als eigenständige Wirklichkeitsebene begreifen. Es wird zwar durchaus zugestanden, dass die Gesellschaft mehr ist als bloß die Summe von Individuen und deren Beziehungen untereinander. Die Frage ist aber, wie dieser Mehrwert theoretisch gefasst wird: als bloße Entäußerung subjektiven Sinns oder als sich selbstorganisierende Komplexität. Obwohl nahezu alle Handlungstheorien die Emergenz des Sozialen anerkennen, werden Intentionalität und Zielverfolgung ausschließlich Individuen zugerechnet, und wird deshalb für das Zustandekommen der sozialen Phänomene nach individualistischen Erklärung-en gesucht. Die These ist, dass das Soziale nur über das individuelle Handeln und die sub-jektiven Dispositionen erklärt werden kann, und dass alle Begriffe, die sich auf soziale Ganz-heiten beziehen, wiederum auf Begriffe von Individuen reduziert werden können. Soziale Phänomene werden dann als Ansammlung interpersoneller Eigenschaften und Beziehungen aufgefasst, einschließlich ihrer nichtintendierten Folgen. Der methodologische Individualismus hat deshalb für den Begriff der Selbstorganisation keine Verwendung (vgl. Wenturis 1992, S. 176 ff.).
Berger und Luckmann vertreten mit ihrer dialektischen Bestimmung der Gesellschaft als Ent-äußerung subjektiven Sinns (Externalisierung) und deren Rückwirkung auf andere Individuen (Objektivierung) einen solchen methodologischen Individualismus: das Soziale wird von ihnen dann als eine eigene Entität betrachtet, die jedoch begrifflich auf das Handeln von Akteuren reduziert wird. Die Autoren bezeichnen die soziale Wirklichkeit als eine »Realität sui generis«, doch ist dies irreführend, weil damit keine operative, keine beobachtungsfähige Realität, ge-meint ist. Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft beschreiben die Autoren dann wie folgt: Vom Individuum ausgehende Effekte verfestigen sich zu Strukturen (Externalisierung), diese wirken dann auf die Individuen als objektive Wirklichkeit zurück (Objektivierung) und werden schließlich in Sozialisationsprozessen angeeignet (Internalisierung). Individuelles Han-deln erzeugt also externe Struktureffekte (Schrift, Architektur, Geld, Wissen, Moral usw.), die dann auf die nachfolgende Generation objektivierend zurückwirken. Diese drei Komponenten sind immer gleichzeitig gegeben, so dass eine soziologische Analyse, die nur eine dieser Komponenten in den Blick nimmt, unzureichend ist. Mensch und Gesellschaft befinden sich damit in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis: »Das Produkt wirkt zurück auf seinen Produzenten. Externalisierung und Objektivation – Entäußerung und Vergegenständ-lichung – sind Bestandteile in einem dialektischen Prozess« (Berger/Luckmann 2000, S. 65). So kommen dann die Autoren zu dem Schluss: »Gesellschaft ist ein menschliches Produkt. Gesellschaft ist eine objektive Wirklichkeit. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Produkt« (Berger/Luckmann 2000, S. 65).
Der Unterschied zur Systemtheorie besteht darin, dass die Autoren die externalisierten Effekte als unorganisierte Komplexität verstehen, die nicht zu einer Selbstbeobachtung fähig ist. Externalisierung (vom Subjekt ausgehend) und Objektivierung (auf das Subjekt zurück-wirkend) basieren also auf einem subjektzentrierten Kommunikationsbegriff: Wissen wird vom Menschen erworben, gesellschaftlich verfestigt und wieder an Menschen weitergegeben. Forschungsgegenstand der Soziologie sei deshalb nicht die Dynamik der gesellschaftlichen Kommunikation, sondern – weil die gesellschaftliche Wirklichkeit vom Menschen geschaffen wird – der Mensch als Mensch (vgl. Berger/Luckmann 2000, S. 198 ff.). Die gesellschaftliche Evolution verdankt sich dann allein der menschlichen Kreativität: Strukturen wirken zwar auf den Menschen als objektiv gegebenes Faktum ein, haben aber selbst nicht die Fähigkeit, sich zu organisieren. Berger und Luckmann sehen also die mikroskopische Ebene des Individuums (Bewusstsein) durch die makroskopische Ebene der Gesellschaft bestimmt, sie übersehen da-bei aber die Differenz von System und Umwelt und können deshalb Kommunikation nicht als ein eigenes System mit einer eigenen operativen Selektivität begreifen. Geht man aber von dieser Differenz aus, dann bekommt man in den Blick, dass sich Kommunikation verselbstän-digen kann, weil sie unabhängig von den Sinngehalten der Subjekte operiert: symbolische Kommunikation (Sprache, Geld, Macht, Liebe) definiert dann mit hoher Präzision die Entsteh-ung bestimmter Sinnhorizonte (Erwartungsstrukturen), hinter denen jedoch keine psychischen Motive mehr stecken, auch wenn sie als solche wahrgenommen werden. Handlungs- und Kommunikationsabläufe sind dann zuverlässig vorprogrammiert, ohne dass man dies vom Be-wusstsein der Subjekte her erklären muss (vgl. Esser 1999, S. 537 ff.).
Während die Handlungstheorie Kommunikation als Ergebnis des sinnhaften Handelns von Subjekten erklärt, begreift die Systemtheorie Kommunikation als eigendynamisch prozessier-endes System, das von niemanden beherrscht wird. Das am Kommunikationsgeschehen be-teiligte Bewusstsein kann Kommunikation immer nur punktuell und in scharfen Grenzen der Zulässigkeit irritieren. Die Emergenz sozialer Systeme ist deshalb nicht in psychologischen Begriffen erklärbar, sondern nur aus sich selbst heraus:
Die These von der Gesellschaft als Wesen sui generis bedeutet daher gleichzeitig auch die Annahme, dass die Gesetze der Gesellschaft nur aus sich heraus verständlich seien und grundsätzlich nicht auf andere Erklärungen reduzierbar seien. Eine »Tiefenerklärung« der Gesetze der Gesellschaft, ein »verstehendes« Erklären sozialer Zusammenhänge ist danach also grundsätzlich ausgeschlossen; mehr noch: Es wäre der falsche Weg.[152]
Gesellschaftliche Kommunikation ist für Luhmann nichts, dass von »unten nach oben«, vom Bewusstsein ausgehend, gedacht werden kann, denn das Bewusstsein ist selbst ein emergentes Produkt, aufgrund der Intransparenz neurophysiologischer Prozesse. Gegenüber dem subjekt- zentrierten Ansatz von Kommunikation wird deshalb »bei einem systemtheoretischen Ansatz die Emergenz der Kommunikation selbst betont« (Luhmann 2001a, S. 100). Gesellschaftliche Kommunikation ist nicht bloß ein Effekt von Handlungen und lässt sich deshalb auch nicht auf darunter liegende Einheiten zurückrechnen:
Aus heutiger Sicht ist die alte Vorstellung, die die wissenschaftliche Entwicklung als eine Folge von ontologischen Mikroreduktionen darstellte, indem soziale Gruppen auf individuelle Organismen, individuelle Organismen auf Zellen, Zellen auf Moleküle, Moleküle auf Atome, Atome auf Elementarteilchen reduziert wurden, kaum mehr aufrechtzuer-halten; denn die Auffassung, dass die Reduktion auf einer niedrigeren analytischen Ebene eine exaktere Erklärung der Phänomene sichern kann, wird inzwischen als überholt betrachtet.[153]
Im Unterschied zur bloßen Verfestigung (Externalisierung) von Handlungseffekten lassen sich Bereiche organisierter Komplexität nicht in linearkausalen Begrifflichkeiten erklären. Während unorganisierte Komplexität in einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang eingebettet ist, ist dies bei organisierter Komplexität nicht der Fall. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, die Gesellschaft werde vom Menschen gestaltet, wenn die Gesellschaft ein operierendes System ist, dass sich gegenüber den Milliarden Bewusstseinssystemen selbst organisiert.[154] Ein System muss nicht über ein Selbstbewusstsein verfügen, um sich organisieren zu können. Zwar verweisen viele Verben (Beobachten, Beschreiben, Entscheiden, Handeln, Erklären) auf ein dahinterliegendes Subjekt, auf einen bewusstseinsfähigen »Träger« dieser Operationen. Aber dann ist es die Sprache, die suggeriert, dass eigentlich nur Menschen (Individuen, Subjekte) handeln können, und nicht Systeme. Beobachtungsoperationen müssen jedoch nicht notwendigerweise in Form von Bewusstsein vollzogen werden, es genügt, wenn als Träger ein selbstreferentielles System angenommen wird (vgl. Luhmann 1984, S. 595).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 12: Emergenz als unorganisierte und organisierte Komplexität. Die subjektfundierte Gesellschaftstheorie begreift das Soziale als Produkt des Handelns von Menschen (links). Dabei wird das Subjekt als das Soziale konstituierend gedacht, Gesell-schaft also begrifflich auf das Bewusstsein zurückgeführt. Die Systemtheorie begreift das Soziale als eigenständig operierendes System, als organisierte Komplexität mit der Fähigkeit zu Selbstbeobachtung (rechts). Bewusstsein konstituiert dann nicht mehr die Gesellschaft, sondern ist lediglich an ihr beteiligt. Das Einzelbewusstsein ist somit Produkt, nicht Produzent der Gesellschaft.
Gesellschaftliche Kommunikation bekommt deshalb für Luhmann eine eigene Beobachter-qualität, die sich nicht auf die Beobachtungsoperationen des Bewusstseins reduzieren lässt. Anders als bei handlungstheoretischen Ansätzen ist hier das Bewusstsein keine privilegierte Sinnquelle, das von sich aus die Kommunikation initiiert. Kommunikation ist immer weniger komplex als das an Kommunikation beteiligte Bewusstsein, es entwickelt deshalb unabhängig von den psychischen Selektionen eigene Verstehensoperationen. Während Berger und Luck-mann lediglich davon ausgehen, dass menschliches Handeln unkontrollierte Effekte zeitigt und deshalb das Soziale als ein Bereich unorganisierter Komplexität ansehen, geht Luhmann von der System-Umwelt-Differenz aus, die ein Komplexitätsgefälle markiert. Als selbstreferent-ielles System formiert es dann seine eigene Selektivität, indem es auf das eigene Gedächtnis zurückgreift. Kommunikation wird deshalb auch nicht als eine psychisch motivierte Handlung verstanden:
Sobald man Kommunikation als eine Mitteilungshandlung begreift, verfehlt man den emergenten Charakter des Sozial-en. Man reduziert Kommunikation auf Handlung und damit letztlich auf psychische Absichten, Pläne, Intentionen des Handelnden. Dabei wird übersehen, dass das menschliche Bewusstsein die Kommunikation nicht bewusst herbeiführen und nicht kausal steuern oder determinieren kann.[155]
Luhmann widersteht also der Versuchung, Kommunikation von vornherein vom Menschen her zu denken. Ausgangspunkt ist das Problem der doppelten Kontingenz, die einen autopoiet-ischen Kommunikationsprozess generiert, in dessen Verlauf Erwartungsstrukturen ausgebildet werden, dabei eine neue Realitätsebene entsteht (vgl. Luhmann 1984, S. 657 f.). Das operative Geschehen organisiert sich dann vielmehr von selbst und ermöglicht autokatalytisch seine eigene Fortsetzung durch Lernen und rückbezügliche Anpassung, es ist in diesem Sinne also ein selbständig lernendes System (vgl. Faßler 1997, S. 144).
Die Handlungstheorie ist evolutionstheoretisch optimistisch, denn sie sieht die Möglichkeit, dass sich die menschliche Vernunft in der Zukunft einlösen lässt. Dazu müssen dann lediglich Pathologien aufgedeckt und beseitigt sowie Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Der Grundgedanke dabei ist: das menschliche Denken kann es in der Zukunft besser machen, es kann die nachfolgende Generation mit neuen Ideen ausstatten. Die Systemtheorie ist in dieser Hinsicht eher pessimistisch, sie bestreitet nämlich, dass gesellschaftliche Evolution sich einer denkenden Rationalität verdankt und infolgedessen von dieser beherrscht werden kann. Statt-dessen verweist sie auf das kumulierte Gedächtnis der Kommunikation und auf funktionale Erfordernisse, die die Ko-Evolution von Kommunikation und Bewusstsein vorantreiben. Wenn man noch hinzudenkt, dass Kommunikation das Bewusstsein partiell und in Abhängigkeit von sozialen Logiken in Anspruch nimmt (inkludiert), dann wird verständlich, warum Luhmann von einem Primat der Kommunikation ausgeht, wenn von einer Subjektivität des Bewusstsein auf die Sozialität des Bewusstseins umgestellt wird, wenn also das Einzelbewusstsein durch und durch als gesellschaftliches Produkt aufgefasst wird. Ein Bewusstsein vollzieht dann zwar Handlungen, das bedeutet aber nicht, dass sich dieser Vollzug einer subjektiven Sinnquelle oder einer denkenden Rationalität verdankt. Das operationale Geschehen wird durch die Sprache lediglich in identifizierbare Einheiten – in Subjekte oder Handlungsträger – aufgeteilt, da die Sprache nach einem »Subjekt« der Kommunikation oder nach einem »Macher« des Sozialen verlangt. Die Systemtheorie betont jedoch die Prozesshaftigkeit und Geschlossenheit aller sinnhaften Operationen, und wird der Subjektbegriff aus differenztheoretischen Gründen abgelehnt. Ein Bewusstsein verdankt sich keiner intrinsischen Intentionalität, und sprachliche Äußerungen sind deshalb auch nicht als »Ausdruck von etwas tief in uns Innerem zu deuten« (Faßler 1997, S. 54). Individualität meint dann nicht die Anwesenheit von etwas Innerlichem, sondern Abwesenheit von Äußerlichem: sie »wird nicht durch die genialische, schöpferischen Subjektivität erfahren, sondern durch die vielschichtige Unzugänglichkeit von anderem« (Faßler 1997, S. 159).
5.6. Zusammenfassung
Die klassische Erkenntnistheorie hatte Ontologie und erkennendes Subjekt unterschieden und musste deshalb die Frage beantworten, wie das Subjekt die Welt erkennt, wie das Weltsein in der Erkenntnis repräsentiert wird. Kant hatte dann herausgearbeitet, dass die Erkenntnis nur wieder auf sich selbst verweist, die Dinge an sich bleiben unerfahrbar. Um der Kontingenz des Erkennens aus dem Weg zu gehen, musste Kant das Bewusstsein mit einem transzendentalen Argument Einhalt gebieten. Die transzendentale Hintergrundstruktur sollte garantieren, dass die Bedingungen des Erkennens für alle Menschen dieselben sind, dass sich das Erkennen stets nach demselben Muster, also unabhängig von historischen und sozialen Gegebenheiten, voll-zieht:
Insgesamt zeigt sich, dass Kants erkenntnistheoretisches und ethisches Streben nach subjektiver Mündigkeit und Auto-nomie zweigleisig ist: Das menschliche Subjekt erscheint einerseits als ein von transzendentalen Instanzen unabhäng-iger Aktant, der unter transzendentalen Bedingungen a priori (Raum, Zeit, Kausalität) die Welt konstruiert; andererseits als eine heteronom bestimmte, unterworfene Instanz, die auf ein Vernunftprinzip reduziert und von ihren empirischen und natürlichen Komponenten abgeschnitten wird. Es ist kein Zufall, dass die Frage nach den a priori Bedingungen des Denkens für Kant – vor allem in der Kritik der reinen Vernunft – entscheidend ist: Es geht darum, von der Erfahrung der Einzelsubjekte zu abstrahieren, um sie einem allgemeinen Prinzip unterwerfen zu können.[156]
Die Selbstreferenz des Bewusstsein ist in neurophysiologischen Untersuchungen dahingehend bestätigt worden, dass zwischen Umweltereignissen und Systemereignissen keine kausale Be-ziehung nachgewiesen werden konnte: Korrelationen treten ausschließlich zwischen system-internen Ereignissen auf. Erkenntnis wird als Konstruktion behandelt, die keine ontologische Entsprechung in der Welt hat, weil sie keine vorfindliche Realität repräsentiert. Anders als bei Kant wird jedoch im Radikalen Konstruktivismus und in der Systemtheorie auf die Annahme einer apriorisch gegebenen Begrifflichkeit verzichtet und damit das Fundament aufgegeben, auf das sich objektives Wissen gründen lässt – das ist das »Radikale« am Konstruktivismus. Der Erkenntnisprozess wird naturalisiert und ausschließlich an empirische Bedingungen ge-koppelt. Es gibt dann keine transzendentale (universelle) Struktur mehr im Menschen, die das Erkennen irgendwie aufhalten, strukturieren, beschränken oder in eine bestimmte Richtung lenken könnte. Insofern ist alles Erkennen kontingent.
Während jedoch der Radikale Konstruktivismus auf der Ebene des Nervensystems verbleibt und den Erkenntnisprozess vom Organismus her erklärt, wird die Reduktion des Erkennens auf neurophysiologische Prozesse in der Systemtheorie Luhmanns überwunden und schließlich von gesellschaftlichen Operationen abhängig gemacht. Obwohl das Erkennen notwendig an physiologische Voraussetzungen wie Nervensystem, Stoffwechselvorgänge oder Bewusstsein geknüpft ist, bekommt es bei Luhmann eine soziale Komponente – und ist dafür dann die Soziologie zuständig. Erkenntnis ist damit ein gesellschaftliches Produkt, das jedoch keine Entsprechung außerhalb der gesellschaftlichen Kommunikation hat. Die »Objektivität« einer Beobachtung sagt also nichts über einen beobachterunabhängigen Gegenstand aus, sondern ist ein Hinweis darauf, dass verschiedene Beobachter dieselben Unterscheidungen verwenden. Aus der Realität des operativen Vollzugs von Beobachtungen lässt sich jedenfalls nicht auf eine objektive Realität schließen: »Deshalb erlaubt die Konvergenz von Beobachtungen keinen Rückschluss auf die Realität ihres Gegenstandes, sondern allenfalls einen Rückschluss darauf, dass Kommunikation stattgefunden hat« (Luhmann 1992, S. 78).
Die operative Erkenntnistheorie (als Theorie des operativen Aufbaus von Formen) besagt, dass verschiedene Beobachter verschieden unterscheiden und deshalb verschiedene Wirklichkeits-vorstellungen hervorbringen können. Der Widerstand von Beobachtungen ist dann kein Wider-stand an einer objektiv gegebenen Realität, sondern ein Widerstand an den eigenen System-operationen: »Alle operativ geschlossenen Systeme müssen ihre Realitätsindikatoren auf der Ebene ihrer eigenen Operationen erzeugen; sie verfügen über keine andere Möglichkeit« (Luhmann 1996, S. 159). Ein erkennendes Bewusstsein kann sich deshalb die Welt nicht sub-jektiv zurechtlegen, sondern nur so, wie es dabei an die eigenen Operationen und an das eigene Gedächtnis gebunden ist.[157] Hier treffen die Systemtheorie Luhmanns und die Sprachtheorie Derridas aufeinander, wenn beide annehmen, dass Erkenntnis nicht auf Subjekte zurückzu-führen ist, und dass jede Beobachtung Bedeutungsverschiebungen unterliegt und sozialen Ver-werfungen ausgesetzt ist. Sowohl Luhmann als auch Derrida gehen davon aus, dass es keinen festen, stabilen, identifizierbaren Sinn gibt. Bei Derrida ist es die différance als Verschiebung, bei Luhmann die Kommunikation, bei der jede Anschlusskommunikation die Bedeutung manipuliert, auf Abstand bringt und damit die Möglichkeit von Präsenz als Sinnpräsenz ver-neint. Diese Verschiebung steht dann nicht in der Macht irgendwelcher Subjekte, sondern läuft gleichsam von alleine. Sinn ist basiert auf selektiven Beobachtungsoperationen, doch liegt diesen keine organisierende Subjektivität zugrunde, sie verdanken sich keines privilegierten Trägers: »Weder Bewusstsein noch Kommunikation ist ein Kandidat für eine solche Rolle« (Luhmann 1984, S. 142).
Die subjektzentrierte Hermeneutik hat Sinn immer als Essenz verstanden, die sich im Subjekt ausdrückt und durch Kommunikation übertragen wird. Ein operativer Sinnbegriff meint etwas anderes: Sinn ist nicht im Subjekt fundiert, um sich dort entfalten und kommunikativ mitteilen zu können, sondern Sinn wird als Differenz und Verschiebung gedacht. Das vermeintliche Sinnzentrum, Subjekt genannt, ist selbst ein Effekt von Beobachtungsoperationen, und kein zugrundeliegendes Bewusstsein. Für die operative (und in diesem Sinne: poststrukturalistische) Erkenntnistheorie liegt deshalb der Bezugsrahmen für die Bestimmung von Sinn allein in der Kommunikation, nämlich »im Rückbezug der Kommunikation auf Kommunikation, in der Verweis- und Anschließbarkeit« (Schmidt 1994, S. 97). Wenn also die Soziologie einen Sinn in Texten zu ermitteln versucht, dann vollzieht sie Beobachtungsoperationen, durch die sie Beliebigkeit einschränkt und damit ein bestimmtes Verstehen produziert. Dieser Versuch einer Bedeutungsfixierung darf nicht als die Rekonstruktion eines essentiellen Sinns begriffen werden. Jede Beobachtung erzeugt Eindeutigkeit dort, wo es an sich keine Eindeutigkeit gibt, wo alles kontingent ist. Wenn sich die Soziologie also mit Texten beschäftigt, dann tut sie dies noch in der Hoffnung, vom Text auf eine manifeste, bewusste Inhaltssubstanz, Aufschluss zu erhalten, um von hier aus die gesellschaftliche Wirklichkeit zu erklären. Die Systemtheorie verweist stattdessen auf die Differenz von Bewusstsein und Kommunikation. Bewusstsein ist unbeobachtbar, und jede Zurechnung auf ein dahinterliegendes Subjekt ist ein Konstrukt der gesellschaftlichen Kommunikation, ist eine kommunikative Behauptung. Die Konsequenzen dieser Umstellung für die soziologische Beobachtung von Gesellschaft sollen im folgenden Kapitel besprochen werden.
6.Soziologische Beobachtung von Gesellschaft
6.1. Kontingenz und richtungslose Evolution gesellschaftlicher Operationen
In der Theorie beobachtender Systeme wird das Realitätsverständnis verschoben von einer objektiven Realität zugunsten des Beobachters, der mit seinen Unterscheidungen Realität konstruiert. Beobachtungsmethoden wie Theorie, Experiment, Befragung und Interview sind dann Beobachtungsoperationen, die einen ontischen Gegenstand erzeugen. Jede Beobachtung hat zwar vorsprachliche Wurzeln, weil sie auf eine »Biologie der Kognition« angewiesen ist, also biologische, neurophysiologische und bewusstseinsmäßige Operationen voraussetzt. Für das, was sich dann aber im Laufe der soziokulturellen Evolution als Wissen ausbildet, ist das Kommunikationssystem Gesellschaft die entscheidende Systemreferenz (vgl. Luhmann 1992, S. 688 ff.). Bewusstseinssysteme unterscheiden, beobachten und konstruieren Wirklichkeit in Abhängigkeit ihrer neuronalen Verschaltungen, also in Abhängigkeit des Aufbaus interner Komplexität. Aber diese ist dadurch bedingt, wie die Kontingenz der Beobachtungsoperation-en durch die Teilnahme an gesellschaftlicher Kommunikation eingeschränkt wird: »Das, was wir als Erkenntnis kennen, ist Produkt des Kommunikationssystems Gesellschaft, an dem Bewusstsein zwar jeweils aktuell, aber immer nur in minimalen Bruchteilen teilhat« (Luhmann 1993, 54). Für Luhmann ist deshalb die Erkenntnis eine soziale Tatsache, »die sich in und nur in der sozialen Kommunikation aktualisiert und Bewusstsein allenfalls über strukturelle Kopplungen als unentbehrliche Umweltbedingungen in Anspruch nimmt« (Luhmann 1992, S. 68).
Was wir wissen, wissen wir durch Teilnahme an gesellschaftlicher Kommunikation. Die aller Kommunikation gemeinsame Realität ist die des Operierens selbst, nicht aber die in einzelnen Kommunikationszusammenhängen hervorgebrachten Inhalte (Wirklichkeitsvorstellungen, Weltbilder, Themenzusammenhänge). Die primäre Realität ist für Luhmann die Operation des Beobachtens, nicht aber das, was im Prozess der rekursiven Verknüpfung von Beobachtungen daraus letztlich konstruiert wird. Die inhaltliche Seite bleibt immer ein Konstrukt der Kommu-nikation oder eines Bewusstseins. Jede Beobachtung konstruiert ihren Gegenstand, weil sie eine unterscheidende Operation ist, die auch hätte anderes unterscheiden, bezeichnen und beobachten können. Ein Phänomen wird zu einem Phänomen dadurch, dass es als solches unterscheidungsabhängig kommuniziert wird. Gegenstände, Tatsachen und Objekte werden diskursiv hergestellt und haben außerhalb sprachlicher Beschreibungen keine Entsprechung in einer vorfindlichen Realität: »Was sich als soziale Realität darstellt, wie wir soziale Wirklich-keit beschreiben und erklären, das hängt von den verwendeten Begriffen und Rhetoriken ab« (Vester 1999, S. 199). Dies gilt auch für die soziologische Kommunikation, »die sehen lernen muss, dass sie das, was sie sieht, selbst erzeugt und nicht eine vorfindbare Realität in ihrer Um-welt abbildet« (Kneer/Nassehi 2000, S. 14).
Obwohl es keine einfachen, vorfindlichen Daten gibt, benutzt die empirische Sozialforschung ihre Beobachtungsmethoden unter der Prämisse, dass sie damit bis zur Realität vordringt, und kann nicht sehen, dass sie lediglich ihre eigenen Konstruktionen validiert (vgl. Luhmann 1999, S. 41). Die Sozialforschung, ob qualitativ oder quantitativ ausgerichtet, kann Gesellschaft nicht außerhalb der Gesellschaft beobachten. Was auch immer sie an Erkenntnissen hervorbringt, sie kommuniziert dann nur ihre eigenen Konstruktionen: »Soweit Rekursionen auf Vergangenes verweisen (auf bewährten, bekannten Sinn), verweisen sie nur auf kontingente Operationen, deren Resultate gegenwärtig verfügbar sind, aber nicht auf fundierte Ursprünge« (Luhmann 1999, S. 47). Jede Beobachtung hat intern Unterscheidungen und Differenzschemata installiert, die als »Informationsgeber« fungieren und mit denen das Rauschen der Umwelt selektiv beob-achtet wird (»order from noise«). Beobachtungsmethoden sind in diesem Sinne dann Filter, Programme oder Transformatoren, mit denen ein Beobachter seiner Umwelt Informationen ab-gewinnt. Wenn also zum Beispiel Texte professionell gelesen und interpretiert werden, dann wird dadurch methodisch Kontingenz abgebaut und Komplexität reduziert, und schließlich im Effekt: Eindeutigkeit erzeugt. Dem Text selbst ist aber kein identischer Sinn eingeschrieben, wie es die traditionelle Hermeneutik immer behauptet hat.[158] Jede Bedeutungsfixierung ist nur eine von vielen, unendlich möglichen Interpretationsversuchen, und das wissenschaftliche Beobachten ist in erkenntnistheoretischer Hinsicht nicht besser dran als andere Interpretations-versuche, denn es gibt keine hinter der Beobachtung liegende, vorsprachliche, eigentliche Realität. Die Gesellschaft kann deshalb durch die Soziologie weder repräsentiert noch als Ein-heit dargestellt werden, denn jeder Versuch einer Repräsentation der Gesellschaft (wenn sie als Kommunikation auftritt) ist selbst eine gesellschaftliche Operation, die sich ihrerseits wieder der Beobachtung und Kritik aussetzt.
Wenn man die Annahme einer ontologischen Darstellung von Realität aufgibt, dann ist jede Beobachtung, jede Erkenntnis und jedes Wissen kontingent, und die wissenschaftliche Beob-achtung nur eine von vielen Beobachtungsmöglichkeiten. Die Konsequenz, die dann daraus gezogen werden muss, ist: Kommunikation muss nicht unbedingt auf Konsens abzielen, denn worüber sollte man sich verständigen, wenn es keine objektive Realität gibt, über die man sich verständigen kann? Diese Idee einer konsensorientierten Kommunikation wird von Habermas noch in seiner »Theorie des kommunikativen Handelns« vertreten. Dabei wird dann unterstellt, dass verschiedene Beobachter in einer gemeinsamen Welt leben, und dass bei vernünftiger Verständigung eine Übereinstimmung angestrebt werden kann:
Die Beobachter entwickeln Methoden und Verfahren, um zu einer Verständigung zu kommen. Sie beschränken ihren Meinungsstreit auf Argumentation. Sie unterstellen sich der Norm gemeinsam zu erreichender Einsicht. Das definiert für sie rationale Kommunikation. Und wenn sie ihr Ziel der Verständigung praktisch nicht erreichen, müssen sie es dennoch erreichen wollen – oder sie führen nicht den Diskurs, den ein normatives Konzept von Rationalität ihnen abverlangt. Sie handeln, würde ich nun sagen, unter der Annahme, dass sie in ein und derselben Welt leben und dass es darum gehe, über diese Welt übereinstimmend zu berichten.[159]
Wenn aber die Welt unterscheidungsabhängig konstruiert (und in der Folge: ontologisierend behandelt) wird, dann ist eine Übereinstimmung von Beobachtungen nur noch ein mögliches Ergebnis, nicht aber ein innewohnendes Ziel aller gesellschaftlichen Kommunikation. Für die wissenschaftliche Kommunikation bedeutet dies: »Objektivität und Intersubjektivität beruht nicht etwa auf ihrer Realitätsadäquanz, sondern ist das Produkt der kulturellen Einheitlichkeit der Wissenschaftler, die sich auf bestimmte Kategorien zur Beurteilung der als wissenschaft-lich geltenden Konstrukte geeinigt haben und andere in diesem Sinne sozialisieren« (Schmidt 2000, S. 153). Die Theorie beobachtender Systeme steht somit quer zu den beiden erkenntnis-theoretischen Positionen von Realismus (Erfahrungswissen) und Idealismus (Vernunftwissen), sie behandelt Erkenntnis als Produkt kommunizierter Unterscheidungen und verlagert damit das Beobachten und Erkennen in die Sozialdimension. Das Mensch hat in dieser Theorielage nicht mehr den Status des allem zugrundeliegenden Subjekts, er wird vielmehr als teilnehmen-des Bewusstsein in die Umwelt des Kommunikationssystems Gesellschaft versetzt. In diesem Sinn wird dann das Erkenntnissubjekt durch einen anonymen Differenzierungsprozess ersetzt, nämlich durch einen Prozess ohne Subjekt. Die Evolution des gesellschaftlichen Wissens wird nicht etwa durch eine transzendentale Vernunft geregelt, sondern ist abhängig vom sozialen Gedächtnis der Kommunikation. Der Mensch als das der Erkenntnis zugrundeliegende Subjekt zerfällt und wird als autonom auftretende Einheit undenkbar: die soziale Differenzierung läuft gleichsam von alleine in der Umwelt des Menschen ab. Dieser kann das Soziale dann weder beherrschen noch überblicken (vgl. Zima 2000, S. 329 ff.).
Der Beobachter der klassischen Erkenntnistheorie ging davon aus, dass es eine Wirklichkeit, also auch nur eine Wahrheit, gibt. In der Erkenntnistheorie des Radikalen Konstruktivismus wird hingegen behauptet, dass es so viele Wirklichkeitskonstruktionen gibt, wie es kognitive Systeme gibt, die sie hervorbringen: Wahrheit sei dann ein subjektabhängiges Phänomen. Die Systemtheorie führt dagegen das Argument an, dass kognitive Welten und subjektive Wahr-heiten keinerlei gesellschaftliche Relevanz haben, solange nicht darüber kommuniziert wird. Man kann deshalb zwar sinnvoll von einer Relativität, nicht aber von der Beliebigkeit des Erkennens sprechen. Für Luhmann symbolisiert Wahrheit die Anschlussfähigkeit an vorange-gangene Beobachtungen, an vorangegangene Wahrheiten. Sie ist ein evolutionäres Produkt und somit kontingent: es gibt zwar nicht notwendigerweise nur eine einzige Wahrheit, aber es kann auch nicht beliebig viele geben (vgl. Luhmann 1992, S. 100). Ein Beobachter hat nicht die Möglichkeit der freien Wahl: er kann nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt alles Beliebige sagen (sonst wäre die Institution der Psychiatrie überflüssig). Luhmann weist auf die Evolution kommunizierter Unterscheidungen und damit auf die Nichtbeliebigkeit gesellschaftlichen Wissens hin. Denn obwohl die Erkenntnis keinen Bezug zu einer außerhalb der Erkenntnis liegenden Realität hat, kann sich ein Beobachter die Welt nicht subjektiv so zurechtlegen, wie es ihm beliebt:
Denn alle Systemoperationen sind, wie unbestrittene Forschungen über die Logik von Selbstorganisation zeigen, stets nur als konditionierte Operationen möglich. Und Menschen sind durch Teilnahme an gesellschaftlicher Kommunikation in einem Maße sozialisiert, dass sie nur im Rahmen dafür freigegebener Möglichkeiten wählen können.[160]
Die Bedingungen und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Wissens sind dann nicht, wie Kant angenommen hatte, im Erkenntnissubjekt angelegt, sondern werden durch die gesellschaftliche Kommunikation geregelt. So bestimmt etwa die Infrastruktur der Kommunikation (damit ist gemeint: ihre physikalische und administrative Topologie), welche Beobachtungen wann, wo und wie anderen Beobachtern zugänglich gemacht werden, welche Beobachtungen massen-medial in das Kommunikationssystem Gesellschaft eingespeist werden, um dann von dort aus wieder Mentalzustände (also Beobachter mit Bewusstsein) zu verändern. In Abhängigkeit des Zugriffs auf Medien bestimmt die gesellschaftliche Kommunikation selbst, welche Erkenntnis-konstruktionen der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden und welche nicht. Dabei kann sich weder Kommunikation noch Bewusstsein auf ein transzendentales Fundament stützen, was bedeutet: die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Normalität und Pathologie, zwischen Vernunft und Unvernunft, zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft, sind frei verschiebbar – und sie werden auch nur wieder innerhalb der gesellschaftliche Kommunikation entschieden.[161]
Während für Kant die Vernunft noch ein menschliches Vermögen darstellte, ist für Luhmann Vernunft ein sozial hergestelltes Konstrukt und fällt dann je nach Beobachter verschieden aus. Vernunft ist keine Eigenschaft, die sich einem menschliche Bewusstsein verdankt, sie wird ausschließlich über soziale Operationen geregelt: »Was man sich von Vernunft versprochen hatte, ist nicht im Bewusstsein erreichbar. Es wird auf einer anderen Realitätsebene, in einem anderen System realisiert, nämlich durch Kommunikation« (Luhmann 1993, S. 36). Das, was als vernünftig gilt, ist somit historischen und sozialen Veränderungen unterworfen. Luhmann setzt sich also von solchen Positionen ab, die ähnlich wie Habermas »in Anspruch nehmen, dass sie das Wahre, Vernünftige, Richtige sehen oder wenigstens Wege und Verhaltensweisen aufzeigen können, die dahin führen« (Luhmann 1992, S. 102). Erkenntnis bleibt immer ein soziales Produkt, und es geht dann immer nur um die Möglichkeiten und Bedingungen der Konditionierung von gesellschaftlicher Kommunikation. Luhmann ersetzt deshalb den Begriff der Vernunft durch den der Systemrationalität, da jedes System seine eigene Rationalität be-sitzt, die nicht gesamtgesellschaftlich repräsentiert werden kann: »Rationalität kann nur noch als Systemleistung begriffen werden und divergiert dann je nach Systemreferenz« (Luhmann 1992, S. 693). Dieses Verständnis von Rationalität fordert dann nicht mehr das Streben nach Einheit und gesellschaftlicher Übereinstimmung, sondern wird differenztheoretisch gewendet. Einem System wird Rationalität dann zugesprochen, wenn »es in der Lage ist, die Differenz von System und Umwelt in sich zu reflektieren« (Luhmann 1992, S. 694).
Die Idee, die Gesellschaft als Einheit repräsentieren und daraufhin vernünftig planen und ge-stalten zu können, ist für Luhmann eine Illusion. Intersubjektivität ist weder Voraussetzung noch Ziel der gesellschaftlichen Kommunikation, sie ist lediglich ein mögliches Ergebnis.[162] Das Bewusstsein ist zwar an den gesellschaftlichen Operationen beteiligt, »dass heißt aber nicht, dass Bewusstseinssysteme spezifizieren könnten, wie und in welche Richtung ein Kommuni-kationssystem seine eigenen Strukturen ändert und durch eigene Operationen sich von einem Zustand in einen anderen bringt« (Luhmann 1992, S. 565). Die Operationen schränken viel-mehr von selbst schon ein, was angeschlossen werden kann und was nicht. Der Realitäts-widerstand von Beobachtungen liegt dann »im Widerstand der Operationen des Systems gegen die Operationen desselben Systems, hier also: von Kommunikationen gegen Kommunikation-en« (Luhmann 1999, S. 127). Wenn also die gesellschaftliche Kommunikation kontingent ist, weil sie weder einer immanenten Vernunft gehorcht noch Beliebigkeit zulässt, dann bedeutet dies: sie ist richtungslose Evolution und folgt keinem vorgegebenen Plan.[163] Die Gesellschaft ist dann eine komplexe nichttriviale Maschine (im Sinne Heinz von Foersters), die keinem vorge-gebenen Ziel folgt, sondern allenfalls stabile Eigenwerte (Attraktoren) ausbildet. Jede gesell-schaftliche Operation ist riskant, weil sie angenommen oder abgelehnt werden kann: »Dieses Risiko ist einer der wichtigsten morphogenetischen Faktoren im Wechselspiel von Kommuni-kation und Bewusstsein« (vgl. Luhmann 2001a, S. 103 f.). Die Theorie der gesellschaftlichen Evolution des Wissens setzt deshalb unterscheidungsrelativ an und wird dabei im Schema von Variation und Selektion konstruiert (vgl. Luhmann 1993, S. 57). Während dieses Prinzip und die damit verbundenen Zufälligkeiten, Mutationen und Richtungsänderungen in der Biologie durchaus anerkannt sind, können die Sozialwissenschaften nur schwer akzeptieren, dass die sozialen Phänomene mehr oder wenig zufällig auftreten und aufgrund von Selektionsprozessen und funktionalen Erfordernissen fortbestehen (vgl. Wenturis 1998, S. 193).
6.2. Beobachten: Bewusstsein oder gesellschaftliche Kommunikation?
Wird nach dem Gegenstand der Soziologie gefragt, dann bekommt man als Antwort: die Gesellschaft. Unklar ist jedoch, was genau unter Gesellschaft zu verstehen ist, weshalb die Soziologie in eine subjektivistische und in eine objektivistische Position gespalten ist. Die sub-jektivistische Position tritt als Handlungstheorie auf und kann gegenwärtig als vorherrschend angesehen werden. Ihr Gegenstand sind dann handelnde Individuen und alle Aktivitäten, die subjektiv gemeinten Sinn zum Ausdruck bringen, da diese als gesellschafts- und wirklichkeits-konstituierend angesehen werden. Das grundlegende Verfahren des Soziologen sei deshalb das verstehende Erklären: das Verstehen des subjektiv gemeinten Sinns wird für eine unabdingbare Voraussetzung des ursächlichen Erklärens sozialer Phänomene gehalten (vgl. Esser 1999, S. 4 f.). Die verstehende Soziologie interessiert sich für sprachlich aufgezeichnete Kommunikation, um darüber Aufschluss über das in der Sprache zum Ausdruck kommende Bewusstsein zu er-halten. Von einem Text wird dann auf das Bewusstsein geschlossen, und vom Bewusstsein das Zustandekommen des Sozialen erklärt. Die Grundannahme ist: der subjektiv gemeinte Sinn in sozialen Handlungen sei ein verständliches und erklärungsfähiges Phänomen und deshalb der methodische Ansatzpunkt der Soziologie: »Dementsprechend besteht die speziell soziolog-ische Erkenntnis und insbesondere die Kausalerklärung darin, das empirische Sozialverhalten in dessen Verlauf und in dessen Wirkung von seinem subjektiv gemeinten Sinn her zu er-fassen« (Wenturis 1992, S. 198). Der individualistische Ansatz vollzieht also eine begriffliche Reduktion, indem er behauptet, dass die soziale Realität am besten verstanden werden könne, wenn alles Gesellschaftliche auf ihre konstitutiven Gründe zurückführt wird, wenn also die handelnden Individuen zum natürlichen Referenzpunkt der Sozialforschung gemacht werden (Knorr-Cetina 1997, S. 134 f).
Die objektivistische (strukturalistische) Position führt die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht auf das subjektive Bewusstsein, sondern auf objektive Sinnstrukturen zurück. Während dem Laien stets nur die Oberflächenphänomene des Sozialen zugänglich seien, würden sich dem professionellen Forscher verborgene Tiefenstrukturen offenbaren, die das soziale Verhalten der Akteure generieren.[164] Aufgabe des Forschers sei es dann, diese objektiv gegebenen, latenten Sinnstrukturen verstehend herauszuarbeiten und in Kommunikationsartefakten exakt jene algorithmischen Regeln als »Taktgeber« des Sozialen ausfindig zu machen, als deren Derivat die gedachte Intentionalität sozial Handelnder allein angesehen werden muss (vgl. Nassehi 1997, S. 146 ff.). Derartige Strukturanalysen gehen davon aus, dass die soziale Wirklichkeit als Oberflächenphänomen von einer tieferliegenden (»eigentlichen« oder »wirklicheren«) Realität beherrscht wird, die als latente Struktur vorhanden und wirksam ist und deshalb vom Forscher aufgedeckt werden kann. Strukturanalysen gehen davon aus, dass Strukturen nicht Resultat von Beobachtungsoperationen, sondern handfeste Realität sind. Den beobachteten Strukturen wird also eine objektive Realität bescheinigt:
Dadurch, dass die Analyse auf Strukturen stößt, dadurch, dass bestimmte prägnante (zum Beispiel binäre) Konfigur-ationen erkennbar werden, entsteht ein Nichtzufälligkeitsbewusstsein, das sich selbst Realitätsbezug bescheinigt. Wenn die Analyse überhaupt Ordnung entdeckt und nicht Chaos, wenn sie trotz Abstraktion nicht ins Beliebige abrutscht, sondern auf gut konturierte Sachverhalte stößt, ist dass für sie ein Symptom dafür, dass sie es mit Realität zu tun hat.[165]
Den Gegensatz von Subjektivismus und Objektivismus haben Berger und Luckmann zu über-winden versucht, indem sie die Gesellschaft dialektisch denken. Gesellschaft ist dann beides, sowohl subjektiv konstituiert als auch objektiv erfahren, so dass die Autoren fragen: »Wie ist es möglich, dass subjektiv gemeinter Sinn zu objektiver Faktizität wird ?« (Berger/Luckmann 2000, S. 20). Der subjektive Sinn eines Bewusstsein ist hier alleinige Sinnquelle des Sozialen, er ist konstituierender Faktor der gesellschaftlichen Wirklichkeit, denn die Gesellschaft wird »konstruiert durch Tätigkeiten, die subjektiv gemeinten Sinn zum Ausdruck bringen« (Berger/ Luckmann 2000, S. 20). Die gesellschaftliche Realität wird also letztlich wieder auf handelnde Subjekte zurückgeführt, wenngleich nichtintendierte Folgen in diesem Ansatz als Struktur-effekte mit berücksichtigt werden. Das Soziale wird dann zwar Realität sui generis genannt, doch ist damit nicht gemeint, dass diese Realität sich einer eigenständigen, selbstbezüglichen Selektivität verdankt. Forschungsgegenstand der Soziologie sei deshalb der Mensch sowie die Gesellschaft als Teil der menschlichen Welt.
Die Frage ist jedoch, ob mit handlungstheoretischen Begriffen und einer Kausalität von unten das Soziale hinreichend erklärt werden kann. Wird nämlich auf das menschliche Bewusstsein als Sinnquelle und Produzent von Semantiken abgestellt, dann wird die Rechnung ohne die Gesellschaft, ohne Anerkennung einer eigenständigen kommunikativen Realität, gemacht. Legt man hingegen die systemtheoretische Differenz von Bewusstsein und Kommunikation zugrunde, dann bedarf es einer Umstellung der soziologischen Beobachtung von Gesellschaft. Für Luhmann besteht denn auch kein Zweifel, dass die Soziologie nicht Bewusstsein, sondern ausschließlich Kommunikation zu beobachten hat: »Methodologisch gesehen, folgt daraus: dass man bei der Beobachtung von sich selbst beobachtenden Systemen ansetzen muss und nicht bei einer zu unterstellenden Ontologie der Kausalität« (Luhmann 1990, S. 29). Für die systemtheoretisch informierte Hermeneutik gilt, dass sie nicht mehr auf Bewusstseinsprozesse, nicht mehr auf psychische Realitäten, zurückgreift. Gegenstand der soziologischen Analyse ist ausschließlich beobachtbare Kommunikation (vgl. Nassehi 1997, S. 145).
Statt wie die Subjekt- und Bewusstseinsphilosophie die gesellschaftliche Praxis auf Akteure zurückzuführen, werden in der Systemtheorie die Akteure als Teilhabende an Praxis erklärt. Hinter den gesellschaftlichen Prozessen steckt dann kein subjektives Bewusstsein mehr (als deren Autor oder Urheber), so dass das Handlungskonzept neu bewertet werden muss: »Eine akteurszentrierte Ontologie müsste aus dieser Perspektive eher als eine Konsequenz gesehen werden denn als eine Vorbedingung einer bestimmten Form von Praxis« (Knorr-Cetina 1997, S. 137). Ein anti-essentialistischer Konstruktivismus geht nämlich nicht davon aus, dass die Konstruktion der gesellschaftlichen Realität etwas mit dem bewussten, aktiven und zielgericht-eten Erzeugen von Ergebnissen zu tun hat:
Er unterminiert die Suche nach dem deutlich Konstruierten auf der Handlungsebene durch Zulassen der Möglichkeit, dass die Rolle des (individuellen) Akteurs oder Handelnden selbst eine geschaffene Kategorie ist, von der wir annehmen können, dass sie in bestimmten, aber nicht in allen Umgebungen aufrechterhalten wird.[166]
Die Systemtheorie braucht nicht auf das subjektive Bewusstsein als Sinnquelle zurückgreifen, weil sie anstelle eines essentialistischen einen operativen Sinnbegriff benutzt. Es finden dann sinnhafte Operationen nicht nur in einem Bewusstseins, sondern auch in der gesellschaftlichen Kommunikation statt. Die These ist, dass auf einer emergenten Ebene Organisationsprozesse stattfinden, die nicht vom Menschen initiiert oder getragen werden, sondern die eigenen Logiken gehorchen und dazu Bewusstsein parasitär in Anspruch nehmen. Die Aufgabe der Soziologie ist es dann nicht, auf das Einzelbewusstsein abzustellen und die Gesellschaft vom Individuum her zu erklären, sondern stattdessen auf der Systemebene der Kommunikation zu verbleiben:
Was man durch die Entscheidung für den Primat der Kommunikation gewinnt, ist die Möglichkeit, Handlung als Be-wusstseinleistung und Handlung als sozial konstituierte Einheit klar analytisch gegeneinander abzugrenzen. Unab-hängig von der sozialen oder nicht-sozialen Ausrichtung subjektiven Sinnes werden diese beiden Handlungsformen unterscheidbar als Operationstypen. Daraus ergeben sich neuartige empirische Folgefragen, die unter den Prämissen der intentionalistischen Handlungstheorie kaum formuliert werden können.[167]
Die Systemtheorie betont die Emergenz der Kommunikation und kann Handeln deshalb nicht sinnvoll als intentionales Verhalten begreifen, wenngleich ein Bewusstsein sich selbst immer als »Handlungssubjekt« wahrnimmt. Ein systemtheoretischer Ansatz lehnt reduktionistische Erklärungsversuche ab und stellt stattdessen auf die Beobachtung von Kommunikationen ab. Damit wird das Verhältnis von Bewusstsein und Kommunikation umgekehrt: die Themen der gesellschaftlichen Kommunikation werden, wenn die Autopoiesis anzulaufen beginnt, mehr und mehr auch zu Bewusstseinsinhalten. Da Bewusstsein immer schon mit gesellschaftlichen Unterscheidungen angereichert ist und die gesellschaftliche Kommunikation nur punktuell und in engen Grenzen der Zulässigkeit irritieren kann, ist weniger davon auszugehen, dass Mental-zustände die Kommunikation verändern als umgekehrt. Was immer in einem Bewusstsein vor-gehen mag: von da aus bis zur gesellschaftlich wirksamen Kommunikation ist es ein weiter Weg, denn die Schwelle möglicher, möglicherweise verständlicher und möglicherweise erfolg-reicher Kommunikation wirkt hochselektiv.[168]
Da die Gesellschaft an jeder Kommunikationsstelle anders beobachtet, kann sie nicht mehr als Einheit beschrieben und dargestellt werden, auch durch die Soziologie nicht. In Anlehnung an Gotthard Günther spricht Luhmann hier von der Gesellschaft als einem polykontexturalem System. Es gibt keine Möglichkeit, die gesamtgesellschaftliche Kommunikation als theoretisch überschaubares und abgeschlossenes System darstellen zu können, denn es gibt kein sinn-erzeugendes Zentrum, keine kollektive Vernunft, keine organisierende Subjektivität (im Sinne Durkheims), sondern nur: Differenzwahrnehmung durch Beobachter beobachtende Beob-achter. Luhmann verneint die Möglichkeit einer objektiven Beschreibung der Gesellschaft, denn jede Beobachtung ist das Konstrukt eines Beobachters, und von einer anderen System-referenz wird eben anderes beobachtet. Wie kann dann aber die Soziologie noch Gesellschaft beobachten? Legt man einen operativen Sinnbegriff zugrunde und geht davon aus, dass jede Kommunikation, die sich auf eine andere Kommunikation bezieht, dieser einen sozialen Sinn zuweist, dann kann man immerhin beobachten, wie dies geschieht. Beobachtbar wird also, wie in der gesellschaftlichen Kommunikation Sinnhorizonte produziert und eingeschränkt werden, wie mit Kontingenz umgegangen wird. Beobachtbar wird, wie in der Kommunikation Objekte, Identitäten, Tatsachen sozial konstruiert und auf ihre Folgen hin untersucht werden. Gegen-stand der Sozialforschung wird dann die Frage nach der Kontingenz ihres Gegenstandes (vgl. Kneer/Saake 2000). Die Autoren weisen darauf hin, dass die Aufgabe der empirischen Sozial-forschung immer noch hauptsächlich darin besteht, methodische Regeln einzuführen, um damit Kontingenz kontrollieren und wegarbeiten, also Eindeutigkeit erzeugen zu können, an-statt die gesellschaftliche Kontingenzbearbeitung und -entfaltung als ihr eigentliches Thema zu entdecken. Es wird kaum gesehen, dass die methodischen Regeln den gleichen Regeln folgen wie der beobachtete Gegenstand, denn auch dieser geht mit Kontingenz um. Die Autoren fordern deshalb eine Umstellung der Beobachtungsmethode: von einer Beobachtung erster Ordnung (»Was ist der Fall?«) hin zu einer Beobachtung zweiter Ordnung, die fragt: Wie wird beobachtet? Wie wird in der gesellschaftlichen Kommunikation Kontingenz bearbeitet? Wie wird durch einen Beobachter Eindeutigkeit erzeugt? Die Aufgabe der Sozialforschung wird dann zum einen darin gesehen, Kommunikation zu beobachten (und nicht Bewusstsein), und zum anderen Kontingenz sichtbar zu machen, anstatt diese vorab methodisch einzuschränken und das Beobachte als ontischen Gegenstand, als soziale Tatsache, auszugeben. Methodische Rationalität meint dann nicht die Suche nach einer gegenstandsadäquaten Methode, sondern, weil Methoden ihren Gegenstand immer schon konstituieren, die Einsicht in die epistemolog-ische Verschlingung von Forscher und Gegenstand sowie die Folgenabschätzung von Begriffs- und Unterscheidungsumstellungen (vgl. Kneer/Saake 2000, S. 80 ff.).
7. Schlussbetrachtung
Die Arbeit hatte zum Ziel, den Subjektbegriff mit all seinen Implikationen kritisch zu hinterfragen und die Konsequenzen aufzuzeigen, die mit dieser Dekonstruktion verbunden sind. Für die subjektphilosophische Tradition ist der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen, das sich die Welt erkennend zurechtlegt und danach sein Handeln ausrichtet und die Gesellschaft gestaltet. Bewusstseinsinhalte würden sich einer subjektiven, im Zentrum befindlichen Sinn-quelle verdanken – oder anders: der menschliche Geist sei ein »zentraler Bedeutungserzeuger« (Dennett). Schrift, Sprache, Kunst oder Kultur wären dann lediglich zeichenhafte Ausdrücke oder Externalisierungen des menschlichen Bewusstseins. Wie ich jedoch zu zeigen versucht habe, setzt sich allmählich die Einsicht durch, dass kognitive Inhalte auf Prozessen beruhen, die sich unter Zuhilfenahme von Umweltbedingungen selbst organisieren. Das Bewusstsein ist nur ein Sonderfall von sich (kognitiv) selbstorganisierenden Systemen und verschwindet damit auch die Grenze zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft. Der Mensch ist jedoch ein Ausnahmefall insofern, als er ein außerordentlich komplex beobachtendes System ist, das darüber hinaus über ein Selbstbewusstsein verfügt. Die entscheidende Frage war, wie dieses Selbst- oder Ich-Bewusstsein zu bewerten ist: als Voraussetzung (Subjekt) oder als Ergebnis (Produkt) von Kommunikationsprozessen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sich die Selbstbeobachtung kognitiver Systeme einer spezifischen Unterscheidung verdankt, nämlich der Unterscheidung von Selbstreferenz und Fremdreferenz, und dass diese Unterscheidung im Bewusstsein nicht als apriorisches Vermögen angelegt ist, sondern durch Teilnahme an gesell-schaftlicher Kommunikation erworben wird, deshalb also keine Qualität eines Bewusstseins sein kann. Der Mensch erfährt sich als Subjekt durch den Vollzug linguistischer Operationen, die zwischen Subjekt und Objekt unterscheiden. Erst dadurch lernt er sich als beobachtendes System wahrzunehmen, und erst dadurch kann er sich als »Subjekt« begreifen.
Das moderne Menschenbild dachte den Menschen als ein bewusst wollendes, autonomes, sich selbst zugrundeliegendes Subjekt. Wie ich gezeigt habe, wird dieser Gedanke einer stabilen, kohärenten Persönlichkeit inzwischen aufgegeben und das Subjektbewusstsein durch das Kon-zept der multiplen Persönlichkeit ersetzt. Das sich selbst bewusste Ich ist dann ein dezentrales, gespaltenes, dissonantes Ich, und die Einheit der Wahrnehmung eine kognitive (sprachlich generierte) Illusion. Das operative Geschehen im Gehirn ist zwar selbstgeleitet und in diesem Sinne autonom, doch das Bewusstsein ist nicht der Urheber, ist nicht der Kontrolleur dieser Prozesse. Wie man beim Blindsehen und bei »splitbrain«-Patienten sehen kann, wird das Ich-Gefühl als bewusst wollendes Agens über sprachliche Beschreibungen realisiert. Die Rolle des Bewusstseins wird somit geschwächt: anstelle einer Urheberschaft übernimmt das Bewusstsein eher die Rolle eines Zuschauers. Es beobachtet das Geschehen (für dessen Autor es sich hält), indem es dieses sinnhaft kommentiert und mit Kausalkonstruktionen unterlegt. In Wirklichkeit aber ist es ein Spielball zwischen unbewussten, neuronalen Prozessen und gesellschaftlicher Kommunikation. Das Bewusstsein hält sich dann für den Autor des Geschehens, obwohl es nur nachträgliche Rationalisierungen in Form sprachlicher Beschreibungen anfertigt. Je nach sozialem Kontext wird es sich dann so präsentieren und rechtfertigen, wie es die soziale Situation erforderlich macht. Es liefert dann sozial erwartbare Sprachfiguren, die es als »aus sich selbst heraus« motiviert oder für »authentisch« hält.
Die realistische Erkenntnistheorie hatte auf die Frage, wie das Subjekt die Welt erkennen kann, mit dem Hinweis auf die Außenwelt geantwortet: das Sein bestimmt, wie dem Bewusstsein die Dinge phänomenal erscheinen. Objektivität war gegeben, wenn sich ein Beobachter von seinen subjektiven Befindlichkeiten frei machen und sich der Realität möglichst gut annähern kann. Die Transzendentalphilosophie Kants hat das Verhältnis von Subjekt und Objekt schließlich umgedreht: nicht die Erkenntnis richtet sich nach ihrem Gegenstand, sondern der Gegenstand richtet sich nach der Erkenntnis (die dann aber unter dem Diktat des transzendentalen Subjekts stehen sollte). Das Fundament der Erkenntnis war für Kant also das Subjekt, genauer: die in ihm angelegten, apriorischen Erkenntnisbedingungen. Diese sollten sicherstellen, dass sich das Erkennen nicht nach Belieben vollzieht, sondern einheitlichen Prinzipien gehorcht. Die phäno-menale, beobachterabhängige Erscheinungswelt (Wirklichkeit) war dann das Ergebnis des Ein-wirkens von Sinnesreizen und deren kategorialer Einordnung in die transzendentale Struktur, die allen Subjekten zugrunde liegt. Im Radikalen Konstruktivismus wird der Objektivitätsan-spruch der Erkenntnis dann endgültig aufgegeben: weder eine Ontologie noch transzendentale Erkenntnisbedingungen würden die Einheit der Erkenntnis sicherstellen. Stattdessen wird das Erkennen erfahrungsabhängig an den Organismus gekoppelt. Das Bewusstsein bekommt damit mehr Spielraum, wie es sich seine kognitive Welt entwirft, da es nicht durch eine transzenden-tale Struktur aufgehalten oder beschränkt wird. Die Systemtheorie radikalisiert schließlich den Beobachterbegriff und verlagert das Erkennen von einem neurophysiologischem Substrat in die Sozialdimension. Damit ist der Weg dann freigegeben für eine kontingente, richtungslose Evolution des gesellschaftlichen Wissens. Wissen wird nicht wie im Radikalen Konstruktivis-mus als subjektabhängiges Phänomen gesehen (obgleich es von einem Beobachter so erfahren, gedeutet und gesellschaftlich kommuniziert wird), sondern der Referenzpunkt des Erkennens ist die Gesellschaft als Vollzug kommunizierter Unterscheidungen. Die Überlegung dabei ist folgende: das menschliche Gehirn ist so komplex, dass Wirklichkeitsvorstellungen kontingent werden und diese Kontingenz auf irgendeine Weise eingeschränkt werden muss. Während im Radikalen Konstruktivismus behauptet wird, dass diese Einschränkung durch das Gehirn selbst vorgenommen wird (was nicht ganz falsch ist), besagt die Systemtheorie, dass beim Aufeinan-dertreffen zweier Bewusstseinssysteme ein neues System entsteht, dass sich gewissermaßen zwischen die Bewusstseinssysteme »schiebt« und dann diese Reduktionsleistung übernimmt. Es schränkt die Bewusstseinssysteme in ihren Beobachtungsoperationen ein, weil es selbst eine interne Komplexität aufbaut und somit eine innere Ordnung entstehen lässt, an die sich die be-teiligten Bewusstseinssysteme dann orientieren können. Mit anderen Worten: die Kontingenz subjektiver Erkenntnismöglichkeiten wird eingeschränkt durch die Teilhabe an gesellschaft-licher Kommunikation, wobei Bewusstsein mit sozialen Unterscheidungen angereichert wird. Es gibt dann keine subjektive Sinnquelle mehr, kein authentisches Subjekt, kein Urheber sinn-hafter Operationen, sondern nur noch Beobachtungsprozesse, die auf andere Beobachtungen Bezug nehmen.
Die Dezentrierung des Menschen als Erkenntnis-, Sprach- und Handlungssubjekt führt zu der Einsicht, dass es keine von sprachlichen Beschreibungen unabhängige Realität gibt, und dass der Mensch diese Beschreibungen nicht beherrscht, da diese sich selbst diskursiv formieren, ohne dass man dazu eine organisierende Subjektivität annehmen muss. Jede Erkenntnis beruht dann auf sprachlichen Unterscheidungen, und jeder Diskurs hält zur Beobachtung von Welt verschiedene Beschreibungen bereit. Es gibt folglich keine privilegierte Beschreibungssprache, die sich der Realität am weitesten annähern kann, denn die Theorie beobachtender Systeme besagt, dass jeder Objektbereich, jede beobachtete Realität, immer das beschriebene Konstrukt eines Beobachters ist und sprachabhängig (unterscheidungsabhängig) erzeugt wird. Es gibt keine ontologisch fixierbare, beobachtungsinvariante, sprachunabhängige Wirklichkeit, die allen kompetenten Beobachtern auf die gleiche Weise zugänglich sein muss. Sprache ist kein Instrument des Zugriffs auf eine sprachunabhängige Wirklichkeit, und folglich sagen sprach-liche Beschreibungen weniger etwas über die Welt als vielmehr etwas über den Beobachter aus, der mit seinen Unterscheidungen Realität konstruiert. Für die Wissenschaft gilt deshalb, dass ihre Beobachtungsmethoden keine vorfindliche Realität abbilden (so dass der Forscher sich lediglich über die Wahl seiner Methoden Gedanken machen muss, nicht aber über das, was als Ergebnis seiner Forschung herauskommt). Wie für jede andere Beobachtung gilt auch für die Wissenschaft, dass sie nicht einfach auf die Realität zugreift und diese dann lediglich in sprachliche Beschreibungen überführt, sondern dass umgekehrt ihre Beobachtungen Realität inszenieren. Wissenschaft ist, wie jedes andere Erkenntnisverfahren auch, eine Technologie der Transformation von Beobachtungen in neue Beobachtungen. Sie rekonstruiert damit keine ontologischen Identitäten, sondern erzeugt sie durch Einführung bestimmter Sprachfiguren. Da sich Wissenschaft nicht auf einen göttlichen Logos oder auf eine universelle Vernunft berufen kann, bedeutet dies, dass sie ihren Objektbereich eigenverantwortlich konstruiert und dabei nur auf eigene Konstruktionen zurückgreifen kann – der Widerstand von Beobachtungen ist kein Widerstand an einer Realität, sondern Widerstand an den eigenen Beobachtungsoperationen. Es gibt keine sprachlichen Ausdrücke, die das »Wesen« einer Sache bezeichnen könnten, denn differenztheoretisch verdankt sich die Unterscheidung in Wesen und Erscheinung selbst einer beobachtenden Unterscheidung und ist keine Qualität von Welt. Für die empirische Sozialfor-schung entsteht damit das Problem, dass sie ihren Gegenstand nicht mehr einfach ontologisch voraussetzen und dann auf die Suche nach einer angemessenen Methode gehen kann, mit der der Gegenstand untersucht werden soll. Methoden sind immer ein Korrelat der Gegenstands-definition, und der Gegenstand ein Effekt sprachlicher Bezeichnungen. Und genau deshalb lässt sich fragen: Wieso wird ausgerechnet so beobachtet, definiert, unterschieden, bezeichnet, und nicht anders? Mit einer Beobachtung zweiter Ordnung kann möglicherweise eine Folgen-abschätzung wissenschaftlicher Kommunikation vorgenommen werden, wenn nämlich die Auswirkungen der wissenschaftlichen Kommunikation auf die Gesellschaft in Rechnung ge-stellt werden, indem überlegt wird, welche Effekte die kommunizierten Unterscheidungen auf die gesellschaftliche Zirkulation haben können.
Wenn das Subjekt als Erkenntnis- und Handlungsträger wegfällt, dann kann es auch nicht Gegenstand der Soziologie sein. Geht man stattdessen vom Primat der Kommunikation aus, dann hat es die Soziologie mit einem in Operation befindlichen System zu tun, das sich ähnlich dem Nervensystem selbst weiterspinnt, ausbaut, differenziert, vernetzt und reproduziert, ohne dass es dazu eines zugrundeliegenden Bewusstseins bedarf, das gewissermaßen vom Fahrersitz aus das Geschehen lenkt. Als eine »historische Maschine« ist das Kommunikationssystem Ge-sellschaft von seiner eigenen Vergangenheit abhängig und kann sich nur wieder auf sich selbst beziehen. Kommunikation verläuft dann zwar autopoietisch, nicht aber autark, denn es muss zu seiner Reproduktion Bewusstsein parasitär in Anspruch nehmen, ist also auf Umweltbe-dingungen angewiesen. Indem Bewusstsein durch Kommunikation und Kommunikation durch Bewusstsein irritiert wird, bedingen sich beide wechselseitig, ohne dass man sagen könnte, dass das eine dem anderen zugrunde liegt oder ontologisch vorzuziehen ist. Die Ko-Evolution von Bewusstsein und Kommunikation erfolgt zirkulär, Ursache und Wirkung sind indifferent: weder ist das Bewusstsein Subjekt der Kommunikation, noch ist Kommunikation das Subjekt des Bewusstseins. Beide Systeme sind operational geschlossen und dennoch ineinander ver-schränkt. Wenn also die Systemtheorie vom Primat der Kommunikation ausgeht, dann des-halb, weil soziale Systeme Komplexität reduzieren und damit einen intersubjektiven Zwang auf das Bewusstsein ausüben. Sprachliche Äußerungen werden nicht von einer denkenden Rationalität oder einem willentlich handelnden Subjekt beherrscht, vielmehr erzwingen soziale Systeme von selbst, welche Sprachfiguren wann, wo, wie und von wem abgeliefert werden. Die Realität der Kommunikation lässt sich kaum auf die Intentionen und Dispositionen von Subjekten zurückzuführen: sie hat keinen psychologischen Ursprung, sondern ist ein emergen-tes Produkt. Soziale Systeme benötigen zwar das Vorhandensein von Bewusstsein, sind aber nicht reduktionistisch auf diese zurückzuführen. Zwischen Bewusstseinssystemen »schiebt« sich die gesellschaftliche Kommunikation, die sich gedächtnisbasiert einer eigenen selektiven Evolution aussetzt.
Wie kann die Soziologie die Selbstorganisation der Gesellschaft beobachten, wenn nicht mehr davon auszugehen ist, dass die Gesellschaft von Subjekten gemacht wird? Ein erster Schritt wäre, sich von einem essentialistischen Sinnbegriff zu verabschieden und zu sehen, dass Sinn nicht als Substanz in Texten verankert (und deshalb: auffindbar) ist, sondern als selektive Beobachtungsoperation immer wieder neu aktualisiert wird. Sinn konstituiert sich dann als Operation von einem Ereignis zu einem nächsten, von einer Beobachtung zu einer anderen. Die traditionelle Hermeneutik, die an einen essentiellen Sinnbegriff festhält, will in Texten einen objektiven Bedeutungskern ausfindig machen. Sie vollzieht damit (unreflektiert) eine Beobachtung erster Ordnung, indem sie nichts weiter macht, als ein soziales Ereignis auf eine bestimmte Weise zu beobachten, auf eine bestimmte Art und Weise zu verstehen. Als gesell-schaftliche Operation unterscheidet sie sich damit jedoch nicht von anderen Beobachtern, die dieses Ereignis ebenfalls beobachten und diesem je eine eigene Bedeutung zuweisen. Erst ein operativer Sinnbegriff, und damit verbunden: erst eine Beobachtung zweiter Ordnung, würde die Soziologie als Beobachter von Gesellschaft in Erscheinung treten lassen. Dann beobachtet sie nämlich Beobachter, wie diese Kommunikation beobachten, wie sie einer Kommunikation Information abringen, wie sie mit Kontingenz umgehen, wie sie Gegenstände und Tatsachen konstruieren.
8. Verwendete Literatur
Auer, Peter (1999): Sprachliche Interaktion. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern. Tübingen: Niemeyer
Baumgartner, Peter / Payr, Sabine (1997): Erfinden lernen. In: Müller, Albert / Müller, Karl H. / Stadler, Friedrich (Hrsg.) (1997): a.a.O., S. 89-106
Berger, Peter L. / Luckmann, Thomas (2000): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirk-lichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. 17. Aufl., Frankfurt am Main: Fischer
Brackert, Helmut / Stückrath, Jörn (Hrsg.) (2000): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs. 6. Aufl., Reinbek: Rowohlt
Claxton, Guy (1997): Die Macht der Selbsttäuschung. München: Piper
Cohen, David (1997): Die geheime Sprache von Geist, Verstand und Bewusstsein. München: Hugendubel
Dennett, Daniel C. (1994): Ellenbogenfreiheit: Die erstrebenswerten Formen freien Willens. 2. Aufl., Weinheim: Beltz Athenäum
Dennett, Daniel C. (1994a): Philosophie des menschlichen Bewusstseins. Hamburg: Hoffmann und Campe
Dennett, Daniel C. (1999): Spielarten des Geistes. Wie erkennen wir die Welt? Ein neues Ver-ständnis des Bewusstseins. München: Bertelsmann
Derrida, Jacques (1986): Implikationen. In: Gespräche mit Henry Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdbine, Guy Scarpetta. Graz/Wien: Passagen, S. 33-82
Deutsche Forschungsgemeinschaft (1997) (Hrsg.): Perspektiven der Forschung und ihrer Förderung: Aufgaben und Finanzierung 1997-2001. Weinheim, New York, Chichester, Brisbane, Singapore, Toronto: Wiley-VCH
Esser, Hartmut (1999): Soziologie: allgemeine Grundlagen. 3. Aufl., Frankfurt am Main / New York: Campus
Faßler, Manfred (1997): Was ist Kommunikation? München: Fink
Fischer, Hans Rudi (Hrsg.) (1995): Die Wirklichkeit des Konstruktivismus: Zur Auseinander-setzung um ein neues Paradigma. Heidelberg: Carl Auer
Foerster, Heinz von (2000): Entdecken oder Erfinden. Wie lässt sich Verstehen verstehen? In: Gumin, Heinz / Meier, Heinrich (Hrsg.) (2000): a.a.O., S. 41-107
Fuchs, Peter (1993): Moderne Kommunikation. Zur Theorie des operativen Displacements. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Geißlinger, Hans (1995): Wissenschaft und Fiktion: Ein Heidelberger Experiment. In: Fischer, Hans Rudi (Hrsg.) (1995): a.a.O., S. 397-406.
Geldsetzer, Lutz (1989): Hermeneutik. In: Seiffert, Helmut / Radnitzky, Gerald (Hrsg.) (1989): a.a.O., S. 127-138
Gold, Peter / Engel, Andreas K. (1998): Wozu Kognitionswissenschaften? Eine Einleitung. In: Gold, Peter / Engel, Andreas K. (1998): a.a.O., S. 9-16
Gold, Peter / Engel, Andreas K. (1998) (Hrsg.): Der Mensch in der Perspektive der Kogni-tionswissenschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Gumin, Heinz / Meier, Heinrich (Hrsg.) (2000): Einführung in den Konstruktivismus. 5. Aufl., München: Piper
Haken, Hermann /Haken-Krell, Maria (1997): Gehirn und Verhalten: unser Kopf arbeit anders, als wir denken. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt
Hejl, Peter M. (1996): Konstruktion der sozialen Konstruktion. Grundlinien einer konstruk-tivistischen Sozialtheorie. In: Schmidt, Siegfried (Hrsg.) (1996): a.a.O., S. 303-339
Hoffman, Ursula (1998): Autopoiesis als verkörpertes Wissen. Eine Alternative zum Repräs-entationskonzept. In: Gold, Peter / Engel, Andreas K. (1998) (Hrsg.): a.a.O., S. 195-225
Jahraus, Oliver (Hrsg.) (2001): Niklas Luhmann – Aufsätze und Reden. Stuttgart: Reclam
Kneer, Armin / Nassehi, Georg (2000): Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Eine Ein-führung. 4. Aufl., München: Fink
Kneer, Armin / Saake, Irmhild (2000): Kontingenz: Methodisch verhindert oder beobachtet? Ein Beitrag zur Methodologie der qualitativen Sozialforschung. In: Zeitschrift für Sozio-logie, Jg. 31, Heft 1, S. 66-86
Knorr-Cetina, Karin (1997): Konstruktivismus in der Soziologie. In: Müller, Albert / Müller, Karl H. / Stadler, Friedrich (Hrsg.) (1997): a.a.O., S. 125-150
Köck, Wolfram K. (1993): Autopoiesis, Kognition und Kommunikation. Einige kritische Bemerkungen zur Humberto R. Maturanas Bio-Epistemologie und ihren Konsequenzen. In: Riegas, Volker / Vetter, Christian (Hrsg.) (1993): a.a.O., S. 159-188
Kromrey, Helmut (1994): Empirische Sozialforschung. Modelle und Methoden der Datener-hebung und Auswertung. 6. Aufl., Opladen: Leske + Budrich
Kutschera, Franz von (1982): Grundfragen der Erkenntnistheorie. Berlin/New York: de Gruyter
Kutschera, Franz von (1993): Die falsche Objektivität. Berlin/New York: de Gruyter
Laing, Ronald D. (1994): Das geteilte Selbst. Eine existentielle Studie über geistige Gesund-heit und Wahnsinn. Köln: Kiepenheuer & Witsch
Laszlo, Ervin (1998): Systemtheorie als Weltanschauung. Eine ganzheitliche Vision für unsere Zeit. München: Diederichs
Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Luhmann, Niklas (1990): Ökologische Kommunikation. Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen? 3. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag
Luhmann, Niklas (1991): Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme. 6. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag
Luhmann, Niklas (1992): Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Luhmann, Niklas (1993): Soziologische Aufklärung. Konstruktivistische Perspektiven. 2. Aufl., Opladen: Westdeutscher Verlag
Luhmann, Niklas (1996): Die Realität der Massenmedien. Opladen: Westdeutscher Verlag
Luhmann, Niklas (1999): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Band 1, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp
Luhmann, Niklas (1999a): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Band 2, 2. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp
Luhmann, Niklas (2001): Erkenntnis als Konstruktion. In: Jahraus, Oliver (Hrsg.) (2001): a.a.O., S. 218-242
Luhmann, Niklas (2001a): Was ist Kommunikation? In: Jahraus, Oliver (Hrsg.) (2001): a.a.O., S. 94-110
Luhmann, Niklas (2001b): Autopoiesis als soziologischer Begriff. In: Jahraus, Oliver (Hrsg.) (2001): a.a.O., S. 137-158
Luhmann, Niklas (2001c): Wie ist Bewusstsein an Kommunikation beteiligt? In: Jahraus, Oliver (Hrsg.) (2001): a.a.O., S. 111-136
Martienssen, Werner u.a. (1997): Nichtlineare Dynamik. In: Deutsche Forschungsgemein-schaft (1997) (Hrsg.): a.a.O., S. 241-261
Maturana, Humberto R. (1982): Erkennen: Die Organisation und Verkörperung von Wirk-lichkeit. Braunschweig/Wiesbaden: Vieweg
Maturana, Humberto R. / Valera, Francisco (1987): Der Baum der Erkenntnis. Die biolog-ischen Wurzeln des menschlichen Erkennens. München: Goldmann
Metzinger, Thomas (1998): Anthropologie und Kognitionswissenschaft. In: Gold, Peter / Engel, Andreas K. (1998) (Hrsg.): a.a.O., S. 326-372
Mohr, Georg / Willaschek, Marcus (Hrsg.) (1998): Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft. Berlin: Akademie
Mohr, Georg / Willaschek, Marcus (Hrsg.) (1998): Einleitung: Kants Kritik der reinen Ver-nunft. In: Mohr, Georg / Willaschek, Marcus (Hrsg.) (1998): a.a.O., S. 5-36
Morel, Julius u.a. (Hrsg.) (1997): Soziologische Theorie: Abriß der Ansätze ihrer Hauptver-treter. 5. Aufl., München/Wien: Oldenbourg
Most, Glenn W. (1982): Unsichtbare Fügung: Strukturalismus und Geschichtsdenken. In: Rudolph, Enno / Stöve, Eckehart (Hrsg.) (1982): a.a.O., S. 253-291
Musgrave, Alan (1989): Objektivismus. In: Seiffert, Helmut / Radnitzky, Gerald (Hrsg.) (1989): a.a.O., S. 234-236
Müller, Albert / Müller, Karl H. / Stadler, Friedrich (Hrsg.) (1997): Konstruktivismus und Kognitionswissenschaft. Kulturelle Wurzeln und Ergebnisse. Wien: Springer
Münch, Dieter (1998): Kognitivismus in anthropologischer Perspektive. In: Gold, Peter / Engel, Andreas K. (1998) (Hrsg.): a.a.O., S. 17-48
Nassehi, Armin (1997): Kommunikation verstehen. Einige Überlegungen zur empirischen Anwendbarkeit einer systemtheoretisch informierten Hermeneutik. In: Sutter, Tilmann (Hrsg.) (1997): a.a.O., S. 134-163
Popper, Karl R. / Eccles, John C. (1982): Das Ich und sein Gehirn. München: Piper
Prinz, Wolfgang / Strube, Gerhard (1997): Kognitionswissenschaften. In: Deutsche Forsch-ungsgemeinschaft (Hrsg.) (1997): a.a.O., S. 141-162
Reese-Schäfer, Walter (1999): Niklas Luhmann zur Einführung. 3. Aufl., Hamburg: Junius
Riegas, Volker / Vetter, Christian (Hrsg.) (1993): Zur Biologie der Kognition. 3. Aufl., Frank-furt am Main: Suhrkamp
Riegas, Volker / Vetter, Christian (1993): Gespräch mit Humberto R. Maturana. In: Riegas, Volker / Vetter, Christian (Hrsg.) (1993): a.a.O., S. 11-90
Roth, Gerhard (1992): Neuronale Grundlagen der Lernens und des Gedächtnisses. In: Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1992): a.a.O., S. 127-158
Roth, Gerhard (1992a): Die Konstitution von Bedeutung im Gehirn. In: Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1992): a.a.O., S. 360-370
Roth, Gerhard (1996): Erkenntnis und Realität: Das reale Gehirn und seine Wirklichkeit. In: Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1996): a.a.O., S. 229-255
Roth, Gerhard (1998): Das Gehirn und seine Wirklichkeit. Kognitive Neurobiologie und ihre philosophischen Konsequenzen. 2. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp
Rudolph, Enno / Stöve, Eckehart (Hrsg.) (1982): Geschichtsbewusstsein und Rationalität. Zum Problem der Geschichtlichkeit in der Theoriebildung. Stuttgart: Klett-Cotta
Rusch, Gebhard (1987): Erkenntnis, Wissenschaft, Geschichte: Von einem konstruktivistisch-en Standpunkt. Frankfurt am Main: Suhrkamp
Rusch, Gebhard (1997): Die Wirklichkeit der Geschichte – Dimensionen historiographischer Konstruktion. In: Müller, Albert / Müller, Karl H. / Stadler, Friedrich (Hrsg.) (1997): a.a.O., S. 151-171
Saussure, Ferdinand de (1967): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin: de Gruyter
Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1992): Gedächtnis: Probleme und Perspektiven der interdis-ziplinären Gedächtnisforschung. 2. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp
Schmidt, Siegfried J. (1994): Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivist-ische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition, Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1996): Der Diskurs des Radikalen Konstruktivismus. 7. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp
Schmidt, Siegfried J. (2000): Vom Text zum Literatursystem. Skizze einer konstruktivistischen (empirischen) Literaturwissenschaft. In: Gumin, Heinz / Meier, Heinrich (Hrsg.) (2000): a.a.O., S. 147-166
Schneider, Wolfgang Ludwig (1993): Die Beobachtung von Kommunikation. Zur kommu-nikativen Konstruktion sozialen Handelns. Opladen: Westdeutscher Verlag
Seiffert, Helmut / Radnitzky, Gerald (Hrsg.) (1989): Handlexikon zur Wissenschaftstheorie. München: Ehrenwirth
Sheldrake, Rupert (1998): Das Gedächtnis der Natur. Das Geheimnis der Entstehung der Formen in der Natur. Bern/München/Wien: Scherz
Spencer Brown, George (1997): Laws of Form – Gesetze der Form. Internationale Ausgabe, Übersetzung von Thomas Wolf. Lübeck: Bohmeier
Stachowiak, Herbert (1989): Neopragmatische Erkenntnistheorie. In: Seiffert, Helmut / Radnitzky, Gerald (Hrsg.) (1989): a.a.O., S. 64-68
Stadler, Michael / Kruse, Peter (1992): Visuelles Gedächtnis für Formen und das Problem der Bedeutungszuweisung in kognitiven Systemen. In: Schmidt, Siegfried J. (Hrsg.) (1992): a.a.O., S. 250-266
Stark, Carsten (1994): Autopoiesis und Integration. Eine kritische Einführung in die Luhmann-sche Systemtheorie. Hamburg: Kovač
Staubmann, Helmut (1997): Sozialsysteme als selbstreferentielle Systeme: Niklas Luhmann. In: Morel, Julius u.a. (Hrsg.) (1997): a.a.O., S. 218-239
Steinmetz, Horst (2000): Sinnfestlegung und Auslegungsvielfalt. In: Brackert, Helmut / Stück-rath, Jörn (Hrsg.) (2000): a.a.O., S. 475-490
Tilmann, Sutter (Hrsg.) (1997): Beobachtung verstehen, Verstehen beobachten. Perspektiven einer konstruktivistischen Hermeneutik. Opladen: Westdeutscher Verlag
Valera, Francisco (2000): Der kreative Zirkel. In: Watzlawick (Hrsg.) (2000a): a.a.O., S. 294-309
Valera, Francisco / Thompson, Evan (2000): Der Mittlere Weg der Erkenntnis. Die Beziehung zwischen Ich und Welt in der Kognitionswissenschaft. Bern/München/Wien: Scherz
Vester, Heinz-Günter (1993): Soziologie der Postmoderne. München: Quintessenz
Watzlawick, Paul (2000): Wie wirklich ist die Wirklichkeit? 26. Aufl., München: Piper
Watzlawick, Paul (Hrsg.) (2000a): Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus. 12. Aufl., München: Piper
Weber, Max (1972): Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. 5. Aufl., Tübingen: Mohr
Wenturis, Nikolaus (1992): Methodologie der Sozialwissenschaften. Eine Einführung. Tübin-gen: Francke
Zima, Peter V. (2000): Theorie des Subjekts: Subjektivität und Identität zwischen Moderne und Postmoderne. Tübingen, Basel: Francke
[...]
[1] Die subjektiven Befindlichkeiten des Forschers sollen dann im Erkenntnisprozess möglichst ausgeschaltet, zumindest aber methodisch kontrolliert und minimiert werden.
[2] Kneer/Nassehi 2000, S. 65.
[3] Aufgrund moderner Untersuchungsmethoden ist es heute möglich geworden, diese Illusion als Illusion zu beobachten und kann damit das Subjekt dann als soziales Artefakt, als Selbstbeschreibung gesellschaftlicher Kommunikation, rekonstruiert werden. Dazu mehr im Verlauf dieser Arbeit.
[4] Die allgemeine Systemtheorie stellt heute nicht mehr auf substantielle Ganzheiten, sondern auf die Organisationsinvarianz von Prozessen ab. Sie gebraucht dann Begriffe wie zirkuläre Kausalität, Emergenz, Systembildung, Evolution, Kontingenz, System-Umwelt-Differenz, Selektion und Variation, Komplexitätsreduktion, Prozessstrukturen usw.
[5] Mit dem systemtheoretischen Beobachterkonzept wird das Subjekt als Erkenntnis- und Handlungssubjekt außer Kraft gesetzt. Für Rationalisten ist diese Vorstellung eine Zumutung, denn die Sonderstellung des Menschen als Subjekt ist stets damit be-gründet worden, dass der Mensch als einziger über eine denkende Rationalität (und damit auch: über Handlungskompetenz) verfügt.
[6] Das Begründungsproblem ist auch insofern von Bedeutung, als aus allgemeingültigen (subjektübergreifenden) Erkenntnissen meist verbindliche Handlungsanweisungen abgeleitet werden, an die sich die Menschen dann zu halten haben.
[7] Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass kognitive Systeme strukturdeterminierte Systeme sind. Die in einem Beobachter-system entwickelten kognitiven Strukturen sind immer schon sozial angereichert, wenngleich das System diese Strukturen selbst ausbilden muss. Kognitive Strukturen besitzen also eine soziale Komponente, die jedoch nicht unmittelbar beobachtet werden kann und deshalb individuell zugerechnet werden muss.
[8] Die Tatsache, dass Homosexualität heute kaum noch gesellschaftliches Aufsehen erregt, deutet in einer komplexen und hoch-gradig ausdifferenzierten Gesellschaft eher auf ein funktionales Korrektiv hin als auf ein aufgeklärtes Bewusstsein.
[9] Meine Kritik richtet sich dann hier auf einen essentiellen, statischen, bedeutungsfixierenden, strukturalistischen Sinnbegriff.
[10] Kutschera 1993, S. VII. In diesem Sinne wird dann unter einer wissenschaftlichen Beobachtung der geschulte, professionelle Blick auf die Realität verstanden: »Empirische Wissenschaft soll nicht ›Glaubenssicherheit‹ vermitteln, sondern die Welt – so wie sie ist – beschreiben und erklären, soll die Augen für den kritischen Blick auf die Realität öffnen« (Kromrey 1994, S. 15). Eine solche Auffassung von Wissenschaft als privilegierte Erkenntnistätigkeit erklärt auch, weshalb ein mit dem Prädikat »wissenschaftlich« versehenes Wissen so viel mehr Anerkennung erzielt als etwa subjektives, mystisches oder religiöses Wissen. Der amerikanische Psychiater Ronald D. Laing bemerkt hierzu: »Es ist zum Beispiel interessant, dass man häufig ›lediglich‹ vor subjektiv antrifft, während es beinahe unvorstellbar ist, von jemandem als ›lediglich‹ objektiv zu sprechen« (Laing 1994, S. 29).
[11] Die Unterscheidung von Wissenschaft und Nichtwissenschaft ist auch insofern von Bedeutung, als heute die gesellschaftliche Entwicklung zu großen Teilen durch die Erkenntnisse aus der Wissenschaft vorangetrieben wird. So werden zum Beispiel in der Politik Entscheidungen getroffen, bei denen auf Expertenwissen aus der Wissenschaft zurückgegriffen wird. Schließlich eröffnet die Unterscheidung von wissenschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Wissen auch eine ethische Dimension, wenn es etwa darum geht, ob es für moralisches Denken und Handeln einen objektiven Maßstab geben kann.
[12] Wenn also nicht immer alle Menschen dieselben Beobachtungen machen, dann liegt das nach diesem Verständnis daran, dass ihnen die entsprechende Kompetenz fehlt. In diesem Zusammenhang wird dann auch darauf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Faktoren – psychologische wie soziökonomische – das Erkenntnispotential des Menschen behindern oder unterdrücken und dies dann möglicherweise einen »unterbelichteten« bzw. »verzerrten« Blick auf die Realität zur Folge hat. Es wird also ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass die Realität etwas ist, das sich auf irgendeine Weise erkennend fixieren lässt.
[13] Die Suche nach der absoluten Wahrheit ist heute kein Erkenntnisideal mehr, das in der Wissenschaft noch ernsthaft angestrebt wird. Während das ältere Wissenschaftsverständnis von »klaren Einsichten« ausging und man Wahrheiten vor allem positiv begründet wissen wollte, wird heute vom umgekehrten Fall ausgegangen: jede Erkenntnis wird als hypothetisch und vorläufig betrachtet, solange bis sie durch neuere Erkenntnisse falsifiziert worden ist. Entsprechend wird die Funktion von Wissenschaft heute nicht mehr darin gesehen, Wahrheiten über die Welt zu verkünden (vgl. Wenturis 1992, S. 86 ff.).
[14] Die Ontologie versucht, das Weltsein zu bestimmen: ein ontologischer Realismus glaubt an Realobjekte in der Außenwelt, ein ontologischer Idealismus an geistige Ideen, die den materiellen Erscheinungen zugrunde liegen. Die Erkenntnistheorie ver-sucht dann zu klären, wie auf dieses Weltsein erkennend Bezug genommen werden kann.
[15] Für einen Realisten ist also die runde Gestalt einer Kugel objektiv gegeben, stellt also einen Weltsachverhalt dar – auch dann, wenn dieses Rundsein von niemanden beobachtet wird. Wenn jemand also eine Kugel in Gestalt eines Würfels wahrnimmt, dann nur als Täuschung oder aufgrund eines Mangels an geistiger Gesundheit (dieses Realitätsverständnis liegt schließlich auch der Drogen- und Gesundheitspolitik zugrunde, die ganz selbstverständlich in »richtig« und »falsch« wahrgenommener Realität unterscheidet und den betroffenen Personen dann ein »Realitätsverlust« attestiert – so als wüsste man, wie die reale Realität tatsächlich beschaffen ist). Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen: es soll hier nicht bestritten werden, dass es Unterschiede in der Realitätswahrnehmung gibt, etwa bei einem LSD-Konsumenten oder einer psychotisch veranlagten Person. Bestritten werden soll jedoch, dass sich diese Unterschiede primär psychologisch-physischen Faktoren verdanken, und dass es eine privilegierte Position gibt, von der aus über die »eigentliche« Realität entschieden werden kann. Denn dass jemand an Realitätsverlust leidet, wird von einem Beobachter gesagt. Damit ist aber noch nicht entschieden, ob dies nicht auch für den Beobachter selbst zutrifft – und wie könnte man sicher sein? Die Gültigkeit der Erkenntnis lässt sich nicht auf ein »richtig« funktionierendes Wahrnehmungssystem oder auf bestimmte Essgewohnheiten zurückführen, sondern ist vor allem in der Sozialdimension zu suchen. Damit wird die Frage nach der Quelle der Erkenntnis zu einer Frage nach ihrer sozialen Geltung, letztlich zu einem Problem der Besetzung der kommunikativen Infrastruktur (mehr dazu im Verlauf dieser Arbeit, besonders im vierten und fünften Kapitel).
[16] Die Unterscheidung in objektive und subjektive Wahrnehmungsqualitäten liest sich dann so: »Primäre Qualitäten wie Form, Härte und Gewicht, sind solche, die den Dingen selbst zukommen und ihre objektive Beschaffenheit charakterisieren. Sekun-däre Qualitäten, wie Farbe oder Geschmack, sind hingegen solche, die sie aufgrund ihrer Wechselwirkung mit unserem Wahrnehmungsapparat für uns zu haben scheinen« (Kutschera 1993, S. 123). Entsprechend dieser Auffassung werden die Objekte im Erkenntnisprozess mit Eigenschaften versehen, die nur zum Teil ihnen selbst zukommen. Deshalb müsse man zwischen außenweltlich realen Attributen und Sachverhalten und innerlich phänomenalen Attributen und Sachverhalten des Erkennens unterscheiden. Kurz: im Realismus wird zwischen objektiven Inhalten der Erkenntnisobjekte und subjektiven In-halten der Erkenntnissubjekte unterschieden (siehe dazu ausführlich: Kutschera 1982, S. 189 ff., Kutschera 1993, S. 121 ff.).
[17] Die Korrespondenztheorie der Wahrheit geht von einer ontologischen Zweiwertigkeit aus: entweder etwas ist, oder etwas ist nicht. Dass eine solche Position nicht haltbar ist, soll im weiteren Verlauf dieser Arbeit deutlich werden.
[18] Wenn also jemand über einen bestimmten Begriff verfügt und dieser Begriff einen erkenntnistheoretischen Gehalt haben soll, dann muss er nach dieser Auffassung notwendig aus der Erfahrung abgeleitet sein, also auf einen realen Sachverhalt außer-halb des Bewusstseins zeigen. Begriffe haben im Realismus also nur dann eine erkenntnistheoretische Bedeutung, wenn sie in der Realität auch eine Entsprechung haben. Zwar ist es dann immer noch möglich, den Begriff »runder Würfel« einzuführen, doch hat dieser Begriff dann eben keine erkenntnistheoretische Bedeutung, da ihm jeglicher Bezug zur Realität abgesprochen wird. Die korrespondierende Beziehung zwischen Realobjekt und zugeordnetem Begriff wird auch Begriffsrealismus genannt. Man glaubt dann an eine Übereinstimmung von realem Objekt und erkanntem Objekt bzw. von Realität und Sprechen über die Realität.
[19] In der Literatur ist anstelle von »Vorstellungen« auch von »Ideen«, »Sinneseindrücken«, »Phänomenen«, »Erscheinungen« oder »Begriffen« die Rede. Der zentrale Gedanke hierbei ist, dass die Gegenstände der Erkenntnis stets dem Bewusstsein zu-gehörig sind, so dass Wirklichkeit und Wissen über die Wirklichkeit nicht losgelöst von einem erkennenden Subjekt gedacht werden können. Die sich dem Subjekt zeigende Wirklichkeit ist damit davon abhängig, wie sich das Subjekt die Wirklichkeit begrifflich vorstellt.
[20] Da also alle Gegenstände und Eigenschaften dieser Welt an einer objektiven Idee teilhaben, wird diese Form des Idealismus auch objektiver Idealismus genannt.
[21] Nach Platon haben die Begriffe zwar auch einen Bezug zu den materiellen Dingen dieser Welt, im Idealfall aber verweisen sie auf eine dahinterliegende Idee. Die höchste Form von Erkenntnis sieht Platon dann realisiert, wenn ein sprachlicher Ausdruck das Wesen einer Sache bezeichnet, indem er die zugrundeliegende Idee repräsentiert. Eine moderne Form des platonischen Denkens ist die Physik und die von ihr »entdeckten« Naturgesetze (zur Kritik an dieser Vorstellung siehe: Sheldrake 1998).
[22] Die Metaphysik versteht sich als Lehre vom Seienden, vom höchsten Wesen der Dinge. Sie sucht deshalb nach einem ersten Prinzip, aus dem sich alles andere in der Welt ableiten lässt: »Im Unterschied zu den Einzelwissenschaften, deren Gesetze und Theorien sich nur auf Teile der Wirklichkeit beziehen, soll die Metaphysik zu den allgemeinsten und höchsten Gesetzen der Wirklichkeit vordringen, die auf alle Bereiche der Wirklichkeit gleichermaßen Anwendung finden« (Wenturis 1992, S. 95). Nach Kant besteht die Aufgabe der Wissenschaft darin, gesicherte und allgemeingültige Erkenntnisse zu liefern, anstatt sich auf die bloße Sinneserfahrung zu verlassen oder wild mit dem Verstand herumzuspekulieren.
[23] Kant unterscheidet empirische (aposteriorische) und analytische (apriorische) Erkenntnis. Empirisches Wissen wird aus der Erfahrung gewonnen und bringt etwas nichtgewusstes an den Tag, etwa wenn die Masse eines Körpers bestimmt wird. Nach Kant verfügt der Mensch aber auch über ein implizites Wissen, dessen Wahrheit unabhängig von jeder Erfahrung gilt (so ist nach Kant der Satz »Entweder ist die Kugel rund, oder sie ist keine Kugel« notwendig wahr, denn im Begriff der Kugel ist das Rundsein immer schon mit eingeschlossen). Ein solches Wissen wird von Kant analytisch genannt, denn es behandelt die darin vorkommenden Begriffe rein logisch, ohne dabei schon auf Erfahrungen zurückzugreifen. Die entscheidende Frage für Kant ist nun, ob der Mensch auch über ein empirisches Wissen a priori verfügt, über ein Wissen also, an dem die Erfahrung zwar notwendigerweise beteiligt ist, dessen Gültigkeit aber durch die im Subjekt angelegten apriorischen Erkenntnisbeding-ungen sichergestellt wird. Letztlich geht es Kant um die Frage, ob es ein Erkennen gibt, das zwar mit der Erfahrung ansetzt, dessen Gültigkeit aber unabhängig von dieser besteht.
[24] Um sich von dem Gedanken zu befreien, allein der Verstand könne die Erkenntnis bewerkstelligen, gibt Kant seinem Werk den Titel »Kritik der reinen Vernunft«. Nach Kant führt der alleinige Gebrauch der Vernunft, ohne Rückgriff auf Erfahrung, zu keinem inhaltlichem Wissen über die Welt. Zwar könnten rein logische Überlegungen eine formale Widerspruchsfreiheit garantieren, jedoch keine inhaltliche Richtigkeit: »Die Gefahr ist deshalb groß, dass die Spekulationen der reinen Vernunft sich verselbständigen: Auf dem scheinbar sicheren Weg logischen Schließens gelangen wir zu metaphysischen Thesen, die wir für wahr halten, obwohl die verfügbaren Mittel für ihre Begründung nicht ausreichen« (Mohr/Willaschek 1998, S. 14 f.).
[25] Abbild- oder Repräsentationstheorien gehen von der Annahme aus, dass die Gegenstände der Außenwelt im Subjekt eine zeichenhafte Repräsentation erhalten, so dass »die Zeichen ein Modell der Wirklichkeit bilden und dass daher die Gesetzmäß-igkeiten der Außenwelt sich in gesetzmäßigen Zusammenhängen der Zeichen widerspiegeln« (Kutschera 1982, S. 201).
[26] Zu diesem Schluss sind einige Philosophen tatsächlich gekommen. Wenn dem Subjekt bewusstseinsmäßig nur Ideen oder Vorstellungen von den Dingen gegeben sind, dann kann man – wenn man nicht bereits eine Zuordnung zwischen diesen Vor-stellungen und entsprechenden Originalen voraussetzen will – auch nichts über die Existenz von irgendwelchen Originalen aussagen. Es kann nicht einmal angenommen werden, dass es so etwas wie die Außenwelt überhaupt gibt. Die Konsequenz ist dann die totale Skepsis im Hinblick auf die Erkennbarkeit und Existenz der außenweltlichen Realität (vgl. Kutschera 1982, S. 213 ff.). Ein erkenntnistheoretischer Idealismus mündet also – sofern keine weiteren Sperren eingebaut werden – in einen Solipsismus, demnach alles nur Produkt meiner eigenen Vorstellung ist. Oder aber man versucht, eine konsistente Theorie zu formulieren, in der das Problem der Intersubjektivität gelöst wird. So nimmt Berkeley an, dass sich die Vorstellungen der Menschen deshalb gleichen, weil sie von Gott eingespeist werden. Kant hingegen begründet die Intersubjektivität mit einem transzendentalen Argument. Er stimmt dann mit Berkeley darin überein, dass man von den gedanklichen Vorstellungen nicht auf Entsprechungen in der Realität schließen kann, kommt jedoch zu einem anderen Ergebnis. Denn während Berkeley für einen ontologischen Idealismus optiert, glaubt Kant weiterhin an die Existenz einer realen Außenwelt. Er muss dann aber die Ähnlichkeit der Vorstellungen mit einer apriorisch gegebenen Strukturgleichheit des Verstandes erklären.
[27] Kant nennt dieses Vorgehen, bei dem das Erkennen sich selbst zum Gegenstand hat, Transzendentalphilosophie (der Begriff »transzendental« ist vom Begriff »transzendent« zu unterscheiden: ersterer meint die Erkenntnis ermöglichend, letzterer die Erkenntnis überschreitend). Kant geht es in seinen Untersuchungen nicht um die empirischen Bedingungen des Erkennens, etwa um das Vorhandensein eines Nervensystems oder anderer physiologischer Voraussetzungen, sondern um die transzen-dentalen Bedingungen des Erkennens. Darunter versteht er jene denknotwendigen Prinzipien, die aller Erfahrung vorausgehen und diese erst möglich machen. Die Transzendentalphilosophie fragt also nicht nach dem ontologischen Was der Erkenntnis, sondern nach dem funktionellen Wie des Erkennens. Kant will die formallogische Struktur des menschlichen Erkenntnisver-mögens herausarbeiten, die gewissermaßen als »Hintergrundstruktur« des Denkens die Einheit der Erkenntnis sicherstellen und auf diese Weise Objektivität garantieren soll. Da nach Kant alle Menschen die gleichen formalen Voraussetzungen in sich tragen, sei deshalb allgemeingültiges Wissen möglich. Wie jedoch zu zeigen sein wird, sind diese Bedingungen keinesfalls transzendental, wie es Kant angenommen hatte, sondern nur wieder empirisch. Luhmanns Kritik zielt dann auch auf diese transzendentale Begründungsfigur ab: er problematisiert die Unterscheidung von transzendental und empirisch, indem er die Transzendentalphilosophie daraufhin befragt, »ob die Unterscheidung von transzendental und empirisch selbst transzendental ist oder empirisch, was in beiden Fällen in eine Paradoxie führt« (Luhmann 2001b, S. 139). Das Erkenntnisvermögen des Menschen ist für Luhmann, anders als bei Kant, nicht anthropologisch und universell vorgegeben, sondern sozial bedingt und historisch veränderbar. Während sich Kant – wenngleich kritisch gegenüber der Tradition eingestellt, so doch diese auch fortsetzend – auf die Suche nach einer letzten, alles garantierenden Einheit im Subjekt begibt, löst sich Luhmann radikal von der Vorstellung, wissenschaftliche Objektivität könne durch Rekurs auf Ontologie oder, wie bei Kant, durch ein transzenden-tales Konstruktionsdesign garantiert werden. Luhmann – evolutionstheoretisch orientiert – begreift stattdessen Erkenntnis als emergentes Produkt sozialer Systeme (dazu mehr im fünften Kapitel).
[28] Zu diesen transzendentalen Bedingungen zählt Kant die raumzeitliche Anschauungsform sowie das kategoriale Schema von Kausalität, Substanz, Qualität, Quantität u.a. Die transzendentale Struktur bestimmt also und übt sozusagen eine Herrschaft darüber aus, wie dem Bewusstsein die Gegenstände phänomenal erscheinen. Dementsprechend dürfte sich das Erkennen nicht außerhalb dieser vorgegebenen Struktur vollziehen. Jedoch hat inzwischen die Quantenphysik Beobachtungen gemacht, die sich mit den herkömmlichen Begriffen von Raum, Zeit und Kausalität nicht erklären lassen. Ebenso hat die Entdeckung einer nichteuklidischen Geometrie dazu beigetragen, dass transzendentale Begründungsaprioris heute kaum noch ernsthaft vertreten werden. Die Hintergrundstruktur des Denkens, von der Kant annahm, dass sie fest im Subjekt verankert ist, hat nämlich vor allem eine soziale Komponente: sie wird durch die Installation sprachlicher Unterscheidungen ko-produziert und ist damit kontingent.
[29] Auf die einzelnen wissenschaftstheoretischen Positionen und ihre Nuancierungen kann hier nicht näher eingegangen werden. Mir geht es vor allem darum, die Grundannahmen der realistischen Erkenntnistheorie herauszuarbeiten und sie in das Subjekt-Objekt-Schema einzuordnen.
[30] Kutschera 1982, S. 410 f.
[31] Prinz/Strube 1997, S. 141. Innerhalb der Kognitionswissenschaften werden dann zwei große Teilverbände ausgemacht: zu den kognitiven Neurowissenschaften zählen Forschungen aus der Neurobiologie, Psychologie und Neurolinguistik, zu den algorithmisch orientierten Kognitionswissenschaften zählen Forschungen aus der Informatik (künstliche Intelligenzforschung, Robotik), der theoretischen Linguistik und der kognitiven Psychologie. Die Rahmenbedingungen lassen in Deutschland aller-dings zu wünschen übrig: die Kognitionswissenschaften sind von einer viel zu starken Disziplinarität geprägt, und zwischen den beiden genannten Teilverbänden herrscht eine geringe Kommunikationsdichte. Im internationalen wie im europäischen Vergleich bestehe großer Nachholbedarf vor allem in der Institutionalisierung der Kognitionswissenschaft als eigenständige Forschungsdisziplin, denn die Strukturen deutscher Universitäten würden eine inter- und multidisziplinäre Kooperation eher behindern als begünstigen (so vor allem die Promotionsordnungen mit ihrer stark disziplinären Ausrichtung, die verhindern, dass disziplinübergreifende Arbeiten angemessen gefördert und begutachtet werden können). Unter diesen Bedingungen wird kaum erwartet, dass Universitäten aus eigener Kraft effektive kognitionswissenschaftliche Forschungsverbände entwickeln und das Fach Kognitionswissenschaft als Interdisziplin realisieren werden (vgl. Prinz/Strube 1997).
[32] Die Überlegung dabei ist folgende: Ein Stein, der in der Sonne liegt, bedarf keiner kognitiven Erklärung, denn er hat nicht die Absicht, dies zu tun. Wenn dieser Stein dann aber von jemanden aufgehoben und beiseite gelegt wird, dann muss dafür eine kognitive Erklärung gefunden werden, denn diesem Verhalten liegt eine Absicht, ein subjektiver Willensakt, zugrunde. Weil kognitive Prozesse stets auf ein Objekt – Ziele, Absichten Wünsche – gerichtet sind, versteht sich die Kognitionswissenschaft deshalb auch als »Wissenschaft vom Intentionalen« (vgl. Münch 1998).
[33] Die Frage, wie das Wissen vom Menschen die eigene Lebensführung und das Verhalten gegenüber anderen Menschen verän-dern könnte, ist inzwischen als eine der wichtigsten Fragen der Gegenwart erkannt worden (vgl. Münch 1998, S. 45). Dieses Wissen ist also auch für die Soziologie von Bedeutung, und dies nicht nur im Hinblick auf das Subjekt als Erkenntnisquelle, sondern auch und insbesondere für den Forscher und seine methodologische Orientierung. Eben aus diesem Grund habe ich einen kognitionswissenschaftlichen Ansatz für meine Arbeit gewählt, da sich erkenntnistheoretische, gesellschaftstheoretische und methodologische Fragestellungen nicht voneinander trennen lassen.
[34] Engel/König 1998, S. 159. Nach diesem Modell führt ein Objekt zu einer sensorischen Erregung der entsprechenden Farb- Form- und Gestaltrezeptoren, und diese Informationen werden dann aufwärts gerichtet (»bottom up«) verarbeitet, so dass am Ende der Hierarchie das entsprechende Symbol aktiviert wird. Dabei wird angenommen, dass es für jedes wahrgenommene Objekt eine Repräsentationszelle gibt: »So wurde schließlich eine Zelle postuliert, die genau dann feuerte, wenn die eigene Großmutter ins Gesichtsfeld trat; scherzhaft wurden daher solche Zellen ›Großmutterzellen‹ genannt« (Roth 1998, S. 155).
[35] Engel/König 1998, S. 156.
[36] Wenn für die Repräsentation kognitiver Inhalte im Kognitivismus einzelne Neuronen angenommen wurden, so sind es im Konnektionismus global verteilte Aktivitäten: »Für Konnektivisten bedeutet Repräsentation, dass ein in Erscheinung tretender (emergenter) globaler Zustand bestimmten Eigenschaften der Welt entspricht; Repräsentation ist hier also keine Funktion spezieller Symbole« (Thompson/Valera 1992, S. 26).
[37] Eine genetische Fixierung der neuronalen Verschaltungen war im Kognitivismus noch eine notwendige Annahme gewesen, denn man konnte sich eine symbolische Repräsentation nicht vorstellen, ohne nicht dabei eine im System fest implementierte Netzwerkarchitektur vorauszusetzen. Hingegen ist im Konnektionismus die neuronale Struktur nicht von vornherein vorbe-stimmt, »sondern sehr plastisch und selbst im Erwachsenenalter noch veränderbar, wenn auch in bestimmten, systemabhängig sehr unterschiedlichen Grenzen« (Roth 1998, S. 193).
[38] Um diese Dynamik besser erfassen zu können, wird hierbei auf Begriffe und Konzepte aus der Theorie nichtlinearer Systeme zurückgegriffen. Die Rede ist dann von Phasenräumen, Attraktoren, chaotischen Transienten, nichtstationären Systemen oder selbstorganisierter Kritizität.
[39] Das klassische Verständnis von Intelligenz – Denken, Rationalität, Zielverfolgung – wird heute nur noch als eine Form von Kognition aufgefasst. Die heutige Psychologie kennt darüber hinaus auch Formen sozialer oder emotionaler Intelligenz.
[40] Engel/König 1998, S. 174.
[41] Nichtlineare Prozesse sind überall auf der Welt zu finden: »Pendelbewegungen, Strömungsvorgänge, Klimaentwicklungen, fraktales Wachstum und Hirnfunktionen erscheinen plötzlich als Phänomene, die Gemeinsamkeiten aufweisen und die in ihrer Dynamik von den gleichen universellen Prinzipien bestimmt werden« (Martienssen u.a. 1997, S. 242). Die Theorie der nichtlinearen Dynamik versucht dann, für diese Phänomene ein einheitliches Beschreibungsmodell zu entwickeln. So können dann die Konzepte und Begriffe auf physiologische Prozesse ebenso angewandt werden wie auf soziale Prozesse: Gehirn und Gesellschaft sind anzusehen als nichtstationäre Systeme, die sich in einer permanenten Einschwingphase befinden, in deren Verlauf dann zwar vorübergehend stabile Eigenwerte entstehen, diese Prozesse aber auf keinen identifizierbaren Endpunkt zulaufen (in der Systemtheorie Luhmanns kommt dies darin zum Ausdruck, dass sich Gesellschaft und Bewusstsein in einem anhaltenden Prozess der Ko-Evolution befinden). Die Tatsache, dass es einen theoretisch beschreibbaren Zusammenhang gibt zwischen der Organisationsweise in neuronalen Netzen und der in sozialen Systemen, ist ebenfalls ein Grund dafür gewesen, in dieser Arbeit auf die Ergebnisse der Kognitionswissenschaften zurückzugreifen.
[42] Inzwischen verlagert sich die philosophische Diskussion von apriorischen Repräsentationen, die eine nichtkontingente Grund-lage für unsere Welterkenntnis bilden sollen, auf aposteriorische Repräsentationen, deren Inhalte sich letzten Endes von kausalen Wechselwirkungen mit der Umwelt herleiten. Eine derart naturalisierte Auffassung der Erkenntnis provoziert nicht mehr jene skeptischen Fragen, die noch der traditionellen Erkenntnistheorie zugrunde lagen. Dennoch lebt auch in der zeitge-nössischen Kognitionswissenschaft ein entscheidender Gedanke fort: die Vorstellung einer Welt mit äußeren, vorgegeben Eigenschaften, die durch Repräsentationen rekonstruiert werden (vgl. Thompson/Valera 1992, S. 192 f.).
[43] Engel/König 1998, S. 172 f.
[44] Vgl. Engel/König 1998, S. 185 ff. Der systemtheoretische Ansatz sieht in sprachlichen Beschreibungen keine Korrespondenz von vorfindlicher und beschriebener Realität. Werden also zu einem bestimmten Thema zwei Studien in Auftrag gegeben und fallen diese dann im Ergebnis unterschiedlich aus – in der einen wird etwa das Gegenteil der anderen behauptet –, dann liegt hier kein Beobachtungsfehler vor. Das Beobachtungsobjekt ist nicht bereits ontologisch präexistent, sondern wird erst durch die Beobachtung (durch das methodische Arrangement von begrifflichen Unterscheidungen) zu einem solchen gemacht. Die methodologischen Konsequenzen für die empirische Sozialforschung sind also von außerordentlicher Tragweite, wenn man nicht mehr davon ausgehen kann, mit Beobachtungsmethoden eine objektiv gegebene Realität empirisch abtasten zu können.
[45] Maturana 1982, S. 72.
[46] Valera 2000, S. 297.
[47] Maturana/Valera 1987, S. 113. So erfährt beispielsweise eine im Wasser lebende Qualle Strukturveränderungen, die mit den strukturellen Veränderungen ihres Milieus (des Wassers) übereinstimmen, der Organismus ist also angepasst. Wird die Qualle dann in ein anderes Milieu (auf trockenen Sand) gesetzt, kommt es zu destruktiven Strukturveränderungen, die ihre operative Autonomie gefährden und schließlich zerstören – in diesem Fall wäre die Autopoiesis beendet. Der Begriff der strukturellen Kopplung impliziert also ein vollkommen anderes Passungsverhältnis von Organismus (System) und Milieu (Umwelt), als es etwa in der Evolutionären Erkenntnistheorie angenommen wird.
[48] Maturana/Valera 1987, S. 112 f.
[49] Vgl. Roth 1998, S. 344. ff. Jedoch sprechen gegen diese einseitige Form der Anpassung mehrere Gründe. So weiß man heute, dass sich viele Organismen innerhalb vieler Millionen Jahre oder sogar Hunderten von Millionen Jahren nicht wesentlich ver-ändert haben, obwohl ihre Umwelt sich änderte, und dass andere sich wiederum zum Teil sehr stark verändert haben, obwohl dies bei der Umwelt nicht der Fall war. Und offenbar haben viele Organismen nur deshalb überlebt, weil sie nicht zu eng an ihre Umwelt angepasst waren, wie auch umgekehrt: viele Organismen sind ausgestorben, weil sie (retrospektiv) zu eng an ihre Umwelt angepasst waren (vgl. Roth 1998, S. 346 f.).
[50] Hoffmann 1998, S. 205. Zum Evolutionsbegriff schreibt Maturana: »Was in der Evolution bewahrt wird, ist also das Überein-stimmungsverhältnis mit dem Medium. Denn das Medium und der Organismus gehören zusammen, sie entwickeln sich mit-einander ›verschränkt‹« (Maturana in Riegas/Vetter 1993, S. 17).
[51] Hejl 2000, S. 120. Zu Beispielen, die auf dramatische Weise vor Augen führen, was es bedeutet, wenn ein Organismus über viable Strukturen verfügt, siehe: Maturana/Valera 1987, S. 137 ff.
[52] Siehe hierzu mit detaillierten Beispielen: Maturana/Valera 1987, S. 155 ff.
[53] Komplexität meint die Anzahl der möglichen Verknüpfungen zwischen sensorischen und motorischen Neuronen, Plastizität ist das Maß für die Veränderungsmöglichkeit (Flexibilität) der strukturellen Organisation des Nervensystems (speziell zum Nervensystem siehe: Maturana 1982, S. 35 ff., S. 142 ff., S. 282 ff.).
[54] Verhalten ist also nicht unbedingt an das Vorhandensein eines Nervensystems gekoppelt (auch eine Amöbe »verhält« sich), wird aber dadurch in seinen Möglichkeiten erweitet. So besitzt das menschliche Gehirn etwa Hundertmilliarden Nervenzellen, die etwa zehn Millionen sensorische und eine Million motorische Zellen in einem Verhältnis von 10:100000:1 miteinander verknüpfen, wodurch dann wiederum einige Tausend Muskeln aktiviert werden. Obwohl der menschliche Organismus nicht grundsätzlich anders operiert als einfachere Lebewesen, potenziert sich die Anzahl der Kombination möglicher Interaktionen durch das Zwischenschalten eines komplexen Nervensystems ins Unüberschaubare und wird dadurch der Verhaltensbereich dramatisch erweitet (vgl. Maturana/Valera 1987, S. 175). Wie die Autoren allerdings betonen, kommt dem Gehirn zwar eine besondere Rolle im Kognitionsprozess zu, doch ist es stets der gesamte Organismus als ein einziges operierendes System, das kognitiv wirksam ist. Die Autoren formulieren deshalb als Aphorismus: »Leben ist Erkennen« (Maturana/Valera 1987, S. 191).
[55] Entsprechend wird ein Beobachter Unterschiede im Verhaltens feststellen können. Während das Verhalten bei einfachen Organismen mit ziemlicher Genauigkeit vorhergesagt werden kann – der Beobachter hat Einblick in den Zusammenhang von Sensorik und Motorik –, ist dies bei komplexen Systemen nicht der Fall. Der Beobachter kann nicht sagen, wie das System auf einen sensorischen Stimulus reagieren wird, da er den internen Zustand des Systems nicht kennt. Es ist wichtig, dass für Maturana Verhalten vor allem eine Beobachterkategorie ist: Verhalten ist die äußere Sicht eines Beobachters auf die Zu-standsänderung des beobachteten Systems. Ein Beobachter fertigt allerdings eine semantische Beschreibung an, wenn er das Verhalten des beobachteten Systems so beschreibt, »als würde die Bedeutung, die er den Interaktionen zuschreibt, den Ver-lauf dieser Interaktion bestimmen« (Maturana/Valera 1987, S. 224). Die Autoren unterscheiden also sorgfältig zwischen dem faktisch ablaufenden Operieren eines Systems und der semantischen Beschreibung, mit der das Operieren in intentionalen Begriffen beschrieben wird.
[56] Vgl. Roth 1998 und Foerster 2000. Während Roth die neuronale Einheitssprache des Gehirns auch als »Neutralität des neuro-nalen Codes« bezeichnet, spricht Foerster vom »Prinzip der undifferenzierten Codierung«.
[57] Roth 1992a, S. 362.
[58] Der Begriff »Maschine« meint hierbei keine Maschine im herkömmlichen Sinne, sondern ein Verfahren, mit dem sich die funktionale Beziehung zwischen Input und Output darstellen lässt. Der Input steht dabei für die Ursache oder ein Ereignis, der Output für die hervorgebrachte Wirkung oder das Verhalten.
[59] Kant hatte dann transzendentale Bedingungen des Erkennens angenommen, um sicherzustellen, dass die Erkenntnis sich nicht selbst blockiert. Denn was eine transzendentale Voraussetzung für die Erkenntnis ist, braucht schließlich durch die Erkenntnis nicht begründet werden.
[60] Valera/Thompson 1992, S. 196.
[61] Wie Roth (1996, S. 238) zu verstehen gibt, ist die Realität »da draußen« lediglich ein »kognitives« draußen, das nicht mit dem »draußen« der realen Welt verwechselt werden darf.
[62] In der Sprache der Mathematik formuliert: die Menge A wird auf die Menge A’ eindeutig abgebildet, dieser Zusammenhang wird dann Funktion genannt (man erinnere sich, dass eine Funktion im Sinne Heinz von Foersters eine triviale Maschine dar-stellt: sie ist eine Zuordnungsvorschrift, die einem Input eindeutig einen Output zuordnet).
[63] Maturana 1982, S. 285 f.
[64] Es verhält sich dabei so, dass unter den gerade herrschenden Lichtverhältnissen die jeweils kürzeste Lichtwellenlänge als »blau-violett« und die jeweils längste als »rot« empfunden wird, und zwar unabhängig davon, ob die gerade vorliegende kürz-este Wellenlänge tatsächlich bei 400 nm liegt und die längste bei 700 nm. Dieser Sachverhalt äußert sich in der Fähigkeit, an Objekten eine bestimmte Farbe auch dann als konstant wahrzunehmen, wenn das Wellenlängenspektrum des reflektierten Lichtes Schwankungen ausgesetzt ist (vgl. Roth 1998, S. 120). Wie leicht einzusehen ist, kann dieser Korrekturmechanismus des Gehirns mit dem kognitivistischen Modell einer »aufwärtsgerichteten Informationsverarbeitung« nicht erklärt werden.
[65] Hoffmann 1998, S. 199.
[66] Maturana 1982, S. 75 f. Dies muss freilich dann auch auf die Theorie selbst zutreffen: Maturana macht nichts anderes, als dass er mit Hilfe von Begriffen die Autopoiesis lebender Systeme beschreibt, die ihrerseits mit sprachlichen Beschreibungen eine komplexe Theorie zu erzeugen in der Lage sind, mit der dann wiederum beschrieben werden kann, wie lebende Systeme zu Beschreibungen fähig sind. Indem also die Theorie autopoietischer Systeme auf eine operative Begrifflichkeit umstellt, kann diese Theorie ihr eigenes Zustandekommen erklären.
[67] Maturana 1982, S. 76.
[68] Cohen 1997, S. 50.
[69] Dazu zählt dann auch und ganz besonders das Hineinwachsen in eine sprachlich vorstrukturierte, soziale Welt.
[70] Roth 1998, S. 343. An anderer Stelle verweist Roth auf ein Experiment, mit dem das erfahrungsabhängige räumliche Vorstell-ungsvermögen demonstriert werden soll. Bei diesem Experiment bekommen die Versuchspersonen eine »invertierte Brille« aufgesetzt, durch die sie die Welt plötzlich seitenverkehrt sehen. Nach einer gewissen Einübungszeit werden die motorischen mit den (nunmehr invertierten) sensorischen Aktivitäten vom Gehirn in Einklang gebracht, und es kommt dabei dann zu einer selbstreferentiellen Reorganisation der Wahrnehmungswelt, so dass die Versuchspersonen schließlich ihre Umgebung wieder auf die gewohnte Art und Weise wahrnehmen. Der gleiche Vorgang wiederholt sich dann in umgekehrter Richtung, wenn die Brille wieder abgenommen wird (vgl. Roth 1996, S. 244). Und wie Heinz von Foerster zeigt, ist das Gehirn sogar in der Lage, durch entsprechende sensomotorische Operationen eine vierdimensionale Erfahrungswelt zu erzeugen, die sich als »Eigen-wert« aus den Interaktionen des operierenden Systems ergibt. Die dreidimensionale Vorstellungswelt ist also dem Menschen weder objektiv (»realistisch«) vorgegeben noch genügt sie transzendentalen Bedingungen der Erfahrbarkeit. Sie wird viel-mehr erlernt und kann dann je nach Erzeugung, Aufrechterhaltung und Reproduktion der sensomotorischen Korrelationen wieder verändert werden. So wurde in einem Experiment ein vierdimensionaler Würfel konstruiert, der als solcher zwar von den Versuchspersonen intellektuell verstanden wurde, aber niemand von ihnen zuvor eine Erfahrung damit hatte. Dies änderte sich in dem Augenblick, als die Versuchspersonen begannen, über einen komplexen Mechanismus mit diesem Würfel zu hantieren. Im Verlauf dieser Interaktion wurden dann neue sensomotorische Korrelationen hergestellt und lernten die Ver-suchspersonen auf diese Weise, wie man eine vierdimensionale Welt erfährt (siehe dazu: Foerster 2000, S. 76 ff.). Das gleiche gilt dann auch für die Einnahme von Drogen. Ein gestandener Realist wird dann zwar immer noch behaupten wollen, dass unter Einfluss von Drogen die Realität »verzerrt« wahrgenommen wird (etwa das Raumzeitempfinden), doch ist er dann ge-zwungen, einen verbindlichen Speiseplan aufzustellen, an dem man sich zu halten hat, wenn die Welt »objektiv« gesehen werden soll. Die hier genannten Beispiele sollen deutlich machen, dass die Kategorien der Erfahrbarkeit, von denen Kant an-nahm, dass ihnen eine unbedingte Gültigkeit zukommt, nur mögliche Kategorien sind.
[71] Die Subjektphilosophie gesteht im Grunde nur dem Menschen die Fähigkeit zu, sich intentional zu verhalten. Kaum jemand würde ernsthaft behaupten, dass sich ein Stein oder ein Thermostat intentional verhalten. Weder »wünscht« ein Stein in der Sonne zu liegen noch »beabsichtigt« ein Thermostat die Temperatur nachzuregeln. Bei einer Bakterie ist man sich schon nicht mehr so sicher, ob sie nicht eventuell doch absichtsvoll handelt. Beim Menschen scheint es dann eindeutig: selbstverständlich wünsche ich, und handele ich und beabsichtige ich.
[72] Wie Münch (1998, S. 35) zu verstehen gibt, zeichnet sich in der westlichen Kultur das Konzept der Handlung dadurch aus, das der Handelnde sich verteidigen kann, indem er Gründe für sein Tun angibt (das Konzept schließt somit aus, dass Tiere handeln können). In der Soziologie führt dieser Standpunkt dann zu handlungstheoretischen Ansätzen, die das Verhalten von Individuen auf deren Ziele, Absichten und Wünsche zurückführen wollen. Zwar ist dies dann eine angemessene Beschreibung für jedermanns Introspektion, nicht aber unbedingt eine wissenschaftliche Beschreibung: »Wenn die Handlungstheorie be-hauptet, dass ihre intentionalistische Beschreibungsweise Verhalten erklären kann, so ähnelt diese Situation der Biologie vor Charles Darwin: Die Giraffe hat einen langen Hals, weil sie beabsichtigt, von Bäumen zu fressen. Aber wir können die Be-schreibungsweise der Handlungstheorie insofern akzeptieren, als sie eine Abkürzung beschreibender Codes für Mechanismen ist, die auf nichtintentionalistische Weise und im Detail noch zu erklären sind« (Haken/Haken-Krell 1997, S. 235).
[73] Wie ich noch zeigen werde, vertritt Luhmann in Bezug auf Bewusstsein und Kommunikation ebenfalls einen solchen Ansatz, der sich als Emergenz »von oben« bezeichnen lässt. Während der emergenztheoretische Ansatz »von unten« reduktionistisch das emergente Produkt als reines Epiphänomen behandelt, ist dies bei Emergenz »von oben« nicht der Fall ist: die emergente Systemebene ist dann vielmehr fähig, sich selbst zu organisieren, und die Prozesse sind auch bei noch so genauer Kenntnis der Systemkomponenten nicht vorhersagbar.
[74] Zu einer kritischen Diskussion der genannten Ansätze siehe: Roth 1998, S. 278 ff.
[75] Roth 1998, S. 308.
[76] Roth 1998, S. 309.
[77] Claxton 1997, S. 125 f.
[78] Claxton 1997, S. 281 f.
[79] Zum Phänomen der Blindsicht siehe: Dennett 1994a, S. 421 ff., Roth 1998, S. 215 f., Claxton 1997, S. 284 f.
[80] Claxton 1997, S. 295.
[81] Claxton 1997, S. 287 f. Weitere Beispiele finden sich bei Maturana/Valera 1987, S. 246 ff., Roth 1998, S. 217 ff.
[82] Maturana/Valera 1987, S. 250. Und schließlich: »Selbstbewusstsein, Bewusstheit, Geist – das sind Phänomene, die in der Sprache stattfinden. Deshalb finden sie als solche nur im sozialen Bereich statt« (Maturana/Valera 1987, S. 249).
[83] Claxton 1997, S. 167.
[84] Zu einer gesellschaftsbezogenen Analyse von Schizophrenie siehe: Laing 1994.
[85] Claxton 1997, S. 217 f.
[86] Roth 1998, S. 233.
[87] Metzinger 1998, S. 361
[88] »Gilt nicht das Ich als der Träger von Moral und Ethik? Was aber droht der Welt, wenn wir die Vorstellung eines solchen Ich in Frage stellen? Unser Meinung nach resultiert die Sorge aus dem Scheitern des westlichen Diskurses, das Ich und sein Pro-dukt, das Eigeninteresse, empirisch genau zu analysieren« (Valera/Thompson 1992, S. 331). Zu einer kritischen Diskussion von Willensfreiheit und Verantwortlichkeit siehe auch: Dennett 1994.
[89] Information wird dann als Substanz aufgefasst, die man sammeln, beliebig vermehren und transportieren kann: vom Lehrer zum Schüler, vom Erwachsenen zum Kind, von einer Generation zur nächsten.
[90] Schmidt 1992, S. 32. Experimente haben ergeben, dass Tiefseetaucher sich an Tatsachen, die sie unter Wasser lernten, besser erinnern können, während sie wiederholt tauchen – und dass im trunkenen Zustand erhaltene Informationen leichter erinnert werden, wenn man wieder betrunken ist (vgl. Cohen 1997, S. 85).
[91] Roth 1998, S. 261 ff.
[92] Roth 1998, S. 267. Auf den Punkt gebracht formuliert Roth (1998, S. 266) deshalb auch: Was wir bewusst wahrnehmen, sind »Gedächtnisbilder«.
[93] Roth 1998, S. 269. In zahlreichen Experimenten konnte nachgewiesen werden, wie unzuverlässig unsere Wahrnehmung ist, eben weil sie aus dem Gedächtnis stammt.
[94] Schmidt 1992, S. 37.
[95] Rusch 1987, S. 346.
[96] Siehe dazu mit einem Beispiel: Claxton 1997, S. 164.
[97] Claxton 1997, S. 164. Wer das bezweifelt, kann einmal versuchen, inkohärente Geschichten zu erfinden oder in unzusammen-hängenden Sätzen zu sprechen. Es ist mit ziemlicher Sicherheit davon auszugehen, dass dieser Versuch, wenn er konsequent fortgesetzt wird, eine Einweisung in die Psychiatrie zur Folge hat.
[98] Siehe dazu mit zahlreichen Beispielen: Watzlawick 2000.
[99] Rusch 1987, S. 374.
[100] Dennett, zitiert nach Claxton 1997, S. 160.
[101] Die Frage wäre dann wieder, woran sich diese Auswahl orientiert, und es wäre zu vermuten: sie orientiert sich an der sozialen Logik, an den Bedingungen des sozialen Geschehens.
[102] Siehe dazu: Dennett 1994a.
[103] Maturana in Riegas/Vetter 1993, S. 84.
[104] »Dennoch sind die meisten Menschen von ihrer Identität überzeugt. Wir haben eine Persönlichkeit, Erinnerungen, Pläne und Erwartungen, die offenbar alle in einem kohärenten Standpunkt zusammenkommen, in einem Zentrum, von dem aus wir die Welt überblicken, dem Boden, auf dem wir stehen. Wie könnte ein solcher Standpunkt möglich sein, wenn wir nicht in einem einzigen, unabhängigen, wahrhaft existierenden Selbst oder Ich verwurzelt wären?« (Valera/Thompson 1992, S. 89 f.)
[105] Zima 2000, S. 261.
[106] Man stelle sich einmal die Situation vor, in der man sich plötzlich einer Beleidigung bewusst wird und daraufhin aufrichtig zu verstehen gibt: »Oh, das habe ich nicht gewollt! Wirklich, das war nicht meine Absicht gewesen! Bitte glauben Sie mir, dass ich das ganz sicher nicht sagen wollte! Das war nicht mein wirkliches Ich, das diese Worte ausgesprochen (und vor allem: gemeint) hat! Nein, ich war in diesem Moment nicht meiner selbst!« Welches Ich hat da eben gesprochen? Wer oder was ist es, das diesen im nachhinein bedauerten (von wem eigentlich?) Sprechakt ausführt? Wie man sieht, wäre es in diesem Fall besser, das »Ich« oder »Sprachsubjekt« mit einem Index zu versehen. Wer will, kann zur Ehrenrettung des Subjekts dann den Versuch anstellen, das eigentliche oder wahre Ich zu bestimmen, indem jener Index ausfindig gemacht wird, der in diesem irren Ich-Komplex als Gravitationszentrum fungieren soll.
[107] Derzeit krankt die Kognitionswissenschaft an selbstauferlegten Beschränkungen, die jedoch für ein umfassendes Verständnis von Kognition unfruchtbar bleiben. Das Problem ist: Wie lassen sich kognitionsfähige von nichtkognitionsfähigen Systemen abgrenzen? Der Begriff der Kognition wird aus einer anthropozentrischen Perspektive fast ausschließlich auf solche Systeme angewandt, die intelligent, zurechnungsfähig und bewusst planend handeln. Affekthandlungen wie Wut oder Zorn sind dann nicht Gegenstand der Kognitionswissenschaft, denn diese Prozesse sind nicht bewusst gewollt, sie stehen einem Subjekt nicht zur Disposition (siehe dazu: Münch 1998).
[108] Luhmann greift hier auf die operative Unterscheidungslogik von George Spencer Brown zurück, der in seinem Formenkalkül den Nachweis erbringt, dass eine Sequenz von Anweisungen, wenn sie befolgt wird, zu komplexen Beobachtungen führt, und dass jedes beobachtende System, das diese Anweisungen operativ nachzeichnet, dieselben Beobachtungsresultate erhält. Ein Beobachter bezeichnet dann als »Realität«, was durch diese Unterscheidungsoperationen als Konstrukt entstanden ist (siehe dazu ausführlich: Spencer Brown 1997).
[109] Siehe dazu: Luhmann 1992, S. 80 f., Luhmann 1996, S. 169.
[110] Im Gegensatz zu Maturana verwendet Luhmann einen allgemeinen und einheitlichen Autopoiesis-Begriff zur Beschreibung unterschiedlicher Systemarten. Um welches autopoietische System es sich in einem konkreten Fall handelt, hängt dann davon ab, welche Elemente jeweils autopoietisch miteinander verknüpft werden (vgl. Kneer/Nassehi 2000, S. 57 ff.).
[111] Luhmann 1999, S. 69. Zum operativen Beobachterbegriff siehe auch: Luhmann 1999, S. 60 ff., Luhmann 1984, S. 242 ff.
[112] Luhmann 1993, S. 37.
[113] Luhmann 1996, S. 18 f.
[114] Die Beobachtung erster Ordnung wird vom beobachtenden System »blind« vollzogen und erzeugt auf diese Weise das »Was« einer Beobachtung, also den Objektbereich. Die Beobachtung zweiter Ordnung hingegen ist eine Beobachtung, die sich einer spezifischen Unterscheidung verdankt, denn sie fragt nach dem »Wie« einer Beobachtung: Wie beobachtet ein Beobachter? Welche Unterscheidung liegt einer Beobachtung zugrunde? Mit einer Beobachtung zweiter Ordnung kann ein Beobachter einen anderen Beobachter schließlich fragen: Warum wird gerade so und nicht anders unterschieden, warum so und nicht anders beobachtet? Die Beobachtung zweiter Ordnung kann also hinterfragen, was mit einer bestimmten Unterscheidung ge-wonnen ist, und vor allem: welche Folgen und Effekte diese Beobachtung für andere Beobachter hat (beispielsweise könnte man fragen, was die Unterscheidung in »homosexuell« und »heterosexuell« für einen Sinn macht, und welche Folgen sie bei rekursiver Anwendung in der gesellschaftlichen Kommunikation zeitigt).
[115] Wenn also jemand ein Bild betrachtet und dazu bemerkt: »Dieses Bild ist obszön!«, dann weiß man deshalb noch nichts über das Bild (denn dazu muss man sich das Bild selbst anschauen), wohl aber etwas über den Beobachter, der diese Äußerung von sich gibt. Dieses Beispiel stammt von Foerster (2000, S. 85), der ebenfalls die Auffassung vertritt, dass die Eigenschaften von Dingen nicht in diesen selbst liegen, sondern die Konstruktion eines Beobachters sind – und deshalb ist es eben immer auch möglich, zu beobachten, wie andere Beobachter beobachten und welche Beschreibungen sie anfertigen. Lediglich Erkenntnis-theorien, die eine Ontologie voraussetzen, verlangen nach einer Trennung des Beobachters vom Beobachteten und müssen dann einfordern: »Die Eigenschaften des Beobachters dürfen nicht in der Beschreibung seiner Beobachtungen zu finden sein« (Foerster 2000, S. 44).
[116] Laszlo 1998, S. 85 f. Es wird dann eingeschränkt: »Dieser Schluss darf aber nicht auf das reflektierende Bewusstsein, also die Fähigkeit eines Systems zum Bewusstsein seiner selbst, übertragen werden. Selbstbewusstheit ist im Gegensatz zur Subjek-tivität der Erfahrung offenbar keine universelle Eigenschaft natürlicher Systeme« (Laszlo 1998, S. 86). Differenzwahrnehm-ung, Subjektivität der Erfahrung und Beobachtung sind dann gleichbedeutend, im Unterschied zu Selbstbewusstsein.
[117] Inwieweit auch ein Thermostat oder Makromolekül beobachten kann, hängt davon ab, wie zu unterscheiden das System fähig ist. Der Beobachtungsbereich eines Thermostaten, das lediglich die Differenz von Temperaturabweichung und eingestellter Temperatur beobachten kann, wird gegenüber einem komplexen Bewusstseinssystem wohl sehr viel bescheidener ausfallen. Dennoch operiert ein Bewusstsein nicht grundsätzlich anders, nämlich mit Unterscheidungen (in diesem Fall: mit einer Fülle von Unterscheidungen), deren rekursives Verknüpfen und relationales Arrangieren dann eine komplexe Welt entstehen lässt.
[118] Aus anthropologischer Sicht bedeutet absichtsvolles oder zielgerichtetes Verhalten (Handeln), dass der Handelnde Gründe für sein Tun angeben kann. Es wird dann angenommen, dass es dafür einer intelligiblen Struktur bedarf, die diese Handlungen denkt, plant, strukturiert, ausführt und sprachlich rechtfertigt. Das Konzept der Intentionalität ist also bereits vorab an Sprache und Intersubjektivität gebunden, und muss dann einem Makromolekül die Fähigkeit abgesprochen werden, sich intentional verhalten zu können: es antwortet nicht, wenn es nach den Gründen für sein Verhalten befragt wird. Es wird aber zugegeben, dass diese Sichtweise keine allgemeine Wissenschaft vom Intentionalen sein will, sondern lediglich dazu dient, eine spezielle Art von Intentionen, nämlich intelligentes Verhalten, zu erklären (vgl. Münch 1998, S. 34 ff.).
[119] Wenn sich eine Person nicht sprachlich mitteilen kann oder will, dann wird ihr deswegen nicht die Fähigkeit abgesprochen, sich intentional zu verhalten. Aus welchem Grund will man es dann aber für Pflanzen oder Tiere tun? Dennett (1999, S. 23 ff.) nennt dies das »Problem des unkommunikativen Geistes«. Ein weiterer Grund, dass den meisten Lebewesen (und auch künstlichen Produkten) keine Intentionalität zugestanden wird, liegt daran, dass viele intentional ablaufende Prozesse nicht dem menschlichen Zeitempfinden angepasst sind. Die Privilegierung der menschlichen Denkgeschwindigkeit wird von ihm dann auch zutreffend als »Zeitrahmen-Chauvinismus« bezeichnet (vgl. Dennett 1999, S. 77 ff.).
[120] Dennett 1999, S. 34.
[121] Dennett 1999, S. 67 f. In diesem Sinne werden also alle Externalisierungen als Verlängerung der intrinsischen Intentionalität verstanden. Nebenbei bemerkt erinnert die Unterscheidung in ursprüngliche und abgeleitete Intentionalität an die linguistische Vorstellung, Signifikate (gedankliche Inhalte) könnten losgelöst von ihren Signifikanten (sprachlichen Ausdrücke) existieren, könnten also ohne sie auskommen und im Grunde für sich allein existieren. Die philosophische Sprachkritik Derridas am Logozentrismus wird hier von Dennett kognitionswissenschaftlich gewendet.
[122] Luhmann 1992, S. 83.
[123] Luhmann 1992, S. 87
[124] Hier wird die folgende These vertreten: Selbstbewusstsein ist zwar notwendig an ein Nervensystem gekoppelt, aber das allein ist keine hinreichende Bedingung. Erst die Teilnahme an Kommunikation ermöglicht es einem Beobachter, sich als »Ich« oder »Subjekt« wahrzunehmen. Dies führt dann aber zu einem Problem: Wenn Kommunikation die hinreichende Bedingung für Selbstbewusstsein ist, wie ist dann Kommunikation zu denken, wenn diese nicht mehr von einem sich selbst bewussten Subjekt konstituiert wird, weil umgekehrt das Subjekt erst durch Teilnahme an Kommunikation zu einem solchen wird? Oder anders gefragt: Wie muss Kommunikation gedacht werden, wenn nicht durch ein kommunizierendes Subjekt? Die Subjekt-philosophie ist stets davon ausgegangen, dass Kommunikation nur möglich ist, weil es bereits ein Selbstbewusstsein vor aller Kommunikation gibt (die Subjektivität des Bewusstsein wird dann zu einer Voraussetzung für Kommunikation gemacht). Ich werde zeigen, dass sich dieses Problemfeld am Begriff der Emergenz abarbeitet, und hat dies weitreichende Konsequenzen für die Gesellschaftstheorie, die bislang als Handlungstheorie daherkommt und behauptet, Kommunikation sei ein Resultat der Interaktion sich selbst bewusster Subjekte.
[125] Und deshalb definiert Weber die Soziologie als eine »Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und in seinen Wirkungen ursächlich erklären will« (Weber 1972, S. 1).
[126] Um ein Beispiel zu nennen: Ich sehe einen Bekannten auf der anderen Straßenseite und winke ihm als Zeichen der Begrüßung zu. Die Handlungstheorie begreift diesen Vorgang als kommunikative Geste, führt also Kommunikation als Handlung ein und erklärt von hier aus das Soziale. Das Problem dabei ist, dass niemand außer mir selbst wissen kann, ob das Zuwinken auch tat-sächlich von jemanden bemerkt worden ist – in diesem Fall hätte mein Winken überhaupt keine soziale Relevanz. Es könnte ja sein, dass mein Bekannter gar nicht wahrgenommen hat, dass ich ihn aus der Ferne grüße. Oder aber er bemerkt mein Zu-winken, fühlt sich aber nicht angesprochen, da er mich nicht wiedererkennt und meint, der Gruß gelte der nebenstehenden Person. Für die Erklärung des Sozialen reicht also das Mitteilungsverhalten allein nicht aus, vielmehr muss es auch jemanden geben, der dieses Mitteilungsverhalten bemerkt und als solches versteht.
[127] Luhmann 1984, S. 198. Zu Kommunikation kann es also auch dann kommen, wenn überhaupt keine Mitteilungsabsicht vor-liegt, denn es genügt, wenn jemand ein Verhalten als Mitteilung einer Information versteht – insofern ist jede Kommunikation Unterstellung einer Mitteilungsabsicht. Wenn also jemand etwas leise vor sich hin murmelt, dann kann dies als die Mitteilung einer Information verstanden werden, muss es aber nicht. Es ist der Beobachter (Alter), der darüber entscheidet, wie er dieses Verhalten bestimmt. Für den Fall, dass er ein Verhalten als Kommunikationsofferte versteht, kann er nun seinerseits mit einer Anschlusskommunikation reagieren, oder auch nicht.
[128] Kommunikation ist dann die Synthese dreier Selektionen. Die erste Selektion bezieht sich auf den Informationsgehalt einer Mitteilung: aus einem Horizont von Möglichkeiten wird eine bestimmte Information ausgewählt (es wird über dieses und nicht über jenes kommuniziert). Die zweite Selektion behandelt die Modalität der Mitteilung: diese kann mündlich, schrift-lich, schreiend, flüsternd usw. erfolgen. Erst die dritte Selektion, das Verstehen der beiden vorangegangenen Selektionen als Mitteilung einer Information, schließt die Kommunikation ab. Sie entscheidet darüber, auf welche Weise eine mitgeteilte Information verstanden wird. Vereinfacht lässt sich sagen: »Eine Kommunikation liegt vor, wenn eine Informationsauswahl, eine Auswahl von mehreren Mitteilungsmöglichkeiten und eine Auswahl von mehreren Verstehensmöglichkeiten getroffen wird« (Kneer/Nassehi 2000, S. 81).
[129] Schneider 1994, S. 167.
[130] Kneer/Nassehi 2000, S. 85.
[131] Luhmann 1999, S. 44.
[132] Der operative Sinnbegriff markiert dann auch die Bruchstelle zur bewusstseinsphilosophischen Hermeneutik. Denn auch eine methodisch abgesicherte Beobachtung kann nicht den objektiven Sinn einer Kommunikation oder eines Bewusstseins erfass-en, denn stets gilt: es ist die nachfolgende Beobachtung, die der vorangegangenen Beobachtung einen Sinn abringt, obgleich dieser dann nicht beliebig ausfallen wird. Die operative Verschiebung von Sinn und die Nichtfixierbarkeit von Bedeutungen ist selbst in der deutschsprachigen Punkbewegung nicht unbemerkt geblieben. So heißt es etwa bei EA80: »Kann schon sein, dass alle Worte bedeutungslos sind. Kann schon sein, dass jedes Wort den Sinn verliert, sobald es gesprochen ist«.
[133] Kneer/Nassehi 2000, S. 73.
[134] So antwortete der Bundeskanzler Gerhard Schröder neulich bei einem Fußball-Länderspiel auf die Frage, wie er denn den Ausgang des Spiels beurteilt: »Ich tippe auf 3:1 für Deutschland« – wohlwissend, dass zwar nicht sein Bewusstsein, dafür aber seine Äußerung einer weiteren Beobachtung ausgesetzt ist (was tatsächlich im Kopf des Bundeskanzlers vor sich ge-gangen ist, und ob dieser sich auch nur ansatzweise für das Spiel interessiert hat, kann aus seiner Äußerung jedenfalls nicht abgelesen werden). Aber selbst, wenn man großzügig ist und hier eine Kongruenz von psychischen und sozialen Selektionen unterstellen will, so bleibt doch die Frage, ob die psychischen Selektionen sich einer Subjektivität des Bewusstseins verdank-en oder ob diese nicht vielmehr ein Effekt sozialer Selektionen sind, weil sie um die nachfolgenden Beobachtungsoperationen der Kommunikation bescheid wissen und auf diese Weise einem sozialen Zwang unterliegen. Wer oder was genau ist es also, der da denkt, entscheidet und Mitteilung macht – das authentische Subjekt? Man kann zwar immer auch meinen, was man sagt, aber dann sollte man anstelle einer Subjektivität des Bewusstsein besser von der Sozialität des Bewusstseins sprechen.
[135] Es ist wichtig zu wissen, dass Saussure das sprachliche Zeichen – die Einheit von Vorstellung und Lautbild – im Bewusstsein des Menschen ansiedelt. Die im sprachlichen Zeichen vereinten Bestandteile (Signifikat und Signifikant) sind also zunächst einmal psychischer Natur, und erst sekundär, in Form von Sprechen oder Schreiben, nimmt das sprachliche Zeichen dann eine außerpsychische, materielle Gestalt an. Wenn Saussure also vom »Lautbild« spricht, so ist damit nicht schon das gesprochene Wort gemeint, sondern vielmehr der psychische Eindruck, der im Bewusstsein entsteht, wenn an etwas bestimmtes gedacht wird (vgl. Saussure 1967, S. 77).
[136] Saussure spricht hier vom »Unmotiviertsein« des Zeichens. So ist die Vorstellung Baum in keiner Weise an die Bezeichnung »Baum« gebunden, sondern wird im Englischen oder Französischen durch einen anderen Signifikanten bezeichnet.
[137] »Aktiv ist alles, was vom Assoziationszentrum der einen zum Ohr der andern Person geht, und passiv ist alles, was vom Ohr der letzteren zu ihrem Assoziationszentrum geht« (Saussure 1967, S. 15). Den aktiven Teil deutet Saussure durch die folgende Schreibweise an: gedankliche Vorstellung ® lautlicher Ausdruck. Der passive Teil, die Rezeption des sprachlichen Zeichens beim Hören, wird dann durch die umgekehrte Schreibweise angedeutet: lautlicher Ausdruck ® gedankliche Vorstellung.
[138] So heißt es bei Aristoteles: »Die Sprache ist Zeichen und Gleichnis für die seelischen Vorgänge, die Schrift wiederum für die Sprache. Und wie nicht alle dieselben Schriftzeichen haben, bringen sie auch nicht die Laute hervor. Die seelischen Vorgänge jedoch, die sie eigentlich bedeuten sollen, sind bei allen die gleichen, und auch die Dinge, die sie nachbilden, sind die gleich-en« (Aristoteles, zit. nach Geldsetzer 1989, S. 128). Diese Definition bestimmt Sinn als Präsens, als Identität, als Substanz, was bedeutet: (1) identischer Sinn lässt sich verschiedentlich ausdrücken und umgekehrt aus verschiedenen sprachlichen Dar-stellungen als identischer entnehmen, (2) der Sinn eines Textes ist zugleich der Sinn des Gedachten, und (3) was gedacht wird, ist ein Abbild der realen Dinge (vgl. Geldsetzer 1989, S. 128).
[139] Die Vorstellung eines sich selbst präsenten, intentionalen Zentrums ist von mir bereits psychologisch zurückgewiesen worden, die Sprachkritik Derridas kommt hier nur wieder zu demselben Ergebnis.
[140] Vgl. Luhmann 1992, S. 73, S. 92.
[141] Luhmann 2001, S. 237.
[142] Die Themengebundenheit dient dann zugleich der Selbstbeschreibung der Kommunikation (vgl. Luhmann 1999a, S. 879 ff.). Wer gerade über den neuen Kinofilm redet, kann nicht im nächsten Moment das Wetter thematisieren, um anschließend die viel zu teure Autoreparatur zu beklagen, ein »Bleib mal beim Thema« wäre wohl eine sehr wahrscheinliche Reaktion. In flüchtigen Interaktionssystemen kann nahezu jedes beliebige Thema angesprochen werden, entscheidend ist, dass sich die Beteiligten etwas zu sagen haben. Hingegen sind in formalen Organisationen die Themen hochgradig konditioniert – hier geht es dann um die Frage: Wer darf wann, wo, worüber, wie und mit wem reden? Für Funktionssysteme gilt, dass sie mit Hilfe einer binären Codierung (Wahrheit, Macht, Recht, Gesundheit) beobachten und deshalb gezwungen sind, kommunikativ alles zum Thema zu machen, wenn ihr eigener Code betroffen ist.
[143] Luhmann 1992, S. 28.
[144] Luhmann 1984, S. 269.
[145] Luhmann 1992, S. 24.
[146] Zum Theoriebaustein der strukturellen Kopplung siehe: Luhmann 1999, S. 100 ff. »Von struktureller Kopplung spricht man, um die Bedingungen der Ausdifferenzierung von Systemen auf der Basis eines fortbestehenden Materialitätskontinuums zu beschreiben, nicht: um eine Kausalerklärung zu geben« (Luhmann 1992, S. 39). Die Strukturkopplung von Bewusstsein und Kommunikation steht also quer zur Strukturdeterminiertheit dieser Systeme, was bedeutet: Kommunikation bewirkt zwar eine Zustandsänderung im Empfänger, aber es liegt dabei kein Kausalverhältnis vor. Die Kommunikation kann nicht bestimmen, welche Zustandsveränderung sie in einem anderen Bewusstsein auslöst. Das Bewusstsein kann die mitgeteilte Information an-nehmen und für weitere Zwecke in Anspruch nehmen, oder aber ablehnen und den Kontakt zur Kommunikation abbrechen. Jede Kommunikation hält also eine Ja- und eine Nein-Fassung bereit, Konsens ist dann ein mögliches Ergebnis, nicht aber ein innewohnendes Ziel der Kommunikation (jemand weiß es besser und informiert: »Alkohol ist keine Lösung!« und bekommt daraufhin zu hören: »Kein Alkohol ist auch keine Lösung«). Ein systemtheoretischer Kommunikationsbegriff distanziert sich deshalb zum normativen Ideal einer auf Verständigung und Konsens angelegten Kommunikation, wie sie etwa von Habermas (»Kommunikatives Handeln«) vertreten wird: »Die Kommunikation hat keinen Zweck, keine immanente Entelechie« (Luh-mann 2001a, S. 102).
[147] Luhmann 1992, S. 59. Der systemtheoretische Kommunikationsbegriff meint also ein von Kommunikation selbst getragenes Selektionsgeschehen, welches das Bewusstsein nur partiell in Anspruch nimmt: »Das soziale Verstehen (das, was sich in den Äußerungen beobachtungstechnisch festlegt) überlagert oder dominiert, was psychisch geschieht« (Fuchs 1993, S. 32 f.). So kann die Kommunikation über ein bestimmtes Thema kommunizieren, während keines der beteiligten Bewusstseinssysteme auch nur ein echtes Interesse an diesem Thema hat. Die Autopoiesis sozialer Systeme verfestigt sich schließlich zu Strukturen, die nicht mehr ohne weiteres aufgebrochen werden können – jedenfalls bedarf es dazu einer aufwendigen Intervention, etwa wenn ein Bewusstsein den Vorschlag unterbreitet, das Thema zu wechseln. Wie man aus eigener Erfahrung weiß, ist damit eine gewisse Hemmschwelle verbunden, und so kommt es mitunter vor, dass man nach einer Stunde noch immer beim selben Thema verweilt, obwohl alle Gesprächspartner längst das Interesse daran verloren haben.
[148] Luhmann 1984, S. 142.
[149] Siehe beispielhaft: Stark 1994. Es wird dann bezweifelt, dass das Phänomen der Emergenz in seiner naturwissenschaftlichen Form auch auf gesellschaftliche Kommunikation übertragen werden kann. Gesellschaftliche Ordnung könne nur entstehen, weil »menschlicher Geist menschliches Handeln beeinflusst und diese Beeinflussung notwendige Voraussetzung gesell-schaftlicher Ordnung ist« (Stark 1994, S. 146). Die Gefahr einer auf dem autopoietischen Paradigma aufbauenden Soziologie wird dann darin gesehen, dass sich dieses Konzept in den Köpfen der Soziologen niederschlagen könnte und irgendwann als sich selbst erfüllende Prophezeiung nichts mehr zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen würde (vgl. Stark 1994, S. 134 f.). In der Tat hat Luhmann keine konkreten Problemlösungsstrategien anzubieten, aber das liegt auch nicht in seiner Ab-sicht. Luhmann will hauptsächlich die Beobachtungsmethode umstellen, um nämlich in einer immer komplexer werdenden Gesellschaft Zusammenhängen nachgehen zu können, ohne dabei ein psychisch motiviertes Interesse unterstellen zu müssen.
[150] Wenn man behauptet, dass der Mensch kommuniziert (und nicht die Kommunikation), dann wird es schwierig zu erklären, wie sich Menschenkinder dem Sozialverhalten von Wölfen anpassen können (siehe dazu: Maturana/Valera 1987, S. 140 ff.). Die soziale Verhaltensabstimmung zwischen Wolf und Mensch lässt sich wohl kaum über die Formel K = f(B) erklären. Legt man hingegen die systemtheoretische Differenz von Bewusstsein und Kommunikation zugrunde und schreibt: B = f (B) sowie K = f (K), unter der Bedingung, dass zwischen Bewusstsein und Kommunikation strukturelle Komplementarität besteht, dann bedeutet dies, dass sich menschliches Bewusstsein in die Kommunikation unter Wölfen einklinkt und sich dementsprechend sozialisiert – so dass es zum Tod führen kann, wenn das Bewusstsein später aus seiner natürlichen Ko-Ontogenese entrissen wird.
[151] Luhmann 1984, S. 234.
[152] Esser 1999, S. 404.
[153] Wenturis 1992, S. 155 f.
[154] »Das Paradigma der Selbstorganisation stellt im wesentlichen darauf ab, dass Systeme nicht linear von ihrer Umwelt gesteuert werden, sondern je nur nach ihrer inneren Eigenlogik auf Umweltveränderungen reagieren« (Kneer/Nassehi 2000, S. 23).
[155] Kneer/Nassehi 2000, S. 89 f.
[156] Zima 2000, S. 101 f.
[157] Das Wissen, dass sich die Erde um die Sonne (und nicht die Sonne um die Erde) dreht, verdankt sich nicht einer außerhalb der Erkenntnis liegenden Realität, sondern wird über soziale Operationen geregelt. Dabei wird auf vorhandenes Wissen (also auf ein soziales Gedächtnis) zurückgegriffen. Ein selbstlernendes System muss dann, wenn sich eine neue Erkenntnis durchsetzen soll, alte Unterscheidungen vergessen oder verlernen. Das System muss dann die eigenen Widerstände intern verarbeiten und kann dafür nur eigene Operationen in Anspruch nehmen. Das gilt dann für das Nervensystem ebenso wie für die gesellschaft-liche Kommunikation.
[158] Zur Auslegungsvielfalt von Texten siehe: Steinmetz 2000.
[159] Luhmann 1993, S. 229.
[160] Luhmann 1993, S. 29.
[161] Ein sozialkonstruktivistisches Experiment hat gezeigt, wie schwierig es sein kann, eine wissenschaftliche Kommunikation für andere Beobachter als wissenschaftliche Kommunikation zu qualifizieren (siehe dazu ausführlich: Geißlinger 1995). Das be-sagte Experiment fand auf einem Kongress in Heidelberg zum Thema »Was ist Wirklichkeit und wie kommt sie zustande?« statt, zum dem zahlreiche Vertreter des Radikalen Konstruktivismus geladen waren. Zu Beginn der dreitägigen Veranstaltung wurden die Kongressteilnehmer beiläufig auf einen Zeitungsartikel aufmerksam gemacht, in dem zu lesen war, dass kürzlich an der Freien Universität Berlin eine Soziologieveranstaltung unter dem Titel »Realitätssucht und ihr Koeffizient« abgehalten wurde. Ein »Professor« für Neurophysiologie hatte dort einen Vortrag gehalten, und obwohl er nur blanken Unsinn redete, ist dies von keinem der Studenten bemerkt worden. Im Gegenteil: die Absurditäten des Gastredners wurden fleißig mitgeschrieb-en, bis der vermeintliche Professor nach einer halben Stunde von einem Nervenarzt und in Begleitung eines Polizisten abge-holt wurde. Der Zeitungsartikel endete mit dem Hinweis, dass dieses Experiment von der Story Dealer A.G. – ein Verein zur Inszenierung von Realität – durchgeführt worden war, und dass weitere Experimente geplant sind, unter anderem auf einem wissenschaftlichen Kongress in Heidelberg. Der Zeitungsartikel hatte fatale Folgen für den Verlauf des Kongresses: so wurde ein Professor vom Publikum plötzlich als Mitarbeiter der Story Dealer A.G. »enttarnt«, die Attraktorentheorie von Prof. Dr. Gerhard Roth wurde als »getürkter Beitrag« identifiziert (denn es war keinem der rund 700 anwesenden Teilnehmer möglich, auf dem von Roth gezeigten Dia eine Kuh zu erkennen), andere Vorträge transformierten sich in Kabarettveranstaltungen und endeten in lautem Gelächter, weil die Zuhörer nicht glauben konnten, was ihnen die Referenten an angeblich wissenschaft-lichen Erkenntnissen anbieten wollten. Auch in den nächsten Tagen wurden immer wieder Verdachtsmomente geäußert, und das Publikum war sich einig: im Kontext einer wissenschaftlichen Veranstaltung kann man keinen Unsinn referieren, der groß genug ist, um nicht als solcher erkannt zu werden. Wie dieses Experiment also zeigt, kann Nichtwissenschaft erfolgreich als Wissenschaft ausgegeben werden, und können umgekehrt wissenschaftliche Beiträge als »Unsinn« identifiziert werden, wenn die Überzeugungskraft auf Seiten der Wissenschaftler nicht groß genug ist, wenn also systemtheoretisch gesprochen die mit-geteilte Information abgelehnt wird. Ob etwas wissenschaftlich ist oder nicht, darüber entscheidet letztlich die beobachtende Kommunikation.
[162] Siehe dazu: Luhmann 1992, S. 19, Luhmann 1999a, S. 874 f.
[163] Evolutionsprozesse sind operativer, nicht aber inhaltlicher Natur: »Komplexität von Struktur und Funktion ist kein Ziel der Evolution, sondern ist ihr Ergebnis « (Laszlo S. 61 f.).
[164] Die Unterscheidung in Wesen (Tiefenrealität) und Erscheinung (Oberflächenphänomene) wird in der Physik schon lange nicht mehr aufrechterhalten. Nur die Sozialwissenschaften sind zum Teil immer noch damit beschäftigt, zugrundeliegende (deshalb: objektive) Strukturen des Sozialen ausfindig zu machen.
[165] Luhmann 1984, S. 379. Man kann einmal den Versuch machen und annehmen, dass es höhere Mächte gibt, die sich gegen die eigene Person verschwört haben. Und siehe da: es braucht gar nicht lange, bis diese Realitätswahrnehmung zur Gewissheit wird. Natürlich wird diese Sichtweise dann nicht von allen Menschen geteilt, und einige Psychiater werden sogar versuchen, diese wieder ausreden und als Kraft der Einbildung dahinstellen zu wollen, aber dann ist das nur wieder ein weiterer Beweis dafür, dass es sich hierbei um eine Verschwörung handelt. Jede Beobachtung beruht auf Unterscheidungen (oder im Sinne von Watzlawick: auf Interpunktionen), mit der die Welt zerlegt und eingeteilt wird. Strukturgewissheit und Kausalzusammen-hänge stellen sich dann ganz von selbst ein, sind aber stets eine unterscheidungsabhängige Konstruktion und deshalb für jede Beobachtung verschieden.
[166] Knorr-Cetina 1997, S. 138.
[167] Schneider 1994, S. 12.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Der Text ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter umfasst. Er hinterfragt kritisch den Subjektbegriff und untersucht die Konsequenzen, wenn das Subjekt als kognitive und soziale Konstruktion behandelt werden muss. Dabei werden der Mensch als erkennendes und als handelndes Subjekt berücksichtigt und schließlich das Subjekt durch den Begriff des Beobachters ersetzt.
Was sind die Hauptthemen, die in diesem Text behandelt werden?
Die Hauptthemen umfassen das Verhältnis von Subjekt und Objekt in der Erkenntnistheorie, das Subjekt aus der Perspektive der Kognitionswissenschaften, das Subjekt aus der Perspektive des Radikalen Konstruktivismus, die Theorie beobachtender Systeme in der Soziologie sowie die soziologische Beobachtung von Gesellschaft. Der Text behandelt auch das Begründungsproblem subjektübergreifender Erkenntnis, Realismus, Idealismus, Kognitivismus, Konnektionismus, Autopoiesis, und Kontingenz.
Welche erkenntnistheoretischen Positionen werden diskutiert?
Es werden Realismus (Erkenntnis als Repräsentation einer objektiven Realität), objektiver Idealismus (Erkenntnis als Repräsentation objektiver Ideen) und subjektiver Idealismus (das apriorische Erkenntnisvermögen des Subjekts) diskutiert.
Wie wird das Subjekt in den Kognitionswissenschaften betrachtet?
Das Subjekt wird als Gegenstand der Kognitionswissenschaften betrachtet, wobei Kognition als Symbolverarbeitung und Repräsentation (Kognitivismus) oder als Selbstorganisation und Repräsentation (Konnektionismus) analysiert wird. Es werden auch repräsentationalistische Ansätze der Kognition kritisiert.
Was ist der Radikale Konstruktivismus und wie steht er zum Subjekt?
Der Radikale Konstruktivismus ist eine Erkenntnistheorie, die die Repräsentation aufgibt und durch das Konzept autopoietischer Systeme ersetzt. Erkenntnis wird als Konstruktion eines kognitiven Systems betrachtet, ohne Entsprechung in der Umwelt. Das Subjekt-Objekt-Schema wird durch autopoietische Systeme ersetzt.
Wie wird der Begriff des Beobachters in der Soziologie verwendet?
In der Soziologie wird die Theorie beobachtender Systeme verwendet, wobei der Beobachter als selbstreferentielles System betrachtet wird. Selbstbewusstsein wird als Effekt von Beobachtungsoperationen gesehen, und das Verhältnis von Bewusstsein und Kommunikation wird analysiert.
Was sind die Konsequenzen für die Soziologie, wenn das Subjekt dekonstruiert wird?
Die Soziologie muss ihre Beobachtungsmethode umstellen und Kommunikation statt Bewusstsein beobachten. Sie muss von einer Beobachtung erster Ordnung zu einer Beobachtung zweiter Ordnung übergehen, die in den Blick nimmt, wie gesellschaftliche Kommunikation Identitäten konstruiert.
Welche Rolle spielt das Gedächtnis in diesem Kontext?
Das Gedächtnis wird nicht als reiner Speicher betrachtet, sondern als aktiver Konstruktionsprozess, der Erinnerungen und Erzählgeschichten formt. Diese sind nicht unbedingt akkurate Wiedergaben der Vergangenheit, sondern Konstruktionen, die zur gegenwärtigen Situation passen.
Was bedeutet Kontingenz in Bezug auf gesellschaftliche Operationen?
Kontingenz bedeutet, dass gesellschaftliche Operationen richtungslose Evolutionen sind und keinem vorgegebenen Plan folgen. Die gesellschaftliche Kommunikation orientiert sich an sich selbst und ist offen für Neues, wobei Einzelbewusstsein kaum einen Einfluss auf die Richtung der gesellschaftlichen Evolution hat.
Welche Rolle spielt der freie Wille in der Theorie des Radikalen Konstruktivismus?
Der Text argumentiert, dass intentionale Verhalten und Entscheidungsfreiheit kognitive Illusionen sind, die dem subjektiven Bewusstsein zugeschrieben werden, während neuronale Prozesse die Handlung initiieren und beeinflussen. Das Bewusstsein wird daher eher als Beobachter denn als Akteur betrachtet.
- Quote paper
- Lars Berghoff (Author), 2003, Vom Subjekt zur Autopoiesis beobachtender Systeme - Eine erkenntnistheoretische Kritik am Subjektbegriff und die Konsequenzen für die soziologische Beobachtung von Gesellschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108406