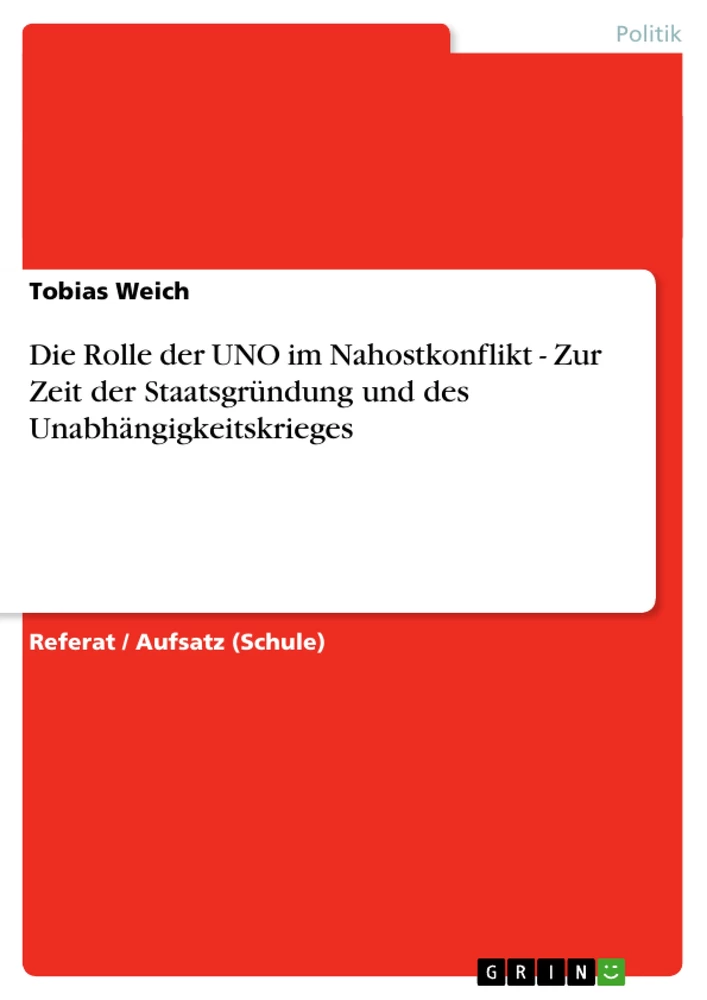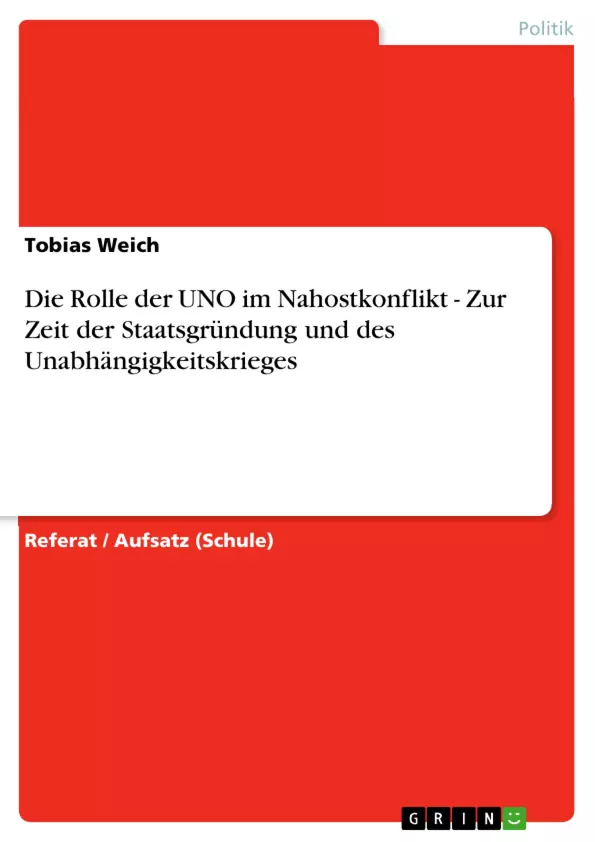Ein Wendepunkt der Geschichte, ein Schicksalsjahr für den Nahen Osten: 1947. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine erschütternde Reise durch die turbulenten Ereignisse, die zur Teilung Palästinas und zur Gründung Israels führten. Erleben Sie die hochspannenden Verhandlungen der Vereinten Nationen, die zerrissenen Fronten zwischen jüdischen und arabischen Interessen, und die verzweifelten Versuche, einen dauerhaften Frieden zu schaffen. Tauchen Sie ein in die komplexe Gemengelage aus politischen Ambitionen, religiösen Überzeugungen und dem unaufhaltsamen Drang nach nationaler Selbstbestimmung. Die brillante Analyse der UN-Resolution 181 beleuchtet die Hintergründe und Motive der internationalen Akteure, während die detaillierte Darstellung des Unabhängigkeitskrieges die menschlichen Tragödien und territorialen Verschiebungen offenbart. Verfolgen Sie die dramatischen Folgen des Teilungsplans, die bis heute nachwirken: die bittere Flüchtlingsfrage, die umstrittene Territorialfrage und der heikle Status Jerusalems. Dieses Buch ist eine fesselnde Chronik der Entstehung des Nahostkonflikts, ein unverzichtbares Werk für alle, die die tieferen Ursachen dieser unendlichen Auseinandersetzung verstehen wollen. Es ist eine aufrüttelnde Mahnung, dass Frieden nur durch Kompromiss und gegenseitiges Verständnis erreicht werden kann. Die fundierte Recherche und die klare Sprache machen dieses Buch zu einem wertvollen Beitrag zur Nahostforschung und einem bewegenden Zeugnis der menschlichen Geschichte. Entdecken Sie die vielschichtigen Ursachen und verheerenden Konsequenzen eines Konflikts, der die Welt bis heute in Atem hält. Ein mutiges Buch, das keine einfachen Antworten gibt, sondern zum selbstständigen Denken anregt. Es ist eine intensive Auseinandersetzung mit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit. Dieses Buch bietet neue Perspektiven und tiefe Einblicke in ein Thema, das uns alle betrifft. Es ist eine Einladung, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und aus ihr zu lernen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Palästinafrage vor 1947
2.1. Politische Lage in Palästina vor 1947
2.2. Britische Versuche zur Lösung der Palästinafrage
3. Bemühungen der UNO zur Lösung der Palästinafrage
3.1. Das UNSCOP
3.2. Das Ad-hoc-Komitee
3.3. Der UN-Teilungsplan
3.3.1. Inhalt der Resolution 181 und des UN-Teilungsplanes
3.3.2. Gründe für das Zustandekommen des Teilungsplanes
4. Folgen des Teilungsbeschlusses
4.1. Reaktionen auf den Teilungsplan
4.2. Der Unabhängigkeitskrieg
4.3. Folgen des Unabhängigkeitskriegs
4.3.1. Flüchtlingsfrage
4.3.2. Territorialfrage
4.3.3. Jerusalemfrage
5. Fazit
1. Einleitung
Fast die Hälfte aller verabschiedeter UN-Resolutionen des Sicherheitsrates und der Generalversammlung beziehen sich auf den Nahostkonflikt. Dies verdeutlicht sowohl die Brisanz des Nahostkonfliktes als auch die aktive Rolle, die die Vereinten Nationen darin spielen. Zwar hat sich auch schon der Völkerbund als Vorgänger der UNO mit der Palästinafrage beschäftigt, er befasste sich aber eher damit, die Mandate der Kolonialmächte für dieses Gebiet zu regeln.
Diese Arbeit versucht ein Bild vom Engagement der UNO im Nahostkonflikt zu geben. Da die Beleuchtung des UNO-Engagements vom Beginn im Jahre 1947 bis heute viel zu umfangreich wäre und den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, habe ich mich entschieden, den Zeitraum um die Staatsgründung Israels und den Unabhängigkeitskrieg näher zu betrachten. Ich habe diesen Zeitraum gewählt, da er auf der einen Seite den Auftakt des Engagement der UNO darstellt und auf der anderen Seite mit der Teilungsresolution 181 die wohl weitreichendste Resolution der UNO beinhaltet. Außerdem kann eine Betrachtung dieses Zeitraums die Entstehung des Nahostkonfliktes verständlicher machen und eine Einblick in die Völkerrechtliche Lage geben.
Die Gefahr, die beim Schreiben über die Rolle der UNO in einem Konflikt besteht ist sicherlich, dass man zu sehr von der Rolle der UNO abkommt und eher allgemein über den Konflikt schreibt. Da die UNO ein Organ der internationalen Politik ist, lässt es sich jedoch nicht vermeiden, auch über die allgemeine internationale Politik zu schreiben, wenn man das Verhalten der UNO als Schmelztiegel der internationalen Interessen verstehen will.
2. Palästinafrage vor 1947
2.1. Politische Lage in Palästina vor 1947
Durch die Bemühungen des Zionismus, der sich 1897 auf dem Basler Kongress zur Zionistische Weltorganisation zusammengeschlossen hatte, und aufgrund des wachsenden Antisemitismus in Europa, der sich zu dieser Zeit bis zu Pogromen und der systematischen Verfolgung steigerte, waren während der Zeit von 1881-1947 etwa 500 000 Juden nach Palästina ausgewandert. Dort hatten sie bis 1945 etwa 1460 km² Land in ihren Besitz gebracht und von 1882-1947 277 landwirtschaftliche Siedlungen gegründet. Im Jahr 1947 betrug die jüdische Bevölkerung in Palästina 608 000[1] und das jüdische Eigentum in Palästina etwa 5%.[2] Das britische Weißbuch beschränkte die jüdische Einwanderung nach Palästina sehr stark. Trotzdem versuchten die Überlebenden des Holocaust illegal nach Palästina einzuwandern. Die britische Mandatsmacht wollte die Einwanderung eindämmen. Sie nahm die Flüchtlinge, die sie erwischte fest und brachte sie zuerst in Lager auf Zypern, später sogar in ein ehemaliges KZ in der englischen Besatzungszone.
Sowohl die Balfour-Deklaration als auch das britische Mandat über Palästina, das vom Völkerbund im Juli 1922 bestätigt worden war und somit eine völkerrechtliche Grundlage bildete, sahen die Schaffung einer „nationalen Heimstätte für Juden“[3] vor.
Die Ziele des arabischen Nationalismus, der die Befreiung der arabischen Gebiete aus der Fremdherrschaft verfolgte, widersprach jedoch den Bestrebungen des Zionismus nach einem jüdischen Staat in Palästina. Diese widersprüchliche Zielsetzung bildete die Grundlage für den Nahostkonflikt.[4]
Die Jewish Agency wurde 1922 als „Vertretung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der in Palästina ansässigen Juden gegenüber der britischen Mandatsmacht“[5] gegründet. Als „erste zionistische militärische Organisation“ wurde 1920 die Haganah gegründet, die später in der israelischen Armee aufging.[6] 1936 bildeten die palästinensischen Parteien das „Obersten Arabischen Komitee“ (später „Arab High Committee“) als palästinensische Interessenvertretung.
2.2. Die britischen Versuche zur Lösung der Palästinafrage
Im Januar 1936 forderten die politischen arabischen Parteien den Stopp der jüdischen Einwanderung und das Verbot des Landverkaufs an Juden, da sich von den jüdischen Einwanderern „wirtschaftlich und sozial [...] gefährdet“[7] sahen. Daraufhin wurde von der britischen Regierung eine Kommission eingesetzt, die die Ursachen der Unruhen in Palästina untersuchen sollte.
Während die jüdische Seite[8] gegenüber der Kommission die Errichtung eines jüdischen Nationalstaates forderte, sprach sich der arabische Vertreter[9] für den Stopp der jüdischen Einwanderung und gegen einen jüdischen Nationalstaat aus.
Im Juli 1937 veröffentlichte die Kommission ihren Bericht (Peel-Plan). Dieser schlug vor, das britische Mandat zu beenden und Palestina zu teilen in:
- einen arabischen Staat, der mit Transjordanien vereinigt sein sollte
- einen jüdischen Staat
- ein neues Mandatsgebiet für Bethlehem und Jerusalem mit ihren heiligen Stätten
Während die arabische Seite den Plan strikt ablehnte, bekundete die jüdische, dass sie grundsätzlich der Schaffung eines jüdischen Staates zustimme. Die Mandatskommission des Völkerbundes sprach sich jedoch gegen die sofortige Schaffung zweier unabhängiger Staaten aus, da sie die Volksgruppen als noch nicht reif genug für einen eigenen Staat betrachtete.
Auf der Palästinakonferenz im Februar/März 1939 machte die britische Delegation einen Kompromissvorschlag der den arabischen Forderungen viel näher kam als der Peel-Plan. Der Kompromissvorschlag sah die Schaffung eines palästinensischen Staates vor, in dessen Exekutive Vertreter beider Volksgruppen vertreten sein sollten. Bis zur Schaffung des Staates war ein Stopp der jüdischen Einwanderung vorgesehen. Der Vorschlag wurde jedoch von beiden Seiten abgelehnt.
Eine weitere Palästinakonferenz nach dem zweiten Weltkrieg (1946) endete ergebnislos, da keiner der britischen Vorschläge angenommen wurde. Die Jewish Agency hatte die Vorschläge schon im Voraus abgelehnt und somit erst gar nicht an der Konferenz teilgenommen.
Nach dem Scheitern der Palästinakonferenz sah sich die britische Mandatsmacht aufgrund der anhaltenden Attacken der jüdischen bzw. arabischen Militärorganisationen, die sich zunehmend auch gegen britische Einrichtungen richteten, nicht mehr in der Lage, ihr Mandat aufrecht zu halten. Daher bat der ständige Delegierte Großbritanniens, Sir Alexander Godogan, den Generalsekretär der Vereinten Nationen am 2.April 1947, „die Palästinafrage auf die Tagesordnung der nächsten ordentlichen Vollversammlung zu setzen und eine Sondersitzung zur Bildung eines Spezialkomitees für Palästina einzuberufen.“[10] Die Regierungen der arabischen Staaten[11] reagierten hierauf indem sie Ende April den Generalsekretär baten „die Frage der Beendigung des britischen Mandats über Palästina und die Erklärung seiner Unabhängigkeit auf die Tagesordnung zu setzen.[12] Damit wollten sie wohl der Debatte über die Teilung Palästinas in der UNO zuvorkommen. Der arabischen Bitte wurde jedoch im Gegensatz zur britischen nicht stattgegeben.
3. Bemühungen der UNO zur Lösung der Palästinafrage
3.1. Das UNSCOP
Die von der britischen Seite gewünschte Sondersitzung der Generalversammlung zur Gründung eines Spezialkomitees wurde am 28.April 1947 eröffnet. Am 15 Mai beschloss sie gegen die Stimmen 7 moslemischer Länder[13] das UNSCOP (United Nations Special Committee on Palastine) zu gründen. Seine Aufgabe war es:
- Ermittlungen über „alle Punkte und Streitfragen, die für das Palästinaproblem von Bedeutung sind“[14] anzustellen
- Die religiösen Interessen der 3 Religionen sorgfältigst zu berücksichtigen
- Der Generalversammlung „einen Bericht [...] und Vorschläge, die er für die Lösung des Palästinaproblems für geeignet ansieht“[15], zu unterbreiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Keystone Pressedienst GmbH
Vollversammlung der Vereinten Nationen
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) ist ein Forum der Mitgliedsstaaten zur Vertretung ihrer jeweiligen Interessen. Jedes Land hat eine Stimme; Resolutionen der UN werden per Mehrheitsentscheid verabschiedet. Sie sind jedoch nicht bindend.
Microsoft ® Encarta ® Professional 2002.
Das Komitee forderte die Konfliktparteien (Jewish Agency, Arab High Committee und die britische Mandatsmacht) zur Zusammenarbeit auf. Das AHC verweigerte diese jedoch, mit der Begründung, dass die Generalversammlung der arabischen Bitte, die Beendigung des Mandates und die Unabhängigkeitserklärung Palästinas auf die Tagesordnung zu setzen, nicht nachgekommen sei. Somit hatte die UNO schon zu Beginn ihres Engagements mit mangelnder Kooperationsbereitschaft zu kämpfen.
Das Komitee hörte die Vertreter der verschiedenen Organisationen in Palästina sowie die benachbarten arabischen Staaten an. Dabei wurde deutlich, dass sich die Juden nur mit der Schaffung eines jüdischen Staates zufrieden geben werden, dass die Araber eine Teilung Palästinas jedoch strikt ablehnten. Sie forderten einen palästinensischen Staat und sicherten zu, den Juden, die die Staatsbürgerschaft rechtmäßig erworben hatten, die gleichen Rechte zuzuteilen.
Die Komission kam zu dem Schluss, dass es keine Lösung gab, „die alle Konfliktparteien voll befriedigte.“[16] Beiden Volksgruppen waren jedoch so groß (600 000 Juden, 1 200 000 Araber) dass keine der beiden vollständig übergangen werden konnte. Die Kommission empfahl daher, dem palästinensischen Mandatsgebiet zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Unabhängigkeit zu gewähren. Die Mehrheit der UNSCOP empfahl des Weiteren die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat und schlug für Jerusalem einen Sonderstatus vor. Der Vorschlag orientierte sich in den Grundzügen an dem Peel-Plan der Briten, die vorgesehenen Grenzen hatten sich jedoch eindeutig zugunsten der Juden geändert.
Eine Minderheit (Irak, Indien, Jugoslawien) empfahl einen Bundesstaat bestehend aus einem jüdischen und einem palästinensischen Staat mit der Hauptstadt Jerusalem.
Die jüdische Seite lehnte den Minderheitsvorschlag jedoch mit dem Verweiß darauf ab, dass die Juden in dem neuen palästinensischen Staat immer noch eine Minderheit bilden würden.
3.2.Das Ad-hoc-Komitee
Nachdem das UNSCOP seine Arbeit beendet hatte bildete die Vollversammlung am 23.09.1947 das Ad-hoc-Komitee für Palästina. Das UNSCOP löste sich auf. Zuerst hörte das Ad-hoc-Komitee Vertreter der Briten, der palästinensischen Araber und der in Palästina lebenden Juden an.
Dabei erklärt der britische Staatssekretär für Kolonien, dass Großbritannien bereit sei sein Mandat niederzulegen.
Der Vertreter des Arabischen Hohen Komitees kündigte „Widerstand mit allen ihnen [palästinensischen Araber] zur Verfügung stehenden Mitteln“[17] gegen jede Art von Teilungsplan an.
Die Jewish Agency erklärte, dass sie trotz „schwerer Opfer, die diese Lösung mit sich bringe“ bereit sei den Mehrheitsbeschluss der UNSCOP zu akzeptieren.
Am 22.10.1947 gründete das Ad-hoc-Komitee zwei Subkomitees und eine Schlichtungsgruppe. Das erste Subkomitee sollte den Mehrheitsbeschluss der UNSCOP, das zweite sollte den Arabischen Vorschlag eines Einheitsstaates prüfen. Die Schlichtungsgruppe sollte eine sowohl für Juden als auch für Araber akzeptable Lösung finden. Sie kam jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis.
Am 25.11.1947 kam es zur Abstimmung über die Berichte der beiden Subkomitees, wobei der Vorschlag zur Teilung Palästinas gegen die Ablehnung der arabischen Länder eindeutig bevorzugt wurde.[18]
3.3. Der UN-Teilungsplan
3.3.1 Inhalt der Resolution 181 und des UN-Teilungsplanes
Die Generalversammlung verabschiedete am 29. November 1947 die Resolution 181 (II), die die künftige Regierungsform Palästinas regeln sollte. Für diese Resolution stimmten 33 Staaten, dagegen stimmten 13 Staaten und 10 Staaten enthielten sich ihrer Stimme.[19]
Diese Resolution empfiehlt[20] allen Mitgliedern der Vereinten Nationen „den Plan einer Teilung mit wirtschaftlicher Union.“[21] Dieser sieht die Schaffung eines jüdischen- und eines arabischen Staates sowie einen Sonderstatus für Jerusalem vor. Außerdem wird die gegenwärtige Lage in Palästina als Bedrohung für den Frieden zwischen den Nationen betrachtet.
Der Sicherheitsrat wird gebeten notwendige Maßnahmen zur Durchführung des Teilungsplanes zu ergreifen. Außerdem soll er für den Fall, dass während der Übergangszeit der Frieden gefährdet ist „gemäß den Artikeln 39[22] und 41[23] der Satzung Maßnahmen ergreifen“[24] Jeder Versuch der gewaltsamen Änderung des Teilungsplanes soll durch den Sicherheitsrat gemäß Art. 39 als Akt der Aggression verurteilt werden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
UPI/THE BETTMANN ARCHIVE
Gipfelkonferenz des UN-Sicherheitsrates
Microsoft ® Encarta ® Professional 2002. © 1993-2001 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Des weiteren wird in der Res. 181 die Bevölkerung Palästinas aufgefordert notwendige Schritte zu unternehmen um den Teilungsplan umzusetzen.
Der Teilungsplan mit Wirtschaftlicher Union gliedert sich in drei Teile: Der erste Teil beinhaltet die zukünftige Verfassung und Regierung von Palästina, der zweite Teil setzt die Grenzen fest und der Dritte regelt den Status des Stadtbezirks von Jerusalem.
Im Abschnitt A des ersten Teils wird die Beendigung des britischen Mandates sowie der Abzug der britischen Streitkräfte vor dem 1.August 1947gefordert. Die Briten sollten sich zuerst aus einem Gebiet des zukünftigen jüdischen Staates zurückziehen, das einen Seehafen und Hinterland beinhaltet. Somit sollte jüdischen Flüchtlingen die Einwanderung ermöglicht werden.
Der Abschnitt B sieht Schritte zur Vorbereitung auf die Unabhängigkeit vor. Hierzu sollte von der Generalversammlung eine Kommission, bestehend aus fünf Mitgliedern, eingesetzt werden. Diese Kommission sollte vorerst einen provisorischen regierenden Rat für die jeweiligen Staaten bilden. Außerdem sollten bis spätestens zwei Monate nach dem Abzug der britischen Streitkräfte Wahlen für eine Verfassungsgebende Versammlung stattfinden.
Die Regeln, die in Abschnitt C aufgeführt werden, sollten von den provisorischen Regierungen beider Staaten als grundlegende Gesetze anerkannt werden. Zu diesen grundlegenden Regeln gehören der freie Zugang zu religiösen Stätten sowie die Gewissens- und Religionsfreiheit. Außerdem sollte unter den Einwohnern kein Unterschied aufgrund der Rasse, der Religion, der Sprache oder des Geschlechts gemacht werden. Die Staaten sollten den jeweiligen jüdischen bzw. arabischen Minderheiten Schulbildung in der eigene Sprache und Tradition gewährleisten. Die Staatsbürgerschaft für die neuen Staaten sollten außer den in den Staatsgebieten ansässigen palästinensischen Staatsbürgern auch Araber und Juden erhalten, die in dem neuen Staatsgebiet leben, aber noch keine palästinensische Staatsbürgerschaft haben. Über 18-jährige arabische oder jüdische Staatsbürger, die als Minderheit in einem der beiden Staaten leben, dürfen innerhalb eines Jahres ihre Staatsbürgerschaft wechseln. Um die neu geschaffenen Staaten wirtschaftlich überlebensfähiger zu gestalten, war für sie eine Wirtschaftsunion vorgesehen. Deren Ziel waren, wie in Abschnitt D erklärt wird, eine Zollunion, ein gemeinsames Währungssystem, der gemeinsame Betrieb von Kommunikationseinrichtungen und Transportwegen sowie eine „gleichberechtigte Nutzung von Wasser- und Energieanlagen für beide Staaten und den Stadtbezirk Jerusalem.“[25]
Der zweite Teil des Teilungsplan besteht aus einer detaillierten Beschreibung der Grenzen. Danach sollte der arabische Staat etwa 11 000 km² , der jüdische 14 900 km² und das internationale Gebiet etwa 530 km² umfassen. Die zur Entstehungszeit des Planes vorherrschende Besiedlung wurde bei der Grenzziehung berücksichtigt (s. Karte)
In dem Gebiet des vorgesehen Arabischen Staates wohnten 725 000 Araber und 10 000 Juden, in dem Gebiet des vorgesehenen jüdischen Staates wohnten 498 000 Juden und 407 000 Araber. Im internationalen Gebiet Jerusalem lebten 105 000 Araber und 100 000 Juden.
Im dritten Teil des Teilungsplan wird der Status des Internationalen Gebiets von Jerusalem beschrieben. Es sollte unter der Verwaltung des UN-Treuhänderrats[26] stehen und über eine demokratisch gewählte Legislative verfügen. Nach spätestens zehn Jahren sollte der Plan vom Treuhänderrat nochmals überprüft werden.
3.3.2. Gründe für das Zustandekommen des UN-Teilungsplans
Die Juden akzeptierten im Gegensatz zu den Arabern den Teilungsplan der UNO. Dies legt die Vermutung nahe, dass dieser Teilungsplan eher zu Gunsten der jüdischen Bevölkerung ausgefallen war. Bestätigt wird die Vermutung durch folgende Fakten:
- Die Schaffung eines jüdischen Staates wurde von den Arabern strikt abgelehnt, trotzdem war nach dem Teilungsplan ein solcher Staat vorgesehen.
- Der Teilungsplan enthielt Maßnahmen um die schnelle Einwanderung jüdischer Flüchtlinge zu ermöglichen. Dies widersprach der arabischen Forderung nach einem Stopp der jüdischen Einwanderung
- Obwohl die jüdische Bevölkerung im Jahre 1947 nur etwa 32% der Bevölkerung bildeten und nur 5,6% des palästinensischen Bodens in zionistischem Besitz war, erhielten die Juden nach dem Teilungsplan 56% des Landes. Außerdem erhielten sie den landwirtschaftlich wertvollsten Boden und sogar Gebiete, „in denen sie nur 1% der Bevölkerung bildeten.“[27]
- Im Gegensatz zum britischen Teilungsplan (Peel-Plan) war den Juden im UN-Teilungsplan ein weitaus größerer Teil Palästinas zugedacht.
Somit stellt sich die Frage, warum die internationale Politik den Wünschen der Juden zu dieser Zeit so freundlich gesinnt war?
Als bedeutendster Faktor sind hier die Ereignisse des zweiten Weltkriegs zu nennen. Und dies sogar in dreifacher Hinsicht.
Durch die Katastrophe, die mit dem Holocaust über das jüdische Volk hereingebrochen war, hatten die Juden eindeutig die Sympathie der internationalen Politik gewonnen. Außerdem hatte die Politik Nazi-Deutschlands „gezeigt, wie nötig ein Judenstaat war“[28] und lieferte außerdem ein hervorragendes Argument gegen einen Einheitsstaat, in dem die Juden wiederum nur eine Minderheit gewesen wären.
Die Araber hingegen hatten durch ihre Zusammenarbeit mit Hitler ihr internationalen Sympathien verloren. So hatte zum Beispiel der ehemalige Präsident des Arabischen Hohen Komitees von Hitler gefordert, Tel Aviv zu bombardieren um das palästinensische Judentum zu treffen.
Außerdem ließ die Frage der jüdischen Flüchtlinge die Palästinafrage zu einem drängenden Problem werden. Die durch den Holocaust vertriebenen Juden benötigten eine neue Heimat und illegale jüdische Einwanderer waren von den Engländern sogar wieder in ein ehemaliges deutsches KZ gebracht worden.
Auch die Haltung der Sowjetunion war, im Gegensatz zu späteren Zeiten, nach dem zweiten Weltkrieg sehr pro-zionistisch. Auf der einen Seite, weil die zionistische Bewegung gegen die englische Mandatsmacht gerichtet und somit antiimperialistisch war, auf der anderen Seite waren auch die Sowjets von der arabischen Kooperation mit Hitler sehr enttäuscht.
In den Vereinigten Staaten, in den es eine relativ große jüdische Bevölkerung gab, hatten die Zionisten eine gute Lobby. Es gelang ihnen somit die amerikanische Sympathie für einen jüdischen Staat zu gewinnen.
So war die Resolution 181(II) eine der wenigen Entscheidungen, in denen sich die USA und die Sowjetunion einig waren.
4. Folgen des Teilungsplans
4.1. Reaktionen auf den Teilungsplan
Schon kurz nach dem Teilungsbeschluss kam es in Palästina zu gewaltsamen Auseinandersetzungen die sich bald zu einem Bürgerkrieg ausweiteten. An den Auseinandersetzungen waren neben jüdischen und palästinensisch-arabischen Milizen auch „irreguläre und reguläre Armee-Einheiten der arabischen Staaten“[29] beteiligt.
Die palästinensische und arabische Seite hatten zuvor den Teilungsplan abgelehnt und ihn für unrechtmäßig erklärt. Die Teilung stände im Widerspruch zum Palästinamandat und zum Völkerrecht, da sie gegen den Willen der Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung gerichtet war. Die jüdische Flüchtlingsfrage sei ein internationales Problem und nicht mit der Palästinafrage verbunden. Alle Länder sollten eine bestimmte Quote von Flüchtlingen aufnehmen, die von der Generalversammlung festgelegt werden sollte. Statt der Teilung sollte ein palästinensischer Einheitsstaat entstehen, da dies dem Wunsch der Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung und somit auch den Zielen der UNO entspräche.
Im Januar nahm die UN-Durchführungskommission ihre Arbeit auf und begann mit der Planung für die vorläufige Regierung des jüdischen Staates. Die arabische Seite hatte ihre Zusammenarbeit verweigert und begann mit der Errichtung einer Regierung für ganz Palästina.
Die UN-Durchführungskommission warnte in ihrem ersten Bericht an den Sicherheitsrat im Februar 1948 davor, dass nach der Beendigung des britischen Mandats „die Gefahr einer Katastrophe“[30] bestände. Daher setzte sie sich für eine „schrittweise Übergabe der Regierungsverantwortung, eine sofortige Einwanderungserlaubnis für Juden und die Schaffung von Milizen“[31] ein. In ihrem zweiten Bericht erklärte sie, dass zur Aufrechterhaltung des Rechts und der Ordnung militärische Kräfte notwendig seien, die den Teilungsbeschluss durchsetzen.
Diese von der Kommission geforderten militärischen Kräfte wurden vom Sicherheitsrat jedoch nie entsandt, obwohl dies laut Artikel 42 der UN-Charta möglich gewesen wäre. Eine solche Entsendung hätte durchaus Vorteile gebracht, denn in der derzeitigen Situation war nicht mit einem Überleben des jüdischen Staates gegen die drohende arabische Übermacht zu rechnen. Außerdem hätten UN-Truppen wahrscheinlich die jüdischen Annexionen nach dem Unabhängigkeitskrieg verhindern können.
Eine Vielzahl von Faktoren verhinderte die Entsendung jedoch: Die arabischen Staaten erklärten, dass sie die gegenwärtige Lage in Palästina als Bürgerkrieg betrachteten und nur militärisch aktiv würden, wenn andere Staaten eingreifen würden. Damit war das Entsenden von UNO-Truppen mit einer akuten Kriegsgefahr verbunden, was wohl in keiner der von zweiten Weltkrieg schockierten Bevölkerungen Zustimmung gefunden hätte.
Auch war in der Resolution 181 kein direkter Hinweis auf die mögliche Anwendung des Artikels 42, jedoch wurden bei der Bedrohung des Friedens (die ja offensichtlich bestand) die Anwendung des Artikels 39 gefordert. Dieser Artikel 39 wiederum verweist unter anderem auf Artikel 42.
Zum dritten gaben die Britten bekannt, dass sie sich an keinem Beschluss beteiligen würden, „der einen Zwang auf eine der Volksgruppen ausübe.“[32] Sie waren somit nicht gewillt für eine der beiden Seiten Partei zu ergreifen und die Generalversammlungsresolution, die nur empfehlenden Charakter hatte, durch eine Sicherheitsresolution zwingend durchzusetzen. Am 27. Februar erklärten die Briten, dass sie ihr Mandat bis zum 15.Mai niederlegen würden.
Die amerikanische Regierung machte im Laufe der Debatte im Sicherheitsrat den Vorschlag ganz Palästina in ein UN-Treuhandgebiet umzuwandeln. Dieser Vorschlag wurde von der jüdischen Seite heftig kritisiert und von der sowjetischen Seite mit dem Vorwurf abgelehnt, die Amerikaner verfolgten nur ihre eigenen Ölinteressen.
Am 12. April wurde in Tel Aviv eine provisorische Regierung unter dem Vorsitz des zukünftigen israelischen Ministerpräsidenten David Ben Gurion gebildet.
Am 14.Mai 1948 um 16:00 Uhr rief der Vorsitzende der provisorischen Regierung den Staat Israel aus. Kurz darauf wurde Israel von den USA und der Sowjetunion anerkannt.
Die Briten erklärten am 14. Mai um Mitternacht das britische Mandat offiziell für beendet. Zur gleichen Zeit marschierten ägyptische, transjordanische, irakische, syrische und libanesische Truppen in das ehemalige Mandatsgebiet ein. Offiziell handelte es sich nicht um eine kriegerische Aktion sondern um eine Polizeiaktion, die den arabischen Palästinensern Sicherheit in den ihnen zugesprochenen Teilen garantieren sollte. Die Reden der arabischen Führer ließen jedoch keinen Zweifel daran, dass das Ziel der Aktion die Vernichtung des neuen jüdischen Staates war. Somit war der erste Nahostkrieg oder der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen.
4.2. Der Unabhängigkeitskrieg
Der Unabhängigkeitskrieg verlief gewissermaßen in drei Phasen, die jeweils durch Waffenstillstände voneinander getrennt wurden.
Die erste Phase vom 15. Mai bis zum 11. Juni war von der israelischen Defensive und dem arabischen Vormarsch geprägt. Die israelische Lage war denkbar ungünstig, da Israel zum Zeitpunkt des Kriegsausbruch nicht einmal über eine gemeinsame Armee verfügte, geschweige denn über eine Luftwaffe oder schwere Geschütze. So eroberten libanesische Truppen arabisch bewohnte Gebiete in Obergaliläa und marschierten syrische Truppen von Nordosten ins Jordan-Tal und überquerten den Jordan. Von Osten stießen irakische Truppen Richtung Yenin und Nazareth vor und von Süden drangen die Ägypter fast nach Tel Aviv vor und trennten den Negev vom Rest Israels ab. Arabischen Legionen gelang es das jüdische Viertel der Jerusalemer Altstadt einzunehmen. Dass die Israelis nicht schon in dieser Phase von den Arabern vernichtet wurden liegt auf der einen Seite an der schlechten Moral und Koordination der arabischen Streitkräfte und zum anderen an dem israelischen Mut der Verzweiflung. Schon vor Kriegsbeginn gab es Verhandlungen zwischen Israel und Transjordanien, die beide gegen die Internationalisierung Jerusalems waren. So waren sie sich über die „Aufteilung Palästinas im Grunde bereist vor dem Ausbruch des regulären Krieges einig“[33]
Bereits am 22. Mai 1948 hatte der Sicherheitsrat alle Konfliktparteien dazu aufgefordert binnen 36 Stunden „den Befehl zur Feuereinstellung zu geben.“[34] Die Waffenruhe trat jedoch erst am 11. Juni ein, nachdem es den Israelis gelang, mit ihren ersten Flugzeugen die Lufthoheit zu erringen. Der Waffenstillstand lief am 7. Juli aus. Trotz des Apells des Sicherheitsrats, die Waffenruhe zu verlängern, brachen die Kämpfe am 8. Juli erneut aus.
In dieser zweiten Phase gelang es den Israelis Lydda, Ramela und Nazareth zu erobern. Außerdem konnte die Verbindung zwischen Tel Aviv und Jerusalem wieder aufgebaut werden.
Am 15. Juli 1948 verabschiedete der Sicherheitsrat zum ersten Mal eine Resolution, in der er die Lage in Palästina als „eine Bedrohung des Friedens im Sinne von Artikel 39 der VN-Charta“[35] bezeichnet. Außerdem befiehlt der Sicherheitsrat in Berufung auf Artikel 40[36] die Feuereinstellung zu einem vom UN-Vermittler festgelegten Zeitpunkt. Er erklärt, dass bei einer Nichtbeachtung der Resolution eine Bedrohung des Friedens gemäß Artikel 39 vorliege, und droht in diesem Falle Konsequenzen nach Kapitel VII der Charta an. In diesem Kapitel ist der Einsatz von Waffengewalt und von Sanktionen zur Wahrung des Weltfriedens geregelt. Daraufhin konnte am 18.Juli ein Waffenstillstand erreicht werden, der nach Wünschen der UNO nicht zeitlich begrenzt sein und bis zu Friedensverhandlungen dauern sollte. Im September reiste der UNO Vermittler Graf Folke Bernadotte nach Jerusalem um Friedensverhandlungen aufzunehmen. Nach seiner Ansicht war der Teilungsplan nicht mehr zu verwirklichen und er war der Meinung, dass weder ein jüdischer noch ein arabischer Staat lebensfähig war. Er schlug deshalb vor, „den arabischen Teil zu Transjordanien zu schlagen und den jüdischen Teil in einer Staatenkonföderation mit Transjordanien aufgehen zu lassen.“[37] Sein Plan wurde sowohl von den Juden als auch von den Arabern kategorisch abgelehnt. Am 17. September wurde er von rechten israelischen Kräften in Jerusalem ermordet.
Trotz des geplanten unbefristeten Waffenstillstands brachen die Kämpfe im Oktober 1948 wieder aus. Diese dritte und letzte Phase des Nahostkriegs war vom jüdischen Vormarsch geprägt. Die israelischen Truppen überquerten im Norden die libanesische Grenze, durchbrachen den ägyptischen Korridor und stießen selbst auf ägyptisches Gebiet vor. Da England mit Ägypten ein Verteidigungsbündnis hatte, drohte es in den Krieg einzutreten. Nachdem der Sicherheitsrat am 22.Dezember erneut beide Seiten dazu aufforderte, das Feuer einzustellen, kam es zum israelischen Rückzug aus den ägyptischen Gebieten und zu Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Israel und Ägypten im Januar des Jahres 1948. Es folgten Waffenstillstandsverträge mit dem Libanon (März), Transjordanien (April) und Syrien (Juli). Damit war der Unabhängigkeitskrieg beendet.
4.3. Folgen des Unabhängigkeitskrieges
Das Ergebnis des Unabhängigkeitskrieges bedeutete das Scheitern für den UN-Teilungsplan. Zwar war mit der Gründung Israels ein wichtiger Punkt erfüllt worden, andere wichtige Punkte, wie die Schaffung eines arabischen Staates und die Schaffung eines internationalen Status für Jerusalem gingen jedoch nicht in Erfüllung. Ali Rahal meint dazu: „...ihr [UN res. 181] eigentlicher Wert bestand in ihrer Komplexität, mit der ein Ausgleich zwischen den Konfliktparteien herbeigeführt werden sollte.“[38] Eine nachträgliche Erfüllung des Teilungsplanes wurde durch die Annexionen Israels und Jordaniens verhindert. Israel vergrößerte sein Staatsgebiet um mehr als ein Drittel auf etwa 20 700 km². Das restliche Gebiet des vorgesehenen arabischen Staates nahm sich Jordanien. Auch Jerusalem, dem der Teilungsplan einen internationalen Sonderstatus zugedacht hatte, wurde zwischen Israel und Jordanien aufgeteilt.
Das Ergebnis des Unabhängigkeitskrieges warf jedoch auch neue Fragen auf, bzw. gab alten Fragen ein neues Gesichte.
4.3.1. Die Flüchtlingsfrage
Die palästinensischen Flüchtlinge stellen bis heute ein ungelöstes Problem des Nahostkonfliktes dar. Das Flüchtlingsproblem ist zum Großteil eine Folge des Unabhängigkeitskrieges. In den Jahren 1948/49 floh eine riesige Anzahl von Palästinensern aus den israelisch gewordenen Gebieten. Die Zahlen schwanken je nach Quelle erheblich (zwischen 500 000 und höchstens 600 000 Flüchtlingen bei israelischen Angaben bis zu arabischen Angaben zwischen 800 000 und einer Million[39] ). Auch die Gründe für die Flucht sind umstritten. Während Araber behaupten, dass die Palästinenser von den Israelis systematisch und gewaltsam vertrieben wurden oder sich von zionistischen Terroristen bedroht fühlten, behaupten Israelis, dass die Palästinenser den jüdischen Staat freiwillig verlassen haben oder dem Aufruf arabischer Führer gefolgt waren, die eine Evakuierung der Kampfgebiete gefordert hatten. Es herrscht auch keine Einigkeit darüber unter welchem Gesichtspunkt man das Flüchtlingsproblem betrachtet: wird das Flüchtlingsproblem als rein humanitäres Problem angesehen reicht es zu seiner Lösung, den Flüchtlingen eine ausreichende humanitäre Versorgung zu gewähren, wird es jedoch als politisches Problem angesehen so kann das Problem nur gelöst werden, wenn die Flüchtlinge in ihre alte Heimat zurückkehren dürfen oder zumindest eine neue Heimat finden.
Bereits im August 1948 startete die UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund) eine Hilfsaktion und sammelte für die palästinensischen Flüchtlinge 16,5 Millionen Dollar.[40] Im November 1948 billigte die Generalversammlung einen Beschluss,der 29,5 Millionen Dollar für die Palästinaflüchtlinge bereitstellte.[41] Am 11. Dezember 1948 beschließt die Generalversammlung in ihrer Resolution 194(III), dass „denjenigen Flüchtlingen, die zu ihrer Wohnstätte zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden soll.“[42] Diejenigen, die nicht zurückkehren wollten, oder deren Eigentum beschädigt wurde, sollten dafür nach internationalem Recht entschädigt werden.
Am 17. Dezember wurde in Genf außerdem ein Abkommen über eine Hilfsaktion für Palästinaflüchtlinge getroffen, demzufolge die UNO die verschiedenen Hilfeleistungen koordiniert.
Am 8. Dezember gründete die Generalversammlung mit ihrer Resolution 302 (IV) die UNRWA (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East). Finanziert wurde die UNRWA hauptsächlich durch freiwillige Beiträge verschiedener Staaten, zum Großteil durch Beiträge der USA, von Großbritannien und Kanada (zusammen etwa 90% des Gesamtetats)[43]. Die UNRWA war in der Zeit nach dem Unabhängigkeitskrieg vor allem mit der Verteilung von Lebensmitteln, der Schaffung von Unterkünften und der Erziehung und Ausbildung der Flüchtlinge beschäftigt.
Die Flüchtlinge wurden in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt und erhielten je nach Kategorie das Recht auf Lebensmittelrationen, Schulungen oder sonstige Dienste. Die Lebensmittelverteilungen der UNO waren zwar positiv, da aber frisches Fleisch und Obst fehlten, kam es bei vielen Flüchtlingen zu Mangelerscheinungen.
Da die meisten Flüchtlinge auf ihrer Flucht nichts mitgenommen hatten hausten viele von ihnen nach ihrer Flucht in Höhlen, Zelten oder Bretterbuden. Die UNRWA errichtete Lager in denen die Flüchtlinge eine Unterkunft finden sollten. Zuerst bestanden diese Lager nur aus Zelten, später errichteten die Flüchtlinge mit der Hilfe der UNRWA eigene Häuser aus Lehm oder Beton. Andere Häuser wurden von der UNRWA alleine errichtet. Die meisten Lager verfügten neben den Häusern über eine Lebensmittelausgabestelle, eine Klinik und eine oder mehrere Schulen. Durch den gemeinsamen Kampf der UNRWA und der WHO (Weltgesundheitsorganisation) gegen Krankheiten in den Lagern konnten die Malariafälle drastisch gesenkt werden. Die Lager wurden von einem Lagerdirektor verwaltete, der selbst Flüchtling war und von der UNRWA ausgesucht wurde.
In Zusammenarbeit mit der UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Oraganisation) unterrichtete die UNRWA über 150 000 Flüchtlinge, ab 1954 ging sie jedoch zur Subventionierung der Schüler über um den Etat der UNRWA zu entlasten. Sie legte dazu einen Betrag von 40 Dollar pro Schüler und Jahr fest, den die unterrichtende Institution erhielt. Die besten Schüler erhielten von der UNRWA Stipendien, die ihnen ein Studium an einer Universität in den Gastländern oder in benachbarten Ländern ermöglichte. Außerdem bildete die UNRWA zahlreiche Flüchtlinge in Fach- und Gewerbeschulen zu qualifizierten Arbeitskräften aus.
Somit gelang es der UNO zwar nicht, durch ihre Resolutionen eine endgültige und gerechte Lösung der Flüchtlingsfrage zu erreichen, durch ihre humanitäre Hilfe konnte sie jedoch das Leid der Flüchtlinge mildern.
4.3.2. Die Territorialfrage
Zwar konnte nach dem Unabhängigkeitskrieg mit allen benachbarten Staaten ein Waffenstillstandsvertrag geschlossen werden, der von Israel erwünschte Friedensvertrag mit den Nachbar blieb jedoch aus. Auch bleiben die israelischen Grenzen trotz der deutlichen Gebietsgewinne im Unabhängigkeitskrieg im Falle eines erneuten arabischen Angriffs fast nicht zu verteidigen. Dies liegt zum einen an der sehr langen Grenze und zum anderen am fehlenden Rückzugsraum. In den Waffenstillstandsverträgen war außerdem ausdrücklich erwähnt worden, dass die Waffenstillstandslinien keine endgültigen Grenzen sind. Die Israelis lebten also in nicht anerkannten Grenzen und somit in ständiger Angst vor einem erneuten Angriff.
4.3.3. Die Jerusalemfrage
Eine Internationalisierung Jerusalems wäre wohl die gerechteste Lösung gewesen, was vielleicht gerade dadurch deutlich wird, dass sie von beiden Konfliktparteien abgelehnt wurde. Obwohl eine Internationalisierung Jerusalems nach dem Waffenstillstandsvertrag zwischen Israel und Jordanien, in dem Jerusalem zwischen den zwei Staaten praktisch aufgeteilt wurde, nahezu illusorisch geworden war bemühte sich die UNO weiterhin eine Internationalisierung zu erreichen. Im Januar 1950 wurde Jerusalem die neue Hauptstadt Israel. Der derzeitige Ministerpräsident David Ben Gurion berief sich hierbei darauf, dass Jerusalem seit König David die Hauptstadt Israels sei. Daher folgte Israel auch nicht den Aufforderungen des Treuhänderrats, „die Verlegung israelischer Dienststellen nach Jerusalem rückgängig zu machen.“[44] Auch weitere Vorschläge und Forderungen des Treuhänderrats wurden sowohl von israelischer als auch von jordanischer Seite abgelehnt. Somit lag es erneut an dem Widerstand der beteiligten Konfliktparteien und auch an der militärischen Ohnmacht der UNO, dass die beste und gerechteste Lösung eines Teilproblems nicht umgesetzt werden konnte.
5. Fazit
Fakt ist, dass der UN-Teilungsplan sowie auch andere zentrale Forderungen der UNO, wie die Internationalisierung Jerusalems und die Rückkehr der Flüchtlinge nicht erfüllt wurden. Daraus jedoch ein Versagen der UNO abzuleiten halte ich für falsch. Wie schon anfangs erwähnt, war das Palästinaproblem keine Streitfrage, bei der es möglich war, Kompromisse durch Verhandlungen herbeizuführen, sondern ein Konflikt in dem die Konfliktparteien unverrückbare vollkommen entgegengesetzte Standpunkte vertraten. Somit gab es keine gerechte Lösung, die die Kernforderungen beider Seiten erfüllte. Ein weiteres Problem, das die Lösung des Nahostkonflikts so schwer macht, liegt darin, dass sich beide Seiten auf Besitzansprüche aus vollkommen unterschiedlichen Zeiten berufen. Auch die fehlende militärische Macht der UNO kann nicht als alleiniger Grund dafür sein, dass es nicht gelang eine dauerhaft friedliche Lösung zu finden; auch den Briten, mit ihrer großen militärischen Macht gelang es während ihrer Mandatszeit nicht, eine friedliche Lösung zu erreichen.
Dass der Teilungsplan aus heutiger Sicht durchaus eine akzeptable Lösung gewesen wäre zeigt sich daran, dass sich heute ausgerechnet die Palästinenser auf den Teilungsplan berufen obwohl sie diesen anfangs generell abgelehnt hatten.
Vor allem die Hilfe der UNO für die Palästinaflüchtlinge zeigt jedoch, dass die UNO auch Stärken besitzt, vor allem, wenn es darum geht humanitäre Hilfe zu leisten und zu koordinieren.
Die Tatsache, dass die UNO sich auch heutzutage noch ausgiebig mit dem Nahostkonflikt beschäftigt zeigt, dass die Hoffnung auf eine friedliche Lösung noch nicht gestorben ist. Auch in zukünftigen Friedensverhandlungen kann die UNO mit ihren Resolutionen eine wichtige Rolle spielen. Der Schlüssel zu einem gerechten Frieden liegt jedoch ganz alleine in den Händen beider Konfliktparteien. Sie müssen durch den Verzicht auf bestimmte Forderungen einen Kompromiss ermöglichen, die UNO kann nur dabei behilflich sein diesen zu finden.
Quellen und Literaturverzeichnis
Bauer, Kirsten: 50 Jahre Israel, München 1998
Hartung, Arnold (Hrsg.): Die VN-Resolutionen zum Nahostkonflikt, Berlin 1978
Hartung, Arnold (Hrsg.): Die VN-Resolutionen zum Nahostkonflikt. Band 2, Berlin 1999
Jendges, Hans: Der Nahostkonflikt, Berlin 1996
Krautkrämer, Elmar: Israel und Nahost, Frankfurt am Main 1980
Krupp, Michael: Die Geschichte des Staates Israel. Von der Gründung bis heute, Gütersloh 1999
Microsoft Encarta Professional 2002
Rahal, Ali: Die Rolle der Organisation der Vereinten Nationen im Nahostkonflikt – Stellungnahmen, Aktivitäten Erfahrungen, Berlin 1993
Rotter, Gernot / Fathi, Schirin: Nahostlexikon. Der israelisch-palästinensische Konflikt von A-Z, Heidelberg 2001
[...]
[1] Rahal, Ali S.22
[2] Rahal Ali, S.9
[3] Rahal Ali, S.8
[4] Rahal Ali, S.8
[5] Microsoft Encarta Professional 2002, Jewish Agency for Paklastine
[6] Bauer Kirsten, 50 Jahre Israel, 1998 München, S.13
[7] Rahal, Ali S.10
[8] Dr. Weizmann Präsident der Jewish Agency for Palastine und der zionistischen Organisation
[9] Mufti von Jerusalem
[10] Rahal, Ali S.16
[11] Ägypten, Irak, Libanon, Syrien, Saudi-Arabien
[12] Rahal, Ali S.16
[13] Afghanistan, Ägypten, Irak, Libanon, Saudi-Arabien, Syrien, Türkei
[14] Harttung, Arnold Bd.1 S.24
[15] Harttung, Arnold Bd.1 S.24
[16] Rahal, Ali S.19
[17] Rahal, Ali S.21
[18] Bericht Sukomitee I (Teilung Palästinas): 25 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen, 17 Enthaltungen
Bericht Subkomitee II (Einheitsstaat): 16 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 23 Enthaltungen
[19] Ergebnis:...
[20] die Resolutionen der Generalversammlung haben lediglich empfehlenden Charakter und sind im Gegensatz zu denen des Sicherheitsrates nicht bindend
[21] Hartung, Arnold Bd.1 S.26
[22] Der Artikel 39 ermächtigt den Sicherheitsrat festzustellen, ob der Frieden bedroht ist, oder ob eine Angriffshandlung vorliegt. In diesem Falle kann er Empfehlungen geben oder Maßnahmen nach Art.41 oder Art.42 (beinhaltet die Anwendung militärischer Gewalt) anordnen.
[23] Der Artikel 41 ermächtigt den Sicherheitsrat zur Durchsetzung seiner Beschlüsse Sanktionen zu verhängen.
[24] Hartung, Arnold Bd.1 S.26
[25] Hartung, Arnold Bd.1 S.38
[26] Aufgabe des UN-Treuhänderrat war bis 1994 die Aufsicht sowie die Verwaltung der Treuhandgebiete die der UNO unterstellt waren. 1994 wurde Palaus als letztes Treuhandgebiet in die Unabhängigkeit entlassen.
[27] Rahal, Ali S.29
[28] Krupp, Michael S.7
[29] Krupp, Michael S.12
[30] Rahal, Ali S.26
[31] Rahal, Ali S.26
[32] Rahal, Ali S.27
[33] Krupp, Michael S.14
[34] Hartung, Arnold S.68
[35] Hartung, Arnold S.70
[36] In Artikel 40 der UN-Charta wird der Sicherheitsrat ermächtigt, bei einer Bedrohung des Friedens, die Konfliktparteien dazu aufzufordern gewisse vorläufige Maßnahmen zu befolgen.
[37] Krupp, Michael S.17
[38] Rahal, Ali S.34
[39] Jendges, Hans S.80
[40] Rahal, Ali S.45
[41] Rahal, Ali S.45
[42] Harttung, Arnold Bd.1 S.84
[43] Rahal, Ali S.57
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Dokuments?
Das Dokument ist eine umfassende Analyse der Palästinafrage und der Rolle der Vereinten Nationen (UNO) bei der Lösung des Konflikts, insbesondere in der Zeit um die Staatsgründung Israels im Jahr 1947 und den darauffolgenden Unabhängigkeitskrieg. Es behandelt die Bemühungen der UNO zur Teilung Palästinas, die Reaktionen darauf und die Folgen des Unabhängigkeitskrieges, einschliesslich der Flüchtlingsfrage, Territorialfrage und der Jerusalemfrage.
Was waren die politischen Verhältnisse in Palästina vor 1947?
Vor 1947 gab es einen wachsenden Konflikt zwischen den zionistischen Bestrebungen nach einem jüdischen Staat und dem arabischen Nationalismus, der die Befreiung arabischer Gebiete von Fremdherrschaft anstrebte. Die jüdische Bevölkerung wuchs durch Einwanderung, was zu Spannungen mit der arabischen Bevölkerung führte. Das britische Mandat über Palästina sah die Schaffung einer „nationalen Heimstätte für Juden“ vor, was die Situation weiter komplizierte.
Welche Rolle spielte die UNO bei der Lösung der Palästinafrage?
Die UNO spielte eine entscheidende Rolle, indem sie das UNSCOP (United Nations Special Committee on Palestine) gründete, das die Teilung Palästinas empfahl. Die Generalversammlung verabschiedete die Resolution 181 (II), den UN-Teilungsplan, der die Schaffung eines jüdischen und eines arabischen Staates sowie einen Sonderstatus für Jerusalem vorsah. Die Bemühungen der UNO wurden jedoch durch mangelnde Kooperationsbereitschaft der Konfliktparteien und die anschließenden Ereignisse des Unabhängigkeitskriegs behindert.
Was war der UN-Teilungsplan (Resolution 181)?
Der UN-Teilungsplan, verabschiedet durch Resolution 181 (II), empfahl die Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat mit einer Wirtschaftsunion. Jerusalem sollte einen Sonderstatus erhalten und unter UN-Verwaltung stehen. Der Plan enthielt auch Bestimmungen für die Beendigung des britischen Mandats und den Abzug der britischen Streitkräfte.
Wie reagierten die Parteien auf den Teilungsplan?
Die jüdische Seite akzeptierte den Teilungsplan, obwohl sie ihn als „schwere Opfer“ ansah. Die arabische Seite lehnte den Plan strikt ab und erklärte ihn für unrechtmäßig, da er gegen den Willen der Mehrheit der palästinensischen Bevölkerung gerichtet sei.
Was waren die Folgen des Unabhängigkeitskriegs?
Der Unabhängigkeitskrieg führte zum Scheitern des UN-Teilungsplans in seiner Gesamtheit. Israel vergrößerte sein Staatsgebiet, während das verbleibende Gebiet des geplanten arabischen Staates von Jordanien annektiert wurde. Die Jerusalemfrage blieb ungelöst, und das palästinensische Flüchtlingsproblem entstand, was bis heute ein zentrales Element des Nahostkonflikts darstellt.
Was war die Flüchtlingsfrage und wie ging die UNO damit um?
Die Flüchtlingsfrage entstand durch die Vertreibung oder Flucht von Palästinensern aus den israelisch gewordenen Gebieten während des Unabhängigkeitskriegs. Die UNO gründete die UNRWA (United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East), um humanitäre Hilfe zu leisten, Unterkünfte zu schaffen und die Erziehung und Ausbildung der Flüchtlinge zu fördern. Die Resolution 194 (III) der Generalversammlung forderte das Rückkehrrecht der Flüchtlinge, wurde jedoch nicht umgesetzt.
Was waren die Gründe für das Zustandekommen des UN-Teilungsplans?
Mehrere Faktoren trugen zum Zustandekommen des UN-Teilungsplans bei, darunter die Sympathie für das jüdische Volk nach dem Holocaust, die Notwendigkeit einer Lösung für die jüdische Flüchtlingsfrage, die pro-zionistische Haltung der Sowjetunion und der Einfluss der zionistischen Lobby in den Vereinigten Staaten.
Was waren die Bemühungen um die Jerusalemfrage?
Die UNO versuchte, Jerusalem zu internationalisieren, um einen gerechten Status für die Stadt zu gewährleisten. Dieser Plan wurde jedoch durch die Annexion Jerusalems durch Israel und Jordanien sowie den Widerstand beider Konfliktparteien verhindert.
Was ist das Fazit des Dokuments bezüglich der Rolle der UNO?
Das Dokument kommt zu dem Schluss, dass die UNO trotz des Scheiterns bei der Umsetzung des Teilungsplans und anderer zentraler Forderungen eine wichtige Rolle im Nahostkonflikt spielte. Insbesondere die humanitäre Hilfe für die Palästinaflüchtlinge wird als Stärke der UNO hervorgehoben. Die Hoffnung auf eine friedliche Lösung besteht weiterhin, und die UNO kann auch in zukünftigen Friedensverhandlungen eine wichtige Rolle spielen.
- Citation du texte
- Tobias Weich (Auteur), 2003, Die Rolle der UNO im Nahostkonflikt - Zur Zeit der Staatsgründung und des Unabhängigkeitskrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108503