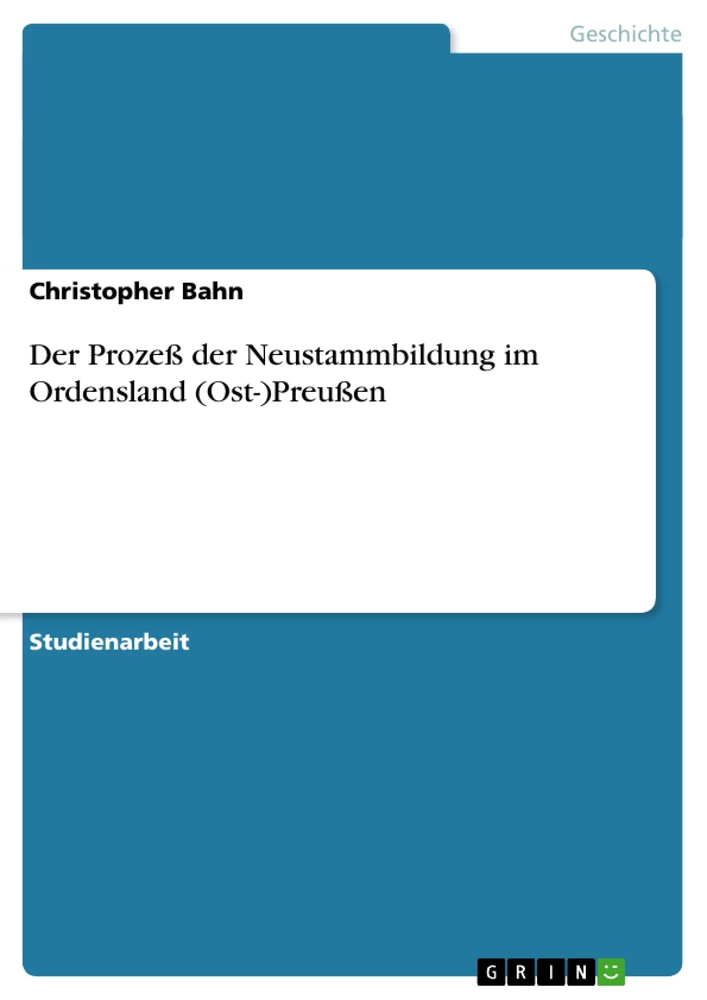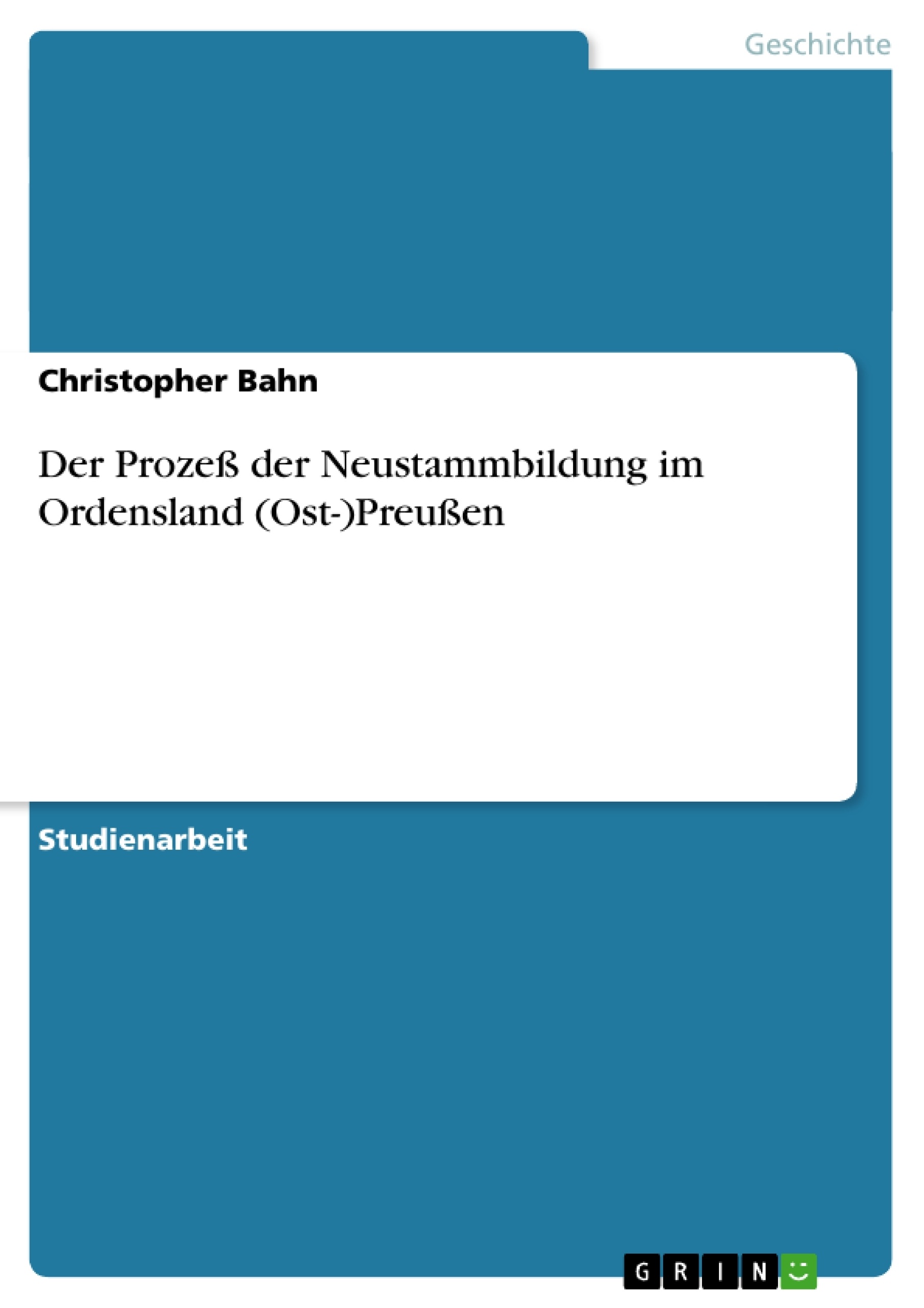1. Einleitung
Der Ordensstaat (Ost-)Preußen gehörte sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart zu den am kontroversesten diskutierten Themen der deutschen respektive polnischen Geschichtsschreibung.1 Insbesondere von deutscher Seite wird dem Deutschen Orden bei der Eroberung Ostpreußens häufig eine fast historische Mission unterstellt, der das in seiner Entwicklung rückständige Volk der Pruzzen in den kulturellen Bereich der romanisch-westeuropäischen Christenheit integriert habe. Dabei wird v.a. der Einführung einer modernen Agrarverfassung ein außergewöhnliches Gewicht beigemessen, mit der die Pruzzen im positiven Sinne kolonisiert worden sein im Sinne einer Teilhabe an dem vorherrschenden kulturellen und technischen Fortschritt.2 Andererseits stellt sich in der polnischen Geschichtsschreibung die Annektion des Pruzzenlandes häufig als ein geradezu barbarischer Akt dar, dem der überwiegende Teil der pruzzischen Bevölkerung zum Opfer fiel. Die Herrschaft des Deutschen Ordens erscheint hier als eine auf deutschem Überlegenheitsgefühl basierende Unterdrückung der anderssprachigen Untertanen.3 Während hingegen bis in die 70er Jahre hinein zumindest in der populären Literatur extreme Thesen von einer Ausrottungs- und Germanisierungspolitik des Ordens einerseits bis zu einer Zivilisierung der unterentwickelten Pruzzen andererseits aufgestellt worden waren, so hat doch in jüngerer Zeit in der wissenschaftlichen Forschung ein gewisser Prozeß der Versachlichung und damit auch der Annäherung eingesetzt, in dem z.T. jedoch noch nationale Differenzierungen zu beobachten sind.4 Ohne schon an dieser Stelle die Vorgehensweise und Politik des Deutschen Ordens beurteilen zu wollen, erscheint doch die z.Zt. vorherrschende differenzierte und ausgewogene Einschätzung den historischen Ereignissen am ehesten gerecht zu werden. Die bei der Eroberung und Besiedlung vorhandenen ökonomischen und politischen Notwendigkeiten entziehen sich schon wegen ihrer Komplexität einer pauschalisierenden Bewertung. Insbesondere die Vorgehensweise des Deutschen Ordens gegenüber den verschiedenen sprachlichen Gruppen ist sehr sorgfältig zu untersuchen, da diese nicht nur zwischen den verschiedenen Ethnien, sondern auch in Abhängigkeit von den einzelnen Landesteilen (Pomerellen, Kulmer Land, Ostpreußen) variierte.5 Die vorliegende Arbeit beschränkt sich aus Kapazitätsgründen nur auf die Verhältnisse in Ostpreußen bezogen auf die deutschen und pruzzischen Siedler. Obwohl diese methodische Vorgehensweise unvollständig und nur einen Teil der historischen Komplexität erfaßt, scheint sie dennoch dem Ziel diese Aufsatzes - eine Darstellung des Prozesses der Neustammbildung im Ordensland (Ost-)Preußen - gerecht zu werden, da dessen Entstehung im wesentlichen auf der Verschmelzung der beiden oben genannten Volksgruppen beruhte. Aufgrund der historischen Entwicklung vollzog sich die Neustammbildung vollständig nur in Ostpreußen, während sie in Pomerellen (Westpreußen) wegen der Abtretung an Polen nach dem 2.Thorner Frieden und der damit einhergehenden späteren Integration in den polnisch-litauischen Staatsverband unterbrochen wurde.6
Ohne auf die Begrifflichkeit näher eingehen zu wollen, erweist sich der Terminus „(Ost-)Preußen“ für den zu untersuchenden Zeitraum als problematisch. Da diese aus dem Ausland kommende Bezeichnung erst mit der Entwicklung und Tätigkeit der Landstände von einer größeren Zahl von Einwohnern adaptiert wurde und zunächst nur als geographischer Begriff Verwendung fand, darf dieser keinesfalls in einem kulturell-politischen Sinn gebraucht werden.7 Erst mit dem sich ausbildenden Neustamm der (Ost-) Preußen kann der Begriff „Ostpreußen“ auch die Bezeichnung eines über die geographische Angabe hinausgehenden kulturell abgeschlossenen Gebietes beinhalten, dessen Homogenität jedoch nicht überschätzt werden darf. Neben dem deutsch geprägten Neustamm der Ostpreußen existierten außerdem der polnisch bestimmte Neustamm der Masuren und eingewanderte Litauer.8 Jedoch kann davon ausgegangen werden, daß in der Ausbildung eines deutschen Neustammes für die Zuordnung des Territoriums zum deutschen Kulturraum ein wesentlicher Faktor auszumachen ist. Die Thematik dieser Arbeit ergibt sich aus der überragenden Bedeutung dieses Prozesses für die weitere Geschichte des Landes. In der Literatur erscheint die Entstehung von Neustämmen als ein vorwiegend mit der deutschen Ostsiedlung verbundener Vorgang, der über Ostpreußen hinausgehend auch in anderen geschlossenen deutschen Siedlungsgebieten von statten ging.9 In der Regel werden dabei Parallelerscheinungen nichtdeutscher Volksgruppen vernachlässigt, deren Untersuchung schon zur Formulierung übergeordneter Entstehungskriterien von großer Bedeutung wäre. Diese Arbeit hat sich leider aus dem schon oben genannten Grund der Kapazitätsknappheit an dieser einseitigen Betrachtung zu orientieren. Die These von Karl Bosl, nach der die Entstehung der Neustämme v.a. aus der Territorialgeschichte und der Tätigkeit der Landstände zu erklären ist, scheint insbesondere für Ostpreußen zuzutreffen, da die schon oben skizzierte unterschiedliche Zugehörigkeit der einzelnen Provinzen zu verschiedenen Staaten und Kulturkreisen nach dem 2.Thorner Frieden eine einheitliche Stammesbildung verhinderte.10 Der von ihm postulierten Komplexität des Prozesses und Vielfältigkeit der Einflußfaktoren soll dadurch Rechnung getragen werden,11 daß im 2. Kapitel zunächst die gesellschaftliche Gliederung und die Lebensweise der Pruzzen vor der Eroberung durch den Deutschen Orden geschildert wird, da sich in diesen Strukturen schon wesentliche Voraussetzungen für den Prozeß der Neustammbildung verdeutlichen. Das 3. Kapitel beschreibt anschließend die Ereignisse im Zusammenhang mit der Annektion des Landes und der Ansiedlung deutscher Kolonisten. Im 4. Kapitel werden schließlich die Geschehnisse nach dem Ausbleiben der deutschen Siedler bis zum Abschluß der Neustammbildung genannt.
Aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse konnte leider nur die deutschsprachige Literatur einschließlich der ins Deutsche übersetzten polnischen Werke herangezogen werden.
2. Die pruzzische Gesellschaft vor der Annektion des Deutschen Ordens
Obwohl die Pruzzen bzw. die Volksstämme an der östlichen Ostseeregion allgemein schon in antiken Schriften erwähnt wurden, stammen unsere Kenntnisse jedoch hauptsächlich von den mittelalterlichen Chroniken und Reiseberichten. 12 Besonders zu erwähnen sind hier die Darlegungen des angelsächsischen oder normannischen Seefahrers Wulfstan, der um 800 vom schleswig-holsteinischen Handelszentrum Haithabu zum pruzzischen Hafen Truso segelte. Ergänzt werden dessen Angaben durch die Reiseberichte des Ibrahim ibn Jakub, der um 965 von Magdeburg über die slawisch besiedelten ostdeutschen Gebiete in das Territorium der Pruzzen aufbrach. Auf seine Bezeichnung der dortigen Bewohner als „Brus“ sollen die späteren Begriffe „Pruzzen“ und „Preußen“ zurückzuführen sein.13 Neben den bisher genannten ist noch Peter von Dusburg zu erwähnen, in dessen „Chronicon Terrae Prussiae“ sich mit der Beschreibung der Ereignisse im Zuge der Eroberung durch den Deutschen Orden auch wertvolle Details bezüglich der traditionellen Lebensweise der Pruzzen und der politischen Gliederung des Landes finden.14
Übereinstimmend berichten alle Quellen zunächst von einer dreischichtigen Gesellschaftsordnung, die sich aus Adligen („nobiles“), Freien mit geringem Besitz sowie Minder- oder Unfreien zusammensetzte. Dieser für Ostmitteleuropa typische Gesellschaftsaufbau erfährt jedoch bei näherer Betrachtung eine weitere Differenzierung : Den „nobiles“ standen eine Schicht von Burgherren vor („cyninge“), die innerhalb des Stammesverbandes wohl eine recht selbständige Stellung besessen haben.15 Mit Hilfe archäologischer Grabungen konnten in der Nähe der Burgwälle Kultstätten gefunden werden, so daß von einer Einheit der religiösen und politischen Zentren auszugehen ist. Eine Legitimierung der Herrschaft auch durch den Kultus findet sich dabei zu dieser Zeit im gesamten ostmitteleuropäischen Raum.16 Während somit die gesellschaftlichen Gliederung der Pruzzen Paralellen zu anderen ostmitteleuropäischen Völkern aufwies, unterschied sie sich doch in der fehlenden mittelalterlichen Nationsbildung erheblich von ihren unmittelbaren Nachbarn. Dabei ist jedoch eher von einer verspäteten Nationsbildung zu sprechen, da bei einsetzender Annektion durch den Deutschen Orden schon erste Anzeichen einer sich bildenden, stammesübergreifenden politischen Organisation erkennbar sind.17 Jedoch scheinen die in den erzählenden Quellen und noch in dem Vertrag von Christburg erwähnten 11 Stammes- bzw. Regionalverbände noch zu dieser Zeit politisch vorherrschend gewesen zu sein, da die kämpfenden pruzzischen Verbände bzw. die unterhandelnden Adligen differenziert beschrieben werden.18 Ohne Übertreibung kann diese verspätete Entwicklung in unterschiedlicher Hinsicht als schicksalsbestimmend für die weitere Geschichte der Pruzzen angesehen werden. Bei den sich im 10.Jahrhundert ausbildenden ostmitteleuropäischen Nationen ist der Zusammenhang zwischen Herrschaftskonstituierung und Christianisierung unverkennbar. Die Übernahme der mit den politisch dominierenden Nationen verbundenen Religion trug wesentlich zur Legitimierung und Überhöhung der zentral herrschenden Dynastie bei. 19 Im Vergleich zur pruzzischen Geschichte ist hier besonders hervorzuheben, daß die eigenständige Einführung des Christentums fremden Mächten die geistige Legitimation zur Aneignung der Territorien entzog. So konnten die slawisch besiedelten Gebiete Ostdeutschlands und die der baltischen Pruzzen v.a. auch mit Hilfe der Kreuzzugsideologie erobert werden. Die politische Zersplitterung der pruzzischen Stämme wirkte sich daher besonders nachteilig für diese aus. Zum einen wäre es einer Zentralgewalt eher möglich gewesen, das Christentum einzuführen und damit ausländische Missions- und Invasionsversuche abzuwehren. Zum anderen gelang es den Pruzzen nicht, einen alle Stämme einbeziehenden, geschlossenen Abwehrkampf zu organisieren. Vielmehr konnte der Deutsche Orden letztendlich erfolgreich die sich zunehmend aus den Stammesverbänden emanzipierenden pruzzischen Adligen gegeneinander ausspielen, so daß sich selbst an den nach der Eroberung durch den Deutschen Orden ausbrechenden Aufständen nicht alle Pruzzen beteiligten.20 Paradoxerweise scheinen gerade die Bestrebungen zur Ausbildung einer pruzzischen Zentralgewalt die Verteidigungsbereitschaft der Pruzzen geschwächt zu haben, da sie die alten Stammesverbände zusätzlich destabilisierten, ohne zugleich schon zu diesem Zeitpunkt zur Etablierung stammesübergreifender Koalitionen beitragen zu können. Die Invasion des Deutschen Ordens kam somit für die autochthone Bevölkerung zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, an dem eine koordinierende Abwehr nur unter erschwerten Bedingungen möglich war. Bei der dennoch nur unter großen Mühen und mit Hilfe von zahlreichen Kreuzfahrerheeren erfolgten Annektion bleibt es daher fraglich, ob diese zu späterer Zeit geglückt wäre.21
Für unseren Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind die Beziehungen zwischen mittelalterlicher Nationsbildung und der Ausbildung eines nationalen Bewußtseins, die jedoch zumindest für die Pruzzen mangels schriftlicher Quellen aus theoretischen Überlegungen zu entwickeln sind. In den entstehenden ostmitteleuropäischen Nationen wirkten sowohl die politischen als auch die kirchlichen Zentren allgemein kulturell integrierend und bewußtseinsbildend im Sinne einer national-kulturellen Identität.22 Als Ergebnis dieses Prozesses blieb bei einer Okkupation von einzelnen Territorien bzw. dynastischen Teilungen des Landes ein Zusammen- und Zugehörigkeitsgefühl bestehen, das einer von einer Besatzungsmacht beeinflußten kulturellen Integration zumindest zeitweise entgegenstand. Für die Pruzzen ist nun zu diskutieren, inwieweit das Ausbleiben der mittelalterlichen Nationsbildung auch kulturell zum Untergang der pruzzischen Kultur im 17. Jahrhundert beigetragen hat. Neben den schon erwähnten Kultstätten in der Nähe der einzelnen Burgwälle existierte auch bei den Pruzzen ein stammesübergreifendes, höchstes Heiligtum, zu dem aus allen Landesteilen Gläubige pilgerten.23 Dennoch konnte dieses keine den christlichen Bistumssitzen vergleichbare kulturell-politisch integrierende Kraft entfalten, da sich schon wegen der fehlenden Schriftlichkeit eine Kommunikation mit den örtlichen Schamanen und Burgherren in Grenzen halten mußte. Desweiteren scheint es keine über Orakelsprüche und Mythen hinausgehende kulturstiftende Wirkung gehabt zu haben.24 Daher konnte sich der in anderen Ländern mit einsetzender Christianisierung und damit verbundener erhöhter Schriftlichkeit beginnende Prozeß der „geistigen Nationsbildung“ nicht unter heidnischen Bedingungen vollziehen, so daß auch für die pruzzische Oberschicht die Ausprägung eines über lokale Bräuche und Sprache hinausgehenden, kulturell- nationalen Bewußtseins nicht anzunehmen ist.25 Zwar läßt sich die über Jahrhunderte hinziehende, vollständige Assimilation der Pruzzen nicht nur durch eine fehlende nationale Kultur erklären, dennoch scheint v.a. hier die Ursache für den geringen Anteil pruzzischer Kulturelemente innerhalb des Neustamm der Ostpreußen zu liegen.
Insgesamt ist daher sowohl aus militärisch-politischen als auch aus kulturellen Gründen in der verspäteten mittelalterlichen Nationsbildung eine wesentliche Voraussetzung für die Entstehung eines deutschen Neustammes der Ostpreußen unter völliger Verdrängung der pruzzischen Kultur zu sehen.
3. Der Deutsche Orden und die deutschen Kolonisten
Mit dem Angebot des Herzogs Konrad von Masowien an den 4. Hochmeister des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, bei Überlassung des Kulmer Landes die angrenzenden Pruzzen zu unterwerfen und bekehren, begann 1226 die Ausrichtung der Ordenspolitik auf den ostpreußischen Raum. Zuvor war der Orden in seinen Bemühungen gescheitert, in Ungarn und im Heiligen Land eine eigene staatliche Existenz zu etablieren.26 Obwohl daher die Offerte des Herzogs von Masowien Hermann von Salza sehr gelegen kam, suchte er nach den negativen Erfahrungen in Ungarn die angestrebte autonome Herrschaft über die zu erobernden Gebiete zunächst diplomatisch abzusichern. Diese Bemühungen führten schon 1226 zum Erfolg, als der deutsche Kaiser Friedrich II. in der sog. „Goldene Bulle von Rimini“ die Abtretung des Kulmer Landes bestätigte und das zu erobernde Land der Pruzzen dem Orden zur Verwaltung übertrug. Mit dem Kruschwitzer Vertrag von 1230 verbriefte daraufhin Konrad von Masowien seine Hermann von Salza gegebenen Versprechen und verlieh dem Orden das Kulmer Land und die zu annektierenden Gebiete.27 In der polnischen Forschung wurde diesem Abkommen häufig eine hohe, verhängnisvolle Bedeutung zugemessen, da mit ihm die Tätigkeit und damit auch die Festsetzung des Deutschen Ordens in den als genuin polnisch betrachteten Gebieten eingeleitet worden sei.28 Zweifelsohne kann der Kruschwitzer Vertrag als wichtige Voraussetzung für die Schwertmission des Deutschen Ordens angesehen werden, da höchstwahrscheinlich ohne sein Zustandekommen keine militärischen Operationen seitens des Ordens eingeleitet worden wären. Konrad von Masowien hätte jedoch wegen seiner eigenen territorialen Interessen bei ausreichenden eigenen Streitkräften diese Übereinkunft niemals getroffen. Die Vereinbarungen mit Hermann von Salza entsprachen daher vielmehr dem Bedürfnis nach befriedeten Grenzen, um machtpolitische Interessen bezüglich einer angestrebten Reunifikation Polens weiterverfolgen zu können. Insofern gewann der Herzog von Masowien mit dem Vertrag von Kruschwitz eine größere Handlungsfreiheit für seine innerpolnischen Ziele unter Aufgabe von Ansprüchen, die von ihm nicht durchzusetzen waren.29 Ohnehin scheint der beidseitig häufig beschworene nationale Gegensatz zwischen Polen und Deutschen in Gestalt des Deutschen Ordens aus den Geschichtsbildern der modernen Nationalstaaten motiviert gewesen zu sein. Insbesondere an den wechselnden Koalitionen zwischen polnischen Fürsten, dem Deutschen Orden und später auch den Landständen wird ersichtlich, daß „nationale“ Interessen bzw. Ideologien wenn überhaupt nur eine untergeordnete Bedeutung hatten. In der Bulle von Rieti übernahm schließlich der Heilige Stuhl 1234 die schon eroberten bzw. noch zu gewinnenden Territorien formal in sein Eigentum und überließ sie dem Deutschen Orden zur Verwaltung.30 Mit diesen Besitztiteln versehen, die zumindest juristisch die Begehrlichkeiten angrenzender Fürsten abwehren sollten, eroberte der Orden zunächst mit tatkräftiger Unterstützung von Kreuzfahrerheeren einen schmalen Landstreifen bis zur Ostsee, die 1239 erreicht wurde. Nachdem sich die Pruzzen 1242 in den schon eroberten Gebieten erneut erhoben, kam es unter päpstlicher Vermittlung zum Abschluß des sog. „Christburger Vertrages“ 1249, der der autochthonen Bevölkerung bei Anerkennung der Ordensherrschaft und Übertritt zum Christentum persönliche Freiheit zusicherte.31 In der Forschung ist dabei die Bedeutung dieser Vereinbarung umstritten. Nachdem sich ein großer Teil der Pruzzen im sog. „Großen Aufstand“ von 1260-1273 empörte, der den Orden in seinen weiteren Eroberungen stark beeinträchtigte und zurückwarf, verlor die Übereinkunft ihre Rechtsgrundlage schon wegen der Tatsache, daß sich die Aufständischen offen wieder zum heidnischen Glauben bekannten. Nach einigen Darstellungen steht daher die spätere Existenz eines unfreien pruzzischen Bauernstandes im Zusammenhang mit der Verwirkung der Freiheitsrechte.32 Zweifelsohne wurden bei der späteren Verleihung bzw. Zuweisung von Rechtspositionen Abstufungen getroffen nach dem individuellen Verhalten der Betreffenden gegenüber der Politik des Orden. Jedoch erscheint die mit der oben genannten These implizierte Gültigkeit des Christburger Vertrages für alle Pruzzen jeglichen Standes zweifelhaft. Den pruzzischen Adel hätte diese „Befreiung“ der abhängigen Hintersassen eher zur Fortsetzung denn zur Aufgabe des Aufstandes gereizt. Somit kann die Existenz eines unfreien pruzzischen Bauernstandes eher als Konservierung altpruzzischer Sozialstrukturen und als Entgegenkommen des Ordens gewertet werden.33 Die Christburger Bestimmungen galten also vornehmlich den gemeinen Freien und dem Adel, die auch nach der Befriedung des Landes ihre soziale Stellung gewahrt sahen.34 Daher scheint der Orden die Siedlungs- und Rechtsverhältnisse fallweise nach der für ihn günstigsten bzw. politisch opportunen Variante gestaltet zu haben relativ unabhängig von den Ereignissen während des Aufstandes. Der Christburger Vertrag gewinnt deswegen eher den Charakter einer Absichtserklärung des Deutschen Ordens, dessen Bestimmungen auch, aber nicht nur als Folge des „Großen Aufstandes“ relativ flexibel gehandhabt wurden. Formal behielt er bis zum Ende der Ordensherrschaft seine Gültigkeit.35 Die Annektion der pruzzischen Territorien kann schließlich 1283 mit der Eroberung des südöstlichen Grenzgebietes zu Litauen als abgeschlossen betrachtet werden. 36 Mit der endgültigen Befriedung des Landes hatte der Orden eine wichtige Voraussetzung für die planmäßige Ansiedlung einer deutschen bäuerlichen Bevölkerung geschaffen, die schon in der Kulmer Handveste von 1233 juristisch vorbereitet worden war. In dieser für den weiteren Landesausbau beispielsetzenden Urkunde wurden exemplarisch die Rechte und Pflichten der Bewohner der Stadt Kulm und deren Umgebung festgesetzt, die später auf die Siedler in den deutschrechtlichen oder „kulmischen“ Dörfern und in den kleineren Städten im Landesinneren übertragen wurden.37 Die größeren Städte an der Ostsee sowohl im eigentlichen Ostpreußen als auch später im erworbenen Pomerellen besaßen hingegen zumeist lübisches oder Magdeburger Recht, z.T. auch wegen der Beteiligung lübischer Bürger an den Stadtgründungen.38 Insgesamt ist festzustellen, daß sich der Landesausbau des Deutschen Ordens durch einen Grad der Planmäßigkeit und Organisation im allgemeinen auszeichnete, der in ganz Europa seinesgleichen suchte. Dafür können mehrere Gründe ausgemacht werden : Wegen des Unterganges vorher bestehender, pruzzischer Herrschaftsrechte durch die Eroberung und der Inkorporation von drei der vier landbesitzenden Bistümer übte der Orden in seinem Territorium die alleinige Landesherrschaft aus. Auch später blieb bis zum dreizehnjährigen Krieg die Ansiedlung von Adligen mit großem Landbesitz die Ausnahme, so daß die Kolonisation einheitlich und ohne adlige Konkurrenz nach den Bedürfnissen des Landes vonstatten gehen konnte. Desweiteren besaßen die Mitglieder des Ordens ein außergewöhnliches Fachwissen auf verschiedenen Gebieten, was sich u.a. in der schon frühen Einführung einer durchgehenden Landvermessung und einem hohen Grad der Schriftlichkeit äußerte.39 Sowohl die Dörfer zu kulmischem Recht als auch die sog. „Kleinen“ und „Großen Freien“ bekamen eigene Handvesten, in denen neben der Größe des zugeordneten Bodens dezidiert die Abgaben und Besitzrechte beschrieben wurden. Mit der Festsetzung des Bodenzinses nach der Ertragsfähigkeit des zu bearbeitenden Landes und einer regelmäßigen Gewannengliederung erhielt der Ordensstaat eine vergleichsweise moderne Agrarverfassung, die in Verbindung mit der durchstrukturierten Verwaltung und einer schon oben erwähnten erhöhten Schriftlichkeit die Herrschaft des Deutschen Ordens als sehr fortschrittlich erscheinen lassen.40 Bei der Agrarverfassung sind vorwiegend zwei rechtlich verschiedene Siedlungstypen zu trennen: die deutschrechtlichen oder kulmischen Dörfer und die Siedlungen zu pruzzischem Recht. In den v.a. in den großen Waldflächen zwischen den alten pruzzischen Dörfern angelegten kulmischen Siedlungen erhielt jeder i.d.R. deutschstämmige Bauer zwei Hufen (= 33ha) zur Bearbeitung, die durch einen Grundzins von einer halben bis zu einer Mark und durch einen Scheffel Weizen sowie Roggen (das sog. „Pflugkorn“) abzugelten waren. Neben diesen Abgaben hatten die Kolonisten keine Scharwerks- oder anderen Dienste zu leisten, so daß sie als persönlich frei zu bezeichnen sind. Der Dorfgemeinschaft stand ein Dorfschulze vor, der zumeist aus den ehemaligen Lokatoren und deren Nachkommen hervorging und die niedere Gerichtsbarkeit ausübte.41 Hingegen besaßen die Vorsteher der pruzzischen Dörfer, die sog. Starusten, keine vergleichbaren Rechte. Im allgemeinen beließ der Orden die Pruzzen in ihren angestammten Dörfern und Gehöften, die nur mitunter zur Steigerung der Produktivität im Rahmen einer Flurbereinigung umgelegt wurden. Die Bauernstellen waren i.d.R. kleiner als die der deutschen Siedler und beliefen sich im Durchschnitt auf zwei Haken (=22ha), der als neue Maßeinheit von der Ordensverwaltung eingeführt wurde. Obwohl der Geldzins niedriger bemessen war, hatte die authochtone Bauernschaft wegen umfangreicher Scharwerksleistungen und des Getreidezehnten eine erheblich höhere Belastung zu tragen als die deutschen Kolonisten.42 Ansonsten blieben die pruzzischen Dörfer von der Ordensherrschaft bzw. von der in den deutschrechtlichen Siedlungen verbreiteten kirchlichen Organisation relativ unberührt. Dieses gilt sowohl für die unfreien pruzzischen Bauern als auch für den Stand der sog. „Kleinen Freien“, die fast ausschließlich aus Pruzzen bestanden und bei persönlicher Freiheit und geringeren Abgaben dem Orden im Kriegsfall Heeresdienste zu leisten hatten.43 In der Forschung wurde die relativ hohe ethnische Abgeschlossenheit der jeweiligen Siedlungsgebiete unterschiedlich bewertet: Zum einen scheinen v.a. ökonomische Beweggründe für diese Politik des Ordens verantwortlich gewesen zu sein. Da während der langwierigen Eroberung viele Pruzzen den kriegerischen Auseinandersetzungen zum Opfer fielen, wäre es für den Orden außerordentlich schwierig und wegen der besseren rechtlichen Stellung auch ökonomisch ungünstig gewesen, gegen Ende des 13.Jahrhunderts und während des 14.Jahrhunderts pruzzische Dörfer in größerer Zahl zu deutschem Recht umzulegen bzw. pruzzische Bauern in deutschrechtlichen Siedlung seßhaft zu machen.44 Erst nachdem sich die Anwerbung deutscher Kolonisten seit der 2.Hälfte des 14.Jahrhunderts zunehmend schwieriger gestaltete, wurde auf pruzzische Bauern zur Binnenkolonisation zurückgegriffen, die dann auch das kulmischen Recht erhielten.45 Die Segregation der verschiedenen Ethnien erscheint hier also als Folge vorwiegend ökonomisch motivierter Zielsetzungen. Von anderer Seite hingegen werden v.a. politische Intentionen als Beweggründe herangezogen. So sollen die ethnisch geschlossenen Siedlungsräume v.a. auf eine Politik des „devidere et impera“ zurückzuführen sein, mit der der Orden eine Vereinigung der rechtlich und kulturell geschiedenen Bevölkerungsgruppen zu einer gegen seine Herrschaft gerichteten ständischen Bewegung verhindern wollte.46 Obwohl dieser These ein gewisser soziologischer Gehalt nicht abgesprochen werden kann, erscheint sie jedoch der Wirklichkeit des späten 13. und des 14.Jahrhunderts nicht angemessen und von den ständischen Auseinandersetzungen des 15.Jahrhunderts konstruiert worden zu sein. Eine Gefahr für die Ordensherrschaft bestand vornehmlich in den Aufständen der gerade befriedeten Pruzzen und nicht in Erhebungen der eingewanderten deutschen Siedler, die im Vergleich zu ihren Herkunftsgebieten ein erheblich verbessertes Recht erhielten. Zur Vermeidung von Unruhen wäre daher eher das gegenteilige Vorgehen, eine Vermischung der pruzzischen und deutschen Bevölkerung, von Vorteil gewesen, um die für einen Aufstand notwendige Geschlossenheit zu unterbinden. Hingegen könnten Bestrebungen zur Vermeidung von ethnischen Konflikten durchaus zur Segregation der Volksgruppen beigetragen haben,47 das ökonomische Moment erscheint jedoch vorherrschend. Für unserem Zusammenhang von größerer Bedeutung sind jedoch die Auswirkungen der Agrarverfassung auf die Ausformung eines mehrere Bevölkerungsgruppen umfassenden territorial- ständischen Bewußtseins als Voraussetzung einer neustämmischen Identität. Wegen der sich aus der rechtlichen Differenzierung ergebenen ethnischen Abgeschlossenheit insbesondere auch der pruzzischen Dörfer bewahrte sich bei der authochtonen Bevölkerung unter dem Deckmantel einer oberflächlichen Christianisierung die angestammte Kultur, Sprache und heidnische Religion z.T. bis in das 17. Jahrhundert hinein, was einer Assimilation bzw. Integration in die deutsch bestimmte Herrschafts- und Gesellschaftsordnung entgegenstand.48 Neben den rechtlich geschiedenen Siedlungsformen kann als Ursache dafür auch der homogene Aufbau einiger Stände herangezogen werden, die sich z.T. zwar funktional aus der Agrarverfassung ableiteten, jedoch in ihrer kulturellen Wirkung über diese hinausreichten. Insbesondere auch in den fast ausschließlich aus Pruzzen bestehenden gesellschaftlichen Schichten der „Kleinen Freien“ und der unfreien Bauern hielt sich das tradierte Brauchtum bis in die Neuzeit hinein.49 Zum Vergleich kann der Stand der sog. „Großen Freien“ herangezogen werden, der sich sowohl aus deutschstämmigen als auch aus pruzzischen Adligen zusammensetzte. Hier assimilierten sich die Pruzzen relativ schnell unter Aufgabe ihrer eigenständigen Sprache und Kultur.50 Daher ist insofern der obengenannten Annahme zuzustimmen, daß die im Verbund zu betrachtenen ethnisch differenzierten Rechts- und Siedlungsverhältnisse eine nur langsame Integration beider Volksgruppen bewirkten. Diese rechtliche Scheidung der Bevölkerungsgruppen ergab sich jedoch aus den ökonomischen Anforderungen heraus und nicht aus einem bewußten, auf eine Stabilisierung der Herrschaft zielenden Kalkül der Ordensverwaltung. Desweiteren waren die Standesgrenzen und damit einhergehend die Siedlungsverhältnisse nicht für alle Zeiten festgeschrieben.51 Unfreie pruzzische Bauern konnten sich freikaufen und damit in den Stand der „Kleinen Freien“ aufsteigen. Viele niedere Verwaltungsämter, wobei hier v.a. das Kämmereramt als mehreren pruzzischen Dörfern übergeordnete Instanz zu nennen ist, waren mit Pruzzen besetzt, die sich als Mittler zwischen der kulturell deutsch geprägten Oberschicht und den pruzzischen Untertanen relativ schnell den deutschen Sitten und Gebräuchen anpaßten.52 Auch hatten Pruzzen bis zum Beginn des 15. Jahrhunderts noch die Möglichkeit, innerhalb der neugegründeten Städte ins Stadtbürgertum aufgenommen zu werden, was i.d.R. die vollständige Assimilation nach sich zog. Obwohl sich das Bürgertum ab diesem Zeitpunkt gegenüber Nichtdeutschen abschloß und deren Zuzug allgemein verbot, kann auch darüber hinausgehend von der Existenz einer ausgedehnten unterbürgerlichen Schicht von Pruzzen und Polen ausgegangen werden, die sich im Zeitablauf kulturell an die deutschen Bewohner anpaßten.53 Insofern bestanden eine Reihe von Kontaktzonen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, in denen die authochtone Bevölkerung im Laufe der Zeit in die deutsch geprägte Gesellschaft integriert wurde. Diese Integration besaß zunächst den Charakter einer Einschmelzung, da die von Pruzzen und Polen angestrebten verbesserten rechtlichen Positionen mit der Kultur der politisch- militärisch überlegenen deutschen Oberschicht verbunden waren.54 Trotz der erwähnten Berührungspunkte blieb jedoch die Assimilation der Pruzzen zahlenmäßig eher begrenzt. Für eine umfassende „Germanisierungspolitik“ des Deutschen Ordens gibt es keine Hinweise. Sie wäre für die Beherrschung des Landes nicht notwendig und auch im Hinblick auf die personellen und materiellen Kapazitäten nicht durchführbar gewesen. Vielmehr läßt sich eher eine behutsame Einbeziehung tradierter pruzzischer Sozialstrukturen in die gesellschaftliche Gliederung des Ordensstaates beobachten, die den Pruzzen bei der Leistung der von ihnen geforderten Dienste und Abgaben ihre kulturelle Eigenständigkeit beließ.55 Ob diese Konservierung von Elementen der pruzzischen Sozialordnung auf einer Politik der Herrschaftssicherung oder nur auf den oben erwähnten ökonomischen Kriterien beruhte, ist nicht mit letzter Sicherheit auszumachen. Dennoch kann hierin der bedeutenste Faktor für eine nur langsame Verschmelzung der Bevölkerungsgruppen identifiziert werden als Voraussetzung für die Ausbildung eines gemeinschaftlichen territorial-ständischen Bewußtseins.
4. Die Entstehung des Neustammes der Ostpreußen
Gegen Mitte des 14.Jahrhunderts läßt sich ein deutlicher Einschnitt in der auch für unser Thema bedeutsamen Siedlungsgeschichte erkennen. Da gegen Ende der allgemeinen Periode der Ostkolonisation deutsche Neusiedler ausblieben, erhielt die pruzzische Bevölkerung bei dem vom Deutschen Orden weiterhin intendierten Landesausbau zwangsläufig eine größere Bedeutung. Die zuvor nur vereinzelt durchgeführte Umsiedlung von pruzzischen Dörfern erfuhr jetzt eine erhebliche Ausweitung, wobei die auf Rodeland umgesetzten Kolonisten mit dem kulmischen Recht begabt wurden.56 Obwohl die ethnische Geschlossenheit der Siedlungen i.d.R. bestehen blieb, scheint dieser Prozeß der Rechtsnivellierung zwischen beiden Bevölkerungsgruppen zur Überwindung ethnischer Differenzierungen beigetragen zu haben, da die authochtone Bauernschaft aus der Sicht der Deutschen nun nicht mehr per se den Status einer minderberechtigten Schicht einnahm. Dennoch dürfen diese Tendenzen nicht überschätzt werden: Der Deutsche Orden hielt schon aus fiskalischen Gründen bei der überwiegenden Mehrheit der pruzzischen Dörfer am bestehenden Recht fest.57 Desweiteren sind die von einer rechtlichen Angleichung ausgehenden Impulse für eine auch kulturelle Integration der Pruzzen nicht ohne weiteres nachzuweisen; sie beruhen z.T. auf theoretischen Annahmen und Analogien zu vergleichbaren Prozessen im 16. und 17. Jahrhundert. 58 Während somit auf dem Land eine zumindest rechtliche Harmonisierung zwischen beiden ethnischen Gruppen im begrenzten Umfang erkennbar wird, läßt sich eine entgegengesetzte Entwicklung bei den Städten beobachten. Seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts existierten in zunehmender Zahl städtische Urkunden, die eine Zuwanderung von Nichtdeutschen untersagen.59 In der Forschung ist dieser Sachverhalt unterschiedlich interpretiert worden: Zum einen wird hierin ein Abgrenzungsbestreben der deutsch geprägten städtischen Oberschicht gegenüber fremdethnischen Einflüssen und Menschen gesehen.60 Hingegen betonen andere Autoren die Intention, untertänige Bauern von einer Landflucht abzuhalten und verweisen auf vergleichbare Bestimmungen in westdeutschen Städten. Die ethnische Differenzierung sei dabei auf die Tatsache zurückzuführen, daß im Ordensland Preußen bis dahin ausschließlich Pruzzen dem Stand der unfreien Bauern angehörten.61 Für unseren Zusammenhang von größerer Bedeutung erweist sich jedoch die Abgrenzung des rechtlich verstandenen Bürgertums gegenüber Nichtdeutschen, da insbesondere in dieser Schicht eine schnelle Assimilation der wenngleich nur wenigen Pruzzen erfolgte.62 Einhergehend mit dieser Abschottung bildete sich eine auf die gemeinsame Herkunft und Sprache zurückgreifende, spezifisch deutsche Identität aus, der eine Tendenz zur Überhöhung der eigenen Kultur innewohnte. Insbesondere an den Städten Westpreußens bzw. Pomerellens nach dem 2. Thorner Frieden kann gezeigt werden, daß sich deren Bewohner als Deutsche im kulturellen Sinne verstanden. In den ständischen Auseinandersetzungen mit der polnischen Krone verbanden sich politische Forderungen zunehmend mit der Verteidigung der kulturellen Eigenständigkeit63. Neben der Ausbildung eines Zugehörigkeitsgefühles zum Deutschtum entwickelte sich v.a. in den großen Zentren an der Ostsee innerhalb der Geistlichkeit und des Bürgertums ein zunächst territorial geprägtes Bewußtsein in deutlicher Parallele zur mittelalterlichen Nationsbildung, das sich zunächst seit der 2.Hälfte des 14. Jahrhunderts in Herkunftsbezeichnungen, d.h. einer Abstammung aus „Prussia“, äußerte.64 Da die überlieferten schriftlichen Zeugnisse ausschließlich von Personen deutscher Herkunft abgefaßt wurden, ist davon auszugehen, daß Pruzzen in dieser frühen Phase der Bewußtseinsbildung nicht einbezogen waren. Dennoch kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden, daß sich die Pruzzen ausschließlich als Untertanen des Deutschen Ordens empfanden, da die mit einer erhöhten Schriftlichkeit verbundenen Ämter und sozialen Positionen mit überwiegender Mehrheit von Deutschstämmigen besetzt wurden.65 Somit ist es nicht auszuschließen, daß sich zumindest in den gehobenen sozialen Schichten auch der nichtassimilierten Pruzzen ein auf gleicher Herkunft und Sprache basierendes Gemeinschaftsgefühl entfaltete, das sich nicht schriftlich niederschlug oder nicht überliefert wurde. Letztendlich scheint jedoch nur der deutsch bestimmte Entwicklungsprozeß für die historische Entwicklung von Bedeutung gewesen zu sein. Obwohl aufgrund der Bedeutung der oben dargelegten Rechts- und Siedlungsverhältnisse der These zugestimmt werden kann, daß der Prozeß der Neustammbildung schon im Mittelalter seine Wurzeln hatte, begann doch dessen eigentliche Entfaltung erst mit der Tätigkeit der Landstände.66 In der Etablierung und Tätigkeit der Landstände allgemein ist wegen ihrer kooperationsbildenen Kraft der bedeutendste Faktor für die Ausformung von Neustämmen in allen neustämmischen Gebieten zu erkennen. Mit der Formulierung und den Bestrebungen zur Durchsetzung von politischen Forderungen entstanden ständeübergreifende und in Preußen auch verschiedene Ethnien einbeziehende Koalitionen, die zur Bildung eines einheitlichen Bewußtseins als „Inländer“ im Gegensatz zu den fast ausschließlich aus dem Reich kommenden Ordensrittern beitrugen.67 Dennoch darf die Beteiligung der Pruzzen an diesem Prozeß zumindest zu Beginn nicht überschätzt werden. Die sich in den Landständen versammelnden Vertreter der Städte und der deutsch geprägten Ritterschaft bzw. der großen Freien waren nur zu einem geringen Anteil vollständig assimilierte Pruzzen.68 Erst mit dem dreizehnjährigen Krieg, der auch eine größere Anzahl von zumeist Kleinen Freien miteinbezog, dehnte sich die aus der Tätigkeit der Landstände formende inländische Identität auch auf weite Teile der pruzzischen Bevölkerung aus.69 Durch die gemeinschaftliche Interessenvertretung und die Auseinandersetzungen mit dem Deutschen Orden bildeten sich vorwiegend an der deutschen Kultur ausgerichtete Traditionen und vereinheitlichte Geschichtsbilder aus, die die zunächst primär wegen politischer Zielsetzungen konstituierten Koalitionen kulturell unterschichteten.70 Aus diesem Entstehungszusammenhang wird deutlich, daß die z.T. im Begriff des „Neustammes“ implizierte kulturell- ethnische Verwurzelung zunächst nicht vorhanden war, sondern sich erst nach der Etablierung eines reinen Interessenverbandes kulturelle Gemeinsamkeiten ausbildeten. Daher kann der These von einer kulturell homogenen Schicht von Deutschen, die den deutschen Neustamm der Preußen konstituierten, schon wegen der unterschiedlichen Herkunft der deutschen Bevölkerung nicht zugestimmt werden.71 Vielmehr scheinen die später gegenüber der pruzzischen bäuerlichen Bevölkerung assimilierend wirkenden Traditionen und Gebräuche das Ergebnis der mit der Tätigkeit der deutsch geprägten Landstände verbundenen kulturellen Prozesse zu sein. Der Prozeß der Neustammbildung wurde vorwiegend von der deutschen Minderheit und den assimilierten Pruzzen getragen, der durch die Ereignisse des dreizehnjährigen Krieg auch die pruzzischen Kleinen Freien zumindest z.T. erfasste und integrierte. Hingegen blieb die authochtone Bauernschaft anscheinend von dieser Entwicklung zunächst unberührt, da sich die pruzzische Sprache und Kultur bis in das 17. Jahrhundert erhielt.72 Erst mit den sich aus der Ansiedlung der deutschen adligen Söldnerhauptleute ergebenen veränderten Rechts- und Siedlungsverhältnissen nach dem dreizehnjährigen Krieg begann sich der Prozeß der Neustammbildung auch auf die pruzzisch bäuerliche Bevölkerung auszudehnen. Da es die neue adlige Schicht verstand, sich neben den bisher freien deutschen und pruzzischen Siedlern auch die unfreien pruzzischen Bauern untertan zu machen, kam es im Zuge der Nivellierung bisher bestehender rechtlicher Unterschiede zu einer stärkeren ethnischen Vermischung der Siedlungsräume, die letztendlich die vollständige Integration der Pruzzen in den deutsch geprägten Neustamm zur Folge hatte.73 In diesem Zusammenhang werden wiederum die wesentlichen Strukturelemente der Neustammbildung deutlich: aufgrund der sich angleichenden Rechts- und Siedlungsverhältnisse erhöhte sich die Integration der bis dahin relativ abgeschirmt lebenden Pruzzen in den wegen der Herrschaftverhältnisse deutsch geprägten Gesellschaftsaufbau, die zur Assimilation an den deutschen Neustamm führte. Daher kann allgemein der Agrarverfassung einschließlich der spezifischen rechtlichen Positionen einzelner Bevölkerungsgruppen eine hohe Bedeutung für den Grad der Ausdehnung der neustämmischen Entwicklung zugesprochen werden. Hingegen scheinen die Herrschaftsverhältnisse wesentlich verantwortlich für die kulturelle Prägung und Ausbildung eines Neustammes zu sein, da die Entwicklung in dem nach dem dreizehnjährigen Krieg abgetretenen Westpreußen (Pomerellen einschließlich Danzig) unterbrochen wurde und wegen der an Bedeutung gewinnenden polnischen Kultur nicht zum Abschluß kam.74 Trotz der sich in Ostpreußen durchgesetzten deutschen Sprache und Kultur ist jedoch die These von einer Einschmelzung der Pruzzen in das „Deutschtum“ dahingehend zu korregieren, daß aufgrund der anzunehmenden wechselseitigen kulturellen Durchdringung beider Bevölkerungsgruppen auch von einer Integration pruzzischer Kulturelemente in das Brauchtum der Ostpreußen ausgegangen werden kann.75 Zusammenfassend stellt sich der Prozeß der Neustammbildung als sehr komplex und in seinen Voraussetzungen weit im Mittelalter wurzelnd dar, so daß eine differenzierte Bewertung angebracht erscheint. Da dieses Phänomen nicht nur für Ostpreußen, sondern auch in anderen Gebieten Ostmitteleuropas zu beobachten und für die weitere Geschichte dieser Territorien bis in unsere Gegenwart von Bedeutung ist, wären weitere und v.a. auch detailliertere Untersuchungen wünschenswert. 76
5. Literaturverzeichnis
5.1. Quellen
- Jacob, G. : Arabische Berichte von Gesandten an germanische Fürstenhöfe aus dem 9. und 10. Jahrhundert, Berlin/Leipzig 1927.
- Töppen, M., Kirsch, Th., Strehlke, E. : Scriptores Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft, Bd.1, Leipzig 1861, S.21-219 u. S.732-735.
5.2. Literatur
- Biskup, M. : Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit im mittelalterlichen Landesausbau in Preussen : Zum Stand der Forschung, in : Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands, Bd.40, Berlin 1991, S.3-25.
- Boockmann, H. : Der deutsche Orden : Zwölf Kapitel aus seiner Geschichte, München 1981.
- Boockmann, H. : Westpreußen und Ostpreußen(=Deutsche Geschichte im Osten Europas), München 1992.
- Bosl, K. : Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, in : Schulz, F.G. (Hg.) : Leistung und Schicksal, Köln/Graz 1967, S.46-54.
- Conze, W. : Ostmitteleuropa : Von der Spätantike bis zum 18. Jahrhundert, herausgegeben und mit einem Nachwort von Klaus Zernack, München 1992.
- Erlen, P.:Europäischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung : Ein struktureller Vergleich zwischen Südwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordensland Preußen (= Historische und Landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien, Bd.9)., Marburg 1992.
- Görlitz, W. : Die Prußen : Die alten Bewohner Ostpreußens, Marburg 1980.
- Jähnig, B. :Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland. Beobachtungen zur Stammesbildung im späten Mittelalter mit einem Ausblick auf die Wandlungen der Neuzeit, in: Bll. für deutsche Landesgeschichte, 121 (1985), S.115-155.
- Kuhn, W. : Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, in: Deutsche Ostkunde 27 (1979), S.1-10.
- Maschke, E. : Preußen. Das Werden eines Deutschen Stammesnamens, in: Domus Hospitalis Teutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1931-1963 (= Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd.10), Bonn 1970, S.158-187.
- Schlesinger, W. : West und Ost in der deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, in: Ekkehard Kaufmann (Hg.), Festgabe Paul Kirn, Berlin 1961, S.111-131.
- Schlesinger, W. : Zur Problematik der Erforschung der deutschen Ostsiedlung, in: W. Schlesinger, Die Deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte (= Vorträge und Forschungen, Bd. XVIII, Reichenau-Vorträge 1970-1972), Sigmaringen 1975, S.11-30.
- Wenzkus, R. : Über einige Probleme der Sozialordnug der Prussen, in : Acta Prussica, Abhandlungen zur Geschichte Ost- und Westpreußens, (= Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr., Bd.XXIX)Würzburg 1968, S.7-28.
- Wenzkus, R. : Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung des Preußenlandes mit besonderer Berücksichtigung der Siedlung, in: W. Schlesinger, Die Deutsche Ostsiedlung des Mittelalters als Problem der europäischen Geschichte (= Vorträge und Forschungen, Bd. XVIII, Reichenau-Vorträge 1970-1972), Sigmaringen 1975, S.417-438.
- Wippermann, W. :Der Ordensstaat als Ideologie.Das Bild des Deutschen Ordens in der deutschen Geschichtsschreibung und Publizistik (= Einzelveröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd.24), Berlin 1979.
- Wunder, Heide : Zur Mentalität aufständischer Bauern, in: Wehler, H.-U. (Hg.) Der Deutsche Bauernkrieg 1524-1526, Göttingen 1975, S.9-37.
[...]
Footnotes
1 H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.13f.; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.67-70; W. Schlesinger, Zur Problematik der Erforschung, S.11 u. S.21.
2 H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.74; W. Schlesinger, Zur Problematik der Erforschung, S.14f., S.18, S.25; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.49ff.
3 R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.418; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.246f. u. S.251; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zuordnung, S.8; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.72.
4 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zuordnung, S.4ff.; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.417ff.; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.115; W. Wippermann, Der Ordensstaat als Ideologie, S.316-369; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.75ff..
5 R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.419; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.72.
6 K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.48 u. S.50f.; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.23.
7 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.15f.; E. Maschke, Preußen. Das Werden eines Stammesnamens, S.158-60 u. S.174; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.141.
8 W. Conze, Ostmitteleuropa, S.92 u. S.98; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.21f.; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.436-438.
9 zum Begriff „Ostsiedlung“ s. W. Schlesinger, Zur Problematik der Erforschung, S.16; K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.46-54.
10 K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.46 u. S.49.
11 K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.53.
12 R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.8 u. S.16; W. Görlitz, Die Prußen, S.2f.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.121.
13 W. Görlitz, Die Prußen, S.2f.; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.75-82; SS rer. Pruss. I S.732-735
14 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.23; SS rer. Pruss. I S.21-219.
15 R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.16.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.123f.; SS rer. Pruss. I S.53f. u. S.733.
16 R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.8-16.
17 R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.11; W. Conze, Ostmitteleuropa, S.28 u. S.50f..
18 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.81; W. Görlitz, Die Prußen, S.15, S.20, S.22f..
19 W. Conze, Ostmitteleuropa, S.42-51.
20 R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.420; R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.11; W. Conze, Ostmitteleuropa, S.50f.; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.71-74.
21 R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.11.
22 W. Conze, Ostmitteleuropa, S.20-24 u. S.47.
23 W. Görlitz, Die Prußen, S.5.
24 W. Görlitz, Die Prußen, S.5; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.21; W. Conze, Ostmitteleuropa, S.22-24.
25 W. Conze, Ostmitteleuropa, S.20-24.
26 P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.66; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.68f..
27 H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.80-85 u. S.87-90; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.67.
28 W. Görlitz, Die Prußen, S.13; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.88f..
29 P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.67; W. Görlitz, Die Prußen, S.12f.; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.88ff..
30 H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.90ff. u. S.254; W. Wippermann, Der Ordensstaat als Ideologie, S.292ff.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.139f..
31 W. Görlitz, Die Prußen, S.17 u. S.20; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.106 u. S.109-115.
32 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.114; W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.3; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.100 u. S.123f.; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.8.
33 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.82; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.69.
34 R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.420; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.125.
35 R. Wenskus, Über einige Probleme der Sozialordnung, S.17ff. u. S.25f.; W. Görlitz, Die Prußen, S.21.
36 H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.100; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.70; W. Görlitz, Die Prußen, S.25.
37 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.3; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.158ff..
38 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes,S.5; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.181.
39 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes,S.3f.; P. Erlen, Europäischer Landesausbau,S.64.
40 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.3ff.; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.248f..
41 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.4f.; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.128; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.266-276.
42 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.5f.; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.128 u. S.132; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.78-89.
43 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.7; H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.135; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.78; W. Görlitz, Die Prußen, S.29; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.8.
44 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.138f. u. S.140; W. Görlitz, Die Prußen, S.27; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.77; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.7; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.128.
45 P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.78; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.427f.; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.10; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.129.
46 H. Wunder, Zur Mentalität aufständischer Bauern, S.24f. u. S.28f.; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit,S.15f..
47 P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.75 u. S.108.
48 P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.78; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.8 u. S.15f.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S. 132 u. S.136.
49 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.10.
50 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.14f.; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.423; E. Maschke, Preußen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens, S.167; W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.6.
51 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.132 u. S.135; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.89.
52 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S. 13 u. S.18; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.423; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.84.
53 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.148 u. S.152; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.171ff.; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.8f.; S.11 u. S.18.
54 Zum Begriff der „Einschmelzung“ s. W. Schlesinger, West und Ost in der deutschen Verfassungsgeschichte, S.115.
55 W. Kuhn, Die Besiedlung des preußischen Ordenslandes, S.5; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.83f. u. S.89.
56 P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.78; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.427f.; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.10; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.129.
57 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.15f..
58 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.18.
59 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.148; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.171ff..
60 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.8 u. S.20f..
61 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.148 u. S.151; P. Erlen, Europäischer Landesausbau, S.171; H. Boockmann, Der Deutsche Orden, S.128.
62 H. Boockmann, Westpreußen und Ostpreußen, S.151f..
63 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.20f.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.148.
64 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.18f.; E. Maschke, Preußen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens, S.170f.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.149f..
65 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.13 u. S.20; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.423.
66 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.25; K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.49 u. S.53.
67 K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.49; M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.19; E. Maschke, Preußen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens, S.169f. u. S.185.
68 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.19f.; E. Maschke, Preußen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens, S.185; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.139.
69 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.19 u. S.21f.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.141f..
70 K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.46 u. S.52f..
71 K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.46f.; W. Schlesinger, West und Ost in der deutschen Verfassungsgeschichte, S.115.
72 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.17f. u. S.19f.; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.136.
73 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.21f.; R. Wenskus, Der deutsche Orden und die nichtdeutsche Bevölkerung, S.430; B. Jähnig, Bevölkerungsveränderungen und Landesbewußtsein im Preußenland, S.150.
74 M. Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit, S.23f.; K. Bosl, Die Entstehung der ostdeutschen Neustämme, S.46.
75 W. Schlesinger, West und Ost in der deutschen Verfassungsgeschichte, S.115.
76 W. Schlesinger, West und Ost in der deutschen Verfassungsgeschichte, S.115.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieses Dokuments?
Dieses Dokument analysiert die Entstehung des Neustammes der Ostpreußen im Kontext des Ordensstaates (Ost-)Preußen, wobei die Interaktion zwischen deutschen Siedlern und der pruzzischen Bevölkerung im Vordergrund steht.
Welche Rolle spielte der Deutsche Orden bei der Besiedlung Ostpreußens?
Der Deutsche Orden spielte eine zentrale Rolle bei der Eroberung und Besiedlung Ostpreußens, indem er deutsche Kolonisten ansiedelte und eine Agrarverfassung einführte. Ihre Politik wird im Dokument differenziert betrachtet, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte der Herrschaft analysiert werden.
Wie war die pruzzische Gesellschaft vor der Ankunft des Deutschen Ordens strukturiert?
Die pruzzische Gesellschaft war dreischichtig gegliedert, bestehend aus Adligen („nobiles“), Freien mit geringem Besitz sowie Minder- oder Unfreien. Es gab eine Schicht von Burgherren („cyninge“), die eine recht selbständige Stellung innerhalb des Stammesverbandes hatten.
Welche Bedeutung hatte der Christburger Vertrag?
Der Christburger Vertrag von 1249 sicherte der autochthonen Bevölkerung bei Anerkennung der Ordensherrschaft und Übertritt zum Christentum persönliche Freiheit zu. Seine Bedeutung ist umstritten, da seine Bestimmungen nicht immer konsequent umgesetzt wurden.
Welche unterschiedlichen Siedlungsformen gab es im Ordensland?
Es gab deutschrechtliche oder kulmische Dörfer und Siedlungen zu pruzzischem Recht. Die deutschrechtlichen Dörfer wurden überwiegend von deutschen Siedlern bewohnt, die pruzzischen Dörfer von der autochthonen Bevölkerung. Die rechtliche Stellung und Abgabenlast unterschieden sich deutlich.
Welche Auswirkungen hatte die Agrarverfassung des Deutschen Ordens auf die Integration der Bevölkerung?
Die Agrarverfassung des Deutschen Ordens trug aufgrund der rechtlichen Differenzierung und der ethnischen Abgeschlossenheit der Siedlungen zu einer langsamen Integration beider Bevölkerungsgruppen bei. Die Konservierung pruzzischer Sozialstrukturen hinderte die Assimilation.
Wie gestaltete sich der Prozess der Neustammbildung?
Der Prozess der Neustammbildung war komplex und wurzelte im Mittelalter. Er wurde vorwiegend von der deutschen Minderheit und den assimilierten Pruzzen getragen. Durch die Tätigkeit der Landstände, die Formulierung politischer Forderungen und die Auseinandersetzungen mit dem Deutschen Orden bildeten sich Traditionen und Geschichtsbilder aus, die die Koalitionen kulturell unterschichteten.
Welche Rolle spielten die Landstände bei der Entstehung des Neustammes?
Die Landstände spielten eine entscheidende Rolle, da sie ständeübergreifende und Ethnien einbeziehende Koalitionen förderten, die zur Bildung eines einheitlichen Bewusstseins als „Inländer“ beitrugen.
Warum dauerte die Assimilation der Pruzzen so lange?
Die Assimilation der Pruzzen dauerte lange, weil der Deutsche Orden tradierte pruzzische Sozialstrukturen in die gesellschaftliche Gliederung einbezog und der pruzzischen Bevölkerung bei der Leistung der von ihnen geforderten Dienste und Abgaben ihre kulturelle Eigenständigkeit beließ.
Was geschah mit Westpreußen (Pomerellen) nach dem dreizehnjährigen Krieg?
In Westpreußen (Pomerellen einschließlich Danzig) wurde die Neustammbildung durch die Abtretung an Polen nach dem dreizehnjährigen Krieg unterbrochen und kam wegen der an Bedeutung gewinnenden polnischen Kultur nicht zum Abschluss.
- Citar trabajo
- Christopher Bahn (Autor), 1995, Der Prozeß der Neustammbildung im Ordensland (Ost-)Preußen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108683