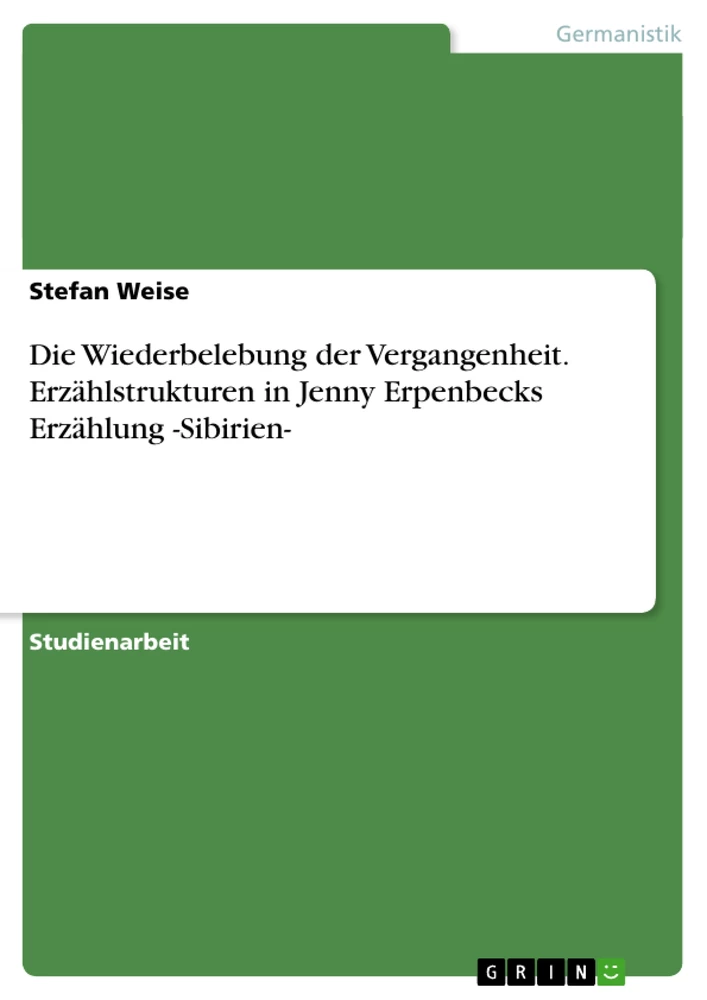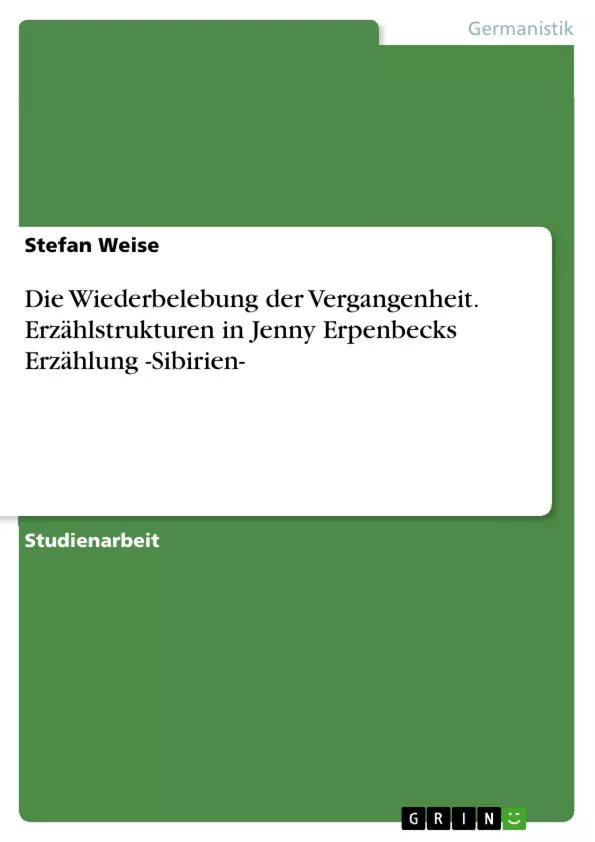Was, wenn die Erinnerungen, die uns am liebsten sind, die größten Lügen verbergen? Jenny Erpenbecks "Sibirien" ist keine einfache Familiengeschichte, sondern eine faszinierende Dekonstruktion der Erinnerung selbst. Ein Mann versucht, das Bild seiner Eltern zu zeichnen: die Mutter, eine Überlebende, stark und bewundert, und der Vater, ein Trinker, schwach und verachtet. Doch je tiefer er in die Vergangenheit eindringt, desto mehr verschwimmen die Konturen, und die vermeintlich klaren Urteile beginnen zu bröckeln. War die Mutter wirklich die strahlende Heldin, und der Vater der schuldige Versager? Durch die Augen eines Sohnes, der zwischen kindlicher Bewunderung und dem Wunsch nach Wahrheit hin- und hergerissen ist, entfaltet sich eine Geschichte von Krieg, Verlust, Liebe und Verrat, die den Leser mit unbequemen Fragen konfrontiert. Die Erzählung ist ein Mosaik aus fragmentarischen Erinnerungen, subtilen Andeutungen und unausgesprochenen Wahrheiten, die sich erst am Ende zu einem verstörenden Gesamtbild zusammenfügen. Die komplexe Erzählstruktur, die verschiedenen Erzählebenen und die subtile Ironie machen "Sibirien" zu einem literarischen Juwel, das den Leser lange nach dem Zuklappen des Buches beschäftigt. Entdecken Sie, wie trügerisch die Macht der Erinnerung sein kann und wie leicht wir uns in unseren eigenen Urteilen verfangen. Ein psychologisch tiefgründiges Porträt einer Familie, das die fragile Natur der Wahrheit enthüllt und die Leser dazu anregt, ihre eigenen Erinnerungen und Vorurteile zu hinterfragen. Ein Muss für alle, die sich für Familiengeheimnisse, Vergangenheitsbewältigung und die Kunst des Erzählens interessieren. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Ambivalenzen und unerwarteter Wendungen, in der nichts so ist, wie es scheint, und in der die Vergangenheit eine lebendige Kraft ist, die unsere Gegenwart formt. Lassen Sie sich von Erpenbecks kraftvoller Sprache und meisterhafter Erzählkunst in den Bann ziehen und erleben Sie, wie die Wahrheit langsam ans Licht kommt – oder vielleicht auch nicht. Erleben Sie literarische Hochspannung und intellektuelle Herausforderung in einem Band!
Inhalt
1. Der verwirrte Leser: Einleitung
2. Wer erzählt wem? Erzähler und Erzählebenen
3. Die gerne erinnerte Vergangenheit: Der Hinauswurf
4. Die zugedeckte Geschichte: Fokussierungen auf der Makrostrukturebene
5. Schnappschüsse aus der Erinnerung: Die Zeitstruktur
6. Der unzuverlässige Erzähler & das beobachtende Kind
a. Der informierende Erzähler.
b. Der erklärende Erzähler.
c. Der wertende Erzähler.
7. Der saufende Krüppel & der schiefe Haussegen: Vielfalt der Indizien
8. Die Angst vor der Wiederbelebung der Vergangenheit: Schluss
9. Literaturverzeichnis.
[Der verwirrte Leser: Einleitung.]
Der Versuch, jemandem in wenigen Worten zu sagen, worum es in Jenny Erpenbecks Erzählung „Sibirien“ geht, erscheint zunächst aussichtslos, denn es ist auf den ersten Blick überhaupt nicht klar, wer hier wem was erzählt. Es ist noch nicht einmal klar, ob eigentlich überhaupt etwas erzählt wird.
Dieser Text ist ein Mosaik aus scheinbar willkürlich angeordneten Handlungs- Beschreibungs- und Reflexionssequenzen, das sich erst dann zu einem (wenn auch unscharfen) Bild zusammensetzt, wenn man das Buch zuklappt und ein paar Schritte beiseite geht. Die nun mögliche Auskunft ‚ Ein Mann erinnert sich an seine Eltern, wobei er von der Mutter ein weißes und vom Vater ein schwarzes Bild zeichnet, beide viereckig und nicht gerade gerecht ’ wirkt zutreffend, lässt aber wichtige und vielleicht wichtigste Elemente der Erzählung außer Acht, und vor allem hat es den Anschein, als ob dies nicht die einzige mögliche Auskunft über den Inhalt des Textes ist. Zum Beispiel lässt sich die Frage ‚ Wieso heißt der Text dann„Sibirien“? ’ nun überhaupt nicht beantworten, auch nicht mit dem Hinweis darauf, dass die Mutter doch in Sibirien war. Denn darum geht es in der Erzählung in der Hauptsache nicht.
Es ist also angebracht, das Buch wieder aufzuschlagen und sich die Struktur des Textes einmal genauer anzusehen. Wir tun dies in der Hoffnung, den Text aus sich heraus zu verstehen und am Ende eine bessere Auskunft über seinen Inhalt geben zu können und lassen text-externe Kontexte wie die Biographie der Autorin, die historische Situation zur Zeit der Niederschrift der erzählten Geschichte sowie den literaturgeschichtlichen und den philosophischen Kontext weitgehend außen vor. Dies alles nicht aus Desinteresse oder Ignoranz, sondern um uns in knapp bemessenem Rahmen um so intensiver den Eigenschaften des Textes zuwenden zu können.
[Wer erzählt wem? Erzähler und Erzählebenen.]
Am auffälligsten an dieser Erzählung ist sicher die wirkungsvolle Verschachtelung der Erzählinstanzen (oder „narrativen Instanzen“, wie Genette sie nennt1 ). Vom ersten Satz an („Mein Vater sagt...“2 ) ist klar, dass hier jemand (sich oder den Leser) distanzierend die Worte eines anderen zur Diskussion stellt. Eine kritische Stellungnahme des extradiegetischen Erzählers3 bleibt jedoch völlig aus. Dieser extradiegetische Erzähler ist das Kurioseste, was die Erzählung zu bieten hat: Wir erfahren über ihn weder Namen noch Alter, sogar das Geschlecht wird verschwiegen, es lässt sich auch aus den Äußerungen des intradiegetischen Erzählers, der ihn ja anspricht, nicht rekonstruieren. Über diesen Erzähler wissen wir nur, dass er ein direkter Nachkomme des intradiegetischen Erzählers („mein Vater“) ist. Überraschenderweise stellt sich am Ende sogar heraus, dass er Teilnehmer an einer Rahmenhandlung ist, die er kurioserweise auch noch gleichzeitig erzählt („Mein Vater und ich sitzen [...]“ (S.104)) Kurios deshalb, weil er gleichzeitig erzählt, was der intradiegetische Erzähler erzählt, eine Situation, die logisch eigentlich ein Unding ist. Man kann nur etwas weitererzählen, was man bereits gehört hat, nicht, was man gerade erst hört. Allerdings gibt es eine (einzige?) Situation, in der ein solches Erzählen irgendwie vorstellbar ist: Das Telefongespräch. Im Telefongespräch gibt man durchaus manchmal das weiter, was ein anderer im Raum ‚ gerade sagt ’, den der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung nicht hören kann. Man kann sich auch vorstellen, der Erzähler sage alle diese Dinge, die wir lesen, zu sich selbst.
Wie dem auch sei, der Erzähler ist auf seltsame Weise allein durch die häufige Verwendung des Konjunktivs und die ständige Wiederholung der Formel „sagt mein Vater“ präsent, ohne dass er auch nur einen winzigen Kommentar zu dem von ihm Erzählten abgibt4. Wichtig scheint also nur die sich durch seine ständige Präsenz einstellende Distanz zum intradiegetischen Erzähler, dem Vater, zu sein.
Beide Erzähler, soweit sie Figuren der Rahmenhandlung sind, sitzen während des Erzählens inmitten des Nachlasses der Mutter des intradiegetischen Erzählers. Das kann der aufmerksame Leser auch an den Stellen merken, an denen die intradiegetische in die metadiegetische Ebene einbricht, z.B. „Das kannst du auf den Fotos sehen.“ (S.95) Der intradiegetische Erzähler ist als solcher das ganze Gegenteil des extradiegetischen Erzählers: Wo jener, zwischen berichteter und indirekter Rede oszillierend, sich jeden Kommentars enthaltend, eine möglichst genaue Darstellung des gerade Wahrgenommenen anstrebt, bringt dieser sich selbst stark in seine Erzählung mit ein, wertet, erklärt, vermutet, lässt weg, wiederholt sich, bleibt ungenau. Eigentlich erzählt er gar nicht, sondern führt einzelne Erinnerungen als Beispiele oder Belege für Wertungen an, die er über seinen Vater, dessen Freundin und hauptsächlich über seine Mutter abgibt.
Was er erzählt, der Inhalt der metadiegetischen Erzählung, liegt viele Jahre zurück. Es ist mit großem zeitlichen Abstand erzählte Kindheit, die er seinem eigenen - inzwischen schon erwachsenen - Kind erzählt. Sehr vage und meist narrativisiert gibt er die Rede eines metadiegetischen Erzählers, seiner Mutter, wieder. Deren Erzählungen, die für den Leser metametadiegetische sind, liegen für sie nur wenige Jahre zurück und handeln ausschließlich von Sibirien.
Da in diesem Text die Erzählenden auf gewisse Weise auch immer die Sehenden sind, also ihre eigenen Erlebnisse erzählen und nur über ihre eigene Innensicht und nicht (wirklich) über die der anderen verfügen5, weil sie außerdem nicht in die Zukunft oder in die vor ihrer Geburt liegende Vergangenheit schauen können oder Dinge wissen, die sich außerhalb ihres Erfahrungsbereiches abspielen, und weil sie sich eines recht umgangssprachlichen Stils befleißigen („die Vergangenheit, die ihr abgesoffen war“ (S.96)), hat man als Leser den Eindruck, es mit realistischen (nicht: realen) Figuren zu tun zu haben, Figuren, von denen ein
Bild entsteht (mehr im Falle des Vaters als im Falle seines ‚Nachkommens’) und über die man sich eine Meinung bilden kann. Bevor dies geschieht, wollen wir aber den Text noch aus einer anderen Perspektive betrachten.
[Die gerne erinnerte Vergangenheit: Der Hinauswurf.]
Der Vater spricht über seine Mutter, seinen Vater und dessen Freundin, und das Urteil, das er über diese Personen und ihre Beziehungen zueinander abgibt, bleibt sich vom Anfang bis zum Ende gleich. Für die Mutter hat er nur positive, für den Vater und dessen Freundin hingegen nur negative Worte übrig. Wie kommt es dann, dass der Leser zu Beginn durchaus noch in das Mutter-Lob einzustimmen bereit ist und mit der Mutter sympathisiert, dass aber diese Sympathie sich gegen Ende immer mehr in Richtung Vater und Freundin verschiebt?
Zerlegt man die Erzählung in ihre mehr oder weniger abgeschlossenen Handlungs- und Sinnsequenzen, erhält man 35 Teile. Mithilfe dieser Unterteilung lassen sich nun einige Dinge deutlich sehen, die vorher (wenn überhaupt) nur vage wahrgenommen worden waren. Der Vorgang, den ich ‚Hinauswurf’ genannt habe, also die Szene, in der die Mutter die Freundin des Vaters aus dem Haus befördert, wird sieben Mal erzählt, wenn auch auf verschiedene Weisen. Er stellt damit zumindest für den Erzähler6 den Schwerpunkt der Erzählung dar, den Mittelpunkt, um den sich alles andere gruppiert, von dem aus alle anderen Szenen betrachtet werden. Immer wieder kommt der Erzähler auf diese Szene zurück und erzählt sie erneut, fügt ein weiteres Detail hinzu, lässt andere weg und leitet von dort zu weiteren Betrachtungen über.
Besehen wir diese Hinauswurf- Darstellungen einmal genauer, fällt uns Folgendes auf: Die Erzählung des Vorgangs erfolgt immer aus der Sicht des Sohnes, (fast) nie gibt er wieder, was ein anderer gesehen hat7. Die Fokussierungen8 der Darstellungen wechseln jedoch auffällig.
In der ersten Hinauswurf-Sequenz (S.91) kann man eine vollständige MutterFokussierung feststellen, sie ist die Handelnde. Die Freundin des Vaters wird nur als „Widersacherin“, als herumgeschleudertes und letztlich hinausgeworfenes Objekt wahrgenommen, der Vater wird überhaupt nicht erwähnt.
Schon in der ersten Wiederholung (S.91) ändert sich die Detailgenauigkeit: Wir erfahren nun, immer noch mit Blick auf die Mutter, was diese zu der „Frau, die sie an ihrem Platz vorfand“ (ebd., eine Benennung, die die Freundin eindeutig und sofort ins Unrecht setzt) genau gesagt hat. Auch wird schon in dieser zweiten Hinauswurf-Sequenz ein flüchtiger Blick auf die Freundin geworfen, die so heftig „an die Wand stieß“, dass „der Jesus, der an der Wand angebracht war, hinterher schief hing“ (S.91f.).
Die nächste Hinauswurf-Sequenz (S.94) ist schon viel länger, der Vorgang wird hier am genauesten geschildert. Der beobachtende Sohn wird einbezogen („Nie werde ich das vergessen“), und mit Blick auf die Mutter erfahren wir genau jede einzelne ihrer gewalttätigen Handlungen - vom An-der-Schulter-Packen über das Ohrfeigen und Herumwirbeln bis zu den groben Worten („Ungeziefer“, „Laus“, „feige Hure“) und dem Hinauswurf. Es wird aber auch auf die passive der beiden Frauen ein Blick geworfen. Sie erscheint nun als (vergeblich) Handelnde, die sich festzuhalten versucht und die kein Wort sagt9. An dieser Stelle wird übrigens zum ersten Mal der für die gesamte Erzählung konstituierende Gegensatz zwischen Sprechen und Schweigen aufgetan, auf den an späterer Stelle noch genauer eingegangen wird10.
Die sechs Sequenzen später (auf S.96) folgende Darstellung ergänzt die Szene um ein weiteres Detail, nämlich um das Essen, das auf dem Tisch steht und von der Mutter durch neues ersetzt wird. Der Blick auf die beiden Kontrahentinnen ist ein ganz neuer: Beide werden als nahezu gleichberechtigte Figuren gesehen, zwei Körper, die kämpfen. Zum ersten Mal wird auch der Vater einbezogen, als Schweigender.
Die fünfte Hinauswurf-Sequenz (S.97) stellt den Hinauswurf selbst gar nicht mehr dar, weil sie eine dominierende Vater-Fokussierung zeigt. Der Erzähler macht sich Gedanken über den Vater und dessen Verhalten, allerdings völlig in die Irre gehende. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die beiden anderen an dieser Szene teilnehmenden Figuren nur durch des Vaters (vom Erzähler vermuteten) Blick wahrgenommen werden („[...] dass seine eigene Frau viel beeindruckender war als diese Freundin“11 ).
Die vorletzte Hinauswurf-Sequenz (S.99) ist überhaupt keine Erzählung mehr. Die Erwähnung des Hinauswurfs erfolgt innerhalb einer Interpretation der Verhaltens der Mutter. Des Vaters Freundin erscheint an dieser Stelle als „Geliebte“ (zweimal), die einen Anspruch
(!) und Wünsche hat, also als Person und nicht mehr bloß als Objekt.
In der siebenten Hinauswurf- Erwähnung (auf S.103) erscheint die Mutter nur noch als „diese Frau“, ihre Kontrahentin hingegen wie selbstverständlich als „die Freundin des Vaters“. Die Darstellung ist genauso knapp und detailarm wie in der ersten Sequenz, fast wortgleich.
Am Anfang ist der Leser noch in völliger Unkenntnis des Vorganges und erlebt es als gerecht, dass die Mutter „die Frau, die sie an ihrem Platz vorfand“ (S.91) hinauswirft. Je mehr Details des gewaltsamen Auftretens der Mutter er erfährt und vor allem je mehr die Kontrahentin der Mutter nicht nur als Objekt, sondern als Person wahrgenommen wird, umso stärker meldet sich das moralische Bewusstsein des Lesers, das die Richtigkeit des Handelns der Mutter in Frage stellt. Wenn die letzte Hinauswurf- Erwähnung genauso knapp geschieht wie die erste, haben sich die Sympathien des Lesers bereits verschoben, und die nahezu deckungsgleiche Erzählung desselben Vorgangs wird völlig gegensätzlich bewertet. Erscheint das Handeln der Mutter zunächst als durchaus gerecht und passend, wirkt es am Ende eher unangebracht, vor allem unzulässig, wenn man es auch weiterhin in gewisser Weise versteht.
[Die zugedeckte Geschichte: Fokussierungen auf der Makrostrukturebene.]
Es ist zu Beginn schon angedeutet worden, dass in diesem Text möglicherweise gar keine Geschichte erzählt wird. In der Tat ist es so, dass der Leser die Geschichte mehr erahnen muss, als er sie erzählt bekommt. Die Erzählung liegt wie eine Decke über der Geschichte. Die Geschichte selbst ist nicht besonders aufregend:
Ein kleiner Junge in Brandenburg erlebt die vorzeitige Rückkehr seines Vaters aus dem Zweiten Weltkrieg, lebt eine zeitlang mit dem Vater und dessen Freundin zusammen, bevor seine Mutter aus Sibirien zurückkehrt, die Freundin aus dem Haus wirft und wieder beim Vater einzieht. Der Vater, der nun mit seiner Freundin über Briefe kommuniziert, beginnt zu trinken und stirbt schließlich. Viele Jahre später stirbt auch die Mutter, was der Anlass für den nunmehr erwachsenen Sohn ist, seinem auch schon erwachsenen Kind von seinen Eltern zu erzählen.
Es ist leicht zu sehen, dass hier viel weniger ‚geschieht’ als zum Beispiel in der etwa gleichlangen Kleist-Erzählung „Das Erdbeben in Chili“. Das Einzige, was wirklich umständlich erzählt wird, ist der Hinauswurf. Alles andere sind größtenteils Beschreibungen, Charakterisierungen oder bloße Benennungen des Geschehens.
Die Geschichte selbst weist klaffende narrative Lücken auf, und es gelingt ihr nur selten, überhaupt sichtbar zu werden. Wenn es ihr gelingt, dann hauptsächlich nur schnappschussartig, was ja auch der Erzähl-Situation12 entspricht, in der der Vater seinem ‚Kind’ unter anderem auch Fotos zeigt (S.95). Die Ebene der Geschichte13 ist uninteressant für den Erzähler. Sein Interesse gilt der darüber liegenden Ebene der Charaktere und der Beziehungen, in denen diese zueinander stehen14. Dies wird deutlich, indem der Erzähler Elemente der Geschichte (fast) nie unabhängig erzählt, sondern sie (fast) immer in Charakterbeschreibungen einbettet oder sie als Begründungen für seine Wertungen anführt. Umso erstaunlicher ist es, dass man als Leser diese Wertungen nicht einfach übernimmt, sondern sich aufgrund der vom Erzähler angeführten Belege (!) sogar eine von der Erzählermeinung stark abweichende eigene Meinung bildet. Wie das kommt und vom Text herausgefordert wird, wird sich später herausstellen15. An dieser Stelle kommt es darauf an zu sehen, dass der Erzähler keine Geschichte erzählen, sondern Charakter- und Beziehungsbilder zeichnen will.
Nun kann man jeder der Sequenzen, in die man den Text zerlegt hat, den Aktanten zuordnen, der dabei fokussiert wird. Dabei ergibt sich ‚im Großen’ ein interessantes Muster, das dem Bild ähnelt, das wir schon beim Vergleich der verschiedenen Hinauswurf- Versionen gewonnen hatten. Es stellt sich nämlich heraus, dass mehr als die Hälfte der Sequenzen auf die Mutter bezogen sind, aber das Gewicht dieser Sequenzen auf der ersten Hälfte des Textes liegt16.
Die ersten sieben Sequenzen (S.91-94) handeln fast ausschließlich von der Mutter. Nach zwei sehr kurzen auf den Vater bzw. dessen Freundin bezogenen Sequenzen (S.94f. - neun Zeilen) folgen wieder vier Sequenzen, die die Mutter fokussieren (S.95-96), so dass nach gut fünf Seiten (einem Drittel des Textes) fast ausschließlich von der Mutter und noch kaum von den ihr gegenübergestellten Charakteren die Rede war. Der Leser hat also noch kaum Gelegenheit gehabt, die Wertungen des Erzählers zu überprüfen.
Nach drei kurzen vater- bzw. freundinbezogenen (S.96f.) und einer kurzen mutterbezogenen Sequenz (S.97f.) steht im Mittelpunkt sowohl des Textes als auch der Sequenzenfolge die lange Traumsequenz (S.98f.), in der der Vater den Sohn im Traum heimsucht. Von da an ändern sich deutlich die Verhältnisse: Waren vor diesem Mittelpunkt die Mutter-Sequenzen nicht nur in der Anzahl, sondern auch im Umfang deutlich dominant (sechs Seiten für die Mutter vs. eine Seite für Vater & Freundin), sind sie nach dem Mittelpunkt den Vater-Sequenzen zahlen- sowie umfangsmäßig unterlegen. Die Freundin des
Vaters wird auf beiden Seiten der Mitte nur am Rande erwähnt, aber vom Erzähler dem Vater zu- und der Mutter gegengeordnet17. Trotzdem ist die Mutter auch in der zweiten Texthälfte immer noch präsent, allein dadurch, dass auch die Vater- Beschreibungen sehr oft einer kurzen vorangegangenen oder folgenden Mutter- Einschätzung kontrastiert werden, so z.B.: „Seine Mutter sei mit einem ungeheuren Willen zum Leben aus ihrer Gefangenschaft zurückgekommen, der Vater aber [...]“ (S.100).
Das Bild, das sich ergibt, ist also folgendes: Die Erzählung beginnt mit dem offenen Blick auf die Mutter, was sich in der Dominanz der auf sie bezogenen Sequenzen spiegelt. Je kürzer und seltener diese Sequenzen vor allem in der zweiten Hälfte des Textes werden, umso mehr weicht der Blick von der Mutter ab und wendet sich dem Vater (und dessen Freundin) zu, so wie auf ihn bezogene Sequenzen in zunehmendem Maße dominieren. Mit wenig Überraschung stellen wir fest, dass dieses Bild dem entspricht, was zu Anfang vom sympathisierenden Blick des Lesers gesagt wurde: Zunächst ruht er auf der Mutter, wendet sich aber mehr und mehr von ihr ab und dem Vater und seiner Freundin zu. Dennoch haben wir das Gefühl, dass das eben Ausgeführte nicht die ganze, sondern nur ein Teil der Erklärung für das Problem sein kann, wie es kommt, dass sich die Wertungen des Erzählers und des Lesers zu Anfang so sehr ähneln, um am Ende so sehr zu divergieren. Wir werden diese Erklärung im Folgenden immer mehr vervollständigen.
[Schnappschüsse aus der Erinnerung: Die Zeitstruktur.]
Die erzählte Zeit der Binnenhandlung erstreckt sich von der Ankunft der Mutter bis zum Tod des Vaters. Als Ausgangspunkt der Erzählung kann man den Hinauswurf der Freundin des Vaters betrachten, dessen Wichtigkeit vom Erzähler besonders nahegelegt wird, indem er dieses Ereignis nicht nur einmal, sondern repetitiv erzählt. Es ist weiter oben schon gesagt worden, dass sich kein richtiger Erzählfluss ergibt, weil die Erzählung stark indiziell ist, d.h. die meisten Aussagen sich nicht auf die Geschichte beziehen, sondern vor allem auf die Figuren.
Dennoch ist es möglich, eine Zeitstruktur zu erkennen, die aber vor allem eines deutlich macht: Den elliptischen Charakter des Erzählens. Zwar wird der Hinauswurf durchaus vollständig erzählt, und eine komplette Analepse ergänzt die kurze Zeit von der Ankunft der Mutter bis zu deren Erscheinen in der Küche (S.92f.). Doch dann weist die Erzählung sowohl zeitlich als auch (vor allem) in Bezug auf erzähltes Geschehen große Lücken auf. Viele Sätze decken mit wenigen Worten die gesamte erzählte Zeit ab, indem sie Ereignisse iterativ erzählen, sich dabei aber auf Details beschränken, die kein richtiges Bild entstehen lassen. Es ergibt sich ein Muster aus beliebig iterierten Details, das nicht geeignet ist, einen Eindruck von der Geschichte zu verschaffen, wohl aber einiges über die Charaktere und deren Beziehungen verrät.
Singulative Erzählungen einzelner Szenen finden sich in diesem Text geradezu selten. Am Anfang der Erzählung steht die schon erwähnte Analepse, die die Ankunft der Mutter erzählt. Eine weitere folgt erst wieder mit dem Traum des Vaters, der eigentlich gar nicht in die Zeit der Geschichte fällt und nur in sie hineinragt, weil die in ihm auftretenden Personen zur Geschichte gehören. Er stellt an der Stelle, an der er steht, eine partielle Prolepse dar, einen Vorgriff auf eine Nacht viele Jahre nach dem Tod des Vaters. Der Traum wird in einer Geschichte geträumt, die vom Leben des Sohnes nach des Vaters Tod handelt, und er ist ihr einziges Element18. Die einzigen singulativ erzählten Ereignisse, die sich nach dem Traum noch finden, sind die Spiegelszene (S.102), in der sich der Vater am Spiegel verletzt, und die Glassplitterszene (S.102f.), in der der Sohn dem Vater mit Selbstzerstörung zu drohen versucht. Zusammen mit der häufig erzählten Hinauswurf- Szene sind dies die einzigen Szenen, an die sich der Erzähler relativ genau zu erinnern scheint. Alle anderen Sequenzen sind überwiegend iterativ, wenn sie überhaupt narrativ und nicht bloß reflexiv sind.
Weil überdies für die meisten dieser Iterationen weder die Dauer noch die ungefähre Frequenz angegeben wird, scheinen die oft schnappschussartig erzählten Szenen sich beliebig oft zu wiederholen. Dies macht es schwer, überhaupt eine Erzählkurve zu erkennen, die beschreibt, wie sich die Erzählung in der erzählten Zeit hin- und herbewegt. Wenn man es dennoch anhand der oft angegebenen Anfangs- oder Endpunkte der Iterationen versucht, sollte man sich bewusst sein, dass in diesem Falle eine Menge Mutwillen dazugehört und dass es durchaus die Absicht des Erzählers sein kann, achronisch zu erzählen, mithin eine solche Kurve gerade nicht entstehen zu lassen. Die singulativ erzählten Szenen und der Hinauswurf lassen sich zeitlich relativ zu den anderen bestimmen. Wenn man die iterativ erzählten Szenen in dieses Muster einfügt, ergibt sich folgendes Bild:
Der Ausgangspunkt ist der Hinauswurf, von dem aus die Erzählung anfangs in externen partiellen Analepsen einige Male in die Sibirien-Zeit der Mutter zurückfällt, zu dem sie aber auch immer wieder zurückkehrt. Die Ankunft-Sequenz füllt komplett ein kurzes Stück Vorgeschichte aus. Die Darstellung der Freundin des Vaters (S.94) als schweigendes, kochendes, aufräumendes Wesen ist eine externe partielle Analepse, die nur deshalb komplett wirkt, weil sie iterativ erzählt wird und der Endpunkt der Iteration mit dem Hinauswurf bekannt ist. Da die Freundin danach nicht mehr im Hause auftritt, erscheint es einigermaßen seltsam, wenn es in dieser Sequenz heißt, „gesprochen hätte sie nie viel, nicht einmal in der Zeit, als sie bei ihnen wohnte, bevor die Mutter aus Sibirien zurückkam.“19 Es scheint dies ein Hinweis darauf zu sein, dass es eine Zeit gegeben haben muss, bevor die Freundin bei Vater und Sohn gelebt hat, und dass der Sohn sie in dieser Zeit schon gekannt hat. Über diese Zeit ist nichts bekannt, der Hinweis ist so winzig und ungenau, dass er leicht übersehen werden kann20.
Jetzt aber geht es um die Bewegung der Erzählung in der erzählten Zeit, und wir haben gesehen, dass sie zu Anfang ziemlich zickzackförmig verläuft. Danach schreitet sie langsam und unbestimmt voran, indem der schweigende Vater und die erzählende Mutter nach dem Hinauswurf erwähnt werden, immer wieder unterbrochen von Analepsen, die nun nicht mehr auf die Zeit vor dem Hinauswurf, sondern auf diesen selbst zurückweisen. Die erzählten Ereignisse lassen sich zeitlich nicht genau orten und liegen irgendwo in der nicht genau spezifizierten Zeitspanne zwischen Hinauswurf der Freundin und Tod des Vaters.
Nach der Traum-Sequenz beruhigt sich dieses Hin und Her ein wenig, in der Erzählung vom Vater als zunächst Briefe Schreibenden, später beim Lesen Trinkenden und endlich in den Spiegel Fallenden, Erkrankenden und letztlich Sterbenden ist sogar eine gewisse Kontinuität zu erkennen, wenngleich es auch hier einzelne Analepsen gibt, die auf den Hinauswurf und sogar auf die Zeit davor zurückweisen - einmal bis zur Rückkehr des Vaters aus dem Krieg (S.103).
Wenn man beachtet, dass sich die Sequenzen vor dem Traum (in der Reihenfolge der Erzählung) fast ausschließlich mit der Mutter und nach dem Traum vorrangig mit dem Vater beschäftigen, hat man die Erklärung für das folgende Phänomen: Zwar wird immer wieder äußerst positiv über die Mutter gesprochen, aber eine Geschichte ihres Lebens nach der Rückkehr aus Sibirien lässt sich nicht erzählen. Dass man das vom Leben des Vaters sehr wohl kann, ist nicht mehr verwunderlich, haben wir doch gerade gesehen, dass wir über den Vater viel mehr bestimmte Informationen erhalten als über die Mutter, über die vor allem Wertungen abgegeben werden.
[Der unzuverlässige Erzähler & das beobachtende Kind.]
Wenn wir im Folgenden über den Erzähler reden, ist es wichtig, vor allem eines zu beachten: die Nicht-Identität des Sehenden mit dem Erzählenden. Man ist leicht geneigt, dies zu übersehen, weil der Sehende nur an sehr wenigen Stellen als Aktant auftritt21. Wo er aber auftritt, müssen wir gewahr werden, dass er ein Kind ist. Derjenige, der die erzählte Geschichte erlebt und beobachtet, ist ein Kind. Und zwar ein kleines Kind, denn sogar vom am Sterbebett seines Vaters, also am Ende der erzählten Zeit stehenden Sohn heißt es: „er, noch ein Kind zu der Zeit“ (S.104). Dieser Erzähler22 aber wird vom extradiegetischen Erzähler als „mein Vater“ apostrophiert.
Der extradiegetische Erzähler selbst - der Nachkomme des Erzählers - ist bereits in einem sprachfähigen Alter, gibt die Äußerungen seines Vaters im Konjunktiv wieder und ist in der Lage, sich von ihnen zu distanzieren. Nach allem, was man bisher über Vaterschaft und Spracherwerb weiß, müssen also wenigstens 30 Jahre zwischen der erzählten Zeit und dem Erzählen liegen. Einiges spricht dafür, dass es noch viel mehr sind, zum Beispiel der redundante Sprachstil des Erzählers, der an einen alten Menschen denken lässt. Überdies darf man nicht vergessen, dass der Erzählanlass (wahrscheinlich) der Tod der Mutter ist. Auch das spricht für ein höheres Alter des Erzählers, wenngleich man nicht wissen kann, wie lange die Mutter nach dem Tod des Vaters noch gelebt hat. Dass es keine kurze Zeit gewesen sein kann, lässt sich anhand des Zustandes der von ihr hinterlassenen Dinge vermuten (staubig, stinkend, teilweise bereits zerstört (S.104f.)).
Dies alles ist gesagt worden, um klarzumachen, dass der Erzähler keinesfalls der Erlebende ist. Er erinnert sich an Sachverhalte, die mindestens ein halbes Leben zurückliegen und - was noch wichtiger ist - er ist nun erwachsen, während der Erlebende noch ein kleines Kind war, das noch nicht im Vollbesitz seiner kognitiven Fähigkeiten war. Ein Fünfjähriger nimmt sich und die Welt anders wahr als ein 55-Jähriger23. Vor allem wertet er anders.
Diese Überlegungen haben mehrere Konsequenzen. Erstens bekommen singulativ erzählte Szenen eine besondere Bedeutung, allein dadurch, dass sich der Erzähler noch an sie erinnert. Iteratives Erzählen ist eher ein Zeichen für ungenaue Erinnerung. Es ist nämlich einfacher zu sagen ‚ Mein Vater hat dann immer geschwiegen ’24 als eine Gesprächssituation konkret wiederzugeben. Außerdem verdeckt iteratives Erzählen dieser Art, dass der Erzähler möglicherweise gar nicht kompetent ist, seine Aussagen zu machen. Denn es ist fast unvorstellbar, dass der Sehende in jeder der betreffenden Situationen überhaupt als Beobachter anwesend war. Wenn der Erzähler Formulierungen wie „Seine Mutter habe immer getan, was notwendig war“ (S.102) verwendet, ist also Misstrauen geboten. Vor allem aus einem anderen Grund, der die zweite Konsequenz der vorherigen Überlegungen ist:
Es ist für den Leser nicht zu erkennen, wer wertet. Ist es der Fünfjährige, der das Gefühl hat, seine Mutter tue immer das Notwendige, oder ist es der 55-Jährige, der viele (oder alle) Situationen verglichen hat und nach reiflicher Überlegung zu diesem Urteil gekommen ist? Oder liegt es gar noch anders, und die beiden Ebenen vermischen sich? Es ist dies der wichtigste Grund dafür, dass der Text so in der Schwebe ist, einige Stellen schwer verständlich sind und der Leser dem Erzähler zu misstrauen geneigt ist. Wir werden auf diesen Punkt später wieder zurückkommen25.
Die dritte Konsequenz aus der Überlegung, dass der Erzähler die erwachsene Ausgabe des kindlichen Beobachters ist, ist diese: Er ist unzuverlässig aus dem Grund, dass Erinnerungen verblassen und sich insbesondere unter dem Einfluss einer Wertung (eines Urteils) auch verändern können. Und damit sind wir bei der vierten Konsequenz: Wie eine Situation sich dem Hörenden oder Lesenden darstellt, kommt vor allem auf den Blickwinkel an, aus dem beobachtet wird - und auf den, aus dem erzählt wird. Wie wir gesehen haben, ist der Erzählanlass der Tod der Mutter des Erzählers und der Anblick der von ihr hinterlassenen Alltags- und Erinnerungsgegenstände. Die Erzählmotivation ist offenbar, die gerade verstorbene, besonders geliebte Mutter in einem guten Licht erstrahlen zu lassen und natürlich auch die Liebe zu ihr zu begründen. Es ist aber durchaus denkbar und wäre für den Erzähler möglich, den (Erzähler-) Blickwinkel zu verändern und mit denselben Erinnerungen eine völlig andere Geschichte zu erzählen. Der Leser bemerkt das, der Erzähler nicht. Und zwar bemerkt der Leser es nicht sofort, sondern allmählich, je mehr er über die (‚Neben’-) Figuren erfährt. So kommt es, dass der Erzähler eindeutig erzählt, die Geschichte aber mehrdeutig dasteht.
Es soll nun nochmals ein wachsameres Auge auf den Erzähler geworfen und dabei der kindliche Beobachter im Blick behalten werden. Wir können mindestens drei Funktionen dieses Erzählers unterscheiden: Den informierenden, den erklärenden und den wertenden Erzähler. Zu dem letzteren gehört auch der empfindende Beobachter, wiewohl man ihn auch dem informierenden Erzähler zuordnen könnte. Diese drei Funktionen sind in dieser Erzählung auf vielfältige Weise miteinander verschränkt und voneinander abhängig, was man sich leicht klarmachen kann. Wenn man über die eine der Funktionen redet, spricht man automatisch auch über die anderen, wie sich sofort zeigen wird.
Der informierende Erzähler:
Es werden jetzt einige weitere Gründe zusammengetragen, warum man dem Erzähler als Informierendem nicht bedingungslos trauen kann. Am deutlichsten fällt das Missverhältnis von Erzähltem zu Nichterzähltem ins Auge. Allein dadurch, dass er eine einzige Szene siebenmal erzählt, weckt der Erzähler Interesse für das, was er nicht erzählt. Dass die Erzählung große narrative Lücken aufweist, ist an früherer Stelle schon gezeigt worden.
Das Thema ‚Sibirien’ ist dem Erzähler besonders wichtig. Die Erzählungen seiner Mutter müssen den Erzähler sehr beeindruckt haben, denn niemand anderes kann ihm erzählt haben, was seine Mutter in Sibirien erlebt hat, als sie selbst. Zu solchen Erzählungen gehört natürlich eine gehörige Portion Selbstdarstellung. Wenn niemand einen korrigiert, kann man leicht eine Geschichte erzählen, in der man als Held erscheint. Damit soll nicht gesagt werden, dass es ein Leichtes sei, das zu überleben, was in der ersten Sibirien- Sequenz (S.91) aufgezählt wird. Aber es soll darauf hingewiesen werden, dass die Tatsachen, die zu den Grundsteinen von des Sohnes Bewunderung für seine Mutter gehören, für den Leser Erzählungen von Erzählungen26 , also mit doppelter Vorsicht zu genießen sind.
Es ist schon fast unheimlich, wie sehr der Sohn von seiner Mutter eingenommen ist - so sehr, dass er sich selbst als Handelnden fast nicht erzählt. In der Ankunft- Sequenz (S.92f.) wird das Treffen zwischen Mutter und Sohn vor dem Haus dargestellt. Im Anschluss daran wird der Weg der Mutter in die Küche beschrieben, wo „die beiden“ beim Essen sitzen. Trotzdem ist der Sohn beim Hinauswurf der Freundin anwesend. Jedenfalls tut der Erzähler so. Es ist nicht davon die Rede, wie er in die Küche kommt, ob er seiner Mutter folgt oder ob er bloß durchs Fenster hineinspäht. Er kann den Hinauswurf in allen Einzelheiten erzählen, aber es ist durchaus möglich, dass diese ihm von seiner Mutter erzählt worden sind. Es soll sich nicht auf diese Deutung festgelegt werden, denn sie ist wenig früchtetragend. Sie würde nur verdeutlichen, was man ohnehin schon bemerkt hat: Der Sohn scheint das Geschehen mit den Augen seiner Mutter zu sehen. Allein schon die Formulierung „die beiden“ für den eigenen Vater und dessen Freundin weist darauf hin. Sie enthält so viel Distanz, wie sie eigentlich nur ein Fremder haben kann. Der Vater und seine Freundin werden auch an anderen Stellen durch solche Formulierungen verfremdet, wenn sie „dieser Mann“ und „diese Frau“ genannt werden.
Eine weitere Beobachtung betrifft die (wenn auch nicht direkt) erzählten Gefühle der beschriebenen Personen. Anhand der tragischen Geschichte des Vaters, an seinem BriefeSchreiben und späteren Trinken, anhand seines Schweigens gegenüber seiner Frau kann man einigermaßen deutlich seine Gefühlslage erkennen. Über die Gefühle der Mutter lässt sich - bis auf ihre innige Beziehung zum Sohn - kaum etwas erahnen. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum sie am Ende der Erzählung so fremd erscheint.
Die oftmals kontrastive Darstellung des Vaters gegenüber der Mutter bewirkt, dass man sich auch bei nicht- kontrastiven Bemerkungen für den Opponenten das Gegenteil denkt: „Meine Mutter hat gut gerochen, selbst wenn sie schmutzig war, ich konnte sie anfassen [...]“ (S.102). Diese ödipal anmutende Darstellung scheint zu implizieren, dass der Vater nicht gut gerochen hat, dass man ihn nicht anfassen konnte, welches letztere durch seine Erscheinung „wie ein Geist“ (S.100) noch nähergelegt wird, aber natürlich Unsinn ist.
Vorsicht vor dem Erzähler ist auch geboten, wenn er die Innensicht anderer Figuren einnimmt und deren Gedanken und Gefühle wiedergibt: „Er glaube, dass sein Vater im Grunde damals schon eingesehen habe, dass seine eigene Frau viel beeindruckender war als diese Freundin. [...] Im Grunde sei sein Vater froh gewesen, dass die Mutter heimgekehrt war“ (S. 97). Die Innensicht des Vaters wird hier verwendet, um den positiven Blick auf die Mutter zu objektivieren. Es ist aber klar: Dies sind nicht die Gedanken des Vaters. Ebenso geht es mit scheinbar sicheren Aussagen über die Mutter. Der Beobachter ist ein kleiner Junge. Wie kann er einschätzen, „es habe sie einfach nicht interessiert, ob der Vater die Verbindung zu seiner Geliebten weiter aufrechterhielt“ (S.99)?
er erklärende Erzähler:
Die letzte Bemerkung im vorigen Abschnitt gehörte schon teilweise in diesen, in dem es um den Erzähler als Erklärenden geht. Er ist in dieser Funktion ganz stark präsent, und wenige Beispiele werden eine Fülle von Textstellen vertreten müssen. Es gibt einerseits die Erklärungen von dem Typ, der bereits zitiert wurde: Der Sohn gibt Erklärungen des Verhaltens seiner Eltern ab, die offenbar nicht autorisiert sind. Man ist geneigt, sie dem leicht dümmlich wirkenden älteren Mann zuzuordnen, der in seltsamer Zerfahrenheit von „Beobachtungswut“ zu „Wut“ springt (S.100f.). Eine Erklärung dieser Art ist die Auskunft über die Freundin des Vaters, sie habe „sich nicht getraut, mit ihm, dem Sohn, zu reden“ (S.94)27.
Auf der anderen Seite gibt es Äußerungen, die gar nicht so recht in das Bild zu passen scheinen, das man sich gerade vom Erzähler gemacht hat. Es sind Äußerungen, die vor allem durch ihre Formulierung hellsichtig wirken28 wie die Bemerkung über die Mutter, „es habe für sie eben keine andere Möglichkeit gegeben, als ihr Leben wieder in Besitz zu nehmen “ (S.96)29. Scheinbar ohne es zu wollen, gibt der Erzähler hier bedeutsame Interpretationshilfen. In der Tat sieht es so aus, als ob die Mutter nicht zu ihrer Liebe (Mann & Kind) zurückgekehrt wäre, sondern zu ihrem Besitz. Dafür spricht auch die Formulierung, sie habe gewusst, „was hätte verloren sein können“ (S. 93). Die Liebe kann an dieser Stelle nicht gemeint sein, sie war ja verloren.
Die Mutter kehrt nach langer Abwesenheit zu ihrem Besitz zurück, entfernt das „Ungeziefer“ (S.91) und lebt weiter, als sei nichts gewesen. Weder das Schweigen des Mannes, der sich nicht in Besitz nehmen lassen will und deshalb die Hand wegzieht (S.104) noch seine Beziehung zu seiner Freundin können sie aus der Bahn werfen. Sogar der Tod des Mannes geht spurlos an ihr vorüber. Weder von ihren Reaktionen darauf noch sonst von ihren Gefühlen für ihn wird erzählt. Als er stirbt, führt sie seinen Haushalt einfach weiter, als wäre er noch da. Es scheint, als ob die Mutter nicht wegen der Erlebnisse im Krieg, die sie überlebt hat, so starr ist („Sein Leben in ihrs eingefroren“ (S.105)), sondern sie nur wegen dieser Starre, Härte und Unanfechtbarkeit diese Dinge überlebt hat. Es wird deutlich gesagt, sie habe überlebt, „woran die meisten gestorben seien“ (S.91). Bei ihrer Rückkehr wird sie sogar - vielleicht als Anspielung auf ihren inneren Tod, ihre Erstarrung - mit einer aus Wotans Totenheer verglichen (S.92). Sie trägt Sibirien in sich, das kalte, weite Land, das der Sohn durch ihre Haut hindurch sehen kann (S.95). Er erlebt die Katastrophe, den Hinauswurf, und es ist gut möglich, dass er ihn aus Angst vor seiner Mutter so aufwertet. Da er gesehen hat, was mit jemandem passiert, der ihr nicht passt, bemüht er sich, ihr zu Gefallen zu sein. Der gewalttätige Hinauswurf, der eigentlich für ein kleines Kind ein erschreckender, nicht verstehbarer Vorgang ist, wird interpretiert als Heldentat, von der aus alle anderen Handlungen der Mutter als positiv und die ihrer ‚Gegner’ als negativ bewertet werden.
Der wertende Erzähler:
Mit diesen Bemerkungen über die Mutter sind wir bereits beim wertenden Erzähler angekommen und auf die Unterscheidung von kindlichem Beobachter und erwachsenem Erzähler zurückgekommen. Man kann sich oft nicht sicher sein, ob nun der eine oder der andere wertet. Die Darstellung suggeriert einerseits, dass der kleine Junge bereits bestimmte Einsichten gewonnen hat, während sie eindeutig spätere Projektionen sind, z.B. als der Erzähler erklärt, der kleine Junge habe „in diesem ersten Moment, als er sah, wie diese Frau die Freundin des Vaters packte, [...] wiedererkannt, wie er selbst war“ (S.103). Es ist wohl kaum glaubwürdig, dass sich ein kleiner Junge Gedanken über seine Identität macht und sogar so weit geht, sich selbst in anderen wiederzuerkennen, was einigen Erwachsenen nicht einmal gelingt.
Andererseits gibt der Erzähler Gedanken eines Fünfjährigen, die er direkt aus dem Mund der Mutter übernommen hat, als seine durchdachten Meinungen eines erwachsenen Mannes aus: „Nein, das Bein war es nicht, [...] es waren diese verflixten Briefe“ (S.102). Darauf, dass der Erzähler die Wertungen der Mutter kritiklos übernimmt, gibt er selbst einen Hinweis, wenn er sagt: „Sibirien sei ein schönes Land, habe sie oft gesagt, und so sei bis auf den heutigen Tag in seinen Augen Sibirien ein schönes Land“ (S.99).
Die Konstellation Kind-Vater-Freundin erinnert an die Kind-Vater-Stiefmutter- Konstellation im Märchen. Nur dass hier einiges vertauscht ist: Während im Märchen die Mutter stirbt und so Anlass zu neuer - für das Kind unglücklicher - Hochzeit gibt, ist hier gerade die ‚Stiefmutter’ die sanfte, leise und die echte Mutter die gewalttätige, die (wie Jesus die Händler aus dem Tempel) die ‚Stiefmutter’ aus dem Haus vertreibt, was letztendlich zur Folge hat, dass der Vater stirbt. Während im Märchen die Bestrafung der Stiefmutter alle Konflikte löst, bleibt hier die Mutter bis zu ihrem Ende ungestraft, weil die positive Mutter- Bewertung (aus dem Märchen) beibehalten wird, und der Vater hinterlässt bei seinem Tod ein Rätsel.
Es ist schwer vorstellbar, dass ein kleiner Junge beide ‚Elternteile’, die mit ihm leben, derartig negativ bewertet, wie das der Erzähler mit seinem Vater und dessen Freundin tut. Wahrscheinlicher ist, dass die Sicht auf die Freundin durch die Rückkehr der Mutter gebrochen ist und dies auch auf die Vater- Sicht zutrifft.
Es soll diesen Vermutungen nun nicht weiter nachgegangen werden, da sie sich in psychologische Bereiche versteigen, doch bleibt festzuhalten, dass Vater und Freundin durchweg negativ bewertet werden30, während die Mutter nur mit positiven Attributen versehen wird. Das ist einigermaßen verdächtig, und der Verdacht lautet: Diese Schwarz- Weiß- Sicht ist die eines kleinen Jungen, der noch nie über seine Beurteilungen nachgedacht hat. Wenn der Erzähler am Ende leise Zweifel an den von ihm abgegebenen Interpretationen äußert (S.104) und angibt, er habe Angst, dass er „die Briefe finde“ (S.105), scheint er diesen Verdacht zu bestätigen. Denn welche unbekannte Wahrheit sollen die Briefe der Freundin, die dem Vater am Ende seines Lebens im wahrsten Sinne des Wortes beisteht, denn enthalten?
Die Geschichte, die der Vater erzählt, enthält alle Anhaltspunkte, die nötig sind, um zu verstehen, welch eine Katastrophe die Rückkehr seiner Frau für den Vater sein muss, der seine Freundin liebt. Aber der Erzähler bemerkt diese Anhaltspunkte nicht. Immerhin fällt ihm auf, dass an seinen Interpretationen etwas nicht stimmt: Erfolglos bemüht er sich, „das herauszufinden, von dem er [...] nicht weiß, was es war“ (S.100), was aber dem Leser klar vor Augen steht.
Der Erzähler redet, wie es ihm gerade einfällt, nicht selten sinnlose oder zumindest unlogische Sätze. So sagt er (S.99) über seine Mutter, sie „sei nicht im mindesten nachtragend gewesen [...] und habe es auch gar nicht nötig gehabt“. Wann hat man es denn nötig, eine bestimmte Charaktereigenschaft zu haben? Seine Begründung oder Alternative für das Nachtragend- Sein überbietet aber diese Unlogik noch: „Es sei einfach ein gleißendes Licht von ihrem Verstand 31 ausgegangen, und dadurch habe sie, ohne dass sie noch hätte einen Gedanken daran verschwenden müssen, andererseits eben harte Schatten geworfen“32. Die kluge Mutter „habe sicher gewusst, dass alles, was einmal in diesen Schatten fiel, blind blieb“ (S.100). Was also vom Verstand der Mutter nicht angestrahlt wird, liegt im Schatten und wird (von ihr) nicht mehr gesehen, z.B. die „Schattenmorelle“ (S.94). Blind bleibt das aber keineswegs, und das hat sie gerade nicht gewusst. Nicht was in den Schatten fällt, wird blind, sondern was vom Licht geblendet wird, z.B. der Sohn, der Erzähler. Er ist offenbar blind für das, was er selbst erzählt.
Interessant ist an dieser Stelle eine Beobachtung, die halb ins nächste Kapitel gehört und zu diesem überleiten wird: Die Mutter wird an der zitierten Stelle offenbar mit der Sonne gleichgesetzt. Mit ihrem Verstand strahlt sie, blendet und wirft harte Schatten. Symbolisch verbunden mit der Sonne ist Gott. Man könnte zutreffend banalisieren: Der Erzähler vergöttert seine Mutter. Dem entspricht die buchstäbliche Verteufelung des Vaters: Er wird als großer Vernichter dargestellt, der „alles, was seine Frau ihm schenkte, [...] in Müll verwandelte“ (S.101)33. Und zwar wodurch? „Durch sein Schweigen“. Während also die Mutter mit ihrem Verstand als strahlende Sonne beschrieben wird, erscheint (!) „ der ganze Vater “34 analog dazu „wie ein einziges, tiefes, schweigsames [schwarzes] Loch, eine Müllgrube“35. Was hier klar wird, ist die folgende Umkehrung des Sprichwortes „Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“: Die laute, redende, schreiende Mutter erhält mehrmals Klugheit und Verstand zugesprochen, die Schweigenden, Vater und Freundin, hingegen keinen. Es geht aber noch weiter: Indem der Erzähler (der ja per definitionem viel redet) dem Leser als nicht besonders schlau erscheint, also der viel Redende nun doch der Dumme ist, kehren sich auch die Vorzeichen vor seinen Bewertungen um: Nun ist die Mutter die Unverständige, die anderen sind die Klugen. Aber so einfach ist es auch nicht, denn bisher ist noch nicht geklärt worden, warum der Vater überhaupt bei seiner Frau bleibt.
[Der saufende Krüppel & der schiefe Haussegen: Vielfalt der Indizien.]
Dieser Text enthält eine Vielzahl von (innertextlichen) Bezügen, Parallelen, Kontrasten und Symbolen, die als Indizien (Hinweise) auf die Figuren oder den Erzähler verweisen. Aus diesem Facettenreichtum sollen hier nur einige Beispiele aufgezählt und teilweise vorsichtig gedeutet werden. Es beginnt damit, dass sich die beiden Frauen - eine weitere Redewendung wörtlich umsetzend - in die Haare geraten und dass die Mutter (die ihr Problem buchstäblich beim Schopfe packt) die Freundin des Vaters ausgerechnet in diesem Zusammenhang „Laus“ nennt (S.91). Dabei hat sie selbst keine Haare, ihre Kahlköpfigkeit (S.92) entspricht ihrem männlich- gewalttätigen Auftreten.
Dieses Auftreten erfolgt, wie deutlich betont wird, „mit beiden Füßen“ (S.92), während der Vater, der saufende Krüppel, nur ein Bein hat. Indem die Mutter aus der Gefangenschaft kommt, nimmt sie Haus und Hof, Mann und Sohn in Besitz und schleudert eine Frau wie einen Gegenstand an die Wand (sicher nicht in der Hoffnung, dass aus dem „Ungeziefer“ eine Prinzessin wird), an der dann buchstäblich der Haussegen schief hängt (S.92). Der Jesus im Flur, einem Übergangsraum, erscheint immer dann im Bild, wenn jemand fällt und etwas kaputtgeht. Beim ersten Mal (mittags, am helllichten Tag) fällt die Freundin gegen die Wand und ihres und des Vaters Leben geht kaputt. Beim zweiten Mal („eines Abends“ (S.102), im Dunkeln) fällt der betrunkene Vater genau gegenüber in den Spiegel und zerstört damit ein Symbol der Wahrheit, Selbsterkenntnis und Weisheit. Beim dritten Mal sitzen der Erzähler und sein Nachkomme, der ihn erzählt, im Übergangsraum Flur, und der Fall der Mutter von dem Sockel, auf den sie der Sohn gehoben hat, kündigt sich an, während der Sohn seine eigene Geschichte zerstört, indem er sie erzählt.
Am Ende dieser Geschichte müsste er von vorn beginnen und die Geschichte des Vaters erzählen. Des Mannes, dem der Sohn nachgeht, wie man einer Frage nachzugehen pflegt (S.96), während er im Urteil seiner Mutter folgt. Dieser Vater sitzt am Ort der männlichen Betätigung, neben dem Hackklotz, und tut nichts als geistige Getränke aufzunehmen (S.101), wodurch er dem Sohn „wie ein Geist“ vorkommt (S.100). Zwischen dem Brennholz sitzt er, und kurze Zeit später gehört er selbst zum Brennholz. Holz ist ein Symbol für Geborgenheit: die Wiege, das Ehebett und der Sarg sind gemeinhin aus Holz. Der Vater geht paradoxerweise aus dem Haus hinaus, um diese Geborgenheit zu finden. Er liest im Schuppen schweigend vielsagende Briefe. Weil er kein Grenzüberschreiter ist (obwohl er im Krieg um Grenzen gekämpft hat), der einfach seine Frau verlässt, gießt er seine Gläschen nur bis zu dem hellblauen Streifen voll (S.101).
Durch sein Schweigen verwandle der Vater die Geschenke der Mutter in Müll, sagt der Erzähler, derselben Mutter, deren erste Handlung im Haushalt das Wegwerfen des Essens ist, was noch auf dem Tisch steht (S.96). Der Erzähler trägt es als Liebesbeweis vor, dass seine Mutter seinen Namen noch gekannt habe (S.92), nennt aber selbst nicht einen einzigen Namen.
Körperliche Kontakte gibt es nur zwischen der Mutter und der Freundin (an den Haaren „herumwirbeln“, „Tritt“) und zwischen Mutter und Sohn (mit „gewaltigen Armen eingeschlossen“ (S.93); „ich konnte sie anfassen“ (S.102)). Der Vater, der in geistigem Kontakt zu seiner Freundin steht, ent zieht sich körperlich seiner Frau, indem er ihr die Hand weg zieht, und zwar „bis zum letzten Atem zug “36, was der Sohn als Rück zug wertet.
Zu dem Sohn, der „laut schreiend“ (S.103) seine Aufmerksamkeit erregen will, indem er droht, Glassplitter zu schlucken, obwohl er beileibe kein Glasfresser ist, sagt er nur: „Der Krieg ist aus“, was soviel heißt wie: Die Gewalt ist zu Ende. Aber erst danach kommt seine gewaltige Frau aus der Gefangenschaft zurück. Als er auf dem Sterbebett liegt, beobachtet der Sohn „durch die Gardine“ (S.104) seine Freundin, der er wie seinem Vater vorwirft, feige zu sein: „Nur in diesem einen trüben Punkt seien die beiden sich einig gewesen, in ihrer Feigheit“ (S.97)37. Dem „trüben Punkt“ entspricht die mangelhafte Erinnerungs- und Urteilsfähigkeit des Sohnes.
Während die Mutter nach dem Tod des Vaters und auch schon vorher auf eine Neuordnung ihres Lebens verzichtet, weshalb sie auch die Briefe der Freundin noch nicht gefunden hat, ist der Sohn während des Erzählens gerade dabei, die Überreste ihres Lebens zu ordnen.
Nachdem der Vater gestorben ist, erscheint er angsterzeugend im Traum (im Leben als Geist, aber im Traum als Mensch) und nimmt seinen Sohn „bei der Hand“ (S.98) - er, der immer seiner Frau die Hand entzogen hat. Er stellt damit eine Verbindung zum Sohn her, die er im Leben nicht hatte und seiner Frau versagt hat. Man kann also auch ihn anfassen, und diese Nähe wirkt warm. Der Sohn folgt ihm auch, er ist bereit, sich auf seinen Vater einzulassen. In einem Boot fahren die beiden ins Reich der Toten, auf ein Meer hinaus, wo nichts sie stören kann, und der Vater beginnt zu sprechen. Der Sohn aber, taub für die Worte seines Vaters, sieht, wie diese Worte gleich Wirbelstürmen durch seine Vorstellungswelt jagen, Bäume entlauben, die Vorstellungswelt verändern. Er ahnt, dass seine (Erinnerungs-) Welt sich verändern wird, wenn er die Worte des Vaters erfährt.
Sobald der Vater schweigt (wofür er einen triftigen Grund hat, nämlich den Aufruhr, den seine Worte erzeugen), beruhigt sich auch die Traum-Welt des Sohnes. Frei von allen Vorurteilen (ein weißes Blatt Papier, kein Brief!) liest er die Worte, die sein Vater nun sagt. „Die Wahrheit [...] sei aus anderem Stoff als ein Schweinebraten“ (S.98f.), nämlich nichts Körperliches, sondern etwas Geistiges. Man kann sie nicht einfach wegwerfen, wie die Mutter das Essen weggeworfen hat, und man kann sie auch nicht aus dem Haus jagen.
Plötzlich ist das Boot festgefroren, das Eis symbolisiert die Kälte der Beziehung zwischen Vater und Sohn und die Starrheit der Vorurteile, die der Sohn seinem Vater entgegenbringt, und über dieses Eis muss er nun aus eigener Kraft „nach Hause zurückgehen“. Er muss seine Vater- Abneigung überwinden und sich dann ansehen, wie sein Zuhause nun aussieht. Ein gefahrvolles Unternehmen, weil man ja auch einbrechen kann. Durch das Eis ist der Erzähler auch wieder an den Anfang der Geschichte zurückgebunden, nach Sibirien. Wenn der nun wieder erwachte Sohn in seiner Vorstellung das leere Boot auf dem nun wieder aufgetauten Wasser schaukeln sieht und die Wahrheit der Wind ist, der dieses Boot schaukelt, die aber dort von niemandem wahrgenommen wird, sieht das wie eine Einladung aus: Das Boot ist da, es ist leer, und die Wahrheit ist greifbar nahe, auch das Eis ist aufgetaut, so wie sich die Urteile des Erzählers am Ende seiner Erzählung zu lockern beginnen, weshalb die Erzählung so abrupt endet. Nur der Vater ist nicht mehr da.
Die Mutter hat Sibirien überlebt, aber auch der Vater hat eine Geschichte. Um seine Eltern gerecht beurteilen zu können, muss der Sohn Sibirien vergessen oder zumindest die Beurteilung des Verhaltens der Mutter nicht daran binden, dass sie Sibirien überlebt hat.
[Die Angst vor der Wiederbelebung der Vergangenheit: Schluss.]
Die Erzählung handelt davon, wie sich ein älterer Mann offenbar falsche Urteile über seine Eltern buchstäblich einredet. Er bewundert seine Mutter, die aus russischer Gefangenschaft (körperlich) zurückgekehrt ist, aber Sibirien paradoxerweise als Land ihrer Sehnsucht noch in sich trägt. Den Vater, der nach der Rückkehr seiner Frau deren Gefangener ist und dessen Liebe zwar erfolgreich aus dem Haus, aber nicht aus seinem Kopf vertrieben wurde, hasst er dafür, dass er seine Frau nicht so liebt wie er. Seine Erzählung beginnt mit dem, woran er sich am liebsten erinnert, und endet mit dem, was er am wenigsten gern erfahren will. Am Ende der Erzählung ist die Diskrepanz zwischen seinem Urteil und dem Bild, das die von ihm erzählte Geschichte ergibt, so groß, dass er selbst es zu ahnen beginnt und vor Angst verstummen muss.
[Literaturverzeichnis.]
Textquelle:
Erpenbeck, Jenny: Sibirien. In: Erpenbeck, Jenny: Tand. Erzählungen, Frankfurt am Main 2001, S. 91-105.
Sekundärliteratur und Nachschlagewerke:
Genette, Gerard: Die Erzählung. 2. Auflage, München 1998.
Martinez, Matias & Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie. München 1999. Biedermann, Hans: Lexikon der Symbole. München 1989.
Cooper, J.C.: Lexikon der Symbole.
Stefan Weise, 12.9.2002.
[...]
1 Gerard Genette: Die Erzählung. 2. Auflage, München 1998. Im Folgenden als: Genette, mit Seitenzahl.
2 Jenny Erpenbeck: Sibirien. In: Jenny Erpenbeck: Tand. Erzählungen, Frankfurt am Main 2001, S. 91- 105. Textnachweise im Folgenden mit Seitenzahl direkt im Anschluss an das Zitat.
3 Ich nenne diese erste Erzählinstanz ‚extradiegetisch’, obwohl sie Figur ihrer Rahmenerzählung ist. Da es keine übergeordnete Instanz gibt, halte ich das für angebracht. Vgl. Genette S. 162f.
4 An manchen Stellen, an denen nicht im distanzierenden Konjunktiv erzählt wird, ist nicht eindeutig klar, ob es sich um Kommentare des extradiegetischen Erzählers oder um berichtete Rede handelt. Zitatzeichen fehlen grundsätzlich, auch wo es sich eindeutig um berichtete Rede handelt: „Eine Erscheinung, meine Mutter.“ (S.93) Wären es Kommentare, würde man nur feststellen, dass der extradiegetische Erzähler dem intradiegetischen nicht widerspricht, was man auch so bemerkt. Ich tendiere dazu, diese unsicheren Fälle als berichtete Rede anzusehen.
5 Der Erzähler nimmt einige Male einen Fokalisierungswechsel vor und erzählt, was die anderen Figuren denken. Genauer dazu im Kapitel über den unzuverlässigen Erzähler.
6 Ich meine im Folgenden mit der einfachen Bezeichnung ‚Erzähler’ immer den intradiegetischen Erzähler und nicht den extradiegetischen.
7 Siehe Anmerkung 5.
8 Ich verwende diesen Begriff, um den Betrachteten (Fokussierten) vom Betrachtenden (Fokalisierenden) zu unterscheiden, eine Unterscheidung, die Genette nicht zur Verfügung stellt.
9 „Kein Wort hat die sich zu sagen getraut.“ (S.94). Parallel dazu wenige Zeilen später: „Hätte sich nicht getraut, mit ihm, dem Sohn, zu reden“.
10 Auf S.18 Dieser Arbeit.
11 Hervorhebung von mir. An dieser Stelle wird meiner Meinung nach am deutlichsten, wie der Erzähler seine eigene Sicht in den Vater hineininterpretiert.
12 ‚Erzähl-Situation’ meine ich wörtlich und nicht in Stanzels Sinn.
13 Barthes meint mit seiner „Ebene der Funktionen“ dieselbe Ebene. Seine „Handlungsebene“, auf der die Figuren mit ihren Beziehungen Platz finden, gibt es bei Genette nicht. Sie ist aber für das, was ich hier sagen will, sehr brauchbar, daher die leichte begriffliche Verwirrung an dieser Stelle.
14 Siehe Anmerkung 13.
15 Ab S.10 dieser Arbeit.
16 Ein Drittel der Sequenzen beziehen sich auf den Vater, der Rest auf die Freundin bzw. niemanden (Rahmenhandlung).
17 Der Sohn tritt an wenigen Stellen selbst als Handelnder auf (z.B. S.98 oben), wird aber vom Erzähler nie in den Blick genommen.
18 Man kann den letzten Satz der Erzählung auch als Prolepse lesen, die auf das Finden der Briefe in unbestimmter Zukunft weist. Dann wäre der Traum nur noch eines von zwei Elementen.
19 Hervorhebung von mir.
20 Man könnte auch behaupten, dass es sich dabei nur um eine Nachlässigkeit des Erzählers handle. Um aber nicht zu frühzeitig in eine Art Relativismus zu verfallen, der den Erzähler gänzlich seiner Glaubwürdigkeit entheben würde, wird hier alles ernstgenommen, was nicht eindeutig widersprüchlich ist.
21 z.B. S.92f, S.96, S.98, S.102.
22 Siehe Anmerkung 6.
23 Ich habe diese Altersangaben willkürlich gewählt. Sie sollen den Unterschied zwischen dem Kind und dem erwachsenen Mann, der selbst ein höchstwahrscheinlich bereits erwachsenes Kind hat, deutlich machen.
24 Vgl. S. 94f.
25 Auf S.15 dieser Arbeit.
26...von Erzählungen, könnte man noch hinzufügen, um nochmals auf die Situation hinzuweisen, dass die Worte des Erzählers ja auch nur erzählte Worte sind.
27 Hervorhebung von mir.
28 Ich meine mit „hellsichtig“, dass der Erzähler hier Dinge zum Ausdruck zu bringen scheint, die ihm nach allen anderen Beobachtungen gar nicht klar sind.
29 Hervorhebung von mir.
30 Zuweilen kann man sogar eine Art Vorwurfsgestus gegenüber dem Vater und dessen Freundin bemerken. (z.B. S.97).
31 Der Erzähler hätte auch sagen können: Geist. Aber dieses Wort ist für die Erscheinung des Vaters vorbehalten, dem aber kein Verstand zugeschrieben wird. Der Vater erscheint wie ein Geist, aber die Mutter ist eine Erscheinung und hat angeblich einen strahlenden Verstand. Dies ist an sich nicht widersprüchlich, weist aber mit möglicherweise von der Autorin intendierter Ironie auf Widersprüche hin.
32 Hervorhebungen von mir.
33 Auch die Freundin erhält eine Benennung, die gerne für den Teufel verwandt wird: „Widersacherin“.
34 Kursivsetzung von mir.
35 Ergänzung in eckigen Klammern von mir.
36 Hervorhebung von mir.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Jenny Erpenbecks Erzählung "Sibirien"?
Die Erzählung "Sibirien" von Jenny Erpenbeck ist ein komplexes Mosaik aus Erinnerungen und Reflexionen, in dem ein Mann sich an seine Eltern erinnert. Er zeichnet ein positives Bild seiner Mutter und ein eher negatives Bild seines Vaters und dessen Freundin. Die Erzählung untersucht die Themen Erinnerung, Wahrnehmung und die Subjektivität von Urteilen.
Wer sind die Erzähler in "Sibirien"?
Es gibt mehrere Erzählebenen:
- Extradiegetischer Erzähler: Ein Nachkomme des intradiegetischen Erzählers, der die Geschichte des Vaters erzählt, ohne Wertung oder Kommentar.
- Intradiegetischer Erzähler: Der Vater selbst, der aus seiner Kindheit erzählt und Wertungen über seine Eltern abgibt.
- Metadiegetischer Erzähler: Die Mutter, deren Erzählungen über Sibirien in die Geschichte eingeflochten sind.
Was ist der "Hinauswurf" und welche Bedeutung hat er?
Der "Hinauswurf" bezieht sich auf die Szene, in der die Mutter die Freundin des Vaters aus dem Haus wirft. Diese Szene wird mehrfach aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt und stellt einen zentralen Punkt der Erzählung dar, um den sich die anderen Ereignisse gruppieren. Die veränderte Wahrnehmung dieser Szene durch den Leser im Laufe der Erzählung ist zentral.
Wie ist die Zeitstruktur der Erzählung aufgebaut?
Die Erzählung weist eine elliptische Zeitstruktur auf. Es gibt wenige singulativ erzählte Szenen, während viele Ereignisse iterativ dargestellt werden. Analepsen (Rückblenden) und Prolepsen (Vorausdeutungen) durchbrechen den linearen Erzählfluss, wodurch ein fragmentarischer Eindruck entsteht.
Inwiefern ist der Erzähler in "Sibirien" unzuverlässig?
Der Erzähler ist unzuverlässig, da er als Kind bestimmte Ereignisse erlebt hat, die er als Erwachsener aus seiner aktuellen Perspektive interpretiert. Erinnerungen können verblassen oder sich unter dem Einfluss von Wertungen verändern. Zudem ist es dem Leser nicht immer klar, ob die Wertungen dem kindlichen Beobachter oder dem erwachsenen Erzähler zuzuschreiben sind.
Welche Rolle spielt das Schweigen in der Erzählung?
Das Schweigen des Vaters wird im Gegensatz zur redseligen Mutter negativ bewertet. Der Erzähler deutet das Schweigen des Vaters als Mangel an Liebe und Engagement. Die Arbeit deutet an, dass das Schweigen auch als Zeichen von Resignation, innerem Konflikt oder als Kommunikationsstrategie interpretiert werden kann.
Welche Symbole finden sich in der Erzählung "Sibirien"?
Die Erzählung enthält zahlreiche Symbole, die auf die Figuren und ihre Beziehungen verweisen:
- Haare: Der Streit um die Haare (wörtlich genommen) deutet auf den Konflikt zwischen den Frauen hin.
- Der hinkende Jesus: Jesus an der Wand wird immer erwähnt, wenn etwas im Argen liegt.
- Holz: Symbol für Geborgenheit, die der Vater sucht, aber nicht findet.
- Spiegel: Ein Symbol für Wahrheit und Selbsterkenntnis, das durch den betrunkenen Vater zerstört wird.
Was ist das Fazit der Analyse von "Sibirien"?
Die Erzählung handelt davon, wie ein älterer Mann falsche Urteile über seine Eltern fällt und sich selbst einredet. Am Ende der Erzählung wird die Diskrepanz zwischen seinem Urteil und dem Bild, das die von ihm erzählte Geschichte ergibt, so groß, dass er selbst es zu ahnen beginnt und vor Angst verstummen muss.
- Citar trabajo
- Stefan Weise (Autor), 2002, Die Wiederbelebung der Vergangenheit. Erzählstrukturen in Jenny Erpenbecks Erzählung -Sibirien-, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108811