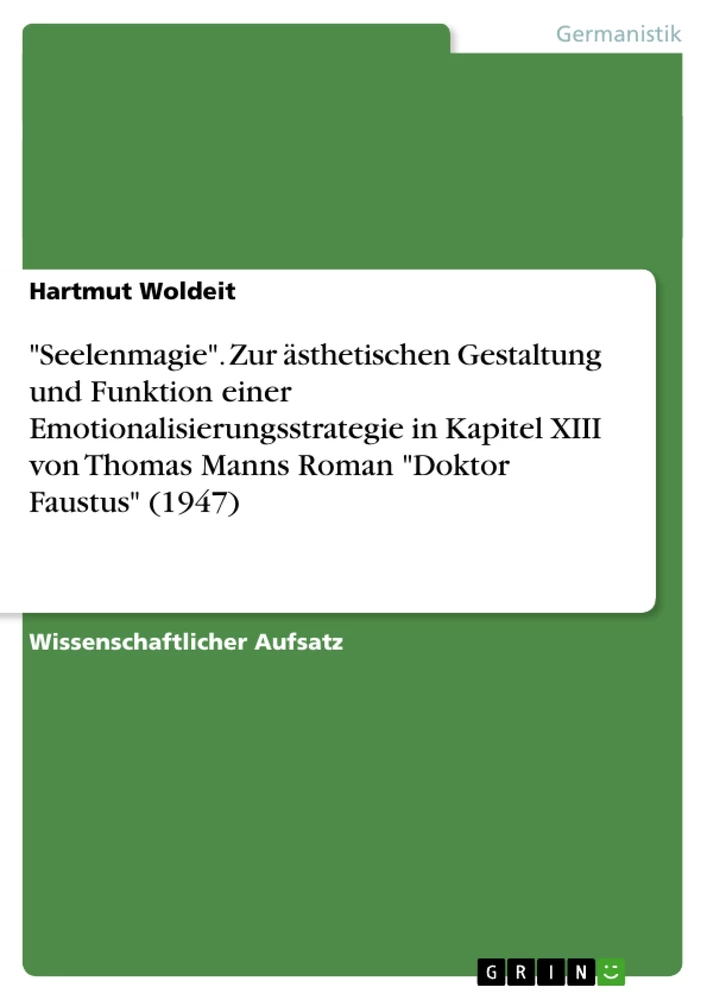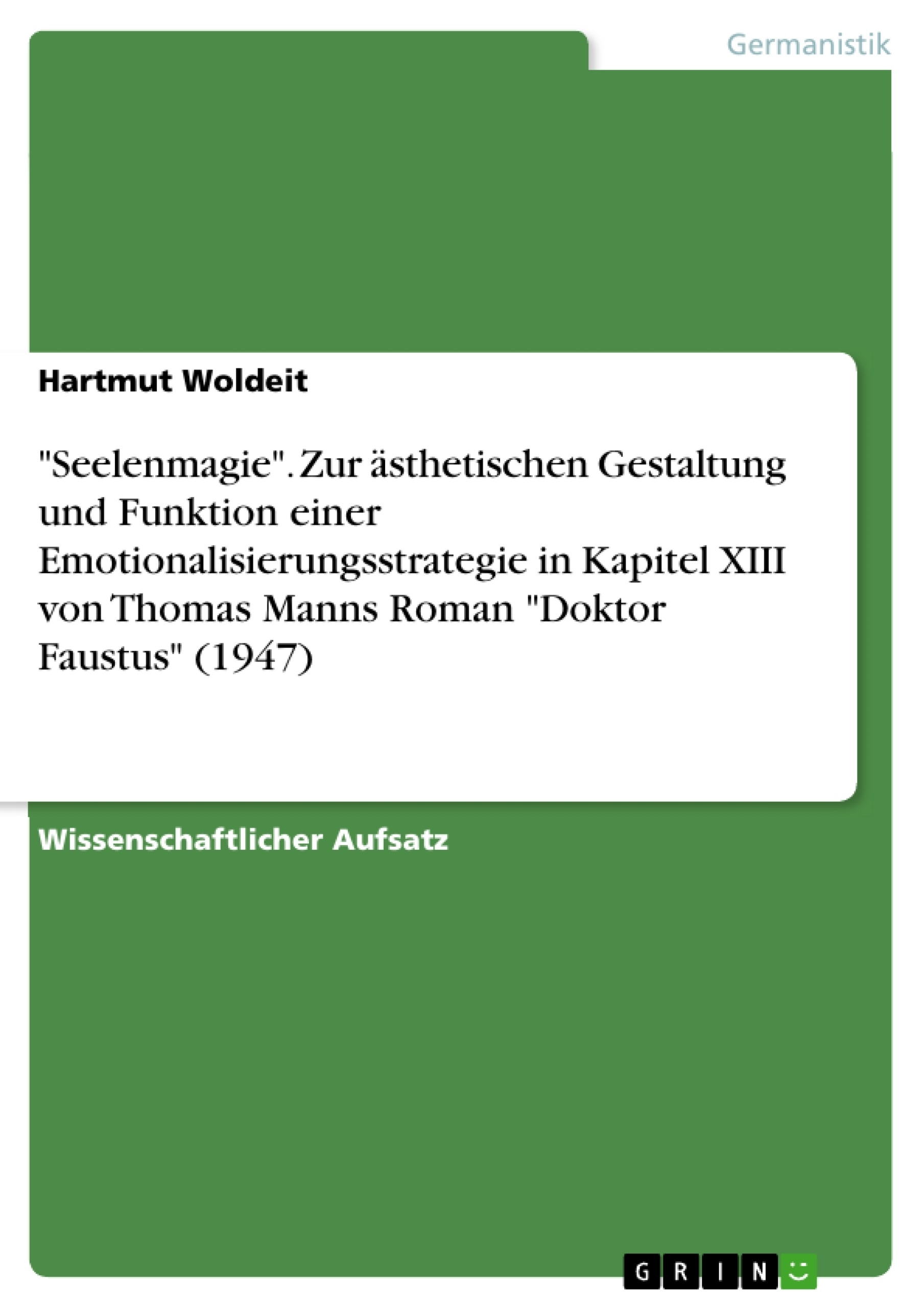Gegenstand der Arbeit ist die Ausweisung und Untersuchung einer
Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII des Romans „Doktor Faustus“. Durch Anwendung tiefenpsychologischer Erkenntnisse der Freud-Schule wird gezeigt, daß die Emotionalisierungsstrategie über ihre identifikatorische Leserwirkung hinaus auch Ausdruck eines
neurotischen Komplexes der Erzählerfigur des Romans -Dr. Serenus Zeitblom- ist. In einem Exkurs wird die Hauptfigur von Kapitel XIII, der Privatdozent Dr. Schleppfuß, analysiert. Schließlich wird im
Rahmen des für die vorliegende Untersuchung grundlegenden kommunikativen Dreiecks Autor-Werk-Leser das rezeptionsästhetische Kalkül Thomas Manns aufgezeigt, mittels der Emotionalisierungsstrategie einen groben Kunstfehler in der Gestaltung der Romanfigur Dr. Schleppfuß zu verhüllen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort: Noch eine Arbeit zum „Doktor Faustus“?
- Abschnitt A
- A 1. Die Ausgangskonstellation: Roman versus Biographie
- A 1.1. Die ästhetische Zwickmühle; Durchführung der Untersuchung
- A 1. Die Ausgangskonstellation: Roman versus Biographie
- Abschnitt B
- B 1. Thomas Manns Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII
- B 1.1. Leserwirkung I
- B 1.2. Mehrdeutige Anführungszeichen
- B 1.2.1. ›unvermögend‹/›Unvermögen‹: Anführungszeichen zwischen Zitationskennzeichen, Distanzierungsmerkmal und Markierung einer Bedeutungsaufhebung
- B 1.2.2. Leserwirkung I (Fortsetzung und Schluß)
- B 1.3. Zur psychoanalytischen Aufklärung der Anführungszeichen
- B 1.3.1. Zeitbloms Verwendung von Anführungszeichen beim Nomen ›Unvermögen‹ als Indiz einer unbewußten Zwangshandlung
- B 1.3.2. Zeitbloms Perspektivenwechsel und dessen Funktionen
- B 1.4. Zwischenfazit, Reflexion und Hinweise zum weiteren Gang der Arbeit
- B 1.5. Zeitbloms Wiedergabe von Schleppfuß' Erläuterungen zum Fall Klöpfgeißel
- B 1.5.1. Zur Leserwirkung von Dr. Schleppfuß
- B 1.5.2. Zeitbloms Resümee zur Vorlesung des Dr. Schleppfuß
- B 1.6. Exkurs: Dr. Schleppfuß als Künstlerfigur
- B 1.6.1. Vertiefung der Analyse: Schleppfuß' Vorlesung als Ausdruck intellektualisierten Sadismus
- B 1. Thomas Manns Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII
- Abschnitt C
- C 1. Die Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII als Verhüllung eines Kunstfehlers
- C 1.1. Zum Verhältnis von Emotionalisierungsstrategie und Zeitbloms Impotenz-Komplex
- C 1.1.1. Professor Kegel: Zur interpretatorischen Bedeutung einer unauffälligen Nebenfigur
- C 1.1.2. Zeitbloms Verwendung eines unpraktischen Schreibgerätes beim Abfassen der Biographie als frühe Andeutung seiner Neurose
- C 1.1. Zum Verhältnis von Emotionalisierungsstrategie und Zeitbloms Impotenz-Komplex
- C 1. Die Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII als Verhüllung eines Kunstfehlers
- Abschnitt D
- D 1. Schlußüberlegungen: Warum hat Thomas Mann auf die Figur des Dr. Schleppfuß nicht verzichtet?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII von Thomas Manns „Doktor Faustus“. Sie analysiert, wie diese Strategie die Leser beeinflusst und gleichzeitig einen neurotischen Komplex der Erzählerfigur, Dr. Serenus Zeitblom, offenbart. Ein Exkurs widmet sich der Figur des Dr. Schleppfuß. Schließlich wird das rezeptionsästhetische Kalkül Manns beleuchtet.
- Analyse der Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII von „Doktor Faustus“
- Wirkung der Strategie auf den Leser
- Zusammenhang zwischen Emotionalisierungsstrategie und Zeitbloms neurotischem Komplex
- Charakterisierung der Figur Dr. Schleppfuß
- Rezeptionsästhetisches Kalkül Thomas Manns
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort diskutiert die umfangreiche Sekundärliteratur zu „Doktor Faustus“ und begründet die Notwendigkeit einer weiteren Arbeit mit literaturpsychologischem Ansatz. Abschnitt A beschreibt die Ausgangskonstellation des Romans als Biographie und den daraus resultierenden ästhetischen Herausforderungen. Abschnitt B analysiert Manns Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII, insbesondere die vielschichtige Verwendung von Anführungszeichen und deren psychoanalytische Bedeutung im Kontext von Zeitbloms Erzählperspektive. Es folgt ein Exkurs zur Figur Dr. Schleppfuß. Abschnitt C untersucht die Emotionalisierungsstrategie als Mittel zur Verschleierung eines möglichen Kunstfehlers in der Gestaltung von Schleppfuß und deren Zusammenhang mit Zeitbloms Neurose.
Schlüsselwörter
Thomas Mann, Doktor Faustus, Kapitel XIII, Emotionalisierungsstrategie, Leserwirkung, Psychoanalyse, Freud, Dr. Serenus Zeitblom, Dr. Schleppfuß, Anführungszeichen, neurotischer Komplex, rezeptionsästhetisches Kalkül, Kunstfehler.
- Quote paper
- Hartmut Woldeit (Author), 2003, "Seelenmagie". Zur ästhetischen Gestaltung und Funktion einer Emotionalisierungsstrategie in Kapitel XIII von Thomas Manns Roman "Doktor Faustus" (1947), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108834