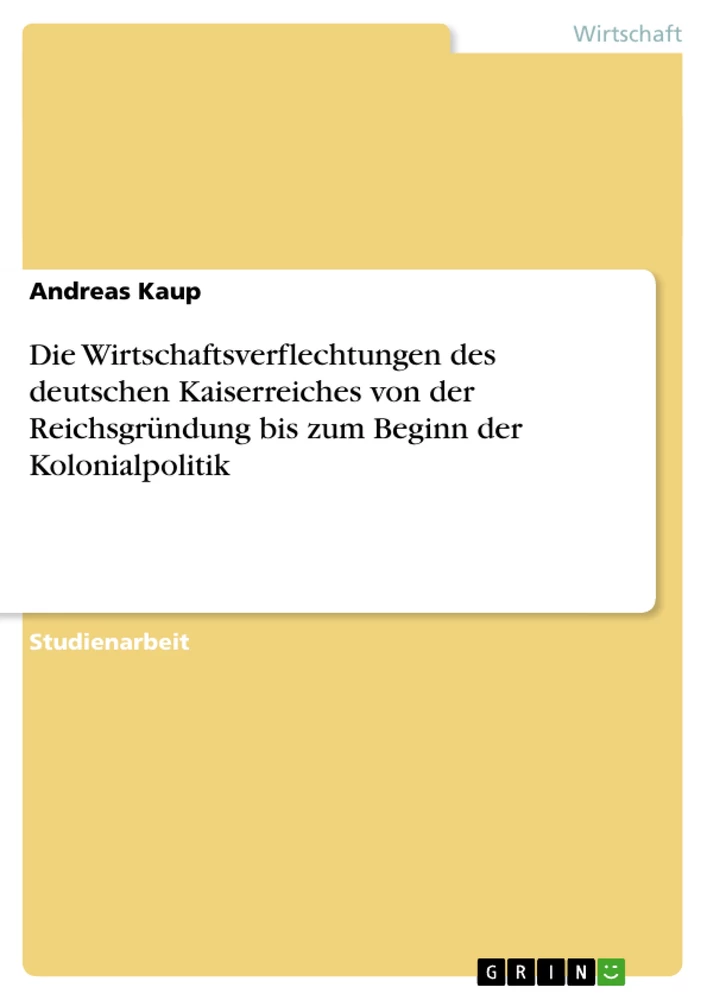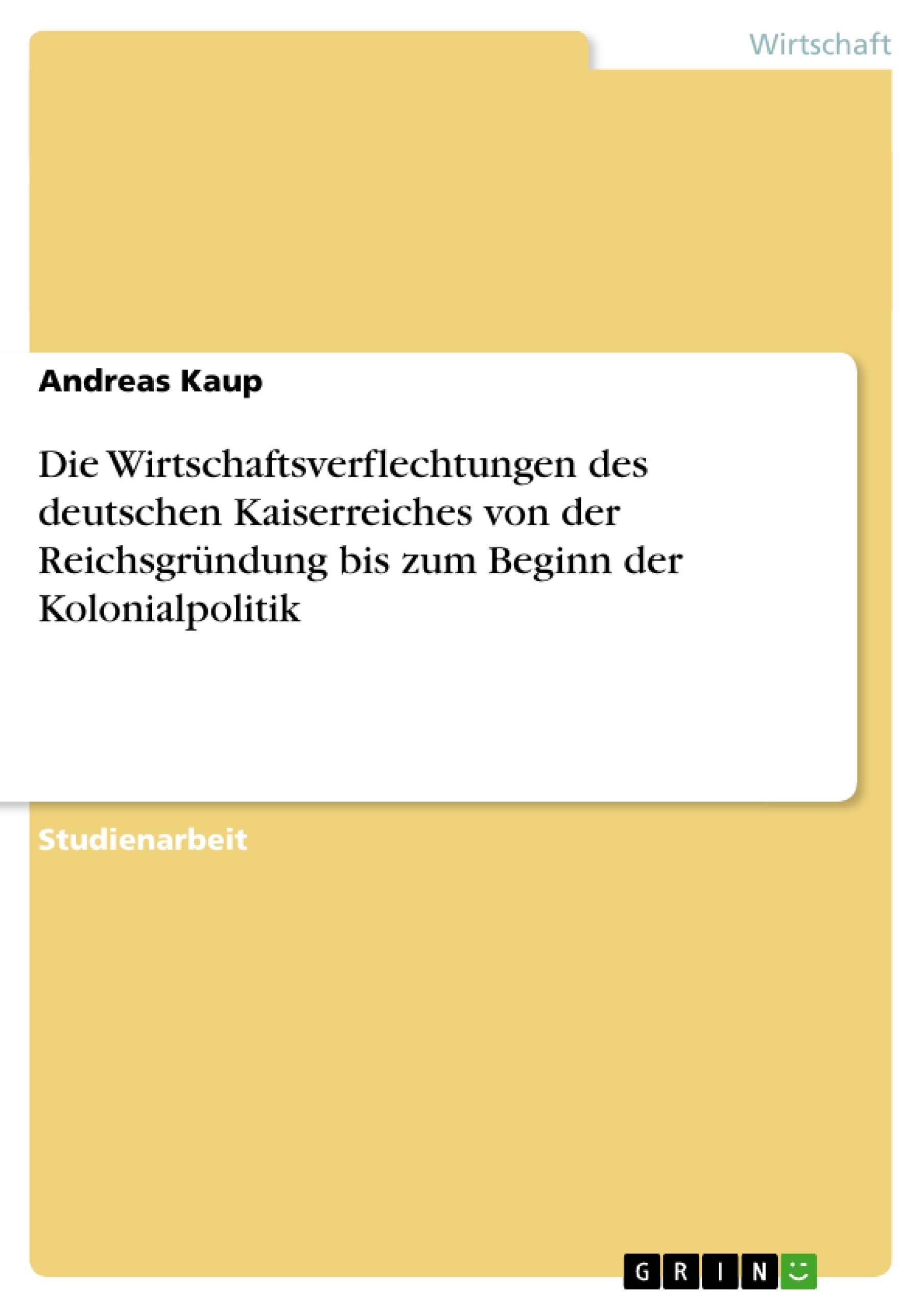Inhaltsverzeichnis
1. Abgrenzung und Definitionen
Der deutsche Zollverein als Vorläufer der Zollpolitik
2. Konjunkturen, Zusammenhänge, Institutionen, Kooperationen
Außenhandel:
Internationale Konjunktur
Die Handelspolitik
Einfluß internationaler Standardisierungen
Grenzübergreifende Beziehungen deutscher Industrie
Goldstandard
Konjunktur und anschließende Rezession
3. Dienstleistungen, Kapital und Finanzen
Innerdeutsche Bündelung zur internationalen Durchsetzungskraft
4. Der Warenaustausch
Der Außenhandel im europäischen Zusammenhang
Eisen und Eisenbahnmaterial
Agrarerzeugnisse Zölle und das Einnahmeninteresse des Reiches
5. Grenzüberschreitender Verkehr und Kommunikation
4. Fazit und Wertung
Anhänge:
Literaturverzeichnis
Versicherung
1. Abgrenzung und Definitionen
Diese Hausarbeit beleuchtet Verflechtungen der deutschen Wirtschaft mit denen des Auslandes. Bereits vor der Reichsgründung hatte sich ein innerdeutscher Binnenmarkt entwickelt, gefördert durch den Zollverein und den Norddeutschen Bund. Ab 1871 waren die Aktivitäten mit dem Ausland nicht mehr primär „preußisch“ oder „bayerisch“, sondern wurden „deutsch“: Mit der Gründung des einheitlichen Hoheitsgebietes bekamen die bisherigen außenwirtschaftlichen Aktivitäten der Einzel-Länder eine neue Kraft und Bedeutung. „The German territories had long maintained close and complex trading links with the rest of the world.“.[1] Fischer definiert bereits ab 1850 das Deutsche Reich im wirtschaftlichen Sinne durch den Zollverein zzgl. Schleswig Holstein und Hansestädte, aber schon ohne Österreich.[2]
Mit dem Eintritt des Kaiserreiches in die europäische Gruppe der Kolonialstaaten Ende der 1880er Jahre erhielten die internationalen Wirtschaftsverflechtungen wiederum eine andere Qualität, weshalb sich eine Zäsur hier anbietet. Fischer[3] sieht den Beginn einer aktiven Kolonialpolitik schon mit der wirtschaftspolitischen Wende Bismarcks Mitte der 1880er Jahre. Seitdem werden wirtschaftliche Interessen im Ausland zunächst nur geschützt, später auch aktiv gefördert.
Untersucht werden sollen die Verflechtungen in Form von Ex- und Importen von Waren, Dienstleistungen und Kapital, auch die Institutionen, von denen die Außenwirtschaft betroffen war. Die Leitfrage geht immer über die Zusammenhänge zwischen den außenwirtschaftlichen Aktivitäten und der deutschen Wirtschaft. Die industrielle Revolution in Deutschland mit ihrer Ausweitung an Produktionskapazitäten und Rohstoffbedürfnissen und der technologische Wandel in Verkehr und Kommunikation bargen Wechselseitigkeiten, die viele Entwicklungen z.B. im Finanzwesen erst ermöglichten. All diese Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen sind keinesfalls monokausal zu erklären, sondern stehen in engen Zusammenhängen. Lohnende separate Themen sind die Migrationen und die sozialen Auswirkungen der außenwirtschaftlichen Verflechtungen, die hier beide nicht angesprochen werden können.
Das Material aus dem 19. Jahrhundert ist bereits mehrfach analysiert worden, sodass hier keine primäre Datenerhebung sinnvoll ist. Besonders schwierig ist die Einschätzung der Wirtschaftszahlen, da ein zentrale statistische Erfassung z.B. des Außenhandels erst ab ca 1883 begann. Die Aufbereitungen von Zorn und Fischer dienen hier als anerkannte Grundlage.[4],[5]
Die Arbeit ist nicht personal- oder intentionalorientiert, sondern schaut überindividualistisch auf Prozesse und vor allem Strukturen. Der Versuchung, deterministische Schlüsse und Wertungen zu ziehen, darf in dem hier gegebenen Umfang nicht nachgegeben werden.
Der deutsche Zollverein als Vorläufer der Zollpolitik
Als wirtschaftlicher Vorläufer des Zollgebietes des Deutschen Kaiserreiches ist der Deutsche Zollverein wesentlich, weil durch ihn seit 1833 innerpreußische und später innerdeutsche Handelshemmnisse abgebaut wurden und auf die (klein-)deutsche Einheit hingewirkt wurde. Nach innen wurden Zölle, Tarife und nicht-tarifäre Hindernisse abgebaut, nach außen die Einfuhrzölle vereinheitlicht. In den 1860er Jahren schloß der Zollverein 21 Handelsverträge mit Meistbegünstigungsklauseln, seit 1865 wurden keine Getreidezölle mehr erhoben.[6]
2. Konjunkturen, Zusammenhänge, Institutionen, Kooperationen
In den 1850er Jahren erlebte der innereuropäische Handel einen starken Aufschwung. Die Rationalisierungen und Produktivitätssteigerungen in den Industrieländern, auch in den Folgejahrzehnten, zusammen mit dem Ausbau der Eisenbahnverbindungen auf dem Kontinent führten zu einer Verbilligung der Produkte und ihrer Transporte.
Durch die Lage Deutschlands im Zentrum Europas mit den vielen Außengrenzen war Außenhandel selbstverständlich: Viele Absatz- und Rohstoffmärkte lagen in ethnischer und geographischer Nähe eher im angrenzenden Ausland statt in den fernen Teilen Deutschlands. Die Steigerungen in Bevölkerungszahl und Lebenstandard machten zudem den Import von Rohstoffen und Halbfertigprodukten erforderlich, die letztlich nur von Exporterlösen bezahlt werden konnten. Der Anteil des deutschen Reiches an der Weltindustrieproduktion betrug 1880 13% und stieg später signifikant an.[7]
Außenhandel:
Die Struktur des Außenhandels änderte sich in jenen Jahren signifikant von der eines typischen Agrarlandes zu der einer Industrienation. Der Anteil der Nahrungsmittel und Rohstoffe am Export ging stetig zurück, selbst innerhalb der Nahrungsmittel verdrängte das Verarbeitungsprodukt Zucker später das Getreide. Bei den Rohstoffen tritt die Kohle an die Spitze. Der Anteil der Halbfertigwaren stieg von 6-7% auf über 30% erheblich, der der Fertigwaren stagnierte bei knapp über 50%, es waren vor allem Apparate und Maschinen.[8]
Internationale Konjunktur
Der Einfluß der internationalen Konjunkturbewegungen auf die Deutsche Wirtschaft wuchs im Betrachtungszeitraum. Der Deutsch-Französische Krieg unterbrach das stürmische Wachstum in Deutschland nur kurz, mit den anschließend sehr schnell fliessenden Reparationszahlungen wurde die deutsche Wirtschaft über die stark gestiegene Geldmenge regelrecht befeuert. Die Gründerzeit ab 1871 fiel in die internationale Boom-Konjunktur und förderte den Export für Produktion, Handel und Finanzen[9]. Durch die neuen Abhängigkeiten der z.T. wirtschaftlich irrationalen Gründungen und Verbindungen wurde die Weltwirtschaftskrise, die Mai 1873 durch eine platzende Börsenblase in Wien begann und sich über die Börsen New Yorks im Winter 1873 nach Deutschland ausbreitete[10], auch nach Deutschland importiert. Obwohl die Hauptabsatzmärkte der deutschen Exportmärkte sich bald wieder stabilisierten, konnte der deutsche Außenhandel die wegbrechende Konjunktur des Inlands und die anschließende Rezession nicht aufhalten.[11] Die Preissenkungen im Ausland wurden zum größten Teil in Deutschland nachvollzogen, was zwar eine geringe Inflation, aber auch wertmäßig geringere Wirtschaftstätigkeit nach sich zog. Mengenmäßig hingegen produzierte die deutsche Wirtschaft in den Jahren 1871 bis 1885 stetig mehr.
Die Krise führte bei der deutschen Industrie zu Modernisierungen und Rationalisierungen, an den Märkten zum Preisverfall bei Rohwaren und Fertigprodukten. Die Weltmarktkonkurrenzfähigkeit wurde durch gezielten Verstoß gegen Urheberrechte und Patentrechte sowie mit Dumpingpreisen hergestellt.[12]
Die 1875 einsetzende Agrarkrise verstärkte die Krise der Industrie noch. Amerikanisches Getreide drang auf den europäischen Markt (das Hauptexportziel der deutschen Landwirtschaft) und die Getreidepreise sanken 1875 bis in die 90er Jahre. Besonders preußische Erzeugnisse wurden teurer produziert als die Importware.[13]
Die Handelspolitik
Die Handelspolitik bestand über die Zollpolitik hinaus in Verträgen zur Harmonisierung und Standardisierung technischer Spezifikationen, dem gezielten Abbau oder Aufbau von nicht-tarifären Handelshindernissen. Gerade auch im beginnenden Kaiserreich war Handelspolitik jedoch kein wirkliches Hauptthema, schon gar nicht des Kanzlers[14], sondern immer im Dienste der internationalen Politik, später der Großmachtpolitik Deutschlands. “Eine gesamtwirtschaftliche Konjunktur-, Wachstums-, Struktur- oder Ordnungspolitik im modernen Sinne konnte es in Deutschland ... nur sehr rudimentär geben, weil weder das Denken in gesamtwirtschaftlichen Kategorien noch die wirtschaftspolitischen Instrumente zur Steuerung der Volkswirtschaft ausgebildet waren.“[15]
Einfluß internationaler Standardisierungen
Gleichwohl beteiligte sich Deutschland an zahlreichen internationalen Vereinbarungen, die den grenzüberschreitenden Verkehr von Post, Eisenbahn und Schiffahrt erleichterten bzw. erst ermöglichten. Die Abkommen zum Niederlassungsrecht, zum Schutz von Marken und Patenten gaben deutschen Exporteuren Rechtsschutz und Rechtssicherheit, und schützte die Konkurrenz vor deutschenPlagiaten.[16],[17]
Ähnlich der Normierung der Währung in Deutschland war auch 1875 die internationale Normierung des Meters und Kilogramms ein Schritt zur Rationalisierung der grenzüberschreitenden Wirtschaft. Der Weltpostverein vereinheitlichte ab 1874 den internationalen Postverkehr und sorgte so für mehr Präzision und Geschwindigkeit.[18],[19]
Bereits in 1865 wurde der Telegraphenverkehr international geregelt, was zusammen mit den Überseekabeln (seit 1866) die für den Ausbau des Kapitalverkehrs entscheidendend wichtige schnelle und preiswerte Kommunikation ermöglichte. Auch ermöglichte erst 1873 ein bilateraler Vertrag mit England, daß die unter beiderseitiger Gerichtsbarkeit stehenden juristischen Personen im Inland akzeptiert wurden.[20]
Diese und andere Standardisierungen reduzierten die Transport- und Transferkosten für Waren und Finanzen im europäischen und auch internationalen Feld signifikant und förderten so den Handel.
Grenzübergreifende Beziehungen deutscher Industrie
Aus der Enge der heimischen Märkte heraus ergab sich für einige Industrieunternehmen die Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Expansion. Wegen der Zoll- und rechtlichen Bestimmungen[21] wurden Zweigwerke oder Kooperationen gegründet, so z.B. aus der Schweiz in Deutschland Maggi und Nestle. Deutsche Banken gründeten Tochterinstitute in anderen europäischen Ländern[22]. Durch die Regelungen u.a. des Patentrechtsschutzes konnten deutsche Lizenzproduktionen in anderen Ländern gegründet werden, durch die weitere Märkte erschlossen werden konnten[23]. Krauss & Cie gründete Lokomotiven-Zweigwerke im Ausland[24]. Siemens als sehr früher internationaler Konzern verfeinerte sein Netz Auslandsniederlassungen und Tochtergesellschaften durch um Um- und Neugründungen.[25] Die grenzüberschreitenden Lizenzierung wurde stark von der Chemiebranche und auch von der Stahlindustrie für die Fertigungen von Stahl, später zusätzlich Aluminium, genutzt.
Internationale Preiskartelle boten sich für homogene Güter an, die im Wettbewerb zwischen den Anbietern verschiedener Länder zum Preiskampf geführt hätten. Aber das einzig wesentliche grenzüberschreitende Kartell (Eisenbahnschienenkartell zwischen Belgien, Deutschland und Großbritannien) brach 1886 wieder auseinander. Der Versuch eines Kartells zwischen deutschen und britischen Reedereien zur Regelung der Übersee-Schiffahrt mißlang Anfang der 80er Jahre.
Goldstandard
Inund 1873 traten das neue Münzgesetz in Kraft, ein Bankgesetz von 1875 baute die 7 verschiedenen Währungsgebiete und 33 Notenbanken ab, und ersetzte sie durch die Preußische Bank, die 1875 in Reichsbank umbenannt wurde. Die Mark wurde in ganz Deutschland gesetzliches Zahlungsmittel und ihr Wert wurde, analog der englischen Konstruktion, an eine Golddeckung gebunden. Dadurch konnte de jure jeder Ausländer oder Inländer eine Mark-Banknote jederzeit bei der Reichsbank gegen eine festgelegte Menge Goldes umtauschen: Eine wesentliche, wenngleich auch praktisch nie benutzte Sicherheit im Außenhandel zur Akzeptanz deutscher Rechnungen und Zahlungen. Die weitestgehende Schwankungsfreiheit der relevanten Währungskurse ließ Im- und Exporteure sowie Finanzinvestoren auf sicheren Werten kalkulieren. Inflation war wegen des Preisdrucks durch Importe (vor allem die Importpreise der Rohstoffe und Agrarprodukte sanken stetig) kein Thema, denn dieser verhinderte wirksam Preissteigerungen im Inland, zusätzlich zu den anderen Senkungsfaktoren der Preislandschaft.[26],[27] Die Einführung des Goldstandards war auch durch die französischen Goldreparationen erleichtert worden, weil diese unter anderem in Gold geleistet wurden.
Konjunktur und anschließende Rezession
Die 5 Mrd Goldfranken Reparationen aus Frankreich wurden zur Hälfte (2,2Mrd Mark) für Modernisierung von Heer und Kriegsmarine und Festungen ausgegeben. Davon profitierte primär die Rüstungsindustrie: Stahl, Telegraphie und Bauindustrie durch direkte Aufträge des Reiches, mithin konsumptiv. Mit der anderen Hälfte wurden via Reichsfonds industrielle Investitionen finanziert und Staatsschulden getilgt. Die Ablösung von Staatsschulden ermöglichte widerum Banken und anderen Financiers, das frei gewordene Geld in die Industrie (und andere Geldanlagen) zu investieren. Der starke Anstieg der Geldmenge (ca 40%) ohne dagegenstehende Wirtschaftsleistung hätte nach heutiger Lesart zu einer exorbitanten Inflation geführt. Trotzdem erlebten große Teile der Industrie (vor allem der Rüstungs- und Infrastrukturindustrie) eine starke Nachfragesteigerung der staatlichen Hand, ohne daß die Preise wesentlich stiegen[28]. Das lag vor allem an der infrastrukturellen Natur der zusätzlichen Staatsausgabe, die keine Konsum- Produkte betrafen und auch nicht die Personalausgaben der Verwaltung steigerten. Dies in Kombination mit der geänderten Ausßenhandelsstruktur ermöglichte Investments in moderne Technologien, Rationalisierungen und Kostendegression durch Mengensteigerung. Die boomende Konjunktur steuerte (erst aus heutiger Sicht vollkommen absehbar) in eine Überhitzungsphase mit anschließender Rezession bzw andauernden Baisse. Die Wachstumsrate der deutschen Wirtschaft in jener Zeit betrug aber immerhin durchschnittlich 2,6%, mehr als in den anderen europäischen Ländern.[29]
3. Dienstleistungen, Kapital und Finanzen
Durch die Faktoren Geld, Kommunikation und Gesetze konnte sich die Finanzwirtschaft als Teil der Gesamtwirtschaft etablieren und ausbauen. Diese Liberalisierung parallel zum Wegfall der Konzessionierungspflicht für Aktiengesellschaften (in Preußen 1870, später so ins Reich übernommen) ermöglichte auch Ausländern, deutsche Aktien zu halten.
Das stürmische Wachstum im Handelsgeschäft mit Aktien, Anleihen und Währungen wurde erst möglich durch die Entwicklungen und breite Einführung der Telegraphie und der Schnelligkeit des Postwesens.[30] Das gesamte Auslandsgeschäft der Banken (Akkreditive, Zahlungen, Wechsel etc) war auf die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit des Posttransportes angewiesen.[31]
Die Einführung des Inskriptionssystems für Staatsschulden in Deutschland führte zu einer Vereinfachung des Handels mit Staatsschuldtiteln[32] auch für Ausländer, mithin zu einem stärkeren Umsatz dieser Papiere an Börse und Freihandel. Seit Mitte der 1860er Jahre übernahmen die anderen europäischen Finanzzentren die Technik der Verbriefung von nichtstaatlichen Schulden in Form von Inhaberpapieren[33]. Der Schwerpunkt des deutschen Handels verlagerte sich mit Reichsgründung von Frankfurt nach Berlin, wo die neuen D-Banken[34] unter Beteiligung der „alten“ Frankfurter Banken den Emissionsmarkt dominierten. Ein großer Teil der Expansion des deutschen Kapitalmarktes fand in Auslandstiteln statt, denn die hohe Liquidität der deutschen (Finanz-)Wirtschaft[35] ließ viele Anleger auch exotische oder auch riskante Papiere kaufen.[36],[37]
Pohl faßt die Entwicklungen griffig zusammen, daß „... bis zum Jahre 1880 bzw 1885 die Börsen in London, Paris, Amsterdam, Wien und Frankfurt am Main führend waren, während nach 1870 die Berliner Börse immer stärker in den Vordergrund trat und nach 1885 hinter London und Paris die dritte Stelle einnehmen konnte.“[38]
Ein Indiz auf den internationalen Einfluß der Finanzmärkte ist die Wirkung des vor allem deutschen Protestes in 1885 gegen die Einführung einer 5% Kuponsteuer auf alle russischen Kapitalmarktpapiere, die daraufhin für Ausländer nur bedingt galt.[39]
Innerdeutsche Bündelung zur internationalen Durchsetzungskraft
Die personelle Verflechtung zwischen Finanzwelt, der Industrie und der Politik wird deutlich an Georg Siemens. 1874 ließ sich Siemens, damals die treibende Kraft (Direktor) der Deutschen Bank, als nationalliberaler Abgeordneter in den Reichstag wählen und stand für die Verbindung zwischen Banken, Wirtschaft und Politik.[40]
Exemplarisch für das Finanzwesen ist die Geschichte der Deutschen Bank, die definitiv als Bank des Außenhandels gegründet worden war und sich exponiert als solche verwirklichte.[41] 1871 gründete sie die German Bank London Ltd[42], um die rasche Ausdehnung des Geschäftes zu begleiten und auch, um die Dominanz des britischen Finanzwesens anzugreifen. Das Übersee-Geschäft veranlaßte sie noch 1871 zu Filialgründungen in Bremen und Hamburg, auch wegen der unterschiedlichen Währungen, mit denen beide Hafenstädte national und international arbeiteten. Filialen in Shanghai und Yokohama folgten. In 1872 kaufte sie etliche Beteiligungen an Banken, die je ein spezielles Überseegeschäft finanzierten, z.B. die La Plata-Bank (für Uruguay und Südamerika), Deutsche Uebersee-Bank, Indo-Egyptische Bank in Wien, Austro-Türkische Kredit-Anstalt.
Ihre Industrie-Beteiligungen im Im- und Export waren u.a. die Rotterdamsche Handelsvereinigung und die Internationale Bau- und Eisenbahn-Gesellschaft, sie dienten zur schnelleren und kostengünstigeren Abwicklung des deutschen Außenhandels bzw zur Akquisition direkten Industriegeschäftes, das dann (natürlich) über die Konsortialbanken finanziert und abgewickelt wurde.
Im Inland gründete die Deutsche Bank die „Deutsche Jute-Spinnerei und Weberei Aktien-Gesellschaft in Meißen. „Siemens erkannte bereits 1882, daß nur eine planmäßige Finanzierung der Verarbeitung der Rohstoffe in Deutschland und industriellen Exports die deutsche Wirtschaft vorantreiben könne.“[43] Die Deutsche Bank betrieb angabegemäß das Gründen lediglich als Nebenzweig zur Erfüllung der im Statut gesteckten Ziele im überseeischen Geschäft.[44]
Bei den Liquidationen deutscher Banken Mitte der 1870er Jahre pickte sie gezielt die zu ihrer Geschäftspolitik passenden außenhandelsbetonten Kundenverbindungen aus den Liquidationsmassen heraus. „Die Idee der Liquidation der Deutschen Union-Bank und des Berliner Bankvereins unter Übernahme von deren Geschäftsverbindungen... war um so willkommener erschienen, als die Entwicklung dieses Geschäfts sich wieder befruchtend und festigend auf das überseeische Geschäft auswirken konnte.“[45] Allerdings blieb auch die Deutsche Bank nicht vor der Weltkonjunkturkrise verschont: Sie mußte z.B. wegen des Verfalls der Silber-Märkte ihre Filialen in Shanghai und Yokohama in 1876 wieder schließen.
Auch die anderen deutschen Banken beteiligten sich selbst und ihre Kunden durch Emissionen an etlichen Eisenbahn-Finanzierungen in den USA. Auch eigene Filial- oder Joint-Venture-Gründungen in den USA halfen, das Geschäft anzukurbeln.
Bei aller Internationalität der deutschen Finanzwelt war doch Großbritannien Hauptinvestor auf der internationalen Bühne geblieben und London das Finanzzentrum der Welt. Allerdings investierten Briten mehr in Übersee (britische Kolonien) als in Europa. Ähnlich verhielten sich auch die belgischen, portugiesischen und niederländischen Investoren. Frankreich und Deutschland konzentrierten ihre Investitionen mehr auf Europa: ca 70% der deutschen Auslandsinvestitionen blieben in Europa.[46]
Die Internationalisierung des Finanzgeschäftes brachte aber auch Probleme zurück. Die große Krise 1873 begann in Wien, hinzu kamen schlechte Nachrrichten aus Nordamerika, wo deutsches Kapital stark an Eisenbahngesellschaften beteiligt war. Die Probleme der deutschen Kapitalmärkte waren durch Vorfälle im Ausland verstärkt worden, wenn nicht durch das Auslandsgeschäft erst möglich geworden. Die internationale Krisen konnte daher sich direkt auch im deutschen Kapitalmarkt auswirken.[47],[48]
4. Der Warenaustausch
Der Außenhandel im europäischen Zusammenhang
Die Struktur des deutschen Außenhandel änderte sich nach der Reichsgründung signifikant. Vorher hatten Getreide und andere Nahrungsmittel sowie Rohstoffe noch mehr als die Hälfte der deutschen Ausfuhren gebildet. Die steigende Industrieproduktion suchte ihren Absatz auch im Ausland und verringerte den Nahrungsmittelexportanteil relativ zu den Halbfertig- und Fertigwaren.[49] Der Anteil der Halbfertigwaren steigt von 6-7% noch 1870 auf über 30% in 1880 erheblich, der der Fertigwaren zwar insgesamt nicht weit über 50%, jedoch treten an die Stelle der Textilien nun vor allem Apparate und Maschinen. Diese Entwicklung des Exportes ist Folge der starken industriellen Entwicklung in Deutschland. Die chemische Indstrie mit Bayer, Hoechst (urspr. Lucius&Meister), BASF wurden gegründet . „Here again the groundwork was complete before the foundation of the German Empire, allthough ... later... German and Swiss firms together controlled about 90% of the world market.“[50]
Herkunft der Importe Europas / Verteilung der europ. Exporte 1880: in % (3-Jahresdurchschnitte) [51]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Eisen und Eisenbahnmaterial
„Zu den deutschen Lieferungen an Eisenbahnmaterial trat ein nennenswerter Export an Roheisen, obwohl die deutsche Roheisenbilanz, ..., grundsätzlich passiv war.“[52] Vor allem in Spezialstählen (Spiegelstahl) hatte die deutsche Industrie eine internationale Marktdominanz, sie wurde in den 70er Jahren von England nur mühsam gebrochen. Die deutsche Spezialstahlindustrie war auf den Import phosphorarmer Erze angewiesen, z.B. aus Spanien. Andererseits wurden Stähle geringerer Qualität auch aus England bezogen.
s. 22: Tabelle in 1000 t Außenhandel in Eisen 1872[53]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das zeigt, daß zwar Roheisen als Halbfabrikat importiert wurde, jedoch die technologisch veredelten Produkte exportiert wurden.
„In den Jahren nach der Krise war nun festzustellen, daß die Einfuhr von Roheisen von ihrem Höhepunkt im Jahre 1873 (rd. 0,7 Mill t) ziemlich kontinuierlich bis 1879 (0,37 Mill t) zurückging. Andererseits stieg die deutsche Ausfuhr an Roheisen ebenso kuntinuierlich von 0,14 Mill t (1873) auf 0,4 Mill t (1879); erstmalig 1879 ergab sich somit ein Roheisen-Ausfuhrüberschuß für Deutschland.“[54] Ab 1879 substituierte Deutschland den Import von Halbfabrikat-Roheisen mit eigenem Roheisen, das aufgrund der hohen Qualität des Ruhrkokses und den technologisch und wirtschaftlich vorteilhafteren Verfahren günstiger war.
Agrarerzeugnisse
Da die englische Volkswirtschaft die Industrielle Revolution unter Reduktion ihrer Agrarproduktion forciert hatte, importierte sie seit Mitte des 18. Jahrhunderts Getreide- und Nahrungsmittel. Bis zur Konkurrenz durch amerikanischen Weizen ab Mitte 1860er Jahre bediente diesen Bedarf vor allem preußischer, später reichsdeutscher Weizen[55]
Die deutsche Regierung war darauf bedacht, die Agrar- und Schwerindustrie wirksam gegen Benachteiligungen zu schützen, die ihr durch die Zoll- und handelspolitischen Maßnahmen anderer Länder bereitet wurden. Der Widerspruch zwischen Interessen der Landwirtschaft, die bislang aus Sorge vor Vergeltung gegen Importzölle war, und denen der Industrie war allerdings nach der starken Agrarkrise Mitte der 1870er Jahre aufgelöst: Der Preisdruck von den russischen Getreidelieferungen, obwohl sie von schlechter Qualität waren, und den amerikanischen Importen brachte auch die Inlandspreise unter ein für die Getreideproduzenten rentables Niveau. Der Export, der ja gegen dieselben Preise im europäischen Ausland ankämpfen mußte, konnte diese Umsatzrückgänge nicht auffangen. So nahm denn auch die Bedeutung anderer Agrarexporte stetig zu, vor allem des Zuckers als Rohstoff oder als Halbfertigprodukt. „In 1880 the value of sugar exports exceeded that of exports of machinery or of chemical products.“[56]
Zölle und das Einnahmeninteresse des Reiches
Die Exportinteressen der Landwirtschaft hatten eine gute Lobby im Reichskanzler, der die Vorteile des Freihandels für Landwirtschaft und Industrie sah. Auch wurde die Lage der preußischen Landwirtschaft von Regierungsseite wesentlich schlimmer dargestellt als sie faktisch war. Die Landwirtschaft selbst war gespalten: die ostdeutschen Großgrundbesitzer und Junker mit ihrem ausgeprägten Exportinteresse waren lange Zeit Verfechter der freihändlerischen Idee, bis hin zu 1876.[57] Aber sie profitierten letztlich aufgrund ihrer großen Verkaufsmengen von den Getreidezöllen und einer generellen Verteuerung des Getreides,[58] und änderten deshalb ihren Standpunkt, mit ihnen die Regierung. Auch die Einnahmemöglichkeit durch Importzölle stimmte Bismarck zur Kehrtwende um. Den Nachteil der fehlenden Kaufkraft hatte die deutsche Bevölkerung, die höhere Preise als nötig zu zahlen hatte, ohne daß sich ihr die Vorteile erhaltener Arbeitsplätze geboten hätten. Andererseits gab es auch keine relevanten Preissteigerungen.
„Der eigentliche Ausgangspunkt für den Übergang Deutschlands zur Schutzzollpolitik im Jahre 1879 war der Übergang Deutschlands vom Agrar- zum Industriestaat und der damit einhergehende Bedeutungsverlust der heimischen Landwirtschaft.“[59]
Durch das Matrikularsystem erhielt das Reich nur relativ wenige Steuern von den Ländern. Importzölle, ebenso wie andere indirekte Steuern, damals traditionell niedrig oder nicht existierend, waren die wenigen eigenen Steuereinnahmen des Reiches. Zur Deckung des Reichshaushaltes und Stärkung der Unabhängigkeit von den Ländern war also die Steigerung dieser Einnahmen naheliegend. Die äußere Verbrämung zum Schutz der nationalen Arbeit war ein nationalistisches, eher neues Argument. Neben der angeblich zu erhaltenden Wirtschaftskraft der deutschen Landwirtschaft wurde auf die drohende Abhängigkeit der Nahrungsmittelversorgung vom Ausland hingewiesen.[60]
1884 brachten die Getreidezölle den gewünschten Erfolg mit rd 24 mio Mark, 1888 schon 58,7mio Mark, bei einem Gesamtaufkommen indirekter Steuern für das Reich von 165,5 m Mark.[61]
Die Importzölle anderer Staaten hingegen trafen nicht voll auf die deutschen Exporteure. „Der 1879 vollzogene, bedeutsame Wandel in der Handelspolitik kann durch die Kündigung bestehender sowie die Nichterneuerung ablaufender Handelsverträge charakterisiert werden, was Deutschlands Übergang zu einer autonomen Handelspolitik bedeutete, d.h., man legt die eigenen Tarife dem Ausland gegenüber nicht fest. Stattdessen beschränkte man sich weitgehend auf die reine Gewährung der Meistbegünstigung.“[62] Dadurch und durch die Nutzung der unkündbaren Meistbegünstigungsklausel mit Frankreich konnte Deutschland alle Vorteile nutzen.[63]
Etliche deutsche Industrieunternehmen umgingen die prompt eingeführten Zollgrenzen anderer Länder durch Lizenzfertigungen oder Zweigwerke im Ausland. Der Schutz der nationalen Arbeit hatte also auch eine Kapitalflucht und Arbeitsplatzabbau in Deutschland zur Folge gehabt, das relative Ausmaß war allerdings eher gering.
Doch auch nichttarifäre Importhindernisse wurden aufgebaut, z.B. durch Veterinärmaßregeln gegen importiertes Fleisch oder durch die Frachtentarifpolitik, deren Regelungshoheit bei der Reichsregierung lag.[64]
5. Grenzüberschreitender Verkehr und Kommunikation
Verkehr
Der Ausbau des Eisenbahnnetzes in Europa hat trotz militärtechnisch begründeter Hemmschuhe ganz entscheidend zum internationalen Handel mit Getreide vor allem in Europa geführt. Der Verkehr war ursprünglich mit Binnenschiffen und Pferdefuhrwerken bewerkstelligt worden, mit dem Bau verschiedener Bahnlinien und der damit verbundenen Kostendegression nahm er jedoch fulminant zu. Auch der Straßenbau profitierte vom Eisenbahnbau, da die Straßen für den Pferde-Nahtransport zu und von den Bahnhöfen ausgebaut werden mussten. Die Binnenschifffahrt war der härteste Konkurrent der Eisenbahnen, da sie das billigste Transportmittel mit der zehnfachen Transportleistung der Eisenbahn war. Durch die technischen Fortschritte im Bereich des Schiffbaus und der Hafenanlagen und durch den Bau zahlreicher Kanäle blieb der Schiffstransport durchaus konkurrenzfähig mit der Eisenbahn. Wegen der relativ anspruchslosen technischen Spezifikationen der Binnenschiffe trotz ihrer zunehmenden Ausstattung mit Dampfantrieb konnten sie leichter als viele Eisenbahnen Grenzen überschreiten.
Auch die deutsche Seeschifffahrt expandierte und die Handelsflotte wurde von der fünft – zur zweitgrößten der Welt (den ersten Rang behielt stets Großbritannien) mit einem Anstieg von 988.000 Bruttoregistertonnen (1871) auf 5.400.000 BRT (1913). Möglich wurde das widerum nur durch die gezielte Einfuhr der notwendigen Stähle bzw. Eisen-Halbfertigprodukte.
Kommunikation
Der grenzüberschreitende Verkehr der Informationen und Meinungen in Deutschland war relativ freizügig, aufgrund einer die bürgerlichen Rechte weitgehend respektierenden Reichsverfassung und der Literalisierung der Bevölkerung. Es war weniger das pure Vorhandensein der Technik wie z.B. Telegraphie, sondern vor allem die fortwährende Kostensenkung ihrer Nutzung, was die exorbitante Nutzungssteigerung verursachte. Die Geschwindigkeitssteigerung des internationalen Posttransportes förderte den Import ausländischer Medien, gleichzeitig stieg durch die zunehmende Verflechtung der Wirtschaft mit dem Ausland und den Migranten auch der kommerzielle und private Brief- und Telegrammverkehr.[65] Die Innovationen, Leistungen, Umsätze und Verbindungen an Finanz- und Kapitalmärkten waren ohne die Telegrafen- und Telefondienste undenkbar. Auch war die funktionierende internationale Kommunikation eine conditio-sine-qua-non für den steigenden grenzüberschreitenden Warenhandel.
4. Fazit und Wertung
Das Deutsche Kaiserreich zeichnet sich durch widersprüchliche und doch plausible Entwicklungen aus. Die im Vergleich zu anderen europäischen Mittel- oder Großmächten späte Einigung der Nation zu einem Staat hatte den früheren Verkehr zwischen den Ländern zu grenzüberschreitendem, fast internationalem Verkehr werden lassen. Die Reichseinigung einte diese verschiedenen Wirtschaftszentren und gab damit Raum für Ideen, Forschung und Technik. Die Industrialisierung Deutschlands und die technische Innovationskraft führte zu wesentlichen internationalen Spitzenstellungen, technologisch, wirtschaftlich, händlerisch. Das wurde durch die Nutzung der modernen Transport- und Kommunikationstechniken gefördert.
Die Verflechtungen der deutschen Wirtschaft mit dem Ausland und ihre Unabhängigkeit von der Politik bis zum Beginn der Kolonialpolitik werden oft als eine frühe Form der Globalisierung der deutschen Wirtschaft interpretiert[66]. Das Finanzwesen hatte sich immerhin zu einem der weltweit führenden entwickelt, die Investitionsinteressen Deutschlands gerade in Europa waren größer als die anderer Länder. „Globalisierung“ erscheint übertrieben, wenn man außer acht läßt, daß im Kaiserreich der Außenwirtschaftsanteil des Nationaleinkommens wesentlich über dem anderer Länder lag und dem heute üblichen recht nahe kommt.[67]
Der vielschichtige Erfolg der deutschen Wirtschaft im Ausland, vor allem in Europa, wurde allerdings kaum politisch begleitet oder gar genutzt. Die Gründe und Auswirkungen für diesen Widerspruch sind vielfältig und ein lohnendes weiteres Thema.
Desgleichen wäre eine interessante weiterführende Frage der (scheinbare?) Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Außenorientierung und gesellschaftlichem Nationalismus.
Literatur- und Quellenverzeichnis
Achterberg, Erich: Georg von Siemens und die Banken Aus: Deutsche Bank AG (Hrsg.): Beiträge zur Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankgeschichte Nr. 1 – 20, Frankfurt am Main (Hase & Köhler Verlag) 1984. S. 325-337.
Borchardt, Knut: Globalisierung in historischer Perspektive Bayerische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte JG 2001, Heft 2
Engelberg, Ernst: Das Reich in der Mitte Europas, Berlin (Siedler) 1990 Fischer, Wolfram: Germany in the World Economy during the Nineteenth Century, London 1983.
Fischer, Wolfram (Hrsg.): Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum ersten Weltkrieg Bd. 5, Stuttgart (Ernst Klett) 1985. (= Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte)
Fröhlich, Michael: Imperialismus: Deutsche Kolonial- und Weltpolitik, München (DTV) 1994.
Hallgarten, George W.F.: Deutsche Industrie und Politik von Bismarck bis in die Gegenwart, Frankfurt am Main (Athenäum) 1986.
Hardach, Karl Willy: Die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren bei der Wiedereinführung der Eisen- und Getreidezölle in Deutschland 1879, Diss. Frankfurt 1967.
Hildebrand, Klaus: Das vergangene Reich : deutsche Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871 – 1945, Stuttgart (DTV) 1996.
Hobsbawm, Eric J.: Das imperiale Zeitalter 1875-1914 The age of Empire 1875 – 1914, Frankfurt (Campus Verlag) 1989.
Osterhammel, Jürgen; Petersson, Niels P.: Geschichte der Globalisierung Dimensionen, Prozesse, Epochen, München (Beck) 2003.
Pohl, Manfred: Die Deutsche Bank in der Gründerkrise (1873-1876) Aus: Deutsche Bank AG (Hrsg.): Beiträge zur Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankgeschichte Nr. 1 – 20, Frankfurt am Main (Hase & Köhler Verlag) 1984. S. 291-308.
Pohl, Manfred: Deutscher Kapitalexport im 19. JH Emissionen, Banken, Anleger bis 1914, Frankfurt (Börsen-Zeitung) 1977.
Reisinger, Nikolaus: Das Zeitalter des Hochimperialismus - Europas Aufbruch zur Weltwirtschaft Aus: Edelmayer / Landsteiner / Pieper(Hrsg): Die Geschichte des Europäischen Welthandels und der wirtschaftliche Globalisierungsprozeß, Wien (Oldenbourg) 2001. S. 207-218.
Steinkühler, Martin: Agrar- oder Industriestaat: Die Auseinandersetzungen um die Getreidehandels- und Zollpolitik des Deutschen Reiches 1879-1914, Frankfurt am Main (Lang) 1992.
Winkler, Heinrich August: Der lange Weg nach Westen: deutsche Geschichte 1806-1933, München (C.H. Beck) 2000.
Zorn, Wolfgang (Hrsg.): Das 19. und 20. Jahrhundert Stuttgart (Ernst Klett) 1976. (= Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte)
Internet-Quellen:
Weltpostverein (Universal Postal Union ), Bern: Quelle: http://www.upu.int/ am 4.7.04
International Statistical Institute, Voorburg, Quelle: http://www.cbs.nl/isi/nutshell.htm am 4.7.04
Siemens AG, München, http://w4.siemens.de/archiv/de/laender/index.html am 26.6.04
Krauss Maffai, München. Quelle: http://www.werkbahn.de/eisenbahn/lokbau/km.htm am 6.7.04
[...]
[1] vgl. Fischer Wolfram: Germany in the World Economy during the Nineteenth Century, The 1983 Annual Lecture, German Historical Institute, London, 1983; S. 4ff
[2] Fischer, Wolfram; Wirtschaft und Gesellschaft Europas 1850-1914, in: Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg; (Band 5 von: Wolfram Fischer (Hrsg).: Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Stuttgart 1985), S. 361
[3] ebd, S. 361ff
[4] Fischer 1985
[5] Zorn, Wolfgang; (Hrsg.); Handbuch der deutschen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 2: Das 19. und 20. Jahrhundert; Ludwigsburg 1976
[6] vgl. Fischer, 1985, S. 432
[7] vgl. Engelberg, Ernst; Das Reich in der Mitte Europas, Berlin 1990, S. 610 f
[8] vgl. Fischer, 1985, S. 410
[9] Siehe auch Kapitel 3. Dienstleistungen, Kapital, Finanzen
[10] Start war in Wien, Italien, Russland. Im September brach ein US-amerikanisches Bankhaus (Jay Cook & Co) zusammen. Im Oktober 1873 brach die Berliner Quistorpsche Vereinsbank zusammen, weil ihre Bodenspekulationen in Berlin platzten, die einen weiteren Boom vorausgesetzt hatten. Ein Domino-Effekt ließ auch andere Unternehmen und Banken illiquide werden.
[11] „Da der Binnenmarkt nur noch ungenügend aufnahmefähig war, musste der Außenhandel mit schwerindustriellen Produkten forciert werden: Bei Roheisen stieg die Ausfuhr von 1872 bis 1878 von 151.000 auf 419.000 Tonnen, bei Schienen von 70.700 auf 207.000 Tonnen und bei Maschinen von 37.300 auf 72.300 Tonnen.“ Wehler: Bismarck und der Imperialismus, zitiert nach: Engelberg, 1990, S. 157. Engelberg unterstellt eine Intention(„mußte forciert werden“), ohne sie zu spezifizieren.
[12] vgl. Engelberg 1990, S. 157f
[13] vgl. Engelberg 1990, S. 160
[14] „Johannes Conrad bemängelte, 'daß (Bismarcks) volkswirtschaftlichen Anschauungen keine klaren, keine befestigten und vielfach keine richtigen sind, weil nur auf individueller Beobachtung und einseitiger Abstraktion beruhend.'“, zitiert nach:Steinkühler, Martin: Agrar- oder Industriestaat: Die Auseinandersetzungen um die Getreidehandels- und Zollpolitik des Deutschen Reiches 1879-1914 Frankfurt am Main, 1992, S. 125
[15] Fischer 1985, S. 431
[16] vgl. Fischer 1985, S. 433
[17] Das Urheberrecht wurde erst 1886 international geregelt, paßt aber hier ins Bild.
[18] Aufgabe des Weltpostvereins ist die Sicherstellung des weltweiten Postdienstes zu weitgehend einheitlichen Bedingungen. Quelle: http://www.upu.int/ am 4.7.04
[19] Das International Statistical Institute, Voorburg, Niederlande, wurde seit 1865 verhandelt und 1885 gegründet. Quelle: http://www.cbs.nl/isi/nutshell.htm am 4.7.04
[20] vgl. Achterberg, Erich: Georg von Siemens und die Banken; Aus: Deutsche Bank AG (Hrsg.): Beiträge zur Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankgeschichte Nr. 1 - 20 Frankfurt am Main,1984., S. 327
[21] z.B. Konzessionierung ausländischer Firmen in Deutschland bzw deutscher Firmen im Ausland
[22] siehe auch Kapitel 3. Dienstleistungen, Kapital und Finanzen
[23] Dies geschah zur Erzielung von Kostenvorteilen, sei es durch niedrigere Löhne im Zielland, durch dort nicht anfallende oder niedrigere Rohstoffimportzölle, sei es durch die Einsparung von Transportkosten.
[24] spätere Krauss Maffai, München. Zweigwerk in Linz wurde 1880 gegründet, um die österreichischen Zölle zu ungehen. Quelle: http://www.werkbahn.de/eisenbahn/lokbau/km.htm am 6.7.04
[25] Gerade für Siemens als Technologieunternehmen der Elektrobranche mit sehr vielen Produktinnovationen war der internationale Patentschutz und die Umgehung nicht-tarifärer Handelshemmnisse ein starker Grund, frühzeitig sich in anderen Ländern (=Märkten) mit Tochtergesellschaften niederzulassen. Quelle: Firmenarchiv, http://w4.siemens.de/archiv/de/laender/index.html am 26.6.04
[26] Technischer Fortschritt und Rationalisierungen führten zu Produktivitätssteigerungen in allen Sektoren der Wirtschaft, wodurch Preise für viele Güter und (Verkehrs- und Kommunikations-) Dienstleistungen rapide sanken.
[27] „Die äußere Stabilisierung der Währung ist also im 19.JH im Unterschied zur Zwischenkriegszeit kein schwerwiegendes, vor allem kein dauerhaftes Problem für die Reichsbank gewesen.“ Fischer 1985, S. 429
[28] Die Preisentwicklung nach Lebenshaltungs-, Erzeuger-, Großhandels- oder Exportpreisen zu differenzieren, war damals nicht üblich, mithin kann hier nur retrograd geschlossen werden: Es gab keine wesentliche allgemeine (Verbraucherpreis- ) Inflation, deshalb auch keine solche der Erzeugerpreise.
[29] vgl Fischer, 1985 S. 391f
[30] vgl Borchardt, Knut; Globalisierung in historischer Perspektive; München, 2001, S. 8: Durch die Verbilligung der Kommunikation (Telegraphie und später Telephon) wurde erst der internationale Finanzmarkt in dem Umfange der 1870er Jahre ermöglicht.
[31] Durch die Umstellung der Post auf Dampfschiffe bzw die Nutzung der Eisenbahn konnten Fahrpläne und Postlaufzeiten kalkulierbar und zuverlässig gestaltet werden.
[32] Die Staatsschulden werden seitdem in ein Schuldbuch eingetragen (inskribere, lat. einschreiben), wodurch der Öffentlichkeitscharakter hergestellt, die Eigentümerschaft und Abtretbarkeit von Staatspapieren nachgewiesen wird und damit der Handel erleichtert. Noch heute gibt es das Bundesschuldenbuch.
[33] Inhaberpapiere werden an den Inhaber zurückgezahlt, ohne daß der Emittent vorher von diesem Inhaber (=Gläubiger) Kenntnins gehabt haben mußte. Das erleichtert ihre Handelbarkeit während der Laufzeit. Dasselbe gilt für die dazugehörigen Zinsscheine. Dadurch konnte mit wesentlich weniger Aufwand auch international mit den Papieren gehandelt werden, weil die Forderungen der Gläubiger nicht mehr mühsam beim Emittenten von einem Konto auf das andere übertragen werden mußten, sondern allein auf Vorlage des Inhaberpapieres hin ausgezahlt wurden.
[34] Darmstädter Bank, Deutsche Bank, Disconto-Gesellschaft, Dresdner Bank
[35] siehe auch Kapitel 2, Abs. Konjunkturrausch durch Geldmengenwachstum
[36] „Der 'Cours-Zettel der neuen Börsenzeitung' vom 28. Mai 1875 notierte 90 ausländische Prioritätsobligationen, 5 ausländische Hypotheken-Certifikate, 75 ausländische Fonds und 31 ausländische Eisenbahn-Stamm- und Prioritätsaktien. Unter den ausländischen Fonds waren die österreichischen, russischen, polnischen und amerikanischen dominierend. [zitiert nach: Historisches Archiv der Deutschen Bank, Kurszettel]. ... Der Russisch-Türkische Krieg von 1877 brachte eine Reihe von neuen Anleihen auf den deutschen Markt, so die 5%ige Orient-Anleihe und die 5%ige Auslandsanleihe, die jedoch zunächst große Mißerfolge brachten.“ Pohl, Manfred; Deutscher Kapitalexport im 19. JH, 1977, S. 53
[37] Vgl. Fischer 1983, S. 23ff
[38] Pohl 1977, S. 54
[39] Das führte 1885 zu der Regelung, daß russische Auslandsanleihen zwar ohne Kuponsteuer behandelt wurden, Ausländer, die russische Inlandsanleihen gekauft hatten, aber die Kuponsteuer zahlen mußten.
[40] Achterberg, 1974, S. 327f: Auch das politische Lobbying zur Erlangung der Konzession zur Gründung einer Aktienbank betonte Siemens in einem Brief an Birsmarck: „Der deutsche Kaufmann bedarf eines zweifachen Vermittlers, wo der englische oder französische auf direktem Wege mit einem Bankhause seines Landes in Verbindung tritt.“ ... „Das Ziel der Deutschen Bank war von Anfang an, eine Gleichberechtigung der deutschen Banken gegenüber den privilegierten englischen Banken im Welthandel zu erreichen.“
[41] Pohl 1977, S. 54
[42] in 1873 ergänzt mit einer Filiale
[43] zitiert nach: Pohl, Manfred; Die Deutsche Bank in der Gründerkrise (1873-1876); 1973; Aus: Deutsche Bank AG (Hrsg.): Beiträge zur Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankgeschichte Nr. 1 - 20 Frankfurt am Main, 1984. S. 298
[44] Achternberg, 1973, S. 327: „Laut Satzung war der leitende Gedanke bei der Gründung der Deutschen Bank die 'Förderung und Erleichterung der Handelsbeziehungen zwischen Deutschland, den übrigen europäischen Ländern und überseeischen Märkten'.“
[45] zitiert nach Pohl, 1973, S. 303ff
[46] vgl Fischer 1985 S 106, zitiert nach: Reisinger 2001, S 211
[47] Anfang 1874 liquidierten in Deutschland 61 Banken, 116 Industriegesellschaften und 4 Eisenbahn-Gesellschaften. vgl. Pohl 1973, S. 303f
[48] 1875 mußte die Northern Pacific Railroad Company saniert werden, was zu Lasten auch deutscher Banken (Deutsche Bank) und deutscher Investoren ging (durch die Anleihen).
[49] Auch innerhalb der Warengruppe der Nahrungsmittel tritt in den 1880er Jahren an die Stelle des Rohstoffes Getreide (großenteils aus dem preußischen Ostelbien) der bereits verarbeitete und schon deshalb höherwertige Rübenzucker als Hauptausfuhrprodukt der deutschen Landwirtschaft (dessen Hauptanbaugebiete eher in West- und Süddeutschland liegen).
[50] vgl. Fischer, Wolfram: Germany in the World Economy during the Nineteenth Century, London 1983., S 13ff
[51] vgl. Reisinger, 1970,S. 214, nach Fischer, 1985, S. 170
[52] Hardach, Karl Willy: Die Bedeutung wirtschaftlicher Faktoren bei der Wiedereinführung der Eisen- und Getreidezölle in Deutschland 1879, Frankfurt, 1967, Dissertation, S. 19
[53] Hardach 1967 S. 22
[54] Hardach 1967, S. 37
[55] vgl. Steinkühler, Martin: Agrar- oder Industriestaat: Die Auseinandersetzungen um die Getreidehandels- und Zollpolitik des Deutschen Reiches 1879-1914; Frankfurt am Main 1992., S.77: „Rußland und Nordamerika lieferten im Durchschnitt der Jahre 1874-1876 ca. 33,6m Zentner Weizen im Vergleich zu 4,7m Zentnern Weizen, die das Inselreich aus Deutschland bezog.“
[56] Fischer 1983, S. 7
[57] vgl Steinkühler 1992, S 126
[58] vgl Steinkühler 1992, S. 140
[59] vgl Steinkühler 1992 S. 116
[60] Ein schwaches Argument, wie die stets ausreichende Versorgung der britischen Bevölkerung zeigte, dern Getreideversorgung wesentlich auslandsabhängiger war.
[61] vgl Steinkühler 1992, S. 137
[62] Steinkühler 1992, S. 195
[63] vgl. Steinkühler 1992 S. 195ff
[64] Koloniale Expansion war im Deutschland der 1870er kein wesentliches Thema, vor allem die Deutschnationalen, freihändlerisch eingestellten Politiker waren antikolonialistisch. Erst der wirtschaftspolitische Kurswechsel vom Freihandel zum Schutzzoll leitete 1879 eine koloniale Bewegung ein. Zusammen mit dem Abblocken von Importen, der Verbreiterung der Reichseinnahmen durch Zölle wurde hier der Export als Ausweichmarkt für die schwindende Binnennachfrage gesehen. vgl.Hildebrand, Klaus; Das vergangene Reich : deutsche Aussenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871 – 1945; StuttgRT 1996; S. 364ff
[65] Fischer 1985, S. 416: „Revolutionär aber war die Übertragung von Mitteilungen durch Telegraph, auch in Verbindung mit Überseekabeln, das Telephon ... : 40.000 Telegrammen im Jahr 1850 standen 522,3 Mio 1913 gegenüber. 1883 wurden 8 Mio Telephongespräche geführt.“
[66] vgl. Osterhammel 2003, Hobsbawm 1999, Borchardt 2001, Fischer 1984, Woyke (2000
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Deutsche Zollverein und welche Rolle spielte er vor der Gründung des Deutschen Kaiserreichs?
Der Deutsche Zollverein war ein wirtschaftlicher Vorläufer des Zollgebiets des Deutschen Kaiserreichs. Er wurde ab 1833 gegründet und beseitigte innerpreußische und später innerdeutsche Handelshemmnisse. Er wirkte auf die (klein-)deutsche Einheit hin, indem er Zölle, Tarife und nicht-tarifäre Hindernisse innerhalb des Gebiets abbaute und die Einfuhrzölle nach außen vereinheitlichte.
Wie veränderte sich die Struktur des deutschen Außenhandels im Kaiserreich?
Die Struktur des Außenhandels wandelte sich von der eines Agrarlandes zu der einer Industrienation. Der Anteil der Nahrungsmittel und Rohstoffe am Export sank, während der Anteil der Halbfertigwaren erheblich stieg. Bei den Fertigwaren dominierten zunehmend Apparate und Maschinen anstelle von Textilien.
Welchen Einfluss hatten internationale Konjunkturbewegungen auf die deutsche Wirtschaft?
Der Einfluss der internationalen Konjunkturbewegungen wuchs im Betrachtungszeitraum. Der Deutsch-Französische Krieg und die anschließenden Reparationszahlungen beeinflussten die deutsche Wirtschaft erheblich. Die Weltwirtschaftskrise von 1873, ausgelöst durch eine Börsenblase in Wien, breitete sich auch nach Deutschland aus.
Welche Rolle spielte die Handelspolitik im Deutschen Kaiserreich?
Die Handelspolitik bestand aus Verträgen zur Harmonisierung und Standardisierung technischer Spezifikationen sowie dem Abbau oder Aufbau von nicht-tarifären Handelshindernissen. Sie stand oft im Dienste der internationalen Politik, später der Großmachtpolitik Deutschlands.
Welchen Einfluss hatten internationale Standardisierungen auf die Wirtschaft?
Deutschland beteiligte sich an zahlreichen internationalen Vereinbarungen, die den grenzüberschreitenden Verkehr von Post, Eisenbahn und Schifffahrt erleichterten. Abkommen zum Niederlassungsrecht und zum Schutz von Marken und Patenten gaben deutschen Exporteuren Rechtsschutz und Rechtssicherheit.
Welche grenzüberschreitenden Beziehungen entwickelten sich in der deutschen Industrie?
Einige Industrieunternehmen expandierten grenzüberschreitend, gründeten Zweigwerke oder Kooperationen, um Zoll- und rechtliche Bestimmungen zu umgehen. Es gab auch internationale Preiskartelle, die aber oft scheiterten.
Was war der Goldstandard und welche Bedeutung hatte er für die deutsche Wirtschaft?
Die Einführung des Goldstandards in den 1870er Jahren stabilisierte die Währung und erleichterte den internationalen Handel, da jeder Ausländer oder Inländer eine Mark-Banknote jederzeit gegen eine festgelegte Menge Goldes umtauschen konnte.
Wie entwickelte sich die Finanzwirtschaft im Deutschen Kaiserreich?
Die Finanzwirtschaft konnte sich durch Liberalisierung, Kommunikation und Gesetze etablieren und ausbauen. Der Handel mit Aktien, Anleihen und Währungen erfuhr ein stürmisches Wachstum. Die Berliner Börse gewann an Bedeutung und rückte nach London und Paris an die dritte Stelle.
Welche Rolle spielten deutsche Banken im internationalen Handel?
Deutsche Banken, wie die Deutsche Bank, spielten eine wichtige Rolle im internationalen Handel. Sie gründeten Tochterinstitute im Ausland, finanzierten Im- und Exportgeschäfte und beteiligten sich an Eisenbahnfinanzierungen in den USA.
Wie war der Waren Austausch?
Im Waren Austausch gab es sowohl Eisen als auch Eisenbahnmaterial. Außerdem wurde das Agrarerzeugniss verstärkt exportiert.
Wie funktioniert Grenzüberschreitender Verkehr und Kommunikation?
Das gut ausgebaute Eisenbahnnetz hatte großen Anteil an der Grenzüberschreitenden Versorgung von Waren. Der Import ausländischer Medien stieg, gleichzeitig stieg durch die zunehmende Verflechtung der Wirtschaft mit dem Ausland und den Migranten auch der kommerzielle und private Brief- und Telegrammverkehr.
- Quote paper
- Andreas Kaup (Author), 2004, Die Wirtschaftsverflechtungen des deutschen Kaiserreiches von der Reichsgründung bis zum Beginn der Kolonialpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108997