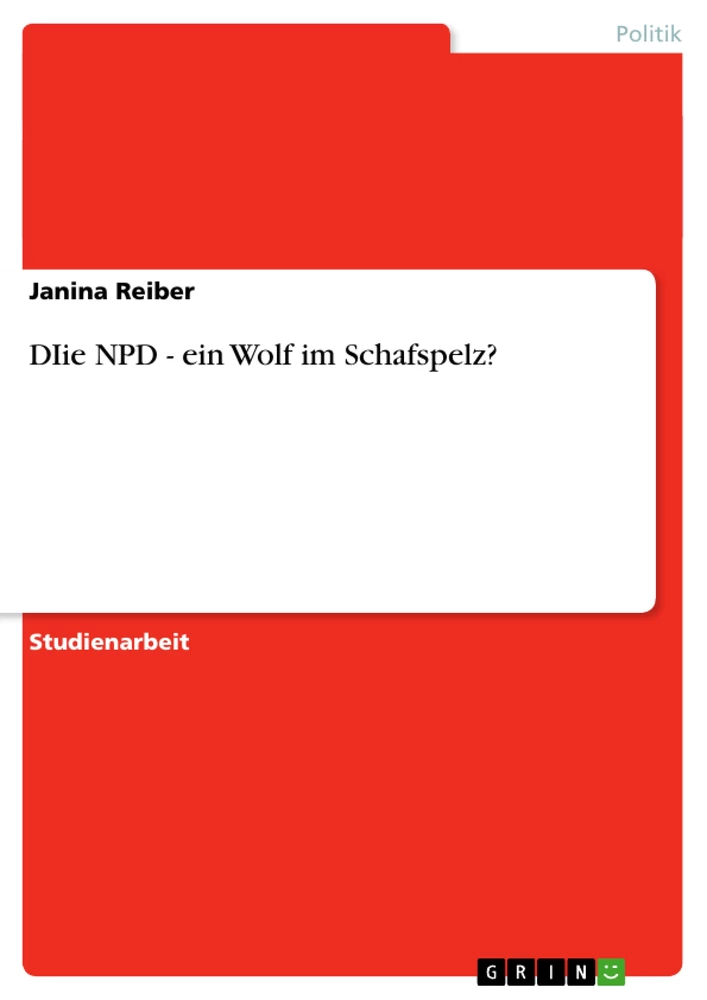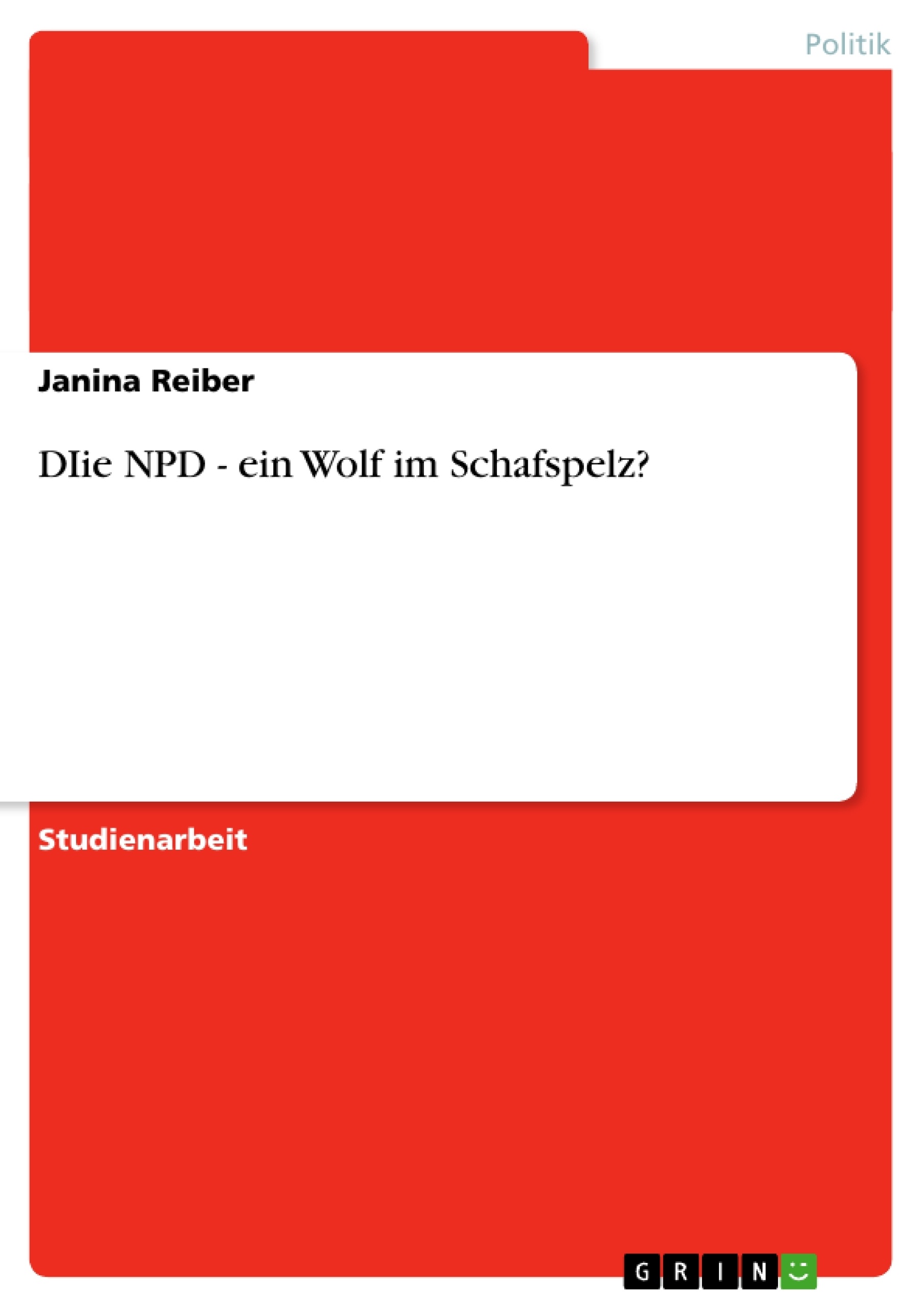Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Grundlagen des Parteiverbotes
Artikel 21 des Grundgesetzes
Parteiverbotsverfahren allgemein
Kriterien eines Parteiverbotes
Das Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP)
Das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)
3. Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
Entstehung und Entwicklung
Zielsetzung und Programmatik
Verhalten und öffentliches Auftreten ihrer Anhänger
4. Parteiverbotsverfahren gegen die NPD
Begründung der Anträge
Bewertung der Anträge
5. Schlussteil
1. Einleitung
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist aus leidvollen Erfahrungen der Weimarer Republik entstanden, speziell wurden gewisse Schutzvorrichtungen eingebaut, um die Demokratie, wenn nötig auch vor sich selbst, zu schützen.
Im Laufe dieser Arbeit wird besonders der Artikel 21 Grundgesetz betrachtet und kritisch bewertet. Artikel 21 GG soll die Demokratie vor sogenannten Wölfen im Schafspelz schützen. Als solche werden Parteien genannt, die nach außen hin einen harmlosen und demokratischen Schein bewahren, in Wirklichkeit aber der Demokratie und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sehr gefährlich werden. Die Gefahr rechtzeitig zu erkennen und diese Parteien nicht zu unterschätzen ist oftmals sehr schwierig. Aber manchmal überschätzen die Staatsorgane gewisse Parteien und klagen diese an, obwohl sie harmlos sind. Im Prinzip ist diesen kleinen aber sehr entscheidenden Unterschied zu erkennen und dementsprechend zu handeln das eigentlich Schwierige.
In dieser Arbeit geht es um das Parteiverbotsverfahren, dem Mittel, mit dem die Demokratie den Wölfen im Schafspelz begegnen kann und auch soll.
Zentral wird in dieser Arbeit die Frage behandelt, ob die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) ein Wolf im Schafspelz ist, oder ob sie lediglich ein Schaf im Wolfspelz ist und die Kritiker recht haben. Nicht jeder ist der Meinung von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung und es gibt eine Menge Kritik wegen des Parteiverbotsantrages gegen die NPD, weil viele denken, dass die NPD auf andere Weise bekämpft werden muss.
Zunächst wird der Artikel 21 GG, der zentrale Artikel wenn es um Parteien und Parteiverbote geht, in dieser Arbeit erläutert und daraus ergibt sich eine Darstellung des Parteiverbotsverfahrens und der Kriterien für ein Parteiverbot, die das Bundesverfassungsgericht festgelegt hat. Dies wird schließlich an historischen Beispielen näher erläutert, nämlich an den Verboten gegen die Sozialistische Reichspartei (SRP) und gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD).
Um die Problematik des Parteiverbotsverfahrens gegen die NPD besser herauszustellen wird die Entstehung und Entwicklung der NPD betrachtet, die Programmatik und Zielsetzung dieser Partei sowie das Verhalten ihrer Anhänger und Wähler. Gegen Ende dieser Arbeit wird speziell das Verfahren gegen die NPD thematisiert, durch die Begründung und Bewertung der Anträge zum Verfahren gegen die NPD. Am Schluss wird anhand der aufgeführten Fakten versucht die zentrale Frage zu beantworten.
2. Grundlagen des Parteiverbotes
2.1 Artikel 21 des Grundgesetzes
Art. 21.1 GG: „Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Ihre Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Sie müssen über die Herkunft und Verwendung ihrer Mittel sowie über ihr Vermögen öffentliche Rechenschaft geben.“
Entscheidend für die wichtige Stellung der Parteien ist Artikel 21 Abs. 1 S. 1, denn dies stellt den wichtigsten Unterschied zwischen Parteien und Vereinigungen dar. Die Mitwirkung der Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes zeigt sich primär in Wahlen, welche verfassungsrechtlich in Art. 20 Abs. 2 S. 2 gesichert sind. (vgl. Schmidt, Thomas (1983): 111)
Parteien haben eine große Verantwortung gerade durch den besagten Art. 21 Abs. 1 S. 1, denn sie machen nicht nur in Wahlen ihren Einfluss geltend, sondern sie prägen im Wesentlichen die sozialen und gesellschaftlichen Gesinnungen ihrer Wähler und Anhänger. Deshalb ist die Parteifreiheit und die Chancengleichheit aller Parteien durch Art. 21 Abs. 1 sowohl gewährleistet, also auch gefordert. Dies bringt aber auch gewisse Gefahren mit sich, wenn eine Partei zum Beispiel gegen die Verfassung gerichtete Aktivitäten und Veröffentlichungen unternimmt. Dafür ist Art. 21 Abs. 2 GG zuständig.
Art. 21 Abs. 2: „Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Über die Frage der Verfassungswidrigkeit entscheidet das Bundesverfassungsgericht.“
Art. 21 Abs. 2 GG ist entstanden, weil man aus der Geschichte gelernt hat. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist nicht nur eine wertgebundene, sondern auch eine wehrhafte Verfassung. Dies ermöglicht den Verfassungsorganen gegen gewisse Strömungen anzugehen, die der Verfassung und somit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gefährlich werden. (vgl. Schmidt, Thomas 1983: 156)
Laut Art. 21 Abs. 2 ist das Bundesverfassungsgericht nicht verpflichtet die Parteien gemäß nach Artikel 21 Absatz 2 zu verurteilen, es ist lediglich festgelegt, dass das Bundesverfassungsgericht alleine über die Verfassungswidrigkeit einer Partei entscheiden kann. Aber durch die Bindung des Bundesverfassungsgerichtes an die Verfassung ergibt sich diese Pflicht von ganz alleine (vgl. Schmidt, Thomas 1983: 155).
Doch bevor das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungswidrigkeit oder –treue einer Partei entscheiden kann, muss ein Verbotsantrag gestellt werden.
2.2 Parteiverbotsverfahren
Antragsberechtigt sind die Bundesregierung, der Bundestag sowie der Bundesrat. Sollte eine Partei auf das Gebiet eines Landes beschränkt sein, so kann auch die jeweilige Landesregierung den Antrag stellen. Die Entscheidung über ein Verbot kann nur das Bundesverfassungsgericht treffen(siehe 2.1). Dieses Urteil hat Gesetzeskraft. Im Falle eines Verbotes folgt die Auflösung der betroffenen Partei und das Verbot, Ersatzorganisationen zu schaffen. Die Überwachung solcher Parteien und gegen die Verfassung gerichteter Aktivitäten obliegt dem Innenministerium des Bundes und der Länder. Jedoch sollten die Staatsorgane zunächst nach dem Opportunitätsprinzip handeln, d.h. ein gewisser Ermessensspielraum für den Verbotsantrag sollte genutzt werden, damit die politische Auseinandersetzung mit extremistischen Gruppierungen ermöglicht wird. Zuerst sollten öffentliche Wahlen und Diskussionen den Kampf gegen den Extremismus aufnehmen (vgl. Leggewie/Meier 2002:13), aber wenn es notwendig ist, muss der Verbotsantrag eingeleitet werden.
2.3 Kriterien für ein Parteienverbot
Wenn ein Verbotsantrag gegen eine Partei gestellt wird, muss das Bundesverfassungs gericht die Verfassungswidrigkeit einer Partei feststellen oder widerlegen. Dies ist nicht ganz einfach, denn eine eindeutige und allgemeine Rezeptur gibt es dafür nicht. Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht durch eine relativ eindeutige Definition grundlegender, für ein Verbot zentraler, Begriffe eine eindeutige Richtung vorgegeben.
Laut Bundesverfassungsgericht ist ein Verbot der Parteien wegen der privilegierten Stellung durch das GG erst dann zu rechtfertigen, „wenn die obersten Grundwerte des freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaates erschüttert seien“ (Schmidt, Thomas 1983: 139). Mit anderen Worten muss eine Partei darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder beseitigen zu wollen.
Im Rahmen des SRP –Verbotes hat das Bundesverfassungsgericht die freiheitlich-demokratische Grundordnung folgendermaßen definiert: „So lässt sich die freiheitlich-demokratische Grundordnung als eine Ordnung bestimmen, die unter Ausschluss jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien sind zu rechnen: die Achtung vor den im GG konkretisierten Menschenrechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouveränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und Ausübung einer Opposition.“ (zitiert nach Backes/Jesse 1993: 412/413)
Außerdem muss diese Partein eine aktiv-kämpferische Haltung aufweisen. (vgl. Schmidt, Thomas 1983:142/143)
Anlässlich des KPD – Verbots hat das Bundesverfassungsgericht „erstmals den Begriff der streitbaren Demokratie explizit verwendet, indem es den Versuch einer Synthese zwischen dem Prinzip der Toleranz gegenüber allen politischen Auffassungen und dem Bekenntnis zu gewissen unantastbaren Grundwerten der Staatsordnung zu begründen unternimmt.“ (Backes/ Jesse 1993: 413) Mit anderen Worten meint das Bundesverfassungsgericht, dass eine Demokratie mit einer gewissen Toleranz dem Extremismus begegnen muss, aber die Toleranz hört dann auf, wenn gewisse Grundwerte beeinträchtigt werden. Dann beginnt die streitbare Demokratie und diese Parteien müssen dann auch auf Grund der streitbaren Demokratie für verfassungswidrig erklärt werden und rechtskräftig durch das Bundesverfassungs gericht verboten werden.
1952 wurde die Sozialistische Reichspartei (SRP) und 1956 die kommunistische Partei Deutschlands (KPD) nach diesen Kriterien rechtskräftig durch das Bundesverfassungs- gericht verboten.
2.4 Verbot gegen die Sozialistische Reichspartei 1952
Am 19. November 1951 stellte die Bundesregierung den Verbotsantrag gegen die Sozialistische Reichspartei (SRP). Die SRP musste als Nachfolgeorganisation der Nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) angesehen werden. Sie stellte auch eine akute Gefahr zu der damaligen Zeit dar, denn sie erzielte gute Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in den norddeutschen Bundesländern. Auf den Antrag der Bundesregierung hin hat das Bundesverfassungsgericht die Sozialistische Reichspartei 1952 für verfassungswidrig erklärt und aufgelöst.
In der Begründung führte es aus, dass es nicht allein um die Inhalte des Parteiprogramms und die öffentlichen Ziele der Partei ging, denn diese kann man nach außen hin verschleiern, sondern vielmehr kommt es auf das Verhalten der Parteianhänger an. In deren Verhalten spiegeln sich die wahren Absichten einer Partei wider. Außerdem habe sich der Eindruck bestätigt, dass „die Führungsschicht der SRP sich hauptsächlich aus ehemaligen ‚alten Kämpfern’ und aktiven Nationalsozialisten zusammensetze“ (Wetzel, Juliane 1994: 91).
Um einem Verbot zuvorzukommen wollte sich die Sozialistische Reichspartei von selbst auflösen, aber das Bundesverfassungsgericht erklärte dies für nichtig, da die Auflösung nicht demokratisch von statten ging, sondern von ‚oben nach unten’ vorgenommen wurde. So wurde die Sozialistische Reichspartei 1952 durch das Bundesverfassungsgericht verboten.
2.5 Verbot gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 1956
Nur drei Tage nach dem Verbotsantrag gegen die SRP reichte die Bundesregierung noch einen Antrag ein, diesmal gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD). Dieses Verfahren jedoch dauerte in etwa fünf Jahre, nicht wie bei der SRP nur ein Jahr. Der Grund hierfür war nicht etwa, dass sie weniger verfassungswidrig wäre, sondern eher die Frage ob ein Parteiverbot notwendig ist, denn dieser Fall war nicht so akut wie bei der SRP.
Zum Zeitpunkt des Verbotsantrages befand sich die Kommunistische Partei Deutschlands bereits im Niedergang. Aus diese Grund fragte das Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung 1954 noch einmal, ob sie an dem Verbotsantrag festhalte. Erst nach dieser Bestätigung begann die mündliche Verhandlung. Knapp zwei Jahre später, 1956, wurde die KPD sowohl wegen ihrer Programmatik als auch wegen ihrer praktischen Politik, einer Diktatur- Politik, verboten.
Weitere Anträge blieben aus. Nicht etwa weil man andere Parteien nicht für verfassungswidrig halten würde bzw. könnte, aber zu viele Verbote könnten in einer offenen Gesellschaft kontraproduktiv sein, zumal diese Parteien kaum Einfluss hatten und auch haben. (vgl. Backes/ Jesse 1993: 419/ 420)
3. Nationaldemokratische Partei Deutschlands
3.1 Entstehung und Entwicklung
Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) wurde am 28. November 1964 zu einer Dachorganisation verschiedener rechtsextremer Gruppierungen wie der Deutschen Reichspartei (DRP), der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP) und Politiker anderer Parteien wie der Deutschen Partei (DP) und des BHE schlossen sich ihr an.
Im Mai 1965 wurde die NPD zur Mitgliederpartei, nachdem sich die DRP, auf deren Basis sich die NPD größtenteils aufbaute, auflöste. Offiziell oblag die Führung der NPD dem national-konservativ eingestellten Fritz Thielen, aber in Wirklichkeit hatte Adolf von Thadden die Partei fest in seiner Hand. Ihm verdankte die NPD einen Aufschwung.
Am 06. November 1966 überschritt die NPD erstmals die 5%-Hürde, nämlich mit 7,9% bei der Landtagswahl in Hessen, und dann am 20. November 1966 folgte der Zweite Einzug in einen Landtag, nämlich in Bayern mit 7,4%.
Im Frühjahr 1967 gab es eine schwere Krise, nachdem der Vorsitzende Thielen versuchte, seinen Stellvertreter von Thadden und weitere Spitzenfunktionäre wegen parteischädigendem Verhalten aus der Partei auszuschließen. Nach einem Machtkampf zog Thielen aber den Kürzeren und trat so aus der NPD aus. Kommissarischer Vorsitzender für zwei Tage wurde Wilhelm Gutmann, der stark durch seine nationalsozialistische Vergangenheit vorbelastet war. Adolf von Thadden wurde bei dem 3. Bundesparteitag der NPD am 12. November 1967 zum Parteivorsitzenden gewählt.
Im April 1967 zog die NPD in fünf weitere Landtage ein. In Schleswig-Holstein mit 5,8% der Stimmen, in Rheinland-Pfalz mit 6,9%, mit 7% in Niedersachsen, in Bremen mit 8,9% sowie in Baden-Württemberg. Die NPD verfügte letztendlich über 60 Abgeordnete in sieben von elf Länderparlamenten und stellte 22 Abgeordnete in der Bundesversammlung, die 1969 den Bundespräsidenten wählte.
Im Parlament jedoch waren die NPD-Abgeordneten isoliert, denn keine andere Partei sah sie als Koalitions- oder Kooperations-Partner.
1968 erlitt die Partei schweren Schaden. Vorfälle wie die Verurteilung des Parteiführers von Thadden zu einem Monat Gefängnis mit drei Jahren Bewährung, Entzug des Führerscheins und Geldbuße, und das Bekannt werden von zahlreichen Vorbestraften unter den Kandidaten für die Kommunalparlamente wirkten sich schlecht auf die Mitgliederzustimmung aus.
Durch die Erfolge der NPD in der Landtagswahlen wurde immer wieder der Ruf nach einem Parteiverbot laut, was seinerseits die Parteimitglieder der NPD einschüchterte.
1968 in West-Berlin spielte die NPD ein wirklich seltsames Spiel. Um einem Verbot zuvorzukommen, löste sich der Landesverband West-Berlin der NPD mit Einverständnis des Bundesverbandes auf. Ein NPD-Mitglied ging deswegen vor Gericht und verfügte über eine einstweilige Verfügung gegen dagegen, weil er der NPD vorwarf, dass die Auflösung nicht demokratisch vorgenommen wurde, sondern von oben nach unten. Daraufhin schrieb von Thadden einen Brief an alle NPD-Mitglieder, indem er betonte, dass die Auflösung legitim abgelaufen sei und jeder, der das Gegenteil behaupte, ein „übler Brunnenvergifter“ sei. Tatsächlich aber hat die NPD den Landesverband West-Berlin nicht aufgelöst, sondern inoffiziell die Mitgliedschaft ruhen gelassen. Von Thadden sah das als eine Chance, sich „von einigen unbrauchbaren Leuten zu trennen“. Tarnorganisationen wurden geschaffen, in denen sich die NPD-Funktionäre getroffen haben. Im Januar 1969 wurde der Beschluss der Selbstauflösung bei einer Landesausschusssitzung rückgängig gemacht, nachdem ein Gericht entschieden hat, dass die Auflösung nicht legitim war. Der Landesverband West-Berlin war jedoch niemals so stark gewesen, wie es der Anschein hatte durch dieses ganze hin -und her.
So gut die NPD bei den Landtagswahlen 1967 abschnitt, so erlitt die bei den Kommunalwahlen 1968 einen kleinen Rückschlag. In Niedersachsen erreichte sie zwar noch 5,2%, in Baden-Württemberg jedoch nur noch 3,7% der Stimmen. In Hessen gelang es der NPD 5,2% der Stimmen auf sich zu vereinigen. Die Spitzenreiter waren die Landkreise Alsfeld mit 9,8%, Waldeck mit 7,9%, Büdingen mit 7,2%, Ziegenhain mit 7,2%, Untertaunus und Marburg mit jeweils 6,9% und Dillkreis und Friedberg jeweils mit 6,6% der Stimmen. Im Saarland war die beste Stadt Saarbrücken mit 7,0% und das niedrigste Ergebnis gelang ihr im Landkreis St. Ingbert mit 4,0% der Stimmen.
Die NPD litt auch an personellen wie finanziellen Schwierigkeiten, sodass sie zu wenige Kandidaten für die Listenplätze hatten und auf Nichtparteimitglieder zurückgreifen mussten. (vgl. Schmidt, Giselher: 50-57)
Die Erfolge der NPD in den 70-er Jahren waren besonders der hohen Arbeitslosigkeit und der schlechten wirtschaftlichen Lage zu verdanken, die viele Protestwähler in die Arme der NPD trieb. Diese wollten damit nur ihren Protest gegenüber der politischen Unfähigkeit zum Ausdruck bringen.
1969 verfehlte die NPD knapp den Einzug in den Bundestag (4,3% der Zweitstimmen), was unter anderem auch der Verbotsdiskussion im Vorfeld der Bundestagswahlen zusammenhing. Ein Verbotsantrag wurde 1969 jedoch nicht gestellt, weil man den Wählern die Chance geben wollte, die NPD selbst in ihre Schranken zu weisen. Dies ist gerade noch einmal gut gegangen. (vgl. Wetzel, Juliane1994: 93-95)
Nach diesem, eigentlich für eine rechtsextreme Partei großem, Erfolg , kam ihr Verfall. Nachdem die NPD den Einzug in den Bundestag verpasst hatte, musste damit gerechnet werden, dass viele enttäuschte Wähler nun wieder abspringen würden und genau dem war so. Bei den Landtagswahlen 1970 blieb die NPD überall deutlich unter der 5% Hürde. Die Wirtschaft stabilisierte sich, die große Koalition trennte sich wieder und so nahm die Zahl der Protestwähler rapide ab, was sehr schlecht für die NPD war.
Nach der Wahlniederlage 1969 spaltete sich die NPD in zwei Lager. Zum Einen wollte die Parteiführung stärker den Legalitätskurs eingehen, also nach der Verfassung, und zum Anderen entwickelte sich eine stark oppositionelle Gruppe, die strikt gegen die Verfassung zu arbeiten suchte. Dies führte 1971 dazu, dass Adolf von Thadden zurücktrat und Martin Mußgnug , ein ehemaliger Nationalsozialist, die Parteiführung übernahm. Dieser schlug jedoch den Weg von Thaddens ein und so spaltete sich der radikale Flügel von der NPD ab. (vgl. Backes/Jesse 1993: 87-89)
1971 wurde die Deutsche Volksunion (DVU) gegründet, die im Wesentlichen die gleichen Charakterzüge wie die NPD auswies. Deshalb war es unumgänglich dass diese mit der stark geschwächten NPD konkurrierten und ihr einige Anhänger entzog. So war ihr Verhältnis zueinander logischerweise nicht das Beste. Dennoch kam es weniger zu Ausschreitungen, sonder das gegenseitige Verhältnis war geprägt durch Ignoranz.
1986 kam es zu Annäherungen zwischen der DVU und der NPD, was sich dadurch zeigte, dass im Blatt der DVU, der „Deutschen Wochen-Zeitung“ zur Wahl der NPD bei den Landtagswahlen in Bayern 1986 und bei den Bundestagswahlen 1987 aufgerufen wurde. Bei der Bundestagswahl kam die NPD dadurch auf 0,6% der Stimmen und kam so in den Genuss der Wahlkampfkostenerstattung. Durch diesen Erfolg ermutigt, einigten sich die DVU und die NPD auf weitere Zusammenarbeit. Das Übereinkommen wurde auch nicht durch die Unterschiede in den außenpolitischen Orientierungen gestört.
Die DVU gründete 1987 die als Partei eingeschriebene DVU-Liste D, die von der NPD unterstützt wurde. Es folgte ein symbiontenhaftes Verhältnis, denn die NPD und DVU-Liste D unterstützten sich gegenseitig und rechneten sich jeweils die Chancen aus, wer wo besser abschneiden könnte. Der Andere verzichtete dann zugunsten des Anderen auf eine Kandidatur. Diese Zusammenarbeit hatte eine hohe Erfolgschance, was dadurch bestätigt wurde, dass in Bremerhaven die Überwindung der 5%-Hürde gelang. Sie befanden sich im politischen Aufwind und hätten bestimmt bei den Wahlen noch besser abgeschnitten, wäre ihnen nicht eine weitere starke rechtsextreme Partei entgegengestanden in Form der Republikaner. (vgl. Backes/Jesse 1993: 105-109)
Seit März 1996 übernahm Udo Voigt die Parteiführung in der NPD. Unter seiner Leitung öffnete sich die NPD immer mehr für Neonazis und die Skinheadszene.
Die NPD ist gegenwärtig als Wahlpartei nicht von besonderer Bedeutung, so erzielte sie im Februar 2002 nur 1% der Stimmen bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und im Mai 2002 in Nordrhein-Westfalen nur 2351 Stimmen, dies entspricht 0,0% . (vgl.: Bundes- ministerium des Inneren 2002 : Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD). www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_21491.htm)
Dennoch ist sie die auffälligste rechtsextreme Partei in Deutschland, was sich am Besten anhand ihrer Programmatik und Zielsetzung erklären lässt.
3.2 Zielsetzung und Programmatik
Wie alle rechtsextremen Parteien versteht sich auch die NPD als eine Art Ersatzkirche. Giselher Schmidt nennt dies den „mythischen Reichsgedanken“. Außerdem legt die NPD sehr viel Wert auf Rassentrennung. Adolf von Thadden lässt keinen Zweifel daran, dass für ihn das Gesetz des Blutes allen anderen Dingen Vorrang hat, ähnlich wie Adolf Hitler zu seiner Zeit. Durch dieses Menschen- und auch Weltbild lehnt die NPD auch die politische Integration Europas ab, sowie Emigranten. In diesem Sinne stimmt die NPD mit den Ideologien der 1952 verbotenen Sozialistischen Reichspartei (siehe 2.4) überein.
Die NPD betrachtet das Volk als ein biologisches Kollektiv und aus dieser Begründung von Volk und Staat erfolgt eine indirekte Ablehnung von Liberalismus und Demokratie. Mit Aussagen wie „Doch wir leben nun einmal im Zeitalter des Liberalismus“ und „Es ist der Liberalismus, an dem die Völker verderben“ bestätigt sich diese Ablehnung. Die Demokraten werden als Abstrakte bezeichnet, und „abstrakt“ hat meist einen negativen Beigeschmack.
Die NPD vertritt die Ansicht eines Antipluralismus. Ihrer Meinung nach muss der Staat dafür Sorge tragen, dass die Verbände und Gewerkschaften keinen Einfluss haben und sie müssen unterdrückt werden.
Gleich wie die Meinungsfreiheit der Gewerkschaften muss nach der Meinung der NPD auch die ausschweifende Sexualität unterdrückt werden. Homosexualität und immer wechselnde Partnerschaften müssen den Menschen wieder ausgetrieben werden und sind laut der NPD durch die Demokratie entstanden. Von Thadden sagt, dass die Jugend nur noch Sexbesessen sei und dies alles wäre ein nationaler Notstand, der zu beseitigen wäre. Diese Einstellung propagierte auch Adolf Hitler zu der Zeit, in der nach der NPD die Kultur ihren Höhepunkt erreichte.
Die NPD versucht auf den Kulturverfall der heutigen Zeit aufmerksam zu machen, indem sie Herbert Böhme und Josef Thorak in höchsten Tönen loben.
Der Antisemitismus der NPD spiegelt sich darin wider, dass sie den Juden nicht nur die Schuld am Ausbruch des zweiten Weltkrieges geben, sondern dass sie angeblich Schuld am Kapitalismus und am Bolschewismus wären. Aber ihr Hass beschränkt sich nicht nur auf die Juden, sondern er richtet sich auch gegen Farbige und Gastarbeiter.
Die NPD sieht nicht, dass die Entwicklungshilfe auch der deutschen Wirtschaft nutzt, durch die Erschließung neuer Märkte, sondern sie verkennt absichtlich diese Möglichkeit der Wirtschaftsverbesserung, um weiter gegen die Entwicklungshilfe und gegen Ausländer propagieren zu können. Gastarbeiter werden von ihnen als outgroups der Gesellschaft diffamiert, aber dass viele Betriebe auf ausländische Arbeitnehmer angewiesen sind und dass auch dadurch die wirtschaftliche Lage verbessert wird, ignorieren sie gekonnt. (vgl. Schmidt, Giselher 1969: 80-130)
Die NPD erfuhr während ihrer Entwicklung eine bedeutsame Wandlung ihrer Zielsetzung. Sie legt den Schwerpunkt weniger auf ihre Funktion als Wahlpartei, vielmehr sieht sie sich gegenwärtig als Spitze einer breiten Protestbewegung. Dies zeigt sich in ihrem „Drei-Säulen-Konzept“, das am prägnantesten die Zielsetzung der NPD veranschaulicht.
Es gibt drei strategische Säulen: 1. Programmatik: Schlacht um die Köpfe, 2. Massenmobilisierung: Schlacht um die Straße, 3. Wahlteilnahme: Schlacht um die Wähler. Die NPD beschäftigt sich gegenwärtig vorrangig mit der zweiten Säule, dem Kampf um die Straße. Laut dem Bundesvorsitzenden Udo Voigt muss der Kampf um die Straße gewonnen werden, damit die NPD nicht nur Proteststimmen auf sich vereinigen kann, sondern eine „dauerhafte nationale Kraft“ (Voigt am 27.Mai 2000 in Rede zum 2. Tag des Nationalen Widerstandes). Dabei geht es der NPD hauptsächlich um junge Menschen. Die Umsetzung des Kampfes um die Straße schlägt sich hauptsächlich in etlichen Versammlungen (deren Zahl erheblich gesteigert wurde), Umzügen und Demonstrationen nieder. Um das Ausmaß der zweiten Säule richtig erfassen zu können, muss das Verhalten der Anhänger der NPD betrachtet werden, welches gerade durch diesen Aufruf zum „Kampf um die Straße“ geprägt wird.(vgl.: Frankfurter Rundschau 2000: Kampf gegen „das System“. www.dike.de/md2001/012001md06.html)
3.3 Verhalten der Anhänger und Wähler der NPD
Um das wahre Wesen einer Partei erkennen zu können, ist das Verhalten der Anhänger und Wähler einer Partei nicht gerade unwichtig. Dies ist gerade bei rechtsextremen Parteien der Fall, da sie sehr oft ihre wahren Absichten verschleiern, um nicht in den Genuss eines Parteiverbotes zu kommen.
Wenn man sich das Auftreten der NPD-Anhänger ansieht, so kann man eindeutige Parallelen zum Nationalsozialismus ziehen. Ein Haufen kahl geschorener, schwarz gekleideter, mit Springerstiefeln ausgestatteter Demonstrationsteilnehmer, die alles andere als friedlich demonstrieren. Bei NPD-Demonstrationen kommt es ihren Anhängern besonders darauf an, einen martialischen, furchteinflößenden und aggressiven Eindruck zu hinterlassen.
Durch die NPD-Propaganda wird nicht nur gegen Ausländer, sondern auch gegen die Demokratie und die bestehende Ordnung des Rechtsstaates gehetzt. Da wundert es kaum noch, dass ein Großteil der Anhänger der NPD aus militanten Skinheads und Neonazis besteht.
Durch bestimmte Aussagen wie „Arbeit zuerst für Deutsche“ und „Ausländerrückführung statt Integration“ sollen den schon bestehenden Krisenherd der Arbeitslosigkeit und der angeblichen Entfremdung in den Köpfen besonders Jugendlicher schüren und diese zu Gewalttaten und Ausländerfeindlichkeit anzustacheln. Was übrigens auch richtig gut funktioniert.
(vgl.: Frankfurter Rundschau 2002: www.dike.de/Lomdim/md2001/012001md06.html)
Nicht nur dass es immer wieder zu Ausschreitungen von NPD-Anhängern kommt, mit Angriffen auf Obdachlosenheime und Obdachlose, auf Behindertenheime und Behinderte, auf Asylantenheime und Ausländer, die sie meist willkürlich wählen, sondern auch, dass der sogenannte Ordnerdienst der NPD vielen auf den Weg in ihre Verbrecherkarierre geholfen hat. Man konnte viele militante Vereinigungen, die ihre Meinungen bzw. Ideologien nicht nur mit Worten, sondern auch mit Waffen kundgetan haben, auf den Ordnerdienst der NPD zurückführen oder zumindest Parallelen ziehen. (vgl. Backes/Jesse 1993: 89/90)
Betrachtet man die Entstehung/ Entwicklung der NPD zusammen mit ihrer rechtsextremen Programmatik und der Zielsetzung, die zu so vielen militanten Anhängern führt, so kann man den Schritt verstehen, den Bundesregierung, Bundesrat und Bundestag 2001 gegangen sind: Der Verbotsantrag gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands
4. Parteiverbotsverfahren gegen die NPD
4.1 Begründung der Anträge
„Die NPD bedroht die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland.“ Zu diesem Schluss kam der Verfassungsschutz, denn er sieht in der NPD eine „ernsthafte Gefahr“.
Der Verbotsantrag der Bundesregierung umfasst 99 Seiten, der des Bundestages 278 Seiten und der des Bundesrates 208 Seiten. Alle drei Instanzen sind sich einig, dass die NPD eine aktiv-kämpferische, aggressive Grundhaltung innehat. Sie begründen ihre Entscheidung durch das Verhalten der Anhänger (siehe 3.3) und der Programmatik und Zielsetzung der NPD (siehe 3.2).
Es gibt eine eindeutige Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus, was sich dadurch zeigt, dass z.B. die JN z.T. wörtlich die Terminologie aus dem 25-Punkte-Programm der NSDAP von 1920 übernommen hat. Aus diesem und den, in dieser Arbeit bereits aufgeführten, Gründen der aggressiven und aktiv-kämpferischen Grundhaltung der NPD gegenüber der Verfassung, kam es zum Verbotsantrag.
(vgl.: Bundesregierung 2002: Bundesregierung hält an NPD-Verbotantrag fest: Zum Stand des Verbotsverfahrens beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe www.bundesregierung.de/servlet/init.cms.layout.LayoutServlet?global.naviknoten=9259&link=bpa_notiz_druck&global.printview=2&link.docs=70187)
4.2 Bewertung der Anträge
Wenn auf Seiten der Politiker fast alle hinter dem Parteiverbotsantrag gegen die NPD stehen, so sind Wissenschaftler und Publizisten doch eher skeptisch. Diskutiert wird nicht etwa die Verfassungswidrigkeit der NPD, da stimmen auch die Wissenschaftler und Publizisten mit den Politikern überein, vielmehr wird diskutiert, ob ein Verbot der NPD sinnvoll ist. Ganz besonders nach dem Bekannt werden der V-Mann-Affäre wurde immer leidenschaftlicher diskutiert.
V-Männer sind verdeckte Ermittler, die von den Innenministerien der Länder oder vom Bundesinnenministerium selbst in Parteien und Organisationen eingeschleust werden, um verfassungsfeindliche Aktionen und Bewegungen zu überwachen und zu einer bestimmten Zeit aufzudecken.
Auch in die NPD wurden mehrere V-Männer eingeschleust und diese drangen in hohe Positionen der NPD vor. Aus diesem Grund entstand auch der Skandal, denn die NPD stellte sich selbst als Unschuldslamm dar, das vom Verfassungsschutz und seinen Leuten nur soweit getrieben wurde, damit der Antrag gegen die NPD überhaupt zustande kommen konnte.
Als die Regierung nach dieser Affäre weiter am Verbotsantrag festhielt, fragten sich die Skeptiker, ob der Antrag wirklich so stichhaltig und fundiert ist, dass er auch mit dieser Affäre vor dem Bundesverfassungsgericht bestehen könne. Die Meinungen darüber sind gespalten. Aber nicht nur die V-Mann-Affäre gibt den Skeptikern Stoff für Kritik. Zum einen führt Ingo von Münch, ein Professor für öffentliches Recht, an, dass es ziemlich grotesk ist, dass ausgerechnet ein CSU-Politiker das NPD-Verbot als erster forderte. Die CSU will eine Partei verbieten lassen, der man eine gewisse Nähe zur eigenen Partei, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von 1982, während des Wahlkampfes unterstellen darf. Zum anderen stellt er das Hauptargument des Bundeskanzlers für ein Verbot der NPD in Frage, welches lautet, dass die Steuerzahler diese Parteien finanzieren und dass dies inakzeptabel wäre. Von Münch jedoch gibt zu Bedenken, dass die Mitgliedsbeiträge die Mitglieder zahlen und die Spenden freiwillige Spender. Die staatliche Parteifinanzierung erfolgt zwar durch die Steuerzahler, aber auch die NPD-Anhänger zahlen Steuern und finanzieren so auch andere Parteien mit. (vgl. Leggewie/Meier 2002: 51-55)
Aber so skeptisch auch viele sind, mindestens ebenso viele befürworten den Antrag. Ernst Benda z.B., ein Professor für öffentliches Recht, Bundestagsabgeordneter der CDU, Bundesinnenminister und Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, kritisiert, dass der Antrag gegen die NPD nicht schon 1969 gestellt wurde. Für ihn spielt die NPD eine zentrale Rolle in der rechtsextremen Szene und man kann ihre Aktivitäten wegen des Parteienstatus weder unterbinden noch einschränken. Er stimmt mit anderen Wissenschaftlern wie Leggewie und Meier überein, dass, egal wie das Verbotsverfahren ausgehen wird, die NPD niemals einen ‚Persilschein’ bekommen wird. Er stimmt aber auch mit Wissenschaftlern wie Buntenbach und Wagner darin überein, dass Verbotspolitik allein nicht viel bringt, sondern dass auch am sozialen Umfeld gearbeitet werden muss. Rechtsextremismus ist kein Randproblem, wie es die Politiker gerne darstellen, sondern es kommt aus der Mitte und muss dort auch effektiv bekämpft werden. (vgl. Leggewie/Meier 2002: 152-155)
Die Bereitschaft zu Gewalt gegenüber Minderheiten und Ausländern stellt eine zunehmend ernste Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung dar. Da die Belastungen von außen nicht von alleine verschwinden, muss dem Rechtsextremismus und in diesem Falle der NPD etwas entgegengesetzt werden. Karl Dietrich Bracher, Professor für Zeitgeschichte und Politische Wissenschaften, hat es treffend mit nur zwei Worten ausgedrückt: „Historia doceat!“ (Leggewie/Meier 2002: 150) Man muss aus der Geschichte lernen! Deshalb handeln Regierung, Bundesrat und Bundestag seiner Meinung nach genau richtig, denn keinen Antrag zu stellen wäre eine Bestätigung der NPD und würde sie nur weiter ermutigen. (vgl. Leggewie/Meier 2002: 149-151)
Nachweislich weist die NPD eine starke Nähe zum Nationalsozialismus auf., und nach Annelie Buntenbach, Historikerin und Setzerin, und Bernhard Wagner, Bundestagsmitarbeiter, darf der Nationalsozialismus nicht durch das Parteiengesetz geschützt, begünstigt oder gar gefördert werden, denn er ist eine Vernichtungsideologie. Über das Lebensrecht Behinderter und die Vernichtung von Menschen darf nicht diskutiert werden! Nicht nur deshalb stimmen Buntenbach und Wagner mit den Verfassungsorganen überein, sondern auch weil die NPD ein „Durchlauferhitzer“ für zahlreiche Führungsfiguren und etliche Terroristen der Szene ist. (vgl. Leggewie/Meier 2002: 132-137)
Zusammenfassend kann man sagen, dass auch die Skeptiker im Großen und Ganzen den Verbotsantrag gegen die NPD befürworten.
5. Schluss
Um auf die zentrale Frage dieser Arbeit zurückzukommen, ob die NPD ein Wolf im Schafspelz oder, wie sie sich selbst gerne darstellt, ein Schaf im Wolfspelz ist, müssen die in dieser Arbeit ausgeführten Ergebnisse betrachtet werden. Wenn man die historischen Beispiele, ganz besonders das Verfahren gegen die Sozialistische Reichspartei, mit der Entstehung und Entwicklung der NPD vergleicht, so lassen sich eindeutige Parallelen ziehen. Berücksichtigt man dann noch die Programmatik und die Zielsetzung der NPD, so muss man zu dem Schluss kommen, dass diese Partei eindeutig rassistisch und antidemokratisch veranlagt ist. Zusammenfassend kann man sagen, dass die NPD darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen und letztendlich zu beseitigen, und dass sie eine aktiv-kämpferische und aggressive Grundhaltung aufweist. Die Problematik in diesem Fall liegt nicht in der Feststellung der Verfassungswidrigkeit der NPD, sondern vielmehr in der Frage, wie die Demokratie einer solchen Partei begegnen soll und kann. Die Staatsorgane haben sich in diesem Fall für den Weg des Parteiverbotes entschieden, und über den Ausgang des Verfahrens muss nun das Bundesverfassungsgericht seinerseits entscheiden. Ob die NPD ein Wolf im Schafspelz ist und ob die Wahl des Parteiverbotsverfahrens die Richtige war, ist eine Frage, die größtenteils sehr subjektiv beantwortet werden muss, und ich kann nur für mich sprechen, wenn ich behaupte, dass dies die richtige Entscheidung war. Die Bekämpfung der Drahtzieher wird zwar um einiges schwieriger werden, da diese sich wohl in den Untergrund zurückziehen werden und bestimmt nicht weniger aktiv sein werden. Aber die NPD ist alles andere als ein Unschuldslamm und ist sehr gefährlich. Den Anhängern der NPD muss gezeigt werden, dass sich eine Demokratie, wie die der Bundesrepublik Deutschland, zu wehren weiß und ich bin sicher, dass die Mitläufer dieser Partei dadurch zum Teil abgeschreckt werden können. Auch wenn die Politiker dies wahrscheinlich mehr aus politischem Geschick als aus Überzeugung getan haben, so ist die NPD ein Wolf im Schafspelz und der Verbotsantrag war die einzig richtige Entscheidung.
Bibliographierung
BACKES, Uwe/ JESSE, Eckhard (1993): Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn
BUNDESREGIERUNG ( 21.02.02): Bundesregierung hält an NPD-Verbotsantrag fest: Zum Stand des Verbotsverfahrens beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. http://www.bundesregierung.de/servlet/init.cms.layout.LayoutServlet?global.naviknoten=9259&link=bpa_notiz_druck&global.printview=2&link.docs=70187. 10.03.03
BUNDESMINISTERIUM DES INNEREN (14.12.02): Nationaldemokratische Partei Deutschland (NPD). http://www.bmi.bund.de/dokumente/Artikel/ix_21491.htm . 10.03.03
FRANKFURTER RUNDSCHAU ( 07.11.00): Kampf gegen „das System“. http://www.dike.de/lomdim/md2001/012001md06.html . 10.03.03
LEGGEWIE, Claus/MEIER, Horst (2002): Verbot der NPD oder Mit Rechtsradikalen leben? Frankfurt am Main. Edition Suhrkamp
SCHMIDT, Giselher (1969): Hitlers und Maos Söhne. Frankfurt am Main. Verlag Heinrich Scheffler
SCHMIDT, Thomas (1983): Die Freiheit verfassungswidriger Parteien und Vereinigungen. Berlin. Duncker & Humblot
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit über die NPD?
Die Arbeit befasst sich mit dem Parteiverbotsverfahren gegen die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD). Sie untersucht, ob die NPD eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt und ob ein Verbot der Partei gerechtfertigt ist.
Was sind die Grundlagen für ein Parteiverbot in Deutschland?
Artikel 21 des Grundgesetzes (GG) ist die zentrale Grundlage für Parteiverbote. Er besagt, dass Parteien, die darauf abzielen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, verfassungswidrig sind. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Verfassungswidrigkeit einer Partei.
Welche Kriterien muss eine Partei erfüllen, um verboten zu werden?
Das Bundesverfassungsgericht hat Kriterien für ein Parteiverbot festgelegt. Eine Partei muss aktiv-kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Diese Grundordnung umfasst die Achtung der Menschenrechte, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip und Chancengleichheit für alle Parteien.
Welche Parteien wurden in der Bundesrepublik Deutschland bereits verboten?
In der Bundesrepublik Deutschland wurden bisher die Sozialistische Reichspartei (SRP) im Jahr 1952 und die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) im Jahr 1956 verboten.
Wie entstand die NPD und wie hat sie sich entwickelt?
Die NPD entstand 1964 als Dachorganisation verschiedener rechtsextremer Gruppierungen. In den 1960er Jahren erlebte sie einen Aufschwung und zog in mehrere Landtage ein. Später verlor sie an Bedeutung, versuchte sich aber immer wieder neu zu positionieren.
Was sind die Ziele und die Programmatik der NPD?
Die NPD wird als rechtsextreme Partei eingestuft, die rassistische und antidemokratische Ideologien vertritt. Sie legt Wert auf Rassentrennung, lehnt die politische Integration Europas ab und diffamiert Ausländer. Sie wird als Ersatzkirche für ihre Anhänger angesehen.
Wie verhalten sich die Anhänger und Wähler der NPD?
Die Anhänger der NPD treten oft martialisch und aggressiv auf. Ein Großteil besteht aus militanten Skinheads und Neonazis. Sie hetzen gegen Ausländer und die Demokratie.
Wie lautet die Begründung für das Parteiverbotsverfahren gegen die NPD?
Die Bundesregierung, der Bundestag und der Bundesrat haben ein Parteiverbotsverfahren gegen die NPD beantragt, weil sie die Partei als eine Gefahr für die Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland sehen. Sie begründen ihre Entscheidung mit dem Verhalten der Anhänger und der Programmatik der NPD.
Wie werden die Anträge auf ein Parteiverbot der NPD bewertet?
Die Meinungen über ein Verbot der NPD sind gespalten. Einige Wissenschaftler und Publizisten sind skeptisch, ob ein Verbot sinnvoll ist, insbesondere nach dem Bekanntwerden der V-Mann-Affäre. Andere befürworten ein Verbot, da sie die NPD als eine zentrale Rolle in der rechtsextremen Szene sehen.
Was ist ein V-Mann und welche Rolle spielte er im Verbotsverfahren?
V-Männer sind verdeckte Ermittler, die in Parteien und Organisationen eingeschleust werden, um verfassungsfeindliche Aktionen aufzudecken. Im Fall der NPD gab es Kritik, dass V-Leute der NPD selbst erst zu Aktionen bewegt hätten, die das Verbotsverfahren erst ermöglichten.
Welches Fazit zieht die Arbeit über das Parteiverbotsverfahren gegen die NPD?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die NPD eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellt und dass das Parteiverbotsverfahren eine richtige Entscheidung war. Auch wenn die Bekämpfung der Drahtzieher dadurch schwieriger werde, sei es wichtig, den Anhängern der NPD zu zeigen, dass sich eine Demokratie zu wehren weiß.
- Quote paper
- Janina Reiber (Author), 2002, DIie NPD - ein Wolf im Schafspelz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109079