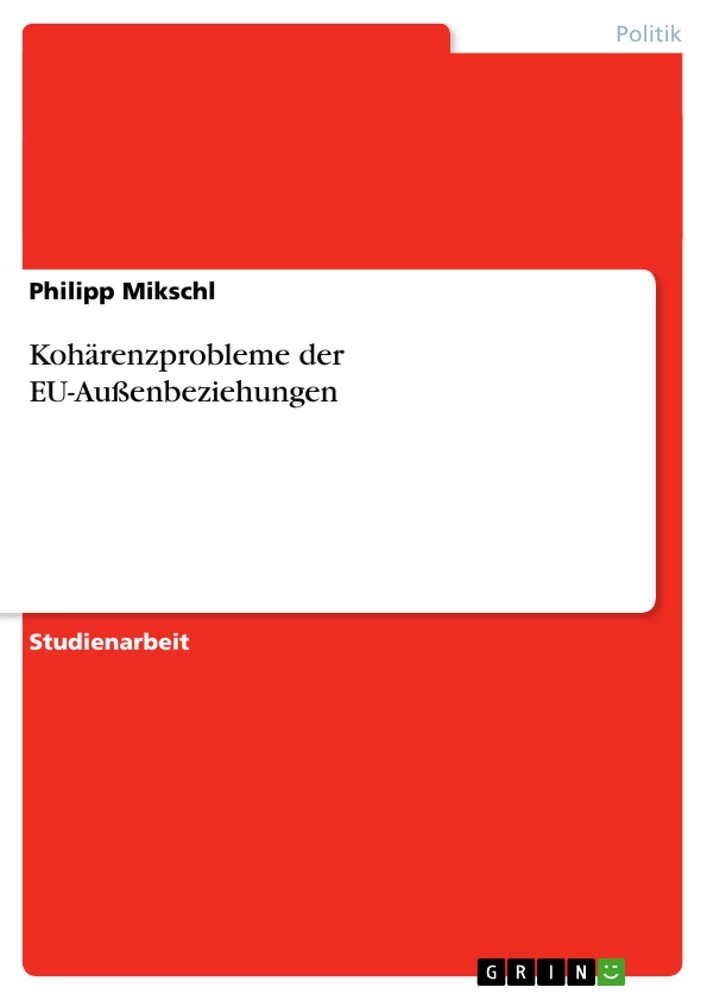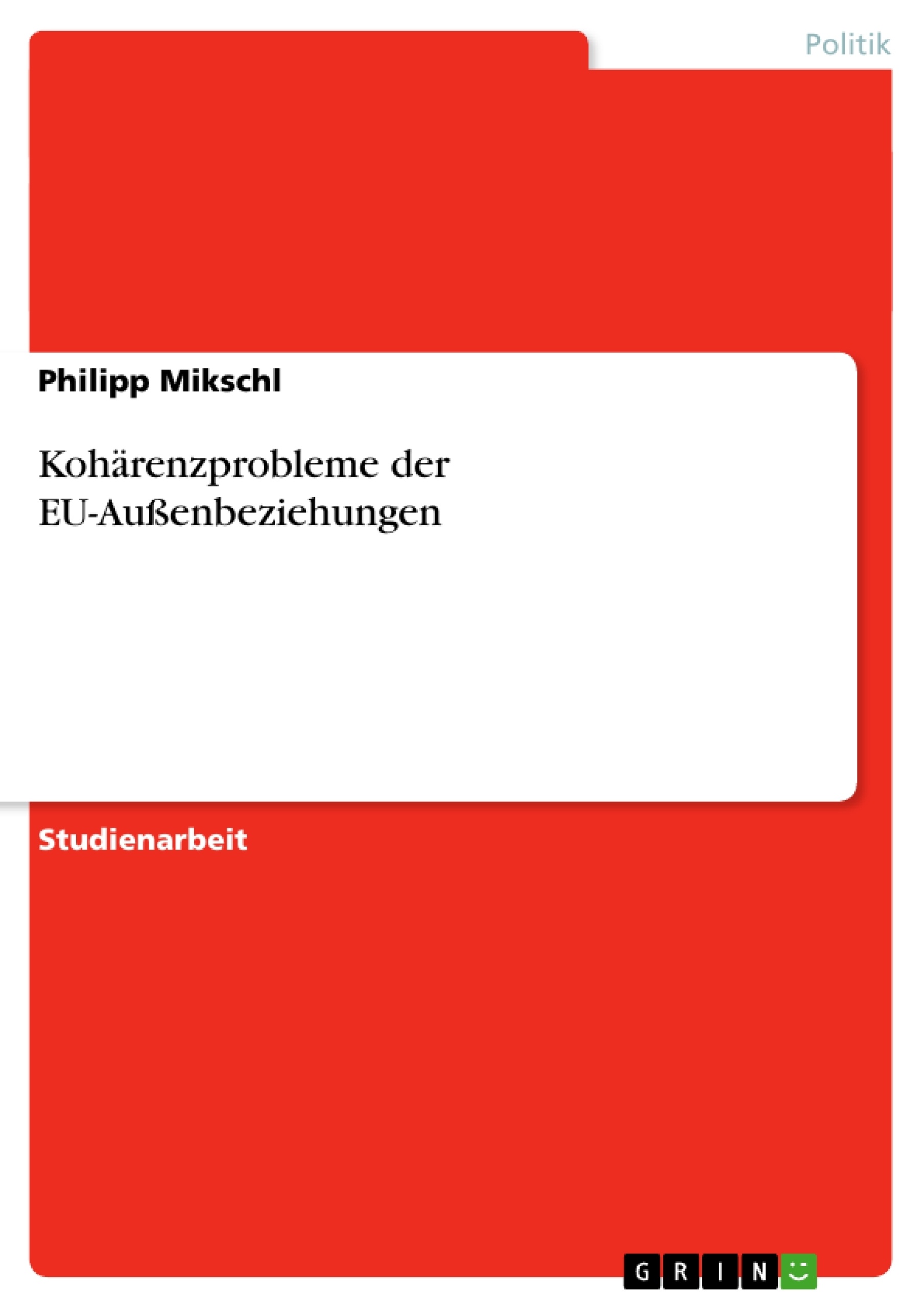Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Strukturen der EU-Außenbeziehungen
1.1 Außenwirtschaftsbeziehungen
1.2 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
2. Probleme der EU-Außenbeziehungen
2.1 Horizontale Kohärenz
2.2 Vertikale Kohärenz
2.3 Außenwirkung
3. Verbesserungen und momentaner Stand der GASP
4. Resümee
5. Literatur
0. Einleitung
Die Europäische Union (EU) ist ein bis dato einzigartiges Objekt innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft. Aus dem Zusammenschluss von jetzt 25 souveränen Staaten entsprang ein internationaler Akteur, der bislang viele Rätsel der politikwissenschaftlichen Analysen aufgab. Mit der Übertragung von Souveränitätsrechten auf ein supranationales Gebilde verpflichteten sich diese Staaten auf weitest gehende Kooperation, Koordination und Kohärenz ihrer Politiken. Gleichzeitig jedoch behielten die Nationalstaaten große Teile ihrer Souveränität für sich. Dadurch entstand ein großer Mix im Ausmaß der Vergemeinschaftung in den einzelnen Politikfeldern. Im Gegensatz zu höchst integrierten Bereichen, wie der Handels- und der Agrarpolitik, bildet die Außenpolitik ein sehr verschwommenes und mirakulöses Bild.
In dieser Arbeit sollen nun die Dimensionen der EU-Außenbeziehungen dargestellt werden und dabei erörtert werden, welche Probleme der Aufbau einer EU-Außenpolitik verursacht.
Dafür wird in einem ersten Schritt die beiden relevanten Bereiche der Außenbeziehungen, die Außenwirtschaftsbeziehungen und die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, in ihrer unterschiedlichen Gestaltung und mit ihren jeweiligen Akteuren vorgestellt.
Im Anschluss daran werden die verschiedenen daraus resultierenden Probleme herausgearbeitet und in drei Gruppen untergliedert: Erstens die Defizite in der horizontalen Kohärenz zwischen den beiden Säulen, zweitens die Probleme der vertikalen Kohärenz zwischen Union und Mitgliedstaaten und drittens die Mängel bezüglich der Außenwirkung der EU.
Im dritten Kapitel folgt eine Darstellung der bisher erfolgten Verbesserungsversuche der GASP durch die Union mithilfe der Vertragswerke von Amsterdam und Nizza.
1. Strukturen der EU-Außenbeziehungen
Die EU-Außenbeziehungen unterscheiden sich von der traditionellen Außenpolitik von Nationalstaaten. Sie stellen einen neuen Typ von Außenpolitik dar, der von einem stark fragmentierten oder multidimensionalen Profil geprägt ist.[1] Er ist Resultat des Dualismus’ zwischen der sog. ersten Säule, dem Gemeinschaftsbereich, und der zweiten, der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). Probleme – und auch die öffentliche Geringschätzung – der EU-Außenbeziehungen folgen aus den fundamentalen Unterschieden zwischen den Dimensionen. Ihnen liegen unterschiedliche Zielsetzungen, Grundlagen und Entscheidungsregeln zu Grunde.
Im Folgenden werden nun die Außenwirtschaftsbeziehungen und die GASP in ihren Grundzügen beschrieben. Die Darstellung beschränkt sich weitest gehend auf die institutionellen Vorgaben des Maastrichter Vertrages. Die Verträge von Amsterdam und Nizza haben zwar gewisse Verbesserungen und leichte Veränderungen eingeführt, aber nichts Grundlegendes verändert.[2] Diese Reformwerke sind u.a. Reaktionen auf die Probleme, welche sich aus dem Dualismus der Säulen ergaben. Die momentane Regelung der GASP wird nach der Erläuterungen der Strukturdefizite angeführt, um die Gründe ihrer Einführung zu erklären.
1.1 Außenwirtschaftsbeziehungen
Außenwirtschaftsbeziehungen fallen in den Kompetenzrahmen der Europäischen Gemeinschaft (EG) und sind somit Bestandteil der supranationalen ersten Säule.[3] Dazu gehören Beziehungen zu Nichtmitgliedsstaaten und internationalen Organisationen in den Bereichen Wirtschaft und Handel wie auch die Entwicklungspolitik und Assoziierungsabkommen.[4] Die gemeinsame Handelspolitik ist der Kern der außenpolitischen Kompetenz der EG und zugleich eine der stärksten integrierten Politiken der EU.[5] Die EG ist beim Abschluss von Abkommen mit Drittstaaten oder Organisationen der handlungsberechtigte Akteur, hat Rechtspersönlichkeit und dadurch Völkerrechtsfähigkeit.[6] Die Kommission hat hier die Hauptrolle. Im Bereich der autonomen Handelspolitik, d.h. nichtvertraglichen Handelspolitik, kann sie selbstständig Maßnahmen, wie Anti-Dumping- oder Anti-Subventionsmaßnahmen, ergreifen.[7] Sie ist die Vertretung der Gemeinschaft in allen internationalen Verhandlungen und besitzt ein Vorschlags- und Verhandlungsmonopol.[8] Dieses Verhandlungsmonopol wird streng überwacht durch den Ministerrat in Form von Verhandlungsmandaten, die den Spielraum der Kommission stark einschränken.[9] Diese Einflussnahme der Nationalstaaten durch den Ministerrat auf Gemeinschaftskompetenzen indiziert die erste Problematik der Säulenkonstruktion, die später ausführlicher behandelt wird.
1.2 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
Mit dem Vertrag von Maastricht ersetzt die GASP die Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ). Die bis dahin außerhalb des Rahmen der Union stehende Außenpolitik wurde so ins Vertragswerk mitaufgenommen. Aber im Gegensatz zu den Außenwirtschaftsbeziehungen dominiert die fortan zweite Säule der EU das intergouvernementale Prinzip. Die Mitgliedsstaaten waren nicht bereit einer Vergemeinschaftung der sensiblen Außenpolitik zuzustimmen.[10] Aber trotzdem zwangen die Zeitumstände die Mitgliedsstaaten ihre Außenpolitik zumindest zu koordinieren, um auswärtigen Druck besser standhalten zu können.
Es besteht das Ziel in allen Bereichen der Außen- und Sicherheitspolitik eine gemeinsame Linie zu finden und sie kollektiv umzusetzen.[11] Dafür sieht die GASP im Europäischen Rat die oberste Instanz. Er bestimmt die „Grundsätze und allgemeinen Richtlinien“ einstimmig, während der Ministerrat die dafür notwendigen Entscheidungen, ebenfalls einstimmig, trifft.[12] So soll die Kohärenz zwischen den jeweiligen nationalen Außenpolitik innerhalb der EU gewährleistet werden.[13] Die Schwierigkeit dessen ist – vorausgreifend – eines der großen Defizite der Regelung in der EU.
Um die nationalen Interessen zu wahren, bekamen die gemeinschaftlichen Organe, Kommission und Europäisches Parlament, keine gleichberechtigten Mitspracherechte.[14] Während der Kommission zumindest ein Vorschlagsrecht dem Ministerrat gegenüber gewährt wurde, beschränkt sich die Mitwirkung des Parlamentes auf ein Anhörungsrecht.[15]
2. Probleme der EU-Außenbeziehungen
Die Säulenkonstruktion mit ihren rigiden Trennungen hat für die Gestaltung von Außenpolitik problematische Folgen, die die Normsetzung der Gemeinsamkeit und des Sprechens mit einer Stimme konterkarieren. Zum einen besteht das Dilemma der Kohärenz. Innerhalb der EU zeigt sich dies in zweifacher Weise, horizontal sowie vertikal.[16] Zum anderen sind die negativen Folgen auf die Außenwirkung zu nennen: das Repräsentationsproblem und der Mangel eines militärischen Armes.
2.1 Horizontale Kohärenz
Die Säulenkonstruktion beruht auf einer strikten, aber genauso künstlichen Trennung der Bereiche Wirtschaft und Politik.[17] Die Komplexität der internationalen Beziehungen nahm besonders mit dem Ende des Kalten Krieges rapide zu. Immer mehr wirtschaftliche Aspekte bekommen eine explizit politische Dimension. Die Folge sind Kompetenzüberschneidungen zwischen den beiden Säulen. Zahlreiche Abkommen mit Drittstaaten sind nicht nur wirtschaftlicher Art – Zuständigkeit der Kommission –, sondern beinhalten auch GASP-relevante Komponenten. Bei den Verhandlungen dieser „gemischten Abkommen“ sind sowohl Kommission als auch Mitgliedsstaaten als eigenständige Akteure beteiligt.[18] Kompetenzstreitigkeiten und Dsyfunktionalitäten sind häufig die Folge. Auch die starke Kontrolle der Kommission durch den Ministerrat hat ihre Auswirkungen. Durch den Vorbehalt eines einstimmig beschlossenen Verhandlungsmandat sichern sich die Staaten ein Vetorecht und schwächen so die Verhandlungsstärke der Kommission.[19]
Weitere Überschneidungen finden sich in der Entwicklungs- sowie humanitären Politik. Das Vertragswerk sieht vor, dass die GASP in allen Bereichen der Außenpolitik agieren soll. Aber auch die EG soll explizit „politische Ziele“ verfolgen: Entwicklungspolitik soll Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte befördern. Ausdruck findet dies in sog. „Menschenrechtsklauseln“ oder „konditionierten Abkommen“.[20]
Zusätzlich wird in den Säulen überschneidenden Aktionen, wie das Initiativrecht der Kommission bei der GASP, ein mögliches folgenreiches Problem gesehen. Mit dem Namen „Kontaminationsproblem“ wird die Befürchtung bezeichnet, wenn die Kommission ihre vollen Rechte innerhalb der zweiten Säule ausschöpfen würde, sich dies auf die erste Säule in Form von Intergouvernementalisierung auswirken könnte.[21] Durch die zu häufige Mischung der beiden Säulen könnten auch bereits vergemeinschaftete Elemente renationalisiert werden. Besonders beim Verhängen von Wirtschaftssanktionen, wo die Kompetenzen sowohl bei der Kommission wie auch bei den Staaten liegen, zeigt sich dieses Dilemma der Koordinierung der jeweiligen Ansichten.[22]
Strukturdefizite innerhalb der Kommission verhindern ebenso eine klarere Ausgestaltung ihrer Politik. Aufgrund der Verteilung der Außenbereichskompetenzen auf mehrere Kommissare wird eine Koordinierung dieser schwieriger.[23] Die Staaten sind daran nicht unschuldig, da sie sich nicht auf eine Verkleinerung der Kommission einigen konnten.[24]
2.2 Vertikale Kohärenz
Diese Uneinigkeit der Mitgliedsstaaten ist nicht die einzige, die den Anspruch einer gemeinsamen Außenpolitik ad absurdum führen. Durch das intergouvernementale Prinzip fallen Entscheidungen nur im Konsens und jedes Land hat dadurch eine Vetomöglichkeit. Sie haben zwar erkannt, dass eine gemeinsame Linie die eigenen nationalen Interessen besser zum Ausdruck bringen kann. Gleichzeitig benützen sie die GASP nur dann, wenn die GASP tatsächlich eigene Interessen vorantreibt. Widerspricht ein Vorschlag diesen, wird ein Veto eingelegt.[25] Sobald Staaten Möglichkeiten haben ihre Anliegen auch ohne den gemeinsamen Rahmen zu verfolgen, greifen sie nicht auf diesen zurück und handeln alleine. Um die Gemeinsamkeit zu wahren, muss ein permanentes Verhandeln einsetzen, welches die einzelnen Interessen balancieren muss, wodurch meist nur Entscheidungen auf Basis des kleinsten gemeinsamen Nenners getroffen werden.[26]
Diese Verhandlungen sind durch die großen Unterschiedlichkeiten der Mitgliedsstaaten geprägt. Variationen finden sich nicht nur in der jeweiligen Geschichte, der Größe, der Fähigkeiten, der Identitäten, sondern auch in verschiedenen Teilnahmen an Bündnissen wie WEU und NATO. Dadurch werden konsequenterweise die Einstellungen zur GASP geprägt. Christopher Hill erkennt auf einem „Kooperationskontinuum“ drei Gruppen von Staaten.[27] Die erste Gruppe begrüßt die GASP und will auch auf deren Entscheidungsmodus beharren. In ihr sind v.a. die Benelux-Länder präsent, die sich ihrer marginalen Größe bewusst sind und daher keinen Sinn mehr sehen, unilateral Einfluss ausüben zu können. Zudem wollen sie Alleingänge der großen Staaten verhindern. Der zweite Block betrachtet die GASP mit weniger Enthusiasmus, lehnt sie aber nicht vollends ab. Dies entspricht der Einstellung der meisten EU-Staaten. Beispielsweise haben die neutralen Staaten keine Vorbehalte gegenüber der GASP, außer wenn Fragen bezüglich ihrer Neutralität aufkommen. Zuletzt sind noch die „unkooperativen“ Staaten zu nennen, voran Frankreich und Großbritannien. Mit ihrem Großmachtanspruch beharren sie stur auf der nationalen Kompetenz zur Gestaltung von Außenpolitik. Fähig und auch gewillt eigene Wege zu beschreiten, stellen sie das größte Hindernis für die GASP dar.
Verschärft wird das Dilemma noch durch die nicht einheitliche Zugehörigkeit zu internationalen Organisationen. Nicht alle Staaten sind Mitglieder von WEU oder NATO, manche beharren strikt auf ihrer Neutralität. Einheitliches Vorgehen ist durch den Mangel an Einigkeit kaum zu gewährleisten.[28] Außerdem bedingt die Umsetzung von Beschlüssen meist ein völkerrechtliches Mandat, aber die GASP besitzt keine Rechtspersönlichkeit, so dass sie nicht bei den Vereinten Nationen vertreten ist.[29] Nicht fähig bei Entschlüssen des Sicherheitsrates mitzuwirken, ist die GASP darauf angewiesen, dass die beiden Sicherheitsratsmitglieder Frankreich und Großbritannien Einigkeit demonstrieren. Diese Machtfülle der beiden Staaten dominiert die GASP und begrenzt vehement deren Funktionsfähigkeit.[30]
2.3 Außenwirkung
Ein weiteres gravierendes Problem ist das Rotationsprinzip der Präsidentschaft im Ministerrat. Da die jeweilige Präsidentschaft auch den Vorsitz der GASP innehat, wechselt die Repräsentation der EU-Außenpolitik jedes halbe Jahr. Es gibt keine permanente Ansprechperson für Drittstaaten und auch die Ausbildung eines einzigen gemeinsamen diplomatischen Dienstes bleibt der EU versagt.[31] Dieses – aus EPZ-Zeit stammende – Prinzip war bereits damals problematisch.[32] Der Mangel an Kontinuität und Identität sowie die Tatsache, dass kleine Länder kaum solch diplomatische Aufgaben erfüllen konnten, war zwar offensichtlich, wurde aber durch die Troika-Regelung nur halbherzig kompensiert.
Neben diesem Repräsentationsdefizit sticht vor allem die nicht vorhandene militärische Kompetenz der EU ins Auge. Wiederholt vorgeschlagen, scheiterte die Integration der WEU in den gemeinsamen Rahmen v.a. an den neutralen Staaten und an Großbritannien. Auch die Parallelität der WEU mit der NATO, in welcher die USA dominieren, verhinderte bislang eine sichtbare Eigenständigkeit der EU.[33] Neben die oben angesprochenen Problematik der Uneinigkeit über die Rolle der WEU tritt noch ein Effizienzproblem.[34] Die WEU hat nicht die Fähigkeit, nachhaltig für die Implementierung europäischer Sicherheitspolitik zu sorgen. Durch diesen Mangel an Entschlossenheit, verursacht durch Streitereien und fehlenden Kapazitäten, kann die EU nicht wie die USA für genügend Glaubwürdigkeit ihrer Beschlüsse sorgen. Konsequente EU-Außenpolitik ist so nicht möglich.
3. Verbesserungen und momentaner Stand der GASP
All diese Probleme um nationale Egoismen, mangelnde Kohärenz und Kompetenzstreitigkeiten führten und führen zu dem Bild des wirtschaftlichen Riesen und des politischen Zwerges. Aber durch die Verträge von Amsterdam und Nizza sind neue Elemente in das GASP-Regelwerk eingeflossen, welche das intergouvernementale Prinzip etwas abschwächen.[35]
Müller-Brandeck-Bocquet erkennt vier verschiedene Dimensionen innerhalb der GASP:[36] Primär bleiben weiterhin strikt intergouvernementale Elemente, welche die volle Souveränitätswahrung garantieren sollen. Zusätzlich existiert ein Souveränität teilendes Prinzip, das die Intergouvernementalisierung abschwächt. Drittens sieht sie sog. „brüsselisierte Elemente“, d.h. Reduzierung der Rolle der Staaten ohne Rückgriff auf supranationale Elemente. Zuletzt finden sich sehr begrenzt supranationale Elemente.
Souveränität wahrende Elemente sind v.a. das Konsensprinzip in Europäischen Rat und Ministerrat sowie die herausragende Rolle des Ratspräsidenten bei der Gestaltung und Ausführung der Außenpolitik. Die Nationalstaatlichkeit der EU-Außenpolitik bleibt der dominierende Aspekt.[37]
Nachdem die Defizite des strikten Intergouvernementalismus erkannt wurden, wurden Souveränität teilende Elemente eingeführt, um diesen Misstand etwas zu mildern.[38] Fortan sind unter gewissen Umständen Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat möglich. Mithilfe zu nennender Gründe kann zwar auch diese durch ein Mitgliedsland außer Kraft gesetzt werden, allerdings ist noch nie auf die Mehrheitsregel zurückgegriffen worden. Weiterhin soll die Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“ die vertikale Kohärenz erhöhen. Ziel ist es Vetos zu verhindern. Ein Land muss nicht mitmachen, soll aber wohlwollend den anderen gegenüber sein und deren gemeinsame Aktion nicht blockieren. Auch sie wurde noch nicht angewendet. Außerdem wurde die Norm gesetzt, dass der Ministerrat die vertikale Kohärenz garantieren soll, während dies bei der horizontalen Kohärenz Kommission und Ministerrat gemeinsam machen sollen.[39]
Herausragendes „brüsselisiertes“ Element ist der Posten eines Hohen Vertreters für die GASP.[40] Er soll garantieren, dass immer häufiger Außenpolitik in Brüssel stattfindet. Er bleibt dem Ministerrat verantwortlich und ist nicht Mitglied der Kommission. Trotzdem wurden ihm so viele Kompetenzen übertragen, dass er – in Person von Javier Solana – in kurzer Zeit zum Chefdiplomaten der EU wurde. Als Teil der Troika soll er nun Kontinuität und auch Identität der EU-Außenpolitik demonstrieren.
An den supranationalen Elementen der GASP hat sich auch durch die neuen Verträge nichts geändert.[41] Mit alleinigem Initiativrecht in der ersten Säule, muss sich die Kommission dieses in der zweiten Säule mit dem Ministerrat teilen. Durch den Hohen Vertreter wurden sogar die Weichen gestellt, eine weitere Supranationalisierung der Außenpolitik zu unterbinden. Eine bestimmende Rolle hat die Kommission nur um die horizontale Kohärenz zu sichern sowie bei Säulen übergreifenden Maßnahmen wie den Wirtschaftssanktionen. An den Rechten des Parlamentes hat sich mit der Beschränkung auf Information- und Anhörungsrecht seit Maastricht nichts verändert.
4. Resümee
Die Eigenheiten der EU in Aufbau und Organisation ihrer Außenpolitik verursachen skurrile Folgen. Durch die unterschiedliche Bereitschaft der Mitgliedsstaaten die Politikfelder Wirtschaft und Äußeres zu vergemeinschaften, entstand ein – meist nachteiliger – Dualismus zwischen den beiden Bereichen. Verschiedenen Integrationsmethoden folgend entstehen Inkompatibilitäten der Entscheidungsfindung zwischen den beiden Säulen. Die nach dem Ende des Kalten Krieges immer mehr politisierte Wirtschaftspolitik kommt zunehmend in Konflikt mit den traditionellen Außenpolitiken der Mitgliedsstaaten.
Die Bemühungen der EU dieses Dilemma innerhalb der horizontalen Kohärenz zu lösen, beschränken sich zum größten Teil auf normative Verpflichtungen der betroffenen Organe. Solange aber nicht in einem deutlichen Maße die jeweiligen Kompetenzen voneinander getrennt werden, so dass der zermürbende Wettstreit um Kontrolle und Macht zu seinem Ende findet, werden auch diese Appelle nichts nützen. Erst eine vollständige Vergemeinschaftung der GASP würde das Problem lösen.
Ein viel größeres Defizit ist die Uneinigkeit der Mitgliedsstaaten untereinander, die durch keine institutionelle Reform überwunden werden kann. Beharren die Mitgliedsländer weiterhin auf ihrer jeweiligen Staatsräson und ihren Interessen, kann auch die Möglichkeit der konstruktiven Enthaltung nicht dazu beitragen, Einigkeit der EU nach außen zu demonstrieren. Um tatsächlich eine gemeinsame Außenpolitik bilden zu können, muss in den Staaten ein Identitäts- und Interessenwandel vonstatten gehen, in welchen Europa einen größeren Stellenwert einnehmen muss. Ob dies gelingen kann, wenn immer mehr Mitglieder in die EU aufgenommen werden, bleibt fraglich. Selbst die bisherigen Staaten konnten dies nicht bewerkstelligen. Auf der Ebene der Nationalstaaten sind und bleiben noch zu viele Unterschiede, um von einer gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sprechen zu können.
5. Literatur
Hill, C.: Convergence, Divergence and Dialectics: National Foreign Policies and the CFSP, in: Zielonka, J. (Hrsg.): Paradoxes of European Foreign Policy, London u.a. 1998, S. 35-52.
Griller, S./ Weidel, B.: External Economic Relations and Foreign Policy in the European Union, in: Ders. (Hrsg.): External Economic Relations and Foreign Policy in the European Union, Wien 2002, S. 5-22.
Krenzler, H./ Schneider, H.: The Question of Consistency, in: Regelsberger, E./ Schoutheete de Tervarent, P./ Wessels, W. (Hrsg.): Foreign Policy of the European Union. From EPC to CFSP and Beyond, London 1997, S. 133-151.
Müller-Brandeck-Bocquet, G.: Die Mehrdimensionalität der EU-Außenbeziehungen, in: Schubert, K./ Müller-Brandeck-Bocquet, G. (Hrsg.): Die Europäische Union als Akteur der Weltpolitik, Opladen 2000, S. 29-44.
Ders.: Das neue Entscheidungssystem in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, in: Ders. (Hrsg.): Europäische Außenpolitik. GASP- und ESVP-Konzeptionen ausgewählter EU-Mitgliedstaaten, Baden-Baden 2002, S. 9-27.
Regelsberger, E.: The Institutional Setup and Functioning of EPC/CFSP, in: Regelsberger, E./ Schoutheete de Tervarent, P./ Wessels, W. (Hrsg.): Foreign Policy of the European Union. From EPC to CFSP and Beyond, London 1997, S. 67-84.
Rummel, R./ Wiedemann, J.: Identifying Institutional Paradoxes of CFSP, in: Zielonka, J. (Hrsg.): Paradoxes of European Foreign Policy, London u.a. 1998, S. 53-66.
Smith, K.: The Instruments of European Union Foreign Policy, in: Zielonka, J. (Hrsg.): Paradoxes of European Foreign Policy, London u.a. 1998, S. 67-85.
Thiel, E.: Die Europäische Union, München 42001.
Weidenfeld, W./ Wessels, W. (Hrsg.): Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen Integration, Bonn 2002.
[...]
[1] Vgl. Müller-Brandeck-Bocquet, G.: Die Mehrdimensionalität der EU-Außenbeziehungen, in: Schubert, K./ Müller-Brandeck-Bocquet, G. (Hrsg.): Die Europäische Union als Akteur der Weltpolitik, Opladen 2000, S. 29-44, hier S. 29f.
[2] Ders.: Das neue Entscheidungssystem in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union, in: Ders. (Hrsg.): Europäische Außenpolitik. GASP- und ESVP-Konzeptionen ausgewählter EU-Mitgliedstaaten, Baden-Baden 2002, S. 9-27, hier S. 10.
[3] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 36.
[4] Ebd., S. 37; Thiel, E.: Die Europäische Union, München 42001, S. 102; Weidenfeld, W./ Wessels, W. (Hrsg.): Europa von A bis Z. Taschenbuch der europäischen Integration, Bonn 2002, S. 82.
[5] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 37; Weidenfeld/ Wessels 2002, S. 82f.
[6] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 37.
[7] Weidenfeld/ Wessels 2002, S. 83f.
[8] Ebd., S. 85; Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 38.
[9] Weidenfeld/ Wessels 2002, S. 85; Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 38.
[10] Müller-Brandeck-Bocquet 2002, S. 9.
[11] Weidenfeld/ Wessels 2002, S. 226.
[12] Thiel 2001, S. 152; Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 32.
[13] Weidenfeld/ Wessels 2002, S. 226.
[14] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 32.
[15] Thiel 2001, S. 152.
[16] Krenzler, H./ Schneider, H.: The Question of Consistency, in: Regelsberger, E./ Schoutheete de Tervarent, P./ Wessels, W. (Hrsg.): Foreign Policy of the European Union. From EPC to CFSP and Beyond, London 1997, S. 133-151, hier S. 133.
[17] Griller, S./ Weidel, B.: External Economic Relations and Foreign Policy in the European Union, in: Ders. (Hrsg.): External Economic Relations and Foreign Policy in the European Union, Wien 2002, S. 5-22, hier S. 6.
[18] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 39; Smith, K.: The Instruments of European Union Foreign Policy, in: Zielonka, J. (Hrsg.): Paradoxes of European Foreign Policy, London u.a. 1998, S. 67-85, hier S. 69f.
[19] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 38.
[20] Griller/ Weidel 2002, S. 11f.
[21] Ebd., S. 13; Rummel, R./ Wiedemann, J.: Identifying Institutional Paradoxes of CFSP, in: Zielonka, J. (Hrsg.): Paradoxes of European Foreign Policy, London u.a. 1998, S. 53-66, hier S. 55.
[22] Rummel/ Wiedemann 1997, S. 55; Smith 1997, S. 72f.
[23] Müller-Brandeck-Bocquet 2000, S. 39.
[24] Rummel/ Wiedemann 1997, S. 55.
[25] Vgl. ebd., S. 61.
[26] Ebd., S. 61f.
[27] Vgl. Hill, C.: Convergence, Divergence and Dialectics: National Foreign Policies and the CFSP, in: Zielonka, J. (Hrsg.): Paradoxes of European Foreign Policy, London u.a. 1998, S. 35-52, hier S. 36f.
[28] Rummel/ Wiedemann 1997, S. 58 und 64.
[29] Ebd., S. 59.
[30] Ebd.
[31] Smith 1997, S. 69.
[32] Vgl. Regelsberger, E.: The Institutional Setup and Functioning of EPC/CFSP, in: Regelsberger, E./ Schoutheete de Tervarent, P./ Wessels, W. (Hrsg.): Foreign Policy of the European Union. From EPC to CFSP and Beyond, London 1997, S. 67-84, hier S. 72f..
[33] Smith 1997, S. 74f.
[34] Vgl. Rummel/ Wiedemann 1997, S. 58.
[35] Müller-Brandeck-Bocquet 2002, S. 11.
[36] Vgl. ebd., S. 11f.
[37] Vgl. ebd., S. 12f.
[38] Vgl. ebd., S. 16f.
[39] Krenzler/ Schneider 1997, S. 136.
[40] Vgl. Müller-Brandeck-Bocquet 2002, S. 18-21.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit den Dimensionen der EU-Außenbeziehungen und untersucht die Probleme, die beim Aufbau einer EU-Außenpolitik entstehen.
Welche Bereiche der EU-Außenbeziehungen werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf zwei Hauptbereiche: die Außenwirtschaftsbeziehungen und die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP).
Welche Probleme der EU-Außenbeziehungen werden identifiziert?
Die Arbeit gliedert die Probleme in drei Gruppen: Defizite in der horizontalen Kohärenz zwischen den Säulen, Probleme der vertikalen Kohärenz zwischen Union und Mitgliedstaaten sowie Mängel bezüglich der Außenwirkung der EU.
Was bedeutet horizontale Kohärenz in diesem Kontext?
Horizontale Kohärenz bezieht sich auf die Abstimmung zwischen den Bereichen Wirtschaft und Politik in der EU-Außenpolitik. Die Säulenkonstruktion trennt diese Bereiche künstlich, was zu Kompetenzüberschneidungen und Dysfunktionalitäten führen kann.
Was versteht man unter vertikaler Kohärenz?
Vertikale Kohärenz bezieht sich auf die Abstimmung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten in der Außenpolitik. Das intergouvernementale Prinzip ermöglicht es den Mitgliedstaaten, ihre nationalen Interessen zu verfolgen, was die Gemeinsamkeit der EU-Außenpolitik beeinträchtigen kann.
Was sind die Auswirkungen auf die Außenwirkung der EU?
Die Arbeit identifiziert Repräsentationsprobleme und den Mangel eines militärischen Arms als negative Folgen auf die Außenwirkung der EU. Das Rotationsprinzip der Präsidentschaft im Ministerrat und die fehlende militärische Kompetenz beeinträchtigen die Glaubwürdigkeit und Effizienz der EU-Außenpolitik.
Welche Verbesserungsversuche der GASP wurden unternommen?
Die Arbeit untersucht die Verbesserungsversuche der GASP durch die Verträge von Amsterdam und Nizza, die darauf abzielen, das intergouvernementale Prinzip abzuschwächen und die Kohärenz zu erhöhen.
Welche Elemente der GASP werden unterschieden?
Es werden vier Dimensionen unterschieden: strikt intergouvernementale Elemente, Souveränität teilende Prinzipien, "brüsselisierte Elemente" und sehr begrenzt supranationale Elemente.
Was ist die Rolle des Hohen Vertreters für die GASP?
Der Hohe Vertreter soll die Kontinuität und Identität der EU-Außenpolitik demonstrieren und eine häufigere Außenpolitik in Brüssel gewährleisten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die unterschiedliche Bereitschaft der Mitgliedsstaaten zur Vergemeinschaftung von Wirtschaft und Äußerem zu einem Dualismus führt. Die Uneinigkeit der Mitgliedsstaaten und die Beharrung auf ihren jeweiligen Staatsräsonen stellen weiterhin große Herausforderungen für eine gemeinsame Außenpolitik dar.
- Citation du texte
- Philipp Mikschl (Auteur), 2004, Kohärenzprobleme der EU-Außenbeziehungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109108