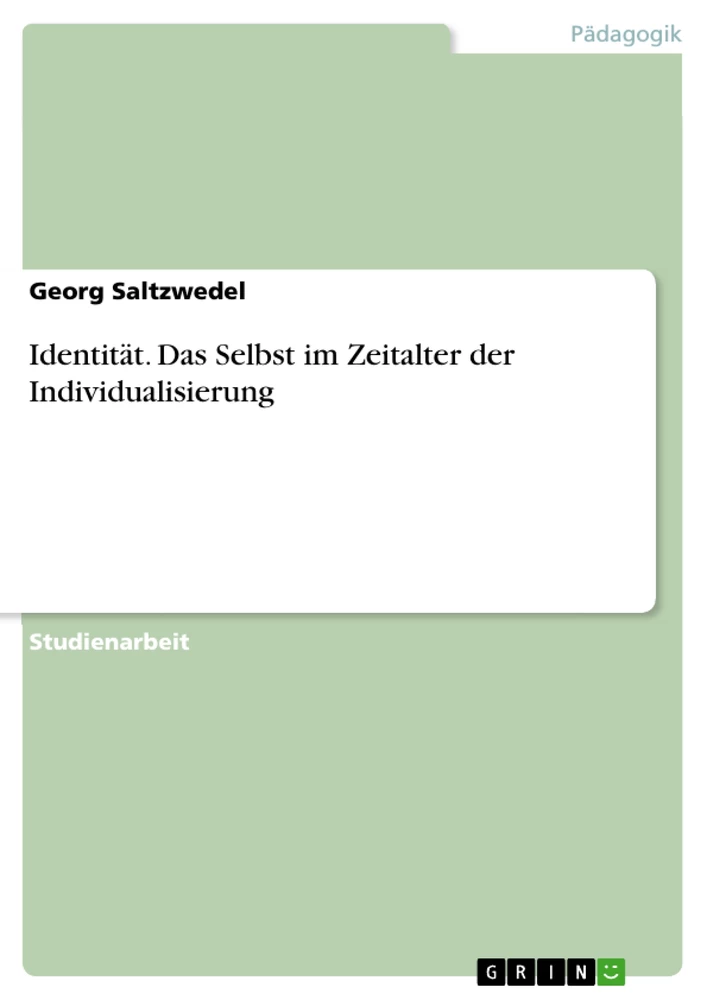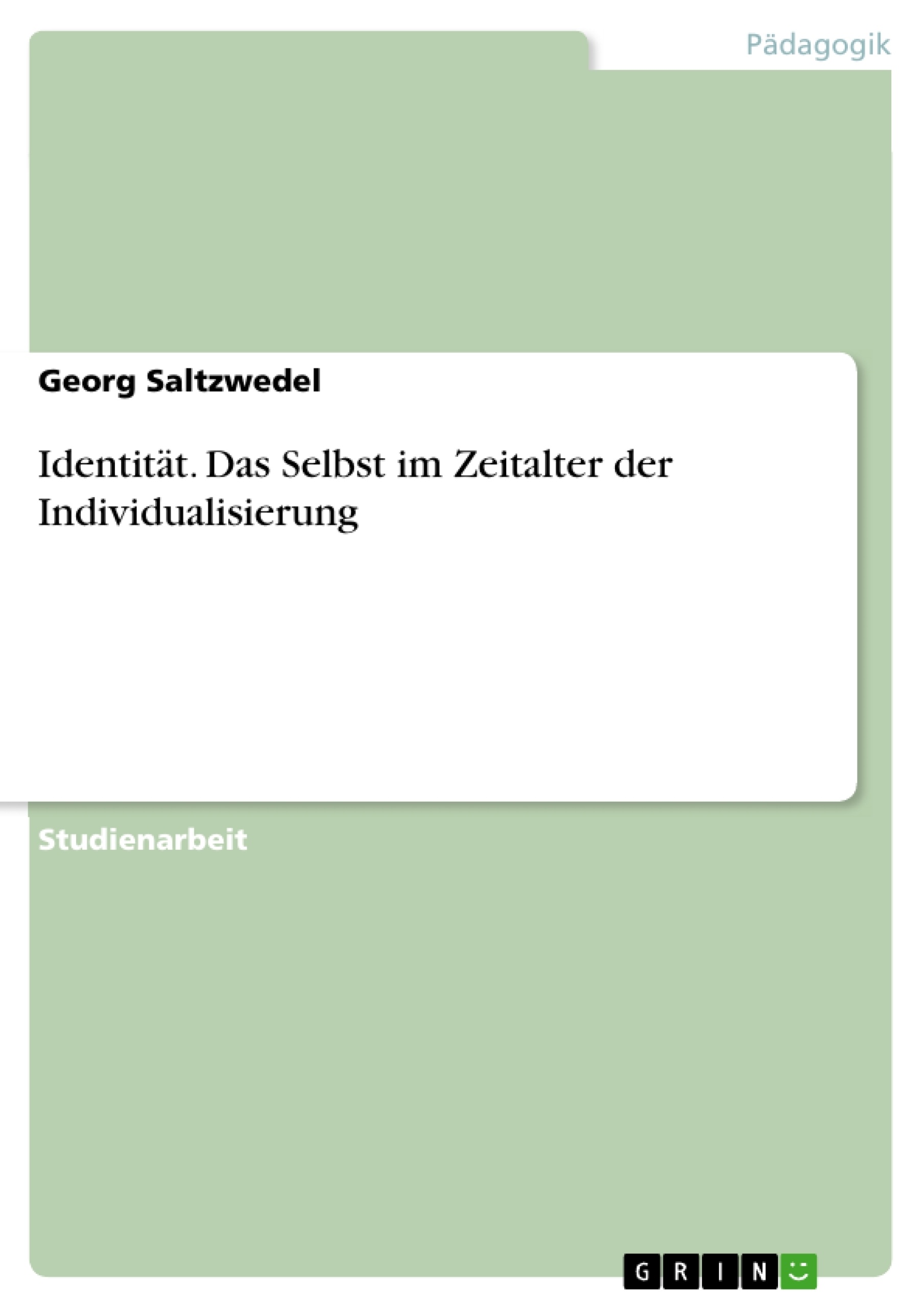Stellen Sie sich vor, Ihr Leben ist eine Bühne, auf der Sie unzählige Rollen spielen – Ehepartner, Elternteil, Freund, Kollege, vielleicht sogar eine Online-Identität in einer virtuellen Welt. Aber wer sind Sie wirklich hinter all diesen Masken? In unserer zunehmend individualisierten und globalisierten Welt, in der Traditionen verblassen und soziale Bezugssysteme sich auflösen, wird die Frage nach der Identität immer drängender. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise durch die faszinierende Landschaft der Identitätstheorien, von klassischen Konzepten, die einen festen Kern des Selbst postulieren, bis hin zu postmodernen Ansätzen, die das Selbst als ein dynamisches, sich ständig veränderndes Konstrukt betrachten. Erforschen Sie die Ideen von Schlüsseldenkern wie Mead, Erikson, Gergen und Turkle, die unsere Vorstellungen davon, wer wir sind, revolutioniert haben. Entdecken Sie, wie das Selbst im Zeitalter der Individualisierung geformt wird, welche Rolle soziale Interaktionen, kulturelle Einflüsse und kognitive Prozesse bei der Identitätsentwicklung spielen. Lernen Sie die Bedeutung von Kohärenz und Authentizität kennen und erfahren Sie, wie multiple Identitäten unser Leben bereichern oder zu inneren Konflikten führen können. Ob Sie sich für Psychologie, Soziologie oder einfach nur für die Frage interessieren, wer Sie selbst sind – dieses Buch bietet Ihnen wertvolle Einsichten und neue Perspektiven auf eine der grundlegendsten Fragen des menschlichen Daseins. Es beleuchtet, wie Identität als ein fortlaufender Prozess der Selbstfindung, ein Balanceakt zwischen Autonomie und Anpassung, zwischen dem Wunsch nach Individualität und der Sehnsucht nach Zugehörigkeit verstanden werden kann. Es zeigt, wie wir unsere eigene Lebensgeschichte konstruieren, wie wir mit den Herausforderungen des modernen Lebens umgehen und wie wir Sinn und Bedeutung in einer Welt finden, die sich ständig verändert. Tauchen Sie ein in die Welt der Identität und entdecken Sie die vielschichtigen Facetten Ihres eigenen Selbst. Dieses Buch bietet eine fundierte Auseinandersetzung mit den komplexen Fragen rund um Identität, Selbstkonzept und die Suche nach dem eigenen Platz in der Gesellschaft. Es analysiert unterschiedliche Theorien und Modelle, um ein umfassendes Verständnis der Identitätsbildung und -entwicklung zu ermöglichen, und bietet wertvolle Impulse für die persönliche Reflexion und das Verständnis sozialer Dynamiken. Schlüsselwörter: Identität, Selbst, Individualisierung, Postmoderne, Identitätsentwicklung, Selbstkonzept, soziale Identität, Kohärenz, Authentizität, Psychologie, Soziologie, Lebensgeschichte, Selbstfindung, soziale Netzwerke, Globalisierung, Rollenidentität, Ich-Identität, multiple Identitäten.
Inhaltsverzeichnis:
1. Einleitung und Begriffsklärung
1.1 Fragestellung
2. Das Selbst im Zeitalter der Individualisierung
3. Klassische Positionen der Identität
4. Identität in der Postmoderne
5. Identitätsaufbau und Identitätsentwicklung
6. Das multiple, dynamische Selbst
7. Kognitive Voraussetzungen des multiplen Selbst
7.1 Untersuchungen zum Selbstkonzept
7.2 Ursachen für die Aktivierung von Selbstkonstrukten
8. Identität in soziologischen und sozialpsychologischen Kontexten
9.Tabellarischer Überblick über erwähnte Autoren und ihre Theorien
10. Diskussion
11. Literatur
1. Einleitung und Begriffsklärung
Gerade in den letzten Monaten ist die Frage nach der Identität auch in der Öffentlichkeit wieder aufgegriffen und zu einem gewichtigen Begriff gemacht geworden, wenn man die Debatten um die EU – Osterweiterung mitverfolgte. Hier wurde immer wieder gefragt, wie einzelne Menschen oder Menschengruppen zu einem Verständnis kommen können wer sie überhaupt sind und wo sie hingehören. Gibt es eine Art „Europäische Identität“, zu der sie sich jetzt plötzlich zugehörig fühlen müssen, sollen oder dürfen? Es scheint fast so, als ob immer neue Orientierungen und Anpassungen notwenig sind, um in den sich ständig verändernden Kontexten des Lebens zurecht zu kommen. Ein anderes Beispiel wäre die ständig weitere Ausgestaltung sowohl der Globalisierung als auch Individualisierung. So scheinen dadurch Traditionen und andere Gewissheiten immer mehr an Bedeutung zu verlieren. Damit erlangen als Konsequenz auch die sozialen Bezugssysteme, auf die sich Identität (meistens) bezieht ein Weniger an Bedeutung. Somit werden wir gezwungen einen Konstruktionsprozess der Identität selber und immer wieder in Gang zu setzen. Ein Blick auf die Definition im Lexikon deutet diesen Prozess an. Hier heißt es „das Sich-gleich-Bleiben im Wechsel“. Dies impliziert also, dass es eine stabile und eine sich verändernde Komponente gibt. So heißt es weiter, dass „sie sich bezieht auf das Durchhalten eines Veränderlichen als eines und desselben in der Zeit, z.B. des Ich, der Erlebniseinheit des Individuums, der Person“ (Bertelsmann-Lexikon, 1973, S. 322). Ist das nicht mehr gegeben, entweder durch Gedächtnisverlust oder Krankheit wie z.B. Alzheimer, dann verändert sich oftmals auch unser Identitätserleben, ja man spricht sogar von Identitätsverlust. Das legt also die Vermutung nahe, dass unser Identitätserleben stark an unsere Vergangenheit gekoppelt ist.
Aus diesen kurzen Beschreibungen wird schon deutlich, dass es sich nicht um ein starres Konstrukt handelt, sondern vielmehr um einen (lebenslangen) Prozess. Darum könnte man Identität auch als Lebensbaustelle bezeichnen. Will man den Begriff weiter differenzieren, so besteht eine Möglichkeit darin, eine Person in eine Innen- und eine Außenwelt zu untergliedern. Die Außenwelt wäre dabei verhältnismäßig einfach in Erfahrung zu bringen. Hier kann man eine Identifikation von Individuen nach Name, Pass, biometrischen Daten oder Rolle (Student...) vornehmen. Anders verhält es sich mit der Innenperspektive; hier kann oder muss ich mich für einen Lebensweg entscheiden, für Verhaltensstile und Rollenzugehörigkeiten.
Betrachtet man die Entstehung der anthropologischen bzw. sozialpsychologischen Identitätstheorie, so fällt der Blick zunächst einmal auf William James. Dieser definierte das Selbst in erster Linie als soziale Erfahrung. Damit meint er, dass sich die persönliche Identität entscheidend durch Beziehungen zu anderen bestimmt. Dies formuliert er so, indem er auf der einen Seite das „Me“ als das Selbst, auf der anderen Seite das „I“ als das Ich unterscheidet. Mit dem „Me“ ist die Person als Objekt in ihrer eigenen Wahrnehmung gemeint, als „I“ dasjenige, das der Welt als erkennendes Subjekt gegenübersteht. Somit ist das „Me“ die Summe dessen, was das Selbst hervorbringt (an Verhalten, Gedanken etc.) das „I“ eher das, was als aktuelles, tätiges Bewusstsein (stream of conciousness) handelt (James, 1892, S. 175).
James löste eine neue Ideenwelle aus, die den Trend nach sich zog, dass die auf ihn folgenden Autoren wie Baldwin und Mead das ‚Selbst‘ nach außen verlegten in die sichtbare Welt, nämlich indem sie es als Resultat sozialer Interaktionen ansahen und nicht länger als Ergebnis der ‚einsamen‘, individuellen Auseinandersetzung mit sich und der Welt (Danzinger, 1997, S.140). Die Folge dieser Wende war, dass das Selbst nun empirisch untersuchbar wurde.
1.1 Fragestellung
Wie aus den vorangehenden Zeilen schon ersichtlich wird, drängt sich bereits bei der Begriffsklärung die Frage auf, inwieweit dasjenige, was wir unter (unserer) Identität verstehen, ein einziger fester Kern ist, ob sie aus mehreren Teilidentitäten besteht oder ob sie gar ein ständiger Prozess ist, also in direkter Opposition steht zu ersterer Annahme. Nun möchte ich im Folgenden der Frage nachgehen, inwiefern sich Wissenschaftler für die Idee eines fixen Identitätskerns aussprechen, wie sie ihre Haltung begründen und untermauern.
2. Das Selbst im Zeitalter der Individualisierung
Den Anfang möchte ich machen mit einer Darstellung des Konzeptes von Bodack (2002). Im Selbst sieht er eine zeitlich überdauernde Struktur, mit sowohl bewussten als auch unbewussten Anteilen[1]. Das entspricht im Kern dem, was wir oben im Lexikon gefunden haben, darum soll dieses Konzept Eingang finden in diese Arbeit.
Die Struktur des Selbst sieht er als Polaritäten im Rahmen einer Triade. So unterscheidet er folgende Grunddimensionen des Selbst:
-Autonomie und Anpassung
-Selbst- und Fremdbestimmung
-Selbsterhaltung und Selbsthingabe
Diese Dimensionen oder Haltungen hat er entwickelt auf Anregung verschiedener Denker. So nimmt er z.B. Bezug auf Erich Fromm, der die Entwicklung des Egoismus auf den Dimensionen „Haben“ und „Sein“ beschrieben hat. Verfällt der Mensch dem „Habenmüssen“, so schwinden seine Chancen sein „Sein“ zu entwickeln. Diese Dimension des ‚Seins’ beschreibt Bodack als „Authentizität“ (Bodack, 2002, S.2). Damit möchte er v.a. aufzeigen, dass jeder Mensch eigene Werte und Überzeugungen entwickeln soll, aus denen er sein Leben gestalten kann. Vor allem im Umfeld des Humanismus wurde Wert darauf gelegt, dass die Individualität angeregt wurde zum eigenständigen Denken. Auf der anderen Seite war es den Vertretern dieser Richtung aber genau so wichtig, Menschen in soziale Kontexte einzubinden; Denn diese Humanisten sagten, dass sich ein Selbst nur dann entwickeln könne, wenn es in der direkten Kommunikation mit anderen Menschen steht.
Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, untersuchte als einen Forschungsschwerpunkt das Verhalten von Menschen in sozialen Kontexten. Dabei stieß er auf eine Persönlichkeitsausprägung, die er „Solidarizität“ nannte. Damit meinte er eine Art Gemeinsinn oder Gemeingefühl. Was die Ausprägungsstärke eben dieser Dimension anging, so stellte Frankl fest, dass es hier auf der einen Seite Entwicklungsdefizite geben kann und auf der anderen Seite Übertreibungen, die bis zur Selbst-Opferung oder Selbst-Aufgabe reichen können. Dieser Ausprägung des Selbst steht der „Egoismus“ gegenüber, der wiederum in seiner Übertreibung zur Habsucht führen kann. Mit diesen drei Aspekten des Ich versucht nun Bodack (2002, S.3) den Rahmen abzustecken, in dem sich das Selbst permanent bewegt. Im Selbstbewusstsein manifestieren sich diese Dimensionen in der
-Werteorientierung, Weltanschauung und dem Menschenbild,
-Mitmenschlichkeit, dem sozialen Engagement, der Umweltorientierung,
-Selbsterhaltung, dem Besitzstreben, der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes.
Eine hypothetische Korrelation unter den drei Dimensionen führt zu der Annahme, dass eine extreme Ausprägung einer oder zwei Dimensionen zu einer Reduktion der anderen führt und eine oder zwei schwach ausgeprägte Dimensionen zu einer Stärkung der anderen. Der Begründer dieses Modells erklärt diese Abhängigkeit damit, dass der Mensch sein Leben individuell ausrichtet und selber seine Schwerpunkte wählt, denen er seine meiste Zeit zuordnet. Als Beispiel nennt er etwa einen Geltungssüchtigen, der sich wohl meist wenig solidarisch aber oft altruistisch verhält, oder ein sich aufopfernder Mensch, der altruistisch und oft dazu konformistisch ist. In extremer Ausprägung können alle diese drei Haltungen des Selbst zu Süchten führen. Hier nennt Bodack die Geltungs- und Profiliersucht als übersteigerten Hang zu „Authentizität“, die Macht- und Herrschsucht als minimierte „Solidarität“ und Geiz- und Habsucht als krankhafter, weil zu starker „Egoismus“. Darüber hinaus vertritt er den Standpunkt, dass eine Entwicklung des Selbst, sei es in der (Selbst/Fremd-) Erziehung oder in der Therapie, immer darauf aufbauen sollte, dass die Individualität ernst genommen wird. Dies bedeutet, dass jeder seine eigenen Wertvorstellungen entwickeln sollte. Und sollte das gelingen, so kann dies einiges an Selbstsicherheit und Lebensqualität vermitteln; denn, um das Argument weiter zu denken, für wen wäre es kein befriedigendes Gefühl auf dem Wege zu sich Selbst zu sein und Authentizität zu erleben. Bedeutend für die Entwicklung des Selbst scheint außerdem, wie schon erwähnt, der Einfluss aus dem sozialen Umfeld zu sein. Niemand wächst auf, ohne dem Einfluss der Familie, des Freundeskreises oder später auch des Berufes und anderen Gruppen oder Einzelpersonen ausgesetzt zu sein. Und auch hier kann man feststellen, dass je umfänglicher, je facettenreicher das „soziale Selbst“ ausgeprägt ist, je mehr soziale Kompetenz also vorherrscht, desto besser kann die Kooperation mit anderen Menschen gelingen. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Bodack die Hypothese einer Triade des Selbst vertritt, wobei das Selbst als individueller Kern zu jeder Zeit Ausgangspunkt allen Handelns ist. Er nimmt an, dass erstens aus „Authentizität“ ein persönliches Wertesystem hervorgeht, zweitens aus „Solidarität“ eine Haltung zur Mitmenschlichkeit entsteht und drittens aus „Egoismus“ ein Wille zur Selbsterhaltung entwickelt wird. Darüber hinaus ist er der Meinung, dass ausgeprägte Einseitigkeiten des Selbst entweder zu Süchten führen oder zumindest das Zusammenleben mit anderen Menschen erschweren.
3. Klassische Positionen der Identität (nach Mead und Erikson)
Hier ist zunächst der Name George Herbert Mead zu erwähnen, der viele menschliche Züge, die vor allem mit einem selber zu tun haben, in die Sozialität, also in die Außenwelt verlagert hat. So sei die Identität bei der Geburt noch nicht vorhanden, sondern entstehe erst nach und nach durch das Sammeln von Erfahrungen in der Gesellschaft resp. durch die Interaktion mit anderen Individuen (Mead, 1983, S.177). Die „Me’s“, wie er sie formuliert, sind Rollenerwartungen, welche die Gesellschaft an den Einzelnen heranträgt und die dieser internalisiert (Mead, 1983, S.218). Das drückt sich in Haltungen gegenüber der Gesellschaft aus, die einen mit anderen Individuen verbinden. Das „I“ hingegen ist die Reaktion des Organismus auf die Haltung anderer, d.h. eine Art Impuls, dessen Auftreten der Einzelne nicht steuern kann. Das klingt nach etwas unbestimmten Reaktionen, doch dies sei laut Mead gerade das Charakteristikum des „I“. Diesen Entstehungsprozess der Identität (im Sinne von „I“ und „Me“) erläutert Mead anhand des Beispiels der Entwicklung des Kindes, bei welcher er zwei aufeinander aufbauende Spielformen feststellt, nämlich das nachahmende Spiel und das Wettspiel. Bei ersterem nimmt das Kind erst Haltungen der anderen gegenüber sich selbst ein, während es auf letzterer Stufe die Haltung aller Beteiligten im Blickfeld hat. So geht denn auch erstere Spielform der letztgenannten in der Entwicklung zeitlich voraus. Denn im Wettspiel gibt es feste Regeln und Spielabläufe. Das bedeutet, dass hier das Kind nicht nur in der Lage sein muss, die Rolle des anderen einzunehmen, (wie bei der Nachahmung) sondern die Rollen aller Beteiligten, um das eigene Handeln entsprechend zu steuern. Die Reaktion auf eine solch komplexe Situation nennt Mead den „generalisierten Anderen“ (Mead, 1987, S.319). Die Identität erschöpft sich jedoch nicht in der Übernahme dieses „generalisierten Anderen“, sondern ist die durch das „I“ geleistete Organisation der unterschiedlichen „Me’s“ zu einem einheitlichen Ganzen, welches wiederum handlungsorientierend wirkt. Mit Mead haben wir also einen Vertreter eines Identitätsbegriffes, der davon ausgeht, dass sich Identität aus vielen Teilidentitäten zusammensetzt, welche durch eine weitere Instanz, das „I“, zusammengehalten werden.
Ein anderer „Präger“ des klassischen Identitätsbegriffs war Erik H. Erikson, dessen Wurzeln in der Psychoanalyse liegen. Um seine Identitätstheorie zu entwickeln untersuchte er Biographien herausragender Persönlichkeiten sowie solche von Kindern, die ihm im Rahmen einer Erziehungsberatung zugänglich waren. Er gelangte zu einem Begriff der Identität, der v.a. einen Aspekt umfasst; den des stetigen Zuwachses an Persönlichkeitsreife über den Lebenslauf hinweg. So muss etwa eine Person am Ende der Adoleszenz so viele Kindheitserfahrungen gemacht und daran gelernt haben, dass sie „für die Aufgaben des Erwachsenenlebens gerüstet ist“ (1993, S.123). Somit spricht Erikson u.a. von der Adoleszenz als einem entscheidenden Stadium für die Identitätsbildung. Am Ende des psychosozialen Moratoriums zwischen Jugend und Erwachsenenalter sollte der Jugendliche in der Lage sein, eine Einheit über die bis zu diesem Zeitpunkt erfahrenen und ausprobierten Rollen herstellen zu können, sowie sich entsprechend dieser neu erworbenen Identität einen Platz in der Gesellschaft zu suchen (Storch, 1999, S.62). So drückt der Begriff der Identität „insofern eine wechselseitige Beziehung aus, als er sowohl ein dauerndes, inneres Sich-Selbst-Gleichsein wie ein dauerndes Teilhaben an bestimmten gruppenspezifischen Charakterzügen umfasst“ (Storch, 1999, S.144). Folgende Merkmale sollen, nach Erikson, eine gelungene Identität aufweisen:
1.) Kontinuität (des Charakters über die Lebenszeit hinweg und soziale, zwischen Einzelnem und Sozialität)
2.) Autonomie (-gefühl)
3.) Einheitliche Konfiguration
So hat die klassische Position auch in Erikson einen Vertreter gefunden, der betont, dass Identität erst im Laufe der Zeit entstehen könne. Ähnlich wie Mead propagiert er eine Instanz, die dafür verantwortlich ist, die verschiedenen Erfahrungen zu vereinen und für ein einheitliches Erleben zu sorgen.
Ergänzend kann Krappmanns Ansicht aufgeführt werden, der die klassischen Positionen weiterentwickelt hat und Identität als balancierte Identität versteht. Identität ist folglich „kein fester Besitz des Individuums, sondern muss in jedem Interaktionsprozess angesichts anderer Erwartungen und einer sich ständig ändernden Lebensgeschichte des Individuums neu formuliert werden“ (Krappmann, 1978, S.208). Mit diesem von Krappmann entwickelten Konzept ist es also nicht mehr erforderlich die Harmonie von gesellschaftlichen und persönlichen Verhältnissen herstellen zu müssen. Sein Identitätsbegriff beschreibt vielmehr einen ständigen Prozess. Damit wird erstmals auf eine Erfahrungen zusammenführende Kraft verzichtet und sich gegen die eingangs formulierte Fragestellung nach einem überdauernden Kern ausgesprochen.
4. Identität in der Postmoderne
Die postmoderne Position postuliert, ganz generell gesagt, die Vielfalt von me’s, d.h. dass Menschen verschiedene Rollen übernehmen und verschiedene Verhaltensweisen an den Tag legen, je nach dem unter dem Einfluss welcher Stimuli resp. sozialen Kontexten sie gerade stehen. Einer der sicherlich wichtigsten Vertreter der postmodernen Position ist Gergen. Er entwickelte die These des „sozialen Konstruktionismus“, die besagt, dass Menschen Konzepte über sich selber hauptsächlich aufgrund kulturell geprägter, selektiver Wahrnehmungen entwickeln, sowie aufgrund von Sprache und der Interaktion mit anderen Menschen (Gergen, 1996). Wenn man den Gedanken, dass das Konzept über sich selber vor allem die soziale Welt wiederspiegelt, weiterdenkt, so wird laut Gergen die Welt mit zunehmender Lebenserfahrung immer komplexer, was wiederum zur Folge hat, dass es seltener zu einer Einheit von Kohärenz in den Konzepten kommt.
In der Vergangenheit war dieses Thema „Identität“ bei weitem nicht so aktuell wie heute, denn die sozialen Rollen waren damals weitgehend festgelegt (Baumeister, 1987). Der Lebenslauf und die Lebensgestaltung der Menschen waren oft schon durch die Geburt geregelt. So wurde der Arbeitersohn genauso Arbeiter wie das „blaue Blut“ weitergegeben wurde; und auf diese Art lief vieles auf traditioneller Basis ab. Vor dem Hintergrund dieser stabilen Lebensführung entstand nun die Vorstellung von einem einheitlichen persönlichen Kern, der jedem Menschen innewohnt. Wie nun jeder aus eigener Erfahrung weiß, sieht in der heutigen Zeit die Situation anders aus; denn „in der postmodernen Welt gibt es keine individuelle Grundlage, der man treu bleibt, oder der man verbunden ist. Die eigene Identität entsteht fortwährend neu, sie formt sich um und richtet sich neu aus, während man sich durch das Meer der ständig wechselnden Beziehungen ‚fortbewegt‘“ (Gergen, 1996, S.230). Bezüglich dieser Idee einer so flexiblen Identität ähneln Gergens Ansichten sehr stark derjenigen Krappmanns. Und aufgrund dieser ständig sich neu formierenden Identität kommt es dazu, dass aus einer Persönlichkeit mit einer Kernidentität die „gemischte Persönlichkeit“ wurde. Gergen beschreibt sie als „soziales Chamäleon“, welches sich je nach anbietendem Nutzen, Identitätsteile für die jeweilige Situation aufbaut. So lässt sich also sagen, dass jeder Moment, in dem wir mit anderen Menschen in sozialem Austausch stehen, eine neue Facette unserer Selbst hervorbringt. Es werden also laufend neue „Me’s“ produziert. Dadurch kommen jetzt die Vertreter der postmodernen Theorie zu der Annahme, dass es nicht Sinn macht nach einer einheitlichen Darstellung des Selbst zu suchen, sondern vielmehr die Identität als einen lockeren Zusammenschluss verschiedener „Me’s“, etwa im Sinne einer Patchworkdecke anzusehen (Storch, 1999, S.71). Diese Haltung oder Idee scheint überaus zeitgemäß zu sein, wo doch eine immer flexiblere Selbstdarstellung mittlerweile zum Alltag gehört. So meint denn Gergen auch, dass mit dem Fallenlassen des Einheitsanspruchs das Leben „ausdrucksvoller und reicher“ geworden ist. Die postmoderne Antwort auf die Frage „wer bin ich?“ ist also eine eher unverbindliche, dafür aber auch eine, die mehr Freiheiten gibt (Gergen, 1996, S.222). Mit dem in Frage stellen eines „wahren“ oder „grundlegenden“ Selbst wird zugleich die Frage aufgeworfen wie groß der Anteil von traditionellen Identitätskennzeichen wie etwa Beruf, Geschlecht und Rasse in Bezug auf die Gesamtheit aller „Me’s“ ist (Gergen, 1996, S.289).
Eine weitere Vertreterin der postmodernen Theorie ist Turkle. Sie beschäftigte sich mit der Frage nach Kohärenz der Vielfalt der „Me’s“. Dazu untersuchte sie Jugendliche, die sich per Computer in eine sogenannte MUD (Multi-User-Domain) einloggten, um dann per Internet in Form einer beliebigen Identität mit anderen zu kommunizieren. Durch diese Art von Rollenspiel versprach sich Turkle Erkenntnisse über das „Innenleben“ der Teilnehmer, da sich jeder nach Belieben eigene „Selbste“ schaffen konnte. Auf diesem Wege gelang es ihr quasi mehrere „Me’s“ zeitgleich nebeneinander zu betrachten. - Sie zog aus ihren Beobachtungen den Schluss, dass es nicht nur möglich sei, eine multiple aber kohärente Identität zu entwickeln, sondern dass der Mensch geradezu danach strebt. Ein Auseinanderfallen entsteht dann, wenn die einzelnen me’s nicht mehr miteinander kommunizieren können. So meint sie, dass sich „ohne das Kohärenzprinzip das Selbst in alle Richtungen verliert. Die multiple Identität ist nicht existenzfähig, wenn sie im Pendeln zwischen Persönlichkeiten besteht, die nicht miteinander kommunizieren können“ (Turkle, 1998, S. 419). Diese Menschen werden also krank. Während Gergen Wert darauf legte aufzuzeigen, wie facettenreich die einzelnen „Me’s“ sein können, so geht Turkle noch einen Schritt weiter, in dem sie fragt, wie mit diesem Facettenreichtum umgegangen werden muss, um nicht in eine Beliebigkeit abzudriften.
Auch McAdams (1997) stellt sich diese Frage in ähnlicher Weise, bei welcher er Bezug herstellt zu Antonovskys salutogenetischem Ansatz. Letzterer geht davon aus, dass Kohärenzerleben die Grundvoraussetzung für ein gesundes Seelenleben darstellt. Und so kommt auch McAdams zu dem Schluss, dass ein gelungenes Kohärenzerleben die Menschen psychisch stabilisiert. Er stellt sich dabei die Frage, wie es gelingen kann Kohärenz in der Vielfalt der „Me’s“ herzustellen. Seine Antwort darauf ist, dass er von einem organisierenden Ich ausgeht. Dabei betont er, dass dieses Ich als Prozess zu verstehen sei und nicht etwa wie ein Gegenstand, ein Organ oder Ähnliches. Er nennt diesen Prozess „selfing“. Damit meint er, dass durch diesen Vorgang des selfing eine Art Ich-Erleben in uns entsteht. Das würde bedeuten, dass jedes „Me“ ein Produkt dieses Prozesses ist. Wenn der selfing-Prozess einmal begonnen hat, was in der Regel um das zweite bis dritte Lebensjahr der Fall ist (nämlich dann, wenn ein Ich-Erleben einsetzt), arbeitet dieser Prozess (das Ich) in der Weise, dass das Kind anhand der Kontexte, in denen es aufwächst, verschiedene Ansichten über sich selbst entwickelt. So entstehen die „Me’s“. Zusammengefasst kann also der Prozess, der die Vielfalt der „Me’s“ organisiert, „Ich“ genannt werden. Mit dieser Annahme geht er wiederum einen Schritt weiter als Turkle, die bei der Feststellung stehen geblieben war, dass durch ein Einheitserleben die Vielfalt der „Me’s“ erst konstruktiv gestaltet wird. Einen Versuch diese vielen „Me’s“ unter einen Nenner zu bringen hat bereits Moreno (1939) in seinem Konzept des kulturellen Atoms unternommen. Dieses geht davon aus, dass der Mensch über eine Art innere Ordnung verfügt, welche ein „Selbst“ in der Mitte als festen Bezugspunkt hat. Darum herum sind die einzelnen „Me’s“ angeordnet, welche einerseits Bezug untereinander, andererseits Bezug zum Selbst haben. Um die Debatte über ein kohärentes Erleben noch zu erweitern, sei Inchaustis (1991) Beitrag eingebracht. Dieser geht davon aus, dass, gleichgültig wie hoch die Anzahl der einzelnen „Me’s“ ist und gleichgültig ob diese einfach miteinander zu vereinen sind oder nicht, es immer einen Prozess gibt, der sich darum bemüht, Einheit zwischen den „Me’s“ herzustellen. Dieser Prozess geschieht immer unter dem Gedanken, dass der Mensch bemüht ist, sich als kohärent wahrzunehmen und zu erleben.
5. Identitätsaufbau und Identitätsentwicklung
Identität hat also zu tun mit einer Vielheit von „Me’s“, die im Laufe des Lebens in verschiedenen Lebenskontexten erworben wurden und zu einem mehr oder weniger kohärenten Konstrukt organisiert sind. Diese Identitätskonstruktion ist es also, die wir vornehmen, wenn wir eine sinnvolle und einheitliche Antwort auf die Frage geben wollen, wer wir sind. Wenn ich also darüber nachdenke was meinen „Me’s“ einen Zusammenhang verleiht, dann denke ich über meine Identität nach. Die Schwierigkeit dabei ist, dass es mir gelingen muss, trotz aller Veränderungen, die mit der Zeit notwendigerweise eintreten, einen roten Faden zu finden. Die in der Vergangenheit erworbenen „Me’s“ müssen also halbwegs sinnvoll zu den später erworbenen in Beziehung gestellt werden können. McAdams spricht davon, dass das Ich den verschiedenen „Me’s“ Einheit und Sinn gibt, in dem es eine Geschichte dazu erfindet, die „Me’s“ zu vereinen. In diesem Sinne spricht er von Identität als einer Theorie, die das Ich über die Vielfalt der „Me’s“ entwickelt (McAdams, 1997, S.63). Anders herum könnte man aber auch anhand der Verbindungen von „Me’s“ untereinander Rückschlüsse ziehen auf die Beschaffenheit des Ich, wenn man den Blick darauf richtet, wie die „Me’s“ miteinander verknüpft sind. Hier kann es etwa sehr kreative Verknüpfungen geben oder welche, die gar nicht so recht zusammenpassen und solche, die sehr geordnet sind. Diese Art der Verknüpfungen gibt nun nicht nur Aufschluss über das Kohärenzerleben einer Person, sondern auch über die Fähigkeit des Ichs „Me’s“ miteinander zu verbinden; man könnte auch sagen, dass sie Auskunft geben über die Ichstärke einer Person. McAdams führt dabei die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben konstruieren, auf diese Verbindungen der „Me’s“ zurück; etwa wenn sie mit einer pessimistischen Grundhaltung durchs Leben gehen, wenn sie sich als Opfer von schicksalhaften Ereignissen sehen oder aber auch wenn sie ihr Leben selber gestalten, Tiefpunkte im Leben als Startpunkte für neue Entwicklungen ansehen etc.. So hängt es also allein von meinem „Ich“ oder „selfing-Prozess“ ab, „ob ich meine Lebensgeschichte als Komödie oder Tragödie, als Romanze oder Heldensage erzähle. Es ist mir überlassen. Ich bin darum auch in der Lage, darüber zu entscheiden, welche Art der Erzählung sich besser eignet, um damit zufrieden zu sein“ (McAdams, 1997, S.46ff). Wichtig hierbei ist, dass es sich nicht um eine Wahrheit handelt (höchstens um eine subjektive und damit eine relative), sondern um eine Perspektive, unter der eine Person ihr Leben betrachtet. Eine zweite Person würde aus demselben Stoff vielleicht eine ganz andere Geschichte schreiben; und nicht nur das – auch die Geschichten, die Menschen über sich selber erzählen, können variieren, je nach Kontext, in dem sie erzählt werden. McAdams versteht die Lebensgeschichten, die Menschen über sich selber erzählen als „psychosoziale Konstruktion“, denn sie seien darauf aus, sich vor anderen in ein möglichst positives Licht zu rücken. Dies bedeute aber nicht, dass sie uneindeutig sind und sich wie ein Fähnchen im Wind drehen. Vielmehr, so argumentiert er, hat es zwar nicht gerade die gleiche materielle (und damit eher gleichbleibende) Realität wie etwa der menschliche Körper, trotzdem aber genügend Stabilität, um sich nicht beliebig von heute auf morgen zu verändern.
Zusammenfassend kann man also McAdams Position so beschreiben, dass er von zwei Komponenten der Identität ausgeht. Das Eine sind die Gedanken, die man sich über seine Sammlung von „Me’s“ macht und sich fragt, wer man eigentlich ist; das Andere sind die Strategien, die man einschlägt, um sich bei der Interaktion mit anderen gut zu präsentieren. Nach McAdams (1997) hat keine der beiden Komponenten mehr Anspruch auf Wirklichkeit oder Authentizität als die andere.
6. Das multiple, dynamische Selbst
Unter den Vertretern eines dynamischen Ansatzes kristallisierten sich v.a. zwei Strömungen heraus. Die eine beruht auf der Definition von James, die andere auf der Computer – Metapher von Greenwald und Pratkanis (Hannover, 1997, S.5). Bei Letzterer vergleichen die Autoren James „Me“ (oder auch „self as known“ = das Selbst) und „I“ (oder auch „self as knower“ = das Ich) mit einem Programm resp. mit den Daten. Das „self as knower“ wird also mit kognitiven Prozessen und das “self as known” mit dem Inhalt dieser Prozesse gleichgesetzt. Selbiges wird von James auch als empirisches Selbst bezeichnet (1892, S. 159). Er differenziert dieses weiter aus in das materielle Selbst (eigener Körper sowie Kleider und engstes Umfeld), das soziale Selbst (reflektiert Reaktionen, die die Person von anderen bekommt) und das spirituelle Selbst (Gesamtheit eigener Bewusstseinszustände sowie Fähigkeiten, Einstellungen und Charakter). Diese verschiedenen Selbste stehen gleichberechtigt nebeneinander. Während James allerdings von je einem materiellen und spirituellen Selbst ausgeht, beschreibt er verschiedene soziale Selbste, die jeweils in Abhängigkeit von Normen auftreten. Diese sollten so nebeneinander stehen können, dass die Person sie nicht konflikthaft erlebt. Das bedeutet nun, dass er nicht ein universales Selbst postuliert, sondern eines mit verschiedenen Ausprägungen, oder eben ein multiples Selbst. – Wie in den meisten vorangehend behandelten Theorien handelt es sich einerseits auch hier wieder um die Unterscheidung zwischen verschiedenen Ausprägungen einer Persönlichkeit und andererseits um deren zusammenführende und für Kohärenz sorgende Instanz. Diese verschiedenen Ausprägungen, Teile oder Facetten einer Persönlichkeit werden hier als multipel bezeichnet und sind gleichbedeutend mit den „Me’s“, die Einheit im Erleben schaffende Kraft entspricht hingegen dem „I“. Die „dynamische“ Komponente soll ausdrücken, dass das Selbst je nach Kontext verschieden in Erscheinung treten kann, also flexibel ist in ihrer Rolle. Sollte der Wechsel zwischen den verschiedenen sozialen Selbsten nicht konfliktfrei verlaufen können, so spricht James von der „multiplen Persönlichkeit“ (ICD-10, 2004).
Ein weiterer Vertreter eines dynamischen Ansatzes ist Goffmann (1967). Zentral in seiner Theorie ist das für die Flexibilität verantwortliche Motiv. Damit meint er v.a. die Absicht das Gesicht oder seinen Ruf zu wahren resp. soziale Interaktionen aufrecht zu erhalten. Letztere beschreibt er als eine Art Bühnenstück, in dem jede Person bemüht ist, als „Darsteller“ ein Verhalten zu zeigen, das einerseits auf das „Publikum“ abgestimmt ist und andererseits doch ehrlich sein Selbst präsentiert. Als mögliche differenziertere Verhaltensform sich seinem Publikum zu präsentieren beschrieb Tedeschi Selbstpräsentationsstrategien (Hannover, 1997). Darunter verstand er eine Taktik, durch bestimmte Verhaltensweisen bei seinem Publikum besonders gut anzukommen. Als kurzfristig zum Erfolg (d.h. zur positiven Einschätzung seiner Selbst) führende Strategien führte er Schmeicheln, Einschüchtern oder auch das Herausstellen der eigenen Kompetenz auf, und als langfristig erfolgreiche Massnahmen nannte er beispielsweise Statussymbole zur Schau stellen oder intime Informationen über sich selber preisgeben. In diesem Zusammenhang hat Snyder (Hannover, 1997) gezeigt, dass Menschen unterschiedlich erfolgreich Selbstpräsentation betreiben. Diejenigen, die dies erfolgreich taten, nannte er Personen mit starkem „self-monitoring“ (=hohe Kontrolle der verbalen und nonverbalen Selbstpräsentationen), diejenigen, die sich damit schwer taten, Personen mit schwachem „self-monitoring“. Erstere scorten bei Fragen (eines von Snyder entwickelten Fragebogens) hoch, die darauf abzielten, schnell die eigene Position zu verändern und viel zu schauspielern, Letztere erreichten bei Fragen hohe Werte, die das Verharren auf einer Position, sowie das Ausmass der Authentizität erhoben (Snyder und Gangestad, 1986, S.137). - Es wird leicht erkenntlich, dass für diese Form der Alltagsbewältigung ein schnelles und auf die individuelle Situation abgestimmtes Verhalten erforderlich ist. Dieses schnelle sich einstellen von der einen auf die andere Situation, oder anders gesagt, das flexible Wechseln zwischen den multiplen Selbstkonstrukten, ist mit dynamisch gemeint. Ein solches Identitätskonzept ist also auch eher prozessorientiert und geht weniger von einem fixen Identitätskern aus.
7. Kognitive Voraussetzungen des multiplen Selbst
Im „social cognition paradigma“, dem im folgenden etwas Platz geschenkt werden soll, wird davon ausgegangen, dass über die Stimulus-Response-Ebene keine befriedigenden psychologischen Erkenntnisse gewonnen werden können bezüglich des Selbstes. Somit konzentrierte man sich mehr auf die Untersuchung kognitiver Prozesse (Schneider, 1991). Definitorisch ist noch vorweg zu schicken, dass das Selbst im Rahmen dieses Paradigmas als eine Gedächtnisrepräsentation angesehen wird, nämlich als sogenanntes Selbstkonzept. Dieses Selbstkonzept ist strukturell vielschichtig und flexibel. Dies ist deshalb der Fall, da das Selbst sich Informationen situationsabhängig zusammensucht und zu Clustern bildet. Flexibel ist es darum, da es zu einem Zeitpunkt nur auf einen Teil der Menge der Informationscluster zurückgreifen kann. Aus diesem Grund, dass immer nur ein bestimmtes Informationscluster aktiviert ist/sein kann, können Menschen auch unterschiedliche Informationen über die eigene Person in ihrem Selbstkonzept repräsentiert haben, ohne dass sie dies als einen Widerspruch empfinden.
Manche Forscher haben das Selbst oder Selbstkonzept als eine Art Schema aufgefasst (Keenan und Baillet, 1980). Darunter verstanden sie eine Wissensstruktur, die auf einen bestimmten Kontext bezogene Bewertungen beschreibt. Diese Schemata können Subschemata enthalten und stehen in so einem Fall in einem hierarchischem Verhältnis zu einander. Ein Schema beinhaltet jeweils Informationen mit einem hohen Allgemeinheitsgrad, d.h. dass spezifische Informationen erst einmal abstrahiert werden um in ein Schema einzufliessen. Eine wesentliche Frage ist nun, wie die einzelnen Informationen aktiviert werden können. Hier kann einerseits die Vorstellung eines assoziativen Netzwerkes helfen, bei dem alle Informationen die „gleichberechtigte“ Chance haben aktiviert zu werden, wenn man davon ausgeht, dass Informationen in Clustern um verschiedene Kontexte herum organisiert sind. Auf der anderen Seite muss man davon ausgehen, wie beim eben erwähnten Schema als Selbstkonzept, dass Informationen auch in hierarchischer Weise organisiert sein können. So können Verbindungen von Selbstschemata in horizontaler Ebene und Verbindungen bei der Modellvorstellung des Selbst als einer hierarchischen Kategorie in einer vertikalen Ebene bestehen.
7.1 Untersuchungen zum Selbstkonzept
Bezüglich Untersuchungen von Selbstkonzepten hat v.a. Markus viele Anstrengungen unternommen und gezeigt, dass sich Personen im Inhalt und in der Struktur ihrer Selbstkonzepte unterscheiden (Markus, 1977, S.65). Sie ging davon aus, dass Personen bestimmte Themen/Inhalte (z.B. bezüglich eines bestimmten Traits) für die Definition ihres Selbst für besonders wichtig halten. Unter dieser Annahme befragte sie Studenten, zunächst mit dem Ziel, diese in verschiedene Gruppen einteilen zu können wie z.B. in individualistische und konformistische Persönlichkeiten. Anschliessend legte sie einschlägige, auf diese zwei Dimensionen abgestimmte Adjektive auf, die es in Relation zu sich selber zu setzten galt. Dabei stellte sie folgendes fest: die Versuchspersonen, die sie den beiden Kategorien zugeordnet hatte, bejahten häufiger und schneller Begriffe, die mit ihrem „Schema“ konsistent waren (Markus, 1977, S.72). Ausserdem waren ihre Urteile sicherer, auf der jeweiligen Dimension stabiler, sowie durch schemainkonsistente Rückmeldungen weniger beeinflussbar.
Weitere Untersuchungen, diesmal zur Zugänglichkeit von Konstrukten, zeigten, dass die Häufigkeit des Abrufs einerseits und die zeitliche Nähe zur letzten Aktivierung andererseits ausschlaggebend dafür sind, mit welcher Wahrscheinlichkeit Adjektive einer Kategorie verfügbar sind. Diese Zusammenhänge wurden mehrfach empirisch belegt, u.a. von Higgins (1989). Bezüglich dieser Verfügbarkeit von Selbstkonstrukten gibt es nun interindividuelle Unterschiede. Zum einen kann hier gesagt werden, dass die Anzahl Konstrukte, über die eine Person verfügt, mit dem Lebensalter zunimmt. Hier könnte man etwa das Selbstkonstrukt erwachsen, berufstätig, oder arbeitslos anführen. Auf der anderen Seite unterscheiden sich die verfügbaren Konstrukte in solche, die für Jedermann zugänglich sein sollten wie physikalische oder visuelle Zuschreibungen und in solche, die nur bestimmten Gruppen zugänglich sind wie etwa Vater zu sein oder Autor o.ä.. Diese permanenten Reize, die ständig das Selbstkonstrukt aktivieren, werden von Markus (1991 ) chronische Aktivierungsquellen genannt. Darunter fällt auch der kulturelle Kontext, indem eine Person aufwächst. Hierbei fällt als interessanter Punkt ins Auge, dass in östlichen Kulturen das Selbst definiert wird durch die Verbundenheit mit anderen Menschen, während in westlichen Kulturen Autonomie und Unabhängigkeit von anderen betont wird. Daraus lässt sich ableiten, dass östliche Kulturen eine chronische Aktivierungsquelle für kollektivistische Selbstkonstrukte darstellen und westliche Kulturen eine für individualistische Selbstkonzepte. Bestimmte Selbstkonstrukte, wie z.B. Linkshänder zu sein sind wahrscheinlicher verfügbar als das Selbstkonstrukt Rechtshänder zu sein (McGuire und McGuire, 1980). Dies ist deshalb der Fall, da Linkshänder eher der Aktivierungsquelle ausgesetzt sind, vom Lehrer getadelt zu werden, weil sie nicht mit der rechten Hand schreiben, während Rechtshänder keinen vergleichbaren Aktivierungsquellen ausgesetzt sind. Insgesamt kann man also sagen, dass dieser permanente oder chronische Zugang zu den Selbstkonstrukten sich inter- und intraindividuell unterscheidet; und zwar einfach deshalb, weil Menschen verschiedenen Aktivierungsquellen ausgesetzt sind.
Im Weiteren kann es dazu kommen, dass die chronische und die situationale Zugänglichkeit von Selbstkonstrukten miteinander interagieren. Zu dieser Thematik untersuchten McKenzie-Mohr und Zanna (1990) männliche Probanden, indem sie ihnen zunächst einen pornographischen Film vorführten. Es zeigte sich, dass im darauf folgenden Verhalten diejenigen Männer sich „sexistischer“ Frauen gegenüber verhielten, die bezüglich ihres Geschlechtsrollenschemas eine chronische Zugänglichkeit hatten (d.h. deren Schema meistens sowieso aktiviert war). Die Ergebnisse wurden von den Autoren dahingehend interpretiert, dass die situationale Aktivierung, nämlich der Film, nur dann zu einer Aktivierung des Geschlechtsrollenschemas führt, wenn dieses eh chronisch gut zugänglich war.
7.2 Ursachen für die Aktivierung von Selbstkonstrukten
Im Folgenden sollen vier mögliche Quellen angesprochen werden, die für eine (temporäre) Aktivierung von Selbstkonstrukten ausschlaggebend sein können. Diese Aktivierung fällt laut Bargh et al. (1986) um so wahrscheinlicher aus, je chronischer zugänglich das jeweilige Selbstkonstrukt ist.
1.) Salienz oder Distinktheit ist zunächst zu nennen als ein Punkt, bei dem sich Personen spontan beschreiben mit Eigenschaften, mit denen sie sich bezüglich eines bestimmten Kontextes oder einer Gruppe unterscheiden. Als Beispiel sei hier eingefügt, dass etwa eine Frau in einer Gruppe von Männern sich als Frau kategorisiert oder ein weisser Mann in einer Gruppe von schwarzen Männern eben als Weisser.
2.) Betonung von Interkategorienunterschieden und Intrakategorienähnlichkeiten. Hier beschreibt Turner (1987) drei verschiedene Abstraktionsniveaus, die seiner Meinung nach hierarchisch organisiert seien. Auf dem obersten Niveau werden menschliche und nicht-menschliche Lebewesen unterschieden, auf der zweiten Ebene werden Kategorisierungen vorgenommen, so dass das Selbst einer sozialen Kategorie angehört (Beruf, Geschlecht) und auf der untersten Ebene unterscheidet er das Selbst als einmaliges Individuum in Bezug auf andere Personen, mit denen das Individuum in Verbindung steht.
3.) Stimmungen und Verhaltensweisen tragen laut Stepper und Strack (1993) dazu bei, dass Selbstkonstrukte aktiviert werden können. Für diese Annahme spricht, dass nachgewiesen werden konnte wie Personen in positiver Stimmung eher positives Material (inkl. persönlicher Erlebnisse) wiedererinnern konnten als negatives.
4.) Selbstbezogene Ziele aktivieren meist automatisch Selbstkonstrukte, sobald die Person im aktuellen Kontext drinsteht. Das will heissen, dass eine Person, die sich etwa gerade auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet, versucht sein wird, ihr Selbstkonstrukt für Erfolg zu aktivieren und nicht etwa eines für Gleichgültigkeit oder gar Misserfolg.
Vorangehend wurden die automatisch aktivierten Selbstkonstrukte beschrieben. Nun soll ein Blick auf die Konsequenzen dieser Konstruktaktivierungen geworfen werden. Vorab sei erwähnt, dass nachgewiesen wurde, dass es für die Informationsverarbeitung einen Unterschied macht, ob eine Information permanent (chronisch) zugänglich ist bzw. zur Verfügung steht, oder nur zu bestimmten Zeitpunkten (temporär). Zumindest scheint dies für nicht selbstbezogene Konstrukte der Fall zu sein (Bargh et al. 1986).
Bei Selbstbeschreibungen, die als direkter Weg zur Messung eines Selbstkonstruktes angesehen werden, zeigt sich, dass Personen, welche verschiedene Adjektive bearbeiten sollten, bei schemakonsistenten Begriffen eher d.h. schneller und häufiger zustimmten als bei welchen, die nicht in ihr aktiviertes Schema passten. Ausserdem stellte sich heraus, dass sich Personen, wenn sie sich selbst frei beschreiben konnten, überzufällig häufig Eigenschaften nannten, gegenüber derer sie sich unterscheiden. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass sie sich mit Eigenschaften entweder bezüglich des aktuellen Kontextes abgrenzen oder aber in Bezug auf ihre personale oder soziale Identität. Wurde Personen Material mit uneindeutigen Stimuli vorgelegt, so interpretierten sie dieses v.a. dahingehend, dass es mit dem gerade aktivierten Selbstkonzept konform war. Ähnliches brachte der Fokus auf das Verhalten zum Vorschein. Hier zeigten sich die Personen konsistent mit Informationen über ihr eigenes Verhalten, wenn diese vorher ins Gedächtnis gerufen wurden. Bei der Untersuchung welche Auswirkungen (aktivierte) Selbstkonstrukte auf Gedächtnisleistungen haben, stellte sich heraus, dass auch hier Personen dort bessere Gedächtnisleistungen erzielten, wo sie sich schemakonsistenten Informationen gegenüber sahen. Bezüglich der Auswirkung von Selbstkonstrukten auf das Selbstwertgefühl stellte sich heraus, dass auch hier die Stimmung bzw. die Einschätzung stark vom vorher aktivierten Schema abhängig ist; vielleicht auch deshalb, weil es i.d.R. inhaltlich relevante, persönliche Ziele beinhaltet. Zusammenfassend lässt sich also unschwer erkennen, dass von selber ablaufende, automatische Selbstkonstruktaktivierungen bedeutende Auswirkungen haben auf die jeweils folgende Informationsverarbeitung.
8. Identität in soziologischen und sozialpsychologischen Kontexten
1985 äußerte sich Richard von Weizsäcker anlässlich des Kirchentags folgendermaßen zur Identität: „Identität ist zunächst eine Frage danach wie man sich selbst versteht, es ist eine ganz persönliche Angelegenheit“. Wenig später erwähnte er jedoch dann auch die Kontextabhängigkeit unserer Identität, nämlich dass wir uns bewusst machen müssen, dass unsere Umgebung „mehr mit unserer Identität zu tun hat, als so mancher schöne Sonnenstrand am Mittelmeer“ (zit. nach Baier, 1985). Hier ist also schon vorsichtig die Frage nach der „deutschen Identität“ bzw. nach einer nationalen Identität angesprochen. Und diesen Gedanken kann man weiter spinnen, indem man fragt, zu wem oder was zugehörig ich mich durch mein Umfeld fühle, durch meine Familie, meine Kultur, meine Bildung etc.. Und diesen Fokus nimmt auch Franz-Josef Strauss ins Auge, indem er im Wahlkampf-Winter 1986/87 verkündet: „ohne eine nationale Identität, in der die Deutschen ihr Verhältnis zu sich selber, zu ihrer Vergangenheit, aber auch zu ihrer Zukunft finden, kann das deutsche Volk seine Aufgabe auf dieser Welt nicht erfüllen“ (zit. nach Frankfurter Rundschau vom 14.01.1987). Für Historiker Michael Stürmer ist es notwendig, dass für eine nationale Identität, speziell für die deutsche, „Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein“ entwickelt werden (1983, S.63). Weiter sagt er, dass man zu einem solchen Geschichtsverständnis kommen müsse, dass der Mensch in der heutigen Dienstleistungskultur mehr als je zuvor seine historische Identität suchen und begreifen muss, um sich selbst nicht zu verlieren (1986, S.16). Dadurch, so befürchtet er, können jedoch „Orientierungskrisen“ resultieren. Für Adorno wiederum ist die hektische Suche des modernen Menschen nach seinem Selbst, nach seinem „wahren Selbst“ ein Zeichen für den Verlust von souveräner Autonomie (1966, S.275).
In der sozialepidemiologischen Forschung taucht immer häufiger das Konzept von den „multiplen Identitäten“ auf. Nun liegt es fast auf der Hand, diesen mit dem Begriff der „multiplen Persönlichkeiten“, wie er in der Psychopathologie verwendet wird, zu vergleichen. Dort meint er das „Vorhandensein getrennter und unterschiedlicher Persönlichkeiten innerhalb desselben Individuums“ (Davison und Neale, 1979, S.156) und gilt als schwere Persönlichkeitsstörung. In Anbetracht dieser „multiplen Realitäten“ (Schütz 1962) ist ein ständiges Umschalten auf Situationen notwendig, in denen ganz unterschiedliche, sich sogar gegenseitig ausschließende Personanteile gefordert werden können. Aus alledem, so Peter Berger (1971, S.119) kann der Eindruck entstehen, dass gar kein wesentlicher Unterschied besteht zwischen Menschen, die an einer psychiatrisch relevanten „multiplen Persönlichkeit“ leiden, und allen anderen. Seit den 70er Jahren häufen sich nun Arbeiten, in denen die Zunahme von Rollenkomplexität eher als gesundheitsförderliche Situation betrachtet wird. Vor allem Peggy Thoits hat sich in mehreren Studien (1987) mit dem Zusammenhang von multiplen Identitäten und psychischer Gesundheit befasst. Sie formuliert eine so genannte „Identitätsakkumulationshypothese“, derzufolge multiple Rollenengagements die Ressourcen einer Person erhöhen.
Wenn wir den Fokus auf die sozialen Netzwerke richten, dann treffen wir zuerst auf den Namen Walker (1977). Dieser vertritt die These, dass der Aufbau und das Beibehalten einer sozialen Identität die zentrale Funktion der sozialen Netzwerke ist. Damit sind sie auch Ressource für die Identitätsbildung. Netzwerke, die durch geringe Größe, starke Bindungen und hohe Homogenität gekennzeichnet sind, erleichtern eher die Bildung und Aufrechterhaltung eines Identitätsmusters, das relativ einfach strukturiert ist und sich wenig verändert. Auf der anderen Seite erhalten Netzwerke, die groß sind, mehr schwache Bindungen beinhalten sowie geringe Homogenität aufweisen, eher eine Identität aufrecht, die offen für Veränderungen ist und eine komplexe Struktur hat; also eher der oben angesprochenen multiplen Identität entspricht. Diese beiden Konstellationen und die ihnen zugeordneten Identitätsmuster weisen auf den gesellschaftlichen Modernisierungsprozess hin. Die Lebensformen, in denen sich eine einfach strukturierte und im biographischen Ablauf relativ stabil bleibende Identität bilden und aufrechterhalten ließ, verschwinden mehr und mehr und weichen solchen, die eine höhere Komplexität aufweisen (Keupp, 1999, S.55).
Weiter zeigt sich Interessantes beim Vergleich von Städtern und Nicht-Städtern; nämlich, dass städtische Lebensformen nicht von sich aus die Isolation fördern, wie oft angenommen wird. Im Gegenteil, die Bewohner großer Städte haben im Durchschnitt vielfältigere Kontakte zu Freunden, Arbeitskollegen oder anderen Angehörigen, etwa von Vereinen etc.. Dabei haben Nachbarschaften an „Beziehungswert“ verloren. Sie geben nicht mehr in dem Masse persönliche Nähe wie noch vor wenigen Jahrzehnten. Gegenüber traditionellen Beziehungsmustern, in die man einfach hineingeboren wurde und damit zu einem gewissen Teil schon mal integriert war, die aber auch persönliche Veränderungswünsche einschränkten, können die Verbindungsnetze in den städtischen Gegenden in stärkerem Masse eine Wahlfreiheit und Eigenentscheidung bieten. Ja man stellt die Sozialbeziehungen und Kontaktnetze selber her und erhält sie (Beck, 1983, S.50). Dadurch ist eine höhere Selbstbestimmung im Rahmen sozialer Netzwerke gewährleistet. Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass sich der Radius, in welchem man sich mit entsprechenden Verkehrsmitteln (und Kommunikationsvorrichtungen) flexibel bewegen kann, im Laufe der Zeit kontinuierlich zugenommen hat.
Nachgewiesenermaßen hat auch der Bildungsstand einer Person einen Einfluss auf die Gestaltung der sozialen Netzwerke (Keupp, 1999, S.57). Dieser drückt sich in einem größeren sozialen Netzwerk aus im Vergleich zu Menschen eines tieferen Bildungsstandes. Außer dem größeren sozialen Begleitschutz haben sie auch vertrautere Beziehungen, welche eine größere geographische Reichweite umfassen als bei weniger gebildeten. Weiter steigt mit dem Einkommen (nicht zwangsläufig an Bildung gekoppelt) auch die Zahl der vertrauten Personen, die nicht aus der Verwandtschaft stammen und auch die Qualität und Sicherheit der von diesen Personen erwartbaren praktischen Unterstützung (Keupp, 1999, S.58). Den Armen fehlen also nicht nur Freunde, sie haben außerdem weniger Verwandtschaftskontakte als Angehörige der höheren Schichten. Mit dem Alter werden auch die sozialen Netzwerke kleiner, die soziale Unterstützung weniger verlässlich und die sozialen Beziehungen räumlich stärker beschränkt. Allgemein kann man sagen, dass hier der sogenannte „Matthäus – Effekt“ (nach dem Matthäus-Evangelium) nachgewiesen werden kann: „wer (Geld, Status, Prestige etc.) hat, dem wird (soziale Unterstützung) gegeben!“ (Marbach et al., 1987, S.12). In Bezug auf die Geschlechter kann festgestellt werden, dass alte Männer in ihren sozialen Beziehungen am meisten eingeschränkt sind. Allerdings zeigt sich eine ähnliche Situation bei Müttern mit kleinen Kindern. Diese haben ebenfalls weniger Freunde und damit weniger verlässliche Unterstützung und einen Kontaktkreis, der sich mehr auf lokale Netzwerke ausrichtet. Insgesamt haben Frauen mehr Verwandtschaftskontakte und vertrauensvollere Beziehungen als Männer.
Der von Vertretern des klassischen Identitätsbegriffs oft erwähnte Vergleich der Identität mit einer Patchworkmetapher (das Ganze als Zusammengesetztes aus mehreren Einzelteilen) wird auch von Antonovsky (1987) aufgegriffen. Er versucht zu verdeutlichen, dass ein „Gefühl der Kohärenz“ (sense of coherence), also eines Gefühls, welches die verschiedenen Anteile in einem zusammenhält, die entscheidende Bedingung für psychische und körperliche Gesundheit sei. Um dieses Kohärenzgefühl herzustellen und aufrechtzuerhalten muss allerdings „Identitätsarbeit“ geleistet werden. Antonovsky versteht darunter einen permanent ablaufenden, kreativen Prozess, der dafür sorgt, dass erstens die Welt einem strukturiert und dadurch vorhersagbar erscheint, zweitens man das Gefühl hat mit den Herausforderungen, die die Welt an einen heranträgt fertig zu werden und drittens, dass die Dinge in der Welt mein Engagement verdienen, oder in anderen Worten, dass ich eine Sinnhaftigkeit in dem sehe, was ich tue.
9. Tabellarischer Überblick über erwähnte Autoren und ihre Theorien
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
10. Diskussion
Nun sind die verschiedensten Ansätze in aller Kürze beschrieben worden und schnell wird augenfällig, dass es sich vor allem und eine Frage handelt; nämlich, um es ganz salopp zu formulieren, ob wir Einer sind oder Mehrere. Die Antwort auf diese Frage zeigt eine deutliche Tendenz in eine Richtung, nämlich: wir sind beides. Doch der Reihe nach. Die Ausgangsfragestellung war diejenige, den Blick einmal schweifen zu lassen in die Landschaft der Identitätstheorien und dabei darauf zu achten, ob sich darunter welche befinden, die von der menschlichen Identität als einem „fixen Kern“ ausgehen. Diese Frage kann bejaht werden, allerdings bedarf es einer genaueren Hinsicht. Beim Autor der zuerst angeführten Theorie, Bodack, ist zunächst einmal auffällig, dass er ein „Ich“ formuliert, welches er als Ausgangspunkt ansieht für alle bewussten Handlungen des Menschen. Dieses „Ich“, welches als eine Art fester Kern der Persönlichkeit eine zeitüberdauernde Struktur aufweist, wird in allen weiteren aufgeführten Theorien nicht mehr in dieser Deutlichkeit formuliert. Im Gegenteil, während die klassische und postmoderne Position noch so etwas wie ein „I“ anerkennen, welches zumindest die „Me’s“ organisiert oder zueinander in Beziehung setzt, so setzten die Vertreter der dynamischen Theorien eher auf die Karte der ständigen Veränderbarkeit, des Prozesses. Aber zurück zu Bodack. Der zweite wesentliche Punkt, bei dem er sich gegenüber der Vertreter aller anderen Richtungen unterscheidet ist, dass er Dimensionen formuliert, auf welchen sich alle Menschen, unabhängig ihres Alters, bewegen. Dabei zeichnet sich eine hohe Entwicklung dadurch aus, dass ein Gleichgewicht zwischen den Ausprägungen herzustellen und zu wahren ist. Im Unterschied dazu steht die Annahme von Erickson, der der Meinung ist, dass die Akkumulation von Lebenserfahrung mit persönlicher Reife einhergeht. So muss eine Person z.B. bestimmte Erfahrungen gemacht (und bestimmte „Me’s“ entwickelt) haben, um zur nächsten „Reifestufe“ zu gelangen. Auf der anderen Seite formuliert er unabhängig von der äußeren Entwicklung eine Art des sich Gleichbleibens und konstruiert somit ein Bild einer Identität, welches sowohl einen stabilen Kern, als auch um sich herum eine gewisse Anzahl und Art von „Me’s“ ausgebildet hat.
Einen entscheidenden Schritt weiter als Bodack und Erickson geht nun Krappmann. Im Vergleich zu diesen beiden verzichtet er auf die Annahme einer festen, unveränderlichen Komponente und läutet damit eine Art neue Ära ein. Man könnte auch sagen, die Vermutung, dass es hinter dem für das sinnliche Auge wahrnehmbare Verhalten noch irgend etwas geben muss, was das Verhalten koordiniert, wird weitgehend fallengelassen und er konzentriert sich fortan auf das empirisch Zugängliche. Im Wesentlichen, so könnte man es sehen, haben die Vertreter der postmodernen Position diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt bzw. umformuliert. Allen voran lässt sich hier Gergen anführen, der v.a. Wert darauf gelegt hat zu erklären, wie sich die „Me’s“ gebildet haben. Diese mussten jetzt nicht mehr zwingend eine Einheit bilden sondern konnten auch, lose miteinander verbunden, nebeneinander stehen. So steht denn auch der von ihm geprägte Begriff des „sozialen Chamäleons“ stellvertretend für diese Entwicklung. Im Zuge der postmodernen Theorieansätze sprach sich nun McAdams wiederum für eine die verschiedenen „Me’s“ zusammenhaltende Komponente aus. Es entsprach wohl nicht seinem Erleben, dass diese „Me’s“ keinen oder nur kaum Zusammenhang miteinander haben sollen und machte er sich auf die Suche nach einem roten Faden in den Lebensläufen. Eines mied er jedoch, nämlich zurückzukehren zu der klassischen Vorstellung, die da zumindest teilweise so eine Art festes und überdauerndes „Etwas“ annahm. Vielmehr betonte er, dass es einen Prozess geben müsse, der die ganzen „Me’s“ permanent zusammenhalte (selfing). Und mit diesem Prozessmodell ist genau die Überleitung geschaffen zu den dynamischen Theorien, die an diesem Strang weiterzogen.
Man könnte sagen, noch ein Stück weiter entfernt von der Annahme, dass unsere Identität nur auf einer einzigen Grundlage aufgebaut ist, ist nun diejenige eines multiplen und dynamischen Selbstes. Hier gibt es jetzt quasi keine „Altlasten“ mehr, keinen Grund warum wir, überspitzt gesagt, heute noch so sein sollten wie gestern. Mit jeder Interaktion kann ein neues Selbstkonstrukt entstehen. Nun liegt der Fokus aber nicht mehr auf dem Entstehungsprozess, der Art oder Beschaffenheit des Konstruktes, sondern auf dem Prozess, der für das ständige, adäquate Hin- und Herwechseln zwischen ihnen verantwortlich ist.
Die Frage, ob nun Identität eine persönliche oder gesellschaftliche Angelegenheit ist, kann nur unter Berücksichtigung des zeitlichen Kontextes und der Denktradition, aus welcher heraus ihre Antwort geboren wurde, beantwortet werden. Soviel wird aber deutlich: je später eine Theorie entwickelt wurde, desto mehr legt sie ihr Augenmerk auf den Prozess und damit weniger auf einen im Hintergrund wirkenden festen Kern.
11. Literatur
Adorno, T. (1966) Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Antonovsky, A. (1987), Unraveling the mystery of health. San Francisco: Jossey Bass.
Baier, L. (1985), Gleichheitszeichen. Streitschriften über Abweichung und Identität. Berlin: Wagenbach.
Bargh et al. (1986). Individual construct accessibility and perceptual selection. Journal of Experimental Social Psychology, 22.
Barkhaus, A. (1999). Theorie der Identität: Begriff und klassische theoretische Ansätze. Dohrenbusch und Blickenstorfer.
Baumeister, R. (1987), Identity. Cultural change and the struggle for self. Oxford: Oxford University Press.
Berger, P. (1971). Einladung zur Soziologie. München: List.
Beck, U. (1983). Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung sozialer Formationen und Idetitäten. Göttingen: Schwartz.
Bodack, K. (2002), Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft auf der Basis zunehmender Individualisierung; Aufsatz, ohne Verlag.
Danzinger, K. (1997). The historical formation of selves. Self and Identity. New York: Oxford University Press.
Das moderne Lexikon, (1973), Bd. 8, S. 322, Bertelsmann Lexikon-Verlag, Gütersloh.
Davison und Neale, (1979), Klinische Psychologie. Ein Lehrbuch. München: Urban und Schwarzenberg.
Erikson, E. (1993) Identity: Youth and crisis. Norton: New York.
Frankfurter Rundschau vom 14.01.1987.
Gergen, K. (1996). Das übersättigte Selbst: Identitätsprobleme im heutigen Leben. Auer: Heidelberg.
Goffmann, E. (1967), Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Frankfurt/M: Suhrkamp.
Hannover, B., (1997), Das dynamische Selbst. Bern: Verlag Hans Huber.
Higgins, E. (1989), Continuities and discontinuities in self-regulatory and self-evaluative process: A developmental theory relating self and affect. Journal of Personality, 57.
ICD-10, (2004), Internationale Klassifikation psychischer Störungen. Bern: Verlag Hans Huber.
Inchaustis, R. (1991), The ignorant perfection of ordinary people. Albany: State University of New York Press.
James, W., (1892) Principles of Psychology. New York: Macmillan.
Keenan, J. und Baillet, S. (1980), Memory for personally and socially significant events. In the R.S. Nickerson (Ed.), Attention and performance. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Keupp, H., Ahbe T., Gmür W., Höfer R., Mitzscherlich B., Kraus W. & Straus F. (1999). Identitätskonstruktion. Rowohlt.
Keupp, H. & Bilden H. (1989). Verunsicherungen: Das Subjekt im gesellschaftlichen Wandel. Göttingen: Hogrefe.
Krappmann, L. (1978). Soziologische Dimensionen der Identität. Stuttgart: Klett-Cotta.
Marbach, J. (1987). Familien in den 80er Jahren. Erste Ergebnisse einer Repräsentativbefragung. Dij Bulletin Heft 3.
Markus, H. (1977). Self-schemata and processing information about the self. Journal of Personality and Social Psychology, 35.
Markus, H. (1991). Culture and the Self: Implications for cognition, emotion and motivation. Psychological review, 98.
McAdams, D. (1997). The case for unity in the (post)modern self: A modest proposal. Self and identity. Oxford: Oxford University Press.
McGuire, W. und McGuire, C. (1980). Salience of handedness in the spontaneous self-concept. Perceptual and Motor Skills, 50.
McKenzie-Mohr, D und Zanna, M. (1990). Treating women as sexual objects: Look to the male who has viewed pornography. Personality and Social Psychology Bulletin, 16.
Mead, G. (1983). Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Suhrkamp: Frankfurt a. M.
Mead, G. (1987). Die Genesis der Identität und die soziale Kontrolle. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Moreno, J. (1939). Psychodramatische Behandlung von Psychosen. Sociometrie, 3, 115-132.
Petzold, H. & Mathias, U. (1982). Rollenentwicklung und Identität. Von den Anfängen der Rollentheorie zum sozialpsychiatrischen Rollenkonzept Morenos. Junfermann: Paderborn.
Schneider, D.(1991). Social cognition. In M.R. Rosenzweig und L.W. Porter (Eds.), Annual review of psychology, 42. Palo Alto, CA: Annual Reviews.
Schütz, A. (1962). On multiple Realities. The Hague: Nijhoff.
Snyder, M. und Gangestad, S. (1986). On the nature of self-monitoring: Matters of assesment, matters of validity. Journal of Personality and Social Psychology, 51.
Stepper, S. und Strack, F. (1993). Proprioceptive determinants of emotional and nonemotional feelings. Journal of Personality and Social Psychologie, 64.
Storch, M. (1999). Identität in der Postmoderne – mögliche Fragen und mögliche Antworten. Dohrenbusch und Blickenstorfer.
Stürmer, M. (1986). Dissonanzen des Fortschritts. München.
Thoits, P. (1987). Negotiating roles. New Haven: Yale University Press.
Turkle, S. (1998). Leben im Netz. Identität in Zeiten des Internet. Reinbek: Rowohlt.
Turner, J. (1987). Rediscovering the social group. A self-categorization theory. Oxford: Basil Blackwell.
Walker, K. (1977). Social support networks and the crisis of bereavement. Social Science and Medicine 11.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus des Textes?
Der Text analysiert das Konzept der Identität aus verschiedenen Perspektiven, darunter klassische, postmoderne und dynamische Ansätze. Er untersucht, ob Identität ein fester Kern ist, aus mehreren Teilidentitäten besteht oder ein fortlaufender Prozess ist.
Welche klassischen Positionen der Identität werden im Text diskutiert?
Der Text beleuchtet die Theorien von George Herbert Mead und Erik H. Erikson. Mead sieht Identität als Ergebnis sozialer Interaktionen und Rollenerwartungen, während Erikson Identität als einen stetigen Zuwachs an Persönlichkeitsreife im Laufe des Lebens betrachtet.
Wie wird Identität in der Postmoderne konzipiert?
Die postmoderne Sichtweise, insbesondere durch Kenneth Gergen vertreten, postuliert die Vielfalt von "Me's" und die Übernahme verschiedener Rollen je nach sozialem Kontext. Es wird betont, dass es keine individuelle Grundlage gibt, der man treu bleibt, und Identität sich fortwährend neu formt.
Was sind die dynamischen Ansätze zur Identität?
Dynamische Ansätze betonen die Flexibilität und Kontextabhängigkeit von Identität. Sie basieren oft auf der Definition von William James oder der Computer-Metapher von Greenwald und Pratkanis. Goffmanns Theorie der Selbstdarstellung ist auch relevant.
Welche kognitiven Voraussetzungen des multiplen Selbst werden diskutiert?
Der Text erörtert, wie das Selbst im Rahmen des "social cognition paradigma" als eine Gedächtnisrepräsentation (Selbstkonzept) angesehen wird, die strukturell vielschichtig und flexibel ist. Es werden Untersuchungen zum Selbstkonzept und Ursachen für die Aktivierung von Selbstkonstrukten beleuchtet.
Wie wird Identität in soziologischen und sozialpsychologischen Kontexten betrachtet?
Der Text untersucht, wie soziale Netzwerke, Bildungsstand und andere soziale Faktoren die Identitätsbildung beeinflussen. Die "Identitätsakkumulationshypothese" und das Konzept des "Gefühls der Kohärenz" werden ebenfalls diskutiert.
Was ist die "Identitätsakkumulationshypothese"?
Die "Identitätsakkumulationshypothese", formuliert von Peggy Thoits, besagt, dass multiple Rollenengagements die Ressourcen einer Person erhöhen und somit gesundheitsförderlich sein können.
Was ist das "Gefühl der Kohärenz" (sense of coherence)?
Das "Gefühl der Kohärenz", ein Konzept von Aaron Antonovsky, bezeichnet ein Gefühl, welches die verschiedenen Anteile in einem zusammenhält und eine entscheidende Bedingung für psychische und körperliche Gesundheit darstellt.
Wer sind einige der im Text erwähnten Hauptautoren?
Zu den erwähnten Hauptautoren gehören William James, George Herbert Mead, Erik H. Erikson, Kenneth Gergen, Krappmann, Sherry Turkle, Dan P. McAdams, Bodack und Aaron Antonovsky.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Diskussion gezogen?
Die Diskussion kommt zu dem Schluss, dass es eine Tendenz in Richtung der Erkenntnis gibt, dass Identität sowohl einen stabilen Kern als auch multiple, kontextabhängige Aspekte hat. Je später eine Theorie entwickelt wurde, desto mehr legt sie ihr Augenmerk auf den Prozess und damit weniger auf einen im Hintergrund wirkenden festen Kern.
- Citar trabajo
- Georg Saltzwedel (Autor), 2005, Identität. Das Selbst im Zeitalter der Individualisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109121