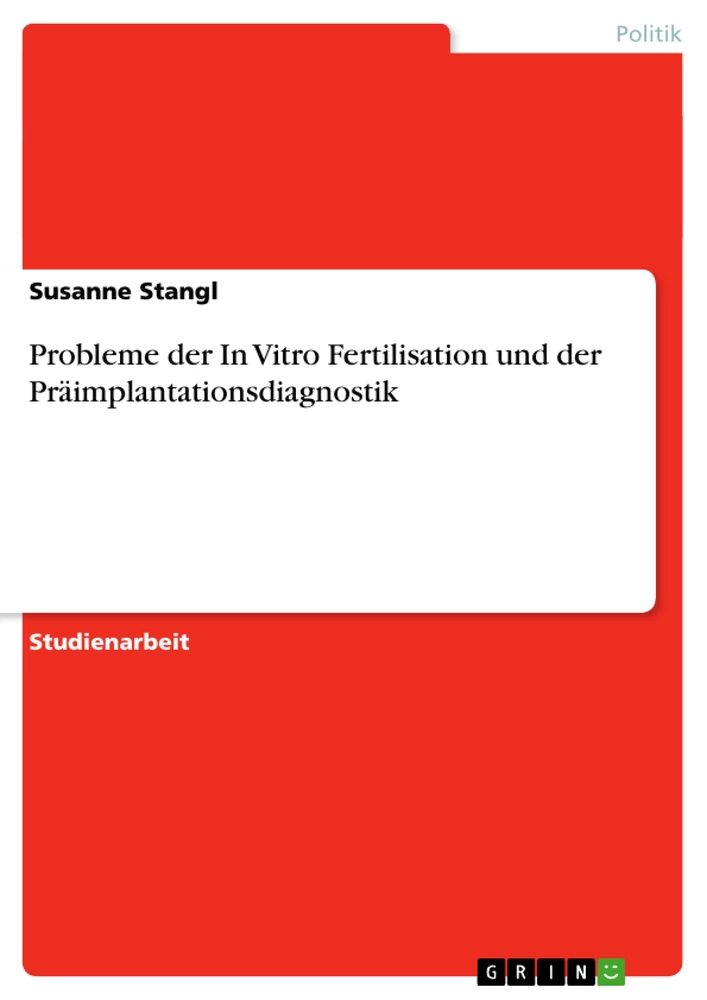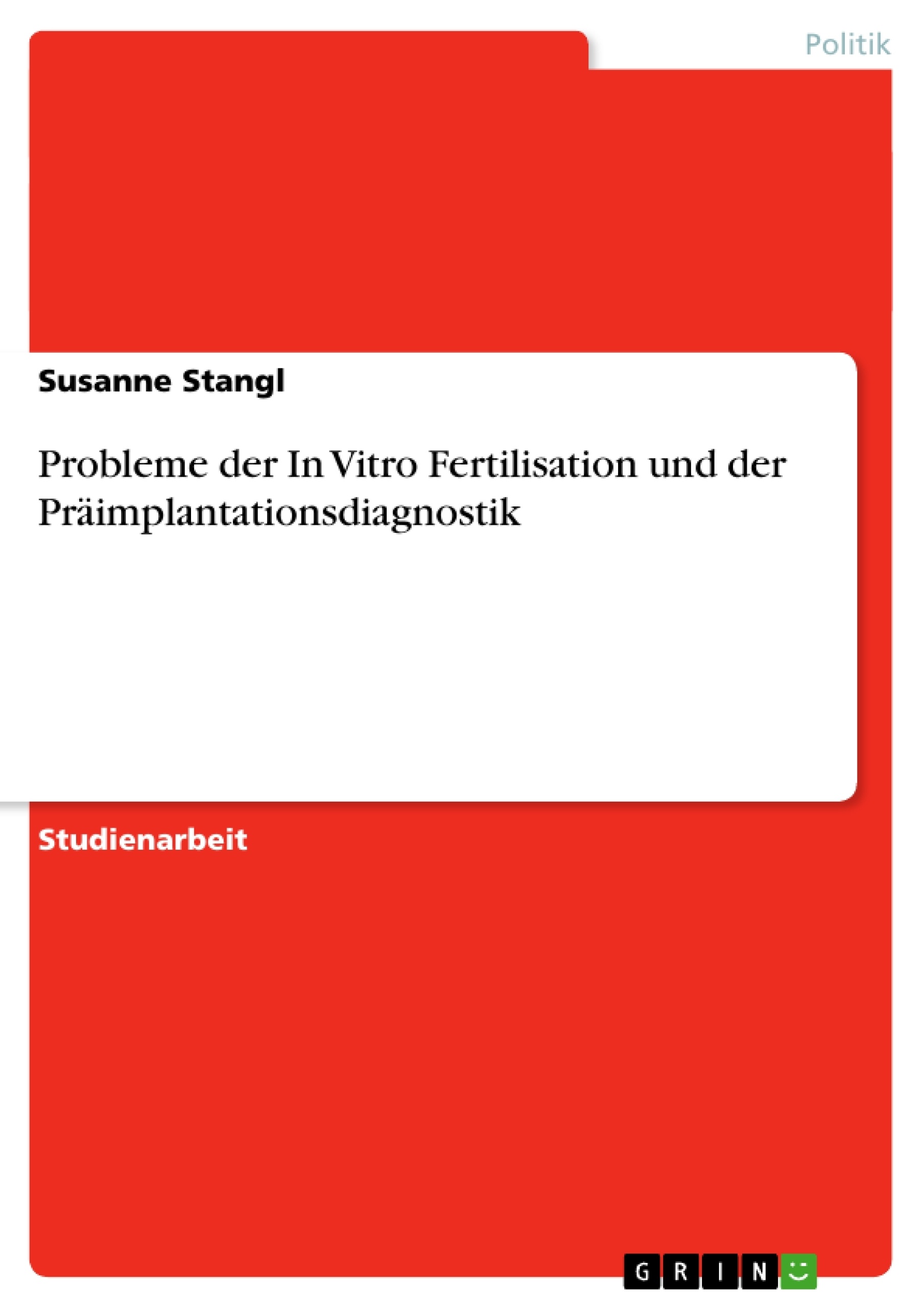Am 25. Juli 1978 wurde in Manchester Louise Brown geboren: das weltweit erste durch „In-Vitro-Fertilisation“ (IVF) und anschließenden Embryonentransfer (ET) gezeugte Baby. Ihre Geburt krönte die über 18 Jahre andauernde Forschungsarbeit des Retortenbabypioniers Robert Edwards, der erstmals 1960 die Möglichkeit einer Zeugung im Reagenzglas in Erwägung gezogen hatte. Um dieses erste Retortenbaby herzustellen, verbrauchten die Mediziner Edwards und Steptoe, sein Mitstreiter, etwa 200 Embryonen. Etwa zeitgleich mit der Mutter Louise Browns waren 3 weitere Frauen durch IVF und ET schwanger, von denen indes keine ein lebensfähiges Kind zur Welt brachte: ein triploider Embryo ging nach einigen Wochen ab, ein weiterer überlebte seine durch invasive pränatale Tests ausgelöste Frühgeburt nur um ein paar Stunden und der letzte Embryo wurde nach Feststellung von Trisomie 21 (Down-Syndrom) abgetrieben.1
Am 27. Februar 1986 kam das erste deutsche „Tiefkühlbaby“ zur Welt. Nachdem man der Mutter im April 1984 neun Eizellen entnommen hatte, konnten acht davon befruchtet und von diesen acht schließlich drei in die Gebärmutter verpflanzt werden. Eine Schwangerschaft trat nicht ein. Die restlichen fünf befruchteten Eizellen wurden mit einer speziellen Technik eingefroren und bei –196°C in flüssigem Stickstoff aufbewahrt. Beim Auftauen im Juni 1985 waren drei der fünf Eizellen noch intakt und wurden der Mutter eingepflanzt - Ergebnis war Anna Katharina, das erste deutsche Baby, das aus der Kälte kam.
Was 1978 eine absolute Sensation war, ist heute bereits Routine geworden. Die IVF hat sich in vielen Ländern etabliert und weltweit gibt es mittlerweile weit über 300.000 IVF-Kindern.2
Diese Methode, die eigentlich unfruchtbaren Paaren doch noch zu einem eigenen Kind verhelfen kann, ist freilich spätestens auf den zweiten Blick ethisch alles andere als unproblematisch. So ist die Erfolgsrate von IVF-Behandlungen nach wie vor relativ gering, die Verlustrate von Embryonen dafür hoch und die Liste der sich aus dieser Methode ergebenden Folgeprobleme ziemlich lang. In der vorliegenden Arbeit sollen nun die ethischen Probleme beleuchtet werden, die IVF und eine Folgetechnologie, die Präimplantationsdiagnostik (PID) mit sich bringen. In einem ersten Teil der Arbeit wird zunächst auf das technische Verfahren bei der IVF eingegangen, um die nötigen Informationen zum Verständnis der weiteren Teile der Arbeit bereitzustellen, [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. In-Vitro Fertilisation
- 2.1. Das technische Verfahren
- 2.2. Zahlen und Fakten zur IVF
- 3. Das Lebensrecht des Embryos
- 3.1. Mehrlingsschwangerschaften und selektiver Fetozid
- 3.2. Der rechtliche Status des Embryos
- 3.3. Kritische Betrachtung des Umgangs mit Embryonen im Rahmen von IVF
- 4. Präimplantationsdiagnostik
- 4.1. Problemfelder der PID
- 4.2. Rechtliche Aspekte der PID
- 4.2.1. Die europäische Ebene
- 4.2.2. Diskussion um die rechtliche Fixierung der PID in der BRD
- 5. (K)eine Zukunftsmusik
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die ethischen Probleme der In-Vitro-Fertilisation (IVF) und der Präimplantationsdiagnostik (PID). Ziel ist es, die technischen Verfahren zu erläutern und die daraus resultierenden ethischen Herausforderungen zu beleuchten.
- Das technische Verfahren der IVF und seine Erfolgsraten
- Das Lebensrecht des Embryos und der Umgang mit Mehrlingsschwangerschaften
- Der rechtliche Status des Embryos in Deutschland und Europa
- Ethische Problemfelder der PID
- Zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Geburt des ersten durch IVF gezeugten Kindes, Louise Brown, vor und führt in die Thematik der ethischen Probleme der IVF und PID ein. Sie skizziert den historischen Kontext und die Bedeutung der Arbeit, welche die ethischen Herausforderungen dieser Technologien beleuchtet.
2. In-Vitro Fertilisation: Dieses Kapitel beschreibt das technische Verfahren der IVF, einschließlich der hormonellen Stimulation, der Eizellentnahme und der Befruchtung im Reagenzglas. Es werden außerdem Zahlen und Fakten zur Erfolgsrate und den Komplikationen der IVF präsentiert, um ein umfassendes Bild der Methode zu liefern. Die geringe Erfolgsrate und die hohe Verlustrate von Embryonen werden als Ausgangspunkt für die ethische Diskussion genannt.
3. Das Lebensrecht des Embryos: Dieses Kapitel befasst sich mit dem zentralen ethischen Konflikt der IVF: dem Lebensrecht des Embryos. Es diskutiert die Problematik von Mehrlingsschwangerschaften und selektivem Fetozid, sowie den rechtlichen Status des Embryos. Eine kritische Betrachtung des Umgangs mit Embryonen im Kontext der IVF wird vorgenommen, wobei verschiedene ethische Standpunkte und ihre Argumentationen beleuchtet werden. Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Beginn des Lebens werden hier diskutiert.
4. Präimplantationsdiagnostik: Dieses Kapitel widmet sich der Präimplantationsdiagnostik (PID) als Folgetechnologie der IVF. Es beleuchtet die Problemfelder der PID, insbesondere die ethischen und rechtlichen Fragen, die sich aus der Möglichkeit der Embryoselektion ergeben. Der rechtliche Rahmen auf europäischer Ebene und die Diskussion um eine rechtliche Fixierung der PID in Deutschland werden ausführlich behandelt, wobei die unterschiedlichen Positionen und ihre Argumente dargestellt werden.
Schlüsselwörter
In-Vitro-Fertilisation (IVF), Präimplantationsdiagnostik (PID), Embryo, Lebensrecht, Ethik, Recht, Reproduktionsmedizin, Mehrlingsschwangerschaft, Embryoselektion, Rechtliche Aspekte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Ethische Probleme der In-Vitro-Fertilisation (IVF) und der Präimplantationsdiagnostik (PID)
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit den ethischen Problemen der In-Vitro-Fertilisation (IVF) und der Präimplantationsdiagnostik (PID). Sie untersucht die technischen Verfahren beider Methoden und beleuchtet die daraus resultierenden ethischen Herausforderungen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: das technische Verfahren der IVF und seine Erfolgsraten, das Lebensrecht des Embryos und den Umgang mit Mehrlingsschwangerschaften, den rechtlichen Status des Embryos in Deutschland und Europa, ethische Problemfelder der PID, zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der Reproduktionsmedizin.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, In-Vitro-Fertilisation (mit Unterkapiteln zum technischen Verfahren und Zahlen/Fakten), Das Lebensrecht des Embryos (mit Unterkapiteln zu Mehrlingsschwangerschaften, rechtlichem Status und kritischer Betrachtung), Präimplantationsdiagnostik (mit Unterkapiteln zu Problemfeldern und rechtlichen Aspekten), (K)eine Zukunftsmusik und Ausblick. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was wird im Kapitel zur In-Vitro-Fertilisation behandelt?
Das Kapitel beschreibt detailliert das technische Verfahren der IVF, von der hormonellen Stimulation bis zur Befruchtung im Reagenzglas. Es präsentiert Zahlen und Fakten zur Erfolgsrate und möglichen Komplikationen und diskutiert die geringe Erfolgsrate und hohe Verlustrate von Embryonen im Kontext der ethischen Fragen.
Welches zentrale ethische Problem wird im Zusammenhang mit IVF diskutiert?
Das zentrale ethische Problem ist das Lebensrecht des Embryos. Die Arbeit diskutiert die Problematik von Mehrlingsschwangerschaften und selektivem Fetozid und beleuchtet den rechtlichen Status des Embryos. Unterschiedliche ethische Standpunkte und Argumentationen zum Beginn des Lebens werden vorgestellt.
Worum geht es im Kapitel zur Präimplantationsdiagnostik (PID)?
Das Kapitel widmet sich der PID als Folgetechnologie der IVF. Es untersucht die ethischen und rechtlichen Fragen der Embryoselektion. Der rechtliche Rahmen auf europäischer Ebene und die Diskussion um eine rechtliche Fixierung der PID in Deutschland werden ausführlich behandelt, inklusive der Darstellung unterschiedlicher Positionen und Argumente.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: In-Vitro-Fertilisation (IVF), Präimplantationsdiagnostik (PID), Embryo, Lebensrecht, Ethik, Recht, Reproduktionsmedizin, Mehrlingsschwangerschaft, Embryoselektion, Rechtliche Aspekte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit zielt darauf ab, die ethischen Probleme der IVF und PID zu untersuchen, die technischen Verfahren zu erläutern und die daraus resultierenden ethischen Herausforderungen zu beleuchten.
- Citar trabajo
- Susanne Stangl (Autor), 2002, Probleme der In Vitro Fertilisation und der Präimplantationsdiagnostik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10912