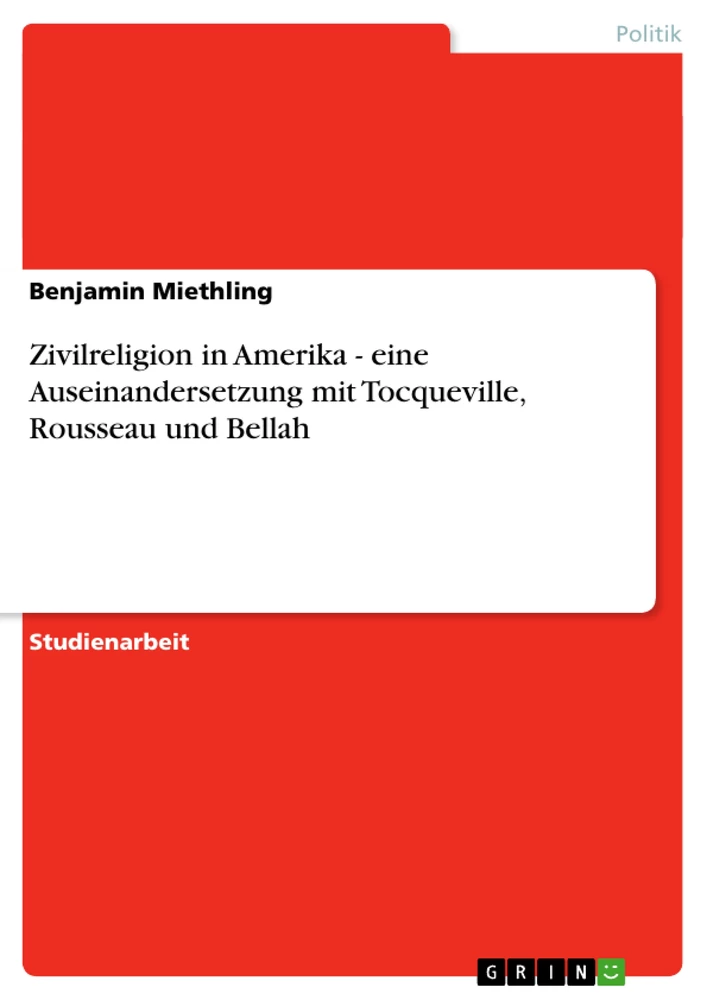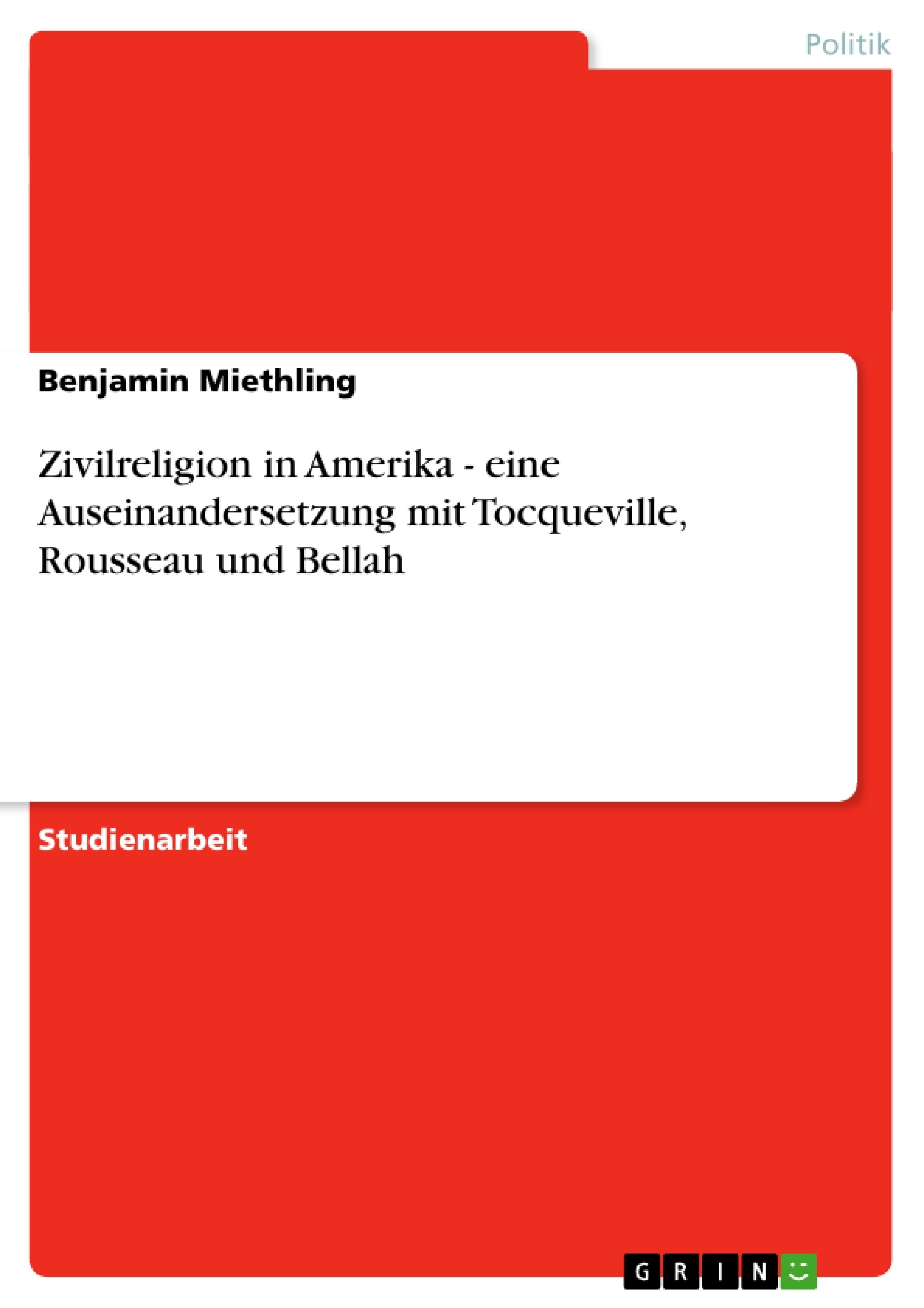Inhaltsverzeichnis:
I. Einleitung
II. Die Theorie der Zivilreligion bei Rousseau
II.1. Der Begriff der Zivilreligion
II.2. Rousseaus Theorie der Zivilreligion
II.3. Probleme
III. Die Zivilreligion in Amerika
a) Tocqueville
III.a.1. Die Idee der Zivilreligion bei Tocqueville
III.a.2. Probleme
III.a.3. Parallelen und Differenzen zu Rousseau
b) Bellah
III.b.1. Bellahs Verständnis von Zivilreligion
III.b.2. Bellahs Bezüge auf Rousseau und Tocqueville
IV. Resümee, aktuelle Debatte und Ausblicke
V. Literaturliste
I. Einleitung
In diesen Tagen kämpfen amerikanische und britische Truppen im Irak gegen den Diktator Saddam Hussein*. Es ist der Vormarsch einer – vom Anführer George W. Bush so genannten – ´Koalition der Willigen´, von denen bislang jedoch nur Amerika und England wirklich aktiv beteiligt sind (Australien, Polen etc. ausgenommen, da in der Anzahl entsendeter Soldaten eher symbolisch aktiv). Doch im Gegensatz zu Amerikas Präsident bläst seinem britischen Mitstreiter Tony Blair ein eisiger politischer Wind aus dem eigenen Land entgegen; dort verweigern ihm seine Landsleute den Gehorsam, seine Beliebtheit sinkt in den Keller und hohe Politiker seiner Regierung wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Auffällig sind die gegensätzlichen Reaktionen in zwei Ländern, die sich gemeinsam an einem völkerrechtlich umstrittenen, von ihren Repräsentanten jedoch als notwendig angesehenen Krieg befinden. Doch woher rührt eine derartige Differenz der Ansichten dieser Völker? Man könnte argumentieren, dass die beiden Länder eben mit unterschiedlichen Voraussetzungen in diesen Krieg gezogen sind: auf der einen Seite ist England ein Teil des immer weiter zusammenwachsenden und nach Frieden und Stabilität trachtenden Europas; auf der anderen Seite sind die Vereinigten Staaten von Amerika die einzig verbliebene Supermacht der Welt, welche nach dem 11. September einen tief sitzenden Schock bewältigen und potentielle Nachahmer abschrecken und vernichten möchte. Doch so einfach lässt sich die Argumentation wohl nicht führen. Es scheint etwas tiefer Greifendes in den Mentalitäten, den Anschauungen und dem Glauben der beiden Nationen verankert zu sein, das dazu beiträgt, George W. Bush auf seinem von den Vereinten Nationen losgelösten Pfad voranschreiten zu lassen und dabei die Mehrheit seiner Bürger hinter sich wähnen zu können.
Worauf ich in diesem Fall abziele, wird der Leser an dieser Stelle bereits ahnen: es geht um das Phänomen amerikanischer Zivilreligion, welches vor allem seit dem 11. September 2001 wieder verstärkt in den deutschen Medien Beachtung findet (vgl. Hase 2001: 13/14).
Selbstverständlich kann man die eben aufgeworfene Fragestellung weder durch die Sicherheitstheorie´ nach dem 11. September noch durch eine Zivilreligionstheorie zweifelsfrei und vollständig klären; doch scheint die Zivilreligion zweifelsohne ein substantieller Bestandteil der amerikanischen Politik zu sein und deshalb würde ich mich darauf festlegen wollen, dass sie einen gewaltigen Einfluss auf die Geschehnisse sowohl in Afghanistan wie auch im Irak hat und das Volk der Amerikaner hinter ihrem Präsidenten eint.
Mit dieser Arbeit möchte ich versuchen einen Überblick darüber zu geben, wie sich die Zivilreligion in den Vereinigten Staaten äußert, welche Charakteristika sie hat und vor allem, was diesen Begriff generell kennzeichnet. Dabei gehe ich von Jean-Jacques Rousseau aus, der durch seine Abhandlung ´Von der bürgerlichen Religion´ im vierten Buch seines 1762 erschienenen Werkes ´Gesellschaftsvertrag´ als ´Urvater´ der Zivilreligion gilt. Auf Amerika bezogen wurde diese Theorie knapp ein Jahrhundert später von Alexis de Tocqueville in seinem Werk ´Über die Demokratie in Amerika´. Um den Bogen bis in die nahe Vergangenheit und hin zur Gegenwart zu spannen, möchte ich mich schließlich intensiv mit den Ansichten und Erkenntnissen des Soziologieprofessors Robert N. Bellahs auseinandersetzen, welcher die Diskussion mit seinem Aufsatz ´Civil Religion in America´ aus dem Jahre 1967 neu entfachte und einen weiteren Meilenstein in der Erforschung des Phänomens amerikanischer Zivilreligion setzte. Bezeichnend für Bellahs Werke sind seine Bezüge sowohl auf Rousseau, dem er die Erkenntnis der grundlegenden Eigenschaften und Offenbarungsmerkmale der Zivilreligion zuschreibt, sowie auf Tocqueville, dessen Thesen er ausführlich und kritisch beleuchtet und in seine Forschung mit einbezieht. Die besondere Fokussierung auf ausgewählte Autoren bleibt in diesem Zusammenhang unerlässlich, da die wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, wie auch im Verlaufe der Arbeit immer wieder sichtbar wird, bislang noch weit von einem konsensfähigen Zivilreligionsmodell entfernt ist, „der kleinste gemeinsame Nenner scheint darin zu bestehen, dass unter diesem Stichwort Beobachtungen verhandelt werden, die weder dem Bereich des Religiösen, noch dem Bereich des Politischen eindeutig zugeordnet werden können“ (Hase 2001: 15).
Dennoch hoffe ich, mit dieser Arbeit einen zusammenhängenden Überblick über bedeutende Theorien der Zivilreligion geben zu können, wobei Bezüge auf ältere sowie aktuelle Reden und Geschehnisse in Amerika (siehe Irak-Krieg) selbstverständlich nicht fehlen dürfen und das heißt zu prüfen, ob und in wieweit diese Theorien unser Verständnis des gesellschaftlichen Geschehens klären und/oder anreichern können.
Beginnen möchte ich mit einer Auseinandersetzung mit Jean-Jacques Rousseaus Ideen einer Zivilreligion in seinem ´Gesellschaftsvertrag´.
II. Die Theorie der Zivilreligion bei Rousseau
II.1. Der Begriff der Zivilreligion:
Um die Begriffliche Evolution der ´Zivilreligion´ besser verständlich machen zu können, möchte ich als Einführung zunächst den Begriff der Zivilreligion aus der Sicht neuerer wissenschaftlicher Analysen beleuchten. Diese soll dem Leser, aber auch mir selbst eine Basis geben, von der aus man die Diskussion beginnen kann, aber auf keinen Fall implizieren, die Begriffsklärung wäre mit dem folgenden Absatz bereits abgeschlossen. Die erwähnten Autoren Kleger und Müller versuchen in dem von ihnen herausgegebenen Buch „Religion des Bürgers: Zivilreligion in Amerika und Europa“, wie auch andere Autoren, Vorschläge zu sammeln und ein Gerüst zu entwerfen, auf dem man die Debatte in Zukunft aufbauen kann. An dieser Stelle soll verdeutlicht werden, in welchem Bereich wissenschaftlicher Untersuchungen sich der Terminus ´Zivilreligion´ bewegt und welche Vorschläge für ähnliche Begriffe vorliegen.
Ideengeschichtlich geht der Terminus ´Zivilreligion´ auf Jean-Jacques Rousseau zurück (vgl. Minkenberg/Willems 2002: 6), den Ausdruck ´civil religion´ gebrauchte Robert N. Bellah zum ersten Mal in seinem Aufsatz ´Civil Religion in America´ aus dem Jahre 1967. Grundsätzlich basiert der Begriff auf der Problematik der Trennung von Staat und Kirche, welche die Glaubensfreiheit und die Freiheit, sich zu religiösen Zwecken zusammenzuschließen garantieren soll, gleichzeitig jedoch die religiöse Sphäre von der politischen trennt. Trotz dieser Privatisierung der Religion basiert die Zivilreligion auf im Volke vorhandenen gemeinsamen Überzeugungen, Symbolen und Ritualen, die sich auf der politischen Ebene vor allem in Meinungsäußerungen wiederfinden (vgl. Bellah 1967: 21/22), der Meinung ist jedenfalls Bellah selbst. In Deutschland ist eine Diskussion entbrannt, ob man den amerikanischen Terminus ´civil religion´ überhaupt 1:1 in deutsche Sprache übersetzen könne oder ob nicht andere Begriffe wie zum Beispiel ´Religion des Bürgers´ den Sinn weitaus eher träfen (vgl. Vögele 1994: 17/18). Man sollte den Begriff jedoch einer etwas intensiveren Abgrenzung unterziehen; vor allem die Unterscheidung zu ähnlich lautenden und der Verwechselung naheliegenden Begriffen scheint mir in diesem Zusammenhang erforderlich. Begriffe wie ´bürgerliche´ oder ´politische Religion´ stehen dabei im Raum. Dies soll natürlich in erster Linie zum besseren Verständnis des Begriffes dienen und dieses Anliegen habe ich beim Verfassen dieser Arbeit, weshalb ich nicht auf alle, mit dem Verhältnis Politik-Religion zusammenhängenden Begriffe näher eingehen werde. Da, wie gesehen, viele Experten dem Begriff unterschiedliche Merkmale zusprechen und sich mit der deutschen Bezeichnung des von Bellah (der im übrigen mit seiner Begriffsauswahl im Nachhinein sehr zufrieden war (vgl. Bellah 1978: 43)) geprägten ´civil religion´ sehr schwer tun, werde ich mich in dieser Arbeit auf den besagten Text von Kleger und Müller stützen. Sie differenzieren dabei zwischen der ´Zivilreligion´ ähnlichen Begriffen, die diese sozusagen durch eine Konstatierung der Unterschiede umreißen sollten.
Betrachten wir dabei zunächst den Begriff der ´bürgerlichen Religion´: dieser bezeichnet ein Christentum, das sich als „privatistisch, gnaden-los und hoffnungsarm“ (Kleger/Müller 1986: 7) zu erkennen gibt und das sich in Form einer Indifferenz erzeugenden und eine ungerechte Weltgesellschaft legitimierenden Innerlichkeitsreligion darstellt. Die ´Religion des Bürgers´ hingegen beschäftigt sich in erster Linie nicht mit der theologischen, sondern mit der philosophischen Bedeutung der Religion für die Bürger eines Staates und umfasst somit eine Reihe von Werten, Verhaltensmustern und Wahrnehmungen, die ein – um mit Rousseau zu sprechen – ´tugendhafter Bürger´ verinnerlicht haben sollte. Im Unterschied zu manchen anderen Formen, wie zum Beispiel der ´politischen Religion´, welche sich in kritischer Distanz zur ´Religion des Bürgers´ befindet und in erster Linie ein Interesse an der Durchsetzung der Werte politischer Eliten hegt, ist letztere durch ihre Aufgeklärtheit und Säkularisierung, sowie die Wahrung der Autonomie von Religion und Politik und die „Sakralisierung der Grundlagen der ´gesellschaftlichen Gemeinschaft´“ (Kleger/Müller 1986: 13) gekennzeichnet. Und an dieser Stelle lässt sich der Bogen zum Begriff der „Zivilreligion“ schlagen, der – von Rousseau erfunden – von Bellah wiederentdeckt wurde und vor allem „das eigentümliche Phänomen“ beschreibt, „dass in Amerika trotz Trennung von Staat und Kirchen das religiöse Moment politisch eine entscheidende Rolle spielt für das amerikanische Selbstverständnis und seine Geschichtsordnung als ´neues Israel´“ (Kleger/Müller 1986: 8). Im Gegensatz zu dem – zugegebenermaßen eng verwandten – Begriff der ´Religion des Bürgers´, dessen Merkmale sich im Wesentliche politisch äußern, zielt die ´Zivilreligion´ auf einen Grundkonsens von religiösen und theologischen Werten innerhalb einer Nation, die sich nach außen vor allem in öffentlich-repräsentativen Handlungen und „theologischen und religiösen Passagen in Reden von Staatsrepräsentanten“ (Vögele 1994: 18) äußern.
Dies soll für den Einstieg zunächst genügen; weiterführende Erkenntnisse hoffe ich im Laufe dieser Arbeit herausstellen zu können. Dabei möchte ich mich zunächst intensiv mit Jean-Jacques Rousseau beschäftigen.
II.2. Rousseaus Theorie der Zivilreligion
Der Staatstheoretiker, Jean-Jacques Rousseau, ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, da er als ´Urvater´ der Theorie der Zivilreligion gilt. Vor allem im achten Kapitel des vierten Buches seines ´Gesellschaftsvertrags´ charakterisiert Rousseau den Einfluss, den die Religion in der Politik spielen sollte und durch welchen sie sein Staatskonstrukt stützen könnte. Dabei war der Einfluss von Religion auf die Politik auch zu seiner Zeit nichts Neues. Unter anderem untersuchte Machiavelli, dessen Schriften Rousseau beeinflussten, im 11. Kapitel seiner ´Discorsi´ die „Religion der Römer“ und deren Einfluss auf das Staatsgeschehen (vgl. Kersting 2002: 189).
Rousseau selbst beginnt sein Kapitel ´Von der bürgerlichen Religion´ mit einer Deskription des Vergangenen, einer Zeit, in der die Nationen ihre jeweils eigenen Götter verehrten, deren Geltung und Macht gewiussermaßen an den Grenzen der Staatsterritorien endeten. Einen anderen Staat erobern hieß demnach: einen anderen Gott besiegen. „Der politische Krieg war auch religiös; die Bereiche der Götter waren sozusagen durch die nationalen Grenzen festgelegt“ (Rousseau 1977: 141). Die Kriege waren demnach in der Regel politisch geprägt und hatten dennoch religiöse Auswirkungen – wohingegen es keine religiöse Kriege gab (vgl. O´Hagan 1999: 222). Erst mit der Errichtung des Römischen Reiches und dem Einzug des Christentums begann die Beerdigung des Religionspluralismus und die Folgen waren verheerend. Rousseau schreibt: „In diese Verhältnisse herein kam Jesus, um ein geistiges Reich auf Erden zu errichten; dies hatte durch die Trennung des theologischen Systems vom politischen zur Folge, dass der Staat aufhörte, einer zu sein, und verursachte die inneren Spaltungen, die nie aufgehört haben, Unruhe unter den christlichen Völkern zu stiften“ (Rousseau 1977: 143). Die enge Verbindung des Staates mit der Religion verschwand – die ´Religion des Bürgers´ wurde zu einer ´Religion des Menschen´ (vgl. Kersting 2002: 190). „Das Christentum“, so schreibt Spaemann in diesem Zusammenhang, „ist keine Bürgerreligion, sondern die ´Religion de l´homme´, die den Menschen als Menschen freisetzt und zum Bürger des Universums macht“ (Spaemann 1992: 21). Die Folge des Einzuges des Christentums war also eine innere Spaltung und Spannung des Menschen, welcher nun sowohl Teil des weltlichen, wie auch des göttlichen Reiches war, er war „hin- und hergerissen zwischen Pflicht und Neigung“ (Spaemann 1992: 25) und musste gleichzeitig dem Willen zweier Herren Folge leisten. Diese innere Zerstrittenheit schlug sich auf höherer Ebene mindestens ebenso dramatisch nieder; es zerstörte die Macht des Gemeinwesens und somit die politische Einheit der Nation (vgl. Kersting 2002: 191). Das Christentum trägt in Rousseaus Augen den Keim zur Unterwerfung der Bürger und somit den Keim des Despotismus in sich, weil es Knechtschaft und Abhängigkeit predigt. Die Begriffe ´christlich´ und ´Republik´ schließen sich in seinen Augen aus (vgl. Rousseau 1977: 149).
Durch diese Erkenntnisse schockiert begibt sich Rousseau auf die Suche nach einer Religion, welche der politischen Macht keinen Schaden zufügt, oder im Gegenteil, den Zusammenhalt der Bürger und den Glauben in Staat und Gesetze fördert. Dabei verweist der oft sehr Hobbes-kritische Rousseau gerade auf dessen Erkenntnisse, indem er diesem zugesteht, der einzige zu sein, „der das Übel und sein Heilmittel richtig gesehen und vorzuschlagen gewagt hat, die beiden Köpfe des Adlers zu vereinigen und alles auf eine politische Einheit zurückzuführen, ohne die weder ein Staat noch eine Regierung jemals gut verfasst sein werden“ (Rousseau 1977: 145). Obwohl sich Hobbes Ansatz, die Kirche aus der Politik auszuschließen, als nicht durchführbar erwies, da „die Undankbarkeit der Priester“ (Hobbes 1970: 172), welche immer mehr Macht unter sich vereinigen möchten, in einem Ungleichgewicht der Mächte gipfelt, führt Rousseau Hobbes Strategie der Einheitssicherung des Staates durch Verstaatlichung der Religion fort. Und bereits hier offenbart sich, was am Ende dieses Kapitels noch einmal intensiver beleuchtet werden soll, nämlich die Intention einer Zivilreligion, nicht den Menschen, sondern dem Staate zu dienen.
Wie genau sollte diese neue Religion also aussehen, die aus oben erwähnten Gründen nun schon einmal nicht christlich sein kann? Kersting schreibt in Rousseaus Sinne: „Eine politisch nützliche Funktion kann die Religion dann ausüben, wenn sich ihre Autorität zur Stärkung politisch erwünschter, wenn nicht gar unerlässlicher Einstellungen und Handlungsweisen einsetzen lässt, wenn sie den Verbindlichkeiten der Bürgermoral zusätzliche Festigkeit verleiht“ (Kersting 2002: 192). Um dies zu erreichen erarbeitet Rousseau einen Katalog von Bekenntnissen, denen der Bürger zustimmen muss und die den Bürger an seinen Staat binden; man könnte diese quasi als die durch die Tugend nur mangelhaft zum Vorschein kommenden wünschenswerten Verhaltensweisen bezeichnen. Diese Dogmen – so Rousseau – müssen „einfach, gering an Zahl und klar ausgedrückt sein“ (Rousseau 1977: 151), um von jedem Bürger mit unterschiedlichsten Glaubensrichtungen, anerkannt werden zu können und somit dem Glaubenspluralismus Rechnung zu tragen. Im Detail unterscheidet Rousseau positive und negative Dogmen, welche wären: die Existenz einer allmächtigen, allwissenden (...) Gottheit, das zukünftige Leben, das Glück der Gerechten, die Bestrafung des Bösen, sowie die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages und der Gesetze auf der positiven Seite und der Intoleranz auf der negativen Seite. Er konzipiert also ein sehr „abstraktes Religionsprogramm“ (Kersting 2002: 195), das gerade aufgrund dieser Abstraktheit mit allen Religionen vereinbar ist. Der Bürger kann diesen Regeln zustimmen, ohne in innere Konflikte mit seiner privaten Religion verwickelt zu werden. Wie wir im Laufe dieser Arbeit sehen werden ist dieser Punkt bis heute in den Zivilreligionstheorien begriffen.
II.3. Probleme
Die Probleme Rousseaus Theorie liegen auf der Hand und O´Hagan wirft ihm sogar vor, mit jedem Versuch der Differenzierung, was der Gemeinschaft im Zusammenhang mit dem religiösen Glauben der Bürger wichtig sei, mehr Probleme zu schaffen als zu lösen (vgl. O´Hagan 1999: 230). Es beginnt mit einer gewissen Widersprüchlichkeit des Toleranzbegriffs in Rousseaus ´Dogmen-Katalog´, indem die Toleranz bereits dadurch eingeschränkt wird, dass man die Intoleranten nicht tolerieren sollte. Wer sich also diesem „bürgerlichen Glaubensbekenntnis“ (Rousseau 1977: 151) verweigert und der Ansicht ist, außerhalb der Kirche kein Heil zu finden, der sollte nach Rousseau vom Staate ausgeschlossen werden, und zwar nicht als Gottloser, sondern als jemand, der sich „dem Miteinander widersetzt und unfähig ist, die Gesetze und die Gerechtigkeit ernstlich zu lieben und sein Leben im Notfall der Pflicht zu opfern“ (Rousseau 1977: 151/ vgl. O´Hagan 1999: 228). Diese Bekenntnispflicht zur Zivilreligion hat sich zu einem der Hauptkritikpunkte in Rousseaus Konstruktion entwickelt, Lübbe bezeichnet sie als Teil einer „voraufgeklärten Verfassung“ (Lübbe 1981: 197), die dem Bürger das Recht auf Religionsfreiheit nicht einräumt und somit dafür mitverantwortlich ist, dass das rousseausche Modell der Zivilreligion auf die heutige Zeit nicht mehr anwendbar ist. Die aktuellen Interpretationen von Zivilreligion stellen mehrheitlich fest, dass auf Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zur Zivilreligion nicht erkannt werden kann und „ihre jeweils kulturell und politisch dominanten Orientierungen unterliegen keiner vor Instanzen zu verantwortenden Disziplin“ (Lübbe 1981: 203). Kersting sieht in der Einführung einer Zivilreligion einen weiteren Bruch für die gesamte Staatskonstruktion Rousseaus: in seinen Augen verkörpert das Bürgerbekenntnis eine Art typisch modernen ´Pluralismusmanagements´, das die nötigen Gemeinsamkeiten für das Zusammenleben der Bürger auf einer „höheren Abstraktionsebene“ (Kersting 2002: 196) suchen muss. Am offensichtlichsten rückt Rousseau den Gesellschaftsvertrag durch das Bekenntnis zur ´Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages und der Gesetze´ auf eine göttliche Ebene und entsagt damit all seinen Beteuerungen, die die Tugend der Menschen als innerem Antrieb für ein friedliches Zusammenleben hervorheben. Dieser „republikanische Optimismus“ (Kersting 2002: 196) wird verworfen; ihm entgegen tritt ein Gesellschaftsvertrag, welcher von einer welttranszendenten Macht entworfen und den Menschen sozusagen gestiftet wurde, so die konsequente Fortführung von Rousseaus Ansatz. Er trennt die Religion und die Politik nicht auf der Begründungs- und Rechtfertigungsebene, jedoch auf der Ebene der Verwirklichung seines Gesellschaftsvertrages.
Wie man sieht, hat die Zivilreligion bei Rousseau eine immense Ausstrahlung auf die inneren Zusammenhänge seiner Staatskonstruktion; sie dient ihm als Stütze, indem sie die Bürger zur Liebe ihrer Pflichten treibt, doch die Probleme, die sich – vor allem aus dem Bekenntniszwang und der Sanktionierungsoption – ergeben, lassen sich dabei nicht von der Hand weisen; die voraufgeklärte Ideengrundlage verbietet gleichzeitig eine direkte Anwendung der Theorie auf die heutige Zeit. In den nächsten Kapiteln soll gezeigt werden, wie Tocqueville und Bellah die Zivilreligion in den Vereinigten Staaten von Amerika beobachteten und in welcher Form sich Rousseaus Konzeptionen und Ideen in Amerika wiederfinden lassen.
III. Die Zivilreligion in Amerika
a) Alexis de Tocqueville (1805-1859)
III.a.1. Die Idee der Zivilreligion bei Tocqueville
Alexis de Tocqueville veröffentlichte 1835 sein berühmtes Werk ´De la démocracie en Amérique´ (Über die Demokratie in Amerika). Die Kapitel ´Über die Religion als politische Einrichtung betrachtet: wie sie zur Erhaltung des demokratischen Staatswesens machtvoll beiträgt´, ´Mittelbarer Einfluss der Glaubenshaltungen auf die politische Gesellschaft in den Vereinigten Staaten´ und ´Wie die Religion in den Vereinigten Staaten die demokratischen Instinkte zu benützen versteht´ beschäftigen sich eingehend mit der Frage nach der Notwendigkeit von Zivilreligion und der Form dessen Auftreten in den Vereinigten Staaten. Grundlegend lässt sich feststellen, dass sich in Tocquevilles Theorie, bei der (wie auch bei Rousseau) viel Wert auf die Erziehung der Menschen im Staate gelegt wird, neben der erzieherischen Funktion politischer Einrichtungen (vgl. Hereth 1981: 14) die Stellung eines zweiten und inneren Erziehers, der die ´Herzensangewohnheiten´ der Menschen und damit ihr Verhalten lenken soll (vgl. Guéhenno 1994: 139), etabliert. Als Voraussetzung für den Erfolg dieser Konstruktion erachtet Tocqueville jedoch die Trennung von Staat und Kirche als besonders wichtig, denn „sind die Priester aber einmal aus der Regierung entfernt oder halten sich abseits, wie sie dies in den Vereinigten Staaten tun, so gibt es keine Menschen, die dank ihres Glaubens (und wohl auch aufgrund ihrer Minderheitsstatus in den Vereinigten Staaten..., Anm.d.Autors) geneigter wären, die Idee der Gleichheit in das politische Leben hineinzutragen als die Katholiken“ (Tocqueville 1987: 435). Der bekennend unreligiöse (oder zumindest äußerst religionskritische) Tocqueville (vgl. Hereth 1991: 73) stellt überraschenderweise fest, dass das Christentum im Grunde mit Demokratie und Republikanismus vereinbar sei; die Katholiken in Amerika seien die demokratischste und republikanischste Klasse, die es in den Vereinigten Staaten gibt (vgl. Tocqueville 1987: 433/434). Vor allem die Tatsache, dass sich die Katholiken in den Vereinigten Staaten in der Minderheit befänden, erwecke in ihnen den Wunsch, dass in ihrer Republik alle Rechte geachtet würden, da sie als Minderheit nur so an der Regierung teilnehmen könnten (vgl. Tocqueville 1987: 435). In Anspielung auf Rousseau schreibt er: „Ich denke, dass man die katholische Religion zu Unrecht als einen natürlichen Feind der Demokratie ansieht. Im Gegenteil scheint mir unter den verschiedenen christlichen Lehren der Katholizismus die Gleichheit der Bedingungen am meisten zu begünstigen“ (Tocqueville 1987: 434). An dieser Stelle offenbart sich unverkennbar, aus welchem Blickwinkel Tocqueville die Religion betrachtet: Er misst die Religion an dem ihr implizierten Beitrag, den sie zum Erhalt und Ausbau der freiheitlichen Verhältnisse leisten kann; in seinen Augen liegt es vor allem an der Religion, die Bedürfnisse der Menschen auf Ziele jenseits der materiellen Genüsse zu richten und eben diese Leistung hält Tocqueville für unerlässlich und außerordentlich wichtig, so dass er den geistigen Führern der Gesellschaft empfiehlt, auch ohne einen wirklichen Glauben, die Glaubenssätze der Religion in der Öffentlichkeit zu vertreten (vgl. Hereth 1991: 82). „Die Hauptaufgabe der Religionen ist es“, so Tocqueville, „die allzu heftige und ausschließliche Neigung zum Wohlergehen, die die Menschen in Zeiten der Gleichheit empfinden, zu läutern, zu regeln und einzuschränken“ (Tocqueville 1985: 233). Die Menschen sehnen sich nach bestimmten Vorstellungen von Gott, ihrer Seele und von den allgemeinen Pflichten gegenüber Gott und ihren Mitmenschen. Ein Volk ohne Religion wäre demnach ein Volk voller Zweifel, das im Geiste gelähmt und somit der Knechtschaft geweiht sei (vgl. Tocqueville 1985; 225/226). Er impliziert den Menschen folglich ein persönliches Bedürfnis nach Religion und äußert sich äußerst skeptisch gegenüber der Annahme, vollkommene politische Freiheit sei ohne Religion möglich. „Der Despotismus kommt ohne Glauben aus, die Freiheit nicht“ (Tocqueville 1987: 444), so schreibt er und verdeutlicht damit, dass eine Gesellschaft ohne Religion in seinen Augen der Bedrohung durch Anarchie oder Despotismus ausgeliefert sei (vgl. Hereth 1991: 74). Er erkennt, „dass völlige Irreligiosität gerade in einer freien Gesellschaft Impulse in der menschlichen Psyche freisetzt, die Ordnung, Stabilität und Freiheit selbst gefährden, und mehrmals betont er die heilsame Wirkung der Religion, die eine menschliche Vernunft, die sich zuviel zutraue, in ihre Schranken weise“ (Hereth 1991: 75). Gemeint sind in diesem Zusammenhang vor allem die Gefahren, welche die Gleichheit unter die Menschen sät, namentlich der Egoismus, der durch die fortschreitend atomisierte Gesellschaftsstruktur hervorgerufen wird, sowie die damit verbundene wachsende Liebe zu materiellen Genüssen (vgl. Tocqueville 1985: 228). In seinen Überlegungen blendet Tocqueville die philosophisch-theoretische Dimension der Selbstvergottung des Menschen und der Regierung komplett aus und widmet sich den praktischen Problemen, die bei der Umsetzung seiner Ideen, also der religiösen Hilfe für das Zusammenhalten des Staates, entstehen. Er entwirft Änderungsvorschläge und konzentriert sich dabei vor allem auf die Auswirkungen der Religion auf die Gesellschaft. In diesem Zusammenhang fordert er, die überflüssigen Riten und abergläubischen Anteile abzustoßen und die Dogmatik auf das Wesentliche zu reduzieren (vgl. Jardin 1991: 230). Vor allem die Fragen der Annahme oder Ablehnung von Dogmen spielen dabei eine zentrale Rolle für ihn – er scheint der festen Überzeugung zu sein, „dass Religion im Volke nur in Form dogmatischer Sätze wirksam werden kann“ (Hereth 1991: 81). Sein Ziel in diesem Zusammenhang ist es, die Tugenden in den Menschen wiederzuerwecken und die Religion als Gegenpol zum Individualismus zu etablieren. Die übereinstimmende religiöse Einstellung der Amerikaner dient demnach als Schutz vor der selbstzerstörerischen Uferlosigkeit der Macht, welche die Menschen dazu bewegt, sich alles auszudenken und alles zu wagen (vgl. Rau 1975: 120). Zu diesem Sinne vermeinte Tocqueville in Amerika bekennender Weise das ´idealste´ politische System seiner Zeit zu erkennen.
III.a.2. Probleme
Doch ergeben sich aus Tocquevilles Theorie diverse Schwierigkeiten; kurz möchte ich an dieser Stelle einige davon skizzieren:
Zunächst sollte man die Erfahrungstatsache berücksichtigen, dass die Religion zur politischen Freiheit in einem rein negativen Verhältnis stehen kann: so vermag sie dazu beitragen, den Gebrauch der politischen Macht in einem Staate zu erleichtern, doch ist sie per se nicht in der Lage, auch dafür Sorge zu tragen, dass diese Macht durch den Mehrheitswillen legitimiert ist. „Eine Regierung vom Typus des absoluten Königtums ist nicht nur problemlos mit religiösen Grundüberzeugungen vereinbar, sondern es ist gerade die Religion, die einer solchen an sich kraftlosen Regierungsform Stärke und Dauer verleihen kann“ (Rau 1975: 120). Beispiele wie die französische Monarchie in der Vergangenheit, aber auch islamistische Staaten wie der Iran, wo Menschenrechte mit Verweis auf religiöse Zwecke beschnitten und missachtet werden, sprechen gegenwärtig in diesem Zusammenhang eine deutliche Sprache.
Weiter besteht durch eine unchristliche Vergottung des nationalen Staates die Gefahr der Entgleisung in den Imperialismus; durch die Erhebung des Staates auf eine göttliche Ebene können Expansionsbestrebungen und die Unterdrückung anderer Völker in zivilisatorischer Absicht gerechtfertigt werden; die Theorie des ´Lebensraumes im Osten´ für die arische Rasse aus der Zeit der Nationalsozialisten bringt dieses Problem auf den Punkt. Hier steht dem Glauben verstärkend die Vaterlandsliebe zur Seite, welche nach Tocqueville eine weitere Voraussetzung für die innere Ruhe in der Demokratie darstellt. Voller Begeisterung berichtet er über Neuengland: „So erwärmt sich der Glaubenseifer an der Vaterlandsliebe“ (Tocqueville 1987; 443). Wie gesehen kann dies zwar der Fall sein, eine Kausalität zwischen Vaterlandsliebe und Demokratie beziehungsweise Gleichheit muss jedoch zurückgewiesen werden.
Neben diesen Problemen führt Hereth an, dass Tocqueville an dieser Stelle seines Werkes nicht der Verbreitung der Wahrheit, sondern in erster Linie seiner pädagogischen Intention folgte, denn er findet auf das aus dem Inhalt und der Verbreitung der Dogmen entstehende Spannungsverhältnis keine nähere Erklärung und flüchtet sich in die Verkündung falscher Tatsachen: tatsächlich haben die Menschen in seinen Augen nicht genügend Muße (und oft auch nicht genügend Intelligenz), um sich mit den Dogmen, welche er die „einfachen Ideen“ nennt, intensiv auseinander zu setzen und sie in Folge eines intensiven Reflexionsprozesses zu internalisieren, weiter schreibt er – hingegen gegensätzlichem Wortlaut in ´Über die Demokratie in Amerika´ – in einem Brief an Louis de Kergorlay ausführlich über die Trägheit des Glaubens und von verbreiteter Indifferenz der Amerikaner (vgl. Hereth 1991: 81/82). Die Existenz und staatliche Verbreitung dieser ´einfachen Ideen´ scheinen also noch keine gesicherten Indizien oder steinlose Pfade auf dem Weg zu einer Verankerung der Zivilreligion in einem Staatsvolk zu sein; die Theorie Tocquevilles scheint sogar von diesem selbst kritisch betrachtet worden zu sein.
III.a.3. Parallelen und Differenzen zu Rousseau
Im Folgenden möchte ich die eben erläuterten Ideen der Zivilreligion Tocquevilles mit denen Rousseaus in Verbindung bringen. Bei der Lektüre der beiden grundlegenden Werke ´Gesellschaftsvertrag´ (Rousseau) und ´Über die Demokratie in Amerika´ (Tocqueville) entsteht in manchen Passagen der Eindruck, Tocqueville habe Rousseau genau kopiert, in anderen Textstellen möchte man meinen, Tocqueville schreibe eine auf Rousseau bezogene Richtigstellung. Derart differieren die Ansichten der beiden Theoretiker oder sie stimmen in anderen Punkten haargenau überein. In prägnanter Weise äußert sich ein Gegensatz in Tocquevilles Äußerung „sie brachten also in die neue Welt ein Christentum mit, dass ich nicht besser beschreiben kann, als indem ich es demokratisch und republikanisch nenne“ (Tocqueville 1987: 433), wenn man sie Rousseaus „aber ich irre, wenn ich von einer christlichen Republik spreche; diese beiden Begriffe schließen sich gegenseitig aus“ (Rousseau 1977: 149), gegenüberstellt. Im weiteren Verlauf schreibt Tocqueville folgendes: „Ich denke, dass man die katholische Kirche zu Unrecht als einen natürlichen Feind der Demokratie ansieht“ (Tocqueville 1987: 434); ein ausdrücklicher kritischer Bezug auf den Genfer Philosophen und Staatstheoretiker Jean-Jacques Rousseau.
Betrachtet man die grundlegenden Ergebnisse der beiden bislang behandelten Ideen, so kann festgestellt werden, dass diese eine großen Schnittmenge aufweisen; zumeist sind es die Wege, welche zu bestimmten Zielen führen, in denen sie sich unterscheiden. So ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass beide Denker die Religion in ihren Werken ´instrumentalisieren´ und versuchen, sie für einen sicheren, ruhigen und nach ihren Vorstellungen optimalen Staat zu gebrauchen. Rousseau schreibt: „Nun ist es ja für den Staat sehr wohl wichtig, dass jeder Bürger eine Religion hat, die ihn seine Pflichten lieben heißt“ (Rousseau 1977: 150), Tocqueville stellt diese Funktionalität mit den bereits oben zitierten Worten her: „Die Hauptaufgabe der Religionen ist es, die allzu heftige und ausschließliche Neigung zum Wohlergehen, die die Menschen in Zeiten der Gleichheit empfinden, zu läutern, zu regeln und einzuschränken“ (Tocqueville 1985: 233). Spirituellen Fragen weicht er in diesem Zusammenhang grundsätzlich aus (vgl. Hereth 1991: 80). Die Unterschiede treten nun ´im kleinen´ an die Oberfläche: Zum Beispiel wird der von Rousseau ins Spiel gebrachte Einwand der Knechtschaft, die der christliche Glauben predigt, von Tocqueville nicht weiter verfolgt. Seiner Meinung nach dient die katholische Religion als idealer Gegenpol zu den Tendenzen der Individualisierung und des Egoismus, hervorgerufen durch zunehmende Gleichheit der sozialen Bedingungen. Während Rousseau sich in seiner Arbeit deutlich tiefgründiger mit dem Wesen der Religion an sich beschäftigt und dabei mehre Religionen einem Vergleich unterzieht (und sie letzen Endes allesamt für untauglich in Bezug auf die politische und gesellschaftliche Unterstützung des Souveräns hält), stellt Tocqueville nüchtern fest, der Katholizismus begünstige die Gleichheit der Bedingungen am meisten und arbeitet intensiver an den Erfordernissen dieser Religion für den Staat. Er spricht sich also direkt für einen Katholizismus aus, schließt jedoch auch andere Religionen nicht aus, solange sie sich aus der Politik heraushalten, während Rousseau die Religion sofort aus der politischen Ebene verdrängen und ein davon losgelöstes „bürgerliches Glaubensbekenntnis“ (Rousseau 1977: 151) etablieren möchte. Doch, so unterschiedlich die Ansätze in diesem Punkt waren, umso enger finden sie ein gemeinsames Ziel: Politik und Religion sollten im Staate getrennt bleiben, es obliegt hingegen dem Staat selbst, einige Dogmen, die, nach Rousseau, einfach, gering an Zahl und klar ausgedrückt sein sollten, zu verbreiten, um die Tugend zu revitalisieren und die guten Sitten aufleben zu lassen. Was bei Rousseau einem ´Deal´ gleicht mit der Formel: Tust Du mir nichts, tu ich Dir auch nichts, ist nach Tocqueville allerdings eher mit dem aus der Ökonomie stammenden Begriff der win-win-Situation interpretierbar: die Kirche wagt sich nicht in politische Gebiete vor, um einem Glaubwürdigkeitsverlust und Konflikten zu entgehen, wohingegen der Staat sich nicht um den Glauben der Menschen kümmert, ihn im Gegenteil unterstützt und fördert: „Die amerikanischen Priester versuchen keineswegs, den Blick des Menschen ausschließlich auf das künftige Leben zu richten und ihn dort festzuhalten; sie überlassen ein Stück seines Herzens gern der Sorge um das Gegenwärtige; sie scheinen die Güter dieser Welt als wichtige, wenn auch untergeordnete Dinge anzusehen“ (Tocqueville 1985: 235). In der Konsequenz sind sich beide jedoch einig.
Dies soll für diesen Teil zunächst genügen; in den folgenden Absätzen möchte ich wieder ein Jahrhundert weiterschreiten und Robert N. Bellahs Ansichten, Erkenntnisse und Ideen zur Zivilreligion in Amerika betrachten.
b) Robert N. Bellah (*1927)
III.b.1. Bellahs Verständnis von Zivilreligion
Der (mittlerweile emeritierte) Soziologieprofessor Robert N. Bellah veröffentlichte im Jahr 1967 einen aufsehenerregenden Artikel mit dem Titel ´Civil Religion in America´. Dieser bildete die Diskussionsgrundlage für weitere Artikel, Vorträge und Bücher Bellahs und anderen Wissenschaftlern, die sich mit der Erforschung von Zivilreligion befassten. Als Ursache für die unerwartet hohe Aufmerksamkeit, die diesem Artikel Bellahs zukam, sieht Hase mehrere Gründe, vor allem wohl „die Unbefangenheit, mit der Bellah die von ihm identifizierte amerikanische Zivilreligion nicht nur beschrieb, sondern sich zugleich persönlich zu ihr bekannte. Diese Unbefangenheit erklärt sich aus dem Entstehungszusammenhang des Aufsatzes. Die Erörterung theoretischer Probleme war zunächst gar nicht das Anliegen Bellahs gewesen“ (Hase 2001: 54). Bellah selbst sah sich im Vorfeld seines Aufsatzes vor ein Problem gestellt, das eher praktischer Natur war: Nachdem er sich einige Zeit in Japan aufgehalten hatte, wurde ihm die Frage gestellt, aus welchem Grunde die Japaner ihren Schrein für die Kriegsopfer unter private Verwaltung geben mussten, unter Heranziehung des Arguments der Trennung von Staat und Kirche, wohingegen zum Beispiel der ´Arlington National Cemetery´ (siehe Deckblatt), ein Friedhof auf dem viele Soldaten des Unabhängigkeitskrieges ihre letzte Stätte fanden, staatlich verwaltet werden durfte (vgl. Bellah 1992: vii-viii). Dieses Problem schärfte Bellahs Augen für das Phänomen der Zivilreligion und führte zu besagtem Artikel.
In ´Civil Religion in Amerika´ erläutert Bellah die amerikanische Zivilreligion chronologisch und ausgehend von den Gründervätern bis zum Zeitpunkt der Publikation (´bis heute´ kann man evtl. nicht mehr sagen, da, vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges oder dem 11. September, neuere Untersuchungen zu diesem Thema zu unternehmen wären). Er orientiert sich in erster Linie an Tocqueville, wenn er hervor hebt, dass in den Vereinigten Staaten ein gesellschaftsumfassender religiöser Konsens jenseits der traditionell verfassten Religionen besteht. Aus dieser Annahme schließt er, dass es eine Zivilreligion gibt und vor allem auch, dass diese Religion (oder religiöse Dimension) „durchaus ernstzunehmen ist“ (Bellah 1967: 19). Die diesem Umstand entspringende Frage ist jene nach den Gegenständen, Ritualen oder anderen Merkmalen, die als Kennzeichen oder Identifikationsmerkmale einer Zivilreligion gelten können und um dies schon einmal vorwegzunehmen: bis heute hat die wissenschaftliche Auseinandersetzung noch nicht zu einem allgemein anerkannten Begriff der ´Zivilreligion´ geführt. Vögele stellt dazu fest: „Zivilreligion ist ein Mischphänomen, bei dem sich politische wie religiöse, philosophische wie theologische Aspekte nur schwer trennen lassen. Das kompliziert die Analyse. Zivilreligion – das ist ein mehrdeutiger und darum missverständlicher Begriff“ (Vögele 1994: 14).
Bellah ist der Auffassung, dass das Fundament der Zivilreligion in dem Prinzip der Trennung von Staat und Kirche und somit auf einer garantierten Glaubensfreiheit besteht. Zur Folge hat diese Abnabelung der Kirche vom Staat jedoch auch die Trennung der privaten religiösen- von der öffentlichen politischen Sphäre (vgl. Bellah 1967: 21). Doch – so Bellah – ist mit der Privatisierung von Religion nicht zwangsläufig eine Gesellschaft entworfen, in der jedermann nur seine eigenen Werte und Anschauungen pflegt. Im Gegenteil, so stellt er fest, gibt es „gleichzeitig für die überwiegende Mehrheit der Amerikaner gewisse gemeinsame Elemente der religiösen Orientierung“ (Bellah 1967: 22). Zu der Distanz des Außenstehenden sind diese Werte und Normen (und selbiges ist in dieser Arbeit bereits besprochen, s.o.) in „einer Reihe von Überzeugungen, Symbolen und Ritualen“ (Bellah 1967: 22) erkennbar. Diese würden seit der Staatsgründung der Amerikaner vor allem in politischen Ansprachen immer wieder ausgedrückt und beschworen und hätten sich mit der Zeit sogar weiterentwickelt. Ein Beispiel aus der Gegenwart macht dies deutlich: In seiner Rede aus dem Weißen Haus vom 7.3.2003 bekennt der amerikanische Präsident George W. Bush: „Mein Glaube trägt mich, weil ich täglich bete. Ich bete um Beistand, Weisheit und Stärke. Wenn wir unsere Truppen ins Gefecht schicken müssten (...), würde ich für ihre Sicherheit beten, und ich würde auch für die Sicherheit unschuldiger irakischer Leben beten. Eine Sache, die an unserem Land wirklich großartig ist, ist: Es gibt tausende von Leuten, die für mich beten (...). Ich bete für Frieden“ (aus: Süddeutsche Zeitung vom 8./9. 3. 2003). Man erkennt unschwer die religiöse Dimension, die - verbunden mit der politischen ´Message´ - an die Gefühle der Menschen appelliert, und die einfache Sprache, die er in seiner Rede verwendet, lässt darauf schließen, dass es vor allem das republikanische, gläubige Stammklientel ist, an welches diese Rede gerichtet ist (vgl. Hujer 2003). Eine bestimmte Religion wird explizit nicht erwähnt und wenn man sich andere Reden des Präsidenten zur Hand nimmt, so fällt vor allem auf, dass Bellahs Feststellung aus dem Jahr 1967 untermauert wird, als er über die Antrittsrede Kennedys schrieb: „In der Tat erwähnte er keine bestimmte Religion, er bezog sich weder auf Jesus Christus noch auf Moses oder die christliche Kirche, und ganz bestimmt nicht auf die katholische Kirche. Seine einzige Bezugnahme war tatsächlich der Begriff ´Gott´, ein Wort, das fast alle Amerikaner akzeptieren können, das jedoch für so viele Leute so verschiedene Bedeutungen hat, dass es fast inhaltslos ist“ (Bellah 1967: 21). Man könnte also folgern, dass Kennedy und Bush versuchten, die Religion für die Politik zu instrumentalisieren (was mit Sicherheit auch nicht gänzlich von der Hand zu weisen ist), doch ganz so trivial scheint die Idee der Zivilreligion nicht zu sein. Bellah weist dabei auf den amerikanischen Geist hin, in dem sich Republikanismus und Liberalismus vereinigen. Probleme bei der Vereinbarkeit von republikanischen Gedanken im Mantel eines liberalen Verfassungsstaats, also die Grundidee eines Staates, in dem die Lebensweise und die Sitten eines Volkes ausschlaggebend für das reibungslose Zusammenspiel von Staat und Bürger gewertet werden und dem liberalen, auf Ausgleich gegensätzlicher Interessen gerichteten Ansatz, treten dabei zwangsläufig hervor. Bellah stellt, sicherlich unter dem Einfluss prominenter Vordenker, wie den hier erwähnten Rousseau und Tocqueville, heraus, dass sich vor allem der Bereich der Erziehung als entscheidend für das Überleben einer Republik entpuppt und republikanische Sitten und Bürger aus einem erzieherischen und spirituellen Prozess erwachsen. Der liberale Ansatz fördert in diesem Fall die positiven Ergebnisse einer liberalen, auf Konkurrenz und Wettbewerb ausgerichteten Wirtschaft. Diese Mischung aus liberalen und republikanischen Elementen, die seit der Staatsgründung aus dem Geist der Amerikaner erwachsen, verkörpern seither das amerikanische Regierungssystem, wobei der liberale Teil primär in der Verfassung, der republikanische vorwiegend in der Unabhängigkeitserklärung auftreten (vgl. Bellah 1978: 48/49). Die mehrmalige Erwähnung des Begriffes ´Gott´ in letztgenanntem Dokument veranlasst Bellah zu einer genaueren Prüfung und lässt ihn zu dem Schluss kommen, dass eine Existenz religiöser Symbolik an dieser Stelle durchaus zu der Behauptung führen kann, dass in den USA eine Zivilreligion bestehe, denn: „Die Unabhängigkeitserklärung verweist auf Gottes Souveränität über die gesamte politische Gesellschaft, indem sie in den ersten Zeilen auf ´die Gesetze der Natur und Gott als Herrn der Natur´ Bezug nimmt, welche über den Gesetzen der Menschen stehen und diese beurteilen. Es wird oft behauptet, der Gott der Natur sei gerade nicht der Gott der Bibel“ (Bellah 1978: 50).
Wir haben bislang also festgestellt, dass Bellah in den Vereinigten Staaten die Existenz einer Zivilreligion nachzuweisen glaubt und bereits die grundlegenden Merkmale dieser Religion erläutert. Als nächstes soll der notwendige Wandel und die Anpassung der Zivilreligion erläutert werden, ohne den in Bellahs Augen die Aktualität und Kraft aller Religionen (also auch der Zivilreligion) dem Untergang geweiht wären. So konstatiert er eine Weiterentwicklung der Zivilreligion vor allem durch den Einfluss großer Ereignisse (vgl. Bellah 1978: 60) – die Religion bedarf stets neuer ´Anstöße´, um weiterhin ihre Aufgabe, nämlich die Schaffung von „disziplinierten, unabhängigen, um das Gemeinwohl besorgten, in einem Wort, tugendhaften Bürgern“ (Bellah 1978: 60) wahrnehmen zu können. Der Bürgerkrieg war so ein Anstoß und Bellah stellt fest, dass dieses zweite große Ereignis (nach der Staatsgründung) in der Geschichte Amerikas, das nationale Selbstverständnis derart beeinflusste, dass es in der Zivilreligion Ausdruck finden musste. In diesem Fall zitiert er Abraham Lincoln, welcher Gott explizit in seiner Rede zum Bezugspunkt aller Argumente bestimmt und Themen, wie Tod, Opfer und Wiedergeburt in die Zivilreligion integriert, dessen Inhalt bis dato primär von Worten und Taten der Gründerväter geprägt war. Lincoln selbst wurde von einigen seiner Anhänger selbst für auserwählt gehalten und nach seinem Tod wurde sein Leben und sein Tod von vielen unter christlichem Hintergrund als märtyrerisch gehuldigt (vgl. Bellah 1967: 29). Mit dem ´Arlington National Cemetery´ (s.o.), wurde der Zivilreligion ein Denkmal geschaffen, der ´Memorial Day´ (Erinnerungstag) verleiht den zivilreligiösen Themen bis heute rituellen Ausdruck. Bellah stellt fest, dass dieser Tag, zusammen mit dem Erntedankfest und flankiert vom Veteranentag, sowie den Geburtstagen Washingtons und Lincolns den „rituellen Jahreskalender“ (Bellah 1967: 30) der Zivilreligion bilden.
Im 20. Jahrhundert, nach der Überwindung von Abhängigkeit und Sklaverei, sieht Bellah das Problem des „verantwortungsvollen Handelns in einer revolutionären Welt, einer Welt, die viele der materiellen und geistigen Dinge zu erlangen sucht, die wir schon erreicht haben“ (Bellah 1967: 35). Der Zweite Weltkrieg und später der Vietnamkrieg bedeuteten den Eintritt der Amerikaner aus der Vorbildrolle in die Rolle des Aufpassers und Ordnungsstifters und damit einen signifikanten Wandel der Zivilreligion. Wie dieser Wandel schließlich aussehen könnte, vermag Bellah zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu sagen, doch ist er sich sicher, dass nach den großen Ereignissen des Unabhängigkeits- und des Bürgerkrieges auch diese „dritte Zeit der Bewährung“ (Bellah 1967: 37) neue bedeutende symbolische Formen hervorrufen wird. Dabei entwirft er das Szenario einer Weltzivilreligion, angeregt durch die Einführung der amerikanischen Zivilreligion in die Vereinten Nationen, und hier offenbart sich noch einmal ganz deutlich der suprakonfessionelle Charakter, den Bellah der Zivilreligion zuspricht; sie kann beinahe auf der gesamten Welt existieren, ohne die verschiedenen Glaubensrichtungen signifikant zu beeinflussen oder zu diskriminieren. Dieses Ziel sieht Bellah als die Erfüllung amerikanischer Zivilreligion, „dieses Ergebnis abzulehnen hieße, die eigentliche Bedeutung Amerikas abzulehnen“ (Bellah 1967: 38). Die Zivilreligion stellt für ihn schließlich ein „Erbe an moralischer und religiöser Erfahrung“, dar, „von dem wir, die wir jetzt daran gehen, die nächsten Entscheidungen zu treffen, noch viel zu lernen haben“ (Bellah 1967: 38).
III.b.2. Bellahs Bezüge auf Rousseau und Tocqueville
Im Folgenden möchte ich kurz einige bereits besprochene Punkte revue-passieren lassen und dabei Bezüge, Unterschiede und Parallelen zwischen Bellah und seinen prominenten Vorgängern aufzeigen.
Bellah selbst bezieht sich in seinen Werken sowohl auf Rousseau, wie auch auf Tocqueville – vor allem deshalb, weil Rousseau die „ursprüngliche Konzeption der Zivilreligion“ (Hase 2001: 58) entwarf und Tocqueville sich in seinen Werken als erster explizit der amerikanischen Zivilreligion widmete. Daher verwundert es auch nicht, wenn Bellah und dessen Rezipienten regelmäßig auf eine der wichtigsten Stellen bei Rousseau in diesem Zusammenhang verweisen, nämlich einem Absatz im vierten Buch des ´Contrat Social´, in dem es heißt: „Es gibt daher ein rein bürgerliches Glaubensbekenntnis, dessen Artikel festzusetzen dem Souverän zukommt, nicht regelrecht als Dogmen einer Religion, sondern als Gesinnung des Miteinander, ohne die es unmöglich ist, ein guter Bürger und ein treuer Untertan zu sein. Ohne jemand dazu verpflichten zu können, daran zu glauben, kann er jeden aus dem Staat verbannen, der sie nicht glaubt; er kann ihn nicht als Gottlosen verbannen, sondern als einen, der sich dem Miteinander widersetzt und unfähig ist, die Gesetze und die Gerechtigkeit ernstlich zu lieben und sein Leben im Notfall der Pflicht zu opfern“ (Rousseau 1977: 151/ vgl. auch: Hase 2001: 58). Die Zivilreligion sollte also, wie bereits dargelegt, aus wenigen, einfachen Glaubenssätzen bestehen, welche die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages und den Glaube an einen Gott beinhalten., gleichzeitig sollte sie jedoch verbindlich für die Bürger des Staates sein, welche von diesem ausgeschlossen würden, sollten sie sich diesem Glauben nicht anschließen wollen. Auch in Bellahs Werken erkennt man deutlich die Idee der gemeinsamen Glaubenssätze und der Trennung von Kirche und Staat, doch lässt sich sagen, dass die beiden Theoretiker unterschiedliche Ansätze vornehmen: währen man bei Rousseau eine eher ´deduktive´ Vorgehensweise konstatiert, wobei er ausgehend von seinem durchweg geplanten und starren Konzept die Zivilreligion erklärt, so stützt sich Bellah auf die Untersuchungen vieler Autoren, sowie auf eigene Erfahrungen und leitet aus ihnen seine Erkenntnisse ab. In der Folge gesteht Rousseau dem Souverän die Ausarbeitung einiger, von den bestehenden Religionen weitgehend unabhängiger Dogmen und die Verankerung selbiger im Staatsvolk zu; Bellah geht hingegen von den bestehenden Religionen aus und schlägt vor, in ihnen nach einer Art ´kleinstem gemeinsamen Nenner´ zu suchen (vgl. Bellah 1967: 22). Die Starrheit in Rousseaus Gedankenkonzept (das sich im Übrigen durch das gesamte Werk ´Gesellschaftsvertrag´ hindurchzieht und somit zum Teil dramatische Konsequenzen hervorbringt) führt schließlich zu einem Diktat des Souveräns, welcher in Rousseaus Staatskonstruktion zwar mindestens die Mehrheitsmeinung vertreten sollte, da die Bürger den Souverän bilden, doch damit vor allem die Minderheiten unterdrücken kann. Dieses Problem entschärft Bellah indem er die Anerkennung der Dogmen durch das Staatsvolk auf eine unverbindliche, aber wünschenswerte, Ebene verlegt*. Tocqueville drückt seine Auffassung zu diesem Thema, wie gesehen, sehr kurz und prägnant aus, wenn er schreibt: „Ihr (der Gesellschaft, Anm.d.Autors) kommt es nicht so sehr darauf an, dass sich alle Bürger zur wahren Religion bekennen, als darauf, dass sie sich überhaupt zu einer Religion bekennen“ (Tocqueville 1987: 438). Die Religion als solche wird folglich in den Hintergrund gestellt und es wird sich vom Leitbild einer wahren Religion, wie eben auch bei Bellah, abgewendet, doch im Gegensatz zu diesem bleibt die Bedeutung der Religion jenseits der politischen Sphäre für Tocqueville unberücksichtigt. Er blendet also jegliche Art spiritueller Dimension der Religion in diesem Zusammenhang aus, auch übergeht er eventuell vorhandene vorherrschende Lehren und Gedanken der Amerikaner, sondern schiebt das bereits beschriebene ´eiserne Kalkül´ in den Vordergrund seiner Überlegungen. Bellah hingegen möchte eine ´Instrumentalisierung´ der Religion für politische Zwecke und durch rationale Überlegung nicht grundsätzlich und gänzlich bestreiten, jedoch führt er ergänzend den ´amerikanischen Geist´ an, dessen Einfluss auf die Zivilreligion in seinen Augen ebenfalls beträchtlich ist (vgl. Bellah 1967: 24/25). Eine weitere Erkenntnis Tocquevilles macht diese verdeutlicht diese Differenz noch stärker, er schreibt: „Ich bin weder befugt noch gewillt, die übernatürlichen Mittel zu ergründen, durch die Gott das Herz des Menschen mit einem religiösen Glauben erfüllt. Ich betrachte zur Zeit die Religionen lediglich in rein menschlicher Sicht; ich trachte zu erkennen, wie sie in demokratischen Jahrhunderten, in die wir eintreten, ihre Herrschaft am besten bewahren können“ (Tocqueville 1985: 228).
Im Verlauf dieser Überlegungen erwähnt Bellah, wie wir bereits gesehen haben, explizit den Gebrauch des Begriffes ´Gott´ in den Reden großer amerikanischer Politiker. Es war „der Begriff ´Gott´, ein Wort, das fast alle Amerikaner akzeptieren können, das jedoch für so viele Leute so verschiedene Bedeutungen hat, dass es fast inhaltslos ist“ (Bellah 1967: 21). Rousseau, welcher seine eigene Zivilreligion, transzendent jeglicher anderen Religionen entwarf, behandelt den Begriff ´Gott´ ebenfalls. Er schreibt, dass unter den Dogmen, die ein ´bürgerliches Glaubensbekenntnis´ umfassen sollte, vor allem „die Existenz einer allmächtigen, allwissenden, wohltätigen, vorhersehenden und sorgenden Gottheit“ (Rousseau 1977: 151) gehören sollte, womit der Gottesbegriff erwähnt, ein direkter Bezug zu einer bestimmten Religion jedoch abgelehnt wird. Wir erkennen also auch hier, trotz zunächst eindeutiger Differenz eine Übereinstimmung der beiden Theoretiker hinsichtlich des Punktes einer gemeinsamen, jedoch religions- und glaubensunabhängigen Gottheit und auch Tocqueville, der in seinen Werken den Katholizismus als ideale Religion für die Republik preist, hat den Gottesbegriff als Religionsübergreifend interpretiert. Er berichtet über eine politische Versammlung, vor welcher ein Priester Gott den Herrscher um die Rettung des Vaterlandes bittet und dessen Rede die gesamte Versammlung mit einem gemeinsamen ´Amen´ beendet. Auch hier ist also die Bedeutung des Gottesbegriffes signifikant.
Ein letzter Punkt, bevor ich die gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammenfassend beurteilen möchte, zielt auf den Wandel und die Anpassung der Zivilreligion. Wie bereits besprochen, geht Bellah davon aus, dass sich zivilreligiöse Dogmen und Rituale mit bedeutenden Ereignissen wandeln oder durch neue ergänzt werden. Tocqueville argumentiert auf eine etwas andere Art und Weise; er sieht die Religion als eigene, vom politischen Leben abgekoppelte Institution, die primär durch ihre erzieherische Funktion auf die Menschen wirkt und sich ansonsten den Neigungen der Gesellschaft anpasst. Dabei unterscheidet er einige Hauptüberzeugungen von sogenannten Glaubenssätzen, welche man in die Nähe der erwähnten Dogmen setzen könnte. Wobei er den Hauptüberzeugungen eine dauerhafte Natur zuspricht, da diese den Kern der Religion ausmachen, doch sieht er die Notwendigkeit, in den Glaubenssätzen ´mobil´ zu bleiben. „(Die Religionen) müssen sich hüten, sich in gleicher Weise an die zweiten zu binden in Zeitaltern, wo alles beständig seinen Platz verändert und wo der Geist, an den Wechsel menschlicher Dinge gewöhnt, sich ungern festlegen lässt. Die Unbeweglichkeit in den äußern und untergeordneten Dingen scheint mir nur dann eine Gewähr für Dauer zu bieten, wenn die bürgerliche Gesellschaft selbst unbeweglich ist; überall sonst halte ich sie für eine Gefahr“ (Tocqueville 1985: 233). Wenn Tocqueville von ´Gefahr´ spricht, so bezieht sich das in der Regel auf eine Gefahr für den Staat und so meint er auch in diesem Fall, dass die Gefahr für die Religion in der Folge eine Gefahr für die Nation darstellt; wenn die Gesellschaft ihren Glauben in die Religion(en) verliert, so „bemächtigt sich der Zweifel der höchsten Bereiche des Geistes und lähmt alle andern zur Hälfte. (...) Ein solcher Zustand muss unvermeidlich die Seelen zermürben; er schwächt die Spannkraft des Willens und bereitet die Bürger auf die Knechtschaft vor“ (Tocqueville 1985: 227). Die Religionen bedürfen in seinen Augen also ebenfalls eines Wandels; wie dieser zustande kommt, ob durch große Ereignisse oder schleichende Veränderungen in der Gesellschaft, lässt Tocqueville offen. Die Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika konnten sich jedoch nur durch diese stetige Veränderung ihrer Zivilreligion als zugehörig empfinden.
Wir haben also gesehen, dass die Konzepte der Zivilreligion von Rousseau, Tocqueville und Bellah alle ähnlichen Ursprungs und ähnlicher Gedankengänge sind und dennoch festgestellt, dass sich im Detail signifikante Unterschiede bis hin zu offensichtlichen Gegensätzen (z.B.: Rousseau: christliche Republik unmöglich ßà Tocqueville: Christentum in Republik optimal) ergeben. Im Folgenden möchte ich die Arbeit noch einmal revue passieren lassen und dabei vor allem auf die Entwicklung der Theorie der Zivilreligion bis in die Gegenwart eingehen und einige Beispiele aus jüngster Vergangenheit erwähnen.
IV. Resümee, aktuelle Debatte und Ausblicke
Die drei behandelten Autoren und deren Bezüge aufeinander verdeutlichten uns in der Debatte immer wieder, dass der Begriff ´Zivilreligion´ im Groben zwar bereits umrissen, jedoch wissenschaftlich bis heute höchst umstritten ist. Wie bereits zu Beginn dieser Arbeit erwähnt, kristallisiert sich in der aktuellen Diskussion zwar bereits ein Substrat aus Übereinstimmungen heraus, doch die bis hierhin angenommene Definition bzw. Abgrenzung des Begriffes von dessen Derivaten, wie sie Kleger und Müller vorgenommen haben, ist bei weitem noch nicht von allen Wissenschaftlern anerkannt. Ähnlich den Differenzen zwischen Bellah, Tocqueville und Rousseau in deren Ansichten, Überlegungen und Erkenntnissen, so sind auch in der aktuellen Debatte höchst unterschiedliche Interpretationen von ´Zivilreligion´ zu finden. Thomas Hase beschäftigte sich in seinem Buch ´Zivilreligion´ unter anderem mit den Punkten, in denen sich die Wissenschaftler in der Mehrzahl einig sind und welche ich deshalb kurz erläutern möchte. Gleichzeitig – und das resultiert auch aus der Aktualität des Buches von Hase, möchte ich den Bogen spannen bis in die heutige Zeit und in einigen Fällen verdeutlichen, inwiefern sich der Begriff der Zivilreligion gewandelt hat und wo er etwa identisch von Rousseau oder Tocqueville übernommen wurde:
Vor allem das in der Theorie den meisten Bürgern inhärente Weltbild scheint für die Wissenschaftler in diesem Zusammenhang größtenteils kein Streitpunkt mehr zu sein; Hase schreibt: „Zivilreligion nennen sie (die meisten Fachautoren, Anm. d. Autors) das kollektiv getragene religiöse Weltbild eines modernen Gemeinwesens, üblicherweise eines Staates“ (Hase 2001: 203). Das religiöse Weltbild entspringt, ebenso wie symbolische Elemente, der Idee der Gemeinschaft, denen sich die Bürger und deren Regierende zugehörig empfinden müssen. Durch Symbole und Rituale jeglicher Art kann dieser Ideen Ausdruck verliehen werden. In den Vereinigten Staaten herrscht in diesem Punkt „eine reichhaltige Tradition symbolischer Selbstthematisierung“ (Hase 2001: 204) vor, welche immer wieder vor allem in den Reden hoher politischer Akteure in den Vordergrund tritt. Der amtierende Präsident, George W. Bush, wurde in dieser Arbeit bereits zitiert und gewiss hatte seine Art, das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen zu dieser Gemeinschaft anzusprechen, auch einen beträchtlichen Einfluss auf seinen Wahlerfolg gegen den Demokraten Al Gore, sowie auf die große Rückendeckung durch die Bevölkerung in denen von ihm geführten Kriegen. Amerika wird in seinen Reden, aber auch in denen seiner Vorgänger, in gewisser Weise zum ´neuen Israel´ (vgl. Bellah 1967: 26) hochstilisiert, eine besondere Inkorporation des Guten und gerade in der jüngsten Debatte um den Irak bereit und verpflichtet zum Kampf gegen das Böse oder ´die Achse des Bösen´. Neben klaren und einfachen Formulierungen (´Achse des Bösen´), nimmt der Präsident auf diese Themen Bezug; hier einige Auszüge aus Reden der jüngsten Vergangenheit: „Wir können nicht untätig herumstehen, während die Gefahr weiter wächst. (...) Wir müssen für unsere Sicherheit sowie die bleibenden Rechte und Hoffnungen der Menschheit einstehen. Aus ihrem Erbe und aus freien Stücken werden die Vereinigten Staaten von Amerika dafür einstehen. (...)“ (Rede vor den UN am 12.9.2002); „Amerika ist ein Freund des irakischen Volkes (...) Falls eine militärische Aktion erforderlich wird, werden die USA und unsere Verbündeten dem irakischen Volk beim Wiederaufbau seiner Wirtschaft helfen und in einem vereinigten Irak, das mit seinen Nachbarn in Frieden lebt, die Einrichtungen der Freiheit schaffen“ (Bush in einer Rede am 7.10.2002); „Wir wollen Frieden. Wir streben nach Frieden. Und manchmal muss der Friede verteidigt werden... Wenn uns Krieg aufgezwungen wird, werden wir für eine gerechte Sache mit gerechten Mitteln kämpfen - die Unschuldigen in jeder uns möglichen Weise verschonend. Und wenn uns der Krieg aufgezwungen wird, werden wir mit der vollen Macht des US-Militärs kämpfen- und wir werden uns durchsetzen (Bushs ´Rede zur Lage der Nation´ vom 29.1.2003). Die USA als einzige verbleibende Supermacht werden in seiner Rhetorik zum großmütigen Opfer kleiner, aggressiver, nach Expansion und Macht strebender Staaten. Er hebt in seinen Reden also nicht nur die Stellung Amerikas als ´Gut´, sondern in einem Atemzug die seiner Gegner oder Kontrahenten als ´Böse´ hervor. Somit schweißt er die Bürger seines Landes in seiner Rhetorik auf zweierlei Arten zusammen: sie sind nun nicht bloß durch das Privileg miteinander verbunden, Amerikaner zu sein, sondern zugleich ist es ihre Aufgabe, Pflicht und Wille, gegen das Böse zusammenzustehen, das zum einen aufgrund des ´Auftrages´ der USA zur Friedens- und Freiheitssicherung auf der Welt, zum anderen aufgrund des Selbstschutzes gegeben ist. Sehr deutlich wird dies, betrachtet man das folgende Statement des Präsidenten: „Wir sind die einzige verbliebene Supermacht der Welt, und wir müssen unsere Macht in starker aber mitfühlender Weise nutzen, um zur Bewahrung des Friedens beizutragen und die Verbreitung der Freiheit zu ermutigen“ (Bush auf der Seite der Amerikanischen Botschaft in Berlin). Friedens- und Freiheitssicherung der „starken und mitfühlenden“ amerikanischen Nation also. Ein göttlicher Auftrag sozusagen.
Ähnlich den ´historischen Urahnen´ der Zivilreligion nimmt auch Hase Bezug auf die „kollektive Aktualisierung“ (Hase 2001: 204) der Zivilreligion. Heutzutage lässt sich in den Vereinigten Staaten beispielsweise die Heroisierung des „einfachen Mannes“ ausmachen – die Ehrungen und Lobpreisungen für die Feuerwehrleute nach dem 11. September könnten Indizien für eine Wandlung sein. Während zu Gründerzeiten und bis etwa Mitte des 20. Jahrhunderts die Präsidenten vergöttert wurden, welche dem Volk als Vorbilder dienen sollten, berufen sich amerikanische Politiker heute vor allem auf den einfachen Mann, der durch seinen Mut, seine Selbstaufopferung, kurzum durch sein staats- und gesellschaftsdienliches Verhalten höchste Anerkennung durch die Gesellschaft verdient. Auch die Rückbesinnung auf das eigene Volk ist zu beobachten; während Bellah, wie gesehen, in den 60er und 70er Jahren den Trend zu einer „Weltzivilreligion“ (Bellah 1967: 19) konstatierte.
Ein weiterer Punkt der aktuellen ´Zivilreligionsdebatte´ besteht in der Veränderung der Zivilreligion, nicht nur im Sinne der oben genannten Wandlung von Glaubenssätzen, Ritualen und Symbolen, sondern vor allem in deren regelmäßiger Aktivierung. Hase versteht unter einem zivilreligiösen Volk demnach ein Volk, welches sich durch die Bereitschaft zur gelegentlichen Aktivierung zivilreligiöser Einstellungen auszeichnet und dann in bestimmten Situationen eine „feierliche, ergriffene Haltung gegenüber ihrer Nation, ihrer Kultur und Geschichte einzunehmen“ (Hase 2001: 205) imstande ist. Die Reaktion auf die Geschehnisse des 11. Septembers offenbarten diese, vielen Amerikanern inhärente Einstellung schlagartig, die Anteilnahme, das Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Unterstützung Bushs für seinen Krieg gegen Afghanistan, die Schaffung eines Ministeriums für Heimatschutz (inklusive der Beschneidung der Rechte jedes Bürgers), sowie die mächtige Aufstockung des Wehretats, sprechen dabei für sich. Hase und andere fügen den Erkenntnissen der hier behandelten Autoren Rousseau, Tocqueville und Bellah in diesem Falle also noch einen weiteren Aspekt hinzu, welcher in der heutigen Debatte nicht vernachlässigt werden sollte.
Der folgende Punkt wurde von mir in den vorhergehenden Kapiteln bereits allgemein erläutert, erhält jedoch in der aktuellen Debatte zusätzlich eine weitere brisante Note; es handelt sich um die Sanktionierbarkeit zivilreligiöser Devianz. Hase machte die Erfahrung, dass die im Grunde sehr tolerante amerikanische Zivilreligion äußerst aggressiv gegenüber unkonformem Verhalten auftritt, die Sanktionen bezeichnet er als „drakonisch“ (Hase 2001: 206). Sie rühren primär von einem immensen sozialen Druck durch die Gesellschaft auf den einzelnen. Die von Rousseau geforderte staatliche Sanktionierung, welche in dem Ausschluss aus der Gemeinschaft gipfelt, ist von Hase quasi als eine de facto verbindliche, jedoch nicht durch den Staat, sondern durch die Gesellschaft selbst sanktionierte zivilreligiöse Existenz identifiziert worden, was die Tatsache vielleicht nicht unbedingt verändert, doch auch im Hinblick auf andere Diskussionen weitreichende Folgen haben könnte. * (nächste Seite)
Hase schlägt zum Abschluss seiner Arbeit, welche vor allem die Beziehung der Zivilreligion zu den ´konventionellen´ Religionen untersucht, vor, den Terminus ´Zivilreligion´ in die Kategorie einer „diffusen Religion“ (Hase 2001: 207) zu stellen – einem religiösen Derivat, das in einigen wesentlichen Punkten von den Religionen differiert und dennoch ähnliche Wirkungen auf die Gesellschaft entfaltet. Er führt in diesem Zusammenhang vor allem drei bedeutende Punkte an, in welchen sich die Zivilreligion in Amerika von den übrigen Religionen unterscheidet: die Abwesenheit eigener Institutionen, sowie das nur temporär sichtbare Auftreten von Zivilreligion (s.o.) verdeutlichen die Unterschiede der ´Zivilreligion´ zu den übrigen Religionen ebenso wie die Variation der Sichtbarkeit der Zivilreligion von Person zu Person. Mit dieser Feststellung wendet er sich explizit gegen Bellah und andere Modell-Konstrukteure, die in seinen Augen einen idealisierten Zustand für ihre Modelle heranziehen und somit die Realität verkennen (vgl. Hase 2001: 209). Er vertritt die Ansicht, dass die Zivilreligion nicht parallel und sozusagen im Schatten der anderen Religionen rangiert, sondern dass Zivilreligion autonom davon ein eigenes Dasein besitzt, welches sich mit dem anderer Religionen vergleichen lässt (vgl. Hase 2001: 210). Die Zivilreligion trägt in seinen Augen einen großen Beitrag zur amerikanischen Kultur, Denken und Handeln bei und liefert der Gesellschaft somit ebenso wie die ´konventionellen Religionen´ diverse Deutungs- und Orientierungsmuster.
Wir haben in den letzten Absätzen Thomas Hases Zusammenfassung und Interpretation der aktuellen Zivilreligionsdebatte näher beleuchtet, doch der hier präsentierte ´kleinste gemeinsame Nenner´ wirkt, verglichen mit den Aufsätzen anderer Wissenschaftler, beinahe schon übertrieben. Denn selbst hier offenbaren sich gravierende Unterschiede. So stellt Hermann Lübbe in seinem Aufsatz ´Staat und Zivilreligion. Ein Aspekt politischer Legitimität´ den Namen Gottes als zentralen Punkt aller Theorien in diesem Zusammenhang fest (vgl. Lübbe 1981: 195). Die Interpretation der Reden bedeutender amerikanischer Politiker, welche er auf zivilreligiöse Elemente untersuchte stellt sich bei ihm folgendermaßen dar: „Es handelt sich um Bestände religiöser Kultur, die in das politische System integriert sind, die somit auch den Religionsgemeinschaften nicht als ihre interne Angelegenheit überlassen bleiben, in dieser Charakteristik Bürger auch in ihrer religiösen Existenz an das politische Gemeinwesen binden und dieses Gemeinwesen selbst in seinen Institutionen und Repräsentanten als in letzter Instanz religiös legitimiert sichtbar machen“ (Lübbe 1981: 196). Neben Gott als zentralen Begriff hebt er nun also die Dogmen und Symbole in den Vordergrund und gliedert in seiner Charakteristik der Zivilreligion alles unter diese eben genannten Punkte. In der Folge nennt er sieben Charakteristika, unter anderem die Überholtheit der Bekenntnispflicht (wobei er sich explizit gegen Rousseau wendet), die Tendenz zur Minimalisierung der bekenntnisförmig ausformulierbaren Gehalte (parallel zu Rousseau, Tocqueville und Bellah), sowie die höchst streitbare Klassifizierung der Zivilreligion als religiöses Staatsrecht, das im Rechtssystem jedoch eher eine marginale Stellung besitzt. Obwohl er seine Belege hauptsächlich auf die Bundesrepublik Deutschland und nicht auf die Vereinigten Staaten von Amerika anwendet, wird bereits hier deutlich, dass von einem ´kleinsten gemeinsamen Nenner´, wie ihn Hase aufzuzeigen glaubte, wohl nicht gesprochen werden kann. Selbstverständlich kann man viele von Hases Charakterisierungspunkten auch in anderen Aufsätzen oder Werken wiederfinden, doch ist die Zivilreligion weitaus geringer viskos, als dass man sie wirklich eindeutig zusammenfassen könnte, bislang ist nicht einmal die Frage unstrittig geklärt, in welchem Verhältnis die Zivilreligion zu den übrigen Religionen steht; ist sie eine Religion mit politischer Wirkung, ist sie politische Rhetorik mit religiösen Elementen oder ist sie ein eigenes, in sich geschlossenes Glaubensfundament, parallel, ersetzend oder ergänzend zu den anderen? Entsprechend existieren derartig auseinanderklaffende und teilweise gegensätzlich geschriebene Aufsätze.
Wir sahen in den letzten Seiten also eine Debatte, welche in vollem Gange – aber weit von einem übereinstimmenden Ergebnis entfernt zu sein scheint. Die Meinungen differieren immens, die Autoren kritisieren sich gegenseitig und folglich kristallisiert sich nur schwerlich eine Art konsensfähiger Lehrmeinung heraus. Ohne eine Theorie der Zivilreligion – so lässt sich resümieren – wäre der Staatsaufbau und die Geschäfte in den Vereinigten Staaten von Amerika kaum hinreichend zu verstehen. Die theoretischen Ansätze bilden jedoch ein noch recht fragiles Gerüst mit teilweise unscharfer Begrifflichkeit, nicht immer klaren Wirkungszusammenhängen und offener (ungeklärter) Reichweite. Es bleibt für die Zukunft noch ein enormer Arbeits- und Forschungsbedarf, dessen Ergebnisse abzuschätzen noch nicht möglich ist. Ein Anhaltspunkt dafür geht von den drei hier vorgestellten Theoretikern aus, deren Konstruktionen und begrifflichen Differenzierungen des Terminus ´Zivilreligion´ bewusst oder unbewusst, die Entwicklung des Begriffes und seiner Erkenntnismöglichkeiten anstießen. Die Existenz einer Zivilreligion und die Bedeutung derselben für das Amerikanische (Selbst-)Bewusstsein und die Rhetorik amerikanischer Politiker lässt sich somit nicht mehr in Abrede stellen, zu deutlich sind deren Merkmale, besonders jetzt, in den Tagen von Terror und Krieg.
V. Literaturliste
- Bellah, Robert N. 1967: Zivilreligion in Amerika, in: Kleger, Heinz/ Müller, Alois (Hrsg.) 1986: Religion des Bürgers: Zivilreligion in Amerika und Europa, München: Kaiser
- Bellah, Robert N. 1978: Die Religion und die Legitimation der Amerikanischen Republik, in: Kleger, Heinz/ Müller, Alois (Hrsg.) 1986: Religion des Bürgers: Zivilreligion in Amerika und Europa, München: Kaiser
- Bellah, Robert N. 1992: Introduction to the Second Edition (of ´The Broken Convenant´), Chicago: University of Chicago Press
- Besier, Gerhard 1992: Religion, Nation, Kultur: die Geschichte der christlichern Kirchen in den gesellschaftlichen Umbrüchen des 19. Jahrhunderts, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener
- Bush, George W. 2002: Rede vor den UN, am 12.9.2002, auf: http://www.wienerzeitung.at/linkmap/politik/irak/bushredenI.htm, Stand: 11.3.2003
- Bush, George W. 2002: Rede vom 7.10.2002, auf: http://www.wienerzeitung.at/linkmap/politik/irak/bushredenII.htm, Stand: 11.3.2003
- Bush, George W. 2003: Rede zur Lage der Nation, am 29.1.2003, auf: http://www.wienerzeitung.at/linkmap/politik/irak/bushreden.htm, Stand: 11.3.2003
- Guéhenno, Jean-Marie 1994: Das Ende der Demokratie, München/Zürich: Artemis und Winkler
- Hase, Thomas 2001: Zivilreligion – Religionswissenschaftliche Überlegungen zu einem theoretiscghen Konzept am Beispiel der USA, Würzburg: Ergon
- Hereth, Michael 1991: Tocqueville zur Einführung, Hamburg: Junius
- Hereth, Michael 1981: Zur Aktualität der Gedanken Alexis de Tocquevilles, in: Hereth, Michael/ Höffken, Jutta (Hrsg.) 1981: Alexis de Tocqueville – Zur Politik in der Demokratie, Baden-Baden: Nomos
- Hobbes, Thomas 1970: Leviathan, Stuttgart: Reclam
- Hujer, Marc 2003: Wir brauchen keine Erlaubnis, in: Süddeutsche Zeitung vom 8./9.3.2003, S.2
- Jardin, André 1991: Alexis de Tocqueville. Leben und Werk, Frankfurt a.M./New York: Campus
- Kersting, Wolfgang 2002: Jean-Jacques Rousseaus ´Gesellschaftsvertrag´, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
- Kleger, Heinz/ Müller, Alois 1986: Religion des Bürgers: Zivilreligion in Amerika und Europa, München: Kaiser
- Lübbe, Herrmann 1981: Staat und Zivilreligion. Ein Aspekt politischer Legitimität, in: Kleger, Heinz/ Müller, Alois (Hrsg.) 1986: Religion des Bürgers: Zivilreligion in Amerika und Europa, München: Kaiser
- Kleger, Heinz/ Müller, Alois (Hrsg.) 1986: Religion des Bürgers: Zivilreligion in Amerika und Europa, München: Kaiser
- Lübbe, Hermann 1981: Staat und Zivilreligion. Ein Aspekt politischer Legitimität, in:
- Minkenberg, Michael/ Willems, Ulrich 2002: Neue Entwicklungen im Verhältnis von Politik und Religion im Spiegel politikwissenschaftlicher Debatten, auf: www.bpb.de/publikationen/KVIMDT,0,0,Neuere_Entwicklungen_im_Verh%E4ltnis_von_Politik_und_Religion_im_Spiegel_politikwissenschaftlicher_Debatten.html, Stand: 27.2.2003
- O´Hagan, Timothy 1999: Rousseau, London: Routledge
- Rau, Hans-Arnold 1975: Tocquevilles Theorie des politischen Handelns. Demokratie zwischen Verwaltungsdespotismus und Republik, Köln: Hansen
- Rousseau, Jean-Jacques 1977: Gesellschaftsvertrag, Stuttgart: Reclam
- Spaemann, Robert 1992: Rousseau – Bürger ohne Vaterland, München: Piper
- Tocqueville, Alexis de 1985: Über die Demokratie in Amerika, Stuttgart: Reclam
- Tocqueville, Alexis, de 1987: Über die Demokratie in Amerika, Zürich: Manesse
- U.S. Embassy Information Resource Center 2003: George W. Bush Biographie, auf: http://www.usembassy.de/bush/bushbio_d.htm, Stand: 11.3.2003
- Vögele, Wolfgang, 1994: Zivilreligion in der Bundesrepublik Deutschland, Gütersloh: Kaiser
[...]
* Am Rande bemerkt: so sieht die in den westlichen Ländern geäußerte Sichtweise aus. Verwunderung würde der Satz erzeugen: ´George W. Bush kämpft gegen die irakischen Truppen´. Auch die Version ´Bush kämpft mit Hussein´ würde als unpassend empfunden werden. Stattdessen also: ´Amerikanische und Britische Truppen kämpfen gegen den Diktator Hussein´. Pointiert ausgelegt: Eine internationale Mehrheit von Vielen kämpft gegen eine singuläre Inkarnation des Bösen! So gelesen, hätte der scheinbar harmlos und neutral beschreibende Satz schon eine gehörige Portion religiöser Simplifizierung bei gleichzeitiger wuchtiger moralischer Aufladung in sich.
* Wie diese rechtliche Unverbindlichkeit in der Praxis gehandhabt wird und dass der gesellschaftliche Druck für den Einzelnen in eine de facto-Verbindlichkeit mündet, sei in diesem Falle zunächst unberücksichtigt gelassen, da der Focus hier auf den Ideen und der Theorie liegen soll.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes?
Der Text befasst sich mit dem Konzept der Zivilreligion, insbesondere in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika. Er untersucht die Theorien von Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville und Robert N. Bellah, um ein umfassendes Verständnis der amerikanischen Zivilreligion zu entwickeln.
Wer sind die Hauptpersonen, deren Theorien analysiert werden?
Die Hauptpersonen sind Jean-Jacques Rousseau, Alexis de Tocqueville und Robert N. Bellah. Rousseau wird als der ´Urvater´ der Zivilreligionstheorie betrachtet. Tocqueville analysierte die Zivilreligion in Amerika im 19. Jahrhundert, und Bellah entfachte die Debatte im 20. Jahrhundert neu.
Was ist Rousseaus Theorie der Zivilreligion?
Rousseau argumentierte, dass der Staat eine bürgerliche Religion brauche, um den Zusammenhalt und die Loyalität der Bürger zu fördern. Diese Religion sollte einfache, wenige Dogmen haben, wie den Glauben an eine Gottheit, ein zukünftiges Leben, Belohnung für Gerechte und Bestrafung für Böse, sowie die Heiligkeit des Gesellschaftsvertrages. Intoleranz sollte nicht toleriert werden.
Welche Kritik wird an Rousseaus Theorie geübt?
Rousseaus Theorie wird kritisiert, weil sie intolerant gegenüber Andersgläubigen ist und dem Individuum keine Religionsfreiheit gewährt. Die Bekenntnispflicht zur Zivilreligion wird als Einschränkung der Freiheit angesehen und sein Modell der Zivilreligion wird als nicht mehr anwendbar auf die heutige Zeit angesehen.
Wie beschreibt Tocqueville die Rolle der Religion in Amerika?
Tocqueville sah die Religion in Amerika als eine politische Institution, die zur Erhaltung der Demokratie beiträgt. Er argumentierte, dass die Religion die Menschen dazu bringt, sich nicht nur auf materielle Güter zu konzentrieren und dadurch die Freiheit sichert. Er glaubte auch, dass die Katholiken in Amerika aufgrund ihres Minderheitsstatus die Gleichheit der Bedingungen am meisten begünstigen.
Welche Probleme werden mit Tocquevilles Theorie angesprochen?
Es wird argumentiert, dass Religion die politische Freiheit negativ beeinflussen kann, da sie auch absolute Königtümer stärken kann. Es besteht die Gefahr, dass die Vergöttlichung des Staates in Imperialismus ausartet. Es wird auch argumentiert, dass Tocqueville die Verbreitung der religiösen Wahrheit nicht so wichtig fand wie die Verbreitung pädagogischer Ansichten.
Was ist Bellahs Verständnis von Zivilreligion in Amerika?
Bellah argumentierte, dass in Amerika ein gesellschaftsumfassender religiöser Konsens jenseits der traditionellen Religionen besteht. Diese Zivilreligion drückt sich in Überzeugungen, Symbolen und Ritualen aus, die in politischen Reden und Handlungen sichtbar werden.
Wie haben Bürgerkrieg und andere Ereignisse die amerikanische Zivilreligion beeinflusst?
Bellah argumentierte, dass große Ereignisse wie der Bürgerkrieg die Zivilreligion weiterentwickelt haben. Abraham Lincoln integrierte Themen wie Tod, Opfer und Wiedergeburt in die Zivilreligion. Auch der Zweite Weltkrieg und der Vietnamkrieg haben die Rolle Amerikas in der Welt verändert.
Welche Bezüge werden zwischen Bellah, Rousseau und Tocqueville hergestellt?
Bellah bezieht sich auf Rousseau als den Schöpfer der ursprünglichen Konzeption der Zivilreligion und auf Tocqueville als den ersten, der sich explizit mit der amerikanischen Zivilreligion auseinandersetzte. Alle drei Theoretiker instrumentalisieren die Religion für den Staat, aber ihre Ansätze unterscheiden sich im Detail.
Was sind die aktuellen Debatten und Ausblicke bezüglich der Zivilreligion?
Die aktuelle Debatte dreht sich um das kollektiv getragene religiöse Weltbild eines Gemeinwesens, ausgedrückt durch Symbole und Rituale. Die Wandlung von Glaubenssätzen, die Aktivierung zivilreligiöser Einstellungen und die Sanktionierung von Devianz sind weitere diskutierte Punkte. Einige Forscher schlagen vor, den Begriff "Zivilreligion" in die Kategorie einer "diffusen Religion" einzuordnen.
Welche Schlussfolgerungen werden in dem Text gezogen?
Der Text kommt zu dem Schluss, dass die Existenz und Bedeutung der Zivilreligion für das amerikanische Selbstverständnis und die Rhetorik amerikanischer Politiker nicht mehr in Abrede gestellt werden kann. Die theoretischen Ansätze bilden jedoch ein recht fragiles Gerüst, und es besteht noch ein enormer Arbeits- und Forschungsbedarf.
- Citar trabajo
- Benjamin Miethling (Autor), 2003, Zivilreligion in Amerika - eine Auseinandersetzung mit Tocqueville, Rousseau und Bellah, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109138