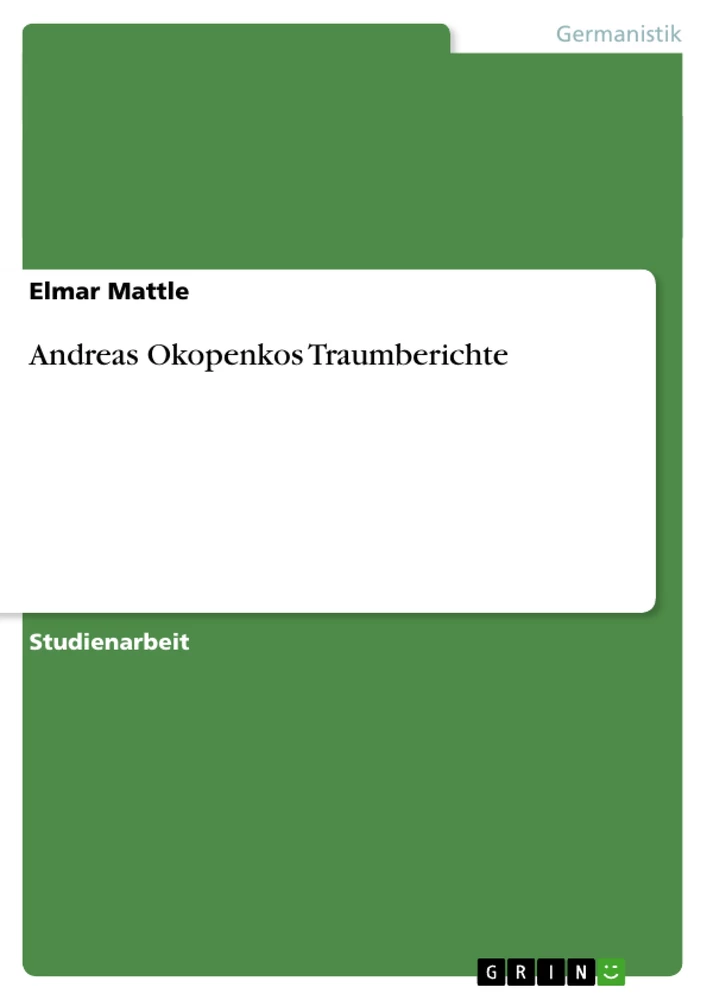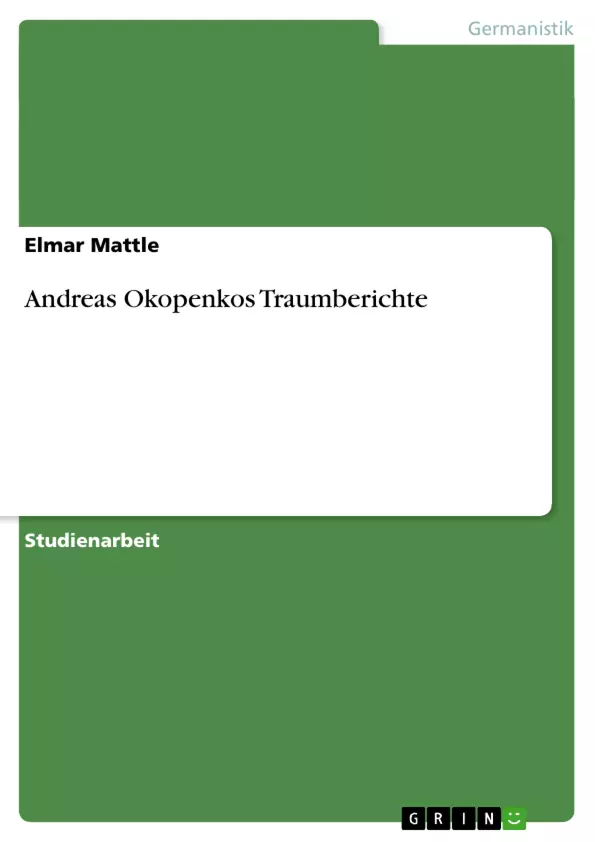Inhaltsverzeichnis
1) Vorwort
2) Von „Anfällen“ und der Poetik des Fluidums
3) Okopenko zwischen Tradition, Konkretionismus und totalem Realismus
4) Die österreichische Nachkriegsliteratur und der Surrealismus
4.1) Okopenkos Weg – mit und ohne André Breton
5) Exkurs: Carl Rogers Klientenzentrierte Gesprächstherapie
6) Traumberichte – mehr als 300 Beispiele für Mensch- und Träumersein
7) Literaturverzeichnis
1) Vorwort
In der vorliegenden Arbeit sollen mehrere quasi unmögliche Dinge zugleich versucht werden: Einerseits ist es unerlässlich für das Verständnis des gesamten Werkes Andreas Okopenkos, sich eingehend mit seinem poetologischen Konzept zu beschäftigen, andererseits soll ein Buch besprochen werden, das aus über 200 größtenteils unzusammenhängenden Träumen besteht.
Ziel ist es nun zuerst, einen möglichst kompakten und übersichtlichen Überblick über die theoretischen Schriften Okopenkos zu liefern – zweifelsohne eine Aufgabe, die ob ihres Umfangs und ihrer Komplexität, sehr anspruchsvoll ist. Natürlich werden alle Bereiche möglichst eng mit dem Thema „Traum“ und „Realität“ in Bezug gesetzt, denn nur so kann gewährleistet werden, dass die Ausführungen nicht zu weitläufig werden. Dabei spannt sich der Bogen vom Fluidumerlebnis über Okopenkos Konkretionismus hin zu einem Vergleich zwischen Okopenko und André Breton, der zeigen soll, inwieweit Bezüge und Differenzen zwischen den beiden Autoren gegeben sind. Ein kurzer Exkurs in die Psychologie stellt die vom Autor bevorzugte Traumtheorie vor. Die von Carl R. Rogers begründete Klientenzentrierte Gesprächstherapie und die damit verbunden Ansichten über das Träumen entsprechend laut Okopenko am ehesten seinen Vorstellungen. Abschließend soll natürlich noch dem Buch selbst ein Kapitel gewidmet sein. Da der Autor selbst eine Interpretation verbietet und eine klassische Analyse fast unmöglich ist, soll nur ein Überblick geliefert werden, der zum einen die vielen verschiedenen, von Okopenko behandelten Themen aufzeigen soll, und zum anderen veranschaulichen soll, ob und wie es Okopenko gelungen ist, seine gesteckten Ziele zu erreichen bzw. seine Theorie in die Praxis umzusetzen
2) Von „Anfällen“ und der Poetik des Fluidums
Andreas Okopenko ist ein Vertreter einer sehr individualistischen Dichtungstheorie, die er bereits seit seiner Jugend erforscht und beschreibt. Wenn Okopenko im Nachwort der Traumberichte von „Erleben des ‚Fluidums’“[1] spricht, so zieht sich diese Diktion durch sein ganzes Leben und Werk. Allerdings scheint er 1998 eine – für ihn – befriedigende Definition des Fluidums gefunden zu haben, wohingegen er in den Aufsätzen und Aufzeichnungen der 50er, 60er und 70er Jahre um eine passende Beschreibung ringt. Die „gefühlsstarke Wahrnehmung des unverwechselbaren Hier und Nun beim Erfahren eines Eindrucks“[2] erscheint auf den ersten Blick als banal und alltäglich, entpuppt sich aber bei genauerer Betrachtung von Okopenkos Abhandlung[3] als komplexer, schwer zu beschreibender und alles andere als alltäglicher Prozess. Dass sich die Traumwelt als Ort dieser „Wahrnehmung“ anbietet, macht die Fluidum-Theorie in Zusammenhang mit den Traumberichten natürlich umso interessanter. Genauso wie er in seinen Traumberichten „eines der zahllos möglichen Beispiele für Menschsein und Träumersein bieten“[4] will, wäre Okopenko glücklich, wenn sein „dichterisches Vermächtnis“, wie er seinen theoretischen Aufsatz nennt, „nicht als ein Denkmal in der Gegend herumstände, sondern Mitmenschen zum Aha-Sagen brächte, weil sie ähnliches Erleben kennen“[5].
Hinsichtlich der Mitteilbarkeit eines Fluidums ist Okopenko recht skeptisch (er nennt es „Sagbarkeitsproblem“), sieht hauptsächlich in der Lyrik eine Möglichkeit und stellt fest, dass in „unlyrischen Ablaufberichten“, wie es die Traumberichte sind, die Wahrscheinlichkeit, ein Fluidum zu vermitteln, eher gering ist. Trotzdem glaubt Okopenko, dass eine „möglichst präzise, dem einmaligen Augenblick spezifisch entsprechende Darstellung der […] Wirklichkeit“ ein praktikabler Weg der Mitteilung ist. Dieser „existenzielle“ bzw. „totale Realismus“, der auch das Surreale (vgl. Kapitel ) mit einbezieht, bildet eine der Grundlagen seines Poetikkonzepts. Aus der Schwierigkeit der Mitteilung eines Fluidums resultiert auch seine Beschreibung. Er definiert zuerst, was das Fluidum alles nicht (nur) ist: „Das Fluidum ist demnach kein Aufnahmemodus der Umwelt, der sich auf ein einzige Komponente beschränkt oder sich bloß einem einzelnen Detail verdankt“[6]. Bewunderung der Schönheit ist kein Kriterium, denn auch hässliche oder unangenehme Erlebnisse können ein Fluidumerlebnis erwirken (genauso wie viele Träume[7] ). Das „Gespür von Schicksalschwere“ und „Erinnerungslust“ sind genauso wenig zwingend Elemente von Fluiden, können aber mitwirken. Okopenko weist darauf hin, dass es auch fluidische Gegenwart geben kann. Eine Konzentration auf (intellektuell) Interessantes wird ebenso ausgeschlossen wie die Möglichkeit, Fluiden seien „die Frucht irgend eines Glaubens“, wiewohl Okopenko nicht abstreitet, dass beides einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Entstehung von Fluiden haben kann.
Am ehesten könnte man ein Fluidum als „Anwandlung, Erleuchtung [oder] Blitz“[8] sehen, vielleicht ist der Vergleich mit dem sechsten Sinn auch nicht zu weit her geholt, der unter anderem auch in Verbindung mit den übrigen fünf Sinnen steht (im weitesten Sinne also ein psychische Erscheinung). Das Fluidum ähnelt „am ehesten einem ‚anwehenden’ Geruch […], den man nur in ‚tastenden’ Worten beschreiben kann (man kann nicht!)“[9]. Demnach ist es auch laut Okopenko ein Phänomen der außersprachlichen Wirklichkeit bzw. des vorsprachlichen Denkens, aus dem unter anderem der Surrealismus zu schöpfen weiß. Diese affektive Komponente, die Okopenko als „Anfall“ beschreibt, ist mit der „neuen Schau, die Expressionismus, Dada und Surrealismus verkündet haben“[10] verwandt. Besonders wichtig für das Zustandekommen eines Fluidums ist die Haltung und Einstellung des Betrachters. Er muss der Welt gegenüber aufgeschlossen reagieren und für neue Reize und Erfahrungsmöglichkeiten offen sein.
Ein Fluidumerlebnis ist prinzipiell also immer möglich, meist aber unwillentlich und sein Auftreten verringert sich, wenn „kommunikative Frustrationen“[11] im Leben Okopenkos auftreten, die durch seine Partnerin und/oder durch die Unmöglichkeit der Mitteilung in Lyrik bzw. Prosa auftreten können. Das Mitteilen von Fluiden war (und ist) Okopenkos wichtigstes Anliegen und gleichzeitig größtes Hindernis. Dieses Ringen um den adäquaten Transport von Fluiden kann man auch in den Traumberichten finden. Die Verbindung und Mitteilung von Träumen und den quasi „erlebten“ Fluiden stellt dahingehend eine große Herausforderung dar. Okopenko, der sich selbst als seismographischen Beobachter und Traumberichterstatter sieht, versucht in seinen Traumberichten Träume/Fluiden wiederzugeben, die er sich in Erinnerung ruft und/oder protokolliert hat, „d.h. ein Fluidum kann auch erinnert werden, als Erinnerungsfluidum oder fluidische Erinnerung ins Bewusstsein gelangen“[12].
3) Okopenko zwischen Tradition, Konkretionismus und totalem Realismus
Um Okopenkos poetische Theorie und Praxis verstehen zu können, ist es unumgänglich, neben seinem Aufsatz zur Fluidumtheorie (vgl. Kapitel ) auch seinen Text zum so genannten Konkretionismus[13] zu kennen. „Als Praktiker will ich verstanden werden, und als Praktiker schreibe ich auch diesen Aufsatz“[14], stellt Okopenko fest, der sich natürlich über die Bedeutung einer ausgereiften Theorie für die Praxis bewusst ist. Die Tatsache, dass er sich in den 50er Jahren weder in der traditionellen Literatur noch in der konkreten Poesie oder Avantgarde zu Hause fühlte, führte zu einem „Zwischen-den-Fronten-Stehen“ und war immer wieder Teil seiner Werke:
„Weil ich nicht blasiert sondern begeistert -, nicht ‚innersprachlich’ sondern ‚gegenständlich’ – (Realismus), nicht zitatbetont, sondern erlebnisbetont (‚Freiheit die ich meine’) schreibe, weil mich Landschaften und Zweierbeziehungen emovieren, Zweierbeziehungen sogar übern elementaren Sex hinaus, habe ich mich in eine Harakiri-Position begeben. Achgott, die Avantgarde will mich nicht, und achgott, in der konservativen Dichtung hab ich schon gar nichts verloren.“[15]
Eine Einordnung Okopenkos in eine literaturwissenschaftliche Schublade erscheint ihm selbst aber auch Literaturwissenschaftlern und –kritikern als unmöglich. Selbst Adolf Haslinger versucht in seinem Aufsatz Der Einzelgänger und sein Mitteilungs-Bedürfnis [16] eine solche Charakterisierung und stellt damit ihr Scheitern dar. Haslinger verwendet Schmidt-Denglers Polaritätspaare als Beschreibung eines dreifachen Gegensatzes zwischen Tradition und Avantgarde[17] [18]:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bei diesem letzten Kriterium sieht sich Haslinger zu Recht vor einem Dilemma stehen und wirft die Frage auf, wo Okopenko nun wirklich steht. Um einen halbwegs befriedigende Antwort zu finden, ist es unumgänglich, den bereits oben erwähnten Aufsatz Konkretionismus heranzuziehen:
„Seit jeher glaube ich (leider muss dies ewig Glaube bleiben), dass es eine von unserem Bewusstsein unabhängige Wirklichkeit gibt, und bin damit definitionsgemäß Realist.“[19] Er geht darüber hinaus davon aus, dass wir mit unseren Sinnesorganen und unserem Gehirn einen weiten Teil der „echten“ Wirklichkeit erfassen können und bezeichnet sich selbst als „naiver Realist“[20]. Er erteilt Schein-, Auszugs- oder Surrogatwelten eine Absage, für ihn liegt die Priorität in der Mitteilung und dem Erleben der „ziemlich echten Realität“[21]:
„Mein Realismus schließt neben vielem anderen auch die Realitäten des minderbewußten Lebens ein: etwa das Traumleben mit seinen Gesetzen, eine Traumlogik, dich ich auch im Wachen kenne, Phänomene, die der Surrealismus von innen und außen (aus dem ‚Zustand’ heraus oder über ihn ‚berichtend’) mitzuteilen versucht hat. Ich spreche deshalb, unterscheidend, von TOTALEM REALISMUS.“[22]
Diese sehr individuelle Art des Realismus präzisierte sich in den 50er Jahren zu einem Konkretionismus, unter dem Okopenko die dichterische Darstellung von Wirklichkeit in seinem Sinne versteht:
„Es ist also nicht nur die unabhängig von unserem Bewusstsein existierende Wirklichkeit anzuzielen, sondern dies soll in möglichst konkreter, (auf die Dinge, auf den Einzelfall) ‚bezogener’ Weise geschehen.“[23]
Aus der Theorie des Konkretionismus entwickelt sich nun die Forderung nach Spezifikation und Präzision, die durch eine detailgetreue Wiedergabe von Dingen und Ereignissen des Autors in eine „Präzision der Erfassung“[24] durch den Rezipienten münden sollen. „Diese POLLEGUNG [zwischen Autor und Leser] zum Erzielen eines adäquaten Stromes im Leser […] ist ein ganz wichtiges Geheimnis der Mitteilungstechnik.“[25]
Das erwünschte Ziel des Konkretionismus (und damit seiner Dichtung) ist jedoch die Übertragung des vom Autor erlebten Fluidums auf den Mitmenschen. Diese letzte Stufe – das Fluidumerlebnis und seine Wiedergabe – unterscheidet sich von der spezifizierten Konkretion in seiner Intensität und unterliegt dem Sagbarkeitsproblem (vgl. Kapitel ), das allerdings - wenn überhaupt - nur durch „konsequente Konkretion“[26] ausgedrückt werden kann.
Okopenko verwendet also zur Beschreibung seiner Dichtungstheorie eine vierteilige Stufenleiter: Realismus – Konkretion – Spezifikation/Präzision – Fluidum. Er beschreibt in seinen Abhandlungen nicht nur seine eigene Vorstellung von Dichtung, sondern versucht auch Kritik an der „althergebrachten ‚poetischen’ Poetik“[27] zu üben. Er spricht in seinem Aufsatz zum Beispiel von einer Krankheit namens „Allegorismus“, die seiner Meinung nach zur Folge hat, dass auch scheinbar konkrete Worte (so genannte „Pseudokonkreta“[28] ) und angebliche Schilderungen der Wirklichkeit allegorisch verzerrt werden. Darüber hinaus kritisiert er die übermäßige Ausschmückung eines Gedichts mit nichts sagenden Beiwörtern und leeren Phrasen. Okopenko, der sich strikt an das Weglassen dieses Ballasts gehalten hat, sieht darin den Grund für die Ablehnung seiner Gedichte in den 50er und 60er Jahren. Ebenfalls in diese Zeit fällt die Übernahme und „Bewunderung [in der österreichischen Literatur] für einen uneigentlichen, nämlich geschönten, nichtautomatischen Surrealismus“[29]. Diese sehr ambivalente Verhältnis Okopenkos zum Surrealismus wird im nächsten Kapitel näher zu betrachten sein.
3) Die österreichische Nachkriegsliteratur und der Surrealismus
„A surrealist in Vienna must feel as lonely und misplaced as an Eskimo in Darkest Africa, for in this city, probably more than in any other capital in Europe, art is conventional to a picture postcard degree.”
Wenn James Gordon in den Morning News vom 18. Jänner 1947 eine solche Aussage tätigt, so stellt sich natürlich die Frage, inwieweit der Surrealismus, der offensichtlich in Österreich nur begrenzt auf fruchtbaren Boden gefallen ist, die Literaturlandschaft im Allgemeinen und Okopenko im Besonderen beeinflusst hat. Okopenko selbst beschreibt die Rolle und den Einfluss des Surrealismus in seinem Aufsatz Die schwierigen Anfänge österreichischer Progressivliteratur nach 1945 von 1975 folgendermaßen:
„Der Surrealismus war bei uns – zum Unterschied von anderen zeitgenössischen Gruppen – nie orthodox und sektiererisch gemeint, spielte aber, weil er neben dem angeblichen Pessimismus das augenscheinlich Provokanteste an uns war, in unserem Kampf (nicht ganz verdientermaßen) die Hauptrolle.“[30]
Wie kommt es nun, dass ein Einzelgänger wie Okopenko von „uns“ spricht und um welchen „Kampf“ handelt es sich? Nach 1945 hielt – etwas verspätet – die Moderne Einzug in die österreichische Literatur und mit ihr formierten sich erstmals junge Autoren, die versuchten, avantgardistische und progressive Literatur dem konservativen Stilideal entgegenzusetzen. Durch die Bildung von Arbeitsgruppen und Schaffung von Publikationsmöglichkeiten sollte diese neue Art von Literatur einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Um 1950 hatten es unter anderem Okopenko, Artmann, Altmann und Weißenborn geschafft, mit der Kulturzeitschrift Neue Wege eine Plattform für junge Autoren zu bilden. „Bei den ‚Neuen Wegen’ bildete sich erstmals etwas wie eine Front heraus, erste öffentliche und streitbare Manifestation des Experimentellen in der österreichischen Nachkriegliteratur.“[31] Eine einheitliche Linie gab es jedoch nie, zu vielfältig waren die Ausprägungen, Intentionen und Einflüsse der Autoren. Nach der Einschätzung Okopenkos waren insbesondere der Maler Edgar Jené mit seinem Umfeld und der Österreichische Art-Club maßgeblich an einer „Surrealisierung Österreichs“[32] beteiligt. Durch die (zunehmende) Inhomogenität dieser Autorengruppe bildeten sich in jener Phase drei verschiedene Flügel, die den Einfluss des Surrealismus unterschiedlich aufnahmen und umsetzten:
„1. Der künstlerisch rechte Flügel (Dienel, Eisenreich, Nahlik, Polakovics, Strobach), traditionsbewusst, auf ‚Zucht’ bedacht, im Schreiben konservativ, im Urteil dem Modernen aufgeschlossen, dem Unkontrollierbaren – dem Surrealen – abhold.
2. Der künstlerisch linke Flügel (Altmann, Artmann, Diem, einige Mitläufer; zeitweise Hauer, Schmied, Weißenborn), im Lebensgefühl extrem und provokant antibürgerlich, rauschig; dem ‚surrealen Akt’ geneigt und zum Unterschied von den anderen Gruppen öfters (unter Artmanns Führung) geschlossen auftretend; im Urteil von genialischer Unberechenbarkeit; im Schreiben meist nur durch Eluardschen Litaneienstil und übermütige bis alogische Elemente als ‚Surealisten’ legitimiert; echt surreale Texte schrieben Diem und gelegentlich Artmann.
3. Die Mitte (Ebner, Fritsch, Kein, ich u. a., zuzeiten sekundiert von den Labileren des linken Flügels), nüchternen Gehabens, kritisch nach beiden Seiten, aussagebetont modernistisch und fernab surrealem Lebensgefühl surreale Elemente als Ausdrucksmittel pachtend. (Ich selbst war vom Surrealismus par distance fasziniert, zeichnete in Allein- und Gemeinschaftsversuchen – zum Beispiel oft mit Artmann – Minderbewusstes auf, als Labor-Surrealist Gegenpol des Ästheten ‚h. c.’.)“[33]
Wie man aus diesem Zitat recht leicht herauslesen kann, erfolgte in Österreich die Aneignung des Surrealismus im Wesentlichen als Stil, im Besonderen auf Okopenko bezogen als Gestaltungsmittel und Stilform. Trotzdem (oder vielmehr deswegen) hatten diese jungen österreichischen Autoren mit massiven Widerstand der breiten Öffentlichkeit zu kämpfen. Besonders Okopenko, der immer seinen eigenen künstlerischen Weg ging und sich dabei oft zwischen extremen Polen bewegte, sah sich in dieser Zeit mit vielen Vorwürfen konfrontiert. Übertriebene Bissigkeit und angebliche Verrücktheit wurden ihm vorgeworfen und eine breite Front aus Politikern, Autoren, Eltern, Lehrern und Schülern formierte sich gegen ihn und seine Kollegen. Nicht zuletzt durch die Forderung der Jugendsektion des Schriftstellerverbandes, ein Schreibverbot für diese Autorengruppe zu verhängen, entstand bei vielen ein „Partisanengefühl“[34]. In dieser Zeit des Kalten Krieges traten die ersten Zerfallserscheinungen innerhalb der jungen Autorenschaft hervor, auf der einen Seite Resignation dem politischen und gesellschaftlichen System gegenüber und auf der anderen Seite persönliche Dichtungskrisen verbunden mit einer Flucht „in das irrationale Glück surrealen Lebensgefühls und –genusses“[35]. Besonders die „linke Gruppe“ versuchte ihr Glück im Separatismus, der mehr und mehr zu einem Zerbrechen des fragilen Autorencorpus führte. Der linke und der rechte Flügel entfremdeten sich zusehends – die Mitte (und mit ihr Okopenko) ging ihren eigenen Weg.
3.1) Okopenkos Weg – mit und ohne André Breton
Auch wenn sich Okopenko selbst zu der mittleren Gruppe zählt und sich deshalb nie als Surrealist bezeichnet hätte, ist doch der Einfluss des Surrealismus (und im Besonderen André Bretons) auf seine Traumtheorie und Poetik bemerkenswert. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich Okopenko eingehend mit Bretons Manifest des Surrealismus beschäftigt hat. Im Folgenden soll versucht werden, Parallelen aufzuzeigen und Unterschiede herauszuarbeiten:
BRETON
„Surrealismus, Subst., m. – Reiner psychischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denk-Diktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft, jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Überlegung.“ (MdS. 26)
OKOPENKO
„Hauptmerkmal der modernen Lyrik ist es, ein Gefühl nicht erst zu nennen und dem anderen somit von außen zu servieren, sondern es Worte treiben zu lassen, die das Gefühl in dem anderen wachrufen.“ (OeE, S. 48)
„[...] Träume, die ich mir hier ausverleibe [...]“ (Traumberichte – Nachwort, S. 203)
Betrachtet man diese zwei Zitate zum dichterischen Schreibvorgang genau, so wird man feststellen können, dass sie Ähnliches auszudrücken versuchen, aber trotzdem viele Unterschiede (vor allem in der Zielsetzung) aufweisen. Breton spricht in seiner lexikalischen Definition von Surrealismus von einem „psychischen Automatismus“, der den Ablauf des Denkens (und - um hier eine Parallele zu Okopenko zu ziehen - des Gefühls) wiedergeben soll, wohingegen Okopenko eine etwas abgeschwächte Form des „Worte-treiben-Lassens“ benutzt. Beide Varianten betonen die Passivität der Vernunft und streben eine „Ausverleibung“ des Innersten an. Diese Gefühle, Gedanken und Stimmungen (bei Okopenko auch Fluiden), die so ohne Kontrolle durch die Ratio an die Oberfläche gelangen, erfüllen jedoch einen unterschiedlichen Zweck: Breton beschreibt eine „écriture automatique“, die einen gewissen Selbstzweck erfüllt und nicht zwingend für eine Leserschaft „nützlich“ (oder wie auch immer „verwertbar“) sein soll. Okopenko hingegen verfolgt mit seiner Lyrik und der damit verbunden Schreibweise ein ganz bestimmtes Ziel, nämlich die Übertragung von Fluiden, also das Hervorrufen von (bestimmten) Gefühlen im Leser (vgl. Kapitel ).
BRETON
„Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität.“ (MdS, S. 18)
OKOPENKO
„Mein Realismus schließt neben vielem anderen auch die Realitäten des minderbewußten Lebens ein: etwa das Traumleben mit seinen Gesetzen, eine Traumlogik, die ich auch im Wachen kenne, Phänomene, die der Surrealismus von innen und außen (aus dem „Zustand“ heraus oder über ihn berichtend) mitzuteilen versucht hat. Ich spreche deshalb, unterscheidend, von TOTALEM REALISMUS.“ (OeE, S.51)
„Träume zählen für mich zur anfaßbaren Realität.“ (Traumberichte – Nachwort, S. 203)
Breton fordert eine Auflösung des Gegensatzes – also eine Synthese - von Traum und Wirklichkeit und weigert sich das Träumen als weniger real anzusehen als die Wahrnehmung im Zustand des Wachseins. „Breton geht es nicht darum, mit einer jenseitigen Welt in Kontakt zu treten, sondern darum, die Totalität der menschlichen Erfahrungsweisen wiederherzustellen.“[36] Dieser Zugang zu einem Bereich der menschlichen Psyche kann laut Breton scheinbar unverständliche Handlungen erklären und Nutzen für unser zukünftiges Handeln bringen:
„Wenn die Tiefen unseres Geistes seltsame Kräfte bergen, die imstande sind, die Oberfläche zu mehren oder gar zu besiegen, so haben wir allen Grund, sie einzufangen […] und danach, wenn nötig, der Kontrolle unserer Vernunft zu unterwerfen.“[37]
In seiner Abhandlung über das Träumen verweist Breton explizit auf Freud, der durch seine Forschungen und Entdeckungen ein neues Gebiet der Psychologie eröffnet hat. Allerdings scheint seine Kenntnis über Freuds Theorien nur oberflächlich zu sein, denn mehrere wichtige freudsche Elemente sind in Bretons Schriften nicht zu finden (unter anderem die Unterscheidung von „Trauminhalt“ und „Traumgedanken“ und der Begriff der „Traumarbeit“).
Im Gegensatz dazu lehnt Okopenko Freuds und Jungs Traumtheorie ab, die er als „starre Deutungslexiken“ beschreibt, und bevorzugt die Traumtheorie von Carl Rogers (siehe dazu Kapitel ). Auch wenn die wissenschaftliche Basis hier eine unterschiedliche ist, so kann man eindeutige Übereinstimmungen zwischen Breton und Okopenko finden. Beide sprechen sich für eine Miteinbeziehung des Traumes in die Realität aus, „anfassbar“ auf der einen Seite und nutzbringend auf der anderen Seite. Allein die Begriffe unterscheiden sich: Während Breton von einer „absoluten Realität / Surrealität“ spricht, fasst Okopenko seine Definition etwas weiter und nennt sie „totale Realität“. Grundsätzlich lässt sich in diesem Bereich also eine weitgehende Übereinstimmung feststellen.
BRETON
„[...], daß der Surrealismus einfach danach strebt, unser gesamtes psychisches Vermögen zurückzugewinnen auf einem Wege, der nichts anderes ist als der schwindelnde Abstieg in uns selbst, die systematische Erhellung verborgener Orte und die progressive Verfinsterung anderer, [...]“. (MdS, S. 65)
OKOPENKO
„So bin ich auch als Traum- berichterstatter nicht anders Realist als in meinen Protokollen der Lyrik und Prosa, [...].“ (Traumberichte – Nachwort, S. 204)
„Das Buch soll mit dem einzigen Ehrgeiz von Genauigkeit eines der zahllos möglichen Beispiele für Menschsein und Träumersein bieten.“ (ebenda)
Es wurde bereits von der Erkundung der Tiefen des Menschen gesprochen und von deren Integration in die Realität, die sowohl Breton als auch Okopenko fordern. Als Methode dazu dient eine „systematische Erhellung verborgener Orte“, also ein genaues Protokollieren von Gefühlen, Gedanken, Träumen und Stimmungen. Diese dokumentarische Absicht, das Erstellen von Traumprotokollen und der Wille zur wissenschaftlichen Erforschung verbinden Breton und Okopenko eng miteinander, selbst ihre Berufe bzw. ihre Studien weisen eine gewisse Affinität zur exakten Erforschung, Dokumentation und Protokollierung auf (Breton begann ein Medizinstudium und arbeitete zeitweise als Psychiater, Okopenko brach sein Chemiestudium ab und war eine Zeit lang als Betriebsabrechner angestellt).
Auch im Zweck dieser Erforschung haben die beiden Autoren große Übereinstimmungen vorzuweisen: Zwar verwenden sie andere Worte, aber letztendlich ist es ihr Ziel, den Mensch in seiner Gesamtheit darzustellen und durch ihr Schreiben zu einer Synthese von Traum und Wirklichkeit zu gelangen.
4) Exkurs: Carl Rogers Klientenzentrierte Psychotherapie
Es ist nicht verwunderlich, dass sich Okopenko mit Träumen nicht nur literarisch, sondern auch wissenschaftlich-psychologisch auseinander gesetzt hat. In seinem Nachwort zu den Traumberichten weist er darauf hin, „am ehesten […] noch die Auffassung von [Carl R.] Rogers“[38] zu teilen. Was aber unterscheidet nun Rogers’ Theorie von den „starren Deutungslexiken von Freud, Jung, etc.“[39] ?
Der Amerikaner Carl Ransom Rogers (1902-1987) gilt als der Schöpfer der „Personen- oder Klientenzentrierten Psychotherapie“ und muss als strikter Gegner Freuds gesehen werden. So lässt sich auch die Tatsache erklären, dass Rogers in seinen frühen Arbeiten dem Traum kaum Beachtung geschenkt hat und seinen Stellenwert in der Therapie als eher gering eingestuft hat. „Zumindest der späte Rogers scheint aber doch Träume als Ausdruck einer höheren Bewusstseinsform und damit als sehr bedeutsam für die Person einzuschätzen.“[40] Im Zusammenhang von Wirklichkeit und (totaler oder Sur-)Realität spricht Rogers davon, „dass die menschliche Psyche Fähigkeiten und Potentiale besitz, die fast unbegrenzt zu sein scheinen“[41]. Er fordert deshalb die Wissenschaft, aber auch jeden einzelnen Menschen auf, „über unsere intuitiven Fähigkeiten, unsere Gaben, mit unserem gesamten Organismus zu fühlen, noch viel mehr in Erfahrung […] bringen“[42]. Auch und besonders Träume müssen in dieser Hinsicht als Fähigkeiten gelten, die eine spezifische persönliche Bedeutung haben und die für die Entwicklung (und die Therapie) entscheidende Wichtigkeit haben können.
Eine umfassende und wissenschaftliche Theorie zur Bedeutung des Traums wurde erst von Rogers Schülern und Nachfolgern konzipiert. Eugene Gendlin, Jerry Jennings und Jobst Finke entwickelten in den 70er und 80er Jahren Theorien und Konzepte im Sinne Rogers, wie der Traum aufgebaut sein könnte und wie ihm begegnet werden soll. Demnach sind Träume Erlebnisprozesse, die einerseits unfertig sind, andererseits aber zugleich wichtige persönliche Bedeutungen beinhalten[43]. Diese persönlichen Bedeutungen sollen daher auch nicht von außen (also vom Therapeuten), sondern vom Träumer selbst ausgelegt werden – eine Interpretation im Sinne Freuds wird hier also strikt abgelehnt. Träume stellen eine Art Brücke zwischen unbewusstem und bewusstem Erleben dar und besitzen ein wichtiges Erfahrungs- und Erkenntnispotential. „Sie ermöglichen dem Träumer ‚ergänzende intelligente Perspektiven’ zu seiner Welt, seinen Beziehungen und seinem Selbst.“[44] Die Bedeutung eines Traums trägt dieser in sich selbst und ist nicht als Symbol für einen anderen Inhalt aufzufassen, die chronologische Abfolge von Bildern und Ereignissen ist Produkt einer inneren „Logik“[45]. In der Klientenzentrierten Psychotherapie geht es darum, „die gefühlte ganzheitliche Bedeutung des Traumerlebens zu finden und zu entfalten, und nicht darum, eine gemeinte Bedeutung davon zu formulieren“[46]. Im Sinne Rogers kann also der Traum als Ausdruck der Aktualisierungstendenz des Organismus gesehen werden. Diese Aktualisierungstendenz ist nach Rogers eine angeborene Tendenz zur Selbstverwirklichung, weswegen der Traum auch immer in gewisser Weise auf die aktuelle Lebenssituation des Träumers Bezug nimmt (allerdings nicht als Wiederkehr des Verdrängten). Die Traumgestalten und –elemente beinhalten weiters durchwegs Aspekte der Person des Träumers, die – und hier liegt die Wichtigkeit für die Therapie - etwas über den Träumenden aussagen. Den adäquaten Zugang bietet allerdings Empathie und nicht Interpretation im Sinne Freuds. Darüber hinaus kennt die Klientenzentrierte Persönlichkeitstheorie „wohl unbewusstes Erleben oder abgewehrtes Erleben, sie kennt aber [im Gegensatz zur Freud’schen Theorie] kein Unbewusstes als psychische Instanz, die einen großen teil unseres inneren Erlebens und äußeren Verhaltens steuert.[47] “ Es ist vielmehr der Organismus bzw. die Person als Ganzes die steuernde Instanz. Ähnlich wie Breton und Okopenko vergleichen Rogers und seine Nachfolger das Traumerleben mit dem Erleben in tiefer Meditation, im Drogenrausch oder unter Hypnose – alle diese Erlebensformen tragen Botschaften der Bedürfnisse, Mängel und Problem unseres Lebens in sich und gehören so „zur anfassbaren Realität“[48].
5) Traumberichte – mehr als 300 Beispiele für Mensch- und Träumersein
Sieht man sich nun Okopenkos Traumberichte genauer an, so wird man feststellen, dass es sich dabei um ein einzigartiges Projekt literarischer Selbstbeobachtung handelt. Einzigartig deswegen, weil vergleichbare Werke von Jack Kerouac, Elsa Morante oder Graham Green nicht diese Konsequenz aufweisen und darüber hinaus einen viel kürzen Zeitraum abdecken. Beginnend mit den 50er Jahren bis hin zur unmittelbaren Gegenwart hat Okopenko Träume und Traumsequenzen stichwortartig festgehalten. Die meisten davon noch in der entsprechenden Nacht, andere wurden von ihm nachträglich aus dem Gedächtnis geholt. Mit viel Ausdauer und Akribie hat Okopenko, auf dessen Nachtkästchen sich neben Trinkglas und Halogenlampe auch ein Block mit automatischer Beleuchtung befindet, diese Traum- und Halbwacherlebnisse protokolliert und „hat seine Textstücke der Zensur des Wachbewusstseins entzogen und sie dabei doch in sanfter Weise literarisch geformt“[49]. Okopenko hat die mehr als dreihundert Traumberichte zu Themenkomplexen geordnet und dabei ein weites Themenspektrum erfasst.
Im ersten Kapitel Träume zum Argwöhnen ist unter anderem ein Traum zu finden, der den Titel Politiker trägt und in dem Okopenko als Kremser Politiker die Aufgabe hat, „dem Bundespräsidenten das Projekt auszureden, in dieser Stadt einen Hafen zu bauen“[50]. Nach einem Telefonat mit Elfriede Gerstl muss der Träumer feststellen, dass sich der Präsident nicht durch die offensichtliche Unsinnigkeit, sondern nur durch zu hohe Kosten von der Realisierung dieses Projekts abbringen lässt. Von der Gesellschaftskritik führen Okopenkos Träume weiter zu den Suiten, in den ganze Szenenfolgen beschrieben werden. Hier tritt in einem unbetitelten Traum der leibhaftige Jean-Paul Satre zur Tür herein und kann auf eine Frage zu Welt und Hölle nur antworten: „Die Welt versteht unter Welt Welt, und bis dorthin reicht meine Kompetenz.“[51] Neben der Philosophie „verfolgt“ auch die Religion Okopenko im Traum. So wird er, nachdem er sich auf die Seite des Außenseiters unter den Kardinälen gestellt hat, von den übrigen Geistlichen auf eine „Todesliste“ gestellt und kann sich nur durch einfaches Aufwachen aus der Misere retten.
Sogar ein eigenes Kapitel mit Schöpfungen im Schlaf hat Okopenko in seinen Traumberichten untergebracht. In einem halbwachen Zustand und „ohne das Gefühl von geistiger Arbeit“ dichtete er erstaunlich komplexe Literatur:
„Schlafe, Kleines, aufbewahrt
in der Zigarettenkiste,
Vater ist auf großer Fahrt,
seit er dich ins Leben pisste.
Mutter ist im Irrenhaus,
seit sie dich ins Leben schiß,
und dein Leben ist bald aus.
Drum schlafe und vergiß.“[52]
Neben Anagrammen wie „God save Eva’s dog!“[53] finden sich auch noch viele halbfertige und fragmentarische Texte und Gedichte, die davon zeugen, dass es offensichtlich auch für Okopenko, dem es recht gut gelingt, Trauminhalte in den Wachzustand mitzunehmen, unmöglich ist, alles zu erinnern bzw. zu Papier zu bringen.
Es ist nicht verwunderlich, dass in einem Band, der Träume aus dem ganzen Leben beinhaltet, auch mehrere Kapitel zum Thema Leben und Tod zu finden ist. Zwar vom Umfang her verhältnismäßig gering gehalten, wird das ganze Spektrum von Leben, Lieben und Tod trotzdem intensiv und ausreichend abgedeckt. Angefangen von einem (Alb)traum, in dem sich der Autor „als zwei Packerln Aas neben dem weißen Herd in der Küche liegen“[54] sieht, bis hin zu verschiedenen Träumen, in den neben seinen beiden geschiedenen Frauen (im Traum „Siglinde“ und „Eva“[55] ) unterschiedlichste Frauentypen auftauchen (Prostituierte, Geliebte, Bekannte, Freundinnen, …).
Was wären natürlich Traumberichte ohne die fast obligatorischen Tierträume? Auch Okopenko kann einige Träume vorweisen, in denen sich er oder jemand anderer in ein Tier verwandelt (hat) oder Tiere einfach vorkommen. In Der Hecht [56] findet eine fast kafkaeske Verwandlung von Okopenko und seinem Freund Ernst Klein in einen Hecht statt, wohingegen in Arme Mayröcker [57] Elfriede Mayröcker als Hase offensichtlich den Tod gefunden hat. Direkt nach diesen fast schon belanglos anmutenden Tierträumen tritt wieder ein zutiefst menschliches Thema in den Vordergrund: die Angst. In Furcht vor der Furcht lassen sich typische sozialkritische Elemente, aber auch existenzielle Ängste finden. In zahlreichen Traumsequenzen thematisiert Okopenko Krieg und Gewalt. So sieht sich der Träumer als Soldat, der bald in den Krieg ziehen muss und dort auch sterben wird („Ich werde töten müssen und wohl getötet werden.“[58] ), oder muss mit ansehen, wie Menschen – darunter auch ein Säugling – gelyncht werden:
„Mir träumte vom Lynchen. Gelyncht wurde alles mögliche, verschiedene Männer, auch ein kleines Kind, was besonders gräulich mitanzusehen war; wie sein Kopf immer mehr zerschlagen und zermanscht wurde.“[59]
Neben diesen mehr oder weniger nachvollziehbaren Traumthemen widmet Okopenko dem Ofen ein ganzes Kapitel (Ofensichtlich). Das mag zuerst verwundern, wird aber von Okopenko im Nachwort (im Zuge seiner Ablehnung der Freud’schen Theorie) erklärt:
„So ist etwa der gefürchtete hohe Kachelofen für mich keine Übersetzung von Phallus sondern Erinnerung an ein gegenständliches kindliches Trauma, und sein Erscheinen im Traum kann eine Warnung vor einer Bedrohung im aktuellen Leben bedeuten, und mein Traumverhalten ein Durchprobieren, wie ich mich dieser Bedrohung stellen oder ihr ausweichen soll.“
Ein starker Bezug und eine große Übereinstimmung zur Klientenzentrierten Psychotherapie Rogers ist hier nicht zu übersehen. Der Traum und das Traumverhalten haben also für Okopenko ein hohes Erfahrungs- und Erkenntnispotential und bieten „ergänzende intelligente Perspektiven“[60].
In einem weiteren Kapitel Versauungen entfaltet sich das, was man (seit Freud) als die Symbolik des Geschlechtsaktes kennt. Auffallend ist nur, dass in Okopenkos Berichten gerade jenes Symbol fehlt, das der Stammvater der Psychoanalyse für das Wesentlichste gehalten hat. Nicht die harten, länglichen Formen dominieren, sondern die runden, fließenden. Überhaupt scheint alles in eine große, allumfassende Kugelwelt getaucht zu sein. Diese antike Eingebundensein in die Welt und der tiefe Einklang von Mensch und Gegenstand muss jedoch allzu oft verteidigt werden. So tauchen am Traumhorizont vielfältige Gefahren auf: Sternschnuppen, die ein Chaos verursachen[61], oder ein Komet, der die Erde bedroht[62]. In einem anderen kosmologischen Traum ist es die „böse Sonne D3“[63], die feindselig auf die Erde herabblickt. Anderswo zeigt sich als Zeichen des Untergangs eine so genannte „Begleit-Erde“[64], die vom Blauen Planten geboren wurde.
Ein Ende im herkömmlichen Sinn gibt es in den Traumberichten natürlich nicht. Allerdings hat Okopenko bewusst den Themenkomplex Ausblicke an den Schluss gestellt und rundet hier mit verschiedenen Zukunftsvisionen seine Traumberichte ab. Im letzten Traum blättert er sogar in „Photoalben, denen die weitere Geschichte der Erde bis zum Jahr 40.000 zu entnehmen ist“[65].
6) Verwendete Literatur:
- Okopenko, Andreas: Traumberichte (= Traumberichte), Linz: Blattwerk-Verlag 1998.
- Okopenko, Andreas: Fluidum. Bericht von einer außerordentlichen Erlebnisart (= Fluidum) , In: Protokolle. 1977, H2, S. 170-194.
- Okopenko, Andreas: Konkretionismus. Einkreisung eines apokryphen Stils (= Konkretionismus), In: Protokolle. 1978, H1, S. 93-127.
- Okopenko, Andreas: Die schwierigen Anfänge österreichischer Progressiv-Literatur nach 1945 (= Progessiv), In: Protokolle. 1975, H1, S. 1-16.
- Okopenko, Andreas: Vier Aufsätze. Ortsbestimmung einer Einsamkeit (= OeE), Salzburg / Wien: Residenz, 1979.
- Breton, André: Das Manifest des Surrealismus (= MdS), Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt-Verlag 1986.
- Bürger, Peter: Der französische Surrealismus. Studien zur avantgardistischen Literatur, Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag 1996.
- Fliedl, Konstanze & Gürtler, Christa (Hrsg.): Andreas Okopenko, Graz/Wien: Literaturverlag Droschl 2004.
- Haslinger, Adolf: Der Einzelgänger und sein Mitteilungs-Bedürfnis (= Haslinger), In: Walter-Buchebner-Gesellschaft (Hrsg.): Wiener Avantgarde einst und jetzt, Wien/Köln: Böhlau-Verlag 1990, S. 66-74.
- Kastberger, Klaus (Hrsg.): Andreas Okopenko. Texte und Materialien, Wien: Sonderzahl-Verlag 1998.
- Keil, Wolfgang W.: Der Traum in der Klientenzentrierten Psychotherapie (= Keil), In: Keil, Wolfgang W. & Stumm, Gerhard (Hrsg.): Die vielen Gesichter der Personenzentrierten Psychotherapie, Wien/New York: Springer-Verlag 2002, S. 427-443.
- Rogers, Carl R.: Der neue Mensch (= Rogers), Stuttgart: Klett-Cotta 1981.
- Kastberger, Klaus: Online-Rezension (http://www.literaturhaus.at/buch/buch/rez/aokopenko Jänner 2005)
- Nüchtern, Klaus: Online-Rezension (Falter-Verlag: http://www.falter.at/rezensionen/printdetail.php?id=197 Jänner 2005)
[...]
[1] Traumberichte, S. 204
[2] ebd.
[3] Okopenko, Andreas: Fluidum. Bericht von einer außerordentlichen Erlebnisart (= Fluidum) , In: Protokolle. 1977, H2, S. 170-194.
[4] Traumberichte, S. 204
[5] Fluidum, S. 194
[6] Petrini, Daniela: Es schlägt ein. Andreas Okopenkos Poetik des Fluidum, In: Kastberger, Klaus (Hrsg.): Andreas Okopenko. Texte und Materialien, Wien: Sonderzahl-Verlag 1998, S. 69-79, hier S. 70.
[7] vgl. dazu Kapitel
[8] Fluidum, S. 175
[9] ebd.
[10] Fluidum, S. 176
[11] Fluidum, S. 184
[12] Petrini, Petra: Es schlägt ein. Andreas Okopenkos Poetik des Fluidums, In: Kastberger, Klaus (Hrsg.): Andreas Okopenko. Texte und Materialien, Wien: Sonderzahl-Verlag 1998, S. 69-79, hier S. 75.
[13] Okopenko, Andreas: Konkretionismus. Einkreisung eines apokryphen Stils, In: Protokolle. 1978, H1, S. 93-127.
[14] Konkretionismus, S. 93
[15] Lexroman, S. 198f.
[16] Haslinger, Adolf: Der Einzelgänger und sein Mitteilungs-Bedürfnis (= Haslinger), In: Walter-Buchebner-Gesellschaft (Hrsg.): Wiener Avantgarde einst und jetzt, Wien/Köln: Böhlau-Verlag 1990, S. 66-74.
[17] ebd., S. 67
[18] vgl. Haslinger, S. 67
[19] Konkretionismus, S. 98
[20] ebd.
[21] ebd.
[22] Konkretionismus, S. 100
[23] ebd.
[24] Konkretionismus, S. 109
[25] Konkretionismus, S. 110
[26] Konkretionismus, S. 112
[27] Konkretionismus, S. 113
[28] Konkretionismus, S. 115
[29] Konkretionismus, S. 117
[30] Progressiv, S. 3
[31] Progressiv, S. 2
[32] Progressiv, S. 3
[33] Progressiv, S. 5f.
[34] Progressiv, S. 9
[35] Progressiv, S. 10
[36] Bürger, Peter: Der französische Surrealismus. Studien zur avantgardistischen Literatur, Frankfurt am Main: Suhrkamp-Verlag 1996, S. 87.
[37] MdS, S. 15f.
[38] Traumberichte - Nachwort, S. 203
[39] ebd.
[40] Keil, S. 428
[41] Rogers, S. 150
[42] Rogers, S. 151
[43] vgl. Keil, S. 429
[44] Keil, S. 431
[45] vgl. Keil, S. 431f.
[46] Keil, S. 432
[47] Keil, S. 438
[48] Traumberichte - Nachwort, S. 203
[49] Kastberger, Klaus: Online-Rezension, (http://www.literaturhaus.at/buch/buch/rez/aokopenko Jänner 2003)
[50] Traumberichte, S. 16
[51] Traumberichte, S. 22
[52] Traumberichte, S. 49
[53] Traumberichte, S. 49
[54] Traumberichte, S. 84
[55] Traumberichte - Nachwort, S. 204
[56] Traumberichte, S. 108
[57] Traumberichte, S. 114
[58] Traumberichte, S. 116
[59] Traumberichte, S. 122
[60] Rogers, S. 151
[61] vgl. Traumberichte, S. 152f.
[62] vgl. Traumberichte, S. 153f.
[63] Traumberichte, S. 155
[64] Traumberichte, S. 155
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit über Andreas Okopenkos "Traumberichte"?
Diese Arbeit analysiert Andreas Okopenkos poetologisches Konzept im Kontext seines Werkes, insbesondere seiner "Traumberichte," die aus über 200 Träumen bestehen. Ziel ist es, Okopenkos theoretische Schriften zu Traum und Realität zu beleuchten, Bezüge zum Surrealismus (insbesondere André Breton) aufzuzeigen und die Umsetzung seiner Theorie in den "Traumberichten" zu untersuchen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine Vielzahl von Themen, darunter:
- Okopenkos Fluidumerlebnis und dessen Bedeutung für seine Poetik.
- Okopenkos Konkretionismus und sein Verhältnis zu Tradition und Avantgarde.
- Die österreichische Nachkriegsliteratur und der Einfluss des Surrealismus, insbesondere Okopenkos ambivalentes Verhältnis dazu.
- Ein Exkurs über Carl Rogers' klientenzentrierte Gesprächstherapie und deren Relevanz für Okopenkos Traumverständnis.
- Eine Übersicht über die Themen und Inhalte der "Traumberichte" selbst.
Was ist das Fluidum nach Okopenko?
Das Fluidum ist eine sehr individualistische Dichtungstheorie, die Okopenko seit seiner Jugend erforscht. Es ist eine "gefühlsstarke Wahrnehmung des unverwechselbaren Hier und Nun beim Erfahren eines Eindrucks." Es ist kein bloßer Aufnahmemodus der Umwelt oder die Bewunderung der Schönheit, sondern eher eine "Anwandlung, Erleuchtung [oder] Blitz". Die Mitteilung eines Fluidums ist schwierig und wird durch kommunikative Frustrationen beeinträchtigt.
Was versteht Okopenko unter Konkretionismus und totalem Realismus?
Okopenko versteht unter Konkretionismus die dichterische Darstellung von Wirklichkeit in seinem Sinne, die sich auf Spezifikation und Präzision konzentriert. Sein Realismus schließt die Realitäten des minderbewussten Lebens, wie das Traumleben, mit ein. Er bezeichnet dies als TOTALEN REALISMUS.
Wie war Okopenkos Verhältnis zum Surrealismus?
Okopenko hatte ein ambivalentes Verhältnis zum Surrealismus. Obwohl er sich selbst nicht als Surrealist bezeichnete, wurde er von ihm beeinflusst, insbesondere von André Breton. Er nutzte surreale Elemente als Gestaltungsmittel, distanzierte sich aber von einem "uneigentlichen" und "geschönten" Surrealismus.
Welche Bedeutung hat Carl Rogers' klientenzentrierte Gesprächstherapie für Okopenko?
Okopenko teilte die Auffassung von Carl Rogers, insbesondere dessen Traumtheorie. Rogers' Ansatz vermeidet "starre Deutungslexiken" und betont die persönliche Bedeutung des Traums für den Träumer selbst. Träume werden als Ausdruck der Aktualisierungstendenz des Organismus und als Quelle von Erkenntnissen über die aktuelle Lebenssituation gesehen.
Was beinhalten die "Traumberichte"?
Die "Traumberichte" sind ein einzigartiges Projekt literarischer Selbstbeobachtung, in dem Okopenko über 300 Träume und Traumsequenzen aus seinem Leben stichwortartig festgehalten hat. Diese Berichte sind nach Themenkomplexen geordnet und decken ein breites Spektrum an Themen ab, von Politik und Gesellschaftskritik bis hin zu persönlichen Ängsten, Beziehungen und kosmologischen Visionen.
Welche Themen werden in den "Traumberichten" behandelt?
Zu den Themen in den "Traumberichten" gehören: Träume über Politik, Suiten (Szenenfolgen), Schöpfungen im Schlaf (halbwache Dichtung), Leben und Tod, Tierverwandlungen, Angst, der Ofen als Symbol, und kosmische Visionen.
Welche Kritik übt Okopenko an der Freud’schen Traumtheorie?
Okopenko kritisiert Freuds Traumtheorie als zu starr und als starre Deutungslexika. Er bevorzugt den Ansatz von Carl Rogers, der die individuelle Bedeutung des Traumes für den Träumer in den Vordergrund stellt. So ist etwa der gefürchtete hohe Kachelofen für mich keine Übersetzung von Phallus sondern Erinnerung an ein gegenständliches kindliches Trauma, und sein Erscheinen im Traum kann eine Warnung vor einer Bedrohung im aktuellen Leben bedeuten, und mein Traumverhalten ein Durchprobieren, wie ich mich dieser Bedrohung stellen oder ihr ausweichen soll.
- Quote paper
- Mag. Elmar Mattle (Author), 2005, Andreas Okopenkos Traumberichte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109252