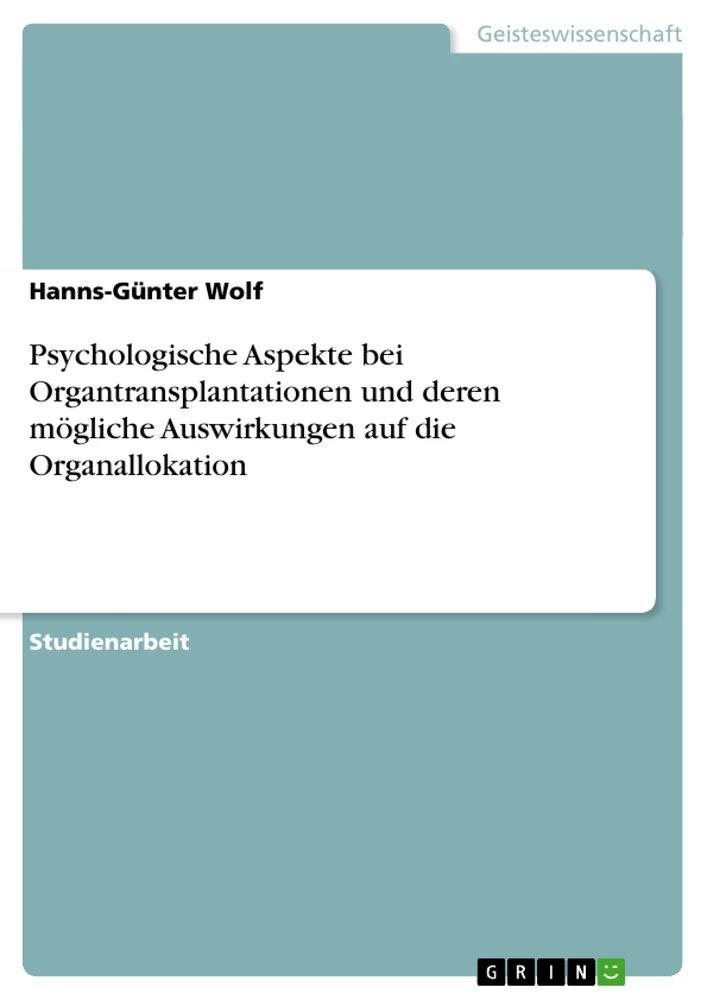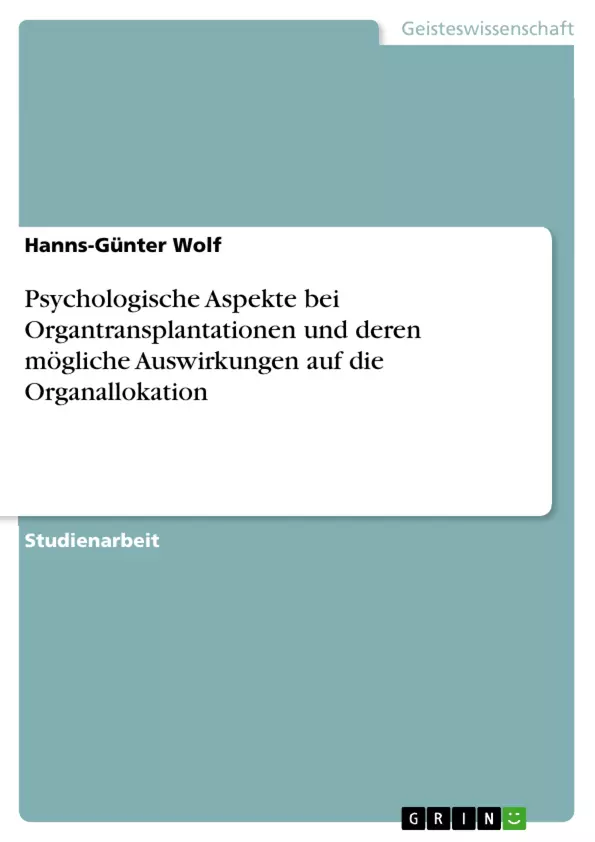Trotz des Transplantationsgesetzes von 1997 besteht in Deutschland weiterhin ein gravierender Mangel an Spenderorganen. Nur etwa 30 Prozent der benötigten Organe können jährlich bereitgestellt werden, was zu ethischen Diskussionen über die gerechte Verteilung der knappen Ressourcen führt. Diese Arbeit untersucht, inwiefern psychologische Aspekte bei der Organtransplantation eine Rolle spielen und wie sie in die Entscheidungsprozesse der Organallokation einfließen könnten. Dabei wird kritisch hinterfragt, ob das aktuelle Vergabeverfahren, das sich primär auf medizinische Kriterien stützt, durch eine interdisziplinäre Perspektive, einschließlich der Psychologie, ergänzt werden sollte, um die Fairness der Allokationsentscheidungen zu erhöhen.
Inhaltsüberblick
1. Einleitung
Trotz des am 1. Dezember 1997 beschlossenen Transplantationsgesetzes (TPG) ist "unstrittig, daß in Deutschland noch immer ein gravierender Mangel an Spenderorganen herrscht: Etwa 14.000 Patienten warten darauf eine lebensrettende Organspende zu bekommen. Doch nur für 4000 Männer und Frauen pro Jahr geht dieser Wunsch in Erfüllung." (marburger bund Ärztliche Nachrichten Nr. 11/2000, S.12). Es können derzeit also maximal 30 Prozent der erforderlichen Organe jährlich bereitgestellt werden. Dieser eklatante Organmangel führt nun zu der ethisch schwierigen Diskussion über die Verteilungsgerechtigkeit der knappen Organe (Allokation).
Das deutsche Transplantationsgesetz enthält keine Richtlinien, nach denen die vorhandenen Organe verteilt werden, stattdessen wurde gemäß §16 des TPG die Bundesärztekammer beauftragt, ein Vergabeverfahren nach medizinischen Kriterien zu erstellen. Diese Richtlinien wurden am 13.11.99 von der Bundesärtzekammer verabschiedet und sind seit 16.07.2000 in Kraft. Die Anwendungsregelungen für die Vermittlung der Organe Niere und Pankreas sind bis zum 15.08.2000, für die Vermittlung der Organe Herz, Herz-Lunge, Lunge und Leber bis 15.03.2001 festzulegen (Deutsches Ärzteblatt 30/2000,S.1746).
Neben medizinischen, Kriterien (Übereinstimmung in den HLAGewebemerkmalen; Entfernung zw. Spender- und Empfängerkrankenhaus ...) enthalten die Richtlinien der Bundesärztekammer jedoch auch nicht medizinisch relevante Kriterien (Länder-Balance, Kinderbonus).
Es handelt sich also nicht um eine rein medizinische Fragestellung, sondern um ein komplexes Problem der Verteilungsgerechtigkeit. Aus diesem Grunde wird kritisiert, daß die Bundesärztekammer alleine damit beauftragt wurde diese Richtlinien zu erstellen, statt ein Gremium interdisziplinärer Experten (Mediziner; Juristen; Theologen Philosophen; Psychologen) damit zu beauftragen - geht es doch im Einzelfall oft um eine frage von Leben und Tod. Auch die Sozialpsychologische Forschung zur Verfahrensgerechtigkeit kommt zu dem Ergebnis, daß Verfahren als um so fairer beurteilt werden, desto mehr Möglichkeiten bestehen strittige Positionen darzulegen. (Müller & Hassebrauck 1993)
Diese Arbeit will sich der Frage zuwenden, inwieweit psychologische Aspekte bei der Organtransplantation eine Rolle spielen und diese eventuell relevant für die Organallokation sein könnten.
2. Psychische Reaktionen der Organspender, bzw. dessen Angehörigen auf Organtransplantation:
2.1. Lebendspende
Die Geschichte der Organtransplantation ist eine Geschichte der Lebendspende. Die erste erfolgreiche Organverpflanzung war die Übertragung einer Lebendspenderniere, die Joseph Murray 1954 durchführte. Heute stellt die Lebendspende eine echte Alternative zur postmortalen Organspende dar. Dabei werden nicht-vitale Organe (vor allem eine der beiden Nieren) von lebenden Spendern übertragen, bei denen es sich um verwandte oder nicht verwandte Angehörige des Empfängers handelt (vgl. Oduncu 2000). Betrug im Jahre 1990 der Prozentsatz der Lebendnierentransplantationen noch 1.7% (absolut: 40 Transplantationen), so hat er sich bis 1998 auf 14,7% (absolut: 334 Transplantationen) um 850% erhöht (vgl. Schneewind 2000).
Neben der Lebendnierenspende können grundsätzlich auch Leberlappen von Eltern auf ihre Kinder übertragen werden. Die Möglichkeit der Teillappenspende bei leberkranken Kindern ist psychologisch gesehen ein Sonderfall, denn die Eltern sind dabei oft unter großen Erwartungsdruck, da ohne Leber das Kind unweigerlich sterben wird, wohingegen es für Nierenkranke noch über längere Zeit die Alternative der Dialyse gibt. Weiterhin spielt die Lebendspende vor allem bei der Konochenmarkstransplantation eine erhebliche Rolle. Da die Knochenmarksspende für den Spender jedoch in der Regel ohne dauerhafte Schädigung möglich ist wird im folgenden vor allem auf die Problematik der Lebendnierenspende eingegangen.
2.1.1. Psychologische Voraussetzung der Lebendspende
Durch die Fortschritte der Immunologie haben für die Nierentransplantation biologische Kriterien der Spenderauswahl an Bedeutung verloren, so daß für einen Dialysepatienten potentiell eine große Zahl von Spendern in Frage kommen würde. Im TPG wird der Spenderkreis aber deutlich eingeschränkt. Abgesehen davon, daß die Spender volljährig sein müssen, kommen als Spender lediglich Verwandte bis zum Verwandtschaftsgrad zweiter Ordnung, Ehepartner und Verlobte in Frage. Ziel des Gesetzgebers war es dabei, jegliche Art der kommerziellen Motivation zur Organspende zu unterbinden und ausschließlich altruistische Motivationen gelten zu lassen.
Eine weitere Forderung des TPG ist daher die Freiwilligkeit der Lebendspende. Dies bedeutet aber, daß ein Lebendspender sich der Bedeutung seiner Entscheidung bewußt sein muß. Nach Schneewind (2000) entscheiden sich jedoch nur ca. ein Viertel der Spender nach einem rationalen Modell, d.h. sie sammeln relevante Informationen, wägen verschiedene Handlungsalternativen ab bevor sie sich entscheiden. Etwa zwei Drittel treffen dagegen ihre Entscheidung nach dem sog. moralischen Modell, d.h. sie entscheiden sich spontan, ohne Überlegung und ohne weitere Informationen einzuholen (snap decision).
Der Rest verfährt nach dem Aufschub- oder schrittweise rationalen Modell, wonach die Entscheidung zunächst aufgeschoben wird und dann eine weitgehend dem rationalen Modell entsprechende Entscheidungsfindung gewählt wird. Die Untersuchungen von Schneewind ergaben weiterhin, "daß es in nahezu allen Fällen der Spender selbst gewesen ist, der das Spendeangebot gemacht hat ..."und daß finanzielle Anreize, die ja nach dem TPG eine Kontraindikation zur Lebendspende darstellen würden, für die Motivation der Spender anscheinend auch tatsächlich keine Rolle spielten.
2.1.2. Psychologische Konsequenzen der Lebendspende
Bei den Spendern ergeben sich mehreren Studien zufolge im Falle einer erfolgreichen Transplantation vor allem längerfristig positive Reaktionen. Besonders markant ist dabei ein erhöhtes Selbstwertgefühl, das sich aus dem Bewußtsein speist, etwas besonderes getan zu haben und seinem Leben einen Sinn gegeben zu haben. Als besonders belohnend wird dabei das deutlich gestiegene körperliche und psychische Wohlergehen des Empfängers empfunden. (Schneewind 2000)
Dieser Sachverhalt wird auch durch den erstaunlich guten Gesundheitszustand der Spender untermauert. So zeigten mehrere Studien mit Kontrollgruppen, daß auch nach 20 Jahren Beobachtungszeit keine nennenswerten Spätfolgen beim Spender festgestellt werden konnten. (vgl. Oduncu 2000). Trotz dieser grundsätzlich günstigen psychischen Wirkung der Transplantation auf die Spender kann nicht übersehen werden, daß ca. 5% der Spender ihre Entscheidung bedauern. Die Gründe liegen einmal in medizinischen Komplikationen, aber auch in Problemen in der Familie und einer Verschlechterung der Beziehung zum Empfänger. Eine möglicher Problemkreis scheint dabei in Ehekomplikationenen zu liegen, wenn ein Ehepartner seine Niere einem Verwandten spendet, was sich dadurch erklärt, daß die Partner der Spender nicht selten gegen die Spende eingestellt sind. (Schneewind 2000).
Überraschend ist, daß auch bei nicht erfolgreichen Transplantationen sich längerfristig bei den Lebendspendern eine deutliche Steigerung des Selbstwertgefühls zeigt. Dabei gibt es in der Forschungsliteratur aber auch vereinzelte Berichte, daß ein Lebendspender Suizid begangen hat, nachdem der Empfänger als Folge der Transplantation verstorben ist.
Noch wenig Erkenntnisse gibt es darüber, ob es psychologische Unterschiede bei verwandten und nicht verwandten Lebendspendern gibt. Die ersten Ergebnisse der Münchner Prospektivstudie (Schneewind et al. im Druck) zeigen, daß verwandte Spenderinnen (Mütter an ihre erwachsenen Söhne) keine transplantationsbedingten Veränderungen in ihrem Leben erwarteten, nicht verwandte Spenderinnen (Ehefrauen an ihre Männer) dagegen hohe Erwartungen an ein verändertes Leben nach der Transplantation knüpften. Diese nannten vor allem die Hoffnung auf eine Aufhebung der Einschränkungen im Zusammenleben mit einem dialysepflichtigen Partner. Hier zeigt sich, daß in eine Spendenentscheidung eine Reihe wohlverstandener Eigeninteressen einfliesen kann, ohne da? daraus ethische Bedenken resultiern müssen. Idealerweise ergibt sich für die Spender-Empfänger-Konstellation eine "win-win" Situation, d.h. es profitieren sowohl Empfänger als auch Spenderin.
2.2. Postmortale Spende
Nach dem TPG gilt in Deutschland für die postmortale Organentnahme zum Zwecke der Transplantation die erweiterte Zustimmungslösung. Das bedeutet, daß eine postmortale Entnahme von Organen nur zulässig ist, wenn eine Zustimmung entweder vom Verstorbenen selbst (Spenderausweis) oder von seiten seiner Angehörigen vorliegt. (TPG §§ 3,4)
Es hat sich jedoch gezeigt, daß seit dem Beschluß des TPG die Anzahl der Menschen, die einen Spenderausweis besitzen nicht gestiegen, sondern sogar zurückgegangen ist. Dies liegt einerseits daran, daß der eigene Tod ein in unserer Gesellschaft eher verdrängtes Thema ist und so auch die Beschäftigung mit allen Konsequenzen des eigenen Sterbens eher vermieden wird. Als weiterer Grund kann die in den Medien geführte Diskussion über den sog. Hirntod gesehen werden.
Hirntod bedeutet: "den vollständigen und irreversiblen Ausfall von Großhirn, Kleinhirn und Hirnstamm nach Verfahrensregeln, die dem Stand der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft entsprechen." (Oduncu 2000). Dieser ist weitere Voraussetzung für eine Organentnahme (TPG §5). Im Gegensatz zu Herz-, bzw. Kreislauftoten wirken Hirntote Menschen jedoch äußerlich vital und können dem Augenschein nach nicht von komatösen Patienten unterschieden werden. So wird bei vielen Menschen die irrationale Angst geschürt, sie könnten nach einem Unfall "bei lebendigem Leibe ausgeschlachtet werden".
Der Klinikalltag zeigt auch, "daß Ärzte und Pfleger mit der gesetzlich gewünschten Förderung der Organspende meist überfordert sind. Oft scheuen sie sich, trauernde Angehörige darum zu bitten. Auch fürchten sie Sanktionen des Trägers, wenn sich möglicherweise Angehörige bei der Klinikleitung über sie beschweren, weil sie das Thema Organspende im Moment der tiefsten Trauer angesprochen haben." (marburger bund Ärztliche Nachrichten Nr. 11/2000, S.12)
3. Psychische Auswirkung der Organtransplantation auf den Organempfänger
3.1. Psychische Reaktionen bei der Diagnoseübermittlung
Trotz der in den letzten Jahren deutlich verbesserten Erfolgsprognosen von Organtransplantationen bedeutet diese für den Betroffenen nicht nur eine - oft die einzige - Chance zum Überleben, sondern auch eine vitale und psychische Bedrohung.
Die Patienten müssen mit der Tatsache leben, daß die Transplantation ein großer chirurgischer Eingriff ist, der z.B. bei der Herztransplantation eine postoperative Mortalität von 15% beinhaltet. Sie müssen lebenslang immunsuppressive Medikamente einnehmen und wissen genau: wenn ein Spenderorgan abgestoßen wird, haben sie nur bei der Nierentransplantation die Alternative der Dialyse. Die einzige Chance bei allen anderen Organen ist eine Retransplantation.
Die psychische Bedrohung der Integrität wird am spürbarsten bei der Herztransplantation.
"Das eigene Herz zu verlieren und das eines (meist durch Unfall oder Selbstmord) gestorbenen zu bekommen, bedeutet mehr als nur eine Operation. Das Herz wird vielfach als Sitz der Gefühle, der Persönlichkeit gesehen und sein "Austausch" läßt die Betroffenen oft fürchten, die eigene Identität zu verlieren und jene des Spenders annehmen zu müssen." Bunzel et al. 1991
In einer der wenigen Studien die sich mit diesem Themenkomplex beschäftigt (Bunzel et al. 1991) wurden 49 Patienten nach erfolgreicher Herztransplantation darüber befragt, wie sie die Mitteilung der Notwendigkeit einer Herztransplantation erlebt haben.
Die Fragestellungen die diese Studie verfolgte waren:
- Wie erwartet kam die Diagnosestellung?
- Welche Krankheitsbewältigungsmechanismen (Copingstile) wurden von den Patienten entwickelt?
Ergebnisse:
Für nur ein gutes Drittel (39%) der Patienten stellte die Indikation zur Herztransplantation eine logische Konsequenz der Erkrankung und die Hoffnung auf ein Weiterleben dar. In diese Gruppe gehörten alle jene Patienten mit langer Krankheitsdauer, die genügend Zeit hatten, ihr Leben auf die Krankheit einzustellen. Es ist also anzunehmen, daß auch die Mehrzahl der Dialysepatienten zu dieser Gruppe gehören würde. Der typische Copingstil dieser Patienten war dabei rationales, planvolles Handeln (verfassen eines Testamentes "für alle Fälle"), sowie compliance-bezogene Strategien (d.h. Vertrauen zu den Ärzten, Befolgen ärztlicher Ratschläge u.ä.). Den Patienten ist die Lebensbedrohung durch die Krankheit bewußt. Für sie bedeutet daher die Möglichkeit der Transplantation neue, oft einzige Hoffnung zum Überleben.
Fast zwei Drittel (61%) der Patienten gaben an, daß sie die Nachricht der bevorstehenden Herztransplantation völlig unvorbereitet getroffen hat.
In dieser Patientengruppe lassen sich drei Copingstile unterscheiden:
- "Die Verleugner" (23% dieser Patientengruppe)
Typischerweise fallen in diese Gruppe alle jüngeren Patienten, deren Krankheit akut aufgetreten war und sich binnen weniger Monate zu einem finalen Stadium entwickelt hatte. Sie hatten noch nicht die Zeit gehabt eine andere Strategie der Krankheitsbewältigung zu finden als sie nicht wahrzuhaben, sie zu verleugnen. Bekannt ist die Verleugnung bei Herzinfarktpatienten, deren Hauptabwehrmechanismus sie ist, und bei denen die Berücksichtigung der Verleugnung wesentlich für den Behandlungsverlauf ist.
- "Die Bagatellisierer" (23% dieser Patientengruppe)
Das Bagatellisieren ist eine klinische Erscheinungsform von teilweiser Verleugnung. Dabei wird nicht die Krankheit an sich, wie bei der vorher genannten Gruppe geleugnet, sondern versucht, die Beschwerden, Krankheitsfolgen und die nötigen therapeutischen Maßnahmen zu minimalisieren. Diese Form der Krankheitsbewältigung tritt meist auf, wenn eine vollständige Verleugnung auf Grund der Stärke der Beschwerden oder der Dauer der Krankheit nicht mehr möglich ist.
- "Die Resignierer" (54% dieser Patientengruppe)
Die größte Gruppe setzte sich aus Patienten zusammen, die von der Information über die nötige Herztransplantation so überrascht wurden, daß sie es als Schock, ja als Lähmung empfanden. Ausgelöst durch die emotionale Überflutung und Überforderung haben sie sich zunächst völlig hilflos dem Kommenden ausgeliefert gesehen und resigniert.
Da dem psychischen Zustand der Hilf- und Hoffnungslosigkeit große Bedeutung bei der Pathogenese und Prognose somatischer Krankheiten zukommt (Engel u. Schmale 1978), soll im Folgenden darauf eingegangen werden, wie typischer weise die Informationsverarbeitung während der Wartezeit vor sich geht.
3.2. Psychische Probleme während der Wartezeit
Ausgehend vom dem Moment der Diagnosestellung beginnt der Patient die Information zu verarbeiten und sich mit der neuen oft schockierenden Nachricht auseinanderzusetzen.
Königswieser(1985) geht (in Anlehnung an Kübler-Ross(1980), Seligman(1979) u.a.) von fünf Phasen der Informationsbewältigung aus:
Schock - Hoffnung auf Rückgängigmachung - Aggression - Depression - Trauerarbeit.
- Schock:
Dieser tritt naturgemäß um so stärker auf, je unvorbereiteter der Patient auf die Diagnose war. Diese Patienten zeigen Orientierungslosigkeit, Fassungslosigkeit, starke Erregung oder Erstarrung. Es treten als plötzliche Reaktion alle Symptome extremer Angst auf. Durch den Schock geschieht eine kurzfristige Entlastung von der Wucht der Katastrophe. Je wesentlicher die Sache, die jetzt verloren ist, für die eigene Identität war, um so schlimmer wird der Schock sein. Dieser blockt kurzzeitig die Realität ab und schützt vor momentan Unerträglichem.
- Hoffnung auf Rückgängigmachung:
Ist der erste Schock vorüber, wird die bedrohliche Information immer noch nicht als wirklich aufgenommen. Es tritt die Hoffnung ein, die Realität könnte durch irgend ein Ereignis doch noch günstiger ausfallen. Bei den meisten Patienten ist in dieser Phase die Hoffnung auf ein "Wunder", auf akute Besserung des Zustandes und damit die Vermeidung der Transplantation vorhanden. Besonders bei Patienten mit einer rapiden Kranheitsentwicklung tritt in dieser Phase die Frage nach dem "Warum" auf ("andere kriegen einen Bypass, warum muß es mich gleich mit einer Transplantation treffen?")
- Aggression:
Wenn die Realität dann doch zur Kenntnis genommen werden muß, setzt die emotionale Abwehr im Sinne von Zorn, Widerstand oder Aggression ein. Diese Aggression wird, obwohl sie an der Realität nichts ändert, als wichtiger lebensbejahender Ausdruck gesehen (Caruso 1968), über den aufgestaute Energie abgeführt wird und der psychotische oder suizidale Impulse verhindert. Das Verleugnen der aggressiven Regung bedeutet dagegen Verlust an Lebendigkeit und an Objektbeziehung. Die Möglichkeit von Aggression wird den meisten Patienten jedoch von vornherein genommen, da sie sich oft in einem schwachen körperlichen Zustand befinden der mit offene Aggressivität nicht kompatibel ist und Ärzte, als logische Ziel der Aggression, sich dieser in der Regel vorsorglich entziehen.
- Depression:
Diese Phase der Informationsverarbeitung wurde von den meisten Patienten erwähnt, mit Ausnahme jener, deren Gesundheitszustand akut lebensbedrohlich war und die deshalb in der Transplantationsnachricht Grund zur Entlastung und neuer Hoffnung sahen. Je tiefer ein Verlust in die eigene Identität eingreift und je schwächer die Abwehrmechanismen sind, die der Mensch sich bisher erworben hat, desto schwerer wird die depressive Krise. Hat man selbst überhaupt noch Wert ohne das Verlorene? "Anhand von Röntgenberichten und Herzkatheterberichten wird den Patienten von den Ärzten klargemacht, daß ihr Herz "Schrott" sei und daß es gegen ein intaktes Spenderherz ausgewechselt werden müsse. Jedoch fühlen sich viele Betroffene mit der Entwertung ihres Herzens auch als Person entwertet." (Bliemel 1998; vgl. Storkebaum 1993) In dieser Phase wird sowohl das stützende Gespräch sowie die Weitergabe sachbezogener Informationen wichtig. Von ganz entscheidender Bedeutung ist aber der Kontakt zu Patienten, die die Transplantation schon gut hinter sich gebracht haben. Wird im Schock keinerlei Information aufgenommen, in der Phase der Verleugnung alles als nicht relevant abgelehnt und in der Aggressionsphase Wut und Neid auf Gesunde projiziert, so ist der Patient in der depressiven Phase offen für Informationen.
Gefühle der wiedererwachenden Stärke treten auf (wenn der das geschafft hat, dann kann ich das auch). Bliemel (1998) betont ebenfalls die Wichtigkeit des Gesprächs mit ehemaligen Patienten, da "Menschen, die sich selbst zu Transplantation entschieden haben leichter in der Lage sind, sich ein Hoffnungsprinzip durch eine klare Zielsetzung für das Leben nach der Transplantation zu schaffen."
- Trauerarbeit:
Die letzte Phase der Bewältigung ist die Phase der Zustimmung und Hoffnung, der Adaptation und Stabilisierung, in der die Trauerarbeit geleistet werden muß. Die Realität wird mit ihren gesamten Konsequenzen gesehen und akzeptiert, es beginnt die Auseinandersetzung mit den neuen Gegebenheiten. Hilfe in dieser Phase bietet vor allen ein stabiles soziales Umfeld. Angehörige und Freunde können den Halt geben, den man durch die Identitätskrise in sich selbst nicht mehr findet. Auch alle konkreten Hilfestellungen (z.B. Personenrufgerät u.ä.) werden wichtig.
Abhängig von der psychischen Grundkonstitution, des Krankheitsbildes, der sozialen Situation und nicht zuletzt von der psychologischen Feinfühligkeit des behandelnden Arztes werden Patienten die oben genannten Phasen in unterschiedlicher Dauer und Intensität erleben. In allen Studien und Erfahrungsberichten wird dabei die Bedeutung des Arztgespräches betont. Dabei wird kritisiert, daß in der Praxis gerade hier ein besonders großes Defizit festzustellen ist. (vgl. Bunzel et.al. 1991; Storkebaum 1993; Bliemel 1998). Das Arztgespräch wird als zu distanziert, zu mechanistisch und bis zum Zynismus reichend unemphatisch beschrieben.
Eine Weitere Ursache psychischer Reaktionen ist die Dauer der Wartezeit zu sehen. Dabei kann sowohl eine sehr lange, aber auch eine (zu) kurze Wartezeit auf das neue Organ eine Belastungssituation für die Betroffenen bedeuten.
Im Falle einer sehr langen Wartezeit (die im Falle der Nierentransplantation die Regel ist) erleben die Patienten oft viele Monate lang das wiederholte Schwanken von einer Phase in die andere, von Hoffnung zu Aggression zu Depression und wieder zu Hoffnung, abhängig von ihrem ebenfalls schwankenden Gesundheitszustand und auftretenden äußeren Gegebenheiten. So können Patienten zur Transplantation einberufen werden und diese wird dann Stunden später wieder abgesagt, weil das Spenderorgan doch nicht geeignet scheint. (vgl. Drees u. Scheld 1993) Die Angst vor einer Verschlechterung der Krankheit ist ständiger Begleiter, kann doch selbst eine harmlose Erkältung zur Folge haben, daß die Patienten vorübergehend von der Warteliste genommen werden und damit die "rettende" Transplantation in noch weitere Ferne rückt. Zwei Berichte verdeutlichen die seelische Not der Patienten während der langen Wartezeit.
- Patientenbericht:
Eine 30 Jahre alte Patientin erzählt von einem fast jede Nacht wiederkehrenden Traum: "Ich stehe vor einem Laden vor der Kasse und bestelle mir eine Semmel, weil ich Hunger habe. Jedesmal, wenn mir die Verkäuferin aber eine Semmel geben will, kommt ein anderer Kunde und nimmt sie mir, kurz bevor ich zugreifen kann, weg."
- Patientenbericht:
Eine Patientin berichtet, daß sie sich seitdem sie auf der Warteliste steht auf Nebel und Glatteis freut. Wenn sie dann aus den Medien erfährt, daß es zu schweren Unfällen gekommen ist, hofft sie immer, es möge Jemand gestorben sein, damit sie weiterleben kann. (nach Bliemel 1998).
Eine zu kurze Wartezeit (die wegen der akuten Organknappheit selten ist) kann dagegen dazu führen, daß sich Patienten überrumpelt fühlen. Sie haben noch keine Strategien aufbauen können, um mit dem Ereignis fertig zu werden. Diese Patienten können dann postoperativ psychopathologisch auffällig werden. So kann es sein, daß sie glauben gar nicht transplantiert worden zu sein, oder paranoid vermuten, die Transplantation wäre nicht nötig gewesen. (Bunzel et.al. 1991)
3.3. Psychische Situation nach der Transplantation:
Da die psychische Situation der Patienten, die mit der Notwendigkeit einer Transplantation konfrontiert sind, im Vergleich zu den somatischen Problemfeldern insgesamt sehr wenig Aufmerksamkeit gefunden hat, ist auch die Frage der psychischen Folgen einer Organtransplantation wenig erforscht. So gibt es auch wenig Wissen über kurz- und langfristige Folgen und die Unterschiede bei erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Transplantationen.
Einig sind sich die Autoren jedoch darin, daß bei einer erfolgreichen Transplantation die positiven Aspekte überwiegen. So ist die Zunahme an Lebensqualität bei Nierentransplantierten im Vergleich zur Dialysesituation beachtlich und zwar in allen Lebensbereichen. Insbesondere das körperliche und psychische Wohlbefinden, die Qualität der Partnerbeziehung - auch im sexuellen Bereich, die Pflege von Sozialkontakten, das erweiterte Freizeitverhalten sowie die geistige und berufliche Leistungsfähigkeit war deutlich verbessert. (vgl. Drees u. Scheld 1993; Schneewind 2000)
Ach Bunzel et.al.(1991) konstatiert in einer Studie über die "Lebensqualität und Lebenszufriedenheit nach Herztransplantationen" eindeutig einen absoluten Lebensqualitätsanstieg. "Obwohl die physische Leistungsfähigkeit und davon ausgehend die globale Lebensqualität am stärksten beeinflußt werden, erstreckt sich die Verbesserung auch auf die psychosoziale Ebene, auf die emotionale Situation wie auch auf den Freizeitsektor.
Dabei gab es keine Unterschiede in der Einschätzung von Lebensqualität und Zufriedenheit zwischen Patienten mit unterschiedlicher präoperativer Diagnose und verschiedenen Lebensalter." (vgl. auch Drees u. Scheld 1993)
Dennoch haben viele Patienten mit psychischen Belastungen zu kämpfen.
3.3.1. Postoperative psychische Reaktionen
Die psychische Verarbeitung der Transplantation selbst ist bislang kaum untersucht, so daß hier vor allem auf Erfahrungsberichte des Pflegepersonals in der Arbeit von Bliemel(1998) zurückgegriffen wird.
- Euphorische Phase
Die erste Empfindung des Patienten nach der Operation ist ein Hochgefühl. Gefühle von Freude und Erleichterung führten zu der Bezeichnung "honeymoon-Periode" (Drees u. Scheld 1993). Diese Euphorie ist darin begründet, alles überlebt zu haben, dem Tod gerade noch entkommen zu sein. Dankbarkeit dem Spender gegenüber macht sich breit. Während der ersten Wochen sind die Patienten stark damit beschäftigt das Erlebte aufzuarbeiten. Sie erzählen fast jedem ihre Krankengeschichte. Die Organverpflanzung ist meist die größte Hürde gewesen, die sie in ihrem Leben meistern mußten. Wie das Leben danach aussieht ist nur schemenhaft erkennbar. Die Zukunftsperspektive reicht oft nur bis zu Transplantation.
- Depressive Phase
Nach ca. 3 - 4 Wochen haben die Patienten das Gefühl die akute Gefahr überstanden zu haben. Ein großer Teil der Angst und Spannung legt sich. Es müssen nun neue Zukunftsperspektiven erarbeitet werden, was in dem erschöpften Zustand der Patienten äußerst schwierig ist, so daß viele Patienten in eine reaktive Depression fallen.
In dieser Phase ist wiederum das soziale Umfeld von großer Bedeutung. Es sollten Ressourcen wie Interessen und Hobbys aktiviert werden, aber auch psychologische Betreuung kann beim Überstehen dieser "Entlastungsdepression" hilfreich sein.
3.3.2. Integration des fremden Organs
Naturgemäß dreht sich die Hauptsorge der Patienten nach der Transplantation um die Vielzahl der möglichen körperlichen Komplikationen. Dies sind vor allem Abstoßungsreaktionen, aber auch die durch die Immunsuppresion deutlich höhere Gefährdung durch Infektionen und Malignome, sowie als mögliche Nebenwirkung der Immunsuppresiva: Nierenfunktionsstörungen; Gastrointestinale Funktionsstörungen, Arterielle Hypertonie, Endokrine Stoffwechselstörungen und Neurologische Störungen.(Dt. Ärzteblatt 90, Heft 10 1993 S. 724-728)
So fürchten knapp die Hälfte der Nierentransplantierten eine Abstoßung des Transplantats, bzw. haben Angst vor einer erneuten Dialyse. Gut ein Drittel sorgt sich wegen der medikamentösen Nebenwirkungen. (Schneewind 2000)
Obwohl die Patienten aufgeklärt werden, daß es zu Abstoßungsreaktionen kommen kann und diese in der Regel mit Medikamenten unter Kontrolle zu bringen sind, haben viele Patienten ungeheuere Angst daran zu sterben. Oft sind sie von sich selbst zutiefst enttäuscht und sie haben das Gefühl, selbst Schuld an dieser Situation zu sein. Möglicherweise wird die Abstoßung auch als Strafe dafür gesehen, daß sie auf Kosten eines anderen Mensch weiterleben wollen.
Die Patienten müssen also lernen, Fachleute ihres Körpers zu werden. Die Körpertemperatur sollte zur Früherkennung der Abstoßungsreaktion zweimal am Tag gemessen werden, und jeden Morgen müssen sie sich wiegen. Ziel ist es, die Patienten zu sensibilisieren, damit sie Veränderungen ihres Körpers möglichst schnell erkennen, um dann entsprechend sicher reagieren zu können. (vgl. Bliemel 1998)
Was es psychisch bedeutet, mit gesunden Organen von fremden Menschen zu leben, eigene vitale Teile wie das Herz zu verlieren, das weiß niemand genau zu sagen. Das Bemühen, die seelischen Probleme zu lindern ist weitaus schwächer ausgeprägt, als das um die richtige Operationstechnik. Menschen mit Herz-, Lungen- und Lebertransplantation verarbeiten ihre Krankheit ambivalenter als Nierenpatienten, die objektiv ein besseres Leben führen können, wenn Sie nicht mehr zur Dialyse müssen. Zusätzlich wird das Herz vielfach als Sitz der Gefühle sowie der Persönlichkeit gesehen und sein "Austausch" läßt die Betroffenen befürchten die eigene Identität zu verlieren und die des Spenders annehmen zu müssen.(Bunzel et.al. 1991, Bliemel 1998)
3.3.3. Auseinandersetzung mit dem Weiterleben "auf Kosten" eines Anderen
Auch diese Frage hat bisher die psychologische Forschung kaum interessiert. Schneewind (2000) gibt zwar an, daß immerhin 20% der Empfänger einer Lebendniere Schuldgefühle dem Spender gegenüber haben und sich Sorgen um dessen Gesundheit machen würden. Er geht darauf allerdings weiter nur mit der Feststellung ein, daß diese psychischen Reaktionen "im Laufe der Zeit" abklingen. Als ersten Ansatz diese "Abklingreaktion" zu verstehen kann die in Kapitel 2.1. erwähnte Münchner Prospektivstudie gewertet werden. So gibt die Erwartungshaltung der Ehefrau (Spenderin) an eine bessere Lebensqualität möglicherweise dem Partner (Empfänger) die Chance seine Schuldgefühle in positive Beziehungsanstrengungen umzusetzen.
Oduncu (2000) erwähnt in diesem Zusammenhang die herausragende Überlebensrate der Lebendspende bei Nierenkranken. Die Gründe liegen demnach zum einen darin, daß die Organverpflanzung zeitnah durchgeführt wird, aber auch die besonders hohe Compliance der Patienten, die mit einer hohen Bereitschaft an den Nachsorgeprogrammen teilnehmen wird angeführt. Hier läßt sich möglicherweise das Bedürfnis ablesen, das Geschenk eines nahen Menschen auch pfleglich zu behandeln. So läßt sich auch erklären, daß die Überlebensrate bei nicht verwandten Spende- Empfängerpaaren trotz der schlechteren organischen Verträglichkeit sogar höher ist, als bei verwandten.
Schwieriger ist die Auseinandersetzung mit dem postmortalen Spender. Die Patienten werden nach der Operation über das Alter, Gewicht und die Todesursache des Empfängers informiert. "Jeder Organempfänger hat für sich eine genaue Vorstellung über das Aussehen des Spenders. Wenn man den Patienten ein Blatt Papier geben würde, könnten sie den Spender als eine ganz konkrete Figur malen." (Bliemel 1998) Wie schon erwähnt haben einige Patienten während der Wartezeit ihrem zukünftigen Spender insgeheim oder offen den Tod gewünscht, so daß die Auseinandersetzung mit dem Spender mit (unbewußten) Schuldgefühlen verbunden sein kann. Dies ist jedoch genauso wie die Hirntoddiskussion nach außen hin kein Thema (möglicherweise weil es keine Gelegenheit gibt diese Gedanken zu kommunizieren).
Öfter kommuniziert wird dagegen die Frage, ob mit dem fremden Organ (vor allem beim Herzen) auch die "Seele" des Spenders mittransplantiert wird. So wurde z.B. einem 50-jährigen Mann das Organ eines Spenders, der Suizid verübte, eingesetzt. Dieser hatte nach der Transplantation dann auch eine stark depressive Phase mit Suizidgedanken. Auch Phantasien, daß über das fremde Organ, das ja den Tod des Spenders "miterlebt" hat, diese Todesgefühle für den Empfänger nun auch spürbar sind, werden geäußert. (vgl. Bliemel 1998)
Wie diese Fragen und Gefühle verarbeitet werden ist psychologisch nicht erforscht. Dennoch scheinen die meisten Patienten eine Lösung zu finden. Sie entwickeln dem Spender gegenüber letztendlich ein Gefühl der Dankbarkeit und versuchen teilweise sogar sich in "seinem Sinne" zu verhalten. So überlegt sich nach Wellendorf (1993) ein Lebertransplantierter möglicherweise fürsorglich, ob wohl der frühere Besitzer seiner Leber jetzt gerne ein Bier gehabt hätte.
4. Reintegration in Beruf und Familie
Die Fortschritte in der Transplantationsmedizin lassen in zunehmenden Maße eine recht gute Wiederherstellung der körperlichen Funktionsfähigkeit erwarten. Es zeigt sich aber, daß, obwohl 60% der Patienten wieder in den Beruf zurückkehren könnten dies nur ca. 30% tun (Drees u. Scheld 1993). Die Arbeitgeber sehen in dem Transplantierten oft die Gefahr eines Kostenfaktors, sie befürchten lange Ausfallzeiten und haben wenig Vertrauen in deren Leistungsfähigkeit. Es ist dabei nach Beer (1995) hilfreicher wenn die Risiken direkt angesprochen werden, statt wenn für den Transplantierten ein ständiger Druck geschaffen wird, er müsse die gleiche Leistung wie ein anderer bringen. Ähnlich ist es mit der familiären Reintegration. Beer (1995) unterscheidet hier zwei extreme Pole. Die "überfürsorgliche" und die "übermotivierte" Familie. Während die "überfürsorgliche Familie dem Transplantierten alle Erschwernisse und Hindernisse abnehmen will, verlangt die "übermotivierte" Familie vom Transplantierten ständige Arbeit an seiner Gesundheit. So kann bei diesem in dem ersten Fall das Gefühl der Hilflosigkeit, im zweiten Fall das der Last entstehen. In beiden Fällen wird jedoch die Krankenrolle festgeschrieben und so neu entstehendes Selbstvertrauen verhindert.
5. Relevanz psychischer Phänomene auf die Allokationsproblematik
5.1. Psychische Fragen bei der Einwilligung zur Organspende.
Die Anzahl der vorhanden Spenderorgane beantwortet zwar nicht direkt die grundsätzliche Problematik einer gerechten Verteilung. Naturgemäß entschärft sie jedoch die Situation bis im Idealfall sich das Allokationproblem auflöst, da eben genügend Organe für alle potentiellen Empfänger vorhanden sind.
- Lebendspende
Durch das TPG erfuhr die Lebendspende nicht nur eine rechtliche Legitimation, sondern auch eine Ausweitung von verwandten auf nichtverwandte Personen. Die wichtigste psychologische Frage bei der Bereitschaft zu Lebendspende eines Organs ist: Wie kann man prüfen, daß der Spender sich tatsächlich uneigennützig und freiwillig zum Eingriff entscheidet? Dieser Aufgabe hat sich die interdisziplinäre Arbeitsgruppe Lebendspende angenommen. Juristen, Psychologen, Theologen und Transplantationsmediziner prüfen über einen Zeitraum von zwei Monaten in einem sogenannten psychologisch-transplantologisch orientierten Beratungsprozeß, welche Gründe zur Spendebereitschaft geführt haben. Am Ende wird eine Transplantationsvereinbarung vom Spender, dem Empfänger und dem beratenden Psychologen unterzeichnet. Dennoch stammen hierzulande noch immer nur ca. 15% der transplantierten Nieren von Lebendspendern, während dieser Anteil in Norwegen und Schweden ca. 50% und in der Türkei sogar über 70% beträgt (vgl. Oduncu 2000). Unklar ist dabei, ob unerkannte psychische Barrieren diese Unterschiede erklären, oder ob die Möglichkeit und die günstige Prognose der Lebendspende einfach noch stärker im Bewußtsein der Bevölkerung verankert werden muß.
- Postmortale Spende.
Wesentlich eindeutiger sind die psychologischen Hindernisse, die bei der postmortalen Spende wirken. Der Bereitschaft einen Spenderausweis zu erwerben wird durch die in den westlichen Industriegesellschaften übliche Verdrängung von Krankheit, Alter und Tod eingeschränkt. So ist es in einer Gesellschaft, in der Jugend, Leistungsfähigkeit und körperliche Attraktivität als Ideale gelten, psychologisch schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, was mit meinen Organen nach meinem Tod geschehen solle oder ob ich selbst einmal in die Lage komme, daß ich ein fremdes Organ brauche. So schlägt Oduncu (2000) vor dieser Verdrängung durch verstärkte Aufklärung entgegenzuwirken und über eine regelmäßige Ausgabe von Spenderausweisen mit der Lohnsteuerkarte oder dem Personalausweis nachzudenken. In diesem Zusammenhang sei jedoch auf die sozialpsychologische Reaktanz- Theorie hingewiesen, die nachgewiesen hat, daß bei Personen, die sich unter zu großen moralischen Druck gesetzt fühlen ein sog. Bumerang-Effekt hervorgerufen wird. D.h. es tritt ab einer bestimmten "Überzeugungsintensivität" Widerstand gegen den "Einflußversuch" auf, mit dem diese Menschen ihre Entscheidungsfreiheit wiederherstellen wollen. (Dickenberger et.al. 1993)
Die größte Schwierigkeit für Angehörige einer Organentnahme Zuzustimmen, liegt sicherlich der psychischen Ausnahmesituation in der diese sich befinden. So ist es wohl eine nachvollziehbare Überforderung, wenn ich in dem Moment in dem ich vom plötzlichen Tod eines Angehörigen erfahre über eine Organentnahme entscheiden soll. Im "Trierer Modell" soll dieser Schwierigkeit begegnet werden. Klinikträger, Kirche, Krankenhausgesellschaft und Landesärztekammer wollen die Mitarbeiter Hilfestellung und Rückenstärkung geben. So soll in jeder Klinik mit Intensivstation ein Transplantationsbeauftragter benannt werden, der mit allen relevanten Fragen zu diesem Thema vertraut ist und entsprechend kompetent und feinfühlig auf die Angehörigen zugehen kann. (marburger bund Ärztliche Nachrichten Nr. 11/2000, S.12)
Als weiterer Grund kann das Mißtrauen genannt werden, das weite Kreise der Bevölkerung in den hochtechnisierten und dadurch menschlich kalten Medizinbetrieb haben. So ist die ausführlich und teilweise unsachlich in den Medien geführte Diskussion über die Hirntodproblematik ein Zeichen dafür, daß den Ärzten fast alles zugetraut wird. So wurde ihnen unterstellt, daß sie einem medizinischen Fortschritt oder der persönlichen Karriere zuliebe sogar bereit wären noch rehabilitationsfähige Patienten quasi auszuschlachten. Zuviel wird in unserem Gesundheitssystem anscheinend auf technisch und operativ Machbares Wert gelegt, so daß der menschliche Kontakt zu den Patienten mehr und mehr Schaden nimmt. In der Bevölkerung wird dem medizinisch- technischen Fortschritt zunehmend mit Angst begegnet (Genmanipulation, Retortenbabys ...) und das Vertrauen in die ethische Integrität der Ärzteschaft ist mehr und mehr beschädigt.
5.2. Der psychische Zustand, bzw. die psychosoziale Situation des Patienten als "medizinisches Dringlichkeitskriterium"
In den "Richtlinien für die Organvermittlung" ist ein Kriterium für die Organzuteilung die "Dringlichkeit", mit der das Organ benötigt wird. Für die Organzuteilung zur Nierentransplantation wird z.B. unter Punkt 1.7. "Hohe Dringlichkeit" angeführt: In Einzelfällen, in denen eine lebensbedrohliche Situation vorliegt beziehungsweise absehbar ist, besteht eine besondere Dringlichkeit, die eine vorrangige Organzuteilung rechtfertigt. (...) (Richtlinien zur Organtransplantation 2000) Es erscheint hier jedoch die Frage diskussionswürdig, ob neben rein organmedizinisch lebensbedrohlichen Situationen auch lebensbedrohliche Situationen psychischer Genese, wie etwa ein wegen der Organerkrankung drohender Suizid, als Dringlichkeitskriterium Anwendung finden sollte.
Auch die akute psychosoziale Gefährdung eines Patienten wäre als besondere Dringlichkeit vorstellbar. Dies wäre etwa der Fall, wenn die soziale Existenz eines Patienten gefährdet ist, weil er wegen seiner Erkrankung seiner selbständigen Tätigkeit nicht mehr nachkommen kann und er nicht entsprechend abgesichert ist. Schließlich könnte auch die akute soziale Bedrohung von Angehörigen als Dringlichkeitskriterium in Betracht gezogen werden. Die wäre z.B. bei einem alleinerziehenden Elternteil vorstellbar, dessen Kind ins Heim muß, da der Patient es krankheitsbedingt nicht mehr versorgen kann. Weiterhin wäre es möglich, diesen psychischen, bzw. psychosozialen Dringlichkeiten ähnlich wie bei den "Richtlinien für die Organvermittlung zur Lebertransplantation" in unterschiedliche Dringlichkeitsstufen zu unterteilen, um so den vielfältigen psychosozialen Konstellationen gerechter werden zu können.
5.3. Psychischer Zustand des Patienten als Kriterium für die Erfolgsprognose der Transplantation.
Im Gegensatz zum Kapitel 5.2. in dem nach psychischen Gründen für eine möglichst schnelle Transplantation gesucht wurde, stellt sich hier die Frage, ob es psychische Gründe gibt, die gegen eine Transplantation (zu einem bestimmten Zeitpunkt) sprechen. So wird in den "Richtlinien für die Warteliste zur Herz- Herz-Lungen- und Lungentransplantation" unter 2. Gründe für die Ablehnung (zur Aufnahme in die Warteliste) aufgeführt: (...) Es handelt sich im wesentlichen um zusätzliche Erkrankungen oder psychosoziale Faktoren, die entweder ein vitales Risiko bei der Transplantation darstellen, oder den längerfristigen Transplantationserfolg mindern.(...)Als psychosoziale Faktoren wird im weiteren aber schlicht "mangelnde Compliance" angegeben, ohne daß aufgeführt wird, wie diese definiert wird, bzw. was deren Gründe sein können. Es konnte in keiner Arbeit eine seriöse Untersuchung zu diesem Thema gefunden werden. Immerhin weißt Bunzel et.al. (1991) aber darauf hin, daß Patienten Zeit brauchen, um die Transplantationsdiagnose zu verarbeiten und eine zu frühe Transplantation negative. psychische Folgen haben kann. (siehe Punkt 3.2.) Auch die Einbeziehung des sozialen Umfeldes des Patienten könnte hier von Bedeutung sein. So könnte eine durch die Krankeht des Patienten völlig überforderte Familie dazu führen, daß vor einer Transplantation erst familientherapeutische Maßnahmen ergriffen werden.
Es wird jedoch deutlich, daß die psychischen Begleitumstände einer Organtransplantation noch wenig bekannt sind, daß sie innerhalb der Transplantationszentren oft unzureichend beachtet werden (vgl. Bunzel et.al 1991) und innerhalb der Organallokation praktisch keine Berücksichtigung gefunden haben. Dies liegt einerseits wohl an der Komplexität der möglichen psychischen Phänomene, da keine zwei Transplantationspatienten gleich reagieren werden. Es stellt sich jedoch auch die Frage, ob der Medizinbetrieb zu sehr auf die organmedizinische Problematik fixiert ist und seelische Probleme eher verdrängt.
- Quote paper
- Hanns-Günter Wolf (Author), 2000, Psychologische Aspekte bei Organtransplantationen und deren mögliche Auswirkungen auf die Organallokation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/109332